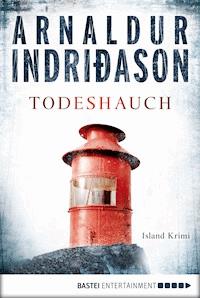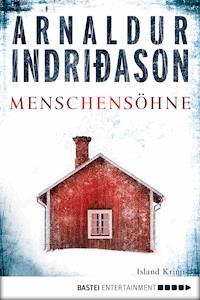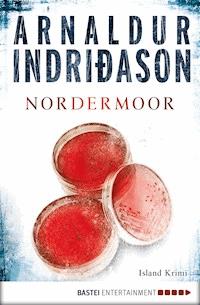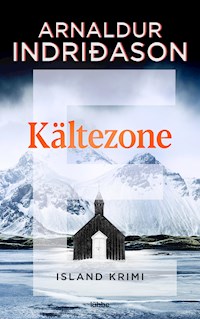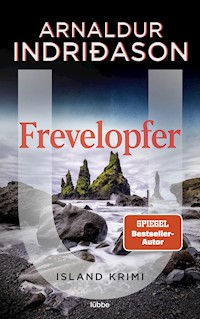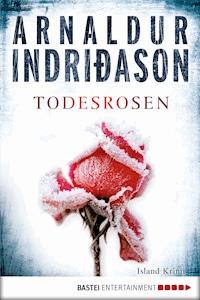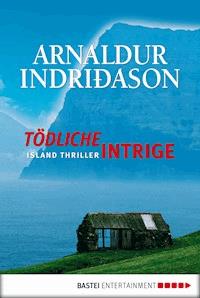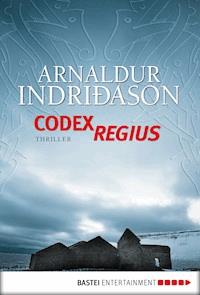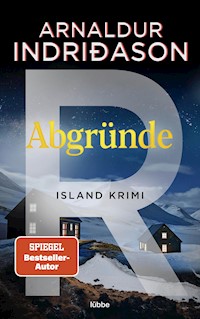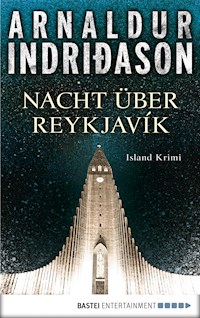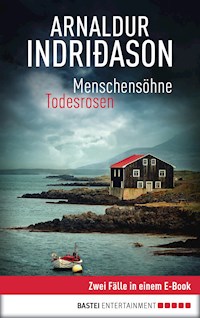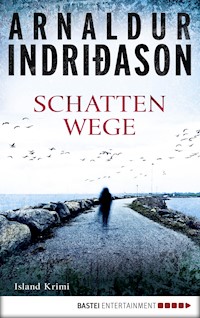Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lübbe Audio
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Reykjavík 1972, der russische Schachweltmeister Boris Spasski tritt mitten im Kalten Krieg gegen seinen amerikanischen Herausforderer Bobby Fischer an. In der aufgeheizten Stimmung wird ein Jugendlicher in einem Reykjavíker Kino brutal erschlagen. Warum bloß ermordet jemand einen Fünfzehnjährigen? Der Junge schien doch nur die Tonspur eines Films aufnehmen zu wollen ... Die Leitung der Ermittlung in diesem brisanten Fall, der nicht nur am Rande auch das Geschehen auf dem Schachbrett berührt, liegt in den Händen von Marian Briem, bereits bekannt aus den bisherigen Indriðason-Krimis. Der Beginn einer neuen Krimiserie von Arnaldur Indriðason, Islands erfolgreichstem Krimiautor.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:11 Std. 34 min
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Inhalt
CoverTitelImpressumEinsZweiDreiVierFünfSechsSiebenAchtNeunZehnElfZwölfDreizehnVierzehnFünfzehnSechzehnSiebzehnAchtzehnNeunzehnZwanzigEinundzwanzigZweiundzwanzigDreiundzwanzigVierundzwanzigFünfundzwanzigSechsundzwanzigSiebenundzwanzigAchtundzwanzigNeunundzwanzigDreißigEinunddreißigZweiunddreißigDreiunddreißigVierunddreißigFünfunddreißigSechsunddreißigSiebenunddreißigAchtunddreißigNeununddreißigVierzigEinundvierzigZweiundvierzigDreiundvierzigVierundvierzigFünfundvierzigSechsundvierzigSiebenundvierzigAchtundvierzigARNALDUR INDRIÐASON
DUELL
Island Krimi
Übersetzung aus dem Isländischen von Coletta Bürling
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Dieser Titel ist auch als Hörbuch erschienen
Titel der isländischen Originalausgabe: »Einvígið«
Namen, Personen und Begebenheiten in diesem Roman sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind nicht beabsichtigt.
In Island duzt jeder jeden. Man redet sich nur mit dem Vornamen an. Dies wurde bei der Übersetzung beibehalten.
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2011 by Arnaldur Indriðason
Published by arrangement with Forlagið, www.forlagid.is
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2014 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Anja Lademacher, Bonn
Covergestaltung: Johannes Wiebel, punchdesign, München
Covermotiv: © Shutterstock/Herbert Kratky, Shutterstock/Anders Peter Photography
E-Book-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-8387-4497-1
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Eins
Erst als nach Ende des Films das Licht wieder angegangen war und alle Besucher das Kino verlassen hatten, fand der Platzanweiser die Leiche.
Es geschah in einer Fünfuhrvorstellung mitten in der Woche. Die Kinokasse hatte wie gewöhnlich eine Stunde vor der Vorstellung aufgemacht, und der Junge hatte sich als Erster eine Karte gekauft. Die Frau an der Kasse hatte ihn kaum wahrgenommen. Sie war um die dreißig und trug ein blaues Seidenband im toupierten Haar. Ihre Zigarette qualmte in einem kleinen Aschenbecher vor sich hin. Sie hatte sich in eine dänische Illustrierte vertieft und kaum hochgeschaut, als er vor der Glasscheibe auftauchte.
»Eine Karte?«, fragte sie, und der Junge nickte.
Die Frau reichte ihm die Karte und das Wechselgeld. Das Programmheft schenkte sie ihm. Dann setzte sie ihre Lektüre fort, und er steckte das Wechselgeld in die eine Hosentasche, die Eintrittskarte in die andere und ging wieder nach draußen.
Am liebsten ging er allein ins Kino, und zwar in die Fünfuhrvorstellung. Er kaufte sich immer eine Tüte Popcorn und dazu eine Flasche Limo. Er hatte einen Stammplatz in diesem Kino, genau wie in allen anderen Filmtheatern der Stadt. So wie die Kinos sich voneinander unterschieden, hatte er auch in jedem einen anderen Lieblingsplatz. Im Háskólabíó wollte er immer ziemlich weit links oben sitzen, denn es war bei weitem das größte Kino mit der größten Leinwand in der Stadt. Er saß dann gerne weiter von der Leinwand weg, damit ihm keine Details entgingen. Mit einer gewissen Entfernung zwischen sich und der Leinwand fühlte er sich auch sicherer, denn Filme konnten so sehr unter die Haut gehen, dass man sich völlig überwältigt fühlte. Im Nýja bíó setzte er sich immer auf einen Platz in der kurzen Bank im oberen Parkett direkt am Gang. Im Gamla bíó hingegen befand sich sein Lieblingsplatz im mittleren Parkett. Wenn er ins Austurbæjarbíó ging, saß er immer rechts, drei Reihen unterhalb des Eingangs. Im Tónabíó war die Reihe beim Eingang am besten, wo er die Beine ausstrecken konnte und die Leinwand in sicherer Entfernung war. Das Gleiche galt für das Laugarásbíó.
Im Hafnarbíó, dem Kino am Hafen, verhielt es sich etwas anders als in den anderen Kinos, und es hatte lange gedauert, bis er den richtigen Platz gefunden hatte. Es war das kleinste Kino von allen und von der Einrichtung her auch das schlichteste. Zunächst kam man in ein nicht sehr großes Foyer, in dem sich ein kleiner Stand mit Süßigkeiten befand. Rechts und links daneben waren die Eingangstüren zum Kinosaal. Der Saal selbst erstreckte sich schmal und lang unter einem Tonnengewölbe, das von einer Militärbaracke aus den Kriegsjahren stammte. Auf beiden Seiten der Sitzreihen befanden sich die Gänge, die zu den Ausgängen rechts und links neben der Leinwand führten. Einige Male hatte er ziemlich weit oben links gesessen, nur ein paar Plätze vom Gang entfernt, manchmal auch links direkt am Gang, bis er schließlich seinen festen Platz weiter hinten rechts gefunden hatte.
Es war noch etwas Zeit bis zum Beginn der Vorstellung, und er ging über die Skúlagata hinunter zum Meer, wo er sich auf einen großen, von der Sonne beschienenen Felsbrocken setzte. Er trug ein grünes Blouson und einen weißen Schal, und er hatte eine Schultasche dabei, in der sich ein relativ neuer Kassettenrekorder befand. Er nahm den Apparat heraus und platzierte ihn auf seinen Knien. Er hatte zwei Kassetten dabei, von denen er eine in das Gerät schob. Dann drückte er auf den roten Aufnahmeknopf und hielt das Mikrofon in Richtung Meer. Kurze Zeit später stoppte er die Aufnahme, spulte zurück, drückte auf Play und lauschte dem Geplätscher der Wellen. Er spulte ein weiteres Mal zurück. Die Probeaufnahme war beendet. Das Gerät war startklar.
Er hatte die Kassetten bereits mit dem Namen des Films beschriftet.
Den Rekorder hatte er vor mehr als einem Jahr zum Geburtstag geschenkt bekommen. Zunächst hatte er gar nicht gewusst, was er damit anfangen sollte. Er lernte aber schnell, ihn zu bedienen. Es war ja auch kinderleicht: aufnehmen und abspielen, vorwärts und rückwärts spulen, schnell oder langsam. Anfangs hatte er es witzig gefunden, seine eigene Stimme zu hören, so als käme sie aus einem Radio, aber das verlor schnell seinen Reiz. Er hatte sich Musikkassetten gekauft, unter anderem aus der Serie Top of the Pops der britischen Hitliste. Und eine Kassette mit Simon und Garfunkel. Da seine Eltern aber einen Plattenspieler besaßen, aus dessen Boxen alles viel besser klang, spielte er Musik lieber auf dem Plattenspieler. Er schnitt die Hitparade des isländischen Rundfunks mit, an anderen Sendungen hatte er kein Interesse. Er wollte gerne etwas Spannenderes aufnehmen, aber nachdem er alle möglichen Laute von sich selber aufgezeichnet und seine Eltern und die Nachbarn aus dem Block interviewt hatte, machte ihm das Gerät keinen Spaß mehr, und es verschwand in einer Schublade.
Bis er die Idee hatte, den Rekorder zu einem ganz anderen Zweck zu verwenden.
Was Spielfilme anging, war er sozusagen ein Allesfresser, ihm gefiel alles, und in jedem Film fand er etwas Interessantes, was den Preis für die Eintrittskarte wert war. Das Genre spielte keine Rolle, er mochte sowohl aufwendige Musical-Verfilmungen vor großartigen Kulissen mit unerhört gut aussehenden Stars als auch Western, die in vegetationslosen Wüsten spielten, in denen die Darsteller die Augen gegen die Sonne zusammenkniffen. Er interessierte sich aber auch für Filme, die in der Zukunft spielten, egal, ob in ihnen die Menschheit in einer atomaren Katastrophe ausgelöscht wurde oder irgendwelche Raumschiffe durch das schwarze All glitten, von nichts als der Fantasie angetrieben. All das drang durch seine im Dunkel des Kinos glänzenden Augen in ihn ein.
Und auch der Ton der Filme faszinierte ihn. Er konnte der Geräuschkulisse einer Großstadt lauschen, dem Stimmengewirr von Menschen, der Landung eines Düsenjets, knallenden Schüssen, Musik und Gesprächen. Einige Geräusche kamen aus längst vergangenen Zeiten, andere aus noch nicht erreichten. Manchmal war der Lärm ohrenbetäubend, ein anderes Mal schrie ihn die Stille förmlich an. Und so war ihm die Idee für eine neue Verwendungsmöglichkeit des Rekorders gekommen. Er konnte nicht den ganzen Film mitschneiden, aber er konnte den Ton aufnehmen und später den Film vor seinem inneren Auge noch einmal ablaufen lassen. Das hatte er schon einige Male getan, und er besaß bereits Tonmitschnitte von diversen Filmen.
Eine Viertelstunde vor der Vorführung öffnete der Platzanweiser die Tür und riss die Karte des Jungen ab. Ein junges Mädchen verkaufte am Kiosk im Foyer Süßigkeiten, doch bevor er zu ihr ging, sah er sich noch die Plakate mit den Filmen an, die demnächst gezeigt werden sollten. Auf einen wartete er besonders gespannt, Little Big Man mit Dustin Hoffman in der Hauptrolle, einem seiner Lieblingsschauspieler. Angeblich sollte es ein ungewöhnlicher Western sein, und er freute sich schon sehr auf den Film. Der Filmvorführer schäkerte mit dem Mädchen, das die Süßigkeiten verkaufte. An der Kinokasse hatte sich inzwischen eine kleine Schlange gebildet.
Der Junge stellte seine Schultasche auf den Boden und holte das Wechselgeld von der Kinokarte aus der Hosentasche, von dem er sich Popcorn und Limo kaufte.
Er ging zu seinem Platz und setzte sich. Wie immer hatte er Popcorn und Limo schon auf, bevor der Film anfing. Er stellte den Rekorder auf den Sitz neben sich und befestigte das Mikrofon an der Lehne des Sitzes vor ihm. Er kontrollierte noch einmal, dass die Kassette eingelegt und der Rekorder aufnahmebereit war. Die Lichter im Saal gingen aus. Er nahm immer alles auf, auch die Vorschau.
Der Film, der gezeigt werden sollte, war ein Western mit Gregory Peck, einem Schauspieler, den er sehr mochte. The Stalking Moon verkündete das Plakat im Eingangsbereich, und er war entschlossen, nach der Vorführung zu fragen, ob er ein Plakat bekommen könne. Vielleicht würden sie ihm auch ein paar Fotos überlassen, denn die sammelte er.
Die Leinwand belebte sich. Er hoffte, dass in der Vorschau kurze Ausschnitte aus Little Big Man gezeigt würden.
Die Fünfuhrvorstellung war schon geraume Zeit vorbei, als der Platzanweiser den Kinosaal betrat. Er war spät dran, denn er hatte für die Frau an der Kinokasse einspringen müssen, sie taten sich manchmal gegenseitig einen Gefallen. Zur Siebenuhrvorstellung waren ungewöhnlich viele Leute erschienen, und vor der Kasse hatte sich eine längere Schlange gebildet. Währenddessen konnte er niemanden in den Saal einlassen, also kontrollierte das Mädchen vom Kiosk die Karten. Sobald sich die Gelegenheit bot, beeilte er sich, in den Kinosaal zu kommen. Er musste die Türen am Ausgang für die Kinogäste öffnen und wieder schließen, damit niemand einfach sitzen blieb, um sich in die nächste Vorstellung zu schummeln, oder durch einen der Ausgänge hereinkam.
Wie immer, wenn er sich verspätete, hatten die Kinobesucher bereits selbst die Türen geöffnet. Also ging er den Gang hinunter und schloss erst die rechte Tür, dann durchquerte er den Raum und machte auch die linke Tür zu. Die Siebenuhrvorstellung würde gleich beginnen, und die Besucher warteten ungeduldig darauf, in den Saal gelassen zu werden. Auf dem Weg zurück ins Foyer ließ der Platzanweiser seinen prüfenden Blick über die Reihen schweifen.
Im Halbdunkel des Raums sah er, dass offensichtlich jemand nach der Vorstellung nicht gegangen war.
Der Junge mit der Schultasche saß immer noch auf seinem Platz, war aber irgendwie auf den Sitz neben ihm gesunken, weshalb er kaum zu sehen gewesen war. Er schlief anscheinend fest. Der Platzanweiser kannte ihn vom Sehen, genau wie die anderen regelmäßigen Kinobesucher, die zur Gewohnheit hatten, entweder nur ganz bestimmte Vorstellungen zu besuchen oder sich auf ganz bestimmte Sitzplätze zu setzen. Dieser Junge kam oft ins Kino, ihm war es völlig gleichgültig, was für Filme gezeigt wurden, er schien sich für alles zu interessieren. Der Junge hatte ihn manchmal gefragt, welche Filme als nächste gezeigt würden oder ob er Fotos bekommen konnte und anderes Werbematerial. Er wirkte ein wenig einfältig, um nicht zu sagen zurückgeblieben für einen Jungen seines Alters. Und er kam immer allein.
Der Platzanweiser rief dem Jungen etwas zu.
Als der Junge nicht reagierte, ging der Platzanweiser durch die Reihe zu ihm hin, stieß ihn an und forderte ihn auf, den Saal zu verlassen, da gleich die nächste Vorführung beginnen würde. Wieder zeigte der Junge keinerlei Reaktion. Der Platzanweiser bückte sich und sah, dass die Augen des Jungen halb geöffnet waren. Er stieß ihn fester an, aber der Junge regte sich nicht. Schließlich fasste er ihn an der Schulter, um ihn hochzuziehen, spürte jedoch, dass der Körper ungewöhnlich schwer und leblos wirkte. Er ließ ihn wieder los.
Auf dem Boden lagen eine leere Popcorntüte und eine Flasche Limo.
In diesem Augenblick gingen die Lichter im Saal an. Da erst sah er die Blutlache auf dem Boden.
Zwei
In Marian Briems Büro stand ein Sofa. Eigentlich hatten die wenigsten Mitarbeiter bei der Kriminalpolizei Interesse an einem solchen Luxus. Und dieses Sofa war noch nicht einmal ein besonders luxuriöses Möbel. Im Grunde genommen war es also verwunderlich, wie viel Aufsehen es erregt hatte. Es war alt und verschlissen, und der dünne Lederbezug war an den Ecken abgeschabt. Mit seinen drei Sitzen und den bequemen Seitenlehnen war es geradezu ideal für einen Mittagsschlaf. Einige der älteren Mitarbeiter ergriffen heimlich die Gelegenheit, wenn Marian nicht in der Stadt war. Sie passten jedoch höllisch auf, denn Marian konnte es einem sehr übel nehmen, wenn man unerlaubterweise das Büro betrat. Das Sofa war lange Zeit Anlass zum Streit unter den Kriminalbeamten gewesen, denn etliche Mitarbeiter waren neidisch darauf und fühlten sich benachteiligt, weil schließlich für alle dieselben Regeln zu gelten hätten. Marian Briem kümmerte sich so gut wie gar nicht darum, und die Vorgesetzten sahen darüber hinweg, aus Angst davor, eine der fähigsten Kräfte bei der Kriminalpolizei zu verärgern. Die Diskussion flammte aber in regelmäßigen Abständen wieder auf, wenn neue Mitarbeiter kamen und sich wichtigmachen wollten. Irgendwann einmal war ein Neuling so weit gegangen, in seinem Zimmer, das er sich mit zwei anderen Kollegen teilte, ein Sofa aufzustellen, mit der Begründung, dass er genau wie Marian Briem ein Anrecht auf ein Sofa im Büro hätte. Schon nach wenigen Tagen war das Sofa des Neulings verschwunden, und er selber ebenfalls, er war zur Verkehrspolizei zurückversetzt worden.
Marian Briem hatte sich hingelegt und schlief fest, als Albert das Büro betrat, um zu melden, dass jemand im Hafnarbíó erstochen worden sei. Albert teilte sich das Dienstzimmer mit Marian, und an dem Sofa hatte er nie Anstoß genommen. Er war Anfang dreißig, hatte Familie und wohnte in einem vierstöckigen Wohnblock an der Háaleitisbraut. Nach seiner ersten Beförderung hatte man ihn in Marian Briems Büro einquartiert. Marian hatte zwar Einspruch dagegen erhoben, jedoch ohne Erfolg. Das Hauptquartier der Kriminalpolizei platzte aus allen Nähten, jeder Raum wurde bis auf den letzten Quadratzentimeter genutzt. In dem nicht sehr großen Haus waren sowohl die Kriminalbeamten als auch die Kriminaltechniker von der Spurensicherung untergebracht, einer kleinen Abteilung, die aber ständig vergrößert werden musste. Albert hatte lange Haare und einen Vollbart, er trug am liebsten Jeans und lässige Hemden. Marian Briem fand, dass er aussah wie ein Hippie, und äußerte sich hin und wieder kritisch zu Alberts Haaren und seiner Aufmachung, vor allem, seitdem sich herausgestellt hatte, dass er über eine Seelenruhe und Langmut verfügte, wie sie nur wenigen gegeben war, und daher solche Bemerkungen an ihm abprallten. Albert wusste, dass es einige Zeit dauern würde, bis Marian Briem ihn akzeptierte. Sie waren gezwungen, sich das Büro zu teilen, das bis dahin ausschließlich Marians Reich gewesen war. Aber jetzt mussten sie eben das Beste aus dieser Situation machen. Ihn störte nur, dass Marian stark rauchte, besonders im Büro. Der große Aschenbecher war fast immer voller Kippen.
Albert hatte dreimal versucht, Marian Briem zu wecken, doch erst beim vierten Versuch regte sich etwas auf dem Sofa. Marian hatte fest geschlafen, und etwas aus dem Traum schien sich in den wachen Zustand fortzusetzen. Möglicherweise war es aber auch nur eine Erinnerung, die im Schlaf hochgekommen war. Mit den Jahren wurde es immer schwieriger, dazwischen zu unterscheiden. Aber da waren einfach immer noch diese altbekannten Bildfragmente aus einem dänischen Tuberkulosesanatorium: blütenweiße, im Sommerwind flatternde Bettwäsche; Stuhl an Stuhl in der halbkreisförmigen Liegehalle; Patienten, die bereits so gut wie am Ende ihrer Kräfte waren; und ein Tisch mit medizinischen Geräten, langen Nadeln, die dazu dienten, Luft in den Brustkorb zu pumpen, um die Lungentätigkeit zu deaktivieren.
»Marian«, sagte Albert ein wenig verärgert. »Hörst du nicht, was ich sage? Im Hafnarbíó wurde ein Junge erstochen. Sie warten auf uns. Die Spurensicherung ist schon auf dem Weg dorthin.«
»Erstochen? Im Hafnarbíó?«, fragte Marian und richtete sich auf. »Hat man den Täter schon fassen können?«
»Nein. Der Junge war ganz allein in diesem Kinosaal, als der Platzanweiser ihn fand«, sagte Albert.
Marian stand auf.
»Im Hafnarbíó?«
»Ja.«
»Hat dieser Junge sich einen Film angesehen?«
»Ja.«
»Und er wurde mitten im Film erstochen?«
»Ja.«
Marian Briem stand mit steifen Bewegungen auf. Die Meldung war kurz zuvor eingegangen. Der Platzanweiser hatte angerufen und mit sich überschlagender Stimme verlangt, dass die Polizei kommen solle, auf der Stelle. Der Mann in der Telefonzentrale musste sich zweimal erklären lassen, was passiert war. Zwei Streifenwagen und ein Krankenwagen waren bereits unterwegs, als die Meldung an die Kriminalpolizei weitergeleitet wurde. Albert nahm sie in Empfang, informierte seine Vorgesetzten, schickte die Kollegen von der Spurensicherung zum Tatort und weckte Marian Briem.
»Würdest du denen bitte sagen, dass sie vorsichtig sein sollen und nicht mit ihren dreckigen Schuhen auf allem herumtrampeln?«
»Wem soll ich das sagen?«
»Denjenigen, die sich bereits am Tatort befinden!«
Tatsächlich kam es nicht selten vor, dass diejenigen, die als Erste an einem Tatort eintrafen, dort gedankenlos herumstiefelten und auf diese Weise große Teile der Ermittlungsarbeit zunichtemachten.
Das Hafnarbíó wäre ohne Weiteres zu Fuß zu erreichen gewesen, doch angesichts der gebotenen Eile zogen Marian und Albert es vor, mit dem Dienstwagen zu fahren. Sie bogen vom Borgartún auf die Skúlagata ein und fuhren bis zur Ecke Barónsstígur, wo sich der Eingang zum Hafnarbíó befand. Das Kino war eine alte Militärbaracke mit Wellblechdach, eine Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg und das, was Island zu den Weltereignissen beigetragen hatte. Die Baracke war ursprünglich als Offizierskasino für das englische Militär errichtet worden. Das weiß gestrichene Foyer hatte Betonwände, alles andere bestand aus Blech und Holz.
»Wer ist das eigentlich, diese Mutter von Sylvia?«, fragte Marian urplötzlich auf dem Weg zum Kino.
»Wie bitte?«, sagte Albert, der am Steuer saß und sich auf das Fahren konzentrierte.
»Sylvias Mutter, von der die da dauernd im Radio singen, was für eine Sylvia ist das? Und was ist das für eine Geschichte mit ihrer Mutter? Worum geht’s da eigentlich?«
Albert spitzte die Ohren, aus dem Radio erklang ein sehr bekannter amerikanischer Schlager, Sylvia’s Mother. Er wurde bereits seit Wochen in der Popmusik-Hitparade des isländischen Rundfunks gespielt.
»Ich wusste gar nicht, dass du dir Schlager anhörst«, sagte er.
»Diesen kann man ja schlecht überhören. Sind das Männer, die da singen?«
»Ja, eine berühmte Band«, sagte Albert.
Er hielt vor dem Kino.
»Eigentlich nicht gut, dass ausgerechnet jetzt so etwas passiert«, sagte er, während er die Filmplakate in den Schaukästen des Kinos betrachtete.
»Dem Schachverband hilft es sicher nicht«, entgegnete Marian und stieg aus.
Alberts Bedenken galten einem Ereignis von Weltinteresse in Island. In Reykjavík wimmelte es derzeit von Reportern aus aller Herren Länder sowie von Vertretern der größten Nachrichtenagenturen, der Fernseh- und Rundfunkanstalten und der Zeitungen, die sich jetzt möglicherweise alle auf den Mord im Hafnarbíó stürzen würden. Außerdem hatten sich viele Schachstrategen und Schachanhänger aus den Vereinigten Staaten, der Sowjetunion und vielen anderen Ländern eingefunden, die sich nicht von der weiten Reise nach Island abschrecken ließen und sich den Flug geleistet hatten. Sie bereuten es nicht. Es schien, als würde die Menschheit mit angehaltenem Atem auf das Weltmeisterschaftsduell zwischen Bobby Fischer und Boris Spasski warten, auf das Match des Jahrhunderts, wie es inzwischen genannt wurde, das in Reykjavík stattfinden sollte. Island war seit der Besatzungszeit während des Zweiten Weltkriegs nicht mehr so in den Schlagzeilen gewesen.
Allerdings stand immer noch keineswegs fest, ob dieses Match überhaupt stattfinden würde. Weltmeister Boris Spasski war zwar bereits eingetroffen, doch der Herausforderer Bobby Fischer machte den Veranstaltern das Leben schwer, indem er praktisch jeden Tag neue Forderungen stellte, vor allem was die Preisgelder betraf. Er hatte bereits mehrere Flugzeuge in New York lange auf sich warten lassen und dann doch in letzter Minute abgesagt. Spasski dagegen war die Höflichkeit in Person, er machte sich nicht viel aus dem Wirbel, den Fischer veranstaltete, er sei nach Island gekommen, um Schach zu spielen. Alles andere ginge ihn nichts an, es sei absolut nebensächlich. Das bescheidene Auftreten des Weltmeisters hatte sogar bei den entschiedensten Gegnern des Sowjetregimes das Eis zum Schmelzen gebracht. Westliche Medien verstiegen sich zu der Behauptung, dass es sich bei diesem Weltmeisterschaftsduell um einen Kampf zwischen Ost und West handele, zwischen den freien, demokratischen Ländern und den unterdrückten Staaten des Ostblocks. In den Schlagzeilen der isländischen Presse wurde es auf den Punkt gebracht: KALTER KRIEG IN REYKJAVÍK.
Zeitweilig hatte auch der Konflikt zwischen Island und England wegen der Ausweitung der isländischen Hoheitsgewässer Schlagzeilen gemacht, denn die Briten hatten zum Schutz ihrer Trawler Kriegsschiffe in die isländischen Fischerzonen geschickt. Über die Scharmützel zwischen den isländischen Küstenwachbooten mit englischen Fregatten und Trawlern war weltweit berichtet worden, und nun kam noch die Schachweltmeisterschaft in Reykjavík hinzu.
Die Türen zum Kinosaal waren noch offen, als Marian Briem und Albert eintrafen. Vor dem Kino standen zwei Streifenwagen und ein Krankenwagen mit geöffneten Hecktüren. Auf dem Bürgersteig vor dem Kino befanden sich viele Menschen, diejenigen, die in die Siebenuhrvorstellung wollten, und andere, die für eine Karte für die Neunuhrvorstellung anstanden. Die Neugierigsten unter ihnen waren sogar bis ins Foyer vorgedrungen. Marian Briem scheuchte zunächst einmal die Polizisten aus dem Kinosaal, damit die Techniker von der Spurensicherung ungestört ihrer Arbeit nachgehen konnten, und sorgte dafür, dass die Eingangstüren geschlossen wurden. Unterdessen kümmerte sich Albert darum, dass die Leute vor dem Kino sich zerstreuten. Die Frau an der Kinokasse war zum Stand mit den Süßigkeiten gegangen. Auf ihre Frage, ob die Neunuhrvorstellung stattfinden könnte, teilte Albert ihr mit, dass es frühestens am nächsten Tag weitere Kinovorstellungen geben werde.
»Er ist so oft hier gewesen«, sagte die Frau, der anzusehen war, dass es ihr nicht gut ging. »So ein ganz Stiller. Ich begreife überhaupt nicht, wie jemand dazu in der Lage ist, einem Jungen wie ihm so etwas anzutun.«
»Kanntest du ihn?«, fragte Albert.
»Nein, das kann ich nicht sagen. Wie ich halt diejenigen so kenne, die häufiger ins Kino kommen. Er hat sich so gut wie alle Filme angeschaut. Es gibt noch ein paar andere, die das tun.«
»Kam er immer allein?«
»Ja, er war immer allein.«
»Ein paar andere, die was tun?«
»Die immer allein ins Kino gehen, und zwar meistens in die Fünfuhrvorstellung. Die mögen die späteren Vorstellungen einfach nicht, da ist es ihnen zu voll. Sie kommen, um den Film ungestört zu sehen.«
»Sind die Sitze nummeriert?«
»Ja, aber wenn es nur so wenige Zuschauer sind, können sie sich hinsetzen, wo sie wollen.«
»Ist dir irgendetwas an dem Jungen aufgefallen?«
»Nein, gar nichts«, sagte die Frau, die Kiddý hieß.
»Überleg vielleicht noch mal.«
»Mir fällt nichts ein. Er hatte seine Schultasche dabei.«
»Er hatte eine Schultasche dabei?«
»Ja.«
»Im Sommer ist doch gar keine Schule.«
»Trotzdem hatte er seine Tasche dabei.«
Das Mädchen vom Kiosk stand daneben und hörte dem Gespräch zu. Sie war noch keine achtzehn, hatte geweint und wirkte sehr verstört, obwohl Kiddý versucht hatte, sie zu trösten. Kaum einer hätte vor der Vorstellung etwas bei ihr gekauft, sagte sie, als Albert sie danach fragte. Sie hatte nur eine Frau unter den Zuschauern gesehen, die anderen Kinogäste waren alles Männer gewesen, die sie aber weder kannte noch beschreiben konnte. Sie konnte nicht bestätigen, dass der Junge eine Schultasche dabeigehabt hatte.
Marian Briem beobachtete die Techniker von der Spurensicherung bei ihrer Arbeit, als Albert hinzutrat und von der Schultasche erzählte. Man wartete auf stärkere Scheinwerfer, denn obwohl die gesamte Beleuchtung eingeschaltet war, reichte das Licht im Saal nicht. Die blutüberströmte Leiche hatte niemand angerührt, seitdem der Platzanweiser den Jungen angestoßen hatte. Auf dem Sitz und auf dem Fußboden war ebenfalls viel Blut. Die Kriminaltechniker behalfen sich mit Taschenlampen. Einer von ihnen fotografierte die Leiche, das Blut und die leere Popcorntüte, die auf dem Boden lag. Blitze zuckten in regelmäßigen Abständen auf, bis der Fotograf schließlich genügend Bilder gemacht hatte.
»Hier ist sehr viel Blut geflossen«, sagte der Arzt, der zum Tatort gerufen worden war und den Totenschein ausgestellt hatte. »Zwei Stiche direkt ins Herz. Wahrscheinlich ist kaum noch Blut im Körper.«
»Seht ihr da irgendwo eine Schultasche?«, rief Marian Briem den Technikern zu.
Einer von ihnen blickte hoch.
»Hier ist keine Schultasche«, rief er zurück.
»Er soll eine Schultasche dabei gehabt haben«, sagte Marian. »Könnt ihr das überprüfen?«
Ein anderer Kriminaltechniker war an den Reihen entlanggegangen und hatte sie mit einer starken Taschenlampe ausgeleuchtet. Er rief etwas, und Marian ging zu ihm. Dort, wo Zuschauer gesessen hatten, lagen allerlei Abfälle auf dem Boden, Popcorntüten, Limo-Flaschen oder Einwickelpapier von irgendwelchen Süßigkeiten. Auf diese Weise war es möglich festzustellen, wo die Zuschauer gesessen hatten, die sich vor der Vorstellung etwas am Kiosk gekauft hatten. Und Marian hatte auf dem Boden unter den Sitzen, die sich in direkter Nähe der Leiche befanden, weder Popcornkrümel noch andere Abfälle gesehen. Der Techniker hielt die Taschenlampe weit von sich und leuchtete mitten in eine Reihe im unteren Parkett, dort lag eine Flasche. Er ging hin und beleuchtete sie.
»Was ist das für eine Flasche?«, fragte Marian Briem.
»Rum«, antwortete der Techniker. »Eine leere Rumflasche. Sie könnte auch von weiter oben bis hierher gerollt sein, auch wenn die Schräge im Parkett sehr gering ist. Hier liegt nämlich sonst kein Abfall.«
»Nicht anfassen«, sagte Marian. »Wir müssen eine Zeichnung vom Saal anfertigen, um alles genau zu erfassen.«
»Ich glaube, ich habe genügend Material«, erklärte der Fotograf, nachdem er eine Aufnahme von der Flasche gemacht hatte. Er verließ das Kino durchs Foyer. Marian folgte ihm und winkte den Platzanweiser herbei, der Matthías hieß. Sie gingen zusammen zurück in den Saal, und Marian bat ihn, ganz genau zu beschreiben, wie er die Leiche vorgefunden hatte. Matthías beschrieb die Szene und versuchte, sich an alles zu erinnern, was seiner Meinung nach von Wichtigkeit sein könnte.
»Wie viele Karten wurden für die Fünfuhrvorstellung verkauft?«, fragte Marian.
»Ich habe vorhin Kiddý gefragt, sie hat fünfzehn Karten verkauft.«
»Kanntet ihr jemandem aus dem Publikum? Waren irgendwelche Stammgäste darunter?«
»Nur dieser Junge«, sagte der Platzanweiser. »Ich habe aber nicht so genau darauf geachtet. Hier wird im Moment ein amerikanischer Western gezeigt, der einigermaßen gut läuft. Ich glaube, die Besucher waren praktisch nur Männer. So ist es oft bei Western, vor allem in der Fünfuhrvorstellung, da kommen nicht viele Frauen.«
»Praktisch nur Männer?«, hakte Marian nach.
»Ja, es war nur eine Frau im Saal. Die ist mir noch nie zuvor aufgefallen. Außerdem waren da noch ein paar Jugendliche und irgendwelche Männer, die ich nicht kenne. Ja, und dann war da noch dieser Typ aus dem Fernsehen.«
»Wer war das?«
»Ach, ich hab vergessen, wie er heißt. Er ist aber bekannt, der macht die Wetternachrichten. Wie heißt er doch noch.«
»Ist er Nachrichtensprecher, oder ist er Meteorologe?«
»Er macht immer die Wettervorhersage. Der hat sich auch eine Kinokarte gekauft.«
»Ist dir im Zusammenhang mit ihm etwas aufgefallen? Kannte er den Jungen? Haben die beiden miteinander geredet?«
»Nein, das glaube ich nicht. Ich hab nichts bemerkt. Ich habe ihn bloß vom Fernsehen her erkannt. Wisst ihr schon, wer der Junge ist?«
»Nein«, sagte Marian, »noch nicht. Aber du kanntest ihn?
»Ja, er kam oft. Er hat sich alle Filme angesehen. Ein wirklich netter Junge, soweit ich das beurteilen kann. Er war immer höflich, aber er wirkte etwas merkwürdig. Er kam mir so vor, als sei er etwas einfältig oder zurückgeblieben, der arme Junge. Und er kam immer allein, nie mit anderen Jugendlichen zusammen. In den anderen Kinos kennen die ihn bestimmt auch, falls euch das hilft. Dort hat er wahrscheinlich auch seinen besonderen Platz gehabt. Es gibt viele Leute, die sich immer auf denselben Platz setzen.«
»Und zu denen gehörte dieser Junge?«
»Ja, er saß immer rechts, ziemlich weit oben.«
»Könnte jemand gewusst haben, dass er sich immer auf diesen Platz setzte?«, fragte Marian Briem.
»Das weiß ich nicht«, antwortete Matthías achselzuckend. »Möglich wäre es.«
»Hast du bemerkt, ob der Junge eine Schultasche trug?«
»Ja, ich glaube schon. Er hatte eine Tasche dabei.«
»Ist der Western gut?«, fragte Marian Briem und deutete auf ein Plakat von The Stalking Moon.
»Ja, er ist ganz gut. Ist auch gut besucht gewesen. Interessierst du dich für Western? Viele Isländer mögen Western. Irgendwie erinnern sie an unsere isländischen Sagas.«
»Ja«, sagte Marian Briem. »The Searchers gehört zu meinen Lieblingsfilmen, auch wenn ich John Wayne nicht sonderlich mag.«
»Ich finde ihn klasse.«
»Fünfzehn Karten habt ihr verkauft, hast du gesagt?«
»Ja.«
»Wie heißt es doch in der Schatzinsel?«
»In der Schatzinsel?«
»Fünfzehn Mann auf des toten Mannes Kiste«, sagte Marian Briem. »Und ’ne Buddel voll Rum.«
Drei
Marian Briem war im Vorführraum und unterhielt sich mit dem Filmvorführer, als Albert mit ernster Miene in der Tür erschien und Marian signalisierte, dass sie miteinander reden müssten.
»Er hatte seinen Personalausweis dabei, wir haben jetzt eine Adresse«, flüsterte er. »Der Junge ist 1955 geboren, also siebzehn Jahre alt. Er heißt Ragnar, Ragnar Einarsson und kommt aus dem Breiðholt-Viertel.«
Marian folgte ihm in den Kinosaal, wo die Leiche immer noch unverändert dalag, halb auf den benachbarten Sitzplatz gesunken, genau wie der Platzanweiser sie zurückgelassen hatte. Einer der Kriminaltechniker zeigte Marian den blutgetränkten Ausweis, der sich in der Brusttasche des Opfers befunden hatte.
»Wir müssen sofort los, um mit seinen Angehörigen zu sprechen«, erklärte Marian. »Braucht ihr hier noch lange?«
»Nein, wir sind gleich fertig«, sagte der Techniker. »Von der Mordwaffe leider keine Spur, wir haben auch die Mülltonnen in der Nähe des Kinos durchsucht, aber nichts gefunden. Ein paar unserer Leute sind runter zum Meer gegangen, die anderen schauen sich auf der Hverfisgata um. Vielleicht haben sie ja Glück. Habt ihr schon irgendeine Idee, was hier passiert ist?«
»Nein, absolut nicht«, sagte Marian.
Auf dem Weg nach draußen blieb Albert vor dem Plakat von The Stalking Moon stehen.
»Dieser Mond ist irgendwie seltsam.«
»Ja, weil er eigentlich abnimmt, aber nicht der Zeichnung nach.«
»Da hast du natürlich recht.«
»Der Mond könnte in diesem Fall interessant sein.«
»Wieso?«
»Unerwartete Todesfälle wurden häufig mit Mondphasen in Verbindung gebracht.«
Es war ein schöner Sommerabend, und vor dem Kino hatten sich leichtgekleidete Menschen versammelt, die wissen wollten, was dort vorgefallen war. Sie hatten in den Radionachrichten von dem Mord gehört. Marian Briem musste sich mit Albert im Schlepptau einen Weg zum Auto bahnen, während Kiddý und der Filmvorführer im Foyer standen und den beiden hinterherschauten. Als keine Gefahr mehr bestand, dass jemand sie hören konnte und die Türen des Kinos sich wieder geschlossen hatten, beugte sich der Filmvorführer zu Kiddý hinüber und flüsterte: »Hast du schon mal so was erlebt, dass du dir nicht sicher warst, ob dein Gegenüber ein Mann oder eine Frau ist?«
»Komisch«, entgegnete Kiddý. »Ich habe gerade genau dasselbe gedacht.«
Ragnars Familie lebte in einem Wohnblock in Breiðholt, dem jüngsten Neubauviertel von Reykjavík, das sich vom Stadtkern in südöstlicher Richtung ausdehnte. Dort wurde immer noch gebaut. Marian und Albert gingen an Betonmischmaschinen vorbei und mussten über Bauholz und große Pfützen steigen, um zum Eingang des Hauses zu gelangen. Auf den Hügeln ringsum, die im Volksmund nur ›Golan-Höhen‹ genannt wurden, entstanden Wohnblocks mit bis zu zehn Stockwerken entlang der Straßen, gewaltige Bauwerke für isländische Verhältnisse. Weiter unten an den Hügeln wurden niedrigere Reihenhäuser und Einfamilienhäuser gebaut. Die Wohnblocks waren staatlich subventioniert und für Niedrigverdiener vorgesehen. Denn sie hatten seit der großen Krise und den Jahren nach dem Krieg, als sie auf der Suche nach Arbeit in Scharen vom Land in die Stadt gezogen waren, immer nur sehr beengt gelebt und ihr Leben in Kellerlöchern, engen Dachstuben und undichten Baracken gefristet. Jetzt freuten sie sich auf bessere Zeiten in modernen Zwei- oder Dreizimmerwohnungen mit gekacheltem Bad, geräumigem Wohnzimmer und einer Küche mit allen möglichen modernen Annehmlichkeiten.
Im Treppenhaus des Blocks, in dem Ragnar gelebt hatte, wurden gerade die Wände verputzt und für den Anstrich vorbereitet. Es gab zwar noch keine Klingelanlage, aber die Briefkästen hingen bereits an der Wand. Auf einem der Briefkästen entdeckte Marian Briem den Namen von Ragnars Familie – Eltern und drei Kinder. Die Wohnung befand sich im zweiten Stock links.
»Er hatte zwei Schwestern«, sagte Marian.
Die Tür zum Treppenhaus stand offen. Auf dem Weg nach oben begegneten sie einer schwer bewaffneten Truppe von Kindern, die sich aus Abfallholz Schwerter und Schilde gebastelt hatten. Die kleinen Wikinger rannten lärmend die Treppe hinunter und nach draußen, ohne auf die beiden Kriminalpolizisten zu achten.
Albert wollte anklopfen, aber Marian hielt ihn zurück.
»Geben wir ihnen noch eine Minute.«
Albert wartete. Die Zeit verging. Marian murmelte ein mittelalterliches Gebet vor sich hin:
Oh Schöpfer der Weltenlass doch nur geltenwas dem Dichter gefieldein Mitgefühl.
Albert stand vor der Tür und wartete auf weitere Anweisungen.
»Erzähl ihnen nur die Fakten«, sagte Marian und gab ihm mit einer Handbewegung das Zeichen zum Klopfen. Als die Tür sich öffnete, blickte ein etwa zehn Jahre altes Mädchen die unerwarteten Gäste fragend an. Aus der Wohnung stieg ihnen ein Potpourri von Gerüchen in die Nase, Wasch- und Reinigungsmittel, halb gedörrter Fisch mit zerlassenem Hammelfett, der Abwasch. Und Zigarettenqualm.
»Ist dein Vater zu Hause, meine Kleine?«, fragte Albert.
Das Mädchen machte kehrt, um den Vater zu holen, der sich nach dem Abendessen mit einem Buch aufs Sofa gelegt hatte. Er kam mit zerzaustem Haar zur Tür, ein untersetzter Mann im karierten Arbeitshemd mit Hosenträgern. Im selben Augenblick kam seine Frau aus der Küche, gefolgt von einem anderen Mädchen im Konfirmationsalter.
Albert ergriff das Wort.
»Entschuldigt bitte die Störung …«
Weiter kam er nicht.
»Ach, das ist schon in Ordnung«, sagte der Mann. »Kommt doch rein, ihr müsst nicht vor der Tür stehen. Weshalb seid ihr gekommen, hat es etwas mit dem Haus zu tun?«
Albert ging ins Wohnzimmer, und Marian folgte ihm. Albert hatte Ragnars Personalausweis aus der Tasche gezogen.
»Es geht um euren Sohn«, sagte er. »Ragnar Einarsson.«
»Was ist mit Ragnar?«, fragte die Frau. Sie war klein und schlank, und ihre Miene war sehr viel besorgter als die ihres Mannes, der über dem Buch eingeschlafen und immer noch nicht richtig wach war.
»Ragnar Einarsson, siebzehn Jahre?«
»Ja.«
»Ist er das?«, fragte Albert und hielt ihnen den blutverschmierten Personalausweis mit dem Schwarzweißfoto hin.
»Ja, das ist Raggi«, sagte der Mann. »Was ist passiert? Was ist das da an seinem Ausweis?«
»Ich fürchte …«, begann Albert.
»Vielleicht sollten die Mädchen lieber in ihr Zimmer gehen«, bemerkte Marian.
Die Frau sah ihre Töchter an und dann Marian. Sie sagte den Mädchen, dass sie in ihr Zimmer gehen sollten, was die beiden, ohne zu protestieren, taten.
»Ich muss euch leider mitteilen, dass euer Ragnar nicht mehr lebt«, sagte Albert, als die Mädchen außer Hörweite waren. »Er war im Hafnarbíó und wurde dort erstochen. Wir wissen weder, wer ihn angegriffen hat, noch weshalb.«
Die Eheleute starrten ihn an, als verstünden sie kein Wort von dem, was er sagte.
»Wie bitte?«, fragte die Frau.
»Wer seid ihr eigentlich?«, fragte der Mann.
»Wir sind von der Kriminalpolizei«, antwortete Albert. »Und es tut uns furchtbar leid, dass wir euch diese Nachricht überbringen müssen. Ein Pastor ist auch schon auf dem Weg, er wurde anscheinend aufgehalten, wird aber sicher bald hier sein. Vielleicht möchtet ihr mit ihm sprechen.«
Der Mann wankte auf einen Sessel zu, Marian reagierte sofort und griff ihm unter die Arme, damit er nicht zusammenbrach. Die Blicke der Frau irrten zwischen ihrem Mann, Marian und Albert hin und her.
»Was sagst du da?«, stöhnte sie. »Was hat das zu bedeuten? Ragnar hat doch nie jemandem etwas zuleide getan. Das ist bestimmt ein Missverständnis. Das muss ein Missverständnis sein!«
»Wir werden alles tun, um herauszufinden, was passiert ist«, entgegnete Albert. »Uns wurde gesagt, dass er allein im Kino war. Hatte er sich dort vielleicht mit jemandem verabredet?«
»Natürlich war er allein«, sagte die Frau. »Ragnar geht immer allein ins Kino.«
»Nein, er hat dort bestimmt niemanden treffen wollen«, bestätigte der Mann.
»Hatte er hier in diesem Haus irgendwelche Freunde, mit denen wir sprechen könnten? Vielleicht wollte er sich ja mit jemandem treffen, den ihr nicht kanntet.«
»Hier hatte er nicht viele Freunde«, sagte die Frau. »Wir sind erst vor Kurzem umgezogen, wir wohnen erst seit einem halben Jahr hier. Er hatte noch kaum Gelegenheit, andere Jugendliche kennenzulernen.«
»Er ist auch nicht so wie die anderen«, fügte der Mann hinzu.
»Inwiefern?«
»Was ist mit ihm passiert«, sagte die Frau, noch bevor ihr Mann antworten konnte. »Könnt ihr uns nicht sagen, was mit ihm passiert ist? Sagt es uns doch einfach!«
Albert berichtete, wie die Situation bei ihrem Eintreffen im Hafnarbíó gewesen war. Er gab sich alle Mühe, einfühlsam zu sein, und ließ kein wichtiges Detail aus. Es schien, als hätten die Eheleute den Ernst der Lage noch nicht begriffen. Dass ihr Leben von diesem Tag an nicht mehr dasselbe sein würde.
»Ihr müsstet noch die Leiche identifizieren«, erklärte Albert, nachdem er ihnen gesagt hatte, wie ihr Sohn gestorben war und wie er aufgefunden wurde.
»Identifizieren?«, wiederholte die Frau. »Wo denn? Wie denn? Wie kommen wir dahin? Jetzt gleich? Würdet ihr uns begleiten?«
»Selbstverständlich«, sagte Albert. »Wir fahren mit euch zum Leichenschauhaus.«
Die Frau stürzte zum Garderobenschrank und riss ihren Mantel heraus. Der Mann stand auf und zog sich sein Jackett an. Sie verabschiedeten sich geistesabwesend von ihren Töchtern, die ihren Eltern fragend nachsahen. Marian und Albert folgten ihnen die Treppe hinunter und gingen mit ihnen zum Wagen. Die kleinen Wikinger aus dem Wohnblock standen sich schwer bewaffnet auf dem Parkplatz gegenüber, legten aber eine Gefechtspause ein, als das Auto mit den fremden Menschen langsam an ihnen vorbeifuhr und auf die vierspurige Breiðholtsbraut in Richtung Stadtmitte einbog.
Ragnars Leiche war zur Obduktion freigegeben und ins Leichenschauhaus am Barónsstígur gebracht worden. Dort lag sie unter einem weißen Laken auf dem kalten Stahltisch, als Albert und Marian mit den Eltern eintrafen. Der ganz in Weiß gekleidete Gerichtsmediziner gab allen die Hand, ging dann zum Seziertisch und nahm das Laken vom Gesicht des Jungen, der immer noch die Sachen trug, in denen er von zu Hause weggegangen war.
Die Frau schlug die Hand vor den Mund, wie um einen Schrei zu unterdrücken, der aus ihr herausbrechen wollte. Der Mann starrte nur regungslos auf das Gesicht seines Sohnes. Dann nickte er.
»Das ist Ragnar«, sagte er. »Das ist unser Ragnar.«
Im gleichen Augenblick erlosch der winzige Hoffnungsfunke der beiden, dass es sich um ein Missverständnis gehandelt haben könnte, um irgendeine aberwitzige Falschmeldung, und dass alles wieder so sein würde wie früher. Die Frau begann zu weinen, und ihr Mann nahm sie mit Tränen in den Augen in die Arme.
Marian Briem stieß Albert mit versteinerter Miene an, ging hinaus auf den Flur und schloss die Türe leise hinter sich.
Vier
Damals während des ersten Sommers in Reykjavík war Marian Briem mit dem Chauffeur des Hauses zum See von Þingvellir gefahren, um Forellen zu fangen, die dann in dem kleinen Teich hinter der Villa ausgesetzt wurden. Das war seit Langem Tradition in der Familie, sie stammte aus der Zeit, als die Söhne des Hauses noch klein waren. Die Jungen hatten im Sommer ihren Spaß an den Fischen, die sich in dem Teich wohlzufühlen schienen. Sie schwammen hin und her und genossen es offensichtlich, dass ihnen Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Wenn die Jungen an warmen Sommertagen ihre Füße im Teich kühlten, schwammen sie ihnen um die Beine herum. Gegen Abend kamen sie an die Oberfläche, ließen sich dort treiben, und es schien, als würden sie die Menschen beobachten, die im Garten saßen und sich unterhielten. Den Jungen hatte man streng verboten, die Forellen zu fangen oder sie auf andere Weise zu stören, doch wenn sie sich unbeobachtet fühlten, zogen sie die Fische manchmal an der Schwanzflosse aus dem Wasser, ließen sie eine Weile zappeln und gaben ihnen dann die Freiheit wieder. Im Herbst brachte der Chauffeur die Fische wieder zurück nach Þingvellir. Dort setzte er sie im See aus, wo sie blitzschnell in der kalten Tiefe verschwanden.
Dieser Brauch wurde auch beibehalten, als die Söhne schon groß waren. Jeden Sommer wurden lebende Forellen aus dem See von Þingvellir geholt und in dem kleinen Teich ausgesetzt. Der Chauffeur, der seit etlichen Jahren im Dienst der Familie stand, trug den seltenen Namen Athanasius und war für alles Mögliche im und ums Haus zuständig. Die Familie beschäftigte außerdem zwei Hausmädchen, eine der beiden war auch Köchin. Athanasius kümmerte sich um die Instandhaltung von Haus und Besitz und sorgte dafür, dass bei Einladungen, sei es ein Cocktail-Empfang oder ein Dinner, alles reibungslos klappte. Darüber hinaus kümmerte er sich um den Garten, dem man ansah, dass dies Athanasius’ Lieblingsbeschäftigung war. Die allergrößte Freude machten ihm aber die Fahrten nach Þingvellir, um die Forellen für den Teich zu fangen.
Marian half Athanasius, der sich auch selber als Faktotum bezeichnete, bei vielen Dingen. Sie mochten sich außerordentlich gerne, denn Athanasius brachte Marian eine große Zuneigung und viel Nachsicht entgegen und hatte immer kleine Aufgaben für das Kind, zum Beispiel bei der Gartenarbeit. Und so lernte Marian viel über die verschiedenen Kräuter, über fruchtbare Erde, über Wolkenformationen, die Regen ankündigten, und über die grüne Kraft der Sonne. Der Gemüsegarten der Familie befand sich im ehemaligen Torfstichgebiet von Kringlumýri am damaligen Stadtrand. Dort züchtete Athanasius Möhren, Steckrüben und Kartoffeln für den Haushalt. Zur Ernte fuhren die Bediensteten des Hauses in dieses Feuchtgebiet, in dem auch immer noch Torf gestochen wurde, und beluden den Lieferwagen mit dem Gemüse.
Die Familie wurde von den Angestellten immer nur ›die Herrschaft‹ genannt. Als die Weltwirtschaftskrise zu Ende ging und die Menschen ganz andere und sehr viel schlimmere Zeiten herannahen sahen, stand der Wohlstand der Familie im Zenit. Der Herr des Hauses war einer derjenigen gewesen, die dank ihrer Umsicht und Tüchtigkeit Geld in der Fischereiwirtschaft gemacht hatten, und er ging klug und besonnen mit seinem Reichtum um. Er duldete keinerlei Verschwendung, aber nicht aus Geiz. Seine dänische Ehefrau war genauso praktisch veranlagt wie ihr Mann. Die beiden hatten drei Söhne, und alle wurden zum Studium nach Kopenhagen geschickt. Der älteste war vor einigen Jahren zurückgekehrt, hatte eine Familie gegründet und arbeitete als Rechtsanwalt. Die anderen beiden waren noch in Kopenhagen, kamen aber im Sommer nach Hause und arbeiteten dann im väterlichen Betrieb.
Athanasius und Marian rumpelten in einem von der Reederei geliehenen Lieferwagen die Schotterstraße nach Þingvellir entlang. In Kilometern gerechnet war es keine lange Strecke, aber die Straße war in so miserablem Zustand, dass sie nur langsam vorankamen.
»In Manitoba gab es doch wenigstens anständige Straßen«, stöhnte Athanasius, während er zu spät versuchte, einem größeren Stein auszuweichen, der nun von unten gegen das Chassis krachte.
Athanasius war mit seinen Eltern nach Kanada gegangen, als er etwa im gleichen Alter wie Marian war, und hatte sich dort in den isländischen Siedlungen durchgeschlagen, war dann aber im besten Mannesalter nach Island zurückgekehrt und hatte Arbeit bei dem Reeder bekommen. Marian hatte Athanasius oft darüber klagen hören, dass er besser in Kanada geblieben wäre, statt nach Island zurückzukehren. Diese Litanei begann meist, sobald sie die Straßen der Stadt verlassen hatten. Anscheinend konnte er gar nicht verstehen, wie er überhaupt auf diese Idee gekommen war. An seinem Dienstverhältnis hatte er aber nichts auszusetzen, im Gegenteil, er hatte großen Respekt vor dem Herrn und seiner dänischen Frau, er konnte sich über nichts beklagen – mit nur einer Ausnahme, nämlich wie sie Marian behandelten.
»Es sind doch sonst so anständige Leute«, sagte er mit ungewohntem Nachdruck. Eigentlich war er ein friedliebender und zurückhaltender Mensch um die fünfzig, der immer sehr beflissen war und allen Menschen nur Gutes wollte. Ein schöner Mann war er allerdings nicht, sein Mund war groß und die Nase flach, und zudem hatte er eine Glatze. »Ich verstehe überhaupt nicht, weshalb sie dich so behandeln«, sagte er. »Wahrscheinlich liegt es an der gnädigen Frau, die Dänen sind so versnobt.«
Die Straße nach Þingvellir war erst vor einigen Jahren für die große Feier anlässlich des 1000-jährigen Allthing-Jubiläums angelegt worden. Seitdem hatte man sie allerdings ziemlich vernachlässigt, und nach einer längeren Regenperiode war der Boden aufgeweicht und schwer, sodass sich Athanasius ganz aufs Fahren konzentrieren musste.
»Ich finde, dass sie den Tatsachen ins Auge sehen sollten«, sagte er und wich einem großen Schlagloch so plötzlich aus, dass sich Marian am Beifahrersitz festklammern musste. »Sie sollten den Quatsch lassen und anerkennen, dass du auch zur Familie gehörst. Ich verstehe einfach nicht, wie sie mit deiner Mutter umgegangen sind.«
»Pass auf!«, schrie Marian.
»Schon gesehen«, entgegnete Athanasius, dem es diesmal gelang, einem größeren Stein auszuweichen. »Aber es geht natürlich ums Geld. Du hast Anrecht auf das Erbe, aber davon wollen sie natürlich nichts wissen.«
Der älteste Sohn und Rechtsanwalt hatte an jenem Morgen die Familie besucht, und genau das war der Anlass für diese kritischen Äußerungen von Athanasius gewesen. Der Sohn war kein häufiger Gast in seinem Elternhaus, doch diesmal war er mit seiner Frau und den beiden noch recht kleinen Töchtern erschienen. Zwar wusste jeder, dass er Marians Vater war, aber darüber wurde nie gesprochen. Marians Mutter hieß Dagmar und war genau wie die Dame des Hauses dänischer Abstammung. Sie war in Reykjavík geboren und aufgewachsen, ihre Mutter war Dänin, ihr Vater Isländer gewesen. Beide waren 1918 an der Spanischen Grippe gestorben. Über Bekannte hatte Dagmar die Stelle bei der »Herrschaft« erhalten, und drei Jahre später hatte der älteste Sohn sie geschwängert, wozu er sich aber nie bekannte. In Athanasius’ Augen war er nichts weiter als ein charakterschwacher junger Kerl. Die Familie schickte ihn mit dem nächsten Schiff nach Kopenhagen, und Dagmar wurde aus dem Haus gejagt. Nach der Geburt des Kindes nahm sie eine Arbeit auf einem Bauernhof in der Nähe von îlafsvík auf der Halbinsel Snæfellsnes an. Sie hatte einige Male versucht, sich mit dem Kindsvater in Verbindung zu setzen, aber der wollte nichts mit ihr zu tun haben. So erfuhr sie auch nicht, dass er in der Zwischenzeit in Dänemark geheiratet hatte.
Als Marian drei Jahre alt war, ging Dagmar zusammen mit einigen anderen mitten im Winter zu einer Tanzveranstaltung in Hellissandur. Der Weg dorthin war nicht ungefährlich, man musste die Gezeiten abpassen, da man nur bei Niedrigwasser die gefährlichen Steilklippen unterhalb von îlafsvíkurenni passieren konnte. Sie hatten sich in Hellissandur länger amüsiert als geplant, sodass auf dem Rückweg bereits die Flut mit starker Brandung eingesetzt hatte. Die Gruppe wusste, dass es keinen Zweck hatte weiterzugehen, und beschloss umzukehren. Im selben Augenblick brandete eine gewaltige Welle an, die einige von ihnen mit sich riss. Zwei Frauen wurden mit der rückflutenden Welle hinausgesogen und ertranken. Eine der beiden war Dagmar. Die Leichen wurden zwei Tage später etwas weiter westlich angespült und in îlafsvík beigesetzt.
Marian blieb auf dem Hof des Bauern und wurde dort wie eines der eigenen Kinder aufgezogen. Doch an diese Ereignisse konnte sich Marian nicht erinnern. Athanasius und Marians Mutter hatten sich gemocht, er hatte sie in den schwierigen Zeiten unterstützt, und sie hatten sich regelmäßig geschrieben, nachdem Dagmar nach Snæfellsnes gezogen war, um dort auf dem Bauernhof zu arbeiten. Nach ihrem Tod hatte er den Kontakt zu dem Bauern gehalten. Im Sommer fuhr er zur Zeit der Heuernte auf die Halbinsel, half beim Einbringen des Heus und verbrachte viel Zeit mit Dagmars Kind.
Marian war kaum krank gewesen, hatte höchstens den einen oder anderen Schnupfen gehabt und manchmal etwas Fieber. Doch eines Tages machte sich nach einem sehr verregneten Herbst anhaltendes Fieber bemerkbar, verbunden mit einem seltsamen Druck auf der Brust und Husten. Und bei einem solchen Hustenanfall hatte das zehnjährige Kind plötzlich Blutgeschmack im Mund. Der Bauer ließ den Arzt kommen, der an einem kalten, regnerischen Herbsttag auf einem schwarzen Pferd über den Bach geritten kam. Er trug einen dicken Mantel und hatte einen Hut auf, dessen Krempe vom schweren Regen nach unten gebogen wurde. Das Wasser lief in Strömen an ihm herunter. Der Bauer nahm ihn auf dem Hofplatz in Empfang und ging mit ihm ins Haus, wo die Hausfrau Hut und Mantel entgegennahm, um die Sachen zu trocknen, bevor er sich wieder auf den Rückweg machte. Sie unterhielten sich über das Wetter und waren sich einig, dass es ganz so wirkte, als wolle es überhaupt nicht mehr aufhören zu regnen. Als der Arzt die Schlafstube betrat, lag Marian im Bett. Er holte das Stethoskop aus seiner Tasche und horchte das Kind sorgfältig ab. Marian atmete auf Geheiß des Arztes tief durch, während er den kleinen Körper am Rücken und auf der Brust beklopfte und Marian bat, noch einmal zu husten. »Atme noch einmal tief durch, mein Kind«, sagte der Arzt und setzte ein weiteres Mal das Stethoskop an. »Hast du Blut gehustet?«, fragte er, und Marian nickte. In der Schlafstube war es kalt und klamm. Der Arzt war bis auf die Knochen nass und wollte sich möglichst bald wieder auf den Heimweg machen. Er horchte noch ein letztes Mal und verkündete dann sein Urteil. »Das Kind hat vermutlich Tuberkulose, die gibt es überall in dieser Gegend. Du solltest dafür sorgen, dass niemand mit Marian in Berührung kommt«, sagte er zu dem Bauern und stand auf. »Das Kind gehört eigentlich in das Tuberkulosespital in Vífilsstaðir.«
Der Bauer wusste keinen anderen Rat, als sich an Athanasius zu wenden, der sofort anreiste und Marian mit nach Reykjavík nahm, wo er ein langes Gespräch mit der Frau des Hauses führte. Niemand wusste, was die beiden beredeten, aber zur Überraschung aller änderte die Dame des Hauses ihre Einstellung, als sie erfuhr, wie es um das Kind stand. Und so wurde Marian in das Haus aufgenommen und der Obhut von Athanasius anvertraut. Die Frau des Hauses war bereit, dem Kind die beste ärztliche Betreuung zukommen zu lassen, sie hatte sogar in Aussicht gestellt, Marian in einem dänischen Tuberkulosesanatorium behandeln zu lassen. Dort sei das Klima viel angenehmer, sagte sie in ihrem seltsamen Gemisch aus Dänisch und Isländisch.
Ihr Sohn, der Vater des Kindes, wurde nicht in diesen Plan einbezogen, er kümmerte sich ohnehin nicht um Marian. Nur eine Bedingung stellte die Dame des Hauses: Die Vaterschaft dürfe niemals offiziell bekannt werden. Niemals. Und darauf einigte sie sich mit Athanasius.
»Natürlich habe ich gewusst, was von diesem Mann zu halten war«, stöhnte Athanasius, als er an Marians Vater dachte. Er schob ein kleines Boot ins Wasser, das er sich von Leuten lieh, die ein Sommerhaus am See besaßen. Er hatte zwei Angelruten dabei, eine für sich und eine für Marian, und die verstaute er zusammen mit einem Bottich im Heck des Bootes. Er ruderte zweihundert Meter auf den See hinaus und befestigte dort die Regenwürmer an den Angelhaken.
»Ist dir kalt?«, fragte er. Marian saß mit der Angelrute im Steven und hatte sich eine Decke um die schmalen Schultern gelegt. »Du musst mir immer gleich sagen, wenn dir kalt ist, das verträgst du nicht mit deinen Lungen.«
»Mir geht es prima«, sagte Marian. Das Boot schaukelte angenehm auf den Wellen. Die Sonne stand hoch im Zenit, und dennoch wehte eine recht frische Brise vom Skjaldbreiður, dem Vulkan im Hochland, herunter zum See. Der Wind machte Athanasius unruhig. Bereits nach kurzer Zeit hatte er aber zwei Forellen gefangen, die inzwischen im Bottich schwammen. Eine weitere wollte er noch fangen, das würde reichen.
»Heißen viele in Island so wie du?«, fragte Marian plötzlich in die Stille hinein.
»Außer mir kenne ich niemanden«, antwortete Athanasius. Er spulte seine Leine auf, um sie dann gleich wieder auszuwerfen. »Ich bin auf der Halbinsel Snæfellsnes zur Welt gekommen, gar nicht so weit entfernt von diesem verflixten Hof, wo du dich angesteckt hast. Dort gibt es sehr viele seltsame Namen, aber das weißt du ja sicher.«
»Ich weiß nur von einem anderen Athanasius, und der war Bischof in Alexandria.«
»Von dem habe ich auch gehört.«
»Der Name bedeutet ›der Unsterbliche‹«, sagte Marian.
»Ach ja, aber das betrifft mich ganz gewiss nicht. Glaubst du, dass so viel Grübeln gut für dich ist?«
»Ich lese einfach nur gerne.«
In diesem Augenblick biss ein Fisch an Marians Haken an, und zwar so heftig, dass die Angelrute beinahe über Bord gegangen wäre. Die Rolle summte, als die Angelleine blitzschnell von der Spule rollte. Die kleine Rute bog sich gewaltig und wurde bis auf die Wasseroberfläche herabgezogen.