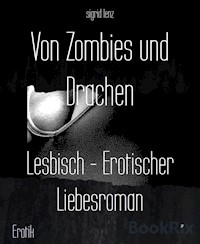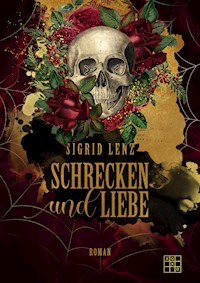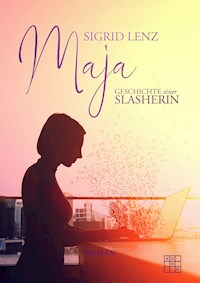Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: XOXO-Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Vier Erzählungen, die sich mit inneren Dämonen beschäftigen. Sie erscheinen in Gestalt eines Monsters, Werwolfes oder Engels und öffnen die tief verborgenen Abgründe einer verwundeten Seele. Florian und Xavier sind wie Licht und Dunkelheit, doch sie ergeben zusammen ein Ganzes. Nathaniel findet, wovon er nicht wusste, dass er es überhaupt gesucht hat, ein dunkles Geheimnis, das Gefahr birgt. Viktor und Leander sind füreinander bestimmt - Alpha und Omega. Bonusstory - Jonahs Weg, eine Geschichte, die nachdenklich stimmt ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 391
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sigrid Lenz
Dämon in dir
Gay Fantasy Erzählungen
Impressum
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.deabrufbar.
Print-ISBN: 978-3-96752-092-7
E-Book-ISBN: 978-3-96752-592-2
Copyright (2022) XOXO Verlag
Umschlaggestaltung und Satz: XOXO Verlag
unter Verwendung der Bilder:
Stockfoto-Nummer: 517288642
von www.shutterstock.com
Engel und Dämon | Wolfsengel
Korrektorat: Sophie R. Nikolay & Mondgesicht Korrektorat und Lektorat
Das Rudel - Eine Werwolfgeschichte | Korrektorat: Sophie R. Nikolay
Jonahs Weg | Korrektorat: Maren Thaler & Sophie R. Nikolay
Hergestellt in Bremen, Germany (EU)
XOXO Verlag
ein IMPRINT der EISERMANN MEDIA GMBH
Gröpelinger Heerstr. 149
28237 Bremen
Alle Personen und Namen innerhalb dieses Buches sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Engel und Dämon
Die Schwestern in der Säuglingsabteilung des Waisenhauses hatten nicht vermutet, dass er lange überlebte. Seine Temperatur war konstant überhöht, sein winziges, verkniffenes Gesicht von einem Film aus kaltem Schweiß überzogen. Die kleinen Fäuste geballt, kämpfte er darum, das flatternde Herz dazu zu bringen weiterzuschlagen, die immer länger werdenden Aussetzer zu beenden und einen Rhythmus zu finden. Es gelang nie vollständig. Auch mit seiner Atmung gab es stets Probleme. Einer der Kinderärzte meinte insgeheim, dass Florians Lungen aussahen, als seien sie nicht für diese Atmosphäre geschaffen.
Doch obwohl niemand es erwartet hatte, stabilisierte er sich. Und je älter er wurde, desto besser ging es ihm, desto besser passte er sich an. Er wurde unauffällig, und nicht nur in gesundheitlicher Hinsicht.
Ein stilles Kind, so bezeichnete man ihn. Er sprach nicht viel, und wenn, dann nur das Notwendigste. Doch er begriff und folgte aufs Wort. Fast war er den Erziehern unheimlich. Florian nahm nie an den regelmäßigen Aufständen teil. An Streichen, zu denen sich immer wieder kleine Gruppen der Waisenhauskinder verschworen, die ihren Frust, die Ablehnung, die sie instinktiv spürten, die Sehnsucht nach einer Familie, die für viele von ihnen immer ein Traum bleiben würde oder in einer unangenehmeren Weise, als ein Kind sich dies vorstellen konnte, in Erfüllung ging, in Zerstörung und Gewalt umsetzten.
Das Schlimmste daran war, dass sie sich selbst das Leben auf diese Art nur zusätzlich erschwerten, dass es das Gebäude war, in dem sie lebten, dessen Mobiliar sie zerbrachen, dessen Fenster sie einwarfen oder dessen Wände sie beschmierten.
Doch während all der Zeit, während der Tobsuchtsanfälle, der nachfolgenden Strafaktionen, dem betretenen Schweigen und der tagelangen peinlichen Ruhe im Gebäude, blieb Florian still. Er beobachtete, die Hände im Schoß, den Kopf leicht gesenkt. Unter kastanienbraunen Strähnen sah er hoch, wandte das Gesicht nicht zur Seite, duckte sich höchstens, wenn ein Gegenstand, der durch die Luft gewirbelt wurde, Gefahr lief, ihn zu treffen.
Kein Wunder, dass die anderen Kinder ihn nicht schätzten. Sie spekulierten, dass er sie verpetzte, dass er ihnen zusah, um haarklein zu berichten, wer was verbrochen hatte. Sie vermuteten, dass er sich für zu gut hielt, um sich mit Abschaum wie ihnen abzugeben, mit Kindern, die von ihren Eltern ausgesetzt oder abgeliefert worden waren, die niemanden mehr hatten, mit denen kein Mensch etwas zu tun haben wollte, die, selbst nachdem sie eine Pflegschaft erlebt hatten, nur allzu oft wieder zurückgebracht wurden. Erneut abgelehnt, diesmal von Fremden, von wirklichen Familien, die ihnen einen kurzen Einblick gönnten, wie es sich anfühlte, in einem eigenen Zimmer zu leben, mit einem Tisch und einem Stuhl, mit Spielsachen und Kleidern, die nicht geteilt werden mussten. Mit Eltern, die sich gegenübersetzten und einen ansahen, während sie ein Brot strichen.
Anders als im Großraumzimmer zu schlafen. Anders als auf einer flachen Matratze zwischen weiteren, ebensolchen flachen Matratzen unter einheitlicher Bettwäsche, den Kopf auf einheitlich bezogenen Kissen, inmitten des Flüsterns und Schnarchens und anderer, unangenehmerer Geräusche, den Schlaf zu suchen. Anders als im Speisesaal wie ein Habicht darauf aufzupassen, dass einem niemand das Brot vom Teller oder den Apfel vom Tablett stibitzte.
Natürlich ließen sie außer Acht, dass Florian mit ihnen in einem Boot saß.
Kinder, die aus einer Pflegefamilie zurückkehrten, waren frustriert. Ihren Frust ließen sie an jemandem aus, der ihnen gelegen kam, der kleiner und schwächer war und der sich nicht wehrte.
Ihren Hass, ihre Unsicherheit, ihre Trauer über den Verlust, das Bild, das sie von sich selbst mitnahmen, als nicht gut genug, nicht ausreichend für ein normales Leben, verwandelten sie in Hiebe, die sie Florian erteilten.
Unauffällig, wie der sich verhielt, bemerkten es die Erzieherinnen nicht immer. Sie übersahen das blaue Auge, die aufgeplatzte Lippe und die Blutergüsse. Und selbst wenn sie nachfragten, so waren sie mit der Antwort zufrieden, die Florian ihnen gab. Und die beinahe immer auf einem unglücklichen Zufall, seinem eigenen Ungeschick oder einem nassen Blatt beruhten, auf dem er ausgerutscht war.
Die Kinder mussten ihn nicht einmal ermahnen oder bedrohen. Er verstand, was sie erwarteten, begriff, wie er handeln musste, und antwortete dementsprechend. Wie immer knapp und leise. Wenige Worte genügten.
Seine Unauffälligkeit ließ die Leichtigkeit, mit der er die Schule bewältigte, überraschend erscheinen. Wenngleich diese Entwicklung ihm das Leben keineswegs erleichterte. Keineswegs dafür sorgte, dass sich Pflegeeltern fanden.
Warum, blieb ein Rätsel. Als still und zurückhaltend eingestuft, sollte er wohl gerne ausgewählt werden. Doch ob es die Geschichten, mehr noch ungelösten Fragen betreffend seiner geschwächten Gesundheit waren, die immer noch regelmäßig auftretenden Atembeschwerden, die zwar Asthma vermuten ließen, aber dennoch nicht darauf zurückgeführt werden konnten, oder die ständig erhöhte Temperatur, die nicht gefährlich, dennoch ungewohnt und für interessierte Eltern irritierend wirkte, es fand sich niemand. Nicht einmal auf Probe. Kein zweiter Blick war ihm vergönnt, selbst wenn er auf Geheiß den Kopf hob und unter zu langen Strähnen hervorblinzelte.
Es musste mit seiner Ausstrahlung zu tun haben, mit der Kühle, die er trotz der Hitze, die in seinem Blut brannte, verbreitete. Dem Schweigen oder der zögernden, langsamen Reaktion auf jede Form der Annäherung.
So entschied man, nachdem er auf eine andere Schule wechseln sollte, ihn in einem Heim unterzubringen, das ältere Kinder beherbergte. Daneben auch Jugendliche und junge Erwachsene, denen es schwerfiel, ihren Weg zu finden.
Er wuchs, wurde lang und schlaksig. Seine Glieder streckten sich mager aus den zu kurz gewordenen Hemden und Hosen. Seine Schultern hingen stärker herab, seinen Kopf neigte er tiefer, seinen Blick hielt er umso gesenkter, je größer er wurde. Und je mehr er seine Lage begriff.
Ihn auf eine andere Schule zu schicken, lag nicht im Bereich des Möglichen. Die Kinder des Heimes besuchten gemeinsam die einzige des Ortes. Zudem sollte er froh und dankbar sein, wenn es ihm leichtfiele, einen Abschluss zu erringen. Man rechnete ihm vor, dass die Möglichkeiten auch danach in alle Richtungen offen standen, dass für einen klugen Jungen viel mehr erreichbar wäre, als er sich erträumen mochte. Florian nickte zu all dem und zu mehr.
Die Pubertät war nicht mehr weit entfernt und wenn er hochsah, dann erblickte er Kinder, die größer waren als er, die mehr wussten, mehr konnten, mehr gesehen hatten. Und sie waren ihm unheimlich.
Bis Xavier eintraf und Florian seine Gewohnheit des kurzen, verstohlenen Aufblickens veränderte, um den anderen anzustarren.
Xavier war nicht zum ersten Mal in diesem Heim. Im Gegenteil, er kannte sich aus. Wenige Jahre älter als Florian, war er bereits aus einigen Pflegefamilien geflogen, nur um in Heime zurückzukehren, die ihn ebenfalls nicht mehr aufnehmen wollten.
Dabei gab es wenig Konkretes anzumerken. Nichts Auffälliges zumindest, das ihn weithin von seinen Altersgenossen unterschieden hätte. Bis auf die Tatsache, dass er zu den Kindern gehörte, die das Eigentum des Heimes oder anderer mutwillig zerstörten, die ihren Frust herausließen, indem sie Kinder wie Florian traten oder schlugen. Die mit Steinen warfen und Autos zerkratzten. Die logen und betrogen, den Pflegeeltern Geld stahlen oder Wertgegenstände. Die in einem Alter, dessen Zahl nicht einmal zwei Stellen aufwies, bereits betrunken aufgegriffen wurden, und die später, doch immer noch viel zu früh, mit Drogen experimentierten.
Xaviers Haar war lang. Wenngleich es ihm nicht wirklich bis zur Schulter reichte. Doch trug er es länger als die anderen im Heim, gelang es ihm immer wieder, sich vor dem Haareschneiden zu drücken. Es war glatt und dunkel. Doch Xaviers Augen schienen hell, in einem Ton, der zwischen Grün und Blau variierte, je nachdem, in welchem Winkel das Licht auf seine Iris traf. Seine Haut schimmerte in einem Ton, der Bronze ähnelte, und seine Herkunft war ebenso ungeklärt wie die Florians.
So still Letzterer auch sein mochte, so geschickt konnte er sein, so perfekt wusste er seine Unauffälligkeit zu nutzen, um an Informationen zu gelangen. Nur, dass bislang nichts dergleichen notwendig gewesen war. Bislang hatte er nie etwas empfunden, was auch nur annähernd dem glich, was er nun empfand. Eine seltsame Dringlichkeit ergriff Besitz von ihm, befahl ihm, seine Ruheposition aufzugeben, das Abwarten zu beenden und einen Schritt zu unternehmen, der so vage und unsicher war, wie er sich fühlte.
Florian war klug. Niemand bestritt dies. Er las gerne, wusste exakt, was in ihm vorging, wenigstens in der Theorie. Hormone, die verrücktspielten, Ungeduld, Veränderung und nebenbei die Ziellosigkeit und Orientierungslosigkeit seiner Jahre. Es sollte sich gut anfühlen, dass seinen Gefühlen eine Richtung gewiesen wurde, dass er einen Ausweg aus dem tristen Einerlei sah, der eintönigen Abwechslung zwischen dem Herumgeschubstwerden und dem leeren Beobachten.
Xavier war es nicht viel anders ergangen als ihm selbst. Bereits als Säugling ausgesetzt, hatte sein Weg durch Heime geführt. Allerdings mit Unterbrechungen, Gastspielen in Pflegefamilien, die ihn mehr oder weniger empört zurückbrachten. Von ungehorsam bis unverbesserlich war die Rede. Von tief innerlich verdorben bis unerträglich. Arrogant und bösartig. Die Adjektive ließen nicht nach, beschrieben ein Monster, machten es ihm bald unmöglich, erneut eines der Heime zu verlassen.
Er würde bleiben, bis er alt genug war, um vor die Tür gesetzt zu werden. Es sei denn, er verschwand vorher und das auf eigene Faust. Keine Frage, dass er nicht der Erste wäre, der sich dazu entschiede.
Florian überflog die Akte, die Aufzeichnungen, die schwarz auf weiß bestätigten, dass das Kind in einem Container gelegen hatte, dass die Krankenschwester ihm bei der Aufnahme den Namen ihres Großvaters gegeben hatte und dass sich keine einzige der üblichen Kinderkrankheiten bei ihm gezeigt hatte.
Nichts davon erklärte, warum Florian fühlte, was er fühlte, wenn er Xavier auch nur aus der Ferne sah. Erklärte nicht, warum er das erste Mal, als sie einen Blick gewechselt hatten, geglaubt hatte, gleichzeitig in bodenlose Tiefen zu stürzen und hoch in den Himmel zu steigen. Es war, als spürte er zum ersten Mal die Leere in sich, als würde sie ihm erst in dem Moment bewusst, in dem Xavier sie füllte. Nicht einmal für eine Sekunde, für einen Bruchteil nur, begegneten sich ihre Augen und Florian spürte, wie sein Körper erzitterte, wie sich in seinen Eingeweiden Wärme und Licht ausbreitete, wie in seinem Inneren eine Anspannung schmolz, von der er nicht gewusst hatte, dass er sie in sich trug.
Wie allein er gewesen war, dass er allein gewesen war, wurde ihm nun bewusst. Schmerzhaft bewusst, wie die Tatsache, dass nur Xavier die Einsamkeit vertreiben konnte.
All diese Gefühle stürmten auf ihn ein, quälten und verwirrten ihn, veranlassten ihn zurückzuweichen, sich noch weiter zurückzuziehen, als es seine Gewohnheit war.
Er wandte den Blick ab, floh zurück in den Schlafsaal, zog die Decke über seinen Kopf und versteckte sich in der Dunkelheit. Nur seine Gedanken konnte er nicht abstellen. Die zwangen ihn dazu, sich jede Information zu besorgen, die er finden konnte, jede Möglichkeit wahrzunehmen, den anderen zu sehen, ohne selbst gesehen zu werden.
Und auch wenn Florian sich einredete, dass der andere ihn nicht sah, ihn nicht beachtete, wusste ein Teil von ihm, der Teil, der ahnte, dass sie zusammengehörten, zwei Hälften eines Ganzen waren, dass Xavier sich seiner Anwesenheit ebenso schmerzlich und ebenso irritiert bewusst war, wie er der des anderen.
Als übe und erprobe sich sein Talent, den anderen zu fühlen und wiederzuerkennen, fiel es ihm mit jedem Tag leichter, Xavier zu spüren. Wenn er die Augen schloss, sah er die Richtung vor sich, der er folgen musste, um zu dem anderen zu finden. Wenn er lauschte, kam es ihm manchmal vor, als hörte er dessen Herz schlagen. Über die Herzen der anderen Kinder hinweg, über alle anderen Geräusche hinweg, die auf der Erde tobten.
Doch er würde nie darüber sprechen, würde nie dergleichen zugeben, würde es nie wagen, seinen Blick länger auf Xavier zu richten, als angemessen, als erlaubt war. Nicht, wenn der oder jemand anderes es bemerkte. Nicht, wenn unverhohlene Blicke zu Beleidigungen im besten Fall, zu Aggressionen im schlimmsten führten.
So alt waren sie nicht, keiner von ihnen. Xavier ein Jugendlicher, aufmüpfig und anstrengend, schnell mit dem Wort, schneller noch mit der Faust.
Er hielt es nicht lange an einem Ort aus, schon gar nicht in der Schule oder im Heim. Nacht für Nacht ging er auf Streifzüge. Tagsüber erschwerte er sich selbst das Leben, blieb seiner Ausbildung fern, wurde gefeuert und gezwungen, neu anzufangen.
Doch immer wieder kehrte er zurück.
Als Xavier siebzehn war, stand er in dem verwilderten Garten, am Rand, nahe des Lochs am Zaun, als hielte er sich eine Möglichkeit zur Flucht offen.
Er drückte die Zigarette im feuchten Laub aus und schob die Flasche ein Stück zurück, bevor er den Jungen betrachtete. Es war lächerlich, dass er es sich zur Gewohnheit gemacht hatte, dem anderen auszuweichen. Der Kleine konnte ihm nichts. Sicher, er war fast so groß wie Xavier, wenn auch einige Jahre jünger, wenigstens zwei. Er machte so gut wie nie den Mund auf, aber dennoch hatte Xavier sich den Namen gemerkt. Nicht zuletzt, weil der Jüngere sich angewöhnte, Xavier in zunehmendem Maße anzustarren. Natürlich immer, wenn er glaubte, dass der es nicht bemerkte. Was umso verstörender war, da Florian sonst niemanden beachtete, weder Kind noch Erziehungsbeauftragten noch einen der Besucher, die von Behörden oder Kontrolleinrichtungen vorbeisahen, um das Heim und dessen Bewohner einer Kontrolle zu unterziehen.
Nicht, dass Xavier ihm selbst Aufmerksamkeit schenkte. Nicht, dass er den anderen ansah oder sich darum kümmerte, was für ein Leben der führte. Das wäre dämlich und peinlich.
Nicht dämlich war es allerdings, zu untersuchen, mit wem er es zu tun hatte. Vorsicht war seit langem zu Xaviers zweiter Natur geworden. Und nicht zuletzt hatte er von den Gerüchten gehört, dass Florian sich bereits als Spitzel betätigt hatte. Nur, dass Xavier keinerlei Hinweise darauf entdecken konnte. Nicht einmal in den besonders gesicherten Akten, nicht einmal, wenn er auf den Instinkt hörte, der ihn selten trog.
Den setzte er nur ein, wenn er keinen anderen Weg sah. Es war unangenehm und er begriff selbst nicht, wie es funktionierte. Am ehesten fühlte die Aktivierung desselben sich an, als verließe er seinen Körper. Dann war er zerbrechlich, ein Hauch nur, zu nichts imstande als zu lauschen und zu fühlen. Doch was er fühlte, war so stark und schmerzhaft, dass es ihn noch Stunden danach zittern ließ. Er hatte sich angewöhnt, die Zeit zu begrenzen, sich in seinem Körper fest genug zu verankern, dass die Rückkehr schneller erfolgte, dass er wie ein Ball, der an einem Gummi befestigt war, aus sich herausschoss, um gleich darauf zurückzuschnellen.
Es reichte aus, um zu erfahren, dass er bei dem neuen Lehrer nie eine Chance erhielte, dass sein Chef nur auf eine Gelegenheit wartete, um ihn zu entlassen, und dass sein Anblick reichte, um bei einem Großteil der Menschen Ablehnung hervorzurufen.
Aber nicht bei Florian. So irritierend dessen Blicke waren, so beinhalteten sie doch keineswegs Verachtung. Xaviers tastender Instinkt verriet ihm, dass keinerlei böse Absicht in dem Jungen schlummerte. Auch, dass der keinerlei böse Absicht in Xavier vermutete.
Was vielleicht ein Fehler war, gut genug kannte der Dunkelhaarige sich.
»Was willst du?« Er sah nicht auf, fühlte die haselnussbraunen Augen auf sich, fühlte ebenso, wie der Junge seine Lider senkte, den Kopf weiter nach vorne neigte, so dass ihm der zu lange Pony ins Gesicht fiel, einen Großteil der jungenhaften Züge verbarg.
»Nichts.«
Xavier zuckte zusammen, sah automatisch hoch. Ihm wurde bewusst, dass er nie zuvor Florians Stimme gehört hatte. Sich nie zuvor mit ihm unterhalten hatte.
Nur, dass sie an diesem Tag, in diesem Teil des Gartens, in dem leichten Nieselregen niemand sah, niemand sich kümmerte. Sein Ruf als gefährlicher Einzelgänger durch nichts gefährdet wurde.
Umso verwirrender wirkte sich Florians Stimme auf Xavier aus. Als ob deren Klang in ihm vibrierte, das einzelne Wort nachhallte und eine Seite in ihm berührte, von deren Existenz er nichts geahnt hatte.
Sein Leben war in Ordnung, im Rahmen seiner Bedingungen. Er haderte nicht mit seinem Schicksal, dachte nicht darüber nach. Es war, wie es war, und anderes erwartete er nicht.
Ein Junge, der einen Narren an ihm gefressen hatte, ihn gelegentlich anstarrte und vielleicht sogar insgeheim beobachtete, sollte nicht stören. Selbst wenn, dürfte eine Tracht Prügel ausreichen, das Problem zu lösen.
Sicher hatte Xavier auch von den Gerüchten über Florian gehört. Ebenso wie von den Schlägen, die der regelmäßig bezog, die ihn seinen Platz lehrten und ihm beibrachten, den Mund zu halten, wenngleich nichts davon jemals notwendig gewesen war. Xavier spürte das, so wie er Florians stille Ehrlichkeit gespürt hatte, das Fehlen von Hass und Ärger, das Fehlen des Egoismus, der über den Selbsterhaltungstrieb hinausging.
»Dann verschwinde«, knurrte Xavier, doch es klang halbherzig, sogar in seinen eigenen Ohren.
Als er hochsah, hatte auch Florian die Augen wieder erhoben und seinen dunklen, warmen Blick auf Xavier gerichtet.
»Ich bin Florian.«
»Ich weiß.« Xavier sah zur Seite. Es kribbelte in seinen Fingern, sich einen Schluck Schnaps zu gönnen, doch entweder wollte er sich die Blöße nicht geben, oder – und das schien ihm wahrscheinlicher – sein Versteck nicht verraten.
»Warum?« Wieder und ohne dass Xavier es beabsichtigt hatte, trafen sich ihre Augen.
»Warum weißt du das?«, fragte Florian.
Xavier verschränkte die Arme vor der Brust, baute einen Schild vor sich auf. »Ich kenne alle hier«, antwortete er. »Es ist gut, die Namen seiner Feinde zu kennen.«
Florian wirkte verletzt. »Ich bin nicht dein Feind.«
Xavier zog eine Augenbraue in die Höhe. »Das sind wir alle hier.« Er zuckte mit den Schultern. »Früher ging es darum, den größten Nachtisch zu ergattern, die Pflegeeltern auf sich aufmerksam zu machen. Und jetzt geht es um Lehrstellen. Oder einfach nur um den Kampf allein.« Er lächelte schief. »Aber dazu bist du zu klein.«
»Nein.« Florian schüttelte den Kopf. »Ich kämpfe nicht. Und sicher nicht mit dir.«
Xavier kniff die Augen zusammen. »Das wäre reichlich dämlich. Wenn du dich nicht wehrst, kassierst du nur mehr Schläge.« Er beugte sich nach vorne. »Aber davon verstehst du bereits etwas, nicht wahr?«
Es kam ihm vor, als verfärbte sich Florians Haut, als nähme dessen Gesicht einen tieferen Ton an.
»Ich kämpfe nicht mit dir, weil ich glaube, dass wir etwas teilen.« Florian runzelte die Stirn. »Ich weiß nur nicht genau was.«
Xavier lachte, ohne es zu meinen. »Soll heißen? Du meinst doch nicht irgendetwas Krankes.«
Er biss sich auf die Lippe und wich einen Schritt zurück. »Pass bloß auf, was du sagst, wenn du nicht gleich eine gebrochene Nase kassieren willst.«
Florian rieb sich über seine Wange, als dächte er darüber nach. »Ich weiß, dass du es auch merkst. Du siehst zu mir. Manchmal.«
Xaviers Augen funkelten. »Ich darf hinsehen, wohin ich will. Daraus kannst du mir keinen Strick drehen.«
Florian atmete aus. Seine Haut nahm wieder den gewohnt bleichen Ton an und sein Blick richtete sich auf den Boden.
»Das meine ich nicht. Ich meine … denkst du denn nicht auch manchmal, dass es mehr gibt? Außerhalb dieses Gebäudes, dieser Ebene, dieser Welt?«
Xavier räusperte sich. »Weißt du eigentlich, wie bescheuert sich das anhört? Ich denke, dass ich nun genug davon habe. Ich rede nicht mit Kindern.«
Damit drehte er sich um und ging. Nein, er rannte, zurück zum Gebäude, doch nur, weil Florian den Weg nicht sehen durfte, der Xavier durch die ungepflegte Anlage führte. Und dies lediglich, da der Junge gar nichts sehen sollte von dem, was Xavier kannte und wusste. Weil Xavier zwar spürte, sein Instinkt deutlich und je länger er Florians Gegenwart fühlte, desto stärker davon sprach, dass der Junge die Wahrheit sagte, lediglich die eigene Verwirrung äußerte, doch er selbst zugleich das Gespräch und seine eigene Verwirrung nicht mehr ertragen konnte. Die Spannung in seinem Körper nahm zu, sein Blut summte und das Summen hallte in seinen Ohren nach. Er versuchte, sich abzuschotten, doch je länger er Florian zuhörte, desto stärker kratzte dessen Stimme an seinem Schutzwall.
Es war verrückt und unangenehm.
Xavier erreichte seinen Schlafsaal und der Erste, der ihm im Weg stand, fing einen Hieb. Es dauerte nicht lange und er fand sich im Einzelzimmer wieder. In dem eingesperrt wurde, wer sich nicht zu benehmen wusste, wohlweislich fern von den anderen, wohlweislich innerhalb von Mauern, die weder scharfe noch sonst bedenkliche Gegenstände beinhalteten. Zeit, um nachzudenken, Zeit, um zur Besinnung zu finden. Zeit, um Fluchtpläne zu schmieden.
***
Es war ein Fehler gewesen, das wusste Florian nun. Doch es änderte nichts daran, dass es notwendig gewesen war, dass alles in ihm danach geschrien hatte, das Schweigen zwischen ihnen zu beenden.
Dennoch erwies sich Xavier als so anders, als fremder und zugleich vertrauter, denn während der unzähligen Augenblicke, während derer Florian sich ihre Begegnung ausgemalt hatte.
Er spürte den Schutzwall, fühlte jeden Stein, den Xavier aufgetürmt hatte. Und er ahnte, dass sich hinter diesem Wall weitaus mehr Dunkelheit befand, als Xaviers Verhalten erahnen ließ.
Aber dennoch war es diese Dunkelheit, die in Florian ein Licht entzündete, die Wärme in ihm ansteigen ließ. Er fieberte wieder. Das kam nur noch gelegentlich vor. Inzwischen stieg seine Temperatur selten so stark, dass es auffiel. Doch sobald er das Gebäude betrat, fielen Karl die roten Flecken auf Florians Wangen, die unnatürlich glänzenden Augen auf, und er duldete keine Widerworte.
Als Florian die Krankenstation wieder verlassen durfte, war Xavier verschwunden.
Zum ersten Mal spürte Florian einen Verlust. Ohne etwas besessen zu haben, ohne zu wissen, was es war, das ihm fehlte, erkannte er doch, dass es mit Xaviers Abwesenheit zusammenhing, dass die schwerer wog nach dem zu kurzen Gespräch, das sie geführt hatten.
Doch dauerte es nicht lange, bis der zurückkehrte. Was Florian nicht ahnte, war die Leere, die Xavier selbst gespürt hatte. Ahnte nicht, dass – so verschieden die beiden auch waren – sie im Schmerz um einen Verlust, der sich nicht definieren ließ, sich annäherten.
Als Xavier zurückkam, veränderte sich die Welt für Florian. Das Lächeln, das sich auf seinem Gesicht ausbreitete, war ihm so fremd, dass es schmerzte, war den anderen so fremd, dass sie ihren Blick abwandten und zurückwichen.
Xavier erwiderte es nicht. Stattdessen drehte er sich auf dem Absatz um und ging.
Er stand am Zaun, wartete, wusste, dass Florian ihm folgte.
»Wie alt bist du?«, fragte er.
»Alt genug«, antwortete Florian.
»Du weißt nicht, was du sagst.« Xavier schüttelte den Kopf.
»Ebenso wenig wie du.« Florian lächelte wieder und Xavier strich sein Haar zurück, biss sich auf die Unterlippe und zog an den Ärmeln seiner Jacke.
»Ich weiß genug«, sagte er ohne aufzusehen. »Ich war weitaus jünger als du, als mein Pflegevater entschied, dass ich nicht nur zum Verprügeln taugte.«
Florian vernahm die Verbitterung in Xaviers Stimme und das Lächeln fiel von seinem Gesicht. Er spürte die Dunkelheit in dem anderen wabern, erhaschte eine Ahnung davon, dass in der weitaus mehr lauerte.
»Und er war nicht der Einzige«, fuhr Xavier fort, als bräche ein Damm, als bliebe ihm nun, da er ein Wort gesprochen hatte, nichts anderes übrig, als sich weiter zu öffnen.
Er sah Florian an, sandte die Dunkelheit durch seine Augen. »Du willst nicht behaupten, dass du im Heim nicht Ähnliches erlebt hast? Du willst mir nicht sagen, dass es an mir liegt, dass ich es provoziere.«
Florian blinzelte, bevor er seinen Arm ausstreckte. Das Handgelenk, das unter dem Ärmel hervortrat, wies eine rote Schwellung auf. Und darunter, den Arm hinauf, kroch eine Narbe.
»Keiner von uns provoziert das«, sagte er. »Sie spüren nur, dass wir anders sind. Und für manche ist es der einzige Weg, sich selbst zu beweisen, dass sie größere Macht besitzen.«
Es war so still, dass Florian Xaviers Schlucken hörte, bevor der unerwartet vorsichtig, als seien sie aus Glas, die Finger des Jüngeren in seine nahm. »Wieso?«, fragte er leise.
Um Florians Lippen zuckte es. »Ich denke, dass ich nur fortwollte. Als ich begriff, wie es funktionierte, dachte ich mir nicht viel dabei.«
Xavier schluckte erneut. »Aber du hast es nicht wieder versucht.«
Florian schüttelte den Kopf. »Ich glaube, dass ich erkannte, wie sehr es sich um eine Frage der Geduld handelte.«
»Verstehe ich nicht.«
Xavier ließ Florians Hand los.
Um dessen Lippen zuckte es erneut, erinnerte dieses Mal stärker an das verloren gegangene Lächeln von zuvor. »Ein Teil von mir wusste, dass ich auf dich warten sollte. Dass es nicht an der Zeit war aufzugeben.«
Der Dunkelhaarige schnaubte leise. »Das ist Blödsinn, esoterischer Quatsch.«
Florian legte den Kopf schief. »Aber es hat funktioniert.«
Xavier schnalzte mit der Zunge. »Du denkst wirklich, es habe eine Bedeutung, dass wir uns begegnet sind. Das ist so kindisch und dämlich, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll.« Heftig schüttelte er den Kopf.
»Ich werde sowieso bald wieder abhauen. Du kannst darauf wetten, dass ich praktisch bereits gefeuert bin, dass sie nur einen Grund suchen, um mich vor die Tür zu setzen. Oder mich von hier aus gleich in den Knast einzuweisen. Volljährigkeit muss ja für etwas gut sein.«
Florian zog die Nase kraus, was ihn jünger aussehen ließ und Xaviers Magen veranlasste, sich schmerzhaft zusammenzuziehen. Was um alles in der Welt dachte er sich, mit dem Jungen, mit einem dummen Kind zu sprechen? Und dann auch noch derart wirre Gedanken zu erörtern. Als ob seine Lage nicht bereits verzwickt genug wäre.
»Du kannst nicht gehen.« Florians Stimme klang leise, beinahe flehend und Xavier fühlte einen Kloß im Hals.
»Was geht es dich an? Du solltest dich um dich selbst kümmern. Deine Noten stimmen und du hast keine schwarzen Flecken in deiner Akte. Sieht gut für dich aus.« Er schob die Hände in seine Hosentaschen, sah an Florian vorbei. »Hör nur darauf, was die dir vorbeten, Schule, Job, Auskommen, dann gibt es keine Beschwerden.«
»Könnte ich dir auch sagen«, brachte Florian hervor, doch Xavier stieß nur einen ärgerlichen Laut aus. »Der Zug ist abgefahren«, schickte er hinterher.
»Trotzdem.« Florian sah ihn bittend an. »Ich möchte nur … wissen, wo du bist. Nur … wissen, dass es dir gut geht, dass du nicht … in der Dunkelheit verschwunden bist.«
»Was?« Xaviers Augenbrauen zogen sich zusammen. Eine steile Falte bildete sich zwischen ihnen, verlieh ihm ein finsteres Aussehen.
Florian holte tief Luft. Er ging einen Schritt auf Xavier zu, schnell genug, dass dem nicht einfiel zurückzuweichen, dass er nicht einmal seine Arme hob, um den anderen abzuwehren.
Florian legte seine Hände auf Xaviers Brust und schloss die Augen.
»Da drin«, flüsterte er. »Da befindet sich ein Rätsel. So wie in mir. Ich möchte … ich stelle mir vor, dass wir es gemeinsam lösen.«
‚Blödsinn‘, wollte Xavier sagen, in Ermangelung eines deutlicheren Begriffs. Doch das Wort erstarb auf seiner Zunge, als die Hitze aus Florians Handflächen seine Kleidung wärmte, durchdrang, er sie auf der Haut fühlte. Als er die Vibration fühlte, an die er sich erinnerte, die eine Barriere in ihm gelöst hatte und die nun das Eis zum Schmelzen brachte, das sein Herz umschloss.
Er schloss die Augen, fühlte, wie etwas in ihm weinte, ohne dass seine Augen Feuchtigkeit verloren.
»Siehst du?«, hörte er Florian flüstern. »Ich wusste, dass du es auch spürst. Dass du weißt, wir gehören zusammen.«
Xaviers Herzschlag stockte und zur gleichen Zeit riss ihn etwas zurück, stärker noch als sein Instinkt. »Vergiss es«, stieß er hervor, ignorierte den rauen Tonfall seiner Stimme. »Du bist verrückt. Das sagen alle. Ich sollte nicht mit dir sprechen.«
Aus den Augenwinkeln erhaschte er die geweiteten Augen, die hängenden Schultern, die herabgefallenen Hände des anderen. Er sah den Ärmel, der immer noch hochgezogen das Handgelenk und die Male darauf erkennen ließ. Ein bitterer Geschmack breitete sich in seinem Mund aus, als er herumwirbelte und vorwärts rannte. Fort von Florian, auf das Gebäude zu. Obwohl alles in ihm schrie, dass darin der Fehler lag, dass es genau umgekehrt sein sollte.
Er verschloss die Ohren vor den Rufen anderer, zog sich auf seine Matratze zurück, winkelte die Knie an und legte den Kopf darauf, wartete ab, bis die Dunkelheit in ihm sich der Dunkelheit anglich, die ihn umgab, bis Gespräche und Geräusche verstummten und die Stille ihm erlaubte, seine Gedanken freier wandern zu lassen.
Nichts und niemand hatte ihn je so verwirrt wie Florian, und Xavier begriff nicht, womit der ihn beeinflusste. Jeden anderen hätte er längst grün und blau geschlagen, jeder andere würde längst nicht mehr wagen, ihn auch nur anzusehen.
Er weigerte sich, über die Andeutungen nachzudenken, über die Verrücktheiten, die der andere in Worte fasste, die nichts anderem dienten, als dazu, ihn in größere Schwierigkeiten zu bringen.
Gefängnis gut und schön, aber auch jemand wie Xavier kannte seine Grenzen. Sich an Minderjährigen zu vergreifen, war dämlich, sogar für ihn. Er wusste sehr gut, wie das endete. Und egal welche fremdartigen, körperlichen Reaktionen dieses verrückte Kind in ihm auslöste, er würde den Teufel tun und zulassen, dass es ihm dadurch ein Grab schaufelte.
Xavier biss sich auf die Lippen, als er merkte, dass er sich bewegte, dass er wie ein Kranker, wie ein Nervenkranker hin und her schaukelte, seiner Matratze lauschte, die fast unhörbar quietschte, und doch laut genug, um seinem Bettnachbarn ein Murren zu entlocken.
Er schmeckte Blut und biss trotzdem stärker zu.
So oder so befand er sich auf einer Straße ohne Ausweg. Dass die direkt in den Abgrund führte, wusste er wohl, doch dass sie einen Umweg nähme, neben Gewalt, Drogen und stetem Ärger eine Komponente mit einschloss, die er nicht erwartet hatte, führte dazu, dass seine Eingeweide sich verkrampften, seine Hände schwitzten und sich der scheußliche Geschmack auf seiner Zunge verstärkte.
Dabei war seine Erkenntnis nicht derart neu, wie er sich einzureden suchte. Spätestens mit seiner letzten Flucht, mit den vergangenen Monaten, in denen kein Tag, kaum eine Stunde vergangen war, in der er nicht Florians Gesicht vor sich gesehen hatte, war es ihm klar geworden, dass er dem Jungen nicht mehr auskam. Dass er früher oder später zurückkehren musste, und sei es auch nur, um dem die Abreibung zu verpassen, die er verdiente, und die ihn selbst befreite.
Xavier war immer gut darin gewesen, sich etwas vorzumachen. Aber nie gut darin, seine eigenen Gefühle zu deuten.
Als er Florian fand, als er ihn nur von Ferne im Gang sah, das Leuchten in dessen Augen, das seltene Anheben des Gesichts, welches sein Haar zurückfallen ließ und es den Zügen erlaubte hervorzutreten, von denen bereits zu erkennen war, dass sie eines Tages, eher früher als später attraktiv sein würden, da wusste er es. Da spürte er wieder das Loch in seinem Inneren, das nur mit der Anwesenheit des anderen gefüllt wurde, nur durch die Tatsache, dass sie dieselbe Luft atmeten.
So gerne er auch Florian die Schuld gäbe, so gerne er wütend auf den wäre, ihm vorwürfe, dass der ihn manipulierte, verhexte, sein übles Spiel mit ihm trieb, so wenig möglich war es ihm, an etwas anderes zu denken als daran, wie es sich wohl anfühlte, seine Hand an Florians Wange zu legen, die Wärme der blassen Haut zu spüren, seine Lippen auf die fiebrige Stirn zu pressen.
Xavier erstarrte. Das mochte es sein. Im Fieber lag die Ursache. Florian trug eine Krankheit in sich, einen nicht identifizierten Erreger. Davon hatte er in dessen Akten gelesen. Damit musste der Junge ihn angesteckt haben. Es ergab vollkommenen Sinn und dann wieder nicht.
Xavier konnte sich nicht daran erinnern, jemals krank gewesen zu sein. Er war alles andere als anfällig. Warum sollte er sich ausgerechnet eine Krankheit holen, die offenkundig nichts anderes als erhöhte Temperatur zur Folge hatte. Und reinen Irrsinn, wie er schweren Herzens ergänzte.
Vage, unausgegorene Ideen von Zusammengehörigkeit und Rätseln. Xavier hatte genug gesehen und erlebt, um leere Worte als die Hüllen zu erkennen, die sich um fragwürdige Absichten oder um Verwirrung wanden. Florian mochte er zugestehen, dass es sich um Letzteres handelte.
Xavier presste die Stirn so fest gegen sein Knie, dass beides schmerzte. Doch die Wut, in die er sich fliehen wollte, war längst verraucht, vertrieben von dem wissenden, dem allzu sicheren Blick Florians. Der so überzeugt, so verdammt überzeugt war, dass Xaviers Überzeugungen in sich zusammenbröckelten, dass sein Bild, welches er sich von der Welt aufgebaut hatte, wankte.
Ein Fremder, ein Junge, der Einfluss auf ihn ausübte, nur weil er sich entschieden hatte, mit Xavier und mit Xavier allein zu sprechen, brachte ihn stärker durcheinander, als jede Misshandlung es getan hatte. Wollte ihm einreden, dass sie etwas teilten. Neben der Erfahrung anders zu sein, am untersten Ende der Kette zu existieren, den zu spielen, der als Fußabtreter benutzt wurde, und der sich nicht einmal darüber beschweren durfte.
Jetzt wollte Florian ihm einreden, dass hinter all dem ein Sinn steckte. Xavier spürte, so verrückt es war, wie sein Widerstand bröckelte, wie er dessen Worte zu verstehen glaubte, sie wenigstens im Ansatz begriff. Und wie das Gesicht, der Blick, den er ohnehin nicht aus dem Kopf bekam, sich in sein Inneres schmiegte, einen Weg in sein Herz suchte, vorbei an allen Grenzen und Wällen, die in ihm aufragten, die der Gedanke an Florians wissende Augen lautlos in sich zusammensinken ließ.
Ebenso lautlos löste Xavier die schmerzenden Glieder voneinander, den klammerartigen Griff um seine Beine, die Verkrampfung in seinen Füßen.
Er schwang seine Beine aus dem Bett, lauschte kurz und erhob sich, huschte aus dem Schlafzimmer, der Weg vertraut genug, dass ihn auch das fehlende Licht einer sternenlosen Nacht nicht abhielt. Dass es so spät geworden war, hatte er ebenso wenig bemerkt wie die tiefe Dunkelheit des Neumondes.
Der Gang bog nach links ab, führte zu den anderen Schlafräumen. Dort, an der Wand, stand Florian und wartete. Xavier fühlte ihn, noch bevor er den Schatten bemerkte, fühlte die Hitze, die umso höher in ihm aufstieg, je näher er dem anderen kam.
Eine Sekunde stand er vor ihm, ahnte dessen Blick mehr, als die Finsternis ihm erlaubte, dessen Tiefe zu erkennen. Bis Florian zögernd seine Hand ausstreckte, sie dorthin an Xaviers Brust legte, wo sie Stunden zuvor bereits geruht hatte.
Xaviers Arme schlangen sich wie von selbst um den Jüngeren, fühlten Schulterblätter, Rippen, Wirbelsäule durch den dünnen Stoff des Schlafanzuges. Fühlten Fieber, während seine Lippen kalten Schweiß auf heißer Haut schmeckten, als er seinen Mund in Florians Nacken presste, das Zittern dessen Körpers sich in seinem fortsetzte.
»Ich weiß«, flüsterte er in Florians Ohr. »Ich kann auch nichts dagegen tun.«
Er sagte nicht, dass es ihm leid tat, wusste nicht, ob das von Bedeutung war, wusste nicht, was es war, für das er sich zu entschuldigen suchte.
Sie standen unbeweglich bis auf das Zittern ihrer Körper, das nicht nachließ, sich nicht verstärkte. Es reichte aus, in der Dunkelheit zu stehen, zu sein und zu spüren, dass es jemanden gab, der verstand. Der Einsamkeit und Traurigkeit teilte und der die klaffende Leere im Herzen füllte.
Als der Morgen dämmerte, verschwanden sie in ihre Räume, ohne sich anzusehen, ohne sich noch einmal umzudrehen. Es war seltsam, dass es sich trotz allem richtig anfühlte.
Florians Augen folgten Xaviers Gestalt, als der zum Frühstück erschien. Sie folgten ihm, als der den Raum verließ, ohne mehr als einen kurzen Blick in seine Richtung geworfen zu haben.
Unauffälligkeit schützte ihn selbst, Argwohn und Aufmerksamkeit standen Xavier im Weg. Doch nun, nachdem der andere sich ihm offenbart hatte, nachdem Florian gefühlt hatte, wie hoch die Hindernisse waren, die der sich selbst als Schutz errichtet hatte, war ihm möglich zu sehen, was der nicht sehen konnte.
Dass Xaviers Gang elastisch war, federte. Dass sein Haar in weichem Schwung fiel und sich mit ihm bewegte. Dass er seine Schultern gerade hielt und sein Kinn erhoben. Dass er Stolz zeigte, den er nicht fühlte, dass er provozierte, ohne es zu wissen. Und dass er schön war, zu schön, um nicht aufzufallen, um nicht jede Form von Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Auch die, welche ihm zum Verhängnis wurde.
Florian sah auch die Spannung, unter der Xavier konstant stand. Er erkannte, wie wenig dazu gehörte, dass der seiner Wut Gewalt über seine Handlungen einräumte. Er sah, wie dessen Kopf herumschnellte, wenn ihn ein Geräusch alarmierte, sah, wie dessen Finger sich zur Faust ballten, ohne dass der es bemerkte.
Und er sah, dass all das zu ihm gehörte. Und somit auch zu Florian. Der nun wusste, dass er den anderen ergänzte. Der während der vergangenen Nacht gespürt hatte, wie sie nur durch ihre Nähe zu einer Einheit wurden.
Getrennt durch eine Laune der Natur. Dazu verurteilt, in Einsamkeit zu leiden, dahinzuvegetieren, durchzuhalten bis zu den wenigen Momenten, in denen sie miteinander verschmolzen.
In der folgenden Nacht küssten sie sich. Es war unbeholfen und in jeder Beziehung merkwürdig. Das plumpe Aufeinandertreffen trockener Lippen. Fiebrige Hitze, die sich gegen raue Kühle presste, einen Moment nur, bevor sie sich wieder trennten, zu schnell, um die Erschütterung zu fühlen, die sich innerhalb eines Herzschlages anbahnen wollte.
Florian verhakte seine Finger in den Schlaufen von Xaviers Jeans, bevor er sein Gesicht auf dessen Schulter legte. »Mein Abschluss«, sagte er leise. »Es dauert nicht mehr lange. Ich kann danach überall hin. Niemanden interessiert es, niemanden geht es etwas an.«
»Was schlägst du vor?«, flüsterte Xavier zurück.
»Dass wir zusammen weggehen.« Florian hob seinen Kopf nicht, auch nicht, als Xavier seufzte.
»Du weißt nicht, was du sagst.« Er ließ seine Hand sinken, die eben noch Florians Arm gehalten hatte. »Das hier ist vielleicht okay. Aber auf mich verlassen darfst du dich nicht. Auf gar keinen Fall.«
»Das tue ich nicht«, wisperte Florian. »Aber ich kann nicht warten.«
Xavier begriff nicht. »Worauf?«
Florian seufzte leise. »Auf ein Leben. Auf Normalität.« Nun hob er den Kopf, doch nur, um seine Lippen gegen Xaviers Hals zu bewegen, in einem kurzen, trockenen Kuss. »Das fühlst du doch«, fragte er. »Dass sich alles verändert. Dass so vieles wächst. Dass, wenn Wälle bröckeln, eingeschlossene Kräfte nach Freiheit suchen.«
Xavier spürte die Dunkelheit in sich nach außen hervorquellen und drängte sie zurück. »Nein«, sagte er. »Nichts verändert sich, wenn wir es nicht zulassen.«
Florian rieb seine Nase gegen Xaviers Schulter. »Du sollst es nur wissen«, sagte er. »Dass ich mit dir gehe. Immer und überallhin.«
Xavier schloss die Augen. Bestimmt genug klangen Florians Worte, dass Widerspruch ebenso sinnlos wäre wie der Versuch, sich aus Florians Armen zu lösen.
Er gewöhnte sich daran. Es fühlte sich gut an. Er bekam nicht genug davon, konnte die Umarmung nicht freiwillig beenden, obwohl er wusste, dass sie ihr Schicksal herausforderten, die Folgen fremd und unbekannt erschienen. So wie ihm eben noch Florian fremd gewesen war. Der sich in seine Arme schmiegte, als habe er immer schon dort hinein gehört.
Doch ahnten sie beide nichts von dem Beobachter, der ihnen gefolgt war, der nun in den Schatten lauerte.
Maurice war ein junger Vikar, noch nicht lange im Amt. Angefüllt mit Idealismus und guten Absichten, nahm er seinen Beruf als Seelsorger ernster als andere mit mehr Erfahrung. Er glaubte noch an die Möglichkeiten der Jugend, an Chancen und zweite Chancen. Bis er Florian und Xavier zusammen sah und nicht wusste, was er denken, geschweige denn, wie er reagieren sollte.
Das Konzept der Liebe, auch der gleichgeschlechtlichen, war ihm vertraut, und er gab sein Möglichstes, sich tolerant und aufgeschlossen zu zeigen. Aber diese Kinder waren seine Zöglinge, wenngleich nicht im Sinne des Wortes. Nichtsdestotrotz fühlte er sich verantwortlich und als er sah wie Xavier Florian küsste, zuckte es in seinen Fingern, Händen und Armen, den Größeren wegzureißen und ihm die Abreibung zu verpassen, nach welcher der Junge förmlich zu schreien schien.
Aber seine Intuition hielt ihn zurück. Seltsam, dass es sich um dieselbe Intuition handelte, die ihn dazu verleitet hatte, sich des Nachts lautlos durch die Gänge zu bewegen. Seltsam, dass es sich um die Intuition handelte, die ihn bereits seit Tagen dazu anstiftete, Florian auf Schritt und Tritt zu folgen, ein gesondertes Auge auf den Jungen zu behalten, nicht erst, seitdem ihm klar war, dass der eine unheilige Allianz mit Xavier einzugehen beabsichtigte.
Gerade darin lag sein Problem. Maurice wusste, dass Florian sich entschieden hatte. Er sah es in dem Blick des Jungen, wenn der die Gestalt Xaviers mit den Augen verfolgte. Wenn es in diesen leuchtete, bevor er sie niederschlug. Doch nicht, ohne dass in seine blassen Wangen Farbe stieg, ihm für einen Moment ein gesünderes Aussehen verlieh.
Maurice mochte naiv sein, sich für weltabgewandt halten, und dem Geistigen, der religiösen Erleuchtung und den Idealen seiner Kirche verschrieben haben, doch er wusste sehr gut, was die Pubertät mit einem Jungen anstellte, was sie ihm in den Kopf setzte und zu welchen Problemen die unkontrollierte Ausschüttung von Hormonen führte.
Es war eine Sache, dass Florian sich für einen Jungen interessierte. Die andere und wichtigere besagte, dass es um Florian anders bestellt war als um die Kinder, denen Maurice sonst begegnete.
Auch dass Xaviers Ruf ihm vorauseilte. Selbst wenn der keineswegs aus dem Rahmen fiel. Selbst wenn Xavier sich in die Riege der heranwachsenden Waisen perfekt einordnete und bis auf sein Aussehen und sein Gehabe nicht hervortrat, blieb doch die dunkle Aura, die Maurice während ihrer ersten Begegnung bereits aufgefallen war. Selbst wenn er die auf schwarze Kleidung, den Gothic-Trend und das strähnige, aus seiner Sicht stets ungewaschene Haar zurückführte, konnte Maurice nicht leugnen, dass etwas an dem Jungen ihn empfindlicher verstörte, als Äußerlichkeiten vermuten ließen.
Geradeso wie Florian eine verwirrende Wirkung auf ihn ausübte. Natürlich hatte Maurice seine Hausaufgaben gemacht, wusste von der Krankheitsgeschichte, von dem Geheimnis, das Florian umgab. Andererseits waren Geheimnisse wie diese in seiner Welt an der Tagesordnung. Kein Kind lebte innerhalb dieser Mauern, dessen Leben nicht mit einem Geheimnis begonnen hatte, und das sich früher oder später damit abfinden musste, dieses nie lösen zu können.
Doch auch wenn Maurice eine blühende Fantasie sein Eigen nannte, auch wenn er sehr gut wusste, dass seine Einbildungskraft Gefahr lief, mit ihm davonzugaloppieren, so spürte er doch mit aller Deutlichkeit, dass es sich bei Florian um einen Sonderfall handelte. Dass der mit Licht und Reinheit zusammenhing. Ebenso wie Xavier in Finsternis wandelte, selbst während der hellsten Stunden des Tages.
Als der Vikar sah, wie die zwei Jungen sich begegneten, wie sie sich in der Dunkelheit umschlangen und küssten, da fürchtete er um die Reinheit, um Florians Seelenheil. Wenigstens sagte er sich dies im Stillen.
Doch er durfte nicht eingreifen, durfte nicht dazwischengehen, denn so viel war sicher: Florian würde weder verstehen noch vergessen noch je verzeihen. Der Junge verlor sich in dem Moment und genau das war seine Absicht. Auch wenn Maurice sich fürchtete, um Florian fürchtete, zusah, wie die Dunkelheit ihn umarmte und festhielt, so blieb er gezwungen stillzustehen und auszuharren. Abzuwarten, bis die beiden sich voneinander lösten, bis sie mit den ersten grauen Strahlen des heranbrechenden Tages den Weg in ihre getrennten Schlafsäle antraten.
Maurice wartete in den Schatten, betrachtete die Helligkeit, die sich ihren Weg suchte, die Mauern erleuchtete, aus dem Gefängnis ein Heim zu zaubern versuchte, und in ihm formte sich ein Gedanke.
***
Der Seelsorger war Xavier schon immer ein Dorn im Auge gewesen. Ebenso wie jeder andere Erzieher, jeder, der sich aufspielte, der glaubte, er könne ihm sagen, wo es lang ging.
Maurice war beileibe nicht der Erste, der versucht hatte, ihn zu erleuchten, und mit Sicherheit würde er nicht der Letzte sein. Heime wie dieses, Auffangstationen für verkrachte Existenzen jeden Alters, zogen Geistliche an wie Motten das Licht. Leichte Beute, vermutete Xavier und schwor sich von jeher, nicht auf derlei Humbug hereinzufallen. Die meisten spürten seine Ablehnung instinktiv, klassifizierten ihn von vornherein als verlorenes, wenn nicht schwarzes Schaf und drehten sich kein zweites Mal nach ihm um.
Umso erstaunter war er, als Maurice es sich zur Gewohnheit zu machen begann, öfter in Xaviers Blickfeld aufzutauchen, als Sinn ergab. Als einleuchtete, wenigstens für jemanden, dem Xavier so augenscheinlich auf die Nerven ging.
Xavier war nicht so dumm, sich ernsthaft mit einem Erzieher oder einer Respektsperson anzulegen, aber er selbst übernahm keine Garantie für seine eigene Geduld.
Sein Verdacht erhärtete sich, als er feststellte, dass Maurice mindestens ebenso häufig um Florian herumschlich, wie er in seiner Umgebung auftauchte.
Öfter noch, was Xavier aus vielerlei Gründen unangenehm aufstieß. Da bemerkte er durchaus den winzigen, grundlosen Stachel einer Eifersucht, die jeder Blick in Florians Augen als lächerliche Einbildung entlarvte. Doch weitaus stärker wirkte sich das Unbehagen aus, das Xavier bald nicht mehr abschütteln konnte.
Selbst wenn Maurice nicht den Eindruck vermittelte, als plante er, Florian an die Wäsche zu gehen, so ließ er sich doch auch nicht abschütteln. Und Xavier stellte rasch fest, dass die Aufmerksamkeit des Seelsorgers sich von Tag zu Tag mehr auf den Jungen konzentrierte.
So war er nicht wirklich überrascht, als der ihn zur Seite nahm, nicht einmal, als Maurice das Gespräch ohne Umschweife auf Florian lenkte.
»Du solltest dich von ihm fernhalten«, sagte der Mann und Xavier verschränkte die Arme vor der Brust und straffte seine Schultern.
»Ich wüsste nicht, was Sie das angeht.«
Maurice fuhr sich durch sein Haar, das infolgedessen steil vom Kopf abstand, ohne dass er es bemerkte.
Für einen Augenblick wirkte er fast verwirrt und einen Moment lang verspürte Xavier beinahe Mitleid.
»Ich denke doch, dass du wenigstens eine Ahnung besitzt.« Die Antwort kam langsam und bedacht, als habe Maurice schon lange darüber nachgedacht, wie er sie formulieren sollte, und sich dann doch im letzten Augenblick umentschieden.
Maurice räusperte sich ein wenig unsicher, fuhr dann fester fort.
»Ich kenne dich lange genug. Du bist ein heller Kopf, aber ein Unruhestifter. Man hat dir unzählige Chancen gegeben, aber du hast keine von ihnen genutzt.«
Xavier hob das Kinn und verengte seine Augen zu Schlitzen. Er hatte es nicht nötig, den Mann zu korrigieren. Das war einer von denen, die sich eine Meinung bildeten und dann nicht einmal mit dem Presslufthammer davon abzubringen waren. Was wollte einer wie der von Chancen wissen? Von den Klamotten bis zur Frisur sah er stets aus wie aus dem Ei gepellt. Wenn der das Heim verließ, kehrte er mit Sicherheit in ein Mehr-Zimmer-Apartment zurück, ausgestattet mit Flachbildfernseher und Apple-Computer. Einer wie der konnte ihm gar nichts.
»Sind Sie fertig?«
Es juckte bereits in Xaviers Fingern und er krallte dieselben in seinen Oberkörper. Kam nicht in Frage, dass er sich in Schwierigkeiten brachte, wegen so einer Saftnase.
Maurice verzog die Mundwinkel. Seine Wangen bliesen sich auf, die Knochen traten hervor und er schluckte vernehmlich.
»Nein«, sagte er dann fest. »Hier geht es um Florian. Ich will nur, dass du mir zuhörst. Du brauchst nicht zu antworten, aber du solltest das hören.«
Der Mann atmete langsam aus.
»Vielleicht liegt es daran, dass ich mein Leben der spirituellen Erkenntnis gewidmet habe, aber ich sehe mehr als andere, weitaus mehr. Sozusagen über die Grenzen der Wahrnehmung hinaus, wenn du verstehst, was ich meine.«
Xavier rollte mit den Augen. Soviel Selbstgerechtigkeit und geschwollenes Gefasel schrie direkt nach einer Abreibung. Vielleicht sollte er die Reifen seines Wagens aufschlitzen.
Maurice zog die Augenbrauen zusammen, fast als könne er Xaviers Gedanken hören.