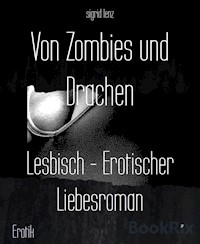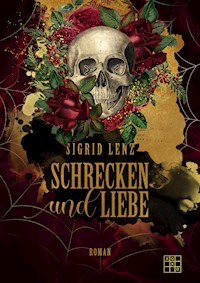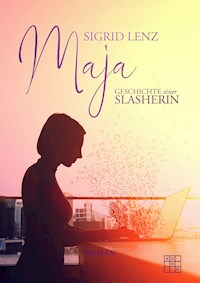Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: XOXO-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Mutter auf der Suche nach dem Vater ihres Kindes. Ein Leben zwischen Magersucht, Alkoholismus, Zwangsneurosen, psychische Erkrankungen, deren Verlauf und Auswirkungen. Eine authentische Erzählung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 249
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sigrid Lenz
Der Weg durch den Wahnsinn
Erzählung
Impressum
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.deabrufbar.
Print-ISBN: 978-3-96752-093-4
E-Book-ISBN: 978-3-96752-593-9
Copyright (2022) XOXO Verlag
Umschlaggestaltung und Satz: XOXO Verlag
unter Verwendung der Bilder:
Stockfoto-Nummer: 298700588
von www.shutterstock.com
Hergestellt in Bremen, Germany (EU)
XOXO Verlag
ein IMPRINT der EISERMANN MEDIA GMBH
Gröpelinger Heerstr. 149
28237 Bremen
Alle Personen und Namen innerhalb dieses Buches sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Kapitel 1
Dies ist eigentlich unglaublich. Nicht vollkommen unmöglich und dennoch absolut spektakulär, erderschütternd unerwartet. Sicher, ich sollte mich nicht zu früh freuen. Sicher, wie es ausgehen wird, kann niemand sagen. Ob sich ein Sinn ergeben, ob dieser zu Resultaten führt oder ob ich überhaupt nur einem Schwindel aufliege, das alles wird erst die Zukunft zeigen können. Doch Tatsache ist, dass es tatsächlich so aussieht, als hätte ich heute, nach beinahe 13 Jahren, den Vater meines Kindes gefunden.
Nicht dass es einfach war, ganz gewiss nicht. Im Grunde genommen hatte mich nur wieder das Glück am Schlafittchen gepackt, herumgewirbelt und mir auf einem Silbertablett serviert, was ich nicht mehr zu hoffen wagte. Das Glück, das mich unverdient schon so viele Male gerettet und mir beigestanden hat. Vielleicht war es eine höhere Macht, vielleicht das Schicksal, vielleicht nur ein längst fälliger Puzzlestein in einem unendlichen Muster. Jedoch glaube ich im Grunde kaum an die allgemein verbreiteten Vorstellungen, die sich verdreht und verkünstelt in den verschiedenen Religionen niedergelassen haben. Nicht, dass ich kein spiritueller Mensch wäre. Aber sollte ein Gott seinen Blick über die Erde schweifen lassen, um sich einen Menschen auszusuchen, dem er beistehen wollte, so würde er mit Sicherheit nicht mich auswählen.
Doch andererseits, wenn ich mein Leben Revue passieren lasse, dann hat eigentlich stets ein guter Geist über mir gewacht. Angefangen bei der ersten Erinnerung, die sich mir eingeprägte, und eine recht übermäßige Angst vor dem Ertrinken zur Folge hatte, um nur eines der Beispiele zu nennen. Verstehen Sie mich nicht falsch, Ängste sind etwas, mit dem ich mich wirklich auskenne. Von der landläufigen Panikattacke bis zur ausgewachsenen Phobie durfte ich jede ihrer Ausprägungen in ihrem vollendeten Entfaltungsreichtum gründlich und intensiv ausleben.
Jedoch sollte ich wohl am Anfang beginnen, oder bei dem was mir mein schrumpfendes Erinnerungsvermögen noch zur Verfügung stellt.
Als Kind von zwei Jahren wusste ich noch nichts von Phobien. Ich wusste lediglich, dass ich auf einmal keine Luft mehr bekam. Ich wusste, dass ich mich im Wasser befand, mich unter Wasser befand, und keine Möglichkeit mehr hatte, an die Oberfläche zu gelangen. Aus dem einfachen Grund, weil über mir ein oranges Etwas schwebte, gegen das ich unweigerlich und wiederholt anstieß. Und dieses bei jedem erneuten Versuch aufzutauchen. Also tauchte ich nicht auf, sondern schluckte Wasser, und erfuhr vermutlich zum ersten Mal in meinem Leben, was es hieß, sich in seiner Existenz bedroht zu sehen. Glücklicherweise fehlte mir damals noch der philosophische Durchblick um die Tragweite des Geschehens, so dass ich einfach nur erleichtert gewesen sein dürfte, als meine Lungen sich unvermittelt wieder mit Sauerstoff füllten
Meine nächste Erinnerung besteht darin, dass ich hustend und spuckend in unglaublicher Höhe auf dem Arm einer Fremden sitze. Besser gesagt von ihr umklammert werde, die mit Sicherheit nicht so groß war, wie ich sie in Erinnerung hatte. Auf jeden Fall hetzte diese Frau mit mir auf dem Arm über eine saftig grüne Liegewiese, auf der sich unzählige Sonnenanbeter und Freizeitgenießer tummelten. Unter ihnen auch meine Eltern, die zutiefst erstaunt erschienen über den gewaltsamen Einbruch in ihre idyllische Sonntagnachmittagsruhe. Selbstverständlich erwiesen sich in diesem zarten Alter meine sprachlichen Fähigkeiten als nicht ausreichend ausgeprägt, um jede Feinheit des Gespräches zu erfassen, doch der Grundton blieb in meiner Erinnerung bestehen. Unterschwelliger Ärger über die angebrachte Kritik, offene Verblüffung über das Rowdytum gewisser Jugendlicher, die sich nicht davor scheuten, kleine Kinder, die am Ufer Dämme bauten, gnadenlos zu überfahren. Mag sein, dass es noch Versuche gab, die Verbrecher zur Rechenschaft zu ziehen. Mag sein, dass man sich verbrüderte gegen den gemeinsamen Feind. Mein eigenes Interesse dürfte sich jedoch in diesem Moment bereits anderen Themen zugewandt haben, die einem brabbelnden Kleinkind eher angemessen waren. Im Grunde war ich in diesem Alter wohl auch noch kein großer Läufer. Ich krabbelte, erforschte die Welt von unten. Von einer sicheren Perspektive aus, mit beiden Beinen und beiden Händen dem Boden verhaftet. Das war meine Welt und meine Sicherheit.
Erst später erkannte ich die Vorteile des großen Überblickes, die Möglichkeiten, die sich boten, wenn man das Leben aus einer gewissen, mentalen Höhe heraus, betrachtete. Doch damals bevorzugte ich noch die Schritt für Schritt, Einzelheit nach Einzelheit Taktik. Und sie ließ mich selten im Stich.
Seltsamerweise besitze ich keine Erinnerung an meinen Bruder, der nicht unwesentlich später zur Welt kommen sollte. Zumindest keine Erinnerung an meine Zeit mit ihm. Lediglich Erzählungen malen ein Bild davon, wie ich ihn bei seiner Ankunft aus dem Krankenhaus, freudig begrüßte und zunächst in einem ungewohnten Anfall von Großmut mit all meinen Stofftieren versorgte. Stofftiere, die ich sonst mit niemandem teilte. Aber offenbar war mir schon damals bewusst, dass dieser Neuzugang eine willkommene Abwechslung, eine notwendige Gesellschaft bedeuten würde. Also füllte ich sein Kinderbettchen mit den bisherigen Kameraden meiner Kinderzeit und begutachtete den Neuzuwachs interessiert.
Man kann also nicht behaupten, dass ich von Anfang an alle Menschen abgelehnt hätte. Ganz und gar nicht. Ich mag Menschen. Ich mag sie sogar sehr. Ich hab sie nur um so lieber, je weiter entfernt von mir, sie sich aufhalten.
Ein quakendes Baby in einem Gitterbettchen war demnach gerade noch akzeptabel. Dagegen ließ sich beim besten Willen nichts sagen. Als es dann begann, Umstände zu machen, als sogar ich einbezogen wurde, um dem kleinen Quälgeist als Aufsicht und Gesellschaft zu dienen, veränderte sich die Sachlage etwas.
Und dennoch nicht derart wesentlich, wie ich es von mir selbst heute erwarten würde. Vielleicht war ich damals unschuldiger, weniger erschöpft, weniger desillusioniert. Zumindest ertrug ich die Gesellschaft meines Bruders besser, als wohl später die Gesellschaft der meisten anderen Menschen. Natürlich trug wohl auch dazu bei, dass ich bei Pflichtvergessenheit den Hosenboden stramm gezogen bekam. Aber unterm Strich waren es wohl doch die Bande des Blutes, die mir zu einer gewissen Achtsamkeit, einer Art von geschwisterlicher Liebe verholfen.
Obwohl in diesen jungen, vorschulischen Jahren noch kein bekennender Pazifist, ließ ich mich kaum zu den Handgreiflichkeiten herab, die sonst die Beziehung zwischen älteren und jüngeren Geschwistern kennzeichnen. So waren meine Eltern denn auch voll des Lobes über meine tolerante, um nicht zu sagen, erwachsene Haltung, mit der ich meine Machtstellung ausübte. Die gelegentliche Ohrfeige, sollte ich ihren Erwartungen einen Strich durch die Rechnung machen, half selbstverständlich auch, meine sich eventuell damals schon hervorwagenden Aggressionen in den Griff zu kriegen. Nicht vollständig, denn mit gewonnener Stabilität des kleinen Nebenbuhlers fand ich hin und wieder Geschmack am Raufen und am Gewinnen. Keine Kunst, war ich doch schließlich über drei Jahre älter. Aber den kleinen Kick für ein ansonsten spärlich ausgeprägtes Selbstbewusstsein, gönnte ich mir damals. Ich war so frei. Wenn auch vorsichtshalber beim verborgenen Spiel im Keller, ohne Aufsicht.
Aber das sind Jugendsünden, dazu verbrochen, um aus ihnen zu lernen. Zumindest habe ich gelernt, dass man besser mit niemandem rauft, der größer oder stärker ist, als die eigene Person. Weshalb diese Gewohnheit des kleinen Schlagabtausches rasch nachließ, als mein Brüderchen zu einem Bruder wurde, der sich nicht mehr so leicht unterbuttern ließ.
Pech für mich, denn nun war ich wirklich auf mich allein gestellt. Zumindest kam es mir manchmal so vor, wie in dem Moment, als meine Eltern mir eine der ersten Lektionen meines Lebens erteilten, noch vor der Geburt des kleinen Kronprinzen. Sie sind sehr schlau, meine Eltern, durchschauten mich schon in den ersten Momenten meines Seins. Gerade dem Mutterleib entschlüpft, trug ich die eindeutigen Züge meiner Großmutter mütterlicherseits, sowie die Frisur eines entfernten Onkels. Dazu muss gesagt werden, dass meine Großmutter mütterlicherseits das Kreuz und die Geißel sowohl meiner Mutter, als auch meines Vaters waren. Im Vergleich dazu, wie sehr sie diese Frau verabscheuten, war es fast ein Wunder, dass sie mich nicht sofort auf der Schwelle des Krankenhauses liegen ließen.
Aber zurück zum Thema, beziehungsweise zu der wichtigen Lektion.
Ich hatte mich mal wieder schlecht benommen, vielleicht genörgelt, möglicherweise sogar laut geweint oder etwas gewünscht. Das mag lächerlich erscheinen, betrachtet man die Respektlosigkeit mit der die Kleinen dieser Tage ihre Wünsche äußern. Doch damals war es noch anders. Damals galt das brave Kind noch als ein Ideal. Und einem Ideal anzustreben, dem blieb ich selten abgeneigt.
Zudem war anscheinend ein Freiheitsdrang in mir erwacht, der mich dazu brachte, meinen Eltern auszubüchsen, oder zumindest den Versuch zu wagen. Möglicherweise wollte ich auch nur Verstecken spielen, möglicherweise war mir langweilig auf einem nicht enden wollenden Einkaufsbummel. Diesem unerhörten Verhalten einer Dreijährigen musste Rechnung getragen werden. Man ließ sie allein. Natürlich nicht ganz allein. Meine Eltern waren keine Monster. Sie verbargen sich nur hinter einer Ecke und sahen zu, wie ich begann, nach ihnen zu suchen. Eine Lehrstunde wirkte natürlich nur, wenn sie weh tat, also ließen sie mich lange suchen, sehr lange.
Als ich dann reumütig und tränenüberströmt in ihre Arme zurückkehrte, war ich nicht nur um einiges schlauer geworden, sondern auch um einiges traumatisierter. Möglicherweise erlebte ich in diesen Momenten meine erste Panikattacke. Wahrscheinlich aber, hatte ich nur eine Menge dazu gelernt. Eine überaus wichtige Lektion, die ich nicht wieder vergessen sollte. Und wahrscheinlich bildete sich auch damals in meinem Unterbewusstsein die Überzeugung heran, dass es Sicherheit nur bei diesen beiden Menschen gab. Und dass es zu meiner Lebensaufgabe werden sollte, die beiden nie wieder alleine zu lassen.
Wie auch immer, das blieb natürlich nicht das Einzige, was sie mir beibrachten. Eine weitere fundamentale Lehre besagte, dass man, oder besser gesagt, dass frau keinen Anspruch auf Äußerungen der Wut oder des Ärgers haben sollte. Ja, dass solche Gefühle an sich schon verpönt waren, daran bestand ebenfalls kein Zweifel. Weisheiten, die mich mit einem milden Lächeln durch mein Leben bringen sollten und ohne die konkrete Erfahrung eines vernünftigen Wutausbruchs.
Lächle und die Welt lacht mit dir. Ein schöner Spruch, nur nahm ich ihn mir wohl etwas zu sehr zu Herzen. Zumindest wirft mir mein Söhnchen gelegentlich das falsche Grinsen vor. Ich hätte eben ein sonniges Gemüt, so kontere ich ihm gerne, wenngleich die stapelweise vorhandenen Anti-Depressiva in unserem Haushalt vom Gegenteil berichten.
Doch wo eigentlich war ich stehengeblieben? Worum ging es hier? Ganz recht, um den Vater meines Sohnes und die erstaunliche Tatsache, dass er sich auffinden ließ. Nun mögen Sie vielleicht denken, er wäre aus gutem Grund gegangen und ich könnte es ihm, nach dem, was ich soeben berichtet hatte, nicht übel nehmen. Doch liegt die Sache geringfügig anders.
Zugegeben, ich bin kein guter Fang, weder optisch, noch finanziell, noch in einer irgendwie anders gearteten Hinsicht. Doch trotz der zahlreichen ausgewachsenen Minderwertigkeitskomplexe, wohnt tief in mir ein nicht klein zu kriegender, geradezu unerschütterlicher Stolz. Welche Art von Stolz das ist und woher er kommt, das konnte ich bisher noch nicht entdecken. Doch er ist vorhanden und drängelt sich hin und wieder an die Oberfläche. Vor allem, wenn es darum geht, mir das Leben noch schwerer oder unmöglicher zu machen. Eben dieser Stolz brach hervor und drückte jeden letzten Rest gesunden Menschenverstandes in einen versteckten Winkel, als ich erfuhr schwanger zu sein.
Wohlgemerkt, ich bin durchaus intelligent, das hatte ich schon vorher gemerkt. Aber darin, mich selbst zu belügen, bin ich besser, als in allem anderen. Schwanger ging einfach nicht. Zu all den anderen Problemen, die ich mit mir herumschleppte, wäre dies ja wohl das Absurdeste und Peinlichste von allen. Irgendwann allerdings wurde die Sache unübersehbar und ich machte mich auf den unangenehmen Weg zum Arzt, der mir das Eindeutige bestätigte. Stolz und verbohrt wie ich war, beschloss ich zugleich, erstens, diesem Mann nichts zu sagen und zweitens, am besten gleich bei der Geburt zu sterben. Die Chancen standen vielleicht schlecht, war ich doch von geradezu beleidigender Gesundheit, trotz allem, was ich dagegen unternommen hatte, jedoch in diesem Fall erschien mir mein Tod als passende Konsequenz für die Gesamtheit meiner Fehlverhalten.
Nicht unwichtig, dass ich zu meinem großen Erstaunen, meiner Freude und allgemeinem Glück, erfahren durfte, dass meine Eltern der Aussicht auf ein Enkelkind durchaus positiv gegenüber standen, was allerdings meinen Entschluss im Kindbett zu sterben nicht im Mindesten beeinträchtigte.
Mochte sein, dass es hilfreich war, auf beiden Seiten der Familiengeschichte eine nicht unbeträchtliche Anzahl lediger Mütter vorzuweisen, womit wir auch wieder bei den Banden des Blutes wären. Mochte auch sein, dass beide mittlerweile dem eigenen und dem Tod des Partners ausgiebig genug ins Auge gesehen zu haben, um sich über das, was sie schlichtweg und durchaus aus gutem Grund nicht zu hoffen gewagt hatten, doch zu freuen.
Wie dem auch sein, sie waren von geradezu reizendem Willen zur Unterstützung beseelt. Noch. Denn damals ahnten sie wohl nicht, dass ein Enkelkind zu beaufsichtigen ebenso anstrengend ist, wie sich um das eigene Kind zu kümmern. Eines der Geheimnisse des Lebens liegt doch immer wieder in der Schnelligkeit, in der der Mensch den Stress, den Schmerz und die Qualen der ersten Jahre der Kindererziehung komplett aus seinem Gedächtnis zu streichen vermag. Ein geschickter Schachzug der Natur, damit nicht nur zeugungsfähige Erwachsene sich zum wiederholten Mal auf dieses Abenteuer einlassen, sondern auch Anverwandte im Überschwang der Gefühle jede Hilfe und Unterstützung in Bezug auf die notwendigen Arbeiten und Anstrengungen zusichern. Glauben Sie mir, ich weiß wovon ich rede. Bin ich doch selbst momentan in der Position des Verwandten, der nicht anders kann, als sich und seine Dienste als Babysitter wiederholt den jungen Eltern, welche aus meinem kleinen Bruder und meiner entzückenden Schwägerin bestehen, aufzudrängen.
Nun gut. Zurück in die Vergangenheit. Da ich mein Leben bisher mit den Versuchen verbracht hatte, mich selbst auf umständliche und langwierige Art und Weise vom Leben zum Tode zu bringen, stand ich mit der Aussicht auf ein Kind noch hilfloser da, als zuvor. Ich beschloss also, besser gesagt, ich wurde beschlossen, meine Ausbildung zu Ende zu bringen, um mich dereinst enthusiastisch und dankbar in ein erfüllendes Berufsleben zu stürzen. Wer hätte gedacht, dass mir dieses nie gelingen sollte? Obwohl… ich eigentlich hätte es zumindest wissen müssen.
Auf alle Fälle ließen mich der Elan und die neue Hoffnung und vermutlich auch diverse wild ausgeschüttete Hormone erblühen und ich bewältigte die Doppelbelastung. Wobei meine Eltern mir durchaus klar machten, dass es keine Doppelbelastung war, da sie es ja waren, die für alles aufkamen, die mich und meine traurige Existenz zusammen mit dem kleinen Wurm weiter bei sich wohnen ließen, und die außerdem noch die Betreuung des Kindes übernahmen für die lange Zeit, die ich abwesend sein musste. Eine unzumutbare Belastung für zwei Menschen, die ihr Werk bereits vollbracht hatten. Dementsprechend schuldig fühlte ich mich auch, von morgens bis abends und jede Stunde dazwischen.
Worauf ich also eigentlich hinaus wollte: Der Vater meines Söhnchens erfuhr nie von seinem Glück. Auch als ich wider Erwarten die Geburt überlebte und einen gesunden kleinen Fratz mit genau der richtigen Anzahl Zehen und Fingern zur Welt gebracht hatte, lagen meine Prioritäten zunächst in anderen Gebieten. Wie zum Beispiel in den vergeblichen Stillversuchen oder dem Erlernen der Kunst des Windelwechselns, all das erschien mir vorerst wichtiger als mich um den Mann zu kümmern, dessen Äußeres mir ohnehin nur noch eine ausgesprochen schattenhafte Darstellung zu sein schien. Was wohlgemerkt nicht an ihm lag. Geradeaus gesagt, konnte ich mir noch nie Gesichter merken. Ich gehe durch die Welt und treffe stets auf unbekannte Menschen.
Ergo rief ich ihn nicht an, obwohl ich die Nummer selbstverständlich gut verwahrt hatte. Pedantisch bin ich nämlich auch noch. So leicht kommt mir nichts weg. Es sei denn, ich wollte es so. Wie bei dem besagten Vater. Nennen wir ihn der Einfachheit halber Denzel. Nicht dass er aussah, wie Denzel Washington, auch wenn gewisse Ähnlichkeiten nicht zu verleugnen waren. Jedoch wäre es vermessen ein Gottesgeschenk an die Frauen wie diesen begnadeten Schauspieler mit dem unschuldigen, jungen Mann zu vergleichen, der netterweise als Samenspender fungierte. Zum einen war dieser besagte Spender erheblich dunkler, um nicht zu sagen von einem glänzenden Zartbitter, dass Seinesgleichen suchte. Was soll ich sagen. Ich gebe es ja zu. Ich stehe nun mal auf schwarze Menschen. Schon immer. Sie sind einfach schön. Ihre Haut ist von unvergleichbarer Makellosigkeit. Es ist die Hautfarbe, die der Herr im Auge hatte, als er den Menschen erschuf. Niemand kann mir erzählen, dass Gottes Schöpfung als Ziel eine blässliche Gestalt wie mich als Krone verfolgte. Ein Weißbrot als Krone der Schöpfung? Ich sage nur: Neurodermitis, Pickel, Hautunreinheiten bis ans Lebensende. Eine Gesichtsfarbe, die je nach Temperatur, Peinlichkeiten, Anstrengung, Übelkeit oder Eiseskälte zwischen knallrot und grünlich blau wechselt. Das kann Gott nicht so gewollt haben. Nie und nimmer.
Und um einmal intim zu werden: Jeder, der einmal die Haut eines Afrikaners hat berühren dürfen, wird mir unweigerlich recht geben. Denn diese fühlt sich anders an, gesünder, fester, glatt und seidig. Ein unvergleichliches Gefühl. Gar nicht anfangen sollte ich mit dem Spiel der Muskeln eines starken Rückens, den kräftigen Armen, perfekten Schenkeln. In keinster Weise zu vergleichen mit einem langweiligen, blonden Schönling.
Selbst nach stundenlangem, mühseligen Entwachsen der Brustbehaarung, Zupfen der Augenbrauen, Hantel-Training oder sogar Braten auf der Sonnenbank bleibt ein Kaukasier einfach weiß. Langweilig, öde, verwaschen, instabil und überzüchtet. Einfach weiß.
Aber ich schweife vom Thema ab.
Es wird also niemanden verwundern, wenn ich zugebe, dass mein Auserwählter – sofern man im volltrunkenen Zustand abgrundtiefer Verzweiflung von Auswahl sprechen kann – so schwarz war, wie frau oder man es sich nur erträumen konnte.
Nun gut, er rief mich an. Wieder und wieder. Und ich wurde weich. Natürlich – wer kann schon zu so jemandem nein sagen. Zumal er nett war, einfach entzückend, auch wenn ich kaum etwas von dem verstand, was er sagte. Wir behalfen uns ein wenig mit französisch, aber mein Schulfranzösisch war den Anforderungen schlichtweg nicht gewachsen. Ein äußerst angenehmer Zustand, wenn ich das so bedenke. Schließlich neige ich zum Grübeln. Sie kennen das vielleicht. Das unendliche Kreisen der Gedanken um immer wieder ein und dasselbe Thema. Das ist anstrengend. Vor allem wenn es noch mit der mir eigenen Eloquenz gepaart ist. Einer Eloquenz, die danach schreit, ohne Unterbrechung das zu äußern, was die Gedanken unermüdlich hinter der Stirn formen. Also muss ich reden. Schwierig, vor allem, wenn man einen Gesprächspartner vor sich hat, der eventuell ebenfalls kommunizieren möchte. Das heißt, auf die Gedanken des anderen eingehen, ihm zuhören und gleichzeitig regelmäßig eine kluge Erwiderung parat haben, die das Gegenüber anregt, interessiert und begeistert. Unter all diesen Ansprüchen schwelt natürlich eine immerwährende Furcht. Die Furcht, dass sich genau dieser andere empört, abgeschreckt, schockiert oder einfach nur irritiert abwendet und niemals wieder zurückkehrt. Ganz gleich, wie langweilig, uninteressant, frei von Inspiration und Unterhaltungswert das Gespräch auch sein mag, diese Reaktion abzuwehren gehört zu den obersten aller Ziele. Sicher, auch das ist wieder zwanghaft. Eine dieser zwanghaften Verhaltensmuster, die mich zwingen, Gespräche mit Menschen zu führen, die im Grunde und so hart es auch klingen mag, nichts als Zeitverschwendung darstellen.
Zurück zum Thema: Ich war also dementsprechend froh, dem Gesprächszwang aufgrund gewisser, von mir zumindest in diesem Augenblick nicht beeinflussbarer Umstände, entkommen zu können. Was sollte auch interessant genug sein, um besprochen zu werden. Wir verabredeten uns und der Rest war Schweigen. Mein Interesse ging peinlicherweise nicht einmal weit genug, um mir seinen Namen zu merken. Die Adresse schrieb ich mir auf, war sogar in der Lage, mir die Busverbindung zu merken. Aber damit blieb ich bereits ausgelastet. Immerhin hatte ich ein Leben, hatte eine Ausbildung abzuschließen, auch wenn ich sie nicht gerade liebte. Einige Verpflichtungen, denn man näherte sich den Weihnachtstagen und damit verbundenen Festivitäten. Und Weihnachten war schon immer eine besondere Sache für mich gewesen. Ich könnte jetzt behaupten, es wäre der Gedanke des Friedens, der weltumfassenden Liebe, des Glückes eines Neugeborenen, das Hoffnung und Freude schenkt. Aber eigentlich sind es die Plätzchen. Das heißt: nicht nur diese. Dazu zähle ich selbstverständlich auch Lebkuchen, Marzipankartoffeln, Dominosteine und Christstollen. Ausreichend Glitzern und Funkeln und ich war selig. Heutzutage ist mir diese kindliche Begeisterung zwar weitgehend entschwunden, aber damit war wohl auch irgendwann leider zu rechnen.
Zumindest damals noch gehörte ich zu den Menschen, für die Weihnachten den Höhepunkt des Jahres darstellte. Nicht zu vergessen, die Erleichterung, die mit den sinkenden Temperaturen, dem Abklingen des verhassten Sommers, den dunklen Abenden einher ging. War es doch ungleich angenehmer, sich zeitgleich mit dem Großteil der Mitbürger, in den eigenen vier Wänden zu verkriechen, die Rollläden hinunterzulassen, den Lauf der Welt anzuhalten und sich mit einem Gläschen und einer Kerze vor dem Fernseher niederzulassen, als dies in der anderen Hälfte des Jahres vonstatten ging. Die gleiche Vorgehensweise an Tagen, in denen ständig von draußen neben nicht unterzukriegenden Lichtstrahlen auch noch Gelächter, Gläserklingen und der Duft von Gegrilltem drang, daran erinnerte, dass man schon am frühen Nachmittag in seinem Schlafanzug vor dem Fernseher saß, einfach, weil man nicht anders konnte, bedeutete schlichtweg nicht dasselbe Vergnügen.
Doch zurück zum Wesentlichen. Mit dem Fortschreiten der Schwangerschaft wuchs in mir die Unlust, Denzel wiederzusehen. Ob das normal ist kann ich nicht beurteilen. Wahrscheinlich nicht, aber Tatsache bleibt, ich hatte ehrlich keine Lust. Mochte eine Rolle spielen, dass er mich bei unserem letzten Treffen gefragt hatte, ob ich seine Freundin sein wollte. In gebrochenem Deutsch, das immer noch besser war, als mein Französisch, aber durchaus nicht falsch zu verstehen. Und ich reagierte, wie ich immer reagiere, wenn ich mich in die Ecke gedrückt fühle. Ich machte mich kleiner und kleiner und versuchte zu verschwinden. Besser gesagt, ich hatte auf einmal überhaupt keine Zeit mehr für ihn. Nicht unbedingt absichtlich. Es wurde nur immer schwieriger, sich aufzuraffen. Der Gedanke an die mühselige Reise in die Stadt, die Aussicht, sich all den Anstrengungen zu unterziehen, wurde unangenehmer, je länger ich dieselben aufschob.
Nicht, dass ich ihn nicht sehen wollte. Zumindest behauptete ich, dass ich es wollte, versicherte es mir selbst ausreichend. Auf seine Fragen antwortete ich immer wieder, dass es kein Problem gäbe. Ich spielte sogar mit dem Gedanken, ihm von dem Baby zu erzählen. Aber es blieb beim Spielen. Ich sagte nichts, und ging ihm weiter aus dem Weg. Wochen, Monate. Und dann traf er mich zufällig, oder ich ihn? Am Hauptbahnhof prallten wir aufeinander. Ich lachte erfreut, verzog mein Gesicht zu dieser freundlichen, übertrieben strahlenden Maske und spielte ihm etwas vor. Natürlich sollten wir uns treffen. Absolut. Jawohl, es würde bestimmt klappen. Ich denke sogar, dass ich ihn noch einmal anrief, oder er mich. Ich denke sogar, dass wir einen Treffpunkt ausmachten. Ich denke sogar, dass ich dort war. Vielleicht allerdings bin ich auch nur vorbeigefahren. Mit Sicherheit sagen, kann ich es nicht mehr. Jahrelanger Alkoholgenuss tötet doch mehr Gehirnzellen, als man für möglich halten sollte.
Auf jeden Fall ist mir dieser Tag, an dem wir uns trafen, in Erinnerung geblieben. Und noch mehr der Blick, den Denzel in die Richtung meines Unterleibes schickte. Gut, dieser war bereits etwas gewölbt. Aber da ich dazu neige, unförmige, sackartige und unmodische Kleidung zu tragen, die alles versteckt, was es nur zu verstecken gibt, werde ich wohl nie genau wissen, worin die genaue Ursache dieses Blickes lag. Vielleicht ahnte er etwas. Vielleicht merkte er etwas. Vielleicht aber sah er nur unbewusst irgendwohin, um nicht in mein verlogenes Gesicht zu sehen.
Zumindest haben wir uns an diesem Tag zum letzten Mal gesehen. Gut, jedes Mal, bei jedem Ausflug, der mich nach München führte, sah ich mich um. Versuchte festzustellen, ob es möglich sein konnte. Ob er mir auflauerte, wie ich ihm ausweichen konnte. Doch dieser Ernstfall trat niemals ein. Was für ein Wunder.
Betrachtet man, wie gründlich ich die Sache in den Sand gesetzt hatte, desto erstaunlicher, dass es mir doch noch gelungen ist, diesen einen Menschen unter so vielen, aufzutreiben. Und das nach einer so langen Zeit. Ist das ein Omen? Und wenn ja, ein Schlechtes?
Eher nicht. Denn eigentlich, objektiv betrachtet, bin ich, wie bereits erwähnt, so etwas wie ein Glückskind. Wenn ich mir vorstellen, was mir alles hätte passieren können, läuft es mir kalt den Rücken hinunter.
Natürlich bin ich ein vorsichtiger Mensch. Auf ein Hobby wie Fallschirmspringen oder Bergsteigen würde ich mich niemals einlassen. Viel zu viele unmöglich abzuwägende Risiken. Außerdem bin ich bei weitem zu feige, anders ausgedrückt zu vernünftig. Es existiert kein nachvollziehbarer Grund für sinnlosen und zugleich gefährlichen Zeitvertreib wie die soeben genannten.
Aber das Leben ist gefährlich und führt offensichtlich zum Tode. Deshalb zog ich schon immer den sicheren Weg vor. Im Augenblick zum Beispiel versuche ich mich zu Tode zu essen. Auch eine interessante Methode, vor allem, wenn man meine Krankengeschichte betrachten möchte. Aber dazu später.
Bedenkt man also die vorsichtigen und behutsamen Schritte, die ich in meinem Leben unternommen habe, so befinden sich auch darunter manche von der Art, die übel hätten ausgehen können, wäre mir nicht ein Glücksengel zur Seite gestanden.
Nehme man nur das Aidsrisiko. Ich bestand zwar durchaus auf einem Kondom. Zuerst zumindest. Aber dann, also später, vergaß ich meine Vernunft. Obwohl, so ganz richtig ist das auch nicht. Ich vergaß meine Vernunft nicht. In mir setzte sich nur die Überzeugung fest, dass dies, dieses Zusammensein mit dem verschrobenen Frauen gegenüber ausgiebig toleranten Denzel, möglicherweise die einzige Möglichkeit für mich sein konnte, jemals ein Kind zu bekommen. Addiert man dazu die deprimierte Grundstimmung, in der ich mich befand, so erklärt sich der Rest von alleine. Bedenkt man diese Grundstimmung, die jede Veränderung des momentanen Zustandes als einzigartigen Vorteil wertete, so lässt sich, unter Umständen und zumindest in gewissen Kreisen der weiblichen Bevölkerung, die nicht mit überirdischer Schönheit, bezauberndem Lächeln und zehn Verehrern an jeder Hand, gesegnet sind, ansatzweise nachvollziehen, was mich dazu brachte, des weiteren nicht mehr auf dem schützenden Kondom zu bestehen.
Nun, wir sprechen von einer Zeit, die über zehn Jahre zurückliegt. Wir sprechen von dem Heimatland meines Auserwählten, in dem es neben Krieg, Völkermord, Ausbeutung und Chaos eine Vielzahl weiterer Probleme gibt, die das Thema Aids in eine Reihe eingliedern, aus der es nicht sonderlich hervorsticht. Verständlicherweise, wenn ich das anmerken darf.
Denzel, das muss man ihm zugestehen, nahm ein Kondom, sofern ich es erwähnte. Nur, als ich mir die Bemerkung ersparte, ersparte er sich die Mühe. Schön dumm. Auch von ihm.
Selbst wenn ihm unter Umständen nicht entgangen war, dass die erste Nacht auch die war, in der er mich entjungfert hatte. Eine ältliche Jungfrau, gut. Aber sein entsetztes Gesicht drang doch durch den Alkoholdunst, in dem ich es mir so gemütlich gemacht hatte.
Ich wachte auf, am Morgen, zu seinen Bemühungen, das Laken zu wechseln und seinen besorgten Fragen, ob alles in Ordnung war. Klar war alles in Ordnung. Meine letzte Erinnerung war die Erwähnung des Kondoms von meiner Seite. Danach hatte ich meine Pflicht und Schuldigkeit offenbar getan, und konnte in gnädiges Vergessen abtauchen.
Wie auch immer, ein Kuss und Schluss. Ich ging und war weg. Dachte mir sogar noch im Nachhinein, dass ich hiermit vielleicht die Chance auf Nachwuchs versiebt hatte. Mit ziemlichem Bedauern, wie ich zugeben muss. Auf jeden Fall kam ich irgendwie nach Hause, reichlich verkatert, versteht sich von selbst. Und schon wenige Tage später konnte ich mich nicht mehr entsinnen, wo ich eigentlich gewesen war. Ja, ich spielte sogar mit dem Gedanken, die einschlägigen Gegenden abzusuchen, auszuprobieren, ob sich die korrekte Buslinie entdecken ließ. Doch das ließ sie nicht. Vielleicht war ich sogar auf dem Weg dorthin. Vielleicht versuchte ich es. Vielleicht sah er mich, wie ich verwirrt in den Winter der Hauptstadt starrte, auf der Suche nach etwas unendlich Unvorsichtigem, unglaublich Dummem.
Zumindest könnte dies der Abend gewesen sein, an dem er mich anrief. Mitten in der Nacht. Spät. Wirklich sehr spät. Meine Eltern gingen an den Apparat. Meine Eltern riefen mich. Und ich war verdattert. Erfreut verdattert.
»Da ist jemand, der spricht so unverständlich.« Große Augen und den ausgestreckten Hörer mir ins Gesicht haltend, standen sie da. In Wirklichkeit war es natürlich nur einer der beiden. Aber ich kann mich beim besten Willen nicht erinnern, wer es wohl gewesen sein konnte. Im Grunde spielt es auch keine Rolle. Sind sie doch beide eins, in meinen Augen auf jeden Fall. Eng verbunden. So eng wie es nur ein jahrzehntelanges Zusammensein zustande bringen kann. Vielleicht einer der Gründe, warum der Gedanke an Heirat mir stets eiskalte Schauer über den Rücken jagt.
Auf jeden Fall war er es, Denzel. Und er versuchte mir klar zu machen, dass er mich wiedersehen wollte. »Ja, ja.« Klar wollte ich. Was hatte ich sonst schon. Und noch viel wichtiger: Was hatte ich zu verlieren. Und damit begannen unsere kurzen Treffen.
Ich brachte ihm Kuchen und Kerzen. Schließlich war Weihnachten und jedermann musste an meiner Stimmung teilhaben.
Er wirkte regelmäßig verdutzt. Hatte ich mir natürlich auch nie die Mühe gemacht, ihn nach seiner Religion zu fragen. Ja, ernsthaft. Ich wusste nichts. Die Zeit, das Leben war zu kurz, um sich nach allem zu erkundigen. Also ließ ich es bleiben. Und wartete ab. Meistens löste die Zeit alle Fragen auf die eine oder andere Art. Zumindest hatte ich diese Erfahrung immer und immer wieder machen dürfen.
Die Zeit löste zumindest die Frage nach einer Infektion. Denn als ich mich endlich zum Arzt bequemte und sehr nett gefragt wurde, ob ich mich einem Test unterziehen wollte, stimmte ich ohne Umschweife zu. Und ich regte mich nicht einmal sonderlich auf. Überhaupt nicht. Komisch eigentlich, bedenkt man die Aids-Panik, die ich später entwickelte. Vielleicht macht die Schwangerschaft einen härter, abgebrühter. Ernsthaft. Das tut sie vermutlich, sonst würde man diesen Mist gar nicht durchstehen.