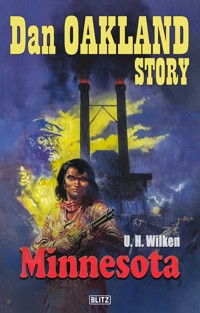3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Dan-Oakland-Story
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Dan Oakland gerät als junger Mann in die Fänge einer politischen Intrige, deren Ziel die Vertreibung der Indianer aus ihren angestammten Gebieten ist.Ein düsteres Kapitel der amerikanischen Geschichte wird in dieser mitreißend erzählten historischen Wildwestsaga beschrieben. Verfasst von einem der bedeutendsten deutschen Wildwest-Autoren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 292
Ähnliche
Dan Oakland Story
In dieser Reihe bisher erschienen
4301 U. H. Wilken Lockruf der Wildnis
4302 U. H. Wilken Teufelsbrigade
4303 U. H. Wilken Die Feuertaufe
4304 U. H. Wilken Der weiße Büffel
U. H. Wilken
Lockruf der Wildnis
Der Text wurde anhand der Originalmanuskripte des Autors sorgfältig überarbeitetet und um bisher unveröffentlichte Textpassagen ergänzt. Der Abdruck erfolgt mit ausdrücklicher Genehmigung von Detlef Wilken.
Diese Reihe erscheint in der gedruckten Variante als limitierte und exklusive Sammler-Edition!Erhältlich nur beim BLITZ-Verlag in einer automatischen Belieferung ohne Versandkosten und einem Serien-Subskriptionsrabatt.Infos unter: www.BLITZ-Verlag.de© 2021 BLITZ-Verlag, Hurster Straße 2a, 51570 WindeckRedaktion: Jörg KaegelmannTitelbild: Rudolf Sieber-LonatiUmschlaggestaltung: Mario HeyerVignette: Wiktoria Matynia/123RF.comSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-080-2Dieser Roman ist als Taschenbuch in unserem Shop erhältlich!
Lockruf der Wildnis
1.
Jim Madley ritt im leichten Trab. Die Zweige tief hängender Äste streiften immer wieder seine Schultern. Der Pfad wand sich sanft durch die Flussniederung.
Plötzlich krachten Kentucky Rifles.
Jim Madley wurde aus dem Sattel gerissen. Er stürzte kopfüber in die Sträucher und rührte sich nicht mehr.
Das Pferd wieherte schrill. Es bäumte sich auf. Dann schlug sein schwerer Körper auf den Pfad.
Aus dem Unterholz brachen Männer hervor.
Daniel Oakland verharrte wie gelähmt neben dem mondhellen Trail am Ufer des Flusses.
Doch dann kam Bewegung in seine schlanke, sehnige Gestalt. Geduckt hetzte er durch die Büsche, nutzte dabei jede Deckung.
Die Männer, die eben den Leichnam des Siedlers Jim Madley aus dem Gestrüpp zerrten, bemerkten Daniel Oakland nicht. Sie hatten genug damit zu tun, die Kleidung des Ermordeten zu durchwühlen.
„Hölle, er hat keinen Brief bei sich!“
„Seht doch mal in den Satteltaschen seines Gaules nach, ihr Schwachköpfe!“
Fluchend grapschten sie in den Taschen. Ohne Erfolg.
„Weg von hier! Lasst ihn liegen!“ Heisere Stimmen entfernten sich im nebligen Dunst am Fluss.
Daniel Oakland erreichte das verendete Pferd, sah daneben die Leiche von Jim Madley, sein von Schüssen entstelltes Gesicht.
Seine grauen Augen flackerten. Entsetzen und Grimm über das Verbrechen spiegelten sich in ihnen.
Er zog die Hawken Rifle des Siedlers aus dem Scabbard und folgte den Mördern.
Vor ihm brach das Geäst, keuchten Männer und stampften Pferde. Er rannte auf die Lichtung und sah, wie sieben Reiter davonjagten. Ohne zu zögern, nahm er die Verfolgung auf, blieb den Reitern auf den Fersen und lief sich dabei fast die Lunge aus dem Leib. Taumelnd fiel er gegen einen Baum.
Die Reiter näherten sich in einem großen Bogen der Siedlung. Lichtschein drang gelb und anheimelnd durch die Nacht.
Schwankend ging Daniel Oakland zurück, stand dann neben dem Toten und atmete rasselnd ein.
„Arme Mrs. Madley.“
Er löste den Sattel, nahm die Decke vom Pferd und hüllte darin den Siedler ein. Behutsam legte er sich den Leichnam über die Schultern.
In den Blockhütten der Siedlung war es schon dunkel. Nur in der Taverne flackerten noch die Talglichter, hockten Männer beisammen, tranken Brandy und schwatzten. Sieben Pferde standen angeleint neben dem Eingang.
Mit dem Toten auf den Schultern blieb Daniel Oakland am Fenster der Taverne stehen und blickte hinein. Mehr als sieben Männer machten die Nacht zum Tag.
Joan Madley war nicht eigentlich hübsch zu nennen. Immerhin hatte ihr das harte Leben an der Seite eines Siedlers noch nicht die durchaus passable Figur zu nehmen vermocht.
Als sie nun Daniel Oakland in der Wohnküche der Blockhütte gegenübersaß, drückte ihr Lächeln sowohl Verwunderung als auch Freude aus. Joan mochte diesen Daniel Oakland, von dem sie nur wusste, dass er in der zweiten Generation Pelztierjägern entstammte. Die Mutter war bei der Geburt gestorben, der Vater hatte den Kampf mit einem Grizzly nicht überlebt.
„Ma’am“, Daniel Oakland hatte den Kopf in die Hände gestützt, „es ist etwas Schreckliches geschehen ...“
Jäh veränderte sich der Gesichtsausdruck der Frau. Sie wurde leichenblass. „Jim – ist etwas mit Jim?“
Ihre festen Brüste unter dem derben Kattunkleid hoben und senkten sich in erregten Atemzügen.
Daniel Oakland konnte nicht länger mit seinem Wissen hinter dem Berg halten.
„Ma’am, er ist tot! Hören Sie, er ist tot!“, sagte er gequält. „Ich – ich hab ihn mitgebracht.“
Joan Madley saß wie versteinert im trüben Lichtschein. Die blauen Augen weiteten sich. Kein Schrei kam über die Lippen. Sie strich sich geistesabwesend über ihr mittelblondes Haar. Sie blickte Dan Oakland ausdruckslos an, betrachtete seine einfache Kleidung, das braun gebrannte Gesicht, das aschblonde Haar.
„Jim ist tot?“, fragte sie tonlos.
Er nickte bedrückt.
„Wenn ich ein Pferd gehabt hätte, dann wär das vielleicht nicht so gekommen, Ma’am.“
„Ja, natürlich“, flüsterte sie. Sie zitterte. „Aber Sie haben ja kein Pferd, Daniel ... Jim ist tot? Nein, ich glaub es nicht ... Es kann nicht sein. Jim hat immer für die unterdrückten Menschen gekämpft. Das kann doch nicht so schrecklich bestraft werden!“
Ihr Oberkörper pendelte plötzlich kraftlos hin und her. Dan sprang auf und stützte sie.
„Es waren sieben Mann, Ma’am. Sie haben Jim am Fluss aufgelauert. Der mutigste Mann hätte keine Chance gehabt. Es war heimtückischer Mord. Sie haben seine Taschen durchsucht – sie suchten wohl nach einem Brief ...“
Sie krampfte die Hände um seinen Unterarm und zitterte heftig, stöhnte auf und wurde immer blasser. Ohnmächtig rutschte sie in seine Arme. Er trug sie zum Schlaflager, bettete sie darauf und hastete in die Wohnküche zurück, um Wasser zu holen.
Dann saß er auf der Bettkante und kühlte ihr bleiches Gesicht.
Joan Madley kam zu sich, richtete den Oberkörper auf und wehrte schwach seine helfende Hand ab.
„Ich bin wieder in Ordnung“, hauchte sie. „Wo ist Jim jetzt?“
Er hatte diese Frage erwartet und er wollte nicht, dass sie den blutüberströmten Leichnam zu Gesicht bekam.
„Ich bin gleich zurück, Mrs. Madley ...“
Dan sah den Mann nicht, der neben der Taverne im tiefen Schlagschatten verharrte. Er trug Jims Leichnam auf den kleinen Friedhof der Siedlung.
Geduckt folgte der Mann ihm und beobachtete, wie er das Grab aushob.
In den Baumkronen raunte der Wind. Nebelschwaden zogen über die Felder, wehten über die Palisaden und hüllten die Kreuze und Grabsteine ein.
Im Blockhaus hielt es Joan Madley indessen nicht länger. Langsam trat sie ins Freie. Wie von einer fremden Hand geleitet, ging sie zur Taverne. Sie suchte Daniel Oakland und schritt langsam durch die trübe Lichtbahn, sah die sieben Pferde am Holm nicht, öffnete die Tür und starrte in den verräucherten Gastraum.
Die Männer verstummten.
Sie alle sahen das aschgraue Gesicht der Frau, die hängenden Schultern und das wirre Haar.
Joan Madley ging mit schleppenden Schritten durch den Raum. Sie blieb im Schein der blakenden Talglichter stehen.
„Jim ist tot.“ Joans fast gemurmelte Worte brachen die lastende Stille. „An den Brief wollten sie ran – diese Narren! Dabei liegt er noch in der Truhe. Jim hatte noch nicht endgültig entschieden, wann er ihn absenden wollte ... Sieben Männer waren es – Daniel Oakland hat sie beobachtet ...“
Joan Madley ahnte nicht, dass sie mit den Mördern ihres Mannes unter einem Dach war. Mit flachen Schritten ging sie zur Tür zurück. Dort drehte sie sich um und blickte die Anwesenden an.
„Jim hat auch für eure Ehre gekämpft“, sagte sie leise, „für die Ehre aller guten Weißen. Ich werde den Brief wegbringen. Der Präsident muss erfahren, was hier in Georgia mit den Indianern geschieht! Auf eine Frau wird doch wohl niemand schießen!“
Tränen rannen über ihr vergrämtes Gesicht. Sie war erst dreißig Jahre alt, doch in dieser Nacht sah sie aus wie eine alte Frau.
Sie ging hinaus, ließ die Tür offen, wankte durch die Siedlung in ihr Haus. Reiter zogen am Blockhaus vorbei.
Dan Oakland schaufelte das Grab zu, blickte auf und sah noch die Umrisse der Reiter.
Er ließ die Schaufel fallen und rannte vom kleinen Friedhof. Am Tor blieb er stehen und hörte nur mehr den Hufschlag. Ohne Pferd konnte er ihnen nicht folgen.
Er hastete zurück zum Blockhaus, blickte zur Taverne hinüber und sah, dass noch ein Sattelpferd vor dem Haus stand. Gerade fiel die Tür zu.
Im Stall hob Dan die Hawken Rifle des Toten auf. Er hörte, wie Mrs. Madley im Haus weinte, und eisige Kälte überkam ihn. Er beherrschte sich, ging aus dem Stall und näherte sich der Taverne.
Sechs Pferde waren mit ihren Reitern verschwunden.
Stimmengemurmel drang durch die Wände. Er dachte an das Leid der Frau und stapfte zur Tür.
Dan konnte nicht wissen, dass er in eine hoch politische Sache hineingeraten war: Es ging um die Ausrottung der Creek-Indianer, um Land für die Siedler und um Macht in Georgia! Als er in die Taverne gehen wollte, wurde die Tür aufgestoßen – er prallte mit dem Mann zusammen, der ihn beobachtet hatte.
Sie starrten sich an. Jeder wusste, wer der andere war.
„Langsam“, murmelte Dan Oakland, „nicht so hastig, Mann. Deine Partner sind schon weggeritten. Dich hab ich doch schon öfter in der Siedlung gesehen. Du hast hier rumgeschnüffelt, wie?“
Groß und breitschultrig stand Dan in der Tür.
Die dunklen Augen des Mannes flackerten. „Geh zur Seite!“, fauchte er. „Lass mich durch!“
Über Dans Gesicht huschte ein düsteres Lächeln. „Nein. Wenigstens dich Halunken hab ich! So schnell entwischst du mir nicht. Ich weiß, dass du dabei gewesen bist. Hast du es schon vergessen?“
Kalt blickte er den Mann an, betrachtete das knochige Gesicht, versperrte ihm den Weg nach draußen.
Die Männer in der Taverne griffen nicht ein. Sie beobachteten nur. Es waren Siedler, denen es gleichgültig war, was aus den Creek-Indianern wurde. Sie würden auch für Dan Oakland keinen Finger rühren.
Von einer Sekunde zur anderen handelte der junge Dan, packte zu und entriss dem Mann die Kentucky Rifle.
Aufbrüllend warf der Bandit sich gegen Dan und versuchte, ihn von den Beinen zu reißen.
Dan schlug mit der Hawken wie mit einem Knüppel zu. Der Hieb fegte den Mann in den Raum zurück. Er stürzte zwischen die Tische. Hart schloss Dan die Tür und stapfte dann in die Mitte des Raumes.
Stöhnend richtete der Gegner sich auf, stand neben zwei Siedlern und blickte Dan hasserfüllt an. „Das wirst du bereuen, Dreckskerl!“
„Halt’s Maul.“ Oakland hielt die Hawken gesenkt. „Hört zu, Männer. Dieser Kerl hat mit sechs anderen auf Jim Madley geschossen. Sie wussten nicht, dass Madley den Brief gar nicht bei sich hatte. Ja, Jim Madley ist tot. Und jetzt frage ich euch – kennt ihr diesen Kerl hier?“
Weder die Gäste noch der Besitzer der Taverne antworteten. Keiner wollte sich in Gefahr bringen. Jeder wusste, dass ihn eine grausame Rache treffen würde, wenn er jetzt den Mund aufmachte. Dan nickte bitter.
„Ich bewundere euren Mut, Männer. Eure Frauen können zu euch aufblicken.“
„Verschwinde hier“, krächzte der Besitzer. „Das alles hier ist allein unsere Sache.“
Dan warf die Kentucky Rifle angeekelt zu Boden.
„Eure Sache? Und was wird aus Mrs. Madley? Ich weiß schon – keiner von euch wird der armen Frau helfen. Ihr alle habt mächtig Angst vor den Komplizen dieses Halunken. Darum wird keiner von euch der Frau beistehen. Aber ihr werdet euch noch wundern, verlasst euch drauf!“
Grimmig blickte er umher, dann wandte er sich wieder dem Gegner zu.
„Ich sollte dich so zusammenhauen, dass du in keinen Sarg mehr reinpasst, Halunke! Glaubst du etwa, ich würde das nicht tun, he? Euch Dreckskerle hab ich gefressen! Das am Fluss war ein heimtückischer Hinterhalt – sieben gegen einen. So schlimm zugerichtet hab ich selten ’nen Mann gesehen.“
„Ich weiß nicht, wovon du sprichst!“, fauchte der Halunke.
Dan beherrschte sich. Er durfte den Gefühlen nicht nachgeben. „Ich rede vom Tod, Mann. Du kannst jetzt abhauen, aber ohne Pferd. Gnade euch Gott, wenn ihr Mrs. Madley etwas antut!“
Er ging langsam durch den Raum und näherte sich der Theke. Die Waffe des Halunken lag neben der Tür.
Dan hielt den Mann für unbewaffnet. Er kehrte ihm den Rücken und sah nicht, wie der Halunke einem der Siedler am Tisch die Waffe entriss. Schon zielte der Halunke auf Dans Rücken.
Keiner der Anwesenden warnte Oakland.
Doch in dieser Sekunde hörten Dan und alle anderen den schrillen Aufschrei einer Frau draußen am Fenster.
Dan handelte unheimlich schnell, ließ sich fallen – und das Bleistück bohrte sich in die Theke.
Mit katzenhafter Geschmeidigkeit wirbelte Dan herum, riss die Hawken hoch und feuerte.
Der Halunke bekam die Kugel in die Brust, wurde zurückgestoßen und krachte mit dem Rücken auf den Tisch. Leblos blieb er darauf liegen. Die Arme hingen über die Tischkante. Ausgelaufener Brandy tropfte zu Boden. Bleich hockten die Männer im Raum. Beißender Pulverrauch breitete sich aus. Am Fenster stand noch immer Joan Madley.
Langsam richtete Dan sich auf. Seine Augen blickten kalt.
„Das war’s wohl“, sagte er, ging zur Tür und verließ die Taverne.
Siedler hasteten von ihren Blockhütten heran und drängten in die Taverne. In mancher Hütte schrien die aus dem Schlaf gerissenen kleinen Kinder.
Oakland löste den Zügel vom Holm und nahm das Pferd des Toten. Vor Joan Madley blieb er stehen. Die Gesichtsmuskeln entspannten sich. „Danke, Ma’am“, sprach er weich, „das war wirklich in letzter Sekunde.“
Er nahm ihren Arm, und beide entfernten sich. Joan Madley blieb draußen stehen, als er das Pferd in den Stall brachte. Dann gingen beide auf den kleinen Friedhof.
Die Frau kniete am Grab nieder.
Dan hörte sie beten. Stimmen tönten herüber. Die Nebel formten sich zu gespenstischen Gestalten.
Behutsam zog er die Frau hoch und stützte sie.
„Ich will weiter nach Westen, Ma’am. Wollen Sie nicht mitkommen? Das wäre besser für Sie, denke ich.“
„Nein, Daniel“, entgegnete sie leise und blickte auf das Grab. „Ich bleibe hier bei Jim. Und wenn ich die Kraft habe, dann bringe ich seinen Brief weg. Ich will für Jim weiterkämpfen.“
„Sie sind eine großartige Frau, Mrs. Madley – aber allein schaffen Sie das nie. Ich hab viel Zeit – ich bleib bei Ihnen, wenn Sie wollen.“
Langsam gingen beide vom Friedhof. Männer trugen den Toten aus der Taverne.
„Sloan hieß er“, hörte Dan einen der Männer sagen. „Sloan, das weiß ich genau.“
Er geleitete die Frau in das Haus. Erschöpft setzte sie sich an den Tisch. Der Weinkrampf war vorbei. Sie fühlte nichts als gähnende Leere in sich.
„Es wird immer wieder Tag“, flüsterte sie vor sich hin. „Das hat Jim oft gesagt, immer dann, wenn wir nicht ein und aus wussten, wenn wir glaubten, es ginge nicht weiter.“
„Erzählen Sie mir von ihm, Ma’am. Ich kann nicht lesen und nicht schreiben. Was steht in diesem Brief? Ist er wirklich so wichtig?“
„Ja, Daniel. Viele Tausend Creek wurden bereits aus Georgia vertrieben. Tausende starben auf dem langen Marsch nach Westen. Jetzt sollen die letzten Creek über den Mississippi gedrängt werden. Auch die Cherokee-Indianer werden bedroht. – Jim hatte herausgefunden, dass der vom Präsidenten eingesetzte Indianerkommissar die große Vertreibung vorbereitet. Slaughnessy will mit Gewalt vorgehen, denn in Georgia warten Tausende von Siedlern darauf, dass das Land der Indianer frei wird.“
„Aber jenseits des Mississippi leben doch andere Indianerstämme?“
„Die sollen weiter nach Westen ziehen und den Creek und Cherokee Platz machen.“
Dan nahm den Brief und blickte auf die Anschrift.
„Er ist an Präsident Andrew Jackson gerichtet, Daniel.“
In Dans Gesicht arbeitete es. Er hatte schon manches über Jackson gehört. Viele hielten ihn für einen rechtschaffenen Mann, andere verurteilten ihn als einen Indianerhasser.
„Jim hat an Jackson geglaubt, Daniel. Sagen Sie, Daniel – ist er ein guter Präsident?“
„Das weiß ich nicht, Ma’am.“
Sie seufzte. „Jim deckt in seinem Schreiben die Machenschaften des Indianerkommissars Slaughnessy auf. Ich glaube, darum musste er sterben.“
„Mrs. Madley.“ Dan beugte sich vor und blickte sie ernst an. „Das würde bedeuten, dass Slaughnessy die Halunken auf Ihren Mann gehetzt hat!“
„Ja – und ich zweifle nicht daran, Daniel.“
„Gerechter! Dann haben wir einen sehr mächtigen Feind, Ma’am!“
„Wir? Oh Daniel, Sie sollten Georgia verlassen! Mir wird nichts geschehen – aber Ihnen droht Gefahr! Sie kennen Jims Mörder!“
„Ich lasse Sie nicht im Stich, Ma’am.“
Sehnsucht nach dem Westen erfüllte ihn, doch Dan blieb. So vergingen zwei Tage. Jedes Mal, wenn er Joan Madley in ihrem Blockhaus aufsuchte, unterbrach sie ihre Arbeit.
„Was tun Sie da, Ma’am?“
„Ich hab für Jim immer viel geschneidert, Daniel. Ich muss was tun. Darum mache ich für Sie eine Jacke und eine Hose. Das ist bestes Leder. Jim hatte es von einem Trapper.“
Er war verlegen und wollte nicht, dass sie sich die Hände wund stach, doch sie ließ sich nicht von der Arbeit abbringen.
An diesem Abend konnte er die Hose aus weichem Leder und die Jacke mit den Fransen anprobieren.
„Darin sehen Sie wie ein Trapper aus, Daniel!“
„Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Ma’am.“
„Sagen Sie nichts, Daniel. Ich sehe es Ihnen doch an, wie sehr Sie sich darüber freuen ...“
„Oh ja, Mrs. Madley.“
Er ging hinaus und schlenderte durch die Siedlung. Die Dämmerung brach herein. Er sah nicht, wie zwei Reiter kamen. Es waren Fremde, die vor Tagen in der Taverne gesessen hatten. Sie verhielten hinter Joan Madleys Haus.
Langsam stiegen sie von den Pferden, hielten Kentucky Rifles und starrten auf den Lichtschein, der aus den Hütten fiel. Beide sprachen kein Wort miteinander. Sie kannten ihr Ziel und ihren Auftrag, und sie waren entschlossen, Gewalt anzuwenden, wenn es sein musste.
Niemand hatte sie bemerkt. Die meisten Siedler waren nach der schweren Arbeit auf den Feldern erschöpft. Nur ein paar Männer saßen in der Taverne. Frauen holten ihre Kinder in die Hütten. In der Siedlung roch es nach Bohnensuppe und Speck.
Die beiden Männer glitten an Joan Madleys Haus heran und verbargen sich im Schatten. Sie horchten und grinsten plötzlich. Lautlos schlichen sie zur Tür, spähten lauernd umher und ließen zwei Siedler vorbei, die mit geschulterten Hacken von den Feldern zurückkamen.
Dan Oakland war indes auf dem Rückweg zum Blockhaus.
Die beiden Männer rissen die Tür auf und drangen blitzschnell in das Blockhaus ein, schlossen die Tür und starrten Joan Madley durchdringend an. Sie hielten die Rifles auf die Frau gerichtet.
Sie stand starr am Herd.
„Wo ist der Brief?“, wollte einer der bärtigen Männer wissen. „Heraus damit! Vorwärts, beweg dich!“
Er kam auf Joan Madley zu, packte ihren Arm und schüttelte sie wild und brutal.
Sie wollte aufschreien, um Hilfe rufen, doch schon presste der Fremde die Hand auf ihren Mund.
„Du stirbst, wenn du uns den Brief nicht gibst!“, fauchte der Mann.
Sie stöhnte dumpf und bekam kaum Luft. Der andere Fremde begann zu suchen. Er polterte durch das Haus. Im Schlafraum wühlte er unter den Decken, fluchte und zerfetzte das Bettzeug. Joan Madley hatte diese Männer bereits in der Taverne gesehen, doch sie erkannte sie nicht wieder. Nebenan im Pferdestall stampfte das Reittier des Toten.
Dan Oakland kam heran und entdeckte die beiden Sattelpferde. Geduckt glitt er in den Stall und horchte. In diesem Moment hörte er einen erstickten Aufschrei im Haus, dann einen wilden Fluch. Ein Hocker kippte um.
Verzweifelt wehrte Joan Madley sich gegen die brutalen Hände des Mannes.
Einen Herzschlag lang stand Dan völlig still – dann hastete er aus dem kleinen Stall nach vorn, hielt Madleys Hawken Rifle und öffnete die Tür. Ein bärtiger Mann hielt Joan gepackt und schlug sie immer wieder mit der flachen Hand. Dan stürmte wutentbrannt auf Joans Peiniger los. Der Mann ließ sie los und griff zur Kentucky Rifle, die er auf den Tisch geworfen hatte.
Joan taumelte gegen die Wand und rang nach Luft. Entsetzt blickte sie auf den Fremden, der sein Gewehr hochriss und auf Dan Oakland anlegte.
Doch schon wuchtete Dan die Hawken auf die Arme des Halunken und das Gewehr prallte auf den Tisch.
Dan drehte sich, holte aus und drosch den Kolben mitten in ein verzerrtes Gesicht. Wie von einem Pferdehuf getroffen stürzte der Bandit gegen die Wand und brach zusammen.
„Daniel!“ Joans Warnung kam gerade noch rechtzeitig.
In der Tür zum Schlafraum war der andere Halunke aufgetaucht.
Diesmal hatte Dan keine Zeit, den Gegner nur kampfunfähig zu machen – er musste schießen. Die Hawken Rifle peitschte das Blei mitten in das Herz des Gegners.
Der Mann war auf der Stelle tot, kippte nach vorn und fiel schwer auf die Kentucky-Büchse.
Sofort löschte Dan das Licht. Der Wind bewegte die Tür. Pulverdampf zog hinaus. Bleich fiel der Mondschein über die Türschwelle. Draußen schrien mehrere Siedler durcheinander und hasteten näher, doch niemand wagte sich in das Haus. Keuchend drehte Dan sich um und ging zu Joan.
Am ganzen Körper bebend, sank sie in seine starken Arme. Er trug sie nach nebenan und legte sie auf ihr Bett.
„Beruhigen Sie sich, Ma’am“, ächzte er, „es ist vorbei. Wir haben noch mal Glück gehabt. – Ja, weinen Sie nur, Ma’am, das ist gut so. Hölle, diese Mistkerle hätten Sie glattweg umgebracht.“
Er stand über sie gebeugt und strich das Haar aus ihrem Gesicht. Im Schlafraum war es fast dunkel. Durch das kleine Fensterloch sickerte Sternenlicht und drang durch die alte Gardine. Draußen riefen die Siedler durcheinander, rotteten sich vor dem Blockhaus zusammen und rochen das verbrannte Pulver.
Der Lärm vor dem Haus übertönte das Stöhnen des Halunken nebenan, der zu sich gekommen war.
Er kroch über den Boden und zog sich am Tisch hoch. Blut sickerte aus dem zerschlagenen Gesicht. Ruckartig bewegte er die Beine, schleppte sich zur Tür und taumelte über die Schwelle.
Erschrocken wichen die Siedler zurück, sahen das blutverschmierte Gesicht, hörten den pfeifenden Atem und wagten nicht, den Fremden aufzuhalten. Er schwankte um das Blockhaus und fiel gegen sein Pferd, zog sich mühsam in den Sattel und ritt an. Das Pferd fiel in einen schwerfälligen Trab.
Im Haus polterten Schritte. Dan Oakland erschien in der Tür und sah, wie der Halunke durch das Tor ritt.
Er hatte die Hawken bereits wieder geladen, konnte schießen – doch er tat es nicht.
Langsam nahm er die Hawken herunter, rieb sich das schweißfeuchte, braun gebrannte Gesicht und blickte die Siedler verächtlich an. Wortlos ging er in das Haus zurück, zog den Toten ins Freie und schloss die Tür.
Dann saß er auf der Bettkante. Ein Talglicht flackerte und warf den unruhigen Schein auf die Frau.
„Sie wollten den Brief!“, stöhnte Joan Madley.
„Ich werde den Brief nehmen, Ma’am, und Sie kommen mit mir. Sie dürfen hier keinen Tag länger bleiben. – Nein, sagen Sie nichts. Keiner der Siedler wird Sie beschützen und Ihnen helfen. Wir müssen uns nach Nordwesten durchschlagen.“
„Daniel, wohin sollen wir denn gehen?“
„Vielleicht nach St. Louis. – Ja, Ma’am, das ist ein beschwerlicher Trail, doch sind die Creek-Indianer nicht viel weiter gezogen?“
Trauriges Lächeln legte sich um ihren Mund. Die brutalen Schläge des Halunken hatten Spuren hinterlassen. Sie schwieg, sah ihn seltsam melancholisch an und griff dann nach seinen großen kräftigen Händen.
Beide blickten einander stumm an.
Da war der junge Dan Oakland, der zu kämpfen begonnen hatte, und da war Joan Madley, die nicht aufgeben wollte. Das Einzige, was beide voneinander unterschied, war das Alter – nur ein paar Jahre.
„Es wird immer wieder Tag, Daniel.“
„Ja, Ma’am ...“
Sie richtete sich auf. „Ja, ich will mit Ihnen gehen, Daniel.“
„Das ist großartig, Mrs. Madley! Wir haben Pferde. Können Sie reiten?“
„Ich werde es versuchen, Daniel.“
„Gut, Ma’am, dann pack ich jetzt alles zusammen. Es ist besser, wenn wir noch heute Nacht aufbrechen.“
Er ging hinaus, zog das Pferd des toten Halunken in den Stall und stand still. Viele Gedanken beschäftigten ihn. Ihr Ritt würde einer Flucht gleichkommen. Er fühlte sich für das Leben der Frau verantwortlich. Sie musste Georgia verlassen.
Nur allmählich verschwanden die Siedler und suchten ihre Heimstätten und auch die Taverne auf.
Dan ging in das Haus zurück und half der Frau.
In Georgia gab es schon Gesetze, doch kaum jemand hielt sich daran. Die Starken brauchten kein Gesetz, um ihren Willen mit Terror und Gewalt durchzusetzen. Den Schwachen blieb der Schutz des Gesetzes verwehrt.
In dieser Nacht verließ Joan Madley für immer ihr Heim. An Dan Oaklands Seite ritt sie langsam aus der Siedlung. Ein letztes Mal sah sie das Grab ihres Mannes. Sie hob die Hand zum letzten Gruß. Sie biss sich die Lippen blutig. Nur einem einzigen Menschen vertraute sie jetzt noch: Dan Oakland.
2.
Zaumzeug rasselte durch die Morgenstille. Die Nebel wehten in Fetzen über die Äcker. Schwarze Raben flatterten heiser krächzend über den Fluss.
Die Männer ritten durch das Tor und schwärmten sofort aus, warfen sich von den Pferden und umstellten das Blockhaus.
Gewehre waren mit Pulver und Blei gefüllt. Der Tod wartete in den schweren Läufen. Sie stürmten das Blockhaus – ohne Erfolg. Fluchend kamen sie wieder heraus und versammelten sich vor der Taverne – schießwütige Männer, die vor nichts zurückschreckten. Und das Gesetz stand auf ihrer Seite!
Aus den Hütten traten die Siedler.
Dann kamen drei weitere Männer durch das Tor geritten und hielten vor der Taverne.
Der Mann, der von zwei schwer bewaffneten Reitern flankiert wurde, trug einen Anzug aus Seide und machte einen sehr vornehmen Eindruck.
Er war blass, wohl weil er nicht oft der Sonne ausgesetzt war, und hatte tief liegende dunkle Augen.
„Die Frau und dieser Hundesohn sind verschwunden, Sir!“, meldete einer der Männer, die das Blockhaus durchsucht hatten.
Der blassgesichtige Mann nickte scheinbar gleichgültig. Er gab dem Reiter neben sich einen herrischen Wink. Daraufhin rief der mit lauter und hohl klingender Stimme durch die Siedlung, und alle kamen – Männer, Frauen und Kinder.
„Hört, Leute, hört! Mister Jonathan Slaughnessy, Kommissar für Indianische Angelegenheiten, Mann des Gesetzes in Georgia, Hüter von Ordnung und Recht, hat euch was zu sagen! Mister Slaughnessy ist für alle eure Sorgen zuständig, er verwaltet das Land. Seid still und hört zu, Leute!“
Das Pferd unter Slaughnessy stampfte. Tiefes Schweigen herrschte innerhalb der Palisaden. Der Kommissar erhöhte die Spannung, indem er noch eine ganze Minute lang schwieg und jeden der versammelten Siedler betrachtete. Sie alle erwarteten ruhige Worte und zuckten zusammen, als er jäh mit heller Stimme schrie: „Es lebe der Präsident!“
Gebieterisch streckte er die Rechte aus und machte eine Bewegung, als wolle er alle segnen.
„Das Land gehört uns Weißen!“, rief er. „Uns allein! Die letzten Creek werden davongejagt! Heute ist ein glorreicher Tag, meine Freunde! Alle Cherokee müssen das Land verlassen! Der Cherokee-Führer Ridge hat einen Vertrag unterschrieben. Danach haben die Indianer sich sofort in Marsch zu setzen. Die Cherokee bekommen über fünf Millionen Dollar für das Land. Das ist eine großzügige Geste unseres Präsidenten! Jeder Cherokee oder Creek, der noch angetroffen wird, wird mit Gewalt nach Westen gejagt. Notfalls werden wir den Schießbefehl erteilen. In diesen Tagen werden über 15.000 Cherokee aufbrechen.“
Er zog ein seidenes Tuch hervor und betupfte damit seine Lippen. Niemand wagte, ihn anzusprechen.
„Meine lieben Freunde“, rief er, „das Land gehört euch! Besiedelt das Cherokee- und Creek-Land! Baut eure Häuser, bestellt die Felder, die die Cherokee verlassen haben!“
Lauter Jubel brach los.
Slaughnessy gebot Ruhe.
„Ihr alle habt das heilige Recht und die Pflicht, jeden zu bekämpfen, der gegen diesen großartigen Vertrag ist! Kämpft, meine Freunde! Helft uns, mit solchen schäbigen Verrätern an unserer Rasse fertig zu werden, wie dieser Jim Madley einer gewesen ist!“
Er sprach es offen aus – und niemand wurde nachdenklich, niemand dachte an Terror und Gewalt – alle jubelten und strahlten, klatschten Beifall oder johlten begeistert.
Jonathan Slaughnessy lächelte zufrieden.
Langsam zog er das Pferd herum und saß ab, betrat die Taverne und ließ sich wie ein König bedienen. Seine Vertrauten saßen bei ihm. Er ließ nach einem der Männer rufen, die draußen neben den Pferden warteten.
Der Mann kam herein. Slaughnessy betrachtete den langen dürren Mann, der ein knochiges, eingefallenes Gesicht hatte, ein Totengesicht, das abergläubische Menschen in Furcht versetzen musste.
„Sie sind Victor Carson?“
„Ja, Sir. Ich stehe in Ihren Diensten.“
„Das weiß ich, mein Lieber. Ich habe schon vieles über Sie gehört. Sie haben schon gegen die Creek gekämpft. Sie sind dabei gewesen, als die Creek das Land verlassen mussten, stimmt das?“
„Ja, Sir.“
„Sehr gut, Carson. Auf Sie ist Verlass. Sie bekommen von mir alle Befugnisse, die Sie brauchen. Ich will, dass Madleys Brief Washington nicht erreicht. Nicht, weil Präsident Jackson etwa nicht wüsste, dass wir hier in Georgia reinen Tisch machen. Nein, ich will nicht, dass der Präsident belästigt wird. Jagen Sie den Mann, Carson!“
Das Totengesicht blieb unbewegt. „Zu Befehl, Sir.“
„Dieser Oakland – so heißt er doch wohl? – ist mit Madleys Frau unterwegs. Sollte die Frau Schwierigkeiten machen, Carson, dann ...“ Er sprach nicht weiter.
„Ja, Sir“, antwortete Carson monoton.
„Gut. Machen Sie sich mit Ihren Männern auf den Weg. Kümmern Sie sich auch um die Creek und Cherokee, Carson. Jeder Widerstand ist zu brechen!“
„Ja, Sir!“
„Ich werde mich persönlich darum kümmern und den Abzug der Indianer überwachen. – Wir sehen uns bestimmt wieder.“
Carson grüßte. Mit unbewegtem Gesicht verließ er die Taverne.
Dan Oakland und die tapfere Frau ritten nordwärts.
Sie kamen an Sumpfgebieten vorbei, an großen Feldern und Siedlungen. Bald hatten sie das von Weißen besiedelte Gebiet verlassen und zogen durch Indianerland.
Joan Madley konnte bald nicht mehr weiter. Erschöpft rutschte sie vom Pferd. Dan schlug ein kleines Lager auf und kümmerte sich um die mutige Frau.
Alte hohe Bäume warfen ihre Schatten auf die beiden Menschen. Hell und warm schien die Sonne. Von ihrem Platz aus konnten sie durch eine Waldschneise blicken.
Auf einmal entdeckten sie viele Hundert Cherokee, die in einer langen Kolonne durch das weite flache Tal zogen.
Feiner Staub wallte über den Schleppschlitten, über den Squaws, die ihre Kinder und ihre Habseligkeiten trugen, über den Männern, die Decken, Feldgeräte und Greise schleppten.
„Diese armen Menschen!“, flüsterte Joan Madley erschüttert. „Gegen das, was nun geschieht, hat Jim immer gekämpft. Mein Gott, er hat nicht wissen können, dass sein Brief den Präsidenten viel zu spät erreichen würde.“
Dan spürte den Brief unter dem Hemd und verzog bitter das Gesicht.
„Sie sollten den Präsidenten vergessen, Ma’am. Der Mann ist kein Heiliger. Er ist nicht gut zu den Indianern. Das, was Sie sehen, ist doch der Beweis.“
„Bitte, Daniel, reden Sie nicht so über unseren Präsidenten. Er ist doch weit weg – er kann in Washington nicht sehen, was hier geschieht!“
„Er muss es wissen, Ma’am“, erwiderte Dan bissig. „Ja, er weiß es genau! Ich sollte diesen Brief zerreißen! Machen Sie sich keine falschen Hoffnungen. Andrew Jackson ist auch nur ein Mensch.“
„Nein, Daniel – nein.“ Versonnen blickte Joan Madley in die Ferne. „Er ist ein großer Mann, der Vater dieser Nation. Er wird Jims Brief lesen und dann anordnen, dass die armen Indianer nicht vertrieben werden dürfen.“
„Hoffentlich haben Sie recht, Ma’am. Ich glaub nicht daran.“
Er legte sich zurück und blickte zu den rauschenden Baumkronen empor. Die Pferde fraßen das Gras der Lichtung. Er dachte an St. Louis, von dem so viele Menschen sprachen, und er hörte die Frau seufzen.
Bis jetzt war alles gut gegangen. Aber Dan ahnte, dass noch Schlimmes geschehen würde.
„Kommen Sie“, sagte er unruhig, „wir müssen weiter. Vielleicht können wir uns den Cherokee anschließen.“
Sie brachen auf.
Steif saß die Frau auf dem Pferd. Dan konnte nicht schnell reiten, er musste Rücksicht auf Joan nehmen.
Immer wieder sah er zurück.
Von Verfolgern war nichts zu bemerken. Dennoch blieb er wachsam und misstrauisch, verwischte, so gut es ging, die Spuren und suchte die Wildpfade auf.
Weit vor Dan und Joan zogen die Indianer nach Nordwesten. Creek und Cherokee waren friedliebende Indianer. Die Vertreibung aus ihrer Heimat hatte sie völlig überraschend getroffen. Sie besaßen kaum Nahrung.
Gegen Abend roch Dan plötzlich Holzrauch.
Er ließ Joan zurück und glitt lautlos durch das Dickicht. Der Wind trieb den schwachen Rauch eines kleinen Lagerfeuers durch das Unterholz. Geduckt schlich Dan näher und entdeckte einen weißbärtigen Mann, der am Feuer hockte und das Fleisch einer Antilope briet. Der Fremde war in brüchiges Leder gekleidet. Das Gesicht war runzlig, ähnelte einer Baumrinde.
„Komm nur näher“, sagte der Mann zu Dans Überraschung, „setze dich an mein Feuer ...“
Dan trat aus dem Unterholz hervor und legte die Hawken in die linke Hand.
Der Trapper blickte ihm aus verkniffenen Augen entgegen und deutete auf einen vom Sturm gefällten Baum.
„Du trägst verdammt neue Sachen, mein Junge. Wenn das Wild deine Kleidung wittert, dann macht es sich davon.“
„Ich bin Daniel Oakland. Ich bin mit einer Frau unterwegs ...“
„Man nennt mich Delaware. Ich weiß nicht, wie ich richtig heiße. Hol die Frau her, mein Junge.“
Dan ging davon. Der Trapper aß und wischte die fetttriefenden Hände an den schmierigen Hosenbeinen ab. Er blickte auf Joan Madley, als hätte er noch niemals eine Frau gesehen.
„Setzt euch endlich!“ Er rülpste und bohrte in der Nase. „Eine richtige weiße Lady. Ich hab schon drei Squaws gehabt. Als sie Kinder kriegten, starben sie. Was soll ein Mann wie ich mit Kindern, nicht wahr?“
Dan schnitt ein Stück Fleisch ab und reichte es aufgespießt der Frau. Er selbst riss sich Fleisch vom Braten und aß es mit bloßen Händen.
„Sind das Cherokee, Delaware, die nach Nordwesten ziehen?“
„Ja. Alle Indsmen werden vertrieben. Wer nicht gehen will, wird erschossen oder erschlagen. Meine Zeit hier ist vorbei. Ich geh über den Strom und nach Westen.“
„Wir haben denselben Weg, Delaware.“
„Das ist ganz gut so. Ich will nicht immer allein sein. Aber irgendwann werden wir uns trennen müssen. Gestern hab ich ein paar Reiter gesehen, die die Indsmen beobachten. Hier braut sich was zusammen. Wenn wir nicht höllisch aufpassen, dann geraten wir mitten in die Sch... hinein. Oh, excuse me, Madam.“
Joan Madley lächelte.
„Mein Mann Jim hat auch nicht gerade mit Engelszungen gesprochen, Mister Delaware ...“
„Fein, fein – und wo ist er jetzt?“
„Tot. Erschossen von Halunken, die offensichtlich für den Indianerkommissar arbeiten ...“
Delaware starrte Dan durchdringend an und verzog das Gesicht.
„Indianerkommissar ist gut, Junge! Dieser Dreckskerl hat nur was für die Siedler übrig. Ich sage das nicht nur, weil die Indianer meine Freunde sind. Jonathan Slaughnessy gehört an den Galgen ...“
„Und wie ist es mit dem Präsidenten?“
„Daniel, ich bitte Sie!“, flüsterte Joan Madley.
„Lassen Sie nur, Ma’am“, brummte Delaware gelassen. „Andrew Jackson denkt nicht im Ernst an die Indianer. Welcher Indianer wählt ihn denn schon, he? Er braucht die Stimmen der Weißen, der Siedler. Mit denen kann er rechnen, wenn er die Indianerstämme vertrieben hat. Creek und Cherokee sollen auf ihrem langen Marsch von privaten Unternehmen mit Proviant versorgt werden. Diese Unternehmer sind Jacksons Freunde – gute alte Bekannte. Sie werden noch etwas erleben, Ma’am – und dann werden Ihnen die Augen aufgehen!“
Die Nacht brach herein. Joan Madley litt unter Albträumen. Um Mitternacht brachen sie auf.
Gnadenlose Männer forschten nach Dan Oakland und der Frau.
Reitertrupps beobachteten den Exodus der Indianer. Siedler strömten in die frei gewordenen Gebiete. Und viele von ihnen folgten den Creek und Cherokee nach Westen.
Auch Banditen. Wie Schakale schlichen sie den Indianern nach.
Seit Tagen und Nächten waren Dan, Joan und Delaware unterwegs. Dan war froh, dass sie dem Trapper begegnet waren. Noch war er nicht erfahren genug – später einmal sollte Dan Oakland einer der berühmtesten Trapper zwischen Mississippi, Missouri und Yellowstone River werden. Und niemals zuvor oder danach sollte ein Mann so viele Freunde unter den Indianern gewinnen und so sehr mit ihnen kämpfen und leiden.
Sein Lebensweg, sein tapferer Kampf für die unterdrückten Stämme, sein ewiges Ringen um Gerechtigkeit und Menschlichkeit sollten Geschichte werden. Noch war er jung, doch schon jetzt zeigten sich seine Verwegenheit, seine Härte und seine Gutmütigkeit.