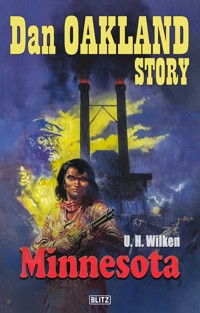3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Dan-Oakland-Story
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Herr der rauen BergeDan Oakland zieht vom Missouri in die Berge, ins Reich der Sioux. Er ist auf dem besten Weg, selbst ein legendärer Mountain Man zu werden.Aufgebot des BösenDan Oakland geleitet einen Siedlertreck durch das Gebiet der Crows und Sioux. Er braucht Glück, um sein Ziel im fernen Westen zu erreichen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 264
Ähnliche
Dan Oakland Story
In dieser Reihe bisher erschienen
4301 U. H. Wilken Lockruf der Wildnis
4302 U. H. Wilken Teufelsbrigade
4303 U. H. Wilken Die Feuertaufe
4304 U. H. Wilken Der weiße Büffel
4305 U. H. Wilken Das Aufgebot des Bösen
4306 U. H. Wilken Grausame Grenze
4307 U. H. Wilken Omaha-Marter
4308 U. H. Wilken Blutige Säbel
U. H. Wilken
Das Aufgebot des Bösen
Der Text wurde anhand der Originalmanuskripte des Autors sorgfältig überarbeitetet und um bisher unveröffentlichte Textpassagen ergänzt. Der Abdruck erfolgt mit ausdrücklicher Genehmigung von Detlef Wilken.
Dieses Buch enthält die Einzelromane:
Der Herr der rauen BergeAufgebot des Bösen
Diese Reihe erscheint als limitierte und exklusive Sammler-Edition!Erhältlich nur beim BLITZ-Verlag in einer automatischen Belieferung ohne Versandkosten und einem Serien-Subskriptionsrabatt.Infos unter: www.BLITZ-Verlag.de© 2021 BLITZ-Verlag, Hurster Straße 2a, 51570 WindeckRedaktion: Alfred WallonTitelbild: Rudolf Sieber-LonatiUmschlaggestaltung: Mario HeyerVignette: Wiktoria Matynia/123RF.comSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-084-0Dieser Roman ist als Taschenbuch in unserem Shop erhältlich!
Der Herr der rauen Berge
1.
„Komm näher, ich will dich töten.“
Der Lauf einer alten Kentucky Rifle zeigte genau auf den Reiter, der ahnungslos auf der anderen Seite der Bergfalte ritt. Es war ein junger Trapper im Lederanzug, der die Schönheit des Sommertages in den Mountains genoss.
Er hieß Dan Oakland.
Der Lauf der Rifle folgte genau den Bewegungen des Reiters. Ein narbiger Finger legte sich langsam auf den Abzug und nahm Druckpunkt.
„Komm näher, ich hab dich genau im Visier.“
Der Finger drückte ab.
Im gleichen Augenblick strauchelte drüben am Berghang das Pferd. Unwillkürlich beugte sich der Reiter vor.
Siedend heiß schrammte ein Stück Blei seine Schulter, fetzte ein Loch in die Lederjacke und vergrub sich in der Rinde eines Baumes.
Peitschend folgte der Knall. Dan Oakland hechtete aus dem Sattel und warf sich hinter einem Felsbrocken in Deckung. Derweil durchrollte das Echo des Knalls das Tal.
Die zweite Kugel aus der Kentucky Rifle fand ihr Ziel. Sie schlug in den Kopf des Pferdes ein und riss den Schädel auseinander. Der Tierkörper bäumte sich auf, überschlug sich und sauste in die Tiefe. Verrenkt und blutüberströmt blieb er in der Bergfalte liegen.
Dan Oakland lag reglos und wartete ab.
Der heimtückische Schütze hatte Zeit, seine Rifle nachzuladen.
Oakland hatte nur ein Jagdmesser und einen Tomahawk bei sich. Er brauchte ein Gewehr, seine Hawken Rifle und die Provianttasche. Sie hingen am Sattel und lagen unten in der Bergfalte.
Oakland musste hinabsteigen.
Er setzte sich vorsichtig kriechend in Bewegung.
Sofort krachte drüben die Büchse wieder. Dan Oakland lag flach, und die beiden Kugeln fegten über ihn hinweg und jaulten als Querschläger in den Bäumen. Abgerissene Blätter fielen auf Dans Rücken.
„Verdammter Hund“, ächzte er, „ich werd dich kriegen ... wer du auch bist ...“
Der Heimtückische musste wieder laden. Dan hob den Kopf und sah in den Abgrund hinunter. Da lag der Pferdekadaver. Dan musste eine freie Fläche ohne jede Deckungsmöglichkeit überqueren und würde unweigerlich abgeschossen werden.
Es musste noch einen anderen Weg geben. Er sah sich um.
Das Echo der beiden Schüsse war in den Tälern und Schluchten zu einem Flüsterton erstorben. Dan musste es wagen. Er schob sich um Bäume und Felsen abwärts, kroch über Luftwurzeln, robbte um Strauchgruppen und nutzte jede Deckung aus.
Drüben am Hang stopfte der skrupellose Schütze Pulver und Blei in den schweren Lauf und stieß mit dem Ladestock nach. Er brachte die feuerbereite Kentucky wieder in Anschlag. Deutlich konnte er das verendete Pferd sehen und den freien Hang überblicken.
Totenstille.
Dan hatte die Sohle der Bergfalte erreicht und spähte durch das Geäst eines dichten Gebüschs dorthin, wo er den Schützen vermutete.
Ein Hauch von Pulverrauch hing noch in dem Strauch, hinter dem der Killer lauern mochte. Dort rührte sich nichts.
Kein Zweig bewegte sich.
Dan biss die Zähne zusammen.
Ohne Pferd konnte er nicht über die Prärie zurück. Das würde einen Fußmarsch von vielen Wochen bedeuten. Wer auch immer den Gaul erschossen hatte – Dan verfluchte ihn.
Nach dem ungeschriebenen Gesetz des Westens hatte Dan Oakland das Recht, jenen Mann über den Haufen zu schießen – ohne Warnung und ohne Pardon, weil er ihn in der Wildnis ohne Chance dem sicheren Tod ausgeliefert hatte.
Dan rechnete sich aus, dass der Schütze jetzt wieder feuerbereit sein musste. Es wäre Wahnsinn, jetzt zu versuchen, das Pferd zu erreichen. Der Killer würde in aller Ruhe zielen und im besten Moment abdrücken können.
Es war noch früh am Tag. Musste Dan die vielen langen Stunden bis zum Abend warten, um mit Einbruch der Dunkelheit den Sprung zu dem Pferd hinüber wagen zu können? Das werde ich nicht schaffen, redete er sich ein. Stunde um Stunde in mörderischer Sonne. Ohne Proviant und Wasser. Das bringt mich um den Verstand.
Dan spannte alle Muskeln und Sehnen an. Er riskierte es.
Mit einem wilden Sprung kam er aus der Deckung heraus, rannte los und schlug dabei Haken wie ein gehetzter Hase.
Brüllend entlud sich die Kentucky Rifle. Die Kugel streifte Dans fransenverzierte Lederhose und riss den Grasboden auf.
Dan stürmte zurück.
Zum zweiten Mal entlud sich das Gewehr des Heckenschützen. Die Kugel ging einen Schritt breit an Dan vorbei.
Jetzt war das Gewehr leergeschossen. Dan setzte zum Endspurt auf das Pferd zu an.
Da bellte ein Schuss aus einer Alston-Reiterpistole. Um Haaresbreite verfehlte ihn die Kugel. Dan warf sich über einen Felsbrocken und blieb liegen. Er musste seinen Plan ändern. Hinter Felsen und Sträuchern kroch er davon.
Weit abseits schob er sich auf dem Bauch aus der Deckung und bewegte sich auf Ellbogen und Knien durch das hohe Gras. Der Halunke, der es auf ihn abgesehen hatte, musste annehmen, dass er nochmals versuchen würde, an das Pferd heranzukommen.
Dadurch erreichte Daniel Oakland unbemerkt den bewaldeten Hang des Berges, auf dem sich der Heckenschütze verbarg.
Lautlos wie ein Schatten glitt Dan von einem Baum zum anderen bergauf. Dem alten Laub in den Senken des Hangs wich er aus, setzte tastend seine Schritte und trat auf keinen einzigen dürren Ast.
Dan war eisern entschlossen, mit dem verdammten Heckenschützen abzurechnen.
Wer konnte das sein? Es musste ein einzelner Mann sein. Es ging das Gerücht, dass sich in diesen Bergen ein Mann aufhielt, der sich Herr der rauen Berge nannte.
Dan mochte nicht glauben, dass dieser Bursche als Heckenschütze sein Reich verteidigen würde.
Es streiften manche dunklen Existenzen durch die Wälder, Verwegene und Verzweifelte. Dan Oakland liebte die Einsamkeit der wilden Berge. Aber es gab auch manchen, der diese Einsamkeit nicht ertrug. Sie machte ihn krank und verwirrte seinen Geist.
Dan kroch vorsichtig höher. Er wollte wissen, was für ein Mensch sich da oben versteckte.
Schräg fielen Sonnenstrahlen durch die Laublücken. Dan blieb im Schatten.
Vielleicht hatten Indianer die Schüsse gehört. Dan musste wachsam sein. Er befand sich im Jagdgebiet der Sioux.
Irgendwo gab es hier auch ein Fort. Das hatte er vor zwei Wochen von einem alten Trapper erfahren, dem er am Fuß des Felsengebirges begegnet war. Seitdem hatte er keinen Menschen mehr gesehen.
Dan hielt an und lauschte. Sein Gegner verriet sich durch kein Geräusch.
Der junge Trapper machte sich auf einen verwegenen Burschen gefasst, der mit allen Wassern gewaschen war.
Auf weichen Lederstiefeln, die hochgeschnürten Mokassins ähnelten, schlich er immer höher. Der weiche Waldboden schluckte seine Schritte.
Verborgen hinter dichtem Unterholz, kniete Dans Gegner. Er legte die Kentucky weg, presste das Ohr auf den Boden und horchte.
Dan kam näher.
Der Gegner packte die Kentucky und griff zum Pulverhorn und lud Rifle und Alston nach. Ihm machte es höllischen Spaß, Menschen wie Tiere zu jagen und abzuschießen. Er war nicht der einzige, der so dachte und handelte. In dieser gottverlassenen Bergwelt nutzte jeder gnadenlos seinen Vorteil aus. Ein Menschenleben zählte nicht mehr als das irgendeines Tieres.
Plötzlich lauschte dieser Mann in eine andere Richtung. Fiebrig flackerten seine Augen.
Wie ein Raubtier huschte er über die abfallende Lichtung und verschwand im Gebüsch.
Irgendwo schrie ein Raubvogel.
Dan horchte angespannt. Der helle Schrei des Goldadlers hallte durch die stille Bergfalte. Hoch oben überflog der Vogel die zerklüfteten Berge.
Dann war es wieder unheimlich still. Nur mehr ein paar Yards.
Der feuchte bemooste Boden nässte Dans Knie und Hände. Er hockte sich hin und zog das Messer, klemmte es zwischen die Zähne und packte den Stiel der kleinen indianischen Streitaxt.
Entschlossen richtete er sich halb auf und schlich um die letzten Bäume. Gestrüpp versperrte ihm den Weg und zwang ihn zu einem Umweg. Aber dann hatte er die kleine Lichtung vor sich, jenen Platz, wo der heimtückische Schütze gelegen hatte. Nirgendwo konnte Dan ihn entdecken. Ringsum unberührte Wildnis im grellen Licht der Sonne.
Lange harrte Dan hinter einem Baum aus, horchte und spähte.
Schließlich wagte er sich hinaus. Auf der Lichtung entdeckte er Spuren. Der Unbekannte hatte beim Laden etwas Pulver verschüttet. Deutlich waren die Eindrücke der Knie zu erkennen. Plötzlich spürte Dan, dass er beobachtet wurde.
Das war ein seltsames Gefühl, ein kalter Schauer, der ihm über den Rücken jagte.
Er wollte sich schon zur Seite werfen und davonhetzen.
Da befahl eine leise Stimme: „Bleib!“ Dan hatte keine Chance. Bestimmt war eine Feuerwaffe auf ihn gerichtet. Mit dem Messer zwischen den Zähnen und dem Tomahawk in der Faust stand er wie erstarrt.
Er hörte Zweige rascheln, leise Schritte hinter sich. Eine Hand berührte seine Schulter, genau dort, wo das Blei die Jacke zerfetzt hatte.
„Lass dein Spielzeug fallen, junger Mann ...“
Die Stimme klang nicht bösartig. Sie verriet nur, dass der Mann keinen Widerspruch duldete und zu allem entschlossen war.
Dan ließ Tomahawk und Messer fallen.
Der Mann nahm die Hand zurück und ging drei Schritte zurück. „Dreh dich jetzt um“, sagte er.
Steif wandte Dan sich ihm zu.
Vor ihm stand ein großer, breitschultriger Mann in alter zerschlissener Lederkleidung. Die Gesichtshaut war braun gebrannt und sah mit unzähligen Falten und Runzeln wie verwittert aus. Langes silbergraues Haar fiel auf die Schultern. In der Rechten hielt der Mann eine Hawken.
„Wer bist du?“, fragte er ruhig und betrachtete Dan mit verletzender Gründlichkeit.
„Daniel Oakland ...“
„Ich wollte nicht deinen Namen wissen.“
„Ich komm aus dem Osten – vom Big Muddy.“
Der Fremde verzog das runzelige Gesicht. Die Hawken zeigte zu Boden. Er war mit Jagdmesser, zwei Pistolen und einer Lederschlinge bewaffnet. Auf dem Rücken hingen eine breite Provianttasche und ein großes Pulverhorn.
„Du hast dich wie ein Dummkopf benommen“, behauptete der Mann. „Wenn du wieder einmal an einen Gegner heranschleichst, tritt nicht mit den Hacken auf. Wozu hast du die Zehen?“
Dan war vielleicht nur ein paarmal mit dem ganzen Fuß aufgetreten. Er war überrascht, dass dieser Fremde es bemerkt hatte.
„Leg dich hin!“, knurrte der Mann. Dan gehorchte.
„Ich werde jetzt unter die Bäume gehen“, erklärte der Fremde, „und dort so herumgehen, wie du das getan hast. Press dein Ohr auf den Boden und horche ...“
Auch das tat Dan. Er hörte dumpfes Pochen im Boden. Als er aufblickte, stand der Fremde wieder neben ihm.
„Du hast es pochen gehört, nicht wahr? Dabei bin ich leise gegangen. Ich bin nur ein paarmal mit den Hacken aufgetreten ...“
Dan richtete sich auf und erkannte, dass dieser Mann nicht auf ihn geschossen und das Pferd getötet hatte.
„Wo ist der andere?“, raunte er.
„Verschwunden. Er hat dich und auch mich kommen gehört.“ Der Mann lächelte rau. „Jetzt weißt du, dass so ein Waldboden sogar den leisesten Schritt aufnimmt und weiterleitet. Denk dran, wenn du wieder mal einen Kerl beschleichst.“
„Danke.“
„Schon gut“, grollte der Fremde. „Ich wollte dir nur einen Rat geben.“
„Trotzdem.“
„Du kannst verdammt stur sein, wie? Was willst du hier in den Bergen, Daniel Oakland?“
„Ich weiß es nicht.“ Dan zuckte die Achseln. „Nur so durch die Berge reiten. Aber der Halunke hat mein Pferd abgeknallt.“
„In den Mountains brauchst du kein Pferd.“
„Ich wollte zum Yellowstone River.“
„Zu Fuß kommst du sicherer dorthin.“
Der Fremde, der wie ein Trapper aussah, betrachtete Dan erneut abschätzend. Dan hatte das Gefühl, diesem Fremden könne nichts verborgen bleiben.
„Ich bin schon lange hinter diesem Kerl her“, gab der Fremde zu, „aber jedes Mal ist er mir entwischt.“
Dan konnte nicht länger im Unklaren bleiben, er musste einfach fragen: „Wer bist du?“
„Ist das so wichtig für dich? Damit kannst du nichts anfangen.“
„Ich will es aber wissen.“
„Ja, du bist ein sturer Hund. Well, ich bin Dutch Scott.“ Der Fremde drehte sich horchend um, witterte in den Wind und blickte Dan dann wieder an. „Er hat sich davongemacht, der feige Hund.“ Flüchtiges Lächeln huschte über das raue Gesicht. „Du kommst also vom Big Muddy. Von da bin ich auch gekommen. Das ist lange her. Ich rede sonst nie so viel, Oakland, das kannst du mir glauben. Ich hab sogar studiert. Das war damals als junger Mann in meiner alten Heimat, in den Niederlanden.“
„Wo ist das?“
„Ich bin ein Dutchman, ein Holländer. – Jetzt mach, dass du weiterkommst! Hol dein Gewehr und folge der Sonne. Dann kommst du zum Yellowstone.“
Langsam wandte Dutch Scott sich ab und ging mit großen Schritten davon, tauchte in den Schatten der Bäume ein und verschwand so lautlos, wie er gekommen war.
Dan verließ die Lichtung und lief zu seinem toten Pferd. Er zerrte die Hawken aus dem Scabbard, riss den Proviantbeutel an sich und suchte wieder die Deckung der Bäume auf.
An diesem Abend saß er einsam an einem kleinen rauchlosen Feuer und dachte über die Erlebnisse nach. Dutch Scott war ein seltsamer Mann. Er hatte studiert und lebte dennoch in dieser Bergwelt, weitab von jeder Zivilisation.
Dan musste zugeben, dass der Mann ihm gefallen hatte. Und mit einem Mal war ihm klar, dass dieser Mann der Herr der rauen Berge sein musste. Wie hatte er sich genannt? Dutch Scott. Dan wollte Dutch Scott wieder begegnen.
2.
Gedämpft klangen Stimmen in der Abenddämmerung. Sie lockten eine schattenhafte Gestalt an. Sie glitt die Bergflanke abwärts, bis sie erkannte, woher die Stimmen kamen.
Um ein flackerndes Feuer saßen drei uniformierte Kundschafter.
Die Männer waren arglos. Die Blechgeschirre klapperten, das Zaumzeug der Pferde klirrte leise, und der Wind fuhr durch die rauschenden Bäume.
Jetzt stand einer der Männer auf, hielt den Blechbecher mit heißem schwarzem Kaffee und sah umher. Dunstschwaden wehten durch das Tal. Dunkel erhoben sich die Berge. Die Sonne war gesunken. Nur schwach glühte noch ein heller Strich am westlichen Horizont.
„Was ist?“, fragte einer der Soldaten, die sitzengeblieben waren.
„Ich weiß nicht recht“, raunte der stehende Soldat. „Wir sollten uns einen besseren Platz suchen. Hier haben wir keine Deckung.“
„Pah! Die Sioux sind weit weg.“
„Vielleicht auch nicht. Das sollen wir ja herausbekommen. Deshalb sind wir hier und nicht, um von den Rothäuten skalpiert zu werden.“
„Mach dir nicht in die Hose, Mann. Hier gibt’s keine Indsmen.“
Der Soldat schüttelte den Kopf, trank den Kaffee und goss den Rest in das Feuer.
„Kommt, wir suchen einen anderen Platz.“
„Mann, du kannst einem auf die Nerven gehen.“
Mürrisch erhoben sich die beiden anderen, stampften das Feuer aus und folgten dem Corporal.
Hinter ihnen am Talrand tauchte die schemenhafte Gestalt auf und starrte ihnen durch den Dunst nach. Er murrte dumpf, folgte ihnen tiefgeduckt und glitt an der schwach qualmenden Feuerstelle vorbei. Das zweibeinige Raubtier war wieder unterwegs.
Er blieb auf der Spur der Soldaten und ihrer Pferde, hörte die Stimmen unter den Bäumen am Talhang. In den Augen flackerten Irrlichter.
Mit beiden Händen hielt er die alte Kentucky, als wäre sie ein schweres Brecheisen, mit dem er den ganzen Wald verwüsten wollte.
Lautlos kroch er um die Strauchgruppen gegen den Wind.
Die Pferde konnten ihn nicht wittern. Die Soldaten hörten ihn nicht. Sie machten Feuer, rollten die Schlafdecken auseinander und legten ihre Waffen bereit.
Die beiden Soldaten streckten sich lang aus und rollten sich in die Decken ein, blickten ihren jungen Corporal an und grinsten.
„Was ist denn wieder?“, fragte einer. „Denkst du immer noch an die Sioux, Corporal? Mann, jetzt haben wir genug Deckung. Willst du denn ewig auf den Beinen bleiben?“
„Ich will steinalt werden. Genügt dir die Antwort?“, fuhr Corporal Cox ihn an. Er nahm sein Gewehr und schritt langsam über den kleinen Lagerplatz zu den Pferden. Hier blieb er stehen.
„Der kann mich noch wahnsinnig machen“, flüsterte einer der liegenden Soldaten, „mit seiner Angst vor den Rothäuten. Hol ihn der Teufel!“
Sie sahen, wie der Corporal zwischen den Bäumen oberhalb des Lagerplatzes verschwand. Dann schlossen sie die Augen. Wenig später schnarchten sie.
Unruhig ging der Corporal den Hang empor. Er konnte keine Ruhe finden. Immer wieder horchte er in den Wind und krampfte immer fester die Hand um sein Gewehr.
Das Feuer fiel langsam in sich zusammen. Rot leuchtete die Holzglut.
Drohend tauchte der Schatten am Rand der Lichtung auf und starrte düster auf die Schlafenden. Unheilvoll weiteten sich seine Augen. Er witterte wie ein Tier und horchte angespannt. Hoch oben am Hang löste sich ein kleiner Stein unter dem Soldatenstiefel des Corporals, rollte abwärts und blieb im Gestrüpp hängen. Unruhig stampften die Pferde.
Doch diese Geräusche weckten die beiden Soldaten nicht.
Lauernd kam der Mann näher, hielt die Kentucky bereit und erreichte die Schlafenden.
Sein Atem ging plötzlich schneller. Steif stand er auf der Lichtung. Seine Kleidung dünstete den Geruch der Wildnis aus. Der Geruch ließ die Pferde wild werden.
Da schlug er zu.
Erbarmungslos wuchtete er den Kolben der Kentucky auf die Schlafenden und hielt erst inne, als alles Leben erloschen war.
Schrill wiehernd zerrten die Pferde an den festgebundenen Zügeln und keilten aus, prusteten und tobten.
Oberhalb des Lagerplatzes hörte der Corporal die Pferde toben, rannte abwärts und erreichte den Lagerplatz. Er blieb neben den keuchenden Pferden stehen und sah auf die beiden Soldaten, die noch immer zu schlafen schienen.
„He!“, rief er. „Was ist los? Wacht auf, ihr verdammten Kerle!“
Sie rührten sich nicht.
Der Corporal konnte die Gesichter nicht sehen, bemerkte nicht das Blut. Zögernd trat er in das bleiche Mondlicht.
Da krachte ein Schuss.
Blei riss den Corporal herum und schleuderte ihn zwischen die auskeilenden Pferde. Er verlor sein Gewehr und griff mit zuckenden Händen umher, krallte sie um ein Sattelhorn, und das Pferd raste los und riss ihn mit sich.
In dieser Sekunde bohrte sich ein Wurfmesser in seinen Rücken.
Doch er hielt durch, ließ das Sattelhorn nicht los. Irgendwie schaffte er es, in den Sattel zu kommen.
Blutend sackte er nach vorn.
Das Pferd trug ihn durch das Tal. Vor seinen Augen verschwamm alles. Er stöhnte, während das Leben aus seinem Körper floh.
Die Hände rutschten ab. Der Oberkörper fiel auf den Pferdehals. Der Kopf hing tief herunter. So ritt der Corporal durch die sternenhelle Nacht.
Plötzlich knickte das Pferd unversehens ein und der Corporal stürzte aus dem Sattel und rollte auf die Seite.
Das Pferd wich Dan Oakland aus, lief noch hundert Yard weiter und blieb stehen.
Dan beugte sich über den Corporal, entdeckte den Griff des Messers, der aus dem Rücken ragte, und sah den Blutfleck auf der Brust des Soldaten ...
Behutsam hob er den Mann hoch, trug ihn auf beiden Armen und brachte ihn zu seinem kleinen Lagerplatz. Hier legte er ihn vorsichtig auf die Decke, kniete nieder und riss die Uniform auf.
Als Dan die Brustwunde betrachtete, wusste er, dass der Corporal sterben würde. Kein Mensch konnte das überleben. Dan wagte nicht, das Messer aus dem Rücken zu ziehen. Ein Blutschwall würde aus dem Körper schießen.
„Armer Kerl“, seufzte er schwer und betrachtete das blasse eingefallene Gesicht, die schwarzen Haare und die staubige und blutige Uniform.
Er versuchte, dem Bewusstlosen etwas Wasser einzuflößen. Das war gefährlich. Der Corporal konnte an dem Schluck ersticken. Dan war behutsam.
Endlich öffnete der Soldat die Augen. Leer sah er auf. Er erkannte Dans Gesicht wohl nicht mehr.
„Überfall ...“, kam es kaum hörbar über die Lippen. „Die – anderen – tot – zwei – Mann.“
„Bleib ruhig liegen, Corporal. Wohin gehörst du?“
„Fort“, hauchte der Soldat. „Fort – Keogh ... Bring – mich hin, muss – Colonel Ferguson – warnen – Sioux ...“
„Seid ihr von Indianern überfallen worden, Corporal?“
„Ja ... bring mich ...“ Seine Stimme verlor sich in einem undeutlichen Murmeln und Stöhnen. Dann war er wieder bewusstlos.
Dan stand auf, lief zurück und fing das Sattelpferd ein. Dann machte er sich in fieberhafter Eile daran, aus den Ästen der Bäume einen Schleppschlitten zu bauen.
Das Stöhnen des Corporals ließ ihn innehalten.
„Hast du mir was zu sagen? Wir brechen gleich auf ...“
„In Ordnung.“
„Wo liegt Fort Keogh, Corporal?“
„Nach Norden – am Powder River – am Powder und – Yellowstone ...“
Dan richtete sich auf und durchsuchte die Satteltaschen des Pferdes, fand Verbandzeug und versorgte die Wunde des Corporals, der ohnmächtig geworden war. Dann brach Dan mit ihm auf, zog den Schleppschlitten mit dem Corporal darauf hinter dem Pferd her und ritt nach Norden durch die weiten Täler.
Auf seinem langen nächtlichen Weg begegnete er keinem einzigen Sioux.
3.
Musik klang aus Fort Keogh. Langsam ritt Dan durch das Tor auf den großen Platz.
Soldaten, ein paar Trapper und Indianerscouts kamen näher und erkannten den Corporal.
Dan gab keine Antwort auf die drängenden Fragen, ritt bis zum hellerleuchteten Kasino und rutschte schwer und müde vom Pferd.
„Wohin, Fremder?“, fragte der Posten neben der Tür des Kasinos.
„Zu Colonel Ferguson ...“
Der Posten trat näher und beugte sich über den Corporal, der eingehüllt in der Decke auf dem Schleppschlitten lag und kein Lebenszeichen von sich gab.
„Ist er tot?“
„Ja.“
„Er war ein feiner Kerl“, versicherte der Posten bedrückt. „Immer müssen die Guten sterben.“
Dan widersprach nicht, obwohl der Posten sich irrte. Wenn böse Menschen sterben, sprach man nicht lange darüber.
„Ich muss zum Colonel. Der Corporal hat das gewollt.“
„Fremder, hörst du nicht die Musik? Offiziere und Sergeants tanzen mit ihren Frauen.“
„Du musst sie stören. Der Tanz ist nicht wichtig ...“
„Hach! Das sagst du so. Du kennst den Colonel nicht. Der gerät schnell in Wut, verstehst du?“
„Lassen wir’s drauf ankommen.“
Dan stapfte auf die Tür zu. Auffordernd sah er den Posten an. „Na los, worauf wartest du noch?“
„Bleib hier stehen.“ Der Soldat zögerte, atmete tief ein und öffnete die Tür.
Dan vernahm die Musik, hörte Frauen lachen und Gläser klingen, sah die tanzenden Paare, die plaudernden Männer in Uniformen, atmete den Geruch von Tabakrauch und Wein und hörte die Stimme des Postens.
Die Musik brach ab.
Alle blickten zur Tür.
„Sir, ein Trapper ist mit Corporal Cox hier. Der Corporal ist tot, Sir. Der Trapper lässt sich nicht zurückhalten. Er will mit Ihnen sprechen, Sir ...“
„Muss das jetzt sein?“ Colonel Grant H. Ferguson kam steif über den blank gebohnerten Tanzboden. „Nur einmal im Jahr treffen sich Offiziere und Sergeants mit ihren Damen zum Tanz, und da kommen Sie und stören ...“ Er unterbrach sich und sah den großen schlanken Mann, der in staubiger Lederkleidung neben dem Posten stand.
Dan Oakland wirkte auf die Anwesenden wie ein Stück Wildnis. Ernst sah er sie alle an. Sein sandfarbenes Haar fiel unter der Biberfellmütze strähnig hervor. Das breite Gesicht verriet Gutmütigkeit. Ihm war sofort anzusehen, dass er eine ehrliche Haut war, offen und freimütig.
Colonel Ferguson drehte sich herum und verbeugte sich steif vor seiner Tanzpartnerin.
„Bitte, entschuldigen Sie, Mrs. Forrester.“ Er sah sich um. „Bitte, tanzen Sie weiter, my Ladys, Gentlemen.“
Wieder erklang Musik.
Langsam kam Ferguson heran und betrachtete Dan herablassend, schritt vorbei und trat hinaus.
Groß stand der Mond über dem Powder River. Wolken wanderten über die dunklen Berge und dichten Wälder. Das klagende Heulen umherstreifender Wölfe drang aus der Wildnis herüber.
Neben dem Schleppschlitten blieb der Colonel stehen und gab dem Posten einen herrischen Wink. Daraufhin zog der Soldat die Decke von dem Toten. Ferguson betrachtete den ausgebluteten Körper.
„Ein Schuss in die Brust“, konstatierte er, „aus ziemlicher Nähe abgefeuert.“
„Und ein Messer im Rücken“, fügte Dan hinzu. „Ich hatte in den Bergen mein Nachtlager aufgeschlagen, als der Corporal durch das Tal gejagt kam. Er hat noch vor wenigen Stunden gelebt, Colonel ...“
„Drehen Sie ihn auf den Bauch.“
Der Soldat gehorchte, zog den Toten herum und wischte mit der Hand über das Hosenbein.
„Ein seltsames Messer“, murmelte Ferguson. „Ziehen Sie es schon raus und säubern Sie es, bevor Sie es mir geben ...“ Er sah Dan durchdringend an. „Ihr Name?“
„Daniel Oakland.“
„Kommen Sie, Oakland ...“
Beide betraten die Kommandantenbaracke. Der Offizier bot Dan einen Platz an und setzte sich hinter seinen Tisch. Hinter ihm an der Wand hing das Sternenbanner.
„Berichten Sie, Oakland.“
Dan sprach ruhig. Ferguson unterbrach ihn nicht ein einziges Mal.
„Sie haben gute Arbeit geleistet, Oakland. – Kennen Sie die Berge im Südwesten?“
„Nein, ich bin zum ersten Mal hier.“
„Bedauerlich. Ich hätte Sie gern als Scout eingestellt.“
„Ich habe nicht vor, Scout bei der Kavallerie zu werden“, entgegnete Dan. „Fragen Sie mich nicht, was ich in diesem Bergland suche. Ich weiß es selbst nicht. Vielleicht die Freiheit. Ich habe keine Ahnung ...“
Ferguson verzog das Gesicht und zwirbelte seinen dunklen Schnurrbart. Ihm unterstanden viele Soldaten. Er war es gewohnt, dass man ihm gehorchte. Mit einem Mann wie Dan Oakland konnte er nichts anfangen.
Der hereinkommende Posten enthob ihn einer Antwort. Er nahm das gesäuberte Wurfmesser entgegen und betrachtete es.
„Was halten Sie davon, Oakland?“ Dan nahm das Messer aus seiner Hand entgegen und sah die Klinge genau an. „Sioux-Arbeit, nicht wahr?“, sagte Ferguson.
„Nein, Colonel, das ist es nicht.“ Dan hatte auf der Klinge unterhalb des Griffs einen eingestanzten Buchstaben entdeckt, der bisher vom Blut verdeckt gewesen war, ein winzig kleines P.
„Unsinn, Oakland!“
„Das ist kein Unsinn, Colonel. Hier, sehen Sie dieses P. Entweder ist es der Anfangsbuchstabe eines Namens oder einer Stadt. Ich kann zwar nicht lesen, aber so ein P kenne ich. Vielleicht heißt es auch Pennsylvanien. Dort ist kein Sioux jemals gewesen.“
Grant H. Ferguson schien Dans Entdeckung nicht zu gefallen.
„Sie mögen recht haben. Doch dieses Messer ist den Sioux in die Hände gefallen. Der Corporal war mit zwei Soldaten ausgeritten. Ich werde sofort eine Schwadron in die Wildnis schicken. Begleiten Sie die Männer, Oakland, und zeigen Sie ihnen, wo Sie den Corporal gefunden haben.“
„Dann brauche ich ein Pferd.“
„Sie werden es bekommen, aber ich kann es Ihnen nicht verkaufen. Wir sind knapp an Pferden. Ich erwarte erst in einigen Tagen den Pferdehändler, der die Armee beliefert.“
Dan lächelte.
Er hatte den Colonel durchschaut. Ferguson konnte ihn und alle freien Trapper nicht ausstehen. Das Pferd des Corporals hätte ebenso gut tot sein können. Ferguson hätte es vom Bestand streichen müssen.
„Ich werde vom Pferd steigen, wenn wir das Tal erreicht haben, Colonel, und zu Fuß durch die Wildnis streifen.“
Ferguson warf das Messer auf den Tisch, erhob sich und ging hinaus. Als er das Kasino betrat, brach die Musik ab. Der Colonel sagte in die Stille hinein: „Ich beende den Ball. – Captain Crawford, Sie brechen sofort mit einer Schwadron auf und lassen sich von diesem Trapper die Stelle zeigen, wo der Corporal niedergemacht worden ist. – Sergeant Forrester, Sie unterstehen ab sofort dem Befehl des Captains. Abrücken in einer halben Stunde.“
Der Colonel wippte auf den Fußspitzen. „Es tut mir leid, meine Damen. Aber drei meiner Männer wurden von Sioux-Indianern massakriert.“
Tiefes Schweigen herrschte.
Dan Oakland wartete draußen im Sternenlicht und sah, wie die Soldaten aus den Unterkünften gelaufen kamen, wie Pferde aus dem Stall geholt und mit militärischer Präzision alle Vorbereitungen zum Ausrücken getroffen wurden. Er bekam ein Sattelpferd.
Nach einer halben Stunde saßen alle Soldaten der Schwadron im Sattel. Captain Crawford setzte sich an die Spitze.
Langsam kam der Colonel heran. Im Hintergrund wartete seine Frau.
„Sollten Sie auf Sioux stoßen, Captain, lassen Sie mich sofort durch Meldereiter verständigen ...“
„Ja, Sir.“
Ferguson warf Dan einen Blick zu und schritt steif zu seiner Frau zurück. „Komm, Lee.“
Crawford drehte sich im Sattel halb herum und hob die Hand. „Schwadron“, rief er, „trabt an!“
Im klirrenden Trab verließ die Kavallerie Fort Keogh.
Dan führte die Schwadron in die Bergwildnis.
4.
Am frühen Morgen des nächsten Tages durchstreiften die Soldaten das Gebiet, aus dem der Corporal gekommen war. In der Mittagszeit entdeckten sie Aaskrähen in den Bäumen. Als sie näher ritten, flatterten die Vögel krächzend davon. Wenig später fanden sie, wonach sie gesucht hatten.
Vor den Soldaten lagen die beiden erschlagenen Männer. Sie waren ausgeplündert und verstümmelt worden. Alles deutete auf einen grausamen und blutigen Indianerüberfall hin.
Dan zweifelte daran. Nirgendwo war ein Pfeil oder eine Lanze zu entdecken, nirgendwo lag ein Tomahawk im Gestrüpp. Auch waren die Toten nicht skalpiert worden.
Überall am Boden und im Geäst waren ausgerissene Krähenfedern zu sehen. Die Vögel hatten um die Leichen gekämpft.
Die beiden Pferde waren ausgeschlachtet worden. Irgendwer hatte das beste Fleisch herausgeschnitten. Der Boden um die Tierkörper herum war mit Eingeweiden übersät.
„Diese blutrünstigen Bestien!“, ächzte Captain Crawford und wischte sich den Schweiß vom grauen Gesicht. „Sergeant Forrester, wir bleiben in diesem Gebiet und suchen nach den Rothäuten.“
„Ja, Sir.“
Dan ließ das Soldatenpferd stehen und ging langsam den Hang empor. Er verließ die Schwadron und suchte die Einsamkeit. Noch lag die Bergwelt wie in einem tiefen Frieden vor Dan. Er sah die Täler im Dunst unter sich, die sonnenhellen Bergflanken und die dichten Baumkronen. Er ruhte entspannt am Hang und aß das gebratene Fleisch eines Präriehundes.
Die Wildnis schien undurchdringlich zu sein. Doch es gab die schmalen, verborgenen Pfade des Wildes und die von weichen Mokassins festgestampften Wege, auf denen indianische Späher von einem Lager zum anderen geeilt waren, als die Sioux noch keine Ponys besessen hatten.
Bedächtig löschte Dan nach dem Mahl das Feuer, warf Sand auf die Holzglut und richtete sich auf.
Jäh warnte ihn sein Instinkt.
Nichts war zu sehen, nichts zu hören – und doch verspürte er eine Gefahr, die im dunklen Unterholz lauerte.
Alle seine Sinne waren in höchster Alarmbereitschaft.
Mit fast geschlossenen Augen stand er da, als wolle er die Wärme der Sonne genießen. Unauffällig schweifte sein suchender Blick umher.
Ein kleiner Zweig bewegte sich gegen den Wind.
Das war es. Er wurde beobachtet. Noch konnte er nicht sehen, wer dort hinter dem Strauch kauerte. Dan konnte ihn auch nicht riechen. Der Gegner war gegen den Wind angeschlichen. So leise konnte kein Weißer sich an sein Lager herangemacht haben.
Seine Hawken lag am Boden. Daneben lagen auch das Pulverhorn und die Provianttasche, in der sich das Blei für die Long Rifle befand.
Er durfte nicht zeigen, dass er den Gegner bemerkt hatte. So setzte er sich wie schläfrig hin. Wenn der Gegner darauf aus war, ihn umzubringen, hätte er es wohl schon längst tun können. Reglos und nach vorn gebeugt saß Dan in der Sonne. Der Wind bewegte sein Haar, trocknete den feinen Schweißfilm auf seinem Gesicht und spielte mit den Zweigen. Dan blickte nach Westen, wo in rauchiger Ferne die ewig schneebedeckten Berggipfel zum blauen Himmel hinaufwuchteten. Er lauschte der Stimme des Windes und legte wie zufällig die Hand auf die Hawken.
Es raschelte merklich lauter im Gebüsch.
Dan musste Augen im Hinterkopf haben. Er wusste genau, dass sich ihm jemand von hinten näherte.
Bisher hatte Dan sich keine Gedanken über seine Abenteuer gemacht. Es war ihm auch noch nicht bewusst geworden, dass die harten Stunden ihn formten und er bereits schon ein erfahrener Waldläufer und Trapper geworden war.
Hier oben auf den Bergen und dort unten in den Tälern hielten manche ihn sogar schon für einen erfahrenen und kampfstarken Mountain Man.
Dan war nicht dieser Meinung. Er hielt sich für einen jungen Mann, der noch viel lernen musste. Und wenn ihn jemand mit Big Dan anredete, weil er ein großer Mann sein sollte, winkte er nur ab.
Aber er war ein großer Mann.
Jetzt, als die Gefahr auf ihn zukam, zählte er seine Herzschläge und war bereit.