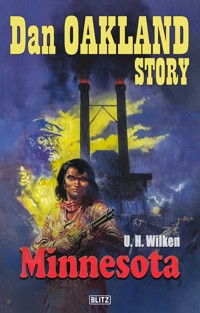3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Dan-Oakland-Story
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Omaha-MarterSam Ballou jagt Indianer, egal ob Männer, Frauen oder Kinder. Er will ihre Skalps. Bei dem Versuch, diese grausamen Verbrechen zu verhindern, wird Dan Oakland in Kämpfe zwischen dem Stamm der Omaha und weißen Soldaten verwickelt.Gesetz der WildnisDan Oakland nimmt eine Sioux zur Frau. Als deren Bruder ermordet wird, beginnt ein langer Weg der Rache.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 274
Ähnliche
Dan Oakland Story
In dieser Reihe bisher erschienen
4301 U. H. Wilken Lockruf der Wildnis
4302 U. H. Wilken Teufelsbrigade
4303 U. H. Wilken Die Feuertaufe
4304 U. H. Wilken Der weiße Büffel
4305 U. H. Wilken Das Aufgebot des Bösen
4306 U. H. Wilken Grausame Grenze
4307 U. H. Wilken Omaha-Marter
4308 U. H. Wilken Blutige Säbel
U. H. Wilken
Omaha-Marter
Der Text wurde anhand der Originalmanuskripte des Autors sorgfältig überarbeitetet und um bisher unveröffentlichte Textpassagen ergänzt. Der Abdruck erfolgt mit ausdrücklicher Genehmigung von Detlef Wilken.
Dieses Buch enthält die Einzelromane:
Omaha-MarterGesetz der Wildnis
Diese Reihe erscheint als limitierte und exklusive Sammler-Edition!Erhältlich nur beim BLITZ-Verlag in einer automatischen Belieferung ohne Versandkosten und einem Serien-Subskriptionsrabatt.Infos unter: www.BLITZ-Verlag.de© 2021 BLITZ-Verlag, Hurster Straße 2a, 51570 WindeckRedaktion: Alfred WallonTitelbild: Rudolf Sieber-LonatiUmschlaggestaltung: Mario HeyerVignette: Wiktoria Matynia/123RF.comSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-086-4Dieser Roman ist als Taschenbuch in unserem Shop erhältlich!
Omaha-Marter
Dan Oakland folgte beharrlich der blutigen Fährte. In den Bergen war er auf die Leiche des skalpierten Indianers gestoßen. Auf der Spur des Mörders musste Dan an jene ehemaligen Waldläufer denken, die sich, nachdem das Wild immer rarer geworden war, auf einen anderen Broterwerb umgestellt hatten: die Skalpjagd.
Mehr und mehr gewann Dan die Überzeugung, dass er solch einem Mordjäger auf den Fersen war. Jede neue Leiche vertiefte seine Trauer um die Opfer und steigerte seinen Zorn auf den feigen Mörder.
Der Skalpjäger war sorglos. Er hinterließ eine breite Spur, die Dan bei Tag und in der Nacht mühelos verfolgen konnte. Nach vielen Tagen führte sie ihn in einer sternhellen Nacht auf einen Hügel, der auf ein Camp hinabsah. Es bestand aus mehreren Blockhäusern. Trüb sickerte der Schein blakender Lampen durch die verhangenen kleinen Fenster. Ein Kettenhund schlug an. Eine Tür flog auf.
„Ruhe!“, brüllte ein Mann. „Willst du endlich ruhig sein, verdammter Köter?“
Dan Oakland ritt langsam an und näherte sich dem Camp. Der Hund kläffte sich heiser. Den Mann in der Tür störte es nicht mehr. Wie gebannt sah er zum Talrand. Dunkel zeichnete sich Dan Oakland vor dem Vollmond ab. Mit einem Fluch wandte sich der Mann schließlich um und schloss hinter sich die Tür. Sekunden später erlosch das Licht im Blockhaus.
Dan Oakland kam unbeirrt näher. Er lächelte. Er wusste genau, dass der Mann jetzt hinter dem Fenster stand und ihn mit einem Gewehr in der Hand beobachtete. Dan ritt zwischen die Häuser und hielt an. Hier endete die blutige Spur, der er seit Tagen folgte. Knarrend wurde die Tür wieder geöffnet. Der Mann trat geduckt einen Schritt vor und hielt sein Gewehr auf Dan gerichtet.
„Was willst du?“
„Ich kann dich nicht verstehen“, rief Dan. „Der Hund ist zu laut.“
Der Mann knurrte irgendetwas, stapfte um das Haus und scheuchte den kläffenden Hund mit einem Fußtritt in eine umgeschlagene Holztonne. Der Hund verstummte. Der Mann kam wieder zurück und blieb einige Schritte vor Dan stehen.
„Was du hier willst, habe ich gefragt.“
Dan zuckte die Achseln. „Ich habe das Camp zufällig gesehen und dabei an einen Schluck Brandy gedacht.“
„So?“, dehnte der Mann. „Dann reite zum Blockhaus da drüben. Da kriegst du Feuerwasser.“
„Danke“, sagte Dan freundlich, zog das Pferd herum und ritt zu der bezeichneten Hütte, rutschte aus dem Sattel und blieb horchend stehen. Die Rechte ruhte dabei auf der Hawken Rifle im Gewehrschuh.
Er hörte Pferde stampfen und schnauben, Gebissketten klirren und Stimmengemurmel, das durch die Fugen des Blockhauses drang. Der Mann beobachtete ihn noch immer. Mit einem Ruck zog Dan die Rifle aus dem Scabbard und näherte sich der Tür. Entschlossen zog er sie auf und prallte mit mehreren Männern zusammen, die gerade herauswollten. Er wich ihnen aus. Sie starrten ihn abschätzend an. Schweigend verließen sie die Hütte. Krachend fiel die Tür zu. Dan war allein mit einem Mann hinter einem Holztresen.
„Fremd hier?“
Dan nickte.
„Brandy?“
„Ja, einen kleinen.“ Langsam schob Dan sich an den Tresen heran, nahm den Becher in die Linke und nippte am Brandy.
„Ich such ’nen alten Bekannten. Er sammelt Skalps.“
„Alle im Camp sammeln Skalps. Sag seinen Namen. Dann kann ich dir vielleicht helfen.“
„Joe heißt er. Ich kenn ihn nur als Joe.“
Draußen stampften mehrere Pferde vorbei. Die Reiter trieben die Tiere hart an und jagten im Galopp aus dem Camp. Das dumpfe Hufgetrappel entfernte sich schnell und erstarb irgendwo auf der Ebene.
„Joe? Kenn ich nicht. Der ist nicht hier.“
„Das kann nicht sein. Ich bin seiner Spur gefolgt, sie führt hierher. Er kann noch nicht lange im Camp sein.“
„Nein, einen Joe gibt’s hier nicht. Weiß der Teufel, wie die Trapper alle heißen. Sie kommen und gehen, sind manchmal monatelang weg, kommen dann mit ihrer Beute zurück, mit ein paar Narben mehr mitunter, und verschwinden wieder. Einige kommen nie wieder her. Die haben die Indsmen erwischt.“
Dan zog ein Biberfell unter der Jacke hervor und bezahlte damit den Brandy, verließ die Taverne und blickte umher. Das Camp lag plötzlich wie ausgestorben. Noch kam Rauch aus den primitiven Schornsteinen, doch nirgendwo waren noch Stimmen. Alle Pferde waren verschwunden. Suchend ging Dan durch das Camp und öffnete die Tür jener Hütte, aus der der Mann vorhin gekommen war. Im Kamin aus Felsgestein glimmte es rot. Das Lager war zerwühlt und verlassen. Oberhalb des Kamins hingen viele Skalps zum Trocknen. Indianerskalps.
Zorn trieb Dan von einer Hütte zur anderen. Überall sah er Skalps. Dumpf grollte ein Unwetter über der Ebene. Fauchende Winde stießen in das Tal und jaulten um die Hütten. Die Spur des Skalpjägers hatte Dan in dieses Camp geführt. Er war entschlossen, nicht aufzugeben. Er lief zu seinem Pferd, stieg in den Sattel und ritt aus dem Tal. Heftig traf ihn der Wind. Dunkle Wolken trieben heran. Regen peitschte ihm entgegen.
Die Spur der Reiter war noch gut zu erkennen. Nach vier Meilen konnte Dan nichts mehr sehen. Einsam ritt er durch das tobende Unwetter und behielt die eingeschlagene Richtung bei. Der alte Mantel aus Fellen war längst durchnässt, als er die Ausläufer der bewaldeten Berge erreichte. Das Unwetter entfernte sich grollend.
Fröstelnd und nass bis auf die Haut ritt Dan weiter nach Osten, der Sonne entgegen.
In den dichten Douglasfichten war der Wind. Bleiches Mondlicht sickerte durch die massigen Kronen. Auf der kleinen Lichtung flackerte ein Feuer. Ein in Pelz gehüllter Mann beugte sich vor und rieb die Hände über den Flammen. Eine alte Pfeife in seinem Mundwinkel qualmte. Er war der älteste von neun Männern, die im Indianerland Beute machten. Dumpf schnaubten die Pferde. Sam Ballou richtete sich auf und lauschte.
Die anderen griffen schweigend nach den Waffen und rückten lautlos vom Feuer weg. Irgendwo heulte ein Bergwolf.
„Da ist doch was“, flüsterte Sam Ballou. „Ich rieche sie. Sie stinken nach Büffelfett.“
Im Unterholz des Waldes knackte es. Sofort richteten sich alle Waffen ins Dunkel. Dort tauchte ein Mann auf.
„Ich habe sie gesehen“, krächzte er. „Macht das Feuer aus. Sie sind ganz in der Nähe.“
„Wie viele?“, raunte Sam Ballou.
„Vier. Sie streifen umher. Wahrscheinlich Dakota oder Omaha.“
„Da hat Vater doch richtig gerochen“, grinste Sam Ballou.
„Vier Rothäute?“, gab einer zu bedenken. „Das sind keine Späher. Eher ein Vortrupp. Wo vier sind, da werden sicher auch mehr sein.“
„Hosenscheißer“, knurrte Ballou verächtlich. „Du hast bloß Angst. War wohl ungefährlicher, harmlose Biber zu jagen, was? Nimm dich zusammen! Die roten Stinktiere sind auch nicht gefährlicher als das andere kleine Kroppzeug in den Wäldern. Ziel gut und drück ab! Dann hast du nichts zu befürchten. Auf, Männer! Wir gehen es an.“
Sie glitten zu den Pferden und saßen auf. Sam Ballou trat das Feuer aus; der Rauch verwehte zwischen den Fichten. Dumpf schlugen die Hufe den bewaldeten Hang abwärts. Bodennebel lagen wie graue Tücher über dem Indianerland. Eingehüllt vom Nebel ritten neun Männer durch die kühle Nacht. Sie ritten stumm im Galopp, bis Sam Ballou den rechten Arm hob. Die Reiter zügelten die Pferde und ließen sie nur noch im Schritt gehen.
Aus dem Nebel drang ein helles Lachen. Vier junge Omaha ritten im Tal hin und her und maßen sich in der Geschicklichkeit des Reitens. Sam Ballou und seine Männer kamen mit Gewehren aus dem Dunst hervor und feuerten auf die Indianer. Lachen erstarb im Aufpeitschen der Schüsse. Leblos sanken die Indianer von den Pferderücken, lagen im taufeuchten Gras. Das Echo der Schüsse zerflatterte in der Wildnis.
Ballou warf sich vom Pferd und beugte sich über einen Omaha. Die anderen Männer saßen ab.
„Ballou, das sind ja noch halbe Kinder.“
Heiser klang eine Stimme durchs Tal, zitternd vor Erregung. Sam Ballou setzte schon das Messer an, zog mit der Klinge einen Kreis und löste die Kopfhaut. Er richtete sich mit dem Skalp auf und blickte ungerührt in die Runde.
„Was willst du?“, entgegnete er. „Sie haben doch schon einen ganz schönen Pelz auf dem Schädel. Gib dich zufrieden! In zwei Jahren wären aus den Burschen blutrünstige Krieger geworden. Sie hätten weiße Frauen geschändet, weiße Kinder ermordet. Das hast du verhindert.“
„Mein Gott, was haben wir nur getan ...“
„Halt das Maul!“
Sieben Männer stürmten auf die gefallenen Omaha zu, um sie zu skalpieren. Drei konnten nur mit einer Trophäe rechnen. Wer sich nicht beeilte, ging leer aus. Sam Ballou schwang sich in den Sattel. Die anderen acht folgten ihm. Der Hufschlag ihrer Pferde entfernte sich. Wieder heulte der Wolf in der Ferne. Die toten Jünglinge lagen im Gras mit blutigen Köpfen. Abseits standen ihre Pferde. Sie wieherten leise. Da sich niemand um sie kümmerte, machten sie sich auf den Weg zurück ins Lager.
Die helle Sonne stach durch die Baumkronen und warf flirrende Lichtflecken auf den Boden. Die Hitze des Tages wallte die Hänge hinauf. Rotwild hatte sich in den Fallen gefangen. Sam Ballou stach mit dem langen Messer zu und tötete den Hirsch. Er ließ das Blut über die Steine fließen und wartete, bis der Körper ausgeblutet war. Dann warf er ihn sich über die Schultern und schleppte ihn den Hang abwärts. Am klaren Wasser des kleinen Bergflusses hatten sie das Lager errichtet. Dort hingen die gestrafften Felle zum Trocknen in der heißen Sonne. Fünf Trapper waren an der Arbeit und blickten kaum auf, als Sam Ballou den Hirsch neben dem Feuer zu Boden warf.
„Wo ist Ballard?“
Sie blickten Sam Ballou an und zuckten die Achseln.
„Wissen wir nicht. Er muss noch auf dem Hügel sein.“
Ballou wischte das Messer am Hosenbein ab und schob es in die lederne Scheide. Er stapfte den Hang wieder empor. Unter Bäumen standen die Pferde. Er zögerte und überlegte. Dann holte er sein Tier und zog es hinter sich her. Unter den Bäumen war es eher auszuhalten. Hier hielt Ballou, horchte und spähte über den Hang. Unten zwischen den Schluchten lag ihr Camp. Ballou stapfte weiter. Die Skalps am Gurt baumelten hin und her.
„Ballard?“, rief er unterdrückt.
Er bekam keine Antwort. In den Baumkronen rieben Blätter aneinander. Ballou ließ sein Pferd im Schatten der Bäume zurück und ging geduckt weiter.
„Ballard ...?“
Stille. Misstrauisch fragte er sich, wo Ballard geblieben sein mochte, in dieser gottverlassenen Wildnis war es besser, wenn sie immer zusammenblieben. Ein Mann allein konnte zwar viele Felle heimbringen, doch die Gefahr, von Indianern überrascht zu werden, war eben zu groß. Lautlos bewegte Ballou sich durch den Wald und suchte. Er rief nicht mehr, sah sich nur um und stieg immer höher hinauf.
Urplötzlich rührte er sich nicht mehr und starrte in die Senke. Ballard lag auf dem Rücken. Die schmutzige, abgenutzte Lederkleidung schimmerte matt. Ein Pfeilschaft ragte aus der Brust.
Sofort ging Sam Ballou in Deckung, kauerte hinter einen Baum, horchte und spähte.
Der Berghang schien verlassen. Aus der Schlucht stieg schwacher Rauch empor. Die Stimmen der Trapper waren nicht zu hören. Als Sam Ballou sich davon überzeugt hatte, dass keine unmittelbare Gefahr drohte, näherte er sich Ballard, kniete bei ihm nieder und starrte in das tote Gesicht. Ballards Kehle war durchschnitten.
Der Anblick des skalpierten weißen Mannes ließ Sam Ballou kalt. Er wusste, dass Indianer in der Nähe waren, dass sie sich irgendwo verbargen und lautlose Jagd auf die Trapper machten. Er konnte sie warnen. Doch damit würde er sich selbst verraten. Geduckt hockte er im Schatten und starrte umher. Nirgends entdeckte er Indianer. Sie waren unbemerkt vorbeigeschlichen. Noch einmal sah er in das bleiche Gesicht des Toten. Ballard war überrascht worden. Neben ihm lagen zwei Felle. Die Stille war unnatürlich. Es roch nach Holz und Harz, nach Erde und Fäulnis. Noch war nichts geschehen unten am Lagerplatz. Sam Ballou hielt den Colt in der Hand und schlich abwärts. Unter den Bäumen stand sein Pferd. Er verharrte daneben und lauschte angespannt.
Ein gellender Schrei zerriss die Stille. In der Schlucht brach jetzt die Hölle los. Pfeile fauchten heran und trafen. Schüsse krachten. Das Gebrüll eines Mannes erstarb in einem röchelnden Schrei. Rauch wirbelte hoch. Schreiend wälzte sich einer der Trapper am Boden und rollte ins Feuer. Die Flammen erstickten. Die Pferde wieherten und zerrten an den Zügeln. Schlanke ölige Körper tauchten hinter Bäumen und Gestrüpp auf und ließen Pfeile von den Sehnen schnellen.
Sam Ballou kroch tiefer in das Unterholz und kauerte sich hinter einen Baum. Er sah, wie die Trapper starben, von Pfeilen durchbohrt. Hinter den Deckungen kamen die Indianer hervor, stießen ein schrilles Heulen aus und skalpierten die Weißen. Sie rissen die Skalps hoch und schwenkten sie. Ihre Gesichtszüge zeigten Triumph. Ballou rührte sich nicht. Der Weg zurück zum Pferd war gefährlich. Er durfte kein Geräusch verursachen. Verkrampft kauerte er hinter dem Baum und beobachtete die Omaha.
Es waren zwölf Krieger, die plötzlich erstarrten. Sie horchten angespannt. Ihre düsteren Blicke schweiften umher, als suchten sie gerade ihn. Sam Ballou kannte das aus ungezählten Jagderlebnissen. Da gab es immer einmal einen Augenblick, in dem Verfolger und Verfolgte die Witterung verloren. Dann hielt jeder den Atem an. Der erste, der sich bemerkbar machte, war verloren.
Sam legte sich lang hin, streckte sich lautlos aus, schob sich behutsam in eine Senke und wartete. Sam wurde die Zeit nicht lang. So hatte er oft Stunde um Stunde ausgehalten und am Ende gesiegt. In den Mountains war es einmal ein Puma, das schönste Tier, das ihm je vor die Flinte gekommen war. Er hatte ihn gejagt. Sie lagen endlich stundenlang voreinander, der Puma auf einem starken Baumast, Sam hinter einem Felsblock. Endlich hielt das Tier den Jäger für tot, stand auf, und der Jäger schoss. Ob Puma oder Indianer, es war dasselbe. Sam Ballou hatte die besseren Nerven.
Plötzlich stießen die Indianer ein schrilles Geheul aus und tanzten wild zuckend um die Toten herum.
Dann war es still. Hufe stampften davon. Langsam kam Sam Ballou auf die Beine und starrte auf den Lagerplatz. Die Omaha schienen weggeritten zu sein. Die Pferde der Trapper waren nicht mehr da. Schwacher Rauch kräuselte aus den angeglühten Holzscheiten. Insekten tanzten über den Platz. Ballou wartete, ohne sich zu rühren. Mit größter Wahrscheinlichkeit lagen die Roten im Gebüsch und warteten darauf, dass Sam Ballou die Geduld verlor. Sie täuschten sich.
Sam Ballou hielt aus, eine ganze Stunde lang. Dann kroch er auf allen Vieren lautlos hinunter zum kleinen Fluss. Geduckt glitt er auf den Lagerplatz hinaus und raffte die Felle an sich. Dann hastete er unter die Bäume und ging zu seinem Pferd. Dort schnürte er die Felle fest und nahm das Pferd am Zügel. Langsam bewegte er sich am Berghang entlang und witterte in den Wind. Die Krieger waren noch in der Nähe. Ballou presste den Mund hart zusammen. Vorsichtig stieg er endlich in den Sattel und ritt durch die zerklüftete Bergfalte. Die Schatten wurden länger; die Sonne sank im Westen. Sam Ballou verhielt und horchte wieder. Überall war Gefahr. Überall konnten die Krieger sich verborgen halten und auf ihn warten, aber er verlor nicht die Nerven. Er hatte die Roten wieder in der Witterung. Sowie sie sich zeigten, würde er sie im Schussfeld haben. Gemächlich zog Sam in die Tiefe des Bergtals und nutzte jede Deckung der Bäume aus.
Die Sonne war verschwunden; die letzten Strahlen streiften die Baumwipfel. Der Dunst verdichtete sich mehr und mehr. Sam Ballou hatte eine Chance, lebendig wegzukommen. Vorsichtig und wachsam ritt er durch das Dunstfeld und lauschte auf den Wind. Die Omaha waren irgendwo unter den Bäumen. Weither klang das Wiehern eines Pferdes übers Tal hinweg. Sofort hielt Ballou und spähte.
„Ihr kriegt meinen Skalp nicht“, flüsterte er verbissen.
Er dachte nicht mehr an die Partner, die umgebracht worden waren. Sie hatten ihm nichts bedeutet. Er war im Grunde genommen ein Einzelgänger. Wie ein grauer Schatten bewegte er sich durch die Dunstschwaden und hielt das Gewehr schussbereit, witterte umher und versuchte mit scharfem Blick, die Dunstwand zu durchdringen. Behutsam folgte er einem schmalen Pfad in die Höhe; oben lag der Pass im letzten Tageslicht.
Am Abendhimmel kreisten ein paar Vögel. Wild brach hervor und hetzte vor Sam Ballou durchs Tal.
Er spürte auf einmal, dass er beobachtet wurde. Unwillkürlich zog er die Schultern an und versteifte sich. Unter dem Pelzhut lauerte er wachsam, konnte aber nichts Auffälliges entdecken. Die hohen Hänge lagen verlassen da; unter den Bäumen rührte sich nichts. Ein Kauzruf klang durch die hereinbrechende Nacht.
Ballou verzog den schmalen Mund.
„Schreit nur“, flüsterte er. „Ihr glaubt, mich täuschen zu können, aber ein Ballou fällt nicht darauf herein.
Mit steingrauem Gesicht stand Dan Oakland vor den Leichen der vier Omaha-Jünglinge. Das fahle Licht der Sterne steigerte die makabre Wirkung dieses grauenvollen Bildes. Dan sah sich um. Der Boden war von den Hufen unbeschlagener Ponys aufgewühlt. Dann führten aber viele beschlagene Pferdehufe aus dem Wald auf den Tatort zu, und ebenso viele Pferde verließen auch den Platz wieder. Das waren die Kerle aus dem Camp. Für Dan gab es keinen Zweifel. Der einsame Skalpjäger, den er bis ins Camp verfolgt hatte, war mit der Bande weitergeritten, zum gleichen verbrecherischen Geschäft. Dan Oakland nahm die Verfolgung auf.
Wenig später wurde die Spur der beschlagenen Pferde von einer großen Zahl von Ponys überdeckt.
Nach einer halben Stunde fand Dan die Weißen. Er zählte acht tote und skalpierte Trapper. Als er weiterreiten wollte, vernahm er schwaches Stöhnen. Seine Augen weiteten sich, als er sah, dass einer der Weißen den skalpierten Kopf hob. Vorsichtig glitt Dan aus dem Sattel und kniete neben dem Mann nieder. Der Trapper hatte zwischen den anderen gelegen. Die Indianer hatten ihn für tot gehalten. Der Mann hatte keine Überlebenschance. Trübe sah er Dan an und röchelte.
„Alle … tot … tot“, stöhnte der Mann. „Hilf … mir, bring … mich … weg von … hier ...“
„Was habt ihr mit den Omaha gemacht?“, flüsterte Dan.
Röchelnd richtete der Mann sich halb auf, zerkratzte mit flatternden Händen Dans Gesicht.
„Du … Hund …“
Tot fiel er zurück. Dan ließ alles unberührt und nahm sein Pferd am Zügel. Bald entdeckte er wieder eine Pferdespur. Einer der Trapper musste entkommen sein. Zäh heftete Dan sich an diese Fährte.
Mondlicht brach durch die Wolken. Sam Ballou drängte das Pferd unter die Bäume und wartete.
Hinter sich vernahm er leise Geräusche. Es klang so, als schleiche jemand durchs Unterholz.
Sam glitt vom Pferd, erdete den Zügel und ging hinter einem Baum in Deckung. Die paar Sekunden waren wie eine Ewigkeit. Dann entdeckte er einen Omaha, der geduckt näherkam. Plötzlich duckte er sich noch tiefer; jetzt hatte er Ballous Pferd entdeckt. Sam presste den Mund hart zusammen und hielt das Gewehr bereit.
Der Indianer glitt von Baum zu Baum. Er blickte zum Pferd und hielt den Tomahawk bereit zum Schlag. Suchend sah er sich um. Das kantige Gesicht zeigte die Farben des Krieges. Zwei Federn steckten im schwarzen Haar.
Sam Ballou verriet sich nicht. Der Trapper wusste, dass er nicht voreilig handeln durfte. Lautlos erreichte der Krieger das Pferd. Mit der linken Hand tastete er über das Pferd und fummelte am Sattel herum.
Sam Ballou glitt hinter dem Baum hervor und hob das Gewehr. In diesem Moment stieß der Omaha einen Kauzruf aus. Der Ruf hallte durchs Tal. Schon wollte der Omaha das Pferd wegziehen.
Da holte Ballou mit dem Gewehrkolben aus und schlug zu. Der Krieger fiel, und sofort kniete Ballou auf ihm, stieß mit dem Messer zu und skalpierte ihn. Auf seinem Gesicht lag ein befriedigtes Lächeln, als er sich aufrichtete und den Skalp am Gurt befestigte. Er packte den Zügel und ging weiter. Der Kauzruf würde die anderen Omaha anlocken. Er beeilte sich, wegzukommen. Im Tal rief ein Kauz. Der leise Schrei war echt.
Sam Ballou entfernte sich eine halbe Meile, bis er in den Sattel stieg und langsam weiterritt.
Nach einer Weile hörte er hinter sich einen markerschütternden Schrei, der die Stille zerriss. Sofort hielt er an und starrte zurück. Er konnte im Dunst nichts erkennen. Aber er wusste genau: im Tal hatten die Omaha den Toten entdeckt. Sam Ballou glitt wieder vom Pferd, zog es vorsichtig hinter sich her und erreichte den Pass.
Zwischen den Felsen blieb er stehen und blickte zurück. Auf dem Gestein hatte er keine Spur hinterlassen.
Doch die Rothäute waren hinter ihm. Erneut schrie ein Kauz; diesmal war es ein Krieger. Sam Ballou verzog den Mund und ging weiter. Der Wind jammerte über den Pass und blies Staub von den Felsen.
Im Mondlicht lag das wilde, zerklüftete Land vor Sam mit dem ganzen Zauber der Unberührtheit. Weitab schimmerte die helle Fläche eines Sees. Stark roch es nach Harz und Holz. Sam saß auf und schlug den Weg nach Süden ein. Nur dort, im fernen Süden, war er sicher vor den Indianern. Das Pferd trug ihn langsam abwärts.
Er suchte harten Boden auf und machte Umwege. Mitten in der Nacht rastete er. Auf ein wärmendes Feuer musste er verzichten. Er war schlau genug, sich nicht sicher zu fühlen. Bedächtig rollte er die Decke zusammen und legte den Sattel hin. Dann zerrte er einen Strauch aus dem Erdreich und stopfte ihn unter die Decke, band das Pferd an und wich zurück. Neben der Decke lag sein Gewehr. Es sah aus, als ruhe dort ein ahnungsloser Mann. Im Schatten wartete Sam mit gezogenem Colt. Er wusste nicht, ob die Omaha seine Spur gefunden hatten. Das müsste sich aber in der nächsten halben Stunde herausstellen. Denn das spürte Sam: es war ein Indianer in der Nähe. Fast genau nach einer halben Stunde raschelte es in den Sträuchern.
Ein Krieger trat hervor und stand still. Er sah auf den Rastplatz und das Pferd, das etwas abseits stand. Im Schatten eines Baumes lag die Decke. Ballou machte sich bereit, nahm das Messer in die linke Hand und duckte sich. Der Omaha witterte in den Wind. Langsam kam er näher. Die starken Arme hielten Pfeil und Bogen, spannten die Sehne, und der Pfeil bohrte sich in die Decke. Es gab ein dumpfes Geräusch. Schon hetzte er heran und holte mit dem Tomahawk aus. In dieser Sekunde schleuderte Sam Ballou sein Messer auf den roten Mann. Lautlos fiel der Omaha neben der Decke zu Boden.
Ballou blieb noch in der Deckung und horchte. Erst als er sich überzeugt hatte, dass niemand in der Nähe war, glitt er auf den Platz hinaus, nahm sein Messer wieder an sich, skalpierte den Toten und sattelte das Pferd. Dann ritt er in die Täler hinunter. Sorgsam verwischte er seine Spur. Nach vielen Meilen rastete er, entfachte ein kleines rauchloses Feuer und kochte etwas Kaffee. Er wollte nicht schlafen. Starr blickte er in die Flamme.
Gedankenversunken trank er vom Kaffee. Nun fühlte er sich sicher vor den Omaha-Indianern. Unter ihm lagen die Täler im bläulichen Dunst der Nacht. Schräg wehte der Rauch des Lagerfeuers über den Platz.
Ballou legte Holz nach und zog die Decke über die Schultern. Im Flammenschein des Feuers sah sein Gesicht noch härter aus. Das Gewehr lag griffbereit neben ihm; matt schimmernd ragte der Kolben des schweren Colts aus der Halfter. Reglos verharrte er am Feuer. Es schien, als sei er erstarrt. Nur die Augenlider bewegten sich manchmal. Später zog er die Decke noch mehr über die Schultern und schloss die Augen. Doch bei dem leisesten Geräusch schreckte er zusammen.
Die Müdigkeit war bleiern. Sie drohte ihn zu übermannen. Die Schultern sackten ab. Der Oberkörper fiel nach vorn. Sam hatte nur den Wunsch, sich hinzulegen und zu schlafen. Aber ein Mann in seiner Lage durfte nicht schlafen. Das wusste er. Das hatte ihn das Leben in der Wildnis gelehrt. Und da er in der Wildnis leben wollte, tat er, was die Wildnis von ihm verlangte.
Die Nacht war ruhig. Als der Morgen graute, beugte er sich vor und blies in die Asche, legte Holz nach und beobachtete zufrieden, wie die Flammen hochschlugen. Plötzlich stand drüben zwischen den Bäumen eine schlanke Gestalt, hochgewachsen, mit Federn im Haar.
Sam Ballou ließ sich nichts anmerken. Ruhig blieb er sitzen und überlegte fieberhaft. Der Indianer musste schon eine ganze Weile dort stehen und ihn beobachten. Ballou griff um sich, als suche er nach weiterem Brennholz. Er erhob sich, kehrte dem Indianer den Rücken zu und tastete den Boden ab. Dabei sah er zwischen den Beinen hindurch auf den Roten. Er stand immer noch da, wie eine Statue.
Ballou ging zwischen die Bäume und suchte nach weiteren Omaha. Es wäre jetzt für ihn ein Leichtes, den Späher abzuschießen. Aber der Knall würde ihn verraten. Ohne ersichtlichen Grund schnellte der Indianer davon. Ballou lief zu seinem Pferd und warf sich in den Sattel. Hart riss er am Zügel und gab dem Tier die Sporen. Da fauchte etwas heran. Das Pferd brach zusammen. Lange Lanzen ragten aus seinem Körper. Ballou hechtete zwischen die Sträucher. Lautlos sprangen drei Omahas auf ihn zu und wollten ihn zu Boden drücken. In letzter Sekunde gelang es Sam, den Colt hochzureißen und zu schießen. Dicht vor ihm brachen zwei Krieger zusammen und überschlugen sich. Der dritte warf sich auf ihn und stieß mit dem Messer zu. Die Klinge zerfetzte Ballous Jacke an der Schulter. Bevor der Indianer wieder zustoßen konnte, hatte Ballou ihm den Colt in den Körper gerammt und abgedrückt. Ächzend warf er den Toten von sich, richtete sich auf und lief los.
Es ging steil bergab. Ballou rannte um sein Leben. Mitten am Hang kam ein Omaha-Krieger aus einem dunklen Schatten auf ihn zu. Beide rollten eng umschlungen abwärts, stießen gegen Bäume und Sträucher, wälzten sich an Felsen vorbei. Der Omaha entwickelte unheimliche Kräfte. Ballou hatte es schwer, den Messerstößen auszuweichen. Keuchend rollten sie in die Tiefe des Tals.
Unten stieß Sam Ballou den Omaha zurück und griff nun selbst zum Messer. Erbarmungslos stieß er zu, traf und zog das Messer zurück. Keuchend kam er hoch, sah sich mit flackernden Augen um und lief weiter.
Durchdringendes Geschrei gellte durchs Tal. Die Indianer waren hinter ihm. Sam flüchtete durch Gestrüpp, um Bäume und Felsen herum quer durch die Bergfalte. Schreiend kamen die Omaha ihm nach, mehr als zehn Krieger. Er lief so schnell wie nie zuvor. Die Felle war er los; sie lagen zusammengeschnürt auf dem Pferd. Er hatte nichts mehr zu verlieren, nur sein Leben. Er sparte an Kraft, suchte nach dem kürzesten Weg. Hinter ihm sprangen die Omaha über die Sträucher hinweg. Er sah nicht zurück. Nur was vor ihm lag, war wichtig. Er durfte keine Sekunde vergeuden. Rechts von sich hörte er Füße den Hang hinunterlaufen. Sam biss die Zähne zusammen und arbeitete sich bergauf. Genau das würden die Rothäute nicht erwarten.
Als er oben war, brach er vor Erschöpfung fast zusammen, schleppte sich nur mühsam weiter.
Die Indianer suchten ihn unten im Tal.
„Ich bring sie alle um“, keuchte er vor sich hin. „Ich komme wieder und mach sie alle fertig. Alle!“
Er taumelte wie betrunken weiter. Die Wildnis bot ihm tausend Verstecke, doch nirgendwo kroch er unter. Ihn beschäftigte nur ein Gedanke: irgendwo musste es ein Fort geben mit Soldaten. Dahin musste er. Dort musste er Soldaten holen, um die verfluchten Rothäute abzuschlachten. Stundenlang torkelte er so in die Richtung, in der er das Fort vermutete. Ob es auch wirklich dort zu finden war? Sam wollte es nicht bezweifeln.
Er lief und lief in der glühenden Hitze des Tages.
Fauchend wirbelte ein Tomahawk durch das Laub der Bäume. In letzter Sekunde warf Dan Oakland sich nach vorn, und die Streitaxt sauste über ihn hinweg und bohrte sich in die Rinde eines Baumstammes.
Aufwiehernd raste das Pferd mit ihm los. Zweige peitschten sein Gesicht. Schrilles Kriegsgeheul gellte durch die Wildnis. Schemenhaft schnellten Indianer in großen Sprüngen über die Sträucher hinweg, durchbrachen das Dickicht und hetzten dem Reiter nach. Pfeile fuhren durch die Baumlücken und bohrten sich in die Stämme. Taufeuchte Blätter streiften die knochigen Gesichter der Omaha und verwischten die Kriegsfarben.
Mitten im Galopp drehte Dan sich im Sattel um und feuerte blindlings zurück, nur um sie sich vom Leib zu halten. Treffen konnte er nicht. Das Pferd donnerte durch Senken und polterte über Luftwurzeln. Ein ganzer Indianerstamm schien ihm zu folgen. Der Wald rauschte, überall schnellten Krieger durch die Baumschatten.
Keuchend raste das Pferd aus dem Waldgebiet in die Ebene hinaus. Atemlos hielt Dan an und blickte zurück.
Kein einziger Krieger brach aus dem Wald hervor. Die Schreie waren verhallt. Nirgendwo war eine Bewegung.
Die Omaha hielten sich verborgen. Es war so, als hätte es sie nie gegeben. Über den Wäldern hing Dunst.
Langsam ritt Dan Oakland weiter. Hier im Jagdgebiet der Omaha-Indianer würde er wohl kaum die Freundschaft des Roten Mannes gewinnen. Für sie war er ein Weißer. Er sah wie ein Trapper aus, wie jene Männer, die mit dem Blutbad begonnen hatten. Dan aß etwas im Sattel. Das Pferd trug ihn auf die zerklüfteten Anhöhen zu.
Er konnte nicht zurück. Die Indianer versperrten ihm den Weg. Die Wildnis nahm ihn wieder auf. Und die Krieger folgten ihm weiter.
Manchmal entdeckte Ballou Spuren. Die Indianer waren überall. In der Mittagszeit machte er ein Rauchsignal aus. Sie suchten nach ihm. Lange Jahre war Sam Waldläufer gewesen. Jetzt zahlte sich das aus. Er hielt durch und wich allen gefährlichen Wegstrecken aus. Nachts verkroch er sich wie ein todwundes Tier, kauerte sich im Dickicht zusammen und schlief. Tagsüber schlich er durch die Schattenfelder der Berge und Wälder. Er hatte kein Wasser. Er durfte nicht auf Wild schießen. Mit dem Messer kam er nicht an das Rotwild heran. Bohrender Hunger trieb ihn weiter. Er aß einmal eine Schlange, die er über einem rauchlosen Feuer gebraten hat. Der Wille zum Überleben in Sam war ungebrochen. Dann sah er Weideland. Rinder standen im geschützten Tal, bewacht von Cowboys. In dunstiger Ferne sah er die Ranch. Bärtig, abgezehrt und zerschunden kam er den Hang herunter und brach zusammen. Die Cowboys kamen herangeritten, saßen ab und betrachteten ihn.
„Ein Trapper. Sieht verdammt runtergekommen aus. Kommt bestimmt aus dem Indianerland.“
Ein anderer nickte. „Die Indsmen werden immer dreister, wagen sich schon in unser Gebiet.“
„Bringen wir ihn zur Ranch“, sagte ein dritter Cowboy.
Aus trüben Augen sah Ballou auf. Er ließ sich auf ein Pferd heben und kippte schwer nach vorn.
„Du hast verdammt viel durchgemacht, wie?“, dehnte ein Cowboy. „Aber jetzt hast du’s geschafft. Wir bringen dich zur Ranch. Bestimmt hast du uns viel zu erzählen. Vielleicht bringt das unseren Boss auf andere Gedanken. Du kommst uns wie gerufen.“
Langsam ritten sie mit ihm durchs Tal.
Dan kam aus den Bergen geritten. Tagelang war er unterwegs gewesen. Sein Gesicht war unrasiert. Es war früher Morgen und empfindlich kühl. Raureif lag auf dem langen Fellmantel. Er hielt an und stützte sich aufs Sattelhorn. Hinter ihm waren die Berge, vor ihm lag Cole Savages Weideland. Langsam schweifte sein Blick über die weiten Hänge. Das Blätterwerk der Bäume hatte sich bereits verfärbt. Es war windstill. Die Morgennebel lagen reglos auf dem Boden. Von fern tönte dumpfes Rindermuhen herüber. Langsam ritt Dan weiter.
Er war groß und sehnig und wirkte abgezehrt. Die grauen Augen musterten die Ranch. Er bewegte sich kaum im Sattel, als er durchs Tal ritt.
Der Winter war noch fern, doch er war schon zu ahnen. Die Tage waren kürzer geworden, die Nächte kälter. Als Dan die Ranch erreichte, sah er zum ersten Mal Sam Ballou. Der Trapper hatte sich von den Strapazen erholt und lehnte am Haus. Im Mundwinkel steckte eine Pfeife.
Dan brachte das Pferd zum Stall und überquerte den Hof. Mehrere Cowboys standen vor dem Schlafhaus. Sie hatten verschlossene Gesichter. Dan rückte den Mantel zurecht und trat über die Türschwelle. Dann stand er dem stämmigen Cole Savage gegenüber.
„Die anderen wissen’s schon“, sagte er gerade und schob Geld über den Tisch. „Nehmt! Das ist der letzte Lohn. Im Frühjahr kommt wieder vorbei. Dann kann ich jeden Mann brauchen.“
Der Rancher machte eine Pause, um dann fortzufahren:
„Ich weiß, das passt euch nicht, aber ich kann’s nicht ändern. Im Winter stehen die Herden in geschützten Tälern. Da brauch ich nur ein paar Mann. Euch muss ich entlassen. Und ihr? Ein paar von euch werden sich in der Stadt im Saloon besaufen und mich in die Hölle wünschen. Andere werden nach einem neuen Job suchen, und ich, ich will hoffen, dass ...“
Die beiden Cowboys öffneten die Tür.