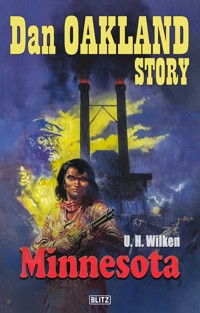3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Dan-Oakland-Story
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Schüsse im GeistercampEine Horde Banditen glaubt, dass Dan Oakland Gold mit sich führt. Sie wollen ihn und seinen Sohn töten. Dan Oakland flieht, bringt Sky in Sicherheit und stellt sich zum Kampf.California TrailEin Siedlertreck durchquert auf seiner Reise nach Kalifornien das Land der Mormonen. Der fanatische Bischof John D. Lee hetzt seine Glaubensbrüder auf und kann sogar die Shoshoni-Indianer überreden, den Treck anzugreifen. Dan Oakland ist in der Nähe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 269
Ähnliche
Dan Oakland Story
In dieser Reihe bisher erschienen
4301 U. H. Wilken Lockruf der Wildnis
4302 U. H. Wilken Teufelsbrigade
4303 U. H. Wilken Die Feuertaufe
4304 U. H. Wilken Der weiße Büffel
4305 U. H. Wilken Das Aufgebot des Bösen
4306 U. H. Wilken Grausame Grenze
4307 U. H. Wilken Omaha-Marter
4308 U. H. Wilken Blutige Säbel
4309 U. H. Wilken Der Unbezwingbare
4310 U. H. Wilken California-Trail
4311 U. H. Wilken Berg der zornigen Götter
4312 U. H. Wilken Die Teuflischen
U. H. Wilken
California-Trail
Der Text wurde anhand der Originalmanuskripte des Autors sorgfältig überarbeitetet und um bisher unveröffentlichte Textpassagen ergänzt. Der Abdruck erfolgt mit ausdrücklicher Genehmigung von Detlef Wilken.
Dieses Buch enthält die Einzelromane:
Schüsse im Geistercamp
California Trail
Diese Reihe erscheint als limitierte und exklusive Sammler-Edition!Erhältlich nur beim BLITZ-Verlag in einer automatischen Belieferung ohne Versandkosten und einem Serien-Subskriptionsrabatt.Infos unter: www.BLITZ-Verlag.de© 2022 BLITZ-Verlag, Hurster Straße 2a, 51570 WindeckRedaktion: Alfred WallonTitelbild: Rudolf Sieber-LonatiUmschlaggestaltung: Mario HeyerVignette: Wiktoria Matynia/123RF.comSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-089-5Dieser Roman ist als Taschenbuch in unserem Shop erhältlich!
Schüsse im Geistercamp
Überall in den Bergfalten, an allen Gewässern und auf allen Anhöhen suchten Tausende von Männern nach Gold. Abenteurer, Kaufleute, Gelehrte, Väter, Söhne. Am Pikes Peak war der Goldrausch ausgebrochen!
Langsam richtete Melford sich auf und blickte zu seinem Partner hinüber.
Auch Sanders sah auf. Sie nickten sich kaum merklich zu, lächelten schwach und machten weiter.
„Wir müssen in der Nacht verschwinden“, sagte Melford dunkel. „Wenn die anderen das wittern, sind wir erledigt.“
„Die Beutel liegen in der Packtasche“, antwortete Sanders leise. „Ich werde das verdammte Gefühl nicht los, daß wir beobachtet werden!“
„Für Gold tun die Burschen alles“, ächzte Melford. „Dafür schlagen sie sich gegenseitig tot. Wir können keinem einzigen trauen.“
Die Sonne stand schon tief über den Bergzügen. Ihre Strahlen streiften die Wipfel der Fichten. Lange Schatten krochen in das Tal.
„Du kannst mir vertrauen, Melford“, murmelte Sanders. „Wir beide sind reich. Ich werde verdammt froh sein, wenn ich wieder zu Hause bin. Zwei Jahre in diesen Bergen, das ist eine verflucht lange und harte Zeit.“
„Es hat sich gelohnt.“ Melford seufzte schwer und stapfte aus dem Fluss. Er warf die Schüssel zu Boden und verharrte unter den windzerzausten Fichten. Sein Blick schweifte forschend durch das Tal und über die Goldsucher hinweg. Die Dämmerung fiel in das Bergtal. Hell loderten die Feuer. Weit hinten schrie ein Mann frohlockend auf und sprang umher.
„Er ist verrückt geworden“, meinte Sanders und kam aus dem Fluss. „Ein paar Unzen Gold, und schon dreht er durch.“
Melford nickte und starrte umher. Sein Blick traf auch die Höhle hoch oben. Dort kauerte Johns am Boden und rauchte. Er befand sich im Schattenfeld des Berges und war kaum zu erkennen.
„Es gibt auch welche, die nichts tun“, knurrte Melford, „die immer herumsitzen und auf irgendetwas warten. Der Kerl da drüben gefällt mir nicht.“
Sanders verengte die Augen und blickte angestrengt zur Höhle.
„Ja“, dehnte er, „wir müssen auf solche Kerle aufpassen. Am Pikes Peak sind schon viele umgebracht worden.“
Sie gingen zum Zelt. In diesem Moment zog Johns sich in die Höhle zurück. Sanders entfachte ein Feuer und schob die Pfanne mit dem Bohnenbrei auf die Flammen.
„Essen wir erst einmal. Wir haben einen weiten Weg vor uns.“
Sie hockten sich hin und aßen wenig später. Die Sonne ging unter, und die Nacht brach herein.
„Legen wir uns für ein paar Stunden hin“, brummte Melford nach dem Essen. „Noch ist es hier nicht ruhig geworden.“ Er blickte zum Himmel empor. „Ein paar Sterne. Die Nacht wird nicht sehr hell.“
„Das ist nur gut für uns.“
Sie krochen in das Zelt und legten ihre Waffen bereit. Gleich darauf schliefen sie ein.
Schattenhaft verschwommene Gestalten glitten aus der Höhle. Schwach schimmerten die Waffen im Sternenlicht. Die Männer traten zusammen und wisperten miteinander. Dann kamen sie den Hang herunter. Johns hob die Hand, sofort blieben die Komplizen stehen. Wachsam blickte Johns zur Baumgruppe hinüber, die abseits vom Camp stand.
Dort bewegte sich jemand, zog an seinem Zigarillo und ließ die Glut aufleuchten.
„Savage wartet mit den Gäulen!“, rief Johns leise. „Alles in Ordnung.“
Sie gingen weiter und trennten sich plötzlich. Jeder nahm einen anderen Weg. Sie mischten sich unter die Goldsucher, standen abseits der Feuer, sprachen mit einigen Diggern. Dann verschwanden sie zum Fluss hin und tauchten in den tiefen Schatten der Bäume.
Der Nachtwind trieb den Rauch durch das Tal. Nicht weit von Melfords Zelt begann plötzlich eine Schlägerei. Der Lärm ließ Sanders wach werden. Ächzend drehte er sich auf die Seite und richtete den Oberkörper auf. Sein Partner Melford schlief.
„Verdammter Lärm“, murmelte er kaum hörbar und kroch aus dem Zelt. Zornig blickte er zum Feuer hinüber, wo zwei Männer aneinander geraten waren und sich auf dem Boden wälzten.
„Narren!“
Sanders entfernte sich vom Zelt. Zwischen den Felsen am Ufer verharrte er und vergewisserte sich, daß er nicht beobachtet wurde. Geduckt schlich er am Ufer entlang und stieg zwischen die Felsen. Hier lag die Packtasche mit dem Gold verborgen.
Nachdenklich setzte Sanders sich.
„Gold“, flüsterte er. „Wir sind reich. Wir können uns alles kaufen. Keine Sorgen. Milly, ich bin bald bei dir.“
Er erhob sich, kletterte über die Felsen zurück und näherte sich dem Zelt des Partners.
Plötzlich vernahm er trotz der Schlägerei ein leises Knacken unter den Bäumen. Sofort ging er in die Knie und horchte. Sekunden später schon bemerkte er drei Gestalten, die unter den Bäumen entlangschlichen.
Es bestand kein Zweifel, sie wollten zum Zelt.
Ein paar Atemzüge lang wusste Sanders nicht, was er machen sollte. Er stand im Schatten und konnte nicht gesehen werden. Vorsichtig schlich er um die Bäume herum. Auf einmal konnte er das Zelt sehen. Zwei Männer hatten das Zelt erreicht, der dritte war nicht zu entdecken. Die beiden Männer hielten lange Messer in den Händen. Die Klingen glänzten kalt. Jetzt holten die beiden aus.
Sanders schrie auf. Er konnte nicht anders, er wollte den Partner warnen. Doch es war zu spät.
Die Messer fuhren durch die Zeltplane in Melfords Körper.
Scharf peitschte ein Schuss unter den Bäumen. Sanders schwankte heftig, ließ sich fallen. Die Schulter war getroffen, er konnte sie kaum bewegen. Er verbiss die Schmerzen und kroch zwischen die Bäume.
Die beiden Männer, die Melford umgebracht hatten, rissen das Zelt weg und wühlten in den Ausrüstungsgegenständen.
„He, was ist da los?“, rief jemand herüber. „Seid ihr verrückt geworden?“
Fluchend ließen die Halunken von den Gegenständen ab, hasteten zurück.
Sanders blutete stark. Vor Schmerzen kamen ihm die Tränen. Er hatte sich halb aufgerichtet und näherte sich den Felsen am Fluss. Immer wieder legte er die Hand auf die Schulter und horchte.
Die Feinde waren in der Nähe. Sie lauerten im Dunkel. Er konnte sie nicht sehen, er wusste auch nicht, mit wie vielen Gegnern er es zu tun hatte. Erbarmungslos hatten sie Melford erstochen. Sie würden ihn, Sanders, ebenso gnadenlos umbringen. Er musste sich verbergen, sich wie ein angeschossener Wolf verkriechen.
Noch immer schallten die Stimmen der Goldsucher herüber. Ein paar Männer liefen los und entdeckten den leblosen Melford.
„Diese Schweine! Sie haben Melford umgebracht! Wir müssen mit diesen Halunken Schluss machen!“
Stöhnend biss Sanders die Zähne zusammen. Der Schmerz raubte ihm die klaren Gedanken. Er konnte versuchen, zu den anderen Goldsuchern zu gelangen, doch er dachte nur an das Gold. Wie betrunken torkelte er zum Fluss und schleppte sich über die Felsen, sackte neben der Packtasche zusammen und schloss die Augen.
Johns und seine Komplizen verbargen sich.
Die Goldsucher, vom Feuerschein noch geblendet, kamen unter die Bäume. Sie suchten nicht lange nach den Halunken und kehrten zu Melford zurück.
Mühsam kam Sanders hoch. Die Nacht schützte ihn. Mit der Kraft der Verzweiflung zerrte er die schwere Packtasche hinter sich her und taumelte am Fluss entlang.
Blut tropfte.
Wie aus weiter Ferne hörte er eine Stimme. Von nun an, so glaubte er, war jeder Mensch sein Feind. Gerade noch rechtzeitig konnte er sich hinter einem Baum verbergen. Vor ihm flackerte ein Feuer. Mehrere Goldsucher hatten sich erhoben. Sie hörten die Stimmen der anderen Digger, die sich bei Melford zusammengerottet hatten.
„Das seh’ ich mir an!“, knurrte einer und lief los. Die anderen folgten ihm.
Langsam kam Sanders hervor, schwankte zu einem der Maultiere und lud die Packtasche auf. Zitternd zog er sich auf das Tier und ritt los.
Nur ein einziger Gedanke beseelte ihn. Er wollte so schnell wie möglich aus diesem Tal verschwinden. Hier war er seines Lebens nicht mehr sicher.
Das Maultier trug ihn durch das Tal.
Noch waren Johns und seine Komplizen am Fluss. Niemand von den Goldsuchern hatte sie erkannt.
Allmählich entfernten sich die Digger. Einer deckte Melford mit der zerfetzten Zeltplane zu.
Johns fluchte unterdrückt.
„Wir müssen ihn finden! Los, weiter. Er kann nicht weit sein.“ Er wandte sich an einen Komplizen: „Buddy, du hast ihm doch eins verpasst?“
„Natürlich. Ich sah, wie er zuckte, dann war er weg.“
Johns nickte. Gemeinsam suchten sie am Fluss, zwischen den Felsen und Bäumen. Einer von ihnen entdeckte die Blutspur, die in der Nacht kaum zu erkennen war.
„Jetzt kriegen wir ihn“, raunte Johns. „Buddy, du hast ihm ein schönes Ding verpasst.“
Langsam folgten sie der Spur.
Unter den Bäumen verloren sie die Spur.
„Welcher Idiot hat eins von den Maultieren genommen?“, drang eine Stimme voller Wut herüber. „Ein Maultier ist weg!“
Die Goldsucher stritten sich, jeder gab dem anderen die Schuld. Johns lauschte den Stimmen und grinste mit schlimmer Zufriedenheit.
„Er hat sich das Maultier genommen“, dehnte er. „Auch mit dem Vieh kommt er nicht weit. Jim, geh zu Savage. Kommt mit den Pferden zum Fluss.“
Der Komplize nickte und lief davon.
Bald kamen er und Savage mit den Sattelpferden aus der Baumgruppe und ritten gemächlich und unauffällig zum Fluss. Dabei machten sie einen großen Bogen um Melfords Claim.
Sie verloren viel Zeit.
Wolken zogen über die Berge und verdunkelten den Himmel. Der Mond kam nur ab und zu aus einer Wolkenlücke hervor.
Sechs Männer ritten durch das Tal.
Nur sehr langsam kamen sie voran. Viele Spuren von Maultieren, Pferden, Wagen und Karren führten durch das Tal. Es war unmöglich, die Spur eines einzelnen Maultieres herauszufinden.
Johns gab die Suche vorübergehend auf.
„Wir müssen bis zum Morgen warten. Es gibt nur zwei Talausgänge. Er hat diesen Weg genommen, aber wohin er geritten ist, können wir nicht sehen. Vor dem Tal rasten wir. Wenn es hell wird, suchen wir die ganze Gegend ab. Vor uns gibt es viele Bergfalten und Täler. Aber wir werden ihn finden, das schwör’ ich euch!“
Sie trieben die Pferde an und verließen das Tal.
Goldgierige Banditen, die vor nichts zurückschreckten.
„Pass gut auf dich auf, mein Junge. Trau’ keinem Menschen. Ich bin bald zurück. Gott schütze dich.“
Raunend strich der Nachtwind über die Berge und trug die Worte des Mannes durch die Wildnis.
In dieser Nacht kam ein Mann aus der Wildnis des Indianerlandes geritten und verhielt vor der einsam gelegenen Pelzhandelsstation.
Im Blockhaus horchten drei Männer auf. Einer war der Händler. Unwillkürlich griff er unter den Tresen und holte ein Gewehr hervor. Hart lud er durch, richtete den Lauf auf die Tür und starrte aus engen Augen dorthin.
Die beiden Männer am Tisch nahmen die Pfeifen aus dem Mund. Ihre Hände glitten über den rauen Tisch und legten sich um die Gewehre.
Knarrend ging die Tür auf.
Groß und breitschultrig stand Dan Oakland in der Tür. Der Ausdruck einstiger Gutmütigkeit war verschwunden. Das harte, von Falten durchzogene Gesicht verriet, daß Dan Oakland viel Schweres durchgemacht hatte. Die Zeit hatte ihre Spuren in das Gesicht des Mountain Man gegraben.
Langsam trat er ein und schloss die Tür.
„Du kannst die Knarre ruhig weglegen“, brummte er, noch während er den drei Männern den breiten Rücken kehrte. „Ich bin Trapper, mehr nicht.“
Dann stapfte er durch den Raum, hielt die Hände über das Feuer im Kamin und wandte sich dem Händler zu.
„Hast du nicht gehört?“
Zögernd legte der Händler das Gewehr auf den Tresen. Forschend betrachtete er Dan Oakland.
„Du kommst aus den Bergen, Fremder?“
Dan nickte.
„Sicher, von dort, wo die Luft noch rein und frisch ist, wo ein Mann frei atmen kann. Aber ich hab’ nicht viel Zeit. Gib mir Munition, wenn du hast.“
„Ich hab’ keine. Ich hab’ Blei und alles andere, du musst dir die Dinger selber gießen.“
„Dann her damit.“ Dan blickte auf das Gewehr des Händlers. „Ein neues, wie?“
„Ja, eine Volcanic Rifle. Hast du noch keine?“
„Ich hab’ die Long Rifle.“ Dan griff zur Volcanic und betrachtete sie fachmännisch. „Ja, sie liegt gut in der Hand. Wieviel Felle willst du dafür haben?“
„Erst muss ich die Felle sehen.“
„Gut“, nickte Dan, ging hinaus und kam mit einem schweren Packen Felle und der Long Rifle zurück. Er wuchtete alles auf den Tresen und grinste den Händler an. „Die Volcanic und ein paar Kleinigkeiten für diesen Berg Felle und dazu noch die Long Rifle, einverstanden?“
Der Händler betrachtete die Felle.
„Du hast gute Jagdgebiete.“
„Die besten, und es wird noch besser, wenn ich mit meinem Jungen weiterziehe.“
„Ich bin einverstanden.“ Der Händler schob Dan Oakland die Volcanic zu. „Ich hab noch zwei davon. Du verstehst was von Gewehren, wie?“
Ernst blickte der eiserne Dan auf.
„Davon hängt mein Leben ab, und das meines Sohnes. Der Junge wartet auf mich in den Bergen. Ich will ihm was mitbringen.“
Suchend sah Dan in die Regale hinter dem Tresen. Stilles Lächeln lag auf seinem Gesicht. Er musste an seinen Sohn Sky denken.
„Gib mir eine Handvoll davon“, brummte er und zeigte auf Kandis. „Darüber wird er sich freuen.“
Wenig später packte Dan Oakland alles zusammen und verließ schweigend die Handelsstation.
Hufschlag entfernte sich.
Nachdenklich sah der Händler auf die geschlossene Tür.
„Ein seltsamer Mann“, sprach er vor sich hin. „Wie ein Wolf und ein Bär zusammen. Er ist wie die Wildnis, er ist ein Stück davon. Er hat Pranken wie Bärentatzen. Habt ihr seine Augen gesehen? Sie sind grau, als wäre Rauch darin.“
Einsam ritt der eiserne Dan Oakland durch die Nacht, in Leder und Pelz gehüllt, in Gedanken schon weit voraus. Er ahnte nicht, daß der Tod zur Hütte in den Bergen kommen sollte. Witternd hob er die Nase und roch in den Wind. Vor ihm buckelten sich die bewaldeten Berge, sank das Land zu tiefen Tälern hinab. Hinter ihm versickerte der Lichtschein der Handelsstation. Er klopfte seinem Pferd den Hals.
„Ich mach mir Sorgen um den Jungen, Alter“, murmelte er vor sich hin. „Ich hätte Sky doch mitnehmen sollen, oder zu den Sioux bringen müssen.“
Er trieb das Pferd vorwärts und ritt schneller. Die Wildnis rief Catch-the-Bear Dan Oakland.
Erschöpft, entkräftet und schwankend saß Sanders auf dem Maultier. Seine Augen waren trüb, das Fieber wütete in seinem Körper. Er wusste nicht, wohin das Maultier ihn trug. Manchmal blieb es stehen und fraß, trottete dann weiter. Irgendwohin.
Wirre Worte kamen über Sanders’ Lippen. Der Staub haftete auf seinem schweißnassen Gesicht. Das Blut, das durch die Jacke gedrungen, war verkrustet.
Röhrend lief das Maultier durch die Wildnis. Immer höher wurden die Berge, immer tiefer die Täler und Schluchten.
Sanders hatte keine Chance mehr.
Er wusste es nicht. Er konnte an nichts denken. Das Fieber nahm ihm die Willenskraft. Alles Gold der Erde nützte ihm nichts mehr.
Dennoch quälte er sich weiter, als gäbe es noch irgendwo eine Rettung.
Wie lange er nun schon auf dem Maultier in die Einsamkeit flüchtete, wusste er nicht.
Es waren viele Meilen.
Der Abend dämmerte.
Das war der Augenblick, da Sanders noch einmal und zum letzten Mal das volle Bewusstsein wiedererlangte. Seine Augen sahen auf einmal klar. Er schien alles überwunden zu haben, er konnte sogar den Oberkörper aufrichten.
Vor ihm war der bewaldete Hang einer Bergflanke. Hohe Sträucher säumten einen natürlichen Pfad, der in die Höhe führte. Blumen leuchteten im letzten Licht des Tages.
Und oben stand eine Hütte.
Nur der Zufall hatte Sanders zu diesem Berg geführt. Ein Zufall, der schicksalhaft werden wollte.
Seine Hände rutschten vom Hals des Maultieres ab. Stöhnend hob er den Kopf. Das Maultier kletterte den Pfad empor. Sanders wollte sich auf dem Rücken halten, doch das Tier ruckte zu scharf, und er stürzte schwer. Sofort blieb das Maultier stehen und fraß.
Mit geschlossenen Augen, das graue Gesicht fratzenhaft verzerrt, kam Sanders hoch und schwankte gegen das Maultier. Es gelang ihm, die Packtasche zu lösen. Torkelnd bewegte er sich auf die Hütte zu.
Oft brach er in die Knie. Die letzten Yards kroch er nur noch und schleifte die Packtasche hinter sich her.
Röchelnd hielt er inne und stierte zur Hütte hinauf.
Dort stand ein Junge.
Die letzten Sonnenstrahlen fielen gegen die Bergflanke und ließen das schwarze Haar des Jungen glänzen. Sein Gesicht war braun, die Augen blickten unruhig auf den fremden Mann.
„Komm her“, flüsterte Sanders mühsam. „Hilf mir doch!“
Doch der Junge rührte sich nicht.
„Mein Gott“, röchelte Sanders und schleppte sich weiter. Er kroch auf den Jungen zu und erschlaffte vor ihm, rollte auf den Rücken und starrte den Jungen an. Er erkannte schon nicht mehr, daß der Junge ein Halbblut war.
Zitternd schob Sanders die Packtasche über den Boden. Wieder verließen ihn die Kräfte. Die Schulterwunde war aufgerissen und blutete stark.
„Nimm … diese Tasche … und versteck sie gut!“
Sanders’ Worte waren kaum zu verstehen. Der Junge kniete auf einmal neben ihm und beugte sich vor.
„Die Tasche“, hauchte Sanders. „Gold …“
Er atmete pfeifend. Das Fieber überfiel ihn wieder. Er zitterte und bewegte die flatternden Hände über den Boden.
Der Junge schluckte und blickte auf die schwere Packtasche.
„Du hast Gold?“, fragte er. „Was ist das, Gold?“
Sanders hörte ihn nicht.
In den Bäumen war der Wind. Kühl kam die Luft aus dem tiefen Tal herauf. Über den Bergen ging der Mond auf. Nebelfelder hüllten die Niederungen ein.
Es war der letzte Abend in Sanders’ Leben. Niemals würde er die Sonne wieder aufgehen sehen.
Das Maultier fraß und drängte sich zwischen die Sträucher.
Ratlos sah der Junge in das Gesicht des Fremden. Er wollte ihm helfen, doch er wusste nicht, wie er das tun sollte.
Schließlich erhob er sich und packte die Hände des Mannes. Mit einer Kraft, die niemand diesem Jungen zugetraut hätte, zog er Sanders über den Platz bis vor die Hütte. Dann holte er Wasser aus der Hütte und goss es über Sanders’ Gesicht. Der Schwerverwundete stöhnte nur.
Lange starrte der Junge auf ihn. Zögernd ging er zurück und packte die Tasche. Er schleppte sie heran und ließ sie neben der Hütte liegen.
Wieder setzte er sich zu Sanders auf den Boden. Er sah, wie das Blut hervorsickerte. Niemand konnte es stillen, niemand konnte Sanders helfen.
Sterne funkelten am weiten Himmel. Die Wölfe waren wieder unterwegs. Ihr Heulen tönte durch die stille Bergwelt.
„Sie kriegen dich nicht“, sagte der Junge leise. „Wenn mein Vater zurückkommt, dann wird er dich begraben.“
Er wusste, daß der Mann sterben würde. Und er hatte auf einmal Angst, mit einem Toten allein zu sein. Mit einem nassen Tuch tropfte er die Stirn des Sterbenden ab, als könnte er ihm damit helfen.
Sanders öffnete plötzlich die Augen. Sie waren so trüb wie schmutziges, aufgewühltes Wasser. Er starrte durch den Jungen hindurch.
„Milly … ich komm … zurück. Liebe Milly, ich …“
Die Stimme verwehte.
Starr blickten die Augen des Toten in den Sternenhimmel. Das Gesicht schien zu gefrieren und wurde furchtbar bleich.
Der Junge rührte sich lange Zeit nicht. Er konnte den Blick nicht vom Totenantlitz lösen.
Schließlich sprang er auf, hastete in die Hütte und zerrte die Tür zu. In der dunklen Hütte kauerte er auf das Schlaflager und horchte nach draußen.
Leise winselte es auf dem Berg. Die Seele des Toten schien klagend zu rufen.
„Trau’ keinem Fremden.“
Sky glaubte, die Stimme seines Vaters zu hören. Langsam verließ er das Lager und öffnete die Tür.
Der Tote lag noch immer vor der Tür. Im kalten Mondlicht war es ein schrecklicher Anblick.
Die Tür fiel wieder zu.
Und die Zeit verging.
Plötzlich trappelten Hufe heran. Vor der Hütte sprang der Reiter ab. Er stürzte zur Tür und öffnete sie mit einem Ruck.
„Sky!“, brüllte er.
Fest nahm Dan Oakland seinen Sohn in die Arme, hob ihn hoch und presste ihn an sich. Beim Anblick des Fremden hatte Dan das Schlimmste vermutet, und was auch immer geschehen sein mochte, jetzt war er glücklich.
Er setzte Sky ab und verließ die Hütte. Sky folgte ihm. Mit oft stockender Stimme berichtete Sky, was er erlebt hatte. Er zog die Packtasche heran, und Dan Oakland öffnete sie, holte einen der vielen Beutel hervor und löste die Lederschnur. Im Sternenlicht erkannte er das Gold.
Nachdenklich blickte er auf den Toten.
„Ein Vermögen, Sky. Und irgendein Mensch, der dieses Gold besitzen wollte, hat ihm die Kugel verpasst. Vielleicht hätte dieser Mann es geschafft und durchgehalten, wenn er durch die schwere Arbeit nicht völlig ausgezehrt gewesen wäre. Wir müssen ihn begraben.“
So geschah es.
Und wieder betrachtete Dan das Gold.
„Das Gold macht nicht glücklich, mein Junge. Die Menschen bauen sich davon große Häuser, aber in diesen Häusern kann man nicht atmen. Du bist nur frei wie die Vögel, wenn du dir nur das nimmst, was du unbedingt brauchst. Was sollten wir beide mit dem Gold anfangen? Die Berge verlassen? Nein, mein Junge, wir brauchen es nicht.“
Er nahm die Packtasche und warf sie in das Gestrüpp neben der Hütte. Die Zweige schlugen über der Tasche zusammen.
Raues Lächeln zog über sein Gesicht. Er legte die Hand auf Skys Schulter und ging mit ihm in die Hütte. Dort holte er die Portion Kandis hervor. Sky freute sich, und während er Kandis lutschte, packte Dan die Sachen zusammen.
„Gehen wir fort, Dad?“
„Ja, Sky, weiter in die Berge hinauf. Die Zeit ist günstig. Ich habe die Camps der Goldsucher gesehen. Irgendwann werden sie wohl auch hier nach dem verdammten Gold graben. Unser Zuhause ist die Wildnis.“
Sky war ein großer kräftiger Junge geworden, der schon so manche Strapazen aushalten konnte. Das Blut eines starken und eisernen Mannes und einer zärtlichen Indianerin floss in seinen Adern. Er verstaute den restlichen Kandis und half seinem Vater.
Dann war der Moment gekommen, da sie Abschied von der Hütte und diesem Berg nehmen mussten.
„Es war ein gutes Zuhause“, murmelte Dan Oakland und versank in der Erinnerung an all die Jahre, als in diesem weiten Land nur wenige Weiße gelebt hatten, da er seine Frau und Skys Mutter kennengelernt hatte. Dunkel wie die Wolken eines Unwetters waren die Tage blutiger Ereignisse heraufgezogen. Dieses Land hatte schon viel Blut aufgesogen. Immer mehr Blut würde fließen. Und der eiserne Dan Oakland sehnte sich nach dem Frieden der fernen Wildnis.
Er hob Sky auf das Pferd und saß auf. Sie ritten hinunter und durch das tiefe Tal. Das Röhren des Maultieres tönte vom Berg herunter.
„Die Wölfe werden es töten“, sagte Dan zu seinem Jungen.
Sky nickte. Er war in diesen Mountains aufgewachsen, er hatte unter den Dakota-Sioux gelebt, und eines Tages würde er so sein wie sein Vater.
Sie ritten in ein fast noch unberührtes Land auf der Suche nach einem neuen Zuhause.
Das schaurige Heulen der Wölfe übertönte das klägliche Schreien des Maultieres.
Heftig riss Johns am Zügel und verhielt vor seinen Komplizen. Völlig reglos saß er im Sattel und lauschte. Die düsteren Augen flackerten; soeben noch hatten sie triumphierend durch das Tal gesehen und die Spur des Maultieres betrachtet.
„Die Wölfe haben was gewittert!“, stieß er heiser hervor.
„Ich höre ein Maultier“, ächzte der untersetzte Buddy. „Die Wölfe machen es fertig.“
Graue Schatten huschten den Hang empor. Schlagartig erstarb das Heulen. Der Schrei des Maultieres erstickte.
Die Banditen peitschten die Pferde vorwärts und zogen die Gewehre, luden durch und jagten durch das Tal. Der blonde Savage mit dem Kindergesicht entdeckte als erster den Pfad und die Hütte zwischen den Bäumen. Rücksichtslos trieben sie die Pferde den Pfad empor. Sie feuerten auf die Wölfe, die jaulend im Gestrüpp verschwanden.
Zerrissen lag das Maultier vor den Banditen. Sie drängten die Pferde weiter und sprangen aus dem Sattel. Geduckt rannten sie auf die Hütte zu. Von allen Seiten kamen sie heran, goldgierige und hemmungslose Schießer, denen kein Leben heilig war. Sie hasteten an dem Grab vorbei und erreichten die Tür der Hütte. Johns machte ein Zeichen. Der rothaarige Ire O’Henry riss die Tür auf. Johns, Buddy und McGraw feuerten in die Hütte hinein und sprangen nach.
Die Hütte war verlassen. Nicht ein einziges Fell lag auf dem Schlaflager. Unordnung herrschte. Mondlicht fiel herein.
„Dieses Schwein!“, fauchte der schwarzhaarige Jim voller Wut und Enttäuschung. „Er ist weg mit dem Gold!“
Sie alle gerieten in Wut und zerstörten alles, was sich noch in der Hütte befand. Als erster verließ schnaufend und fluchend der dickleibige Buddy die Hütte und wischte sich den Schweiß vom vollen Gesicht. Er lauschte dem Winseln eines sterbenden Wolfes und blickte suchend umher. Dabei entdeckte er das frische Grab. Langsam ging er darauf zu, während seine Komplizen nach wie verrückt wüteten. Er beugte sich hinunter und befühlte die Erde.
„Johns!“, schrie er. „Komm mal her!“
Von den Komplizen gefolgt, stürzte Johns ins Freie und rannte heran.
„Es ist noch ganz frisch, Johns“, dehnte Buddy schwer. „Hier ist jemand eingescharrt worden.“
Düster starrte Johns auf das Grab. Die Narbe an seinem Kinn glühte.
„Seht nach!“
Selbst vor Toten hielten sie nicht inne. Gemeinsam fielen sie über das Grab her und schaufelten mit den bloßen Händen die Erde weg, legten Sanders frei und blickten sich starr an.
Da war Johns, hager und gefährlich, gewissenlos. Er hatte das Gold zu seinem Götzen gemacht.
Da war Buddy, dick und schwer, ewig schwitzend.
Jim, der schlanke, schwarzhaarige Bursche, für den es neben dem Gold nur noch Frauen, Mord und Totschlag gab.
Savage, das Baby Face. Dieser Bandit mit den weichen Gesichtszügen und dem sinnlichen Mund.
O’Henry, stur und trotzdem hitzig, der vor Jahren aus Irland ausgewandert war.
Und da war McGraw, barbarisch-grausam in seinen Vorstellungen und Taten.
Das war das Rudel des Bösen!
Sie stierten sich an. Jeder überlegte, bis Johns das Schweigen brach.
„Schießt endlich den verfluchten Wolf tot!“
McGraw entfernte sich, suchte im Gestrüpp nach dem Wolf und jagte ihm eine Kugel in den Kopf.
„Die Hütte war bewohnt“, überlegte Johns, „das Grab ist noch frisch, die Wölfe haben nicht lange gebraucht, um das Maultier zu wittern. Wir müssen überall nach einer Spur suchen! In dieser Hütte muss ein Trapper gehaust haben. Er hat das Gold genommen!“
Nach Johns’ Worten sprangen sie sofort auf die Pferde und ritten davon, polterten den Hang abwärts, suchten wie Bluthunde.
Sie fanden die Spur.
Danach kehrten sie zurück und suchten nach dem Gold.
Doch keiner entdeckte die Packtasche unter dem Strauch.
Nun glaubten sie, dass jener Reiter das Gold mitgenommen hatte. Und wieder schwangen sie sich auf die Pferde und verließen den Berg. Hoch wirbelte der kalte Staub auf. Am Fuß des Berges rotteten sie sich zusammen.
Der Wind trug ihre Stimmen in das Tal. Sie spornten die Pferde an und folgten der Spur.
Die Treibjagd hatte begonnen!
„Was siehst du am Himmel, mein Junge?“ Dan Oakland blickte von der Bergkuppe aus nach Norden.
„Bald wird es wieder Tag, Dad.“
„Spürst du es nicht, Sky? Ein Druck ist in der Luft.“
„Ja, Dad. Es wird bald regnen.“
Lächelnd nickte Dan und ritt weiter. Durch den Hochwald mit seinen schlanken Stämmen sickerte schon das erste Tageslicht. Wild brach vor ihnen aus dem Dickicht und hetzte in die grauen Schattenfelder.
„Das Wild wird häufiger“, murmelte Dan zufrieden. „Wenn wir bald auf Büffelherden stoßen, dann wissen wir, dass unser Land beginnt.“
Langsam ritten sie tiefer.
An diesem Morgen wollte es nicht hell werden. Gewitterwolken zogen herauf und verhüllten die Sonne.
Dan Oakland hielt an, als sie eine Felsengruppe am Berg erreicht hatten. Forschend betrachtete er den Rastplatz und überzeugte sich davon, dass selbst stürzende Wasser sie nicht erreichen konnten. Dan hatte Naturkatastrophen erlebt, bei denen ganze Bergflanken abgerutscht und infolge der Regenwassermassen große Wälder an den Hängen der Mountains zu mörderisch schlagenden Wäldern geworden waren.
Er dachte an die Natur und ahnte nicht, dass ein Reiterrudel ihnen folgte.
„Die Felsen schützen uns vor den Wassermassen. Wer weiß, wie schlimm das Unwetter wird.“ Er zog das Pferd zwischen die Felsen und sammelte dann Holz im Wald. Sie verbargen es unter einem hervorspringenden Felsen. Dort machte Dan auch ein kleines Feuer. Das Pferd bekam eine Decke übergeworfen. Schon fauchte der Wind über die Berge und fing sich in den Tälern. Die Fichten bogen sich ächzend. Zweige fielen herunter. Heftig schlugen die Äste. Regenwolken trieben heran.
Sky kauerte sich dicht am Feuer nieder. Dan packte die Volcanic und Proviant unter den schützenden Felsen.
Beide blickten hinaus in das Unwetter.
„Nicht die Unwetter werden schlimmer, es sind die Menschen.“
Jetzt begann es zu regnen. Regenschauer prasselten gegen die Bergflanke und in den Hochwald hinein. Wasser floss den Berg herunter.
Der Junge rückte an Dan näher heran, und Dan breitete über Skys Schultern ein warmes Fell.
Der Regen löschte ihre Spur.
Doch die Banditen waren nahe! Auch sie trieb das Unwetter in den Schutz von Felsen.
„Ich wäre froh, wenn ich jetzt bei den Dakota sein könnte“, sagte Sky auf einmal. „Ich erinnere mich noch an alles. Es war eine schöne Sache, Dad.“
„Du bist ein halber Indianer, Sky. Dich wird es immer wieder zu den großen Stämmen der Sioux und Cheyenne treiben. Da kannst du machen, was du willst.“
„Ja, Dad, und wenn ich groß bin, werde ich eine Squaw heiraten.“
Sie sprachen über Vergangenheit und Zukunft, über all die kleinen Dinge des Lebens, die doch so wichtig waren. Nur der Berg trennte sie von den erbarmungslosen Verfolgern. Im Tal unter ihnen schoss das Wasser entlang.
Erst nach Stunden ließ das Unwetter nach.
Dan hatte Zeit, nichts trieb ihn zur Eile an. Sie blieben zwischen den Felsen. Plötzlich ruckte Dan nach vorn und horchte. Dumpfe Geräusche kamen näher. Sofort trat er das Feuer aus, und der Qualm wurde vom Wind weggetrieben. Dunstschleier hingen im Tal.
„Reiter“, knurrte Dan. „Das hat nichts Gutes zu bedeuten, merk’ dir das, Sky. Was suchen Reiter hier? Es müssen Weiße sein, ihre Pferde sind beschlagen.“
Sky lauschte angestrengt. Seine Augen, die wie ein weicher Abendhimmel aussahen, hatten ihm seinen Namen gegeben. Unruhig nagte er auf der Unterlippe.
„Bleib sitzen, mein Junge.“ Dan Oakland langte nach der Volcanic. Die paar Schuss Munition, die er noch besaß, nützten ihm nichts. Um seinen Jungen zu beruhigen, behielt er die Volcanic in den Händen. Sein Gesicht war angespannt und hart. Er atmete hörbar ein und starrte in den Dunst.
Die Reiter kamen um den Berg herum und lenkten die Pferde in das Tal. Sie waren nur schemenhaft zu erkennen. Dan zählte sechs Reiter. Nicht ein einziger Indianer war darunter. Er konnte die Gesichtszüge nicht deutlich genug ausmachen. Die Männer waren schwer bewaffnet.
Sie suchten im Tal.
Vorsichtig richtete Dan sich auf und glitt zum Pferd, legte die Hand auf die weichen nassen Nüstern und beobachtete argwöhnisch die Reiter.
Nass tropfte es von den Bäumen. Noch immer rauschte das Wasser herunter. Aus dem Tal tönte eine kratzende Stimme herüber.
Sky hatte sich erhoben und stellte sich neben den Vater. Er konnte die Reiter nicht mehr sehen.
„Was tun sie, Dad?“
„Sie suchen wie Hunde, reiten hin und her, starren auf den Boden. Wir sind vor dem Unwetter hier gewesen. Jetzt kommen diese Fremden.“
„Vielleicht suchen sie uns, Dad?“
Daran hatte Dan Oakland schon gedacht, hatte es seinem Jungen aber nicht sagen wollen.
„Schon möglich, Sky. Wir warten, bis sie verschwunden sind. Dann reiten wir weiter.“
„Aber dann sehen sie unsere Spur. Der Boden ist nass, die Hufe drücken sich tief ein.“
Ernstes Lächeln zog über Dans Gesicht. Er war stolz auf Sky. Der Junge bedeutete ihm mehr als alles andere.
„Richtig, Sky, aber wollen wir ewig hier bleiben? Ich denke, daß wir es riskieren können, wenn sie erst einmal aus dem Tal sind.“
Mit verkniffenen Augen beobachtete er die Reiter. Sie zogen kreuz und quer. Plötzlich kamen zwei genau auf das Versteck zu! Der schlüpfrige Boden ließ die Pferde rutschen, sie sackten ein, arbeiteten sich keuchend vorwärts. Dans Herz machte einen harten Schlag. Er fürchtete den Tod nicht. Wenn jedoch Sky diesen Männern in die Hände fallen würde, wäre auch sein Leben nichts mehr wert. Dan kannte die Menschen und ihre Gesichtszüge. Und in den Gesichtszügen von McGraw und O’Henry sah er, daß die beiden eine rastlose und rauchige Fährte ritten.
Trotzdem sagte er kein Wort zu Sky.