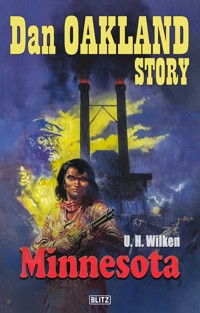Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Dan-Oakland-Story
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Schwarzer Horizont Sie sind Deserteure und ziehen eine Spur des Todes. Sie plündern und morden. Dan Oakland und sein Sohn Sky nehmen die Spur der Mörder auf. Doch die Bande weiß Bescheid. Im Gluthauch des Todes In den Südstaaten hat der blutige Bürgerkrieg an vielen Stellen verbrannte Erde hinterlassen. Dan Oakland und sein Sohn Sky finden nur verlassene Plantagen und niedergebrannte Häuser. Sie stellen sich gegen geflohene Sklaven, die ihre einstigen weißen Herren töten wollen. Ein grausamer Kampf beginnt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 255
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dan Oakland Story
In dieser Reihe bisher erschienen
4301 U. H. Wilken Lockruf der Wildnis
4302 U. H. Wilken Teufelsbrigade
4303 U. H. Wilken Die Feuertaufe
4304 U. H. Wilken Der weiße Büffel
4305 U. H. Wilken Das Aufgebot des Bösen
4306 U. H. Wilken Grausame Grenze
4307 U. H. Wilken Omaha-Marter
4308 U. H. Wilken Blutige Säbel
4309 U. H. Wilken Der Unbezwingbare
4310 U. H. Wilken California-Trail
4311 U. H. Wilken Berg der zornigen Götter
4312 U. H. Wilken Die Teuflischen
4313 U. H. Wilken In Todesgefahr
4314 U. H. Wilken Schwarzer Horizont
4315 U. H. Wilken Der Raubadler
4316 U. H. Wilken Trail aus Blut und Eisen
U. H. Wilken
Schwarzer Horizont
Der Text wurde anhand der Originalmanuskripte des Autors sorgfältig überarbeitetet und um bisher unveröffentlichte Textpassagen ergänzt. Der Abdruck erfolgt mit ausdrücklicher Genehmigung von Detlef Wilken.
Dieses Buch enthält die Einzelromane:
Schwarzer Horizont
Im Gluthauch des Todes
Als Taschenbuch gehört dieser Roman zu unseren exklusiven Sammler-Editionen und ist nur unter www.BLITZ-Verlag.de versandkostenfrei erhältlich.Bei einer automatischen Belieferung gewähren wir Serien-Subskriptionsrabatt.Alle E-Books und Hörbücher sind zudem über alle bekannten Portale zu beziehen.© 2022 BLITZ-Verlag, Hurster Straße 2a, 51570 WindeckRedaktion: Alfred WallonTitelbild: Rudolf Sieber-LonatiUmschlaggestaltung: Mario HeyerVignette: Wiktoria Matynia/123RF.comSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-100-7
Schwarzer Horizont
„Nicht schießen! Um Gottes willen, nicht ...‟
Aufbrüllend entluden sich die schweren Army Colts und hämmerten Feuer und Blei über den heißen Hof. Der Farmer sank auf der Schwelle seines Hauses zusammen. Flatternd fuhren die Hände im Todeskampf über den heißen Boden, umkrallten das Gewehr, und ein Schuss verließ den Lauf. Die Kugel traf eines der Pferde.
Während es röhrend zusammenbrach, sprangen die Männer fluchend über die Türschwelle und drangen in das kleine Farmhaus ein.
In hemmungsloser Gier polterten sie durch die Räume, suchten nach Raubgut und zerstörten alles.
Leblos lag der Farmer in der Sonne.
Schon längst ruhte seine Frau in einem Grab unter den alten Bäumen. Niemand hatte ihm beistehen können. Seine Söhne waren im Bürgerkrieg verschollen.
Staub zog in Schwaden durch die zertrümmerten Fenster. Sporen klirrten an staubigen Soldatenstiefeln. Unruhig stampften die Pferde auf dem Hof. Neben dem erschossenen Pferd stand ein junger Mann und verfluchte den toten Farmer.
Jetzt kamen die grausamen Banditen in den zerfetzten Uniformen aus dem Haus.
Sie hatten nichts erbeuten können.
„Lasst ihn liegen!‟, schrie ein baumlanger Mann wütend. „Los, auf die Pferde. Wir reiten weiter.‟
Fluchend stiegen sie in die Sättel. Einer zerrte den Komplizen ohne Pferd hinter sich auf den Pferderücken. Langsam ritten sie an.
Sie zogen weiter nach Westen.
Hinter den Reitern wurde es still. Im heißen Wind bewegte sich leise knarrend die Tür des Hauses. Staub legte sich auf den alten Mann und sein altes Gewehr.
Einsam ging Dan Oakland über die Ebene. Langsam folgte ihm das lahmende Sattelpferd durch Hitze und Staub. Gnadenlos glühte die Sonne am wolkenlosen Himmel.
Soweit Dans Blick reichte, dehnte sich die verbrannte Erde aus. Vor dem fernen schwarzen Horizont ragte halb verkohlt ein Baum empor.
Dröhnender Hufschlag ließ Dan stehenbleiben. Er wandte sich um und starrte aus verkniffenen Augen den Reitern entgegen, die durch Asche und Staub jagten.
Sie kamen schnell heran. Männer in zerschlissenen Uniformen, verwahrlost und staubig. Waffen funkelten in der Sonne.
Dan konnte nicht entkommen.
In stoischer Ruhe harrte er aus. Bald waren sie bei ihm.
Bevor er ihre groben Gesichter richtig erkennen konnte, schlugen sie mit den Gewehrläufen nach ihm. Abwehrend streckte er noch die Hände aus, doch schon trafen die brutalen Hiebe Kopf und Brust. Schrill wiehernd wich sein Pferd aus. Wie ein gefällter Büffel sackte Dan auf die Knie. Die heiseren Stimmen der Männer verloren sich auf der Ebene.
Bewusstlos kippte Dan Oakland nach vorn und schlug mit dem Gesicht in die schwarze Asche.
Ein tapferer Mann war gnadenlos niedergeknüppelt, sein Pferd gestohlen worden.
Lange lag er reglos.
Stöhnend quälte er sich schließlich hoch und schleppte sich zum Horizont. Dort stand neben dem einsamen Baum sein angeleintes Pferd.
Die Fremden hatten es dem Hungertod ausgeliefert, weil es lahmte und sie es nicht gebrauchen konnten.
Im spärlichen Schatten des hohen Baumstumpfes brach Dan Oakland mit dem Namen seines Sohnes auf den Lippen zusammen.
„Sky.‟
Und Sky kam.
Mit wehenden langen Haaren jagte der junge schlanke Sohn über die verbrannte Prärie. Geschmeidig saß er im Sattel, ein Sohn der Wildnis. Das Blut einer Sioux-Indianerin floss in seinen Adern.
Schon schnellte er aus dem Sattel, lief heran und kniete neben seinem Vater nieder. Das schwarze Haar glänzte bläulich im Schein der sinkenden Sonne.
„Dad!‟
„Alles in Ordnung, mein Junge.‟ Dan Oakland richtete schwer den Oberkörper auf. „Ein paar Fremde haben mich zusammengeschlagen.‟
In Skys dunkelbraunen Augen flackerte es. Er sah die Blutergüsse und Schwellungen am Kopf seines Vaters. Er gab ihm Wasser zu trinken. Besorgt betrachtete er den erschöpften Vater.
„Geht es wirklich schon wieder, Dad?‟
Dan lächelte mühsam.
„Ja, mein Junge. So schnell macht mich niemand fertig. Hast du das Wasserloch gefunden?‟
Sky nickte und stützte seinen Vater. Sie waren schon lange auf der Prärie. Eine Feuerwalze hatte sie in diese Einödlandschaft abgedrängt. Sky hatte nach einem Wasserloch gesucht.
Gebeugt saß Dan in der Asche. Mit rauchgrauen Augen sah er über die große Ebene. Längst waren die Fremden am Horizont verschwunden. Um seinen geschwollenen Mund grub sich ein bitterer Ausdruck ein.
„Sie haben wie Soldaten ausgesehen, Sky. Aber das waren keine Soldaten. Fahnenflüchtige müssen das gewesen sein, Deserteure, die plündernd umherreiten. Sie haben mein Pferd gewollt, die Halunken. Ich werde ...‟ Er verstummte, hustete und umfasste Skys Arm. „Hilf mir hoch, mein Junge.‟
Schwankend ging er zu Skys Pferd. Sein erwachsener Sohn half ihm in den Sattel. Dann nahm Sky beide Pferde am Zügel und zog sie hinter sich her.
Catch-the-Bear Dan Oakland und sein Halbblutsohn Sky verschwanden im Feuer des Sonnenuntergangs.
Trübgelber Lichtschein sickerte durch die Nacht.
Mit angeschlagenem Gewehr verharrte Patty Frank LeRoy vor seinem Ranchhaus und lauschte dem unruhigen Kläffen der Kojoten zwischen den Hügeln. Nebelschwaden vom nahen Fluss zogen ihre Schleier um Haus, Stallungen und Korral.
Hinter Patty Frank LeRoy quietschte leise die Tür. Er drehte sich nicht um, hörte die leisen Schritte seiner Frau und spürte ihre Hand am Arm.
‟Was ist denn? Hast du was gehört? Ist irgendwas nicht in Ordnung? ‟
„Ich glaub doch, Mary-Lou‟, antwortete er unsicher. „Ich bin einfach nervös, verstehst du? Der Krieg kann auch zu uns kommen. Wenn keine Soldaten kommen, dann vielleicht Indianer. Die Rothäute stoßen nirgendwo auf starke Kavallerie. Viele Soldaten sind aus dem Westen an die Front geworfen worden.‟
Seine Frau lauschte unruhig dem heiseren Chor der Kojoten, der den Mond über den Hügeln anheulte.
„Denk nicht an das Schlimmste, Patty‟, sprach sie ihm gut zu. „Wir haben unsere Söhne und die Ranch. Gott meint es gut mit uns, Patty.‟
Er schwieg und blickte über den mondhellen Hof. Wolken trieben über das Hügelland. Im Tal weidete Vieh; die wenigen Rinder standen im Flussnebel eng beisammen.
„Komm ins Haus, Patty.‟
„Nein. Geh nur, Mary-Lou, ich bleibe noch hier. Es ist besser, wenn ich heute Nacht hier draußen schlafe.‟
„Soll ich Chris und Joey wecken? Sie könnten dich in der Wache ablösen.‟
„Nein, lass die Boys schlafen, Mary-Lou.‟
Seine Frau ging im langen weiten Kleid zurück. Er war wieder allein vor dem Haus. Das Licht erlosch.
Steif schritt Patty Frank LeRoy über den sandigen Hof am Stall vorbei. Sein Leben lang hatte er stets schwer gearbeitet und an die Zukunft geglaubt. Er verabscheute so sehr die Gewalt, dass er seine Söhne nicht in den Krieg hatte reiten lassen, obwohl sie das wollten.
Langsam bewegte er sich mit geschultertem Gewehr durch sein Tal und erreichte den Fluss. Raschelnd schlug das taufeuchte Gras um seine alten Stiefel. Gebeugt blieb er unter den Bäumen stehen.
Plötzlich verstummten die Kojoten.
Im Nu hatte Patty Frank LeRoy sein Gewehr im Anschlag und witterte argwöhnisch in den Dunst.
Irgendetwas hatte die Kojoten verscheucht.
LeRoy spähte umher und entdeckte wenig später weit hinten am Flussufer schemenhafte Gestalten. Sie verhielten am Wasser.
Er schlich am Fluss entlang.
Allmählich schälten sich die Konturen der Fremden aus dem Dunst. Patty Frank LeRoy konnte einen schlanken jungen Indianer deutlich erkennen, der am Wasser kniete und die Blechflasche füllte. Halb unter den Bäumen standen die Pferde. Daneben wartete ein großer Mann. „Wir tun nichts‟, sagte dieser Mann plötzlich zu LeRoys Überraschung. „Kommen Sie ruhig her, Mister. Mein Sohn und ich haben Sie längst bemerkt.‟
„Wer, zum Teufel, seid ihr?‟, krächzte LeRoy. „Das da am Fluss ist doch ein Indianer.‟
„Das ist mein Sohn Sky. Ich bin Daniel Oakland. Wir sind von der Prärie herübergekommen. Es war ein langer Weg, Mister.‟
Jetzt kam Dan näher. Tau glänzte auf seiner Lederkleidung. Über sein breites Gesicht zog ein gutes Lächeln.
Patty Frank LeRoy senkte das Gewehr.
„Ich glaube, ich kann ehrliche Menschen von Banditen unterscheiden. In Ordnung, Oakland. Komm mit deinem Indianersohn auf meine Ranch.‟
„Wir sind nicht zufällig hier. Wir wollen Sie warnen. In diesem Gebiet treibt sich eine Bande herum.‟
„Wir sind zu dritt. Meine Söhne und ich können schießen und auch treffen, Oakland.‟
„Ein braver Mann ist der brutalen Gewalt oft unterlegen, Mister‟, entgegnete Dan ernst. „Das liegt daran, dass er nicht so rücksichtslos kämpfen kann wie seine Gegner.‟
In dieser Nacht hatten Dan und Sky ein Dach über dem Kopf. Sie saßen am Tisch im kleinen Ranchhaus, und Mary-Lou LeRoy füllte die dickbauchigen Tassen mit schwarzem Kaffee.
Immer wieder betrachteten die LeRoys den jungen Sky. Sie sahen das glatte lange Haar, das blauschwarz auf die Schultern fiel, sein sonnengebräuntes schmales Gesicht und die edlen Züge eines Sioux-Indianers. Sein Körper war gestählt, seine Hände waren schlank und sehnig. Er trug weiche Lederkleidung mit Fransen, die das Regenwasser besser ablaufen ließen. Um seinen Mund spielte sanftes Lächeln.
LeRoys Söhne Chris und Joey waren in Skys Alter, hartknochige Burschen mit geröteten Gesichtern und hellen Augen. Beide hatten für den Norden kämpfen wollen. Noch immer fieberten sie im Stillen nach Kampf und Bewährung.
„Ich weiß nicht, ob der Krieg aus ist oder nicht‟, antwortete Dan dem jungen Chris. „Es heißt, er ist vorbei. Doch im Osten wird weitergekämpft.‟
„Ihr werdet auch weiterhin im Tal bleiben‟, knurrte LeRoy grimmig. „Der Feind steht vor unserer Tür, wer das auch immer sein mag. Er will das, was wir in vielen Jahren hart erarbeitet haben.‟
„Euer Vater hat recht‟, bestätigte Dan. „Ihr lebt hier im Westen zwischen den Fronten und dem Indianerland. Vielleicht taucht eines Tages die Bande hier auf, vielleicht eine andere. Dann müsst ihr bereit sein.‟
„Das sind wir, Mister Oakland‟, versprach Joey. „Wir werden bis zur letzten Patrone kämpfen.‟
Still saß Sky am Tisch. Er hatte viele grausame Dinge gesehen und erlebt. Das Wissen um die Grausamkeit hatte ihn schon in jungen Jahren reifen lassen.
Sein Vater hatte vor nicht langer Zeit seine zweite Frau verloren. Vater und Sohn hatten dem Wild auf der weiten Ebene nachgestellt. Doch alles Wild und alle Büffelherden waren verschwunden.
„Kaffee, Mister Oakland?‟
„Gern, Ma’am.‟
Dan blickte auf und sah das Medaillon am Hals der Frau. Sie bemerkte seinen Blick und berührte lächelnd den Schmuck.
„Es ist aus St. Louis‟, erklärte sie. In ihren Augen erschien ein träumerischer Ausdruck. „Damals war ich ein blutjunges Mädchen aus Georgia. Patty und ich lernten uns im Hafen kennen, bei den Schiffen am Steg. Es war eine wunderschöne Zeit.‟
„Ja, das war sie‟, sagte Patty Frank LeRoy lächelnd. „Das Schönste im Leben ist die erste Liebe.‟
Die Söhne stießen sich an.
„Natürlich müssen Sie und Ihr Sohn bei uns im Haus schlafen, Mister Oakland. Wir lassen es nicht zu, dass Sie im Stall übernachten.‟
„Wir sind es gewohnt, im Freien zu kampieren, Mister LeRoy‟, versicherte Dan lächelnd. „Das ist auch besser so. So ein Haus kann unsere Nase verderben.‟
„Heißt das, dass Sie Ihre Feinde wie ein Wolf wittern können?‟, fragte Joey gespannt.
„So ungefähr‟, schmunzelte Dan. „Das lernt man, wenn man in der Wildnis lebt.‟
„Und die Sioux bringen Sie und Sky nicht um?‟
„Warum sollten sie das, Joey?‟ Dan legte die Hand auf Skys Schulter. „Mein Junge ist ein halber Sioux. Ich habe mit den Indianern Freundschaft geschlossen. Dakota ist unsere Heimat.‟
„Ich möchte zu gern einmal in einem Indianerlager sein‟, offenbarte Joey seine Träume. „Das muss sehr schön sein, wenn man Indianer zu Freunden hat.‟
„Es gibt genug blutrünstige Indianer‟, grollte LeRoy. „Ist das nicht so, Mister Oakland?‟
Dan sah die LeRoys ernst an.
„Das ist genauso wie mit den Weißen.‟
Kurze Zeit später verließen Dan und Sky das Haus und übernachteten im Freien.
Als Patty Frank LeRoy in die Morgenröte hinaustrat, waren beide verschwunden.
„Kommt alle raus‟, rief er. „Sie sind weg.‟
Die Söhne hasteten in grauen Unterhosen auf den Hof. Mary-Lou LeRoy kam im weiten langen Nachthemd auf die Türschwelle.
„Sie wollten sich nicht aufdrängen‟, sprach LeRoy nachdenklich. „Diese Oaklands sind anständige Burschen.‟
„Sky hat seine Provianttasche vergessen‟, sagte Joey kurz darauf. „Mam hat Proviant reingetan.‟
„Bring ihnen die Tasche, Joey. Du wirst die Fährte noch sehen.‟
Dumpf schlugen die eisenbeschlagenen Hufe der Pferde durch die Hügelfalte und stampften das Gestrüpp nieder.
Schweigend saßen die Männer im Sattel.
Der heiße Mittagswind trug das Murren der Rinder herüber. Horchend verhielten die Reiter und zogen die Gewehre aus den Scabbards.
Wortlos zog der baumlange Anführer sein Pferd herum und lenkte es den bewaldeten Hang hoch.
Die Komplizen folgten, ritten um die Bäume, durch Licht und Schatten. Kurz vor der Hügelkuppe saßen sie alle ab, ließen die Pferde angeleint zurück und rannten die letzten Yard nach oben.
Vor ihnen lag ein Tal.
Silbern in der Sonne funkelnd durchzog ein kleiner Fluss das Tal. An seinen Ufern standen Rinder. Drüben stieg Herdrauch über dem flachen Dach des Ranchhauses empor. Niemand war zu sehen. Die LeRoys saßen am Mittagstisch.
Lange starrten die Fremden zur Ranch hinüber. In ihren Gesichtern arbeitete es. So grausam sie alle waren, so wild und hemmungslos, jeder von ihnen hatte noch eine leise Sehnsucht nach der zerstörten und verwüsteten Heimat.
„Rinder‟, flüsterte ein junger Mann. „Ich möchte mal wieder Fleisch essen.‟
„Du bist verrückt, Tab.‟
Die Komplizen lachten freudlos wie unter einem Zwang.
„Nein, ich bin nicht verrückt‟, fuhr der blonde Tab auf. „Mein Alter hatte auch ’ne Ranch in Kansas, wie ihr wisst. Wir haben jeden Tag Fleisch gegessen.‟
„Wenn schon‟, blaffte der Anführer kalt. „Was haben wir damit zu tun? Da unten sind zwei Pferde im Korral. Du brauchst ein Pferd, Tab. Wir werden uns die beiden Pferde holen. Mein Gaul macht es auch nicht mehr lange.‟
Der blutjunge blonde Tab schwieg.
Lauernd starrten sie in das Tal. Der Wind bewegte die rauschenden Bäume und das hoch im Halm stehende Gras. Immer wieder drang das Murren der Rinder herauf.
„Schön ist es hier‟, äußerte sich ein schwarzhaariger Mann. „Und friedlich. Dabei beginnt gleich hinter der Hügelkette das verbrannte Land.‟
„Mir kommen die Tränen, Rico‟, höhnte der Boss.
„Dann wein dich doch aus‟, konterte der schwarzhaarige Rico grinsend und blickte den Anführer spöttisch an. „Ich habe dich noch nie weinen sehen, McQueen. Vielleicht steht dir das?‟
„Halt’s Maul.‟
Nacheinander verschwanden sie von der Hügelkuppe. Wenig später saßen sie bis auf den blonden Tab im Sattel. Langsam ritten sie abwärts, hielten hinter hohen Sträuchern an und umwickelten die Hufe mit den Streifen zerrissener alter Pferdedecken.
Tab näherte sich zu Fuß der Ranch.
Unheil braute sich über dem Tal zusammen.
Es war ein Mittag wie viele andere, nur fehlte heute am Tisch der junge Joey.
Die Gewehre lehnten neben der Tür. Leises Klappern drang aus dem Haus. Draußen tanzten kleine Staubwirbel über den Hof und durch den Stangencorral. Kein Kojote kläffte, kein Geräusch warnte Patty Frank LeRoy, seinen Sohn Chris und seine Frau Mary-Lou.
LeRoy schob den leeren Teller zurück und nickte seiner Frau zu.
Daraufhin nahm sie die abgegriffene Bibel, schlug sie auf und begann daraus vorzulesen.
Drüben am Corral tauchte ein blutjunger blonder Fremder auf. Sein Haar leuchtete wie Stroh in der Sonne. Schweiß rann über das staubige Gesicht. Unruhig presste er die Hände um die obere Stange des Corrals und starrte zum Haus hinüber.
Die beiden Pferde im Corral hatten die Ohren aufgerichtet. Sie prusteten dumpf.
„Dad!‟ Erschrocken sah Chris zum Korral hinaus. „Da steht jemand.‟
Mary-Lou LeRoy verstummte. Ihr Mann sprang auf und versteifte sich.
„Ein Fremder. Der ist nicht älter als du, Chris.‟
„Jetzt winkt er. Was will der von uns? Warum kommt er nicht näher? Kannst du bei ihm Waffen sehen?‟
„Nein, er hat keine Waffen.‟ Patty Frank LeRoy atmete schwer ein. „Mary-Lou, bleib im Haus. Ich geh mit Chris raus.‟
„Bitte, seid vorsichtig‟, flehte sie.
„Der Bursche ist allein, Mary-Lou. Was kann uns der schon tun? Mach dir keine Sorgen. So ein junger Bursche ist nicht gefährlich, der hat wahrscheinlich mehr Angst als du.‟
Sie zwang sich zu einem Lächeln.
„Ja, du hast recht, Patty. Was sollte dieser Junge schon tun können? Er wird aus dem Krieg kommen. Vielleicht irrt er umher und sucht eine Bleibe.‟
„So wird es sein, Mary-Lou. Komm, Chris.‟
Der Mann und sein Sohn gingen zur Tür, nahmen die Gewehre und traten auf den heißen hellen Hof hinaus.
Mörderische Schüsse dröhnten.
Gellend schrie Mary-Lou LeRoy auf, sah ihren Mann und ihren Jungen fallen. Pferde wieherten schrill. Hufe knallten heran. Fremde erschienen in der Tür. Mündungsfeuer blitzten auf. Pulverdampf füllte den Wohnraum.
Es war totenstill im Tal.
Zurückgelassen stand ein abgetriebenes Pferd ohne Zaumzeug und Sattel in der Sonne des Spätnachmittags.
Weinend kniete ein junger Mann auf dem Hof. Er schluchzte wie ein kleiner Junge.
Reglos stand Sky neben dem Stall, hielt die Volcanic Rifle bereit und ließ den scharfen Blick suchend über die Talflanken schweifen.
Gebeugt, wie unter schwerer Last, ging Dan Oakland über den Hof.
Sie hatten die Schüsse gehört und waren sofort mit Joey LeRoy umgekehrt. Doch hier gab es nur eine traurige Pflicht zu erfüllen, hier war kein Leben mehr.
Die Tränen eines jungen Menschen nässten das graue Gesicht des toten Vaters und des Bruders. Weinend kroch Joey in das Haus, weil er nicht mehr die Kraft hatte, sich zu erheben.
Im Haus umarmte er seine Mutter am Boden. Immer wieder schrie er gequält auf.
Jeder Schrei traf wie ein Peitschenhieb Dans und Skys Rücken.
Mehrere Rinder waren abgeschlachtet, die besten Stücke Fleisch herausgetrennt worden.
Die beiden Pferde fehlten. Im Haus sah es aus wie nach einer Explosion.
Die Bilder waren von den Wänden gerissen und zertrümmert. Die Gardinen hingen zerfetzt, Schränke und Betten waren nur noch Brennholz.
Der Überfall der Banditen war grausam. Dan Oakland schloss die Augen.
Als Sky seinen Vater schwanken sah, ging er schnell zu ihm. Unruhig sah er in das steingraue Gesicht seines Vaters.
„Dad‟, flüsterte er, „Was … was soll ich tun?‟
Stöhnend schlang Dan die Arme um seinen Jungen und presste ihn an sich.
Im Haus lag Joey am Boden, ganz nahe am Gesicht seiner Mutter. Wie in ferne Träume versunken, streichelte er mit zitternder Hand ihr Gesicht.
„Liebe, gute Mum, ich habe dich ja so lieb, ich ...‟
Draußen stieß Dan Oakland einen Wolfsschrei aus, der durch das Tal hallte und ein wildes Echo in den Hügelfalten weckte.
„Vater!‟, schrie Sky.
Mit flatternder Hand wischte Dan Oakland über die Augen.
„Es geht schon wieder, mein Junge.‟ Dan atmete tief die heiße Luft ein. „Es muss weitergehen, Sky. Ich kümmere mich um Joey.‟
Langsam ging er in das Haus. Sky folgte ihm wie ein Schatten.
Dan Oakland war ein rauer Mann, der viele harte Schläge ertragen konnte. Aber Dan war auch ein Mann mit Empfindungen und Gefühlen; er konnte nicht kaltschnäuzig über diese Tragödie hinwegsehen und so tun, als ginge ihn das alles nichts an.
Seine Einstellung zum Leben beruhte auf Hilfsbereitschaft und Mitempfinden.
Aber die Banditen in Uniform hatten in ihm den Wolf geweckt.
Die Spur führte durch das verbrannte Land und zum schwarzen Horizont.
Auf der endlos weiten Prärie glimmte ein Lagerfeuer. Der rote Schein lag auf den Gesichtern der drei Männer. Abseits ragten die Sattelpferde dunkel empor. Der Mond leuchtete über den fernen Bergen, und am Wegrand lagen die Wracks halbverkohlter Planwagen, die Skelette verendeter Pferde und das brüchige Metall rostender Säbel.
Geistesabwesend blickte Joey in die Glut.
Sie hatten drei Gräber zurückgelassen. Gräber, in denen Joeys Hoffnung und Lebensfreude lagen.
Was ihm geblieben war, schien ihm nichts wert zu sein.
„Joey, hörst du, Joey?‟
„Was ist, Mister Oakland?‟, flüsterte Joe, ohne aufzublicken.
„Wir möchten, dass du bei uns bleibst.‟
„Ich will die Mörder suchen‟, sagte er mit fremder Stimme. „Ich muss das für Mam, Dad und Chris tun. Und ich will sie töten.‟
„Joey, hör mich an. Hass und Rache sind niemals gut. Geh deinen Weg und kämpfe, doch ohne Hass und Rachsucht.‟
„Ich will aber hassen!‟, schrie Joey. Weinend legte er sich auf die Seite und zog die Knie an wie ein Kind, das des Nachts fröstelte.
Dan Oakland beugte sich über Joey LeRoy und klopfte ihm sanft auf den Rücken.
„Das wird ein langer Weg für uns alle. Versuch zu schlafen, Joey.‟
Stunden später ritten sie wieder über die verbrannte Erde und erreichten im Morgengrauen eine Ruine.
Hier zwischen Ruine und ausgetrocknetem Flussbett hatten die Banditen gelagert. Hier stießen sie auf Abfall und Fleischreste.
Dan suchte den Lagerplatz genau ab, während Sky auf der Mauer der Ruine stand und über das Land sah.
Die Hufeindrücke und Stiefelspuren verrieten Dan, dass es mehr als zehn Banditen sein mussten. Er hatte sie, als sie ihn niederknüppelten, nicht zählen können.
Die Armee würde diese Deserteure an die Wand stellen und kurzerhand erschießen. Aber zurzeit gab es kaum noch einen festen Truppenverband; alles war in einer heillosen Auflösung begriffen.
Er und Sky wollten Joey helfen.
Sie wussten, dass sie einer blutigen Spur der Gewalt folgten, die Bande immer wieder zuschlagen würde.
Irgendwo am schwarzen Horizont musste es irgendwann zu einem gnadenlosen Kampf kommen.
Das Camp war riesengroß.
Wie ein bösartiges Geschwür lag es langgestreckt am North Platte River, von ständiger Unruhe erfüllt.
Viele hundert Männer hausten in ihm. Sie hockten zusammengepfercht in alten zerschlissenen Armeezelten, in Bretterverschlägen und Hütten aus Kistenholz.
Im Camp keimten Angst und Verbrechen, Mord und Totschlag, Verzweiflung und Rachsucht. Hier lebten die Deserteure, die vom Krieg verkrüppelten, die Widerstandskämpfer.
Hier gab es unzählige ehemalige Animiermädchen, eiskalte Geschäftemacher und heimtückische Betrüger.
Hierher führte die Spur der Bande.
Dan Oakland, sein Sohn Sky und Joey LeRoy ritten langsam durch die Abenddämmerung, folgten dem Fluss und kamen an unzähligen Baumstümpfen vorbei. Wälder waren abgeholzt und zu Brennholz verarbeitet worden.
Wenn Dan und Sky jetzt Joey Le Roy allein ließen, war der noch heute Nacht tot.
Sie mussten seinen Kampf zu ihrem Kampf machen. In seiner rasenden Verzweiflung würde er sich den Banditen entgegenwerfen und im Feuer ihrer Colts sterben.
Schon jetzt zitterte Joey wie unter Schüttelfrost. Er wusste, dass die Mörder seiner Eltern und seines Bruders in diesem Camp in seiner Nähe lagerten und ihn vielleicht sogar auslachten.
In keinem Fall würde sie das Gewissen plagen.
Abseits des Camps verhielten die drei Reiter. Verworrene Stimmen tönten herüber. Rot schimmerte der Treibstaub in der Abendsonne. Viele Wege und Straßen führten durch das Camp. Im Gewirr der Hütten und Zelte waren alle Männer nur als graue Masse zu erkennen. Kaum ein Gesicht hob sich von der Menge ab.
„Ihr bleibt hier.‟ Dan stieg vom immer noch lahmenden Pferd. „Joey, mach Sky keinen Kummer. Ich werde mich im Camp erst einmal umsehen. Dann sehen wir weiter.‟
Joey antwortete nicht; wie gebannt starrte er auf das Camp. Graue Flecken zeichneten sein Gesicht. Staub und Schweiß hatten auf ihm eine Kruste gebildet.
Dan warf Sky einen bedeutungsvollen Blick zu. Sky nickte kaum merklich, glitt aus dem Sattel und zog Joey sanft vom Pferd.
„Komm, Joey.‟
Mit gesenkter Volcanic stapfte Dan Oakland zum Camp hinüber, erreichte die sandige und aufgewühlte Straße und befand sich mitten im Gewirr der Hütten, Zelte und Menschen.
Nur schwach konnte er sich an die Gesichtszüge der Banditen erinnern. Er hatte sich keins dieser Gesichter einprägen können, dazu war alles auf der Prärie zu schnell geschehen. Wenn diese Halunken sich nun auch noch die Bartstoppeln aus dem Gesicht schabten und sich wuschen, würde er keinen von ihnen wiedererkennen.
Im Camp sahen sie alle irgendwie gleich aus. Unzählige Männer trugen die gleiche Kleidung.
Langsam bewegte der Trapper sich an den Hütten und Zelten vorbei. Niemand kümmerte sich um ihn.
Über den Eingängen der Hütten sah Dan Schilder mit hochtönenden Namen. Das waren die Saloons des Camps, wo Whiskey zu Wucherpreisen ausgeschenkt wurde.
Er sah junge und alte Männer, gesunde, kranke und verkrüppelte. Sie grölten und lachten wild und suchten Vergessen im Streit.
Die Sonne sank. Die Dämmerung legte sich wie ein graues Leichentuch auf das Camp. Das hektische Leben der Nacht begann.
Dan erreichte einen alten Kämpfer, der an seinem hölzernen Armstumpf herumschnitzte.
„Ich suche ein paar Boys, die erst vor ein paar Stunden ins Camp gekommen sind.‟
Der Alte spie aus und rieb mit dem Handrücken des gesunden Arms über den Mund.
„Dann such sie‟, ächzte er. „Wenn du Glück hast, findest du sie. Doch du wirst kein Glück haben. Hierher kommen täglich viele Reiter. Ebenso viele verschwinden auch wieder.‟
„Danke.‟
Dan wollte weitergehen, doch der Alte griff nach seinem Arm.
„He, wozu Danke? Das Wort habe ich schon eine Ewigkeit nicht mehr gehört. Du bist ein seltsamer Heiliger. Was ist los mit dir? Warum suchst du die Burschen?‟
„Weil sie einen Mann, eine Frau und einen Jungen umgelegt haben‟, bekannte Dan offen.
„Das ist was anderes‟, dehnte der Alte und spähte aus verkniffenen Augen umher. „Du musst zum Alhambra gehen oder zum Jenny Saloon. Vielleicht findest du sie auch im King Albert.‟
„Saloons?‟
„Yeah. Geh die Straße weiter rauf. Da findest du die Saftläden. Aber kauf keinen Whiskey, der macht dich kaputt.‟
„Glaubst du, dass ich die Kerle in einem dieser Saloons finde?‟
„Ja. Da treiben sich die Höllenhunde rum, verstehst du? Sie haben sich gesucht und gefunden. Ich sag dir, Böses findet zu Bösem.‟
„Danke.‟
„Ach, scher dich zum Teufel mit deinem Dank. Mach’s gut, Trapper.‟
Dan ging weiter.
Zwischen den Hütten und vor den Zelten loderten Lagerfeuer. Knochige Sattelpferde und Maultiere standen ständig bewacht neben den Behausungen. Ein Pferd war mehr wert als ein Menschenleben.
Abseits warteten Sky und Joey LeRoy. Für Sky war dieses Camp ein Ort, den er verabscheute. Er liebte die Freiheit vor dem Wind, die stillen und ruhigen Lager der Indianer von Dakota, die Welt des Roten Mannes.
Joey LeRoy fieberte. Das grauenvolle Erlebnis hatte ihn krank gemacht. Er konnte nicht klar denken. Als er sich plötzlich in Bewegung setzte und zum Camp gehen wollte, hielt Sky ihn zurück.
„Lass mich los!‟, fauchte Joey. „Nimm die Pfoten weg.‟
„Nein, Joey‟, sagte Sky ruhig. In seinem schmalen braunen Gesicht spannten sich die Muskeln. „Daraus wird nichts. Ich lasse dich nicht weg, damit die Halunken dich erschießen.‟
Joey krümmte sich.
„Du sollst mich loslassen, Rothaut. Weg mit den dreckigen Bastardhänden.‟
In Skys dunklen Augen wurde es Nacht. Er begriff, dass Joey nicht wusste, was er sagte.
„Wir bleiben hier und warten auf meinen Vater.‟
„Loslassen, verdammt! Hast du nicht gehört, Rothaut? Lass mich sofort los!‟ Joey griff schon zum Colt.
Da schlug Sky mit der geballten Faust zu. Joey sackte bewusstlos in seine Arme.
Als er zu sich kam, weinte er.
„Das … das tut mir … leid, Sky‟, stöhnte er, „das war eine Gemeinheit von mir.‟
„Schon gut, Joey. Komm, lagern wir am Fluss.‟
Schwer, reglos und in grauer Wolfsfellkleidung stand Catch-the-Bear Dan Oakland vor dem Alhambra.
In der engen Hütte drängten sich Männer und tranken Whiskey. Ein paar Stalllampen verbreiteten trübes Licht. Dicker Tabakrauch wallte hervor. Er roch nach Gras und Blättern.
Entschlossen schob Dan sich über die Türschwelle.
Die Männer, die er sah, waren bärtig und verschwitzt, bewaffnet und angetrunken. Sie grölten und lachten, sprachen laut durcheinander und prahlten mit vergangenen Heldentaten.
Dan wollte nicht zur Theke. Er blieb an der Wand neben der Tür stehen und suchte in den von Rauch umnebelten Gesichtern nach Spuren.
Umsonst.
Er verließ das Alhambra, stapfte weiter und erreichte den Jenny Saloon. Hier sah es nicht anders aus. Neben der Hütte lagen betrunkene Männer, hielten sich an den Händen und weinten wie Kinder. Im Saloon gab es ein paar Tische mit Baumstümpfen als Sitzen. Hier pokerten Männer um den letzten Sold. Hier kroch ein Schwarzer über den Boden und sammelte die Abfälle auf. Wer Lust dazu verspürte, trat ihm ins Kreuz.
Animiermädchen, das Gesicht mit Schminke verkleistert, kreischten.
Sie alle waren Entwurzelte.
Dan Oakland konnte sie nicht verachten. Diese Menschen brauchten Hilfe, auch die, die sich nicht helfen lassen wollten.
Er wandte sich ab und suchte die Hütte auf, die sich stolz King Albert Saloon nannte.
Die Wände dieser stallähnlichen Hütte waren aus Brettern und so dünn, dass sie sich unter dem Gewicht der sich anlehnenden Männer weit nach außen bogen. Auch hier kreischten Mädchen, auch hier wurde gepokert, gelärmt, gelacht und getrunken.
Neben dem King Albert entdeckte Dan etliche Sattelpferde. Der Mann, der die Pferde bewachte, hockte am Boden und hatte den Rücken gegen die Hüttenwand gelegt. Zwischen den Beinen ragte ein Gewehr empor.
Als Dan die Pferde betrachtete und dabei im Schatten der Hütte verharrte, packte der Mann sein Gewehr.
Noch hatte er Dan Oakland nicht erkannt.
Steif richtete er sich auf und richtete das Gewehr auf den Trapper.
Dan bemerkte ihn nicht, starrte auf ein Brandzeichen und tastete es ab. So ein Brandzeichen trug auch Joey LeRoys Pferd. Es war das Brandzeichen der LeRoy Ranch.
Er hatte die Pferde der Banditen gefunden. Die Halunken hielten sich im King Albert Saloon auf.
„Hoch mit den Pfoten! Wird’s bald? Sonst pump ich dich voll Blei.‟
Dan hörte die scharfe Stimme des Wachpostens und bewegte sich nicht. Er konnte die Schritte des Banditen kaum hören, denn im ganzen Camp brodelte und lärmte es.
Kaltes Metall stieß hart in seinen Rücken zwischen die Schulterblätter. Bei einem Schuss würde von Dan Oakland nicht viel übrigbleiben.
„Du willst wohl ein Pferd klauen, wie?‟
„Nein.‟
„Halt’s Maul. Weg mit der Knarre. Los!‟
Dan musste gehorchen. Er ließ die Volcanic fallen.
„So ist’s gut‟, höhnte der Bandit. „Eine Bewegung und du bist ein toter Mann.‟
Dan hatte sich in der Gewalt. Immer dann, wenn Gefahr sein Leben bedrohte, wurde er besonders ruhig.
Langsam drehte er den Kopf, blickte über die Schulter und versuchte, den Halunken zu erkennen. Er spürte, wie der Druck im Rücken zunahm.
„Was sucht ein Trapper wie du in diesem Camp? Los, mach das Maul auf. Ich kann dich abknallen. Kein Schwein wird sich darum kümmern. Das weißt du.‟
„Ja, natürlich‟, antwortete Dan ungerührt. „Du hast mich in der Gewalt. Aber mein Tod nützt dir nichts.‟
„Munition habe ich genug. Ich brauch damit nicht zu sparen. Los, dreh dich langsam um. Du kommst mir irgendwie bekannt vor.‟