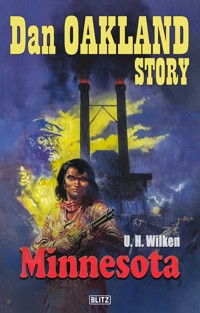Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Dan-Oakland-Story
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Rote Rache Weiße und Indianer stehen sich als Todfeinde gegenüber, niemand spricht mehr vom Frieden. Als Colonel Chivington mit einem Soldatentrupp das Lager des Häuptlings Black Kettle überfällt und dort ein grausames Massaker anrichtet, eskaliert die Gewalt. Raubadler Canyon Banditen überfallen einen Zug der Union Pacific. Auf ihrer Flucht hinterlassen sie Tod und Verderben. Der Eisenbahnmarshal Ford jagt die Banditen und stößt dabei auf Dan Oakland und dessen Sohn. Ford hält Oakland für einen der Banditen und nimmt ihn gefangen, während Sky entkommen kann. Ford will seinen Gefangenen ins Bahncamp bringen und schließt sich einem Treck an. Doch unterwegs werden sie von Crow-Indianern überfallen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 260
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dan Oakland Story
In dieser Reihe bisher erschienen
4301 U. H. Wilken Lockruf der Wildnis
4302 U. H. Wilken Teufelsbrigade
4303 U. H. Wilken Die Feuertaufe
4304 U. H. Wilken Der weiße Büffel
4305 U. H. Wilken Das Aufgebot des Bösen
4306 U. H. Wilken Grausame Grenze
4307 U. H. Wilken Omaha-Marter
4308 U. H. Wilken Blutige Säbel
4309 U. H. Wilken Der Unbezwingbare
4310 U. H. Wilken California-Trail
4311 U. H. Wilken Berg der zornigen Götter
4312 U. H. Wilken Die Teuflischen
4313 U. H. Wilken In Todesgefahr
4314 U. H. Wilken Schwarzer Horizont
4315 U. H. Wilken Der Raubadler
4316 U. H. Wilken Trail aus Blut und Eisen
U. H. Wilken
Der Raubadler
Der Text wurde anhand der Originalmanuskripte des Autors sorgfältig überarbeitetet und um bisher unveröffentlichte Textpassagen ergänzt. Der Abdruck erfolgt mit ausdrücklicher Genehmigung von Detlef Wilken.
Dieses Buch enthält die Einzelromane:
Rote Rache
Raubadler Canyon
Als Taschenbuch gehört dieser Roman zu unseren exklusiven Sammler-Editionen und ist nur unter www.BLITZ-Verlag.de versandkostenfrei erhältlich.Bei einer automatischen Belieferung gewähren wir Serien-Subskriptionsrabatt.Alle E-Books und Hörbücher sind zudem über alle bekannten Portale zu beziehen.© 2022 BLITZ-Verlag, Hurster Straße 2a, 51570 WindeckRedaktion: Alfred WallonTitelbild: Rudolf Sieber-LonatiUmschlaggestaltung: Mario HeyerVignette: Wiktoria Matynia/123RF.comSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-101-4
Rote Rache
Catch-the-Bear Dan Oakland war an diesem kalten Novembertag seltsam unruhig. Sein sonst so gutmütiger Gesichtsausdruck war ernst und bedrückt; er war argwöhnisch und hatte es ganz plötzlich eilig.
Dans Sohn Sky war ein Halbblut und wurde von den Soldaten beobachtet. Sie blieben vor dem Store stehen, und Dan bemerkte die Blicke.
„Sky‟, sagte er dumpf, „verlass schon das Fort. Warte draußen auf mich. Es ist besser so. Man will uns hier nicht.‟
In Skys braunen Augen flackerte es kurz auf. Er fragte nicht, presste die Lippen zusammen und nickte. Langsam saß er auf und ritt zum Tor. Die Posten ließen ihn hinaus.
Dan sah seinen Jungen davonreiten, dann schloss sich das Tor, und über Dans hartes, männliches Gesicht huschte ein trauriger Ausdruck. Er senkte das Kinn und stapfte zur Tür des Depots.
Da hörte er einen Fluch und Schreie. Er drehte sich um und blickte zum Block hinüber, wo die kleinen dunklen Zellen der Gefangenen waren. Von dort kam der Lärm. Schon seit einiger Zeit war ihm im Fort aufgefallen, dass immer ein paar Soldaten mit ihren Gewehren bereitstanden, und dass auch die patrouillierenden Posten oben auf den Planken oft zum Gefängnisblock blickten.
Reglos blieb Dan stehen. Abseits entdeckte er Major Anthony, der gelassen vor seiner Kommandantenbaracke stand, als ginge ihn das alles nichts an.
Doch das Lächeln des Offiziers verhieß nichts Gutes.
Plötzlich kamen drei halb verhungerte Indianer aus dem Gefängnisblock. Sie liefen nicht, dazu waren sie viel zu schwach. In zerfetzter Kleidung schwankten sie auf den Platz. Ihre Gesichter waren eingefallen und maskenhaft starr. Sie trugen keine Waffen, keinen Schmuck, keine Federn im Haar, und sie wussten nicht, wohin sie eigentlich sollten.
Irgendwer brüllte im Gefängnisblock: „Die Gefangenen sind entflohen!‟
Harte Stiefel polterten über Planken. Soldaten stürmten aus dem Gefängnisblock. Gewehre richteten sich auf die Indianer und Schüsse fielen.
Die Indianer zuckten zusammen, sanken zu Boden; im Fall schlugen die Beine hoch, flatterte das lange strähnige Haar. Kraftlose Hände krallten sich im Todeskampf in den Boden. Der Knall der Schüsse verlor sich im kalten Wind. Pulverrauch trieb über den Platz mit den toten Indianern.
Dan Oakland zog fröstelnd die Schultern hoch; ihm war kalt. Im schärfsten Wind, der jäh aufkam, tränten seine Augen. Er sah, wie die Soldaten die toten Indianer an den Armen packten und sie über den Platz zogen. Die Lederlappen rutschten von den Füßen, die Füße zogen flache Furchen in den Sand.
Dan konnte nicht erkennen, von welchem Stamm sie waren, er kannte sie nicht, wusste nicht, woher sie gekommen waren. Aber er stellte fest, dass sie wohl wochenlang nur eine kleine Portion Essen bekommen hatten und fast verhungert waren.
Man schleifte sie einfach weg und ließ sie zunächst liegen. Und Major Anthony war wieder in seiner Unterkunft. Die Soldaten hatten die Gewehre gesenkt, alles war wieder wie vorher.
Dan ging in das Depot und trug gleich darauf Proviant zum Pferd, verstaute alles in den Taschen und hinter dem Sattel. Er hörte den Ruf eines Postens und sah, wie ein Corporal hastig die Leiter herunterkam und zur Kommandantenbaracke lief. Noch einmal suchte er das Depot auf und ließ sich Tabak geben.
„Wohin soll’s denn gehen, Trapper?‟, erkundigte sich der Soldat hinter dem Tresen.
„Nach Norden, irgendwohin, wo die Wildnis noch frei ist.‟
„Im Norden sind die Indsmen, Cheyenne und Arapaho. Ist das nicht zu gefährlich, allein durch Indianerland zu reiten?‟
Draußen schallten Stimmen über den Platz. Soldaten rannten umher. Die Stimme des Majors trieb sie auf ihre Plätze. Knarrend schloss sich das Tor.
„Was ist denn los?‟, murmelte Dan ernst.
Der Soldat hastete hinaus, kam gleich darauf zurück und atmete schwer.
„Sie kommen!‟
„Wer?‟
„Colonel Chivingtons Colorado-Regiment! Mann, das wird ein Ding! Sechshundert Mann! Die Jungen brennen schon alle darauf, den Indsmen eins überzubraten! Verstehst du, Trapper? Jetzt machen wir die Indianer fertig!‟
Dan hatte sich in der Gewalt. Not und Elend hatte er unter den Stämmen gesehen, heroische Tapferkeit, schändliche Demütigung und verruchten Verrat an ihnen.
Die Worte des Soldaten schnitten tief in sein Herz. Niemals hatte er einen Grund gehabt, die Indianer zu verfluchen. Er kannte ihre Rechte auf dieses Land, das ihnen immer wieder mit Gewalt genommen wurde. Und oft hatte er ihre Geduld und ihre Gutgläubigkeit den Weißen gegenüber nicht verstehen können.
„Trapper, warum sagst du nichts? In ein paar Jahren kannst du überall Wild jagen, und kein verdammter Indianer wird dich dabei stören!‟
„Dann wird es kein Wild mehr geben‟, sprach Dan leise und seltsam melancholisch. „Das Wild wird mit den Indianern sterben, und die Wildnis wird veröden.‟
„Wie sprichst du, Trapper? Trauerst du um die Indianer oder um dein Wild? Was ist los mit dir?‟
„Nichts.‟ Dan zuckte die Achseln. Er schien auf einmal sehr müde. „Ich mache mich jetzt auf den Weg nach Norden.‟
Langsam ging er hinaus, saß auf und ritt zum Tor.
Die Wachposten traten ihm entgegen, versperrten ihm den Weg. Überall im Fort herrschte fiebrige Unruhe. Die Disziplin unter diesem zusammengewürfelten Haufen Männer in verwaschenen und abgetragenen Uniformen war nicht sehr groß. Draußen vor dem Fort stampften Pferde, riefen Männer, klirrte es metallisch, wurden Zelte in aller Hast aufgeschlagen und Feuer entfacht. Dan konnte das alles nicht sehen, nur ahnen. Ernst blickte er die Posten an. Dabei berührte er die Fellmütze.
„Ihr seht, dass ich Trapper bin, nicht Soldat. Lasst mich reiten.‟
„Nein, du bleibst. Wir dürfen keinen rauslassen. Das Fort ist umstellt.‟
„Von wem denn eigentlich? Von Indianern?‟
Sie grinsten verächtlich.
„Die verdammten Rothäute wagen sich nicht hierher. Nein, Trapper, es sind Soldaten, Colonel Chivingtons Vorhut. Wenn wir dich reiten lassen, knallen sie dich ab. Niemand darf das Fort verlassen. Das hat seine Gründe. Kehr um, reite zur Kantine und warte dort ab.‟
Horchend hob Dan den Kopf. Draußen klirrten Säbel, rasselte Zaumzeug, stampften Soldaten umher. Der Qualm ihrer Lagerfeuer wehte über den Palisadenzaun.
Wortlos zog er sein Pferd herum, stellte es vor der Kantine ab und ging hinein, setzte sich ans Fenster und blickte hinaus. Er dachte an seinen Sohn Sky und hoffte, dass Sky nicht mehr in der Nähe war, dass er alles beobachtete und handelte.
In der Kantine war nur der Keeper. Manchmal kam ein Soldat herein, bestellte schnell und verschwand wieder.
Fiebrige Spannung breitete sich innerhalb der Palisaden aus.
Dan Oakland saß still. Die Furchen im rauen Gesicht hatten sich vertieft. Gäbe er sich als Freund der Indianer zu erkennen, würde man ihn rücksichtslos in eine der dunklen Zellen werfen und ihm den Prozess machen.
„Ein ganz schöner Aufstand hier, wie?‟ grinste der Keeper. „Der Colonel weiß schon, warum er die Vorhut losgeschickt hat. Kein Schwein darf die Indianer warnen. Das ist es. Aber ich glaube, dass die Indsmen die Warnung nicht ernst nähmen. Sie haben das Wort unseres letzten Kommandanten, Major Wynkoop, der abgelöst wurde. Vor kurzem noch lagerten die Arapaho vor dem Fort. Sie bekamen von Major Wynkoop Lebensmittel. Aber Major Anthony gab ihnen nichts, er sagte, sie sollten Büffel jagen, um was zu fressen zu haben.‟
„Die gibt es doch nur im Süden, und wenn ein Weißer dort einen Indianer antrifft, kann er ihn erschießen.‟
„Ja, so will es der Colonel, und auch Gouverneur John Evans! Wir wissen, dass der Arapaho-Häuptling Little Raven mit seiner Gruppe zum Arkansas River zieht. Der Arapaho Left Hand ist zum Sand Creek gezogen.‟
Dan sah dem Keeper an, wie sehr jener die Indianer hasste und wie begeistert er von der Ausrottung des roten Mannes war. Tiefe Abscheu gegenüber den Soldaten erfasste ihn. Dennoch klang seine Stimme ruhig und ohne Feindschaft, als er sagte: „Sand Creek? Lagern dort nicht die Cheyenne, um zu überwintern?‟
„Sicher, etwa sechshundert Indsmen. Vierhundert davon sind Frauen und Kinder. Das hat mir ein Scout erzählt. Hier heißt es jedenfalls, dass es über fünfhundert Krieger sein sollen. Du bist weiß, ein Trapper, sonst würde ich dir kein Wort darüber sagen.‟
Ein Schauer lief Dan über den Rücken. Unruhe erfasste ihn. Er schwitzte auf einmal. Und er wandte das Gesicht ab, um dem Keeper nicht seine tiefe Sorge zu zeigen.
„Sky‟, flüsterte er, „sei klug.‟
„Hast du was gesagt, Trapper?‟
„Nein, nichts.‟
Das breite Tor öffnete sich. Die Besatzung von Fort Lyon war angetreten. Major Anthony begrüßte den hünenhaften Colonel Chivington, der als Methodistenprediger einst in den Goldgräbercamps dieses Landes Sonntagsschulen gegründet hatte.
Noch immer war Dan Oakland in Fort Lyon, noch immer musste er bleiben.
Reglos lehnte er in der Nähe der Kommandantenbaracke, und nicht weit von ihm stand ein wohl siebzig Jahre alter Mann, ein Mulatte, der von Rheumatismus geplagt wurde und die trüben Augen verengt hatte, um dieses Schauspiel verfolgen zu können.
Chivington und Anthony reichten sich die Hände, schüttelten sie überschwänglich, und der Colonel legte Anthony die Rechte auf die Schulter. Lächelnd schritten sie zur Kommandantenbaracke. „Alles vorbereitet, Major?‟
„Ja, Sir, alles! Meine Männer sind bereit. Ihnen ist die Freude anzusehen, dass es gegen die Indsmen geht. Nur drei meiner Offiziere machen Schwierigkeiten.‟
„Captain Sole, wie?‟
„Ja, und die Lieutenants Connor und Cramer. Sie wollen Black Kettles Lager nicht angreifen.‟
„Mit denen werdeich schon fertig, sonst stelle ich sie vor ein Kriegsgericht.‟ Chivington blieb mit Anthony vor der Baracke stehen und lächelte sanft. „Es wird Zeit, dass wir im Blut der verdammten Indsmen waten, Major. Ich bin mit meinen Männern hier, um alle Indianer zu töten. Wir werden eine Menge Skalpe sammeln.‟
„Ich habe schon lange darauf gewartet, Sir. Man muss es den Indsmen richtig zeigen. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie mich nach Fort Lyon geschickt haben, Sir, und mich an dieser Operation teilhaben lassen.‟
„Aber sicher, lieber Anthony, ich kann mich schließlich auf Sie verlassen.‟
Die Tür fiel hinter ihnen zu.
Dan Oakland seufzte schwer. Drohend zog sich das Verhängnis über den Indianern zusammen, und er war hier ein Gefangener, er konnte sie nicht warnen, ihnen nicht sagen, dass alle Verträge nichts galten, dass der weiße Mann wieder einmal über die Indianer herfallen wollte. Resigniert wandte er sich ab. Dabei kam er dicht an dem alten Mulatten vorbei.
„Du bist ein Weißer‟, sprach ihn der Alte an, „aber du denkst nicht wie ein Weißer. Meine Augen sind schlecht, aber ich kann es noch erkennen.‟
„Wer bist du?‟
„James Beckwourth. Chivington will, dass ich die Truppen zum Sand Creek führe.‟
Ernst blickte Dan ihn an.
„Wirst du es tun?‟
„Er wird mich dazu zwingen, aber er wird schon sehen, dass Medicine Calf Beckwourth zu alt ist.‟ Müdes Lächeln glitt über das runzlige Gesicht. „Er wird mich ablösen, noch vor dem Lager am Sand Creek. Ich habe fünfzig Jahre meines Lebens unter den Indianern verbracht, und der Teufel soll mich holen, wenn ich den Blauröcken auch noch helfe, sie umzubringen! Chivington wird schon noch einen anderen finden, der das tut, ob freiwillig oder unter Zwang. Ich bin ein alter Mann, Trapper. Ich denke nicht ans Töten. Wenn man bald stirbt, dann liebt man das Leben, ob es in weißer oder roter Haut steckt.‟
Langsam nickte Dan und schritt zu seinem Pferd, setzte sich zu Boden und hüllte sich in seinen Fellmantel, hockte reglos am Rand des Platzes und dachte an die Zeiten, da er mit den Sioux, Cheyenne und Arapaho Wild gejagt, an ihren Feuern gesessen und mit ihnen geraucht und gesprochen hatte.
Düstere, schlimme Ahnungen kamen ihm.
Oft genug hatte er niedergemetzelte Indianer gesehen! Nur selten hatten die Indianer zum Vergeltungsschlag ausgeholt. Fast immer hatten sie sich ihrem Schicksal ergeben, und auch jetzt noch glaubten sie an den wahrhaftigen und ewigen Frieden mit dem weißen Eindringling. Das würde ihr Untergang sein.
Irgendwie stand Dan an der Schwelle zu einer anderen Zeit. In diesen kalten Tagen würde eine alte und schöne Zeit für immer vergehen. Er ahnte, dass die Tage der Indianer nunmehr gezählt waren, dass Männer wie Chivington mit der großen Ausrottung begannen und, dass niemand sie aufhalten würde.
Wo waren all seine indianischen Freunde geblieben! Sie waren umgebracht worden, dahingegangen zu Staub. Wo waren die Gräber seiner Squaws, wo ruhten die Gebeine von Chief One-Eye, Großer Wolf und Tatanka?
Und nun sollte das Lager am Sand Creek überfallen werden!
Sein Blick schweifte suchend umher. Er wartete auf eine Chance, doch sie kam nicht. Noch war es nicht zu spät, noch konnte er Black Kettle und die anderen warnen; auf ihn würden sie hören. Denn er war ein Sohn der Wildnis, und in den Adern seines Jungen floss das Blut einer Indianerin.
Im Fort wurden die letzten Vorbereitungen getroffen. Nur selten wurde das Tor geöffnet. Draußen kampierten Hunderte von Soldaten.
Der kalte Wind ließ den Tod ahnen.
Es würde ein strenger Winter werden, und die Indianer würden mit ihren Frauen und Kindern hungernd umherirren und kein Wild mehr finden.
Das große Sterben hatte schon begonnen.
Nacht! Ein Reiter kam aus dem Dunkel, verhielt und starrte zu den vielen Feuern hinüber.
Geschmeidig glitt er vom Pferd, zog es hinter blattlose Sträucher und bizarre Felsen und witterte wie ein Wolf in den Wind. Die braunen Augen flackerten unruhig, er atmete die kalte Luft ein, sein Atem dampfte in der Kälte.
Er zog eine lange Lederschnur aus der Satteltasche und nahm sein Spencergewehr in die Rechte.
Dann schlich er geduckt durch das harte trockene Gras, überquerte die Spur vieler Pferde und mehrerer Wagen und glitt um Strauchgruppen. Immer wieder verharrte er, lag am Boden, horchte und hörte die Stimmen der Soldaten und das Schnauben der zusammengetriebenen Pferde. Dunkle Schatten bewegten sich vor dem flammenden Rot der Feuer, und Rauch zog herüber. Es roch nach Soldaten, nach ihren Stiefeln und ungewaschenen Uniformen, nach Schweiß und Whiskey.
Sky spürte nicht die Kälte, obwohl sie nach Gesicht und Händen griff. Er dachte an seinen Vater. Er musste wissen, was geschehen war. Um das zu erfahren, riskierte er sein Leben.
Wachposten schritten mit geschultertem Gewehr fröstelnd umher und klopften die Hände gegeneinander. Die dumpfen Geräusche verrieten Sky, wo sie sich befanden, und er machte einen Bogen um sie und schlich am Rand des großen Camps entlang.
Flackernder Feuerschein geisterte über die Zelte und Soldaten hinweg, fiel auf die abgestellten vier Zwölf-Pfund-Haubitzen.
Flüche ertönten.
Stiefel stampften durch das gefrorene Gras und zerbrachen die Halme, Säbel klirrten und Holz knackte in den Feuern.
Wie ein Schatten glitt der junge Sky auf das Fort zu, dessen spitze Palisadenwand sich vom Nachthimmel abhob.
Er musste durch die Zeltreihen hindurch, um die Palisadenwand zu erreichen.
Auf dem Wachturm von Fort Lyon standen zwei Soldaten, eingehüllt in ihre langen Mäntel, die Kragen hochgeschlagen. Sie blickten auf das große Camp hinunter.
Der Geruch von Whiskey verstärkte sich. Flaschen gingen von Hand zu Hand. Sergeanten und Offiziere saßen in Zelten; die Lampen warfen ihre Schatten an die Zeltwände.
Plötzlich bemerkte er einen Soldaten, der aus dem Dunkel kam, wo er wohl ein dringendes Geschäft erledigt hatte. Der Soldat hielt sein Gewehr.
Sky überlegte fieberhaft. Wenn er sich erhob, würde der Soldat ihn vor den Feuern sehen können, und wenn er liegenblieb, würde der Mann über ihn stolpern.
Es blieb ihm nichts anderes übrig, er musste liegenbleiben. Und er presste sich an den kalten Boden, lag zwischen zwei Zelten und starrte dem Soldaten entgegen.
Niemals würde Sky ein Freund der Blauröcke werden können, denn Soldaten hatten seine Mutter umgebracht. Er war nicht zur Versöhnung bereit mit Männern, die in diesem Land alles Leben zertraten.
Der Soldat hatte ihn noch nicht entdeckt. Er knöpfte sich gerade die Jacke zu und fluchte verhalten. Allmählich geriet sein Gesicht in den Schein der Feuer.
Sky blickte in ein bärtiges, verwüstetes Gesicht, das der Alkohol zerfressen hatte.
Seine Rechte löste sich vom Gewehr, er spannte die Muskeln, lag still, hörte die Stimmen und die Schritte.
Die Feuer blendeten den Soldaten.
Er stieß mit dem rechten Stiefel hart gegen den liegenden jungen Mann, stolperte und fiel fluchend nach vom.
Schon schnellte Sky herum, warf sich auf ihn, und bevor der Soldat warnend aufbrüllen konnte, schlossen sich Skys Hände wie Zangen um seinen Hals und drückten zu. Er ruckte hin und her, zuckte und röchelte. Sky ließ nicht locker. Der Mann erschlaffte allmählich, und erst jetzt ließ Sky los, blickte zu den Feuern, beobachtete die Soldaten, die Kaffee aus dem großen Topf schöpften. Seine dunklen Augen funkelten im Widerschein der Feuer. Das braungebrannte Gesicht schimmerte wie Bronze. Hart packte er den ohnmächtigen Soldaten und zerrte ihn hinter das Zelt. Hier ließ er ihn liegen und schlich mit der Spencer weiter.
Mühsam arbeitete er sich weiter. Immer wieder lag er still hinter den alten, zerschlissenen Zelten. Die Gespräche der Soldaten drehten sich um Indianer und Weiber, Whiskey und Saloons; sie redeten über Indianerskalpe, die man zu guten Preisen im Osten verkaufen könnte. Manchmal kamen Soldaten dicht an Sky vorbei.
Niemand ahnte, dass ein Halbindianer allein durch das große Camp schlich, denn mehrere hundert Männer mussten doch jeden Indianer abschrecken.
Mit verbissenem Eifer und kalter Entschlossenheit suchte Sky sich einen Weg durch das Camp und erreichte schließlich die Palisadenwand des Forts.
Rund um das Fort loderten die Feuer.
Er duckte sich tief und stieß den Ruf eines Kauzes aus.
Der leise sanfte Ruf konnte kaum den ständigen Lärm durchdringen, und doch vernahm Catch-the-Bear Dan Oakland den Ruf seines Sohnes. In seinem rauen Gesicht zuckte es, er richtete sich an der Wand der Unterkunft der Soldaten auf und blickte schnell umher. Die Soldaten beachteten ihn nicht. Im Fort war es ruhiger als draußen. Gelber Lichtschein sickerte aus der Offiziersunterkunft. Dort saß man zur Lagebesprechung zusammen.
Leise antwortete Dan.
Sky atmete erleichtert auf. Sein Vater lebte und konnte sich im Fort frei bewegen.
Wieder rief er wie ein Kauz.
Im Fort horchte auch ein anderer Mann auf: Medicine Calf Beckwourth. Der alte Mann blickte zu Dan Oakland hinüber, rührte sich nicht.
Dan konnte nicht lesen und nicht schreiben, so wie es seinem Sohn gelehrt worden war. Er besaß auch kein Stück Papier, das er über die Palisaden hätte werfen können. So blieb ihm nichts anderes übrig, als einen warnenden Ruf auszustoßen.
Sofort starrten mehrere Soldaten herüber, und Dan hustete. Drei Soldaten kamen langsam heran und bauten sich vor Dan auf. Sie blickten ihn forschend und misstrauisch an.
„Bist du das gewesen, Trapper?‟, dehnte einer von ihnen. „Was soll das bedeuten, he? Mach’s Maul auf!‟
Oakland blieb ruhig. Er befürchtete, dass Sky noch antworten und daraufhin entdeckt werden könnte, doch sein Junge musste die Gefahr richtig erkannt haben, denn es blieb still draußen.
„Ich bin schon ein paar Jahre in diesem Land‟, knurrte der vierschrötige Soldat, „und ich weiß, wie ein richtiger Kauz ruft. Die verdammten Indianer benutzen den Kauzruf, um sich zu verständigen. Du bist ein Freund der Indsmen, wie? Und vielleicht sind da draußen ein paar Indsmen!‟
Bevor Dan antworten konnte, kam Beckwourth heran, ging steif und rieb sich ächzend den Rücken. Neben den Soldaten blieb er stehen.
„Kauzrufe haben den Vorteil, dass man nicht weiß, woher sie kommen, Soldiers‟, sagte er mit faltigem Lächeln. „Sonst hättet ihr auch gemerkt, dass ich diese Rufe nachgeahmt habe. Nur ein Mann, der lange genug unter Indianern gelebt hat, kann solche Rufe ausstoßen. Fragt diesen Trapper doch mal, ob er in einem Indianerdorf gelebt hat.‟
„Du warst das? Klang verteufelt von hierher!‟
„Eben, und darum fallen so viele auch darauf herein‟, meinte Old Beckwourth, wandte sich ab und humpelte zum alten Platz zurück.
Die Soldaten ließen Dan allein. Sie fragten nicht mehr. Unauffällig nickte Dan dem Alten zu.
Plötzlich schrie jemand draußen im Camp mit heiserer Stimme. Im Nu geriet alles durcheinander. Die Soldaten hasteten um die Zelte und holten ihre Waffen.
Sky duckte sich tief. Er durfte die Lederschnur nicht über die Palisaden werfen und seinem Vater so einen Fluchtweg eröffnen. Er musste höllisch schnell von hier verschwinden, sonst würden sie ihn erwischen.
Der Soldat, den er überwältigt hatte, war zu sich gekommen und hatte das Camp alarmiert, doch er wusste nicht zu sagen, wer ihn gewürgt hatte. So rannten alle durcheinander.
Lautlos schlich Sky auf die Feuer und Zelte zu. Soldaten kamen näher, und er schmiegte sich an ein Zelt, lag dicht unten am Rand und im Schatten des Zeltes. Hart stampften sie vorüber, riefen und schwangen die Gewehre. Sergeanten und Offiziere versuchten Ruhe ins Camp zu bekommen.
Skys Versuch, den Vater herauszuholen, war gescheitert. Er durfte nicht im Camp bleiben. Wieder kamen Soldaten. Auch diesmal ließ er sie vorbei, sprang jedoch sofort hinter ihnen auf und rannte mit ihnen zu den Feuern. Sie stürmten weiter, zwischen die Zelte, und er rannte mit, kam aus dem Flammenschein der Feuer und hastete zur Seite.
Irgendwer musste ihn entdeckt haben, die schlanke, sehnige Gestalt mit dem langen wehenden Haar. Ein Schuss krachte, und die Kugel fauchte heiß an Skys Gesicht vorbei. Obwohl der Soldat nicht wusste, wen er vor sich hatte, schoss er weiter und wollte Sky mit einer Kugel von den Beinen holen.
Wie eine Wildkatze rollte Sky über den Boden, schnellte zwischen Gestrüpp und entging den Kugeln nur knapp.
Doch da kamen andere Soldaten, die ihm den Weg zum Pferd versperrten. Noch hatten sie ihn nicht entdeckt, und er kauerte am Boden zwischen den Felsen und rührte sich nicht. Sie keuchten und riefen, durchkämmten das Gelände mit schussbereiten Gewehren und kamen auf die flachen Felsen zu.
Wie eine Schlange glitt Sky in eine schmale Lücke und lag völlig still, atmete mit geöffnetem Mund und starrte zum Camp hinüber.
Gräser raschelten. Tastende Schritte erstickten im Lärm. Schattenhaft verschwommene Gestalten bewegten sich vorbei. Zwei Soldaten machten kehrt und näherten sich wieder den Felsen. Ihre Gewehre waren auf Sky gerichtet, doch sie sahen ihn nicht. Mit eisernen Nerven harrte er aus. Dicht vor ihm blieben die beiden Männer stehen.
„Ich glaub’, das ist ein Indianer‟, sagte der eine, und der andere meinte zynisch: „Wenn wir ihn erwischen, haben wir unseren ersten Skalp.‟
Sky konnte schießen, aber dann hatte er sie alle auf dem Hals. Er wusste nicht, warum so viele Soldaten vor Fort Lyon lagerten und wer sie befehligte, doch er spürte das Unheil, das von ihnen ausging.
Die Blicke der Soldaten schweiften über ihn hinweg, und auf einmal entfernten sich die beiden.
Er lag noch lange still. Stimmen tönten durch die Nacht. Im Camp wurde es ruhiger. Erst jetzt verließ Sky sein Versteck, schlich abseits der Feuer weiter und näherte sich seinem Pferd. Er wollte in der Nähe von Fort Lyon bleiben und auf seinen Vater warten.
Schwach raschelten die Sträucher, als er tastend durch das kalte Gestrüpp kroch. Dumpf schnaubte sein Pferd. Er ahnte nichts, lächelte wild und richtete sich neben dem Pferd auf. Schon wollte er in den Sattel springen, als ihn ein kaltes Gefühl warnte. Er spürte schon körperlich die Nähe der Gegner, und als er den Kopf herumriss, blickte er in die Mündungen von vier Gewehren, die von grinsenden Soldaten gehalten wurden.
Gleich viermal war der Tod zu ihm gekommen, und selbst die kleinste Bewegung würde seinen augenblicklichen Tod zur Folge haben. Völlig erstarrt stand er neben dem Pferd im kalten Mondlicht. Das dunkle Gesicht wirkte wie eingefroren. Die Augen glitzerten unter den schwarzen Wimpern. Lauernd schnellte sein Blick umher. Er hatte keine Chance.
„Welchen Hundesohn haben wir denn da erwischt?‟, dehnte ein Soldat gehässig. „Soll das ein Indianer sein, so ein dreckiger, verlauster Indsman?‟
„Ja‟, grunzte ein anderer, „so ein Schwein von Indianer, die überall hier herumstreifen. Knall ihn ab, Smith. Der Skalp gehört dir.‟
Sky verstand jedes Wort. Im Mienenspiel der Feinde erkannte er ihre Niederträchtigkeit. Sie konnten grausam handeln. Doch bevor der Soldat abdrücken konnte, wurde Hufschlag laut. Ein Reiter in Uniform trieb das Pferd ins Gestrüpp und verhielt neben den Felsen.
„Habt ihr ihn hier erwischt?‟
„Ja, Sergeant. Er kam vom Camp herübergeschlichen.‟
„Bringt ihn ins Fort!‟, befahl der Sergeant, riss das Pferd herum und ritt zum Camp zurück.
Die Soldaten packten Sky. Sie schlugen auf ihn ein und warfen ihn bäuchlings auf sein Pferd, schnürten Hände und Füße zusammen und ritten mit ihm zu den Feuern.
Tief hing Sky mit dem Kopf hinab. Unter ihm zog der Boden entlang. Er konnte sich nicht vom Pferd fallenlassen. Mühsam hob er den Kopf an und starrte auf die Feuer und Soldaten. Dann hörte er, wie das Tor geöffnet wurde.
„Wir bringen einen Gefangenen!‟
Unwillkürlich duckte Dan Oakland sich, als er die Reiter mit seinem Sohn auf den Platz reiten sah. Während er noch fieberhaft überlegte, rissen die Soldaten Sky vom Pferd und ließen ihn zu Boden fallen. Kein Stöhnen kam über Skys Lippen; reglos lag er vor ihren Stiefeln.
Zwei Offiziere kamen heran.
Dan blickte noch einmal auf seinen Sohn, dann schob er sich an der Wand der Unterkunftsbaracke vorsichtig entlang und suchte den dunklen Schatten auf.
Die Soldaten des Forts würden Sky wiedererkennen. Man wusste, dass er mit Dan ins Fort geritten war, und man würde nach Dan suchen. Hier im Fort!
Dan hörte, wie die Soldaten sprachen, wie Sky über den Platz geschleift und in eine der dunklen kleinen Zellen geworfen wurde, die großen Käfigen ähnelten.
Sofort tastete er sich durch den Gang zwischen Unterkunftsbaracke, Depot und Pferdestall, stieß gegen eine Tonne, wühlte mit den Stiefeln durch einen Berg von Abfall und erreichte die Latrine. Suchend blickte er umher, hörte laute Stimmen und den Befehl, nach ihm zu suchen. Er hielt die Volcanic fest gepackt.
Nur in Freiheit konnte er seinem Sohn helfen!
Sein Pferd war in diesem Moment völlig unwichtig. Sie würden es wohl gleich finden.
Er musste ein Versteck finden, wo niemand ihn vermutete.
Hart presste er sich an die Wand aus Baumstämmen. Vielleicht wäre er am sichersten in einer der dunklen Zellen, die noch nicht belegt waren, doch der Weg dorthin war ihm versperrt.
Schon kamen Soldaten.
Entschlossen glitt er zur Latrine. Sie lag erhöht und war etliche Yards lang. Unterhalb der Latrine entdeckte Dan eine schmale Tür. Er zerrte sie auf und bewegte sich hinein. Vor ihm im Halbdunkel standen mehrere Tonnen. Gestank schlug ihm entgegen. Von oben fiel nur wenig Licht durch die Löcher. Er wagte kaum, sich zu bewegen, um nicht gegen die Wände zu stoßen.
„O verdammt!‟, flüsterte er. „Das bringt dich um, Oakland!‟
Oben quietschte eine Tür in trockenen Holzangeln, und Schritte polterten über ihm entlang. Soldaten suchten in der Latrine nach ihm. Sie blickten durch die Löcher nach unten und fluchten. Geräuschvoll verließen sie die Latrine. Dan hörte sie davongehen. Er drückte die Tür behutsam auf und starrte hinaus. Rufe verrieten ihm, dass sein Pferd entdeckt worden war. Hart biss er die Zähne zusammen. Er musste die Soldaten täuschen. Lange harrte er unten aus. Langsam wurde es still im Fort. Nur die Schritte, der Wachposten waren zu hören.
Am Tag würden sie wieder nach ihm suchen.
Er verließ den Unterbau der Latrine und schlich zum Pferdestall. Die Stille zerrte an seinen Nerven. Überall konnten Posten auf ihn lauern. Innerhalb des Forts war alles eng beieinander. Am Tag hatte er die Seitentür des Pferdestalls bereits gesehen. Lautlos öffnete er sie einen Spalt und starrte hinein.
Viele Pferde standen nebeneinander. Die meisten schliefen, und nur manchmal klirrte eine Gebisskette. Es roch nach Stroh und Pferdeschweiß. Er zog die Tür weiter auf und schob sich in den Stall.
Hier stand er horchend.
Irgendwo im Halbdunkel des Stalls schliefen bestimmt jene Soldaten, die sich um die Pferde zu kümmern hatten. Gewöhnlich übernachteten Stallburschen am Stalltor.
Vorsichtig ging Dan durch den schmalen Gang. Dumpf prustete ein Pferd. Stroh raschelte. Durch die Baumstammfugen fielen dünne Streifen Mondlicht. Dan duckte sich, blickte unter den Pferdebäuchen zum Stalltor hin, erkannte drei schlafende Männer. Das Stalltor war nur angelehnt.
Er musste an die Sättel herankommen! Sie lagen aufgereiht auf einem langen Baumstamm, der auf zwei Pfosten im Stallgang entlangführte.
Auf Fußspitzen bewegte er sich durch das Halbdunkel. Vor Anspannung verkrampften sich die Kiefermuskeln. Immer wieder starrte er zu den Schlafenden hinüber. Er hütete sich, durch verstreutes Stroh zu gehen.
Jetzt trat er auf den Stallgang hinaus und erreichte die Sättel. Mit der Linken löste er von einem Sattelhorn das Lasso, das sicherlich einem ehemaligen Cowboy gehörte, der jetzt als Soldat diente.
Wenig später war er draußen, blieb im Schlagschatten des Pferdestalls, kam an der Latrine vorbei und erreichte die Palisadenwand. Von hier aus beobachtete er die Posten, und als sie ihm den Rücken kehrten, warf er die Schlinge des Lassos über die Palisaden und zog sofort straff an. Das Lasso hing nun ins Fort hinunter und schwang im Wind schwach hin und her.
Dan zögerte keine Sekunde und suchte sein übelriechendes Versteck unterhalb der Latrine wieder auf. Er ließ die Tür angelehnt und hörte plötzlich Schritte.
Drei Männer kamen aus dem Schattenstreifen des Pferdestalls hervor und blieben stehen, blickten um sich und sprachen leise miteinander.
‟Es muss eine beschlossene Sache sein, dieses Massaker nicht mitzumachen, meine Herren. Das ist kein Kampf, der uns zur Ehre gereicht, sondern ein Abschlachten von friedlichen Indianern, von Frauen und Kindern.‟
„Ja, Captain. Ich habe ja bereits dem Colonel gesagt, dass es eine schlimme Sache ist, wenn wir angreifen.‟
„Schlimme Sache? Mord ist das! Grausamer Mord, bestialisch vorbereitet! Der Befehl zwingt uns, daran teilzunehmen, aber ich werde meinen Männern sagen, dass sie nur in Notwehr schießen sollen.‟
„Dann werde ich es meinen Leuten auch sagen, Captain.‟
Dan hörte die raunenden Stimmen von drei Offizieren, die in ihrer Gewissensnot keinen anderen Ausweg fanden, als sich dem Befehl zum Morden insgeheim zu widersetzen.
„Wenn das herauskommt, meine Herren, ist uns das Kriegsgericht sicher. Colonel Chivington hat zu viel Macht, er ist ein Freund des Gouverneurs.‟
„Aber Washington muss doch darauf was unternehmen, Sir!‟
„Bei anderer Gelegenheit würde ich über Ihren Einwand lächeln, Lieutenant, aber heute ist mir das Lachen vergangen. Gehen Sie jetzt, sonst entdeckt man uns noch hier.‟
Die Männer entfernten sich. Dan war ein wenig beruhigt, dass es noch solche Soldaten gab.
Die Nacht war lang.
Am Morgen wurde das Lasso entdeckt. Major Anthony bekam einen Tobsuchtsanfall. Die Suche nach Dan Oakland wurde eingestellt. Ein endloser Tag begann für ihn.
Hungernd und frierend verbrachte er all die langen Stunden in seinem düsteren Versteck. Er wusste nicht, was mit seinem Sohn gemacht wurde. Er konnte nicht hinaus und ihn befreien.
Es war ein frostklirrender kalter Abend, der in die Geschichte eingehen sollte.
28. November 1864.