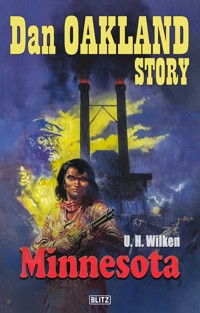Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Dan-Oakland-Story
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
IndianersommerCaptain Mortimer Tanner hasst alle Indianer. Er nutzt jede Gelegenheit, um die Krieger der Sioux zu töten. Dabei macht er auch vor Alten, Frauen und Kindern nicht Halt.TodesvögelGerüchte über einen bevorstehenden Armeefeldzug schrecken die Sioux auf. Häuptling Sitting Bull schickt Späher los. Die Spur führt nach Three Coins. Dort lagern große Waffen- und Munitionsvorräte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 264
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
In dieser Reihe bisher erschienen
Todesvögel
Dan Oakland Story
Buch 29
U. H. Wilken
Dieses Buch gehört zu unseren exklusiven Sammler-Editionen
und ist nur unter www.BLITZ-Verlag.de versandkostenfrei erhältlich.
In unserem Shop ist dieser Roman auch als E-Book lieferbar.
Bei einer automatischen Belieferung gewähren wir Serien-Subskriptionsrabatt. Alle E-Books und Hörbücher sind zudem über alle bekannten Portale zu beziehen.
Copyright © 2024 BLITZ-Verlag
Hurster Straße 2a, 51570 Windeck
Titelbild: Rudolf Sieber-Lonati
Umschlaggestaltung: Mario Heyer
Logo: Mario Heyer
Satz: Gero Reimer
Alle Rechte vorbehalten
www.Blitz-Verlag.de
ISBN: 978-3-7579-2186-6
4329v1
Inhalt
Indianersommer
Todesvögel
Über den Autor
Indianersommer
Wie eine Antilope hetzte er über die Prärie, warf sich hinter buschige Sträucher und verkroch sich wie ein todwundes Tier. Voller Angst blickte er durch das wild schlagende Geäst zurück. Heftig hämmerte sein junges Herz. Dunkle Wolken zogen über die weite Ebene. Vor dem fahlen Horizont hoben sich schwarz und drohend vier Reiter ab; ihr Lachen wehte herüber. Fern über den Black Hills zuckten die grellen Blitze. Sie tauchten das Indianerland in bleiches, kaltes Licht.
Das heisere Gelächter wurde lauter. Schrill wieherten die gepeinigten Pferde. Die Mähnen flatterten im Wind. Grausam spornten die Männer die Tiere an. Sie kamen den Strauchgruppen immer näher. Gleich einem Kind, das sich vor dem wilden Ausbruch der Naturgewalt fürchtet, hob der junge Indianer den Kopf an und starrte in den dunklen Himmel. Der Große Geist war zornig. Er schickte das Feuer vom Himmel, ließ die Erde erzittern und verbarg sein Gesicht hinter den Wolken.
„Er muss zwischen den Sträuchern sein!“ Hart trieben die Männer die Pferde in das Gestrüpp, Hufe stampften, zerbrachen die Zweige. Gewehre senkten sich, Läufe zeigten auf das Blattwerk. „Verteilt euch, Jungs! Wir scheuchen ihn raus. Er hat sich hier irgendwo verkrochen!“
Zweige brachen, Pferde polterten zurück, keuchten und stampften. Das Unwetter zog näher. Über dem Little Big Horn River riss sekundenlang die Wolkendecke auf. Bleiches Licht geisterte über das Land der Teton-Sioux.
Wieder kamen die Reiter näher, diesmal von drei Seiten. Sie hatten ihren Spaß an der Menschenjagd.
Panische Angst trieb den Indianer aus der Strauchinsel hervor. Wieder hetzte er über die Prärie. Heftig flatterte das lange schwarze Haar im Sturm. Die schlanken Beine bewegten sich schnell. Der Mund des jungen Sioux war weit geöffnet. Die Augen blickten wie im Fieber zu den dunklen Bergzügen hinüber, wo sich die Bäume im Sturm schüttelten.
„Da ist er!“, schrie einer der Reiter und peitschte das Pferd vorwärts. Brüllend folgten ihm die anderen drei Männer.
Gehetzt blickte der Indianer zurück, sah die vier Reiter nebeneinander, hörte ihr Lachen. Die Angst erhitzte seinen Atem, er atmete pfeifend.
Sie ließen ihn nicht entkommen. Dicht vor den Bergzügen holten sie ihn ein, umzingelten ihn, trieben die Pferde so hart zusammen, dass er von den Tieren fast zerquetscht wurde. Ein erstickter Aufschrei brach über seine Lippen. Er tauchte weg, schnellte unter einem Pferdebauch hindurch und lief weiter. Hinter ihm schleuderte einer der Männer das Gewehr. Wie ein Knüppel schlug es zwischen die Beine des Sioux und warf ihn um. Er rollte wie ein Bündel über den Boden, sprang auf und hob abwehrend die Hände. Hart schlug einer der Reiter zu. Der Gewehrlauf traf den Kopf des Indianers und ließ ihn bewusstlos zusammenbrechen.
Keuchend hielten sie inne und starrten auf die reglose schlanke Gestalt.
„Wir hängen ihn auf! Wir lassen ihn zappeln!“ Sie saßen ab, hielten die Pferde am Zügel, packten den Sioux und schleiften ihn über die Erde.
Knarrend bogen sich die Bäume im Sturm. Das Lasso wirbelte über einen Ast. Die Schlinge schwang im Sturm. Blätter wirbelten davon. Schmutzige Hände streiften die Schlinge über den bloßen Oberkörper des Indianers und zurrten sie fest. Heiseres Lachen wurde vom Sturm davongetragen. Die Pferde standen angeleint an einem Baum, zerrten am Zügel und wieherten unruhig. Blitze zuckten über die Ebene.
Der Indianer kam zu sich, hockte gefesselt am Boden, war wehrlos. Die ersten Regentropfen trafen klatschend sein Gesicht. Das Regenwasser lief wie Tränen über das dunkle Gesicht. Die Schlinge presste seine Rippen zusammen. Er hatte Mühe, Atem zu holen. Ein kehliger leiser Laut kam über seine Lippen. Die Weißen verstanden ihn nicht; sie waren der Sprache der Sioux nicht mächtig.
„Was hat er gesagt?“
„Weiß der Teufel. Bringen wir’s hinter uns.“
* * *
Nur allmählich ließ der Sturm nach. Der Wind winselte über die nasse Prärie. Eintönig prasselte der Regen. Dunstfelder hüllten die Täler ein.
Im Wigwam saßen zwei Männer am kleinen Feuer. Der Rauch zog durch die obere Öffnung des Spitzzeltes ins Freie. Der rote Schein der Glut fiel in das raue, zerfurchte und wettergebräunte Gesicht des Trappers Dan Oakland. Die Sioux nannten ihn Catch-the-Bear. Schon zu Lebzeiten war dieser Mountain Man zur Legende geworden.
Stilles Lächeln entspannte das männliche Gesicht. Das sandgraue Haar hing bis zu den Schultern hinab. Die Lederjacke aus Wolfsfellen klaffte auseinander und gab die mächtige breite Brust frei. In den grauen Augen war ein gutmütiger Ausdruck. Er warf etwas Holz in das Feuer und blickte über die hochzuckenden Flammen hinweg zu seinem jungen erwachsenen Sohn.
„Das Unwetter bleibt noch zwischen den Bergzügen.“
Sein Sohn Sky lauschte dem fernen Grollen und nickte. Langes schwarzes Haar umrahmte glatt sein schmales dunkles Gesicht. Er sah aus wie ein Sioux-Indianer. Büffelfell umhüllte den sehnigen schlanken Körper. Der flackernde Feuerschein traf seine dunklen weichen Augen. Hier im Land der Dakota war er zu Hause. Hier war er geboren worden als Sohn des weißen Trappers Catch-the-Bear Dan Oakland und einer jungen Sioux, die von Weißen umgebracht worden war. Hier fand er den Frieden, nach dem er sich immer sehnte.
„Wir wollen in den nächsten Tagen auf Büffeljagd gehen, Dad“, sagte er.
„Wirst du mitkommen? Bitte, komm mit.“
Der eiserne Dan lächelte und sah in das Feuer. In Gedanken wanderte er weit hinaus über die Prärien und zu den großen Büffelherden. Dakota erwartete den Winter. Die Krieger und Jünglinge mussten Fleisch und Felle heranschaffen, denn die Winter waren immer lang und sehr streng.
„Ja, Sky, ich komme mit euch. Ich brauche die Luft der Ebenen. Und ich werde sehen, ob meine Muskeln noch so hart sind wie früher.“
„Warum denkst du an das Alter, Dad? Du wirst ewig jung bleiben. Sieh dir die Bäume an, Dad. Sie werden zwar älter, doch immer stärker, sie graben ihre Wurzeln tief in den Boden, und kein Sturm kann sie entwurzeln. Sie strecken ihre Äste in den Himmel, und kein Blitz kann sie fällen.“
„Wir Menschen sind keine Bäume, mein Junge. Wir werfen auch nicht Laub ab. Wenn unsere Zeit um ist, dann gehen wir von dieser Erde. Das ist der ewige Lauf der Dinge. Hörst du es, Sky?“
Zitterndes Geschrei tönte aus dem Nachbarzelt herüber. Eine junge Squaw war vor einer halben Stunde allein durch den strömenden Regen davongegangen, sie hatte ihr Kind abseits des Lagers zur Welt gebracht, und jetzt schrie es nebenan im Wigwam.
„Ja, Dad“, flüsterte Sky. „Es ist neues Leben geboren worden.“
„Und altes Leben wird dahin gehen.“ Dan richtete sich auf und verließ das Zelt. Regen traf sein verwittert aussehendes Gesicht. Gebeugt und mit wiegenden breiten Schultern stapfte er durch das Lager. Rauch stieg über den Zelten empor. Die Sioux hörten seine schweren, erdhaften Schritte und sahen ihn an ihren Wigwams vorbeigehen. Der Regen rann an den Zelten hinunter. Nasse Hunde kauerten neben den Wigwams. Im grauen Regendunst verharrten reglos die Ponys im Tal. Die bewaldeten Talhänge verschwammen hinter der Regenwand. Fernab leuchteten Blitze über Dakota.
Am Rand des Siouxlagers blieb Dan stehen und blickte zum Bergkamm empor.
Dort oben stand schwankend ein greiser Indianer. Der Wind bewegte nur schwach das nasse silbergraue Haar. Langsam ging der alte Mann in die Knie, hielt das eingefallene Gesicht in den Regen hinein und erwartete den Tod.
Scheinbar schwerfällig drehte Dan sich um und sah zurück. Rauch und Regendunst wallten über dem Lager. Leise tönten verhaltene Stimmen aus den Wigwams. Niemand war zu sehen. Tief atmete er die feuchte, kühle Luft ein und stapfte zurück.
Sky briet etwas Fleisch über dem Feuer und blickte nicht auf, als er eintrat und sich setzte. Das Wasser perlte auf den Wolfsfellen. Dan schloss die Augen, legte sich auf den Fellen zurück und lauschte dem Regen.
Hoch oben auf dem Berg starb der Greis. Der Wind fauchte über ihn hinweg und strich wimmernd über die Prärie, traf den toten jungen Indianer, winselte um die Bäume und fing sich in der Bergfalte. Gebeugt hockten die vier Weißen auf den Pferden. Langsam ritten sie in das Tal und erreichten den Windschatten hoher zerklüfteter Felsen. Hier saßen sie ab und zogen die Pferde dicht an die Felsen heran. Suchend starrten sie umher. Plötzlich stieß einer einen scharfen Ruf aus und zeigte durch das Tal.
Das rote Auge eines Feuers glühte durch die Regennacht. Es war kaum zu erkennen. Nur das Aufflackern hatte den Weißen aufmerksam gemacht.
Misstrauisch und lauernd stierten sie durch das Tal.
„Wer kann dort sein?“, krächzte einer. „Indianer bestimmt nicht. Die sind nicht so verrückt und machen mitten im Tal ein Feuer.“
„Ich kann mich täuschen, aber das dort unten könnten Wagen sein!“, vermutete ein anderer. „Das sind doch Wagenplanen!“
„Schon möglich. Sehen wir uns das aus der Nähe an!“
Sie stiegen auf die Pferde, verließen den Windschatten und ritten durch den strömenden Regen in das Tal hinunter.
* * *
Die nassen Wagenplanen bewegten sich schwer im Wind und schlugen gegen die Stangen. Eine Windfangplane war neben dem Feuer aufgespannt. Dicht am Feuer kauerte ein Mann unter einem Regenmantel. Der Lauf eines Gewehres ragte unter dem Mantel hervor. Regenwasser tropfte vom Hut. Dampf stieg aus dem Feuer. Holz glühte und warf die Wärme in das Gesicht des Mannes, der die Augen geschlossen hatte.
Unter einem der drei Wagen lagen zwei Männer, eingerollt in ihre wärmenden Decken. Hinter der Plane eines Wagens flackerte schwaches Licht. Dumpfer Hufschlag ließ den Mann am Feuer hochfahren. Er packte das Gewehr, wich aus dem Feuerschein und zog die Waffe hoch.
Zwischen den Wagen verhielten vier Reiter. „Du brauchst nicht zu schießen“, tönte es heiser herüber. „Wir beißen nicht.“
Die Stimme ließ die beiden Männer unter dem Wagen nach den Waffen greifen. Sie starrten unter den anderen Wagen hindurch und sahen nur die Beine von vier Pferden.
„Wer seid ihr?“, rief der Wachtposten misstrauisch.
„Goldsucher. Nimm die Knarre runter und lass uns an das Feuer. Wir sind nass wie Hunde.“
„Kommt langsam näher, aber einzeln!“, verlangte der Mann am Feuer.
„Mann, du machst ja vor Angst fast in die Hosen! Wir haben nichts gegen euch. Wir sind doch keine Indianer, Mann!“
Langsam kam der erste Reiter heran, ein hagerer, blassgesichtiger Mann, der lächelte und sein Pferd neben dem Feuer zügelte. Schwarze Augen starrten den Wachtposten durchdringend an. „Meine Freunde nennen mich Scarfaced Bill“, sagte er schleppend. Er deutete auf den nächsten, der stark schielte. „Das ist Curly Hooker.“
„Nett, deine Bekanntschaft zu machen, Mister“, sagte Curly Hooker und schielte umher. „Was macht ihr hier mit den drei Wagen?“
„Sei nicht so neugierig, Curly“, rügte Scarfaced Bill. „He, Modoc Charley, Big Clum, kommt her! “
Aus dem Dunkel lösten sich die beiden letzten Reiter. Der dunkelhäutige Modoc Charley grinste breit. Die Wangenknochen stießen hart aus dem Gesicht hervor. Er sah wie ein Halbblut aus, doch er war ein Weißer. Hinter ihm kam der große, dicke Big Clum heran. Er lächelte einfältig und nickte. Diesen vier Männern war nicht anzusehen, dass sie erst vor kurzem einen blutjungen Indianer grausam getötet hatten.
Die beiden Männer unter dem Wagen krochen hervor. Auf den Wagen wurde es unruhig. Ein Mädchen steckte seinen Kopf durch die Lücke der Wagenplane.
„He, haben wir Besuch?“, fragte es mit einer Burschenstimme und lächelte „Wie schön! Männer kann man gar nicht genug haben.“
„Still, Mary“, antwortete der Mann am Feuer. „Steck dein Gesicht wieder weg. Heute Nacht ist Affenjagd.“
Verwundert blickten Scarfaced Bill und seine Begleiter auf den Wagen.
„Was ist denn das?“, flüsterte Curly Hooker. „Ein Mädchen?“
„Ja“, knurrte der Posten, während die beiden anderen Männer neben ihm stehenblieben. „Wir sind mit neun Frauenzimmern unterwegs nach Fort C. F. Smith. Von dort geht es dann weiter nach Norden zum Yellowstone. Wir bringen den Trappern ein paar Frauen. Dafür kriegen wir einen Haufen Felle, die wir dann nach St. Louis bringen. Jetzt wisst ihr alles. Mein Name ist Vince Edwards.“ Er entspannte den schlanken Körper und kratzte sich im schwarzen Haar. „Der Rothaarige ist Joe Connery, und unser Alter hier ist Major Finch, natürlich ein ehemaliger Major.“
„Die Armee hat ihn rausgeschmissen“, erklärte Joe Connery grinsend. „Unser Major hatte das Depot unter sich.“
„Darüber brauchst du nicht das Maul aufzumachen, Connery!“, grollte Finch. „Was geschehen ist, ist vorbei und vergessen, verstanden?“
„Ihr gefallt uns“, grinste Scarfaced Bill. „Wir werden uns gut vertragen.“
„Seid ihr auch unterwegs nach Norden?“, wollte Vince Edwards wissen.
„Ja“, antwortete Scarfaced Bill und blickte nach den Wagen hinüber. „Ihr zieht durch das Indianergebiet. Drei Mann sind verdammt wenig, wenn die Sioux angreifen sollten. Was haltet ihr davon, wenn wir euch begleiten?“
Edwards zuckte die Achseln und sprach leise mit Joe Connery und dem ehemaligen Major. Sie gingen abseits und sahen forschend zu den vier Goldsuchern hinüber.
„Wir können sie nicht davonjagen“, flüsterte Connery.
„Sie würden gehen“, vermutete Finch. „Doch sie würden aus dem Hinterhalt auf uns feuern. Ich traue ihnen nicht.“
„Aber dieser Scarfaced Bill hat recht“, dehnte Edwards. „Wenn die Sioux uns entdecken sollten, wird es hart. Vier Gewehre dazu bedeuten mehr Sicherheit für uns.“
Sie gingen zum Feuer zurück. Die vier Männer waren abgesessen und standen dicht am wärmenden Feuer. Der Wind schlug gegen die Plane, und der Regen prasselte hernieder.
„Bringt eure Pferde zu unseren“, sagte Vince Edwards. „Legt euch unter die Wagen. Morgen früh brechen wir auf.“
Sie grinsten und nickten, zogen die Pferde weg und kamen mit Decken und Fellen zurück. Schweigend krochen sie unter die Wagen und rollten sich in die Decken. Über ihnen auf den Wagen flüsterten die Mädchen. Edwards, Connery und Finch setzten sich an das Feuer und sprachen leise miteinander. Schließlich übernahm der grauhaarige Finch die Wache, und die beiden anderen legten sich nieder. Die Nacht blieb ruhig.
* * *
Früh am Morgen loderten die Flammen zwischen den Wagen empor und breitete sich der Duft von Kaffee aus. Noch immer regnete es. Der Wind hatte nachgelassen.
Nacheinander kletterten die Mädchen von den Wagen und zogen die Schultern fröstelnd hoch, rückten dicht an das Feuer heran und tranken den heißen Kaffee. Immer wieder blickten sie zu den vier Fremden hinüber, und die blonde Mary lächelte lockend.
„Die Jungs sind doch nett, nicht wahr?“, flüsterte sie zu den anderen Mädchen hin.
„Ich wüsste was Besseres“, erwiderte ein Mädchen derb. „Diese Kerle stinken doch nach Wildnis. Lass die Finger davon, Mary!“
„Was du wieder hast“, sagte Mary. „Wir haben noch einen langen Weg vor uns.“
Sie alle waren keine Ladys. Edwards und seine beiden Begleiter hatten sie aus Saloons geholt, aus schmutzigen Spelunken. Sie hatten nichts zu verlieren, nur zu gewinnen. Es gab nur eine einzige Ausnahme unter diesen Mädchen, die es mit der Moral nicht so genau nahmen. Das war die schwarzhaarige kleine Chris; ihre blauen Augen blickten traurig. Sie schwieg, sprach selten ein Wort, schien mit den Gedanken immer weit fort zu sein. Auch sie hatte in einem Saloon gearbeitet. Vielleicht träumte auch sie von einem besseren Leben in der Wildnis des Nordens, in einem Heim eines Trappers.
Scarfaced Bill und seine Komplizen betrachteten die Mädchen offen und grinsten.
„Ihr seid viel zu schade für die Trapper“, sagte Modoc Charley mit dunkler Stimme. „Warum macht ihr das alles überhaupt mit?“
Bevor eins der Mädchen antworten konnte, richtete Vice Edwards sich auf und starrte ihn durchdringend an. „Wir bringen die Mädchen nach Norden. Das ist unsere Sache, Modoc Charley. Lasst die Finger von den Mädchen. Wir wollen keinen Ärger, verstanden?“
Modoc Charley grinste, doch in seinen Augen flirrte es seltsam. „Schon gut, Edwards, war doch nur eine Frage, verstehst du?“
„Das will ich hoffen“, knurrte Edwards. „Los, Mädchen, trinkt die Becher leer, wir brechen auf.“
„Oh, du bist ein richtiger Sklaventreiber, Edwards“, meinte Mary und stand auf. „Kommt, meine Lieben, Edwards ist heute sauer.“
Kichernd stiegen sie auf die Wagen. Edwards, Connery und Finch spannten die Wagenpferde vor und leinten die Sattelpferde an die Wagen, stiegen auf und trieben die Wagenpferde an. Langsam rollten die Planwagen durch das Tal und in die Bergfalte hinein. Die vier Männer folgten mit ihren Pferden.
Nur langsam kamen die Wagen voran. Der Regen trommelte auf die Planen, rann über die Pferde. Dichter Dunst lag in der Bergfalte. Es war windstill geworden. Die feuchten Nebel drangen durch die Kleidung. Die Wagenachsen knarrten, und unter den Rädern zerplatzten kleine Steine und wurden zu Steinmehl zerrieben. Dunkel und verschwommen erhoben sich die Bergflanken. Überall hatte sich Wasser in den Senken gesammelt. Keuchend zerrten die Pferde die Wagen vorwärts.
Scarfaced Bill zeigte voraus und verzog das blasse Gesicht zu einem Lächeln.
„Gleich sehen sie den Indsman. Ich bin gespannt, was sie tun.“
Vince Edwards lenkte den ersten Wagen. Mit verkniffenen Augen starrte er über die nassen Pferde hinweg und voraus. Verkrüppelte Bäume schälten sich aus dem Dunst hervor. Die Bergzüge im Osten fingen das Sonnenlicht auf. Der Morgen war grau und trist. Auf einmal erblickte er den Baum mit der schlaffen schlanken Gestalt am Lasso. Sofort packte er das Gewehr, fuhr weiter und zog die Zügel straff, als er die Baumgruppe erreicht hatte. Von der Prärie wehten Nebelfetzen heran. Sein Gesicht wurde grau und fleckig. Hinter ihm verhielten die beiden anderen Wagen. Auch Connery und Finch hatten den toten Indianer entdeckt.
„Mein Gott!“, flüsterte Edwards und schluckte. Er stieg vom Wagen und stapfte zum Baum. Connery und Finch folgten ihm. Steif und etwas gebeugt verharrten sie vor dem Toten. Scarfaced Bill kam mit den Komplizen herangeritten. Die Mädchen blickten durch die Lücken der Wagenplanen herüber und schwiegen, und die zierliche Chris wandte sich schnell ab und verschwand wieder unter der Plane.
„Er war noch so jung“, flüsterte Finch. „Ich habe nicht viel übrig für die Sioux, aber das hier ist furchtbar. Es ist besser, wenn wir unsere Route ändern.“
„Unsinn.“ Scarfaced Bills Stimme klang rau. Er empfand beim Anblick des toten Indianers keine Reue. „Er war allein. Wir haben ihn wie einen Hasen gehetzt und dann aufgeknüpft.“
„Das habt ihr getan?“ Edwards starrte sie an. „Warum, zum Teufel? Wenn die Sioux diesen Indianer entdecken, dann sind wir erledigt.“
„Sie kommen nicht hierher, verlass dich drauf. Was glotzt du uns an? Wenn die Sioux uns entdecken, dann greifen sie uns an und werden versuchen, uns umzubringen, auch wenn sie nicht diesen Toten gesehen haben.“
„Ja, so ist das!“, knurrte Big Clum. „Wir werden jeden Indianer umlegen, den wir sehen.“
Vince Edwards presste die Lippen zusammen und wandte sich wortlos ab, ging zum Wagen zurück und kletterte hinauf. Schon trieb er die Wagenpferde wieder an.
Die Wagen rollten auf die Ebene hinaus. Hinter ihnen verhielten die vier Reiter noch. Curly Hooker zog das Messer und durchtrennte mit einem einzigen Hieb das Lasso. Der Tote stürzte zu Boden. Sie warfen Gestrüpp auf ihn und folgten dann den Wagen.
„Hört mal gut zu“, murmelte Scarfaced Bill. „Wir übernehmen den Transport der Weiber und bringen sie nach Fort Smith.“
„Und die drei Kerle?“, dehnte Modoc Charley. „Die werden das nicht mitmachen.“
„Du bist ein kluges Kind“, höhnte Scarfaced Bill. Dabei schlug er klatschend gegen den Schaft seines Gewehres.
* * *
Sie kamen auf den scheckigen Ponys und zu Fuß aus den Wäldern und zwischen den Bergen hervor. Sie trugen Gewehre, Pfeil und Bogen, lange Jagdmesser und Lanzen. Im warmen Wind des sonnigen Tages bewegten sich die Krähenfedern im schwarzen langen Haar der Sioux. Viele hatten sich Büffelfelle über die sehnigen, muskulösen Schultern geworfen, und so mancher Jäger trug einen knochigen Büffelschädel mit sich. Die Herbstjagd hatte begonnen.
Sie wanderten über die heimatliche Prärie, zogen in kleinen Gruppen durch die weite Wildnis und folgten den breiten Straßen der ziehenden Büffelherden.
Hoch stand das Gras im Halm und raschelte im Wind, leuchtete in der Sonne und wogte wie ein Meer. Die massigen Fichten an den Bergflanken wiegten sich im Wind, und ein Raunen ging durch die nordischen Wälder.
Versonnen lächelnd verhielt Dan Oakland und blickte vom Sattel aus den davonziehenden Indianern nach. Sein Herz war erfüllt vom Frieden dieser Stille. Er genoss die wärmenden Sonnenstrahlen und legte den Kopf in den Nacken, roch den Duft des Grases und den schweren Geruch des Bodens. Er kannte dieses weite Land, die Ebenen und Prärien, die Berge und Täler. Schon viele Male war er hoch oben auf den bizarren Berggipfeln gewesen und hatte über das Land der Dakota gesehen.
Im Galopp jagte sein Sohn heran. Das schwarze Haar flatterte im Reitwind. Eine frische Röte überzog das braungebrannte sympathische Gesicht. Er lachte und zeigte über die Prärie.
„Komm, Dad! Lass uns die Büffel jagen!“
Dan schmunzelte. „Glaubt mein Sohn, dass ich noch so geschmeidig wäre wie eine Antilope, so kräftig wie ein Bär und so zäh wie ein Bergwolf? Sieh mich an, Sky. Ich bin alt geworden.“
„Hört euch das an!“ Sky machte eine weitausholende Bewegung über all die raunenden Gräser hinweg. „Mein Vater glaubt, dass er alt wäre! Aber ich kenne keinen anderen Mann, der einen so starken Arm hat, Atemzüge, die wie Sturmböen sind, und Augen, die weiter blicken als die eines Adlers!“
„Nun heb mich nicht gleich in den Himmel, Junge. Natürlich werde ich mit euch die Büffel jagen! Los, Sky!“
Sie trieben die Pferde an und jagten im Galopp über die unermesslich weite Ebene. In der Ferne zog eine kleine Büffelherde entlang. Die Sioux glitten weitab von den Büffeln von den Pferden und verteilten sich, glitten geschmeidig über den Boden und lagen dann still. Sie warfen sich die Büffelfelle über die Körper und bewegten sich dann geduckt auf die Herde zu. Ihre Fäuste hielten die Lanzen und Gewehre, und auf ihren Rücken hingen die Köcher mit den Pfeilen, während der Bogen über der Schulter lag.
Auch Dan und Sky saßen ab. Wie gebannt blickten sie zu den großen starken Tieren hinüber, die ganz langsam dahintrotteten, stehenblieben und herüberäugten.
„Sie sind sanft wie Lämmer“, raunte Sky und lächelte beglückt. „Ihre Augen sind ganz braun und weich, wie Kinderaugen.“
„Ja, Sky.“ Dan lag neben ihm und kaute auf einem Grashalm. „Nur wenn sie gereizt werden, können sie mächtig wild und angriffslustig werden. Wenn die Kälber getroffen werden und aufschreien, dann geraten die Büffel in wilde Wut, dann kann niemand sie aufhalten.“
Sie krochen durch das Gras und beobachteten die kleine Herde. Und sie sahen die verhüllten Indianer, die manchmal aus dem hohen Gras auftauchten. Die Sonne schien hell, der Himmel war von einer seidigen Bläue und der Wind wie der Atem der Wildnis. Kein Laut zerstörte den Frieden.
Die Sioux mussten Büffel jagen, wollten sie den Winter überleben. Sie töteten die Büffel nur deshalb, weil sie die Felle, das Fleisch und auch alles andere brauchten. Und sie töteten auch nur so viel, wie sie verantworten konnten.
Der Weiße aber brachte die Büffel gnadenlos um, nicht nur des Fleisches und der Felle wegen. Er wollte töten.
Ein paar der großen Tiere drehten sich schwerfällig um und stampften langsam auf die verhüllten Indianer zu. Sie schreckten nicht vor den Sioux zurück, denn die Büffelfelle täuschten die mächtigen Tiere.
Die Indianer verharrten. Sehnige Hände hielten die Lanzen. Blitzschnell fuhren die Hände nach vorn und schleuderten die Lanzen mit voller Kraft in die Körper der Büffel hinein.
Sekundenlang standen die großen Tiere völlig still, wie erstarrt. Dann brachen sie zusammen, und der Atem verwehte. Kein Tier hatte aufgebrüllt. Die Lanzen hatten die Büffel tödlich getroffen.
Doch irgendein Indianer stieß gleich darauf mit dem Gewehrlauf gegen einen Stein im Gras. Das helle Klirren ließ die Büffelherde losrasen. Donnernd jagte sie davon.
Dan und Sky wuchsen aus dem Gras empor. Fast andächtig blickten sie der Herde nach. Die Büffel verkörperten den Geist der Wildnis, den Hauch der Romantik; sie waren die Könige dieses Landes.
Der eiserne Dan hastete zurück zu den Pferden. Sky lief hinterher, doch er konnte ihn nicht einholen. Dan war noch immer schnell, zäh und ausdauernd. Er keuchte kaum, als er die Pferde erreichte und aufsaß. Sie folgten mit den anderen berittenen Indianern der Herde.
Als sie neben der dahindonnernden Herde waren, zog Dan seine Winchester, lud durch und zielte. Gespannt wartete Sky. Immerhin ritt sein Vater im Galopp.
Scharf peitschte der Schuss auf. Mitten in das Auge getroffen, brach ein Büffel tot zusammen, überschlug sich und blieb liegen. Es war ein Meisterschuss.
Die weißen Büffeljäger schossen mit schweren Sharps-Gewehren, deren Durchschlagskraft verheerend war und oftmals einen Büffelschädel völlig zertrümmerte. Nur ein guter und sicherer Schütze konnte einen Büffel mit der Winchester töten.
Dan zügelte das Pferd. „Das reicht“, sagte er und senkte die Winchester. „Jetzt bist du dran, Sky.“
Sky trieb das Pferd an und jagte los, beugte sich weit nach vorn und hob die Winchester an. Einmal setzte er sie ab, dann schlug er den Kolben hart an die Schulter und feuerte. Mit einem dumpfen Laut stürzte der Büffel und blieb liegen. Freudestrahlend kehrte Sky zurück.
„Was sagst du dazu, Dad?“
Dan Oakland lächelte. „Du bist mein Sohn, Sky.“
Sie sahen, wie die Sioux der Herde folgten, wie Büffel fielen und wie Indianer die Tiere enthäuteten und zerlegten. Späher kamen über die Ebene und sprachen von mehreren kleinen Herden, die sich weiter im Süden sammeln wollten.
„Sie verlassen Dakota noch nicht“, sprach Dan leise zu Sky. „Aber sie wissen bereits, dass es einen harten Winter geben wird. In zwei Monden werden sie unterwegs nach Süden sein, in wärmere Gebiete. Und dann werden sie den Weißen begegnen und abgeschlachtet werden.“
Er war auf einmal ernst und in sich gekehrt. Die großen Hände lagen schwer auf dem Sattelhorn. Der Wind spielte in den Wolfsfellen. Ein Hauch von Melancholie lag auf seinem wettergebräunten Gesicht.
Sky sah ihn fragend an, und Dan spürte den Blick, wollte nicht, dass sein Sohn die Freude an der Jagd verlor, und atmete tief ein. Er lächelte wieder.
„Jage weiter, mein Junge! Wir treffen uns später.“
„Wohin gehst du, Vater? Willst du in das Lager zurückkehren?“
„Nein, Sky. Ich schließe mich der Jagdgruppe von Old Dead Eyes an.“
„Ich verstehe, Dad. Wir sehen uns bald wieder.“
Sein Sohn ritt mit den anderen Sioux davon. Langsam zog Dan das Pferd herum und lenkte es zu einer Gruppe Männer, die auf einer flachen Bodenwelle die Pferde gezügelt hatten.
Im Kreis seiner treuen Freunde verhielt Old Dead Eyes. Sein ergrautes Haar glänzte in der Sonne wie Silber. Die Haare waren so dünn geworden wie Fäden eines Spinngewebes. Tiefe Falten durchzogen das Gesicht. Der Blick der milchig hellen, glanzlosen Augen war in die Ferne gerichtet, dorthin, wo die Büffel mit schweren Hufen über die Prärie donnerten.
Dan zügelte sein Pferd und verharrte neben dem greisen Häuptling. Er sagte kein Wort und beobachtete, wie die anderen die Büffel und die jagenden Indianer.
Da brach Old Dead Eyes das Schweigen. Seine Stimme klang ruhig und hohl, getragen von großer Würde und Weisheit, aber auch von Erfahrung und durchlebter Not. „Mein Bruder Catch-the-Bear wird mir seine Augen leihen. Er wird für mich den Büffel sehend machen. Möge er mich begleiten auf meiner letzten Jagd in diesem späten Sommer. Mein Gesicht spürt den Wind der Prärie, meine Ohren hören das Donnern der Büffel, meine Hände sind ruhig für die Jagd. Bald wird es für mich keine Jagd mehr geben auf dieser Prärie. Old Dead Eyes wird in den ewigen Jagdgründen umherziehen und seine alten Brüder wiedersehen. Seine Augen werden das ewige Licht erblicken und die Stimme des Großen Geistes vernehmen.“
Dan sah den schon vor Jahrzehnten erblindeten Sioux ernst an. Er bemitleidete ihn nicht, denn das würde der Häuptling niemals dulden.
„Du siehst mehr als wir, Häuptling“, antwortete er ehrlich. „Unsere Augen sehen nichts, wenn es Nacht ist. Du aber siehst auch in der Nacht. Ich werde dich begleiten, Häuptling.“
Der greise Mann beugte sich zur Seite und griff tastend nach Dans Arm, drückte ihn flüchtig und ritt dann von der Bodenwelle. Die Sioux zogen an diesem hellen Sonnentag in mehreren Gruppen über die Prärie. Sie würden viele Tage und Nächte auf der Jagd sein. In dem Lager waren die Squaws, Mädchen, Jünglinge, Kinder und Greise zurückgeblieben. Auch die anderen Stämme der Sioux jagten nun auf den weiten Ebenen.
Dan dachte an diesem Tag an nichts Böses. Er hatte vergessen, dass es Soldaten gab, weiße Büffeljäger und hasserfüllte Indianermörder. Er wollte diese goldene Herbstzeit erleben, die leuchtenden Farben der Laubwälder sehen und gemeinsam mit den Freunden an den Feuern sitzen. Es war Indianersommer.
* * *
„Sehr interessant“ Zynismus klang in der Stimme, und Genugtuung. Gehässiges Lächeln grub sich um den schmalen kalten Mund ein. Wasserhelle Augen starrten durch das Fernglas und beobachteten die kleine Rotte Indianer, die am Fuße des Berges lagerte. Die Abendröte glühte über der Wildnis.
Langsam setzte der Captain das Glas ab und blickte zum Lager hinunter.
Hinter ihm waren die Soldaten abgesessen und warteten auf seinen Befehl. Neben ihm stand ein Sergeant und ein Lieutenant.
„Sioux“, sagte er. „Oglala. Sieben. Sie sind gerade am Fressen. Das Büffelfleisch soll ihnen im Hals steckenbleiben.“
„Wollen Sie angreifen, Sir?“, fragte der Lieutenant.
„Natürlich, mein Lieber, oder glauben Sie, dass ich mir diese Gelegenheit entgehen lasse? Die Sioux sind im Moment verdammt ruhig. Es muss wieder etwas munterer werden, sonst wird unser Dienst langweilig. Ich habe keine Lust, noch monatelang in Fort C. F. Smith herumzuhocken.“
„Sir, der Colonel legt größten Wert darauf, dass der Friede bewahrt wird, jedenfalls jetzt noch.“
„Das ist mir bekannt, Lieutenant, trotzdem werden wir die Halunken fertigmachen. Sie und der Sergeant werden mit mir zum Colonel gehen. Ich werde ihm melden, dass wir angegriffen wurden. Haben Sie mich verstanden?“
Beide nickten zögernd. „Dann sind wir uns also einig, meine Herren.“ Der Captain zerrte den Säbel hervor und legte den Daumen auf die scharfe Klinge. „Ich will keinen Schuss hören. Wir machen sie lautlos fertig. Die Männer kommen sonst noch aus der Übung. Lassen Sie aufsitzen, Lieutenant!“
„Ja, Sir!“
Geräuschlos stiegen die Soldaten auf die Pferde. Auf den Befehl hin zogen sie ihre Säbel. Langsam ritten sie den Hang hinunter und folgten dem Captain.
Wieder einmal zerstörte Hass jede Vernunft und Menschlichkeit.
Nahezu lautlos bewegten sich die Kavalleristen abwärts. Fanatismus glühte in den hellen Augen des Captains. Sein Wille zwang die Soldaten vorwärts. So mancher unter ihnen war innerlich nicht bereit, doch er konnte sich diesem Befehl nicht entziehen, er musste mitreiten und mit den anderen angreifen.
Noch unter den Bäumen schwärmten sie aus. Der Captain hob die Rechte mit dem Säbel, und alle verhielten.