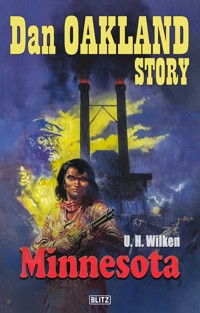Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Dan-Oakland-Story
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Der Skalphügel Für jeden Indianerskalp gibt es eine Prämie. Trowman Culver und seine beiden Kumpane wollen das schnelle Geld. Sie töten wahllos Männer, Frauen und kleine Kinder. Der letzte Blackfoot Die Nachricht von Goldfunden in den Black Hills hat sich in Windeseile verbreitet. Tausende Abenteurer und Glücksritter strömen aus dem Osten in die heiligen Berge der Sioux. Indianer werden gnadenlos getötet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 284
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
IN DIESER REIHE BISHER ERSCHIENEN
DER SKALPHUEGEL
DAN OAKLAND STORY
BUCH 32
U. H. WILKEN
Dieses Buch gehört zu unseren exklusiven Sammler-Editionen
und ist nur unter www.BLITZ-Verlag.de versandkostenfrei erhältlich.
In unserem Shop ist dieser Roman auch als E-Book lieferbar.
Bei einer automatischen Belieferung gewähren wir Serien-Subskriptionsrabatt. Alle E-Books und Hörbücher sind zudem über alle bekannten Portale zu beziehen.
Copyright © 2024 Blitz-Verlag, eine Marke der Silberscore Beteiligungs GmbH, Mühlsteig 10, A-6633 Biberwier
Titelbild: Rudolf Sieber-Lonati
Umschlaggestaltung: Mario Heyer
Logo: Mario Heyer
Satz: Gero Reimer
Alle Rechte vorbehalten
www.Blitz-Verlag.de
ISBN: 978-3-7579-2866-7
4332 vom 11.09.2024
INHALT
Der Skalphügel
Der letzte Blackfoot
Anmerkung
Über den Autor
Der Skalphügel
Schwankend bewegte der alte Mann sich über den felsübersäten Berghang. Das lange eisgraue Haar flatterte wie die Fransen einer alten, zerschlissenen Decke. Der Ausdruck weltlicher Entrücktheit machte das eingefallene knochige Gesicht zur leeren Maske. Starr war der Blick auf die Bergkuppe gerichtet. Mit letzter Kraft schleppte sich der Greis bergan. Träge schwang die alte Büffeldecke hin und her. Weite Schatten fielen vom Berg, doch dort oben war das Licht der Sonne.
Dünne, knochige Füße trugen den ausgemergelten Körper, wurden zwischen dem harten Gestein blutig. Stöhnen kam über die Lippen des Indianers. Kraftlos erreichte er die Bergkuppe und blieb stehen. Die trüben Augen konnten nicht mehr in die Ferne sehen. Rot glühte der Abendhimmel über den Wäldern. Schwarz hob der Greis sich vor dem Himmel ab.
Aus dem Unterholz des farbigen Laubwaldes schob sich der Lauf eines Gewehres. Zu Füßen des Greises lagen die sonnengebleichten Knochen vorangegangener Indianer. Längst waren die ledernen Decken vermodert, die Krähenfedern zerbrochen und die Mokassins verfault.
Krachend entlud sich das Gewehr. Die Kugel traf den Greis. Seine Hände griffen haltsuchend in die Luft. Wieder traf ihn eine Kugel. Blut quoll aus dem Körper. Ganz langsam sank er in die Knie.
Hart klirrten die beschlagenen Hufe eines Sattelpferdes. Zweige brachen, und ein Weißer kam hervorgeritten, trieb sein Pferd den Berghang empor. Schon unterwegs zog er sein Messer.
Keuchend trug das Pferd ihn auf die Bergkuppe. Er rutschte aus dem Sattel und starrte auf die Gebeine der Toten. Der Schein der untergehenden Sonne fiel rot wie Blut auf den Berg. Mit dem Messer in der rechten Hand näherte der Weiße sich dem Greis, kniete nieder und wollte ihn skalpieren, doch jäh schreckte er zurück, verfärbte sich, hastete zu seinem Pferd und ritt abwärts.
Trowman Culver jagte in wilder Flucht davon. Es wurde still.
In blauen Bändern zog die Dämmerung durch die Täler der Wildnis. Da ertönte Hufgetrappel. Zwei Reiter. Horchend beugte der bullige Mann sich nach vorn.
Das wettergebräunte Gesicht war zerfurcht. In den grauen Augen schimmerte es wie Eis. Die große rechte Hand hielt eine Winchester. Eine schwere, lange Jacke aus Wolfsfellen umhüllte die breiten Schultern. Dan Oakland.
Cath-the-Bear spähte zur Kuppe des Berges empor und sah, wie die Krähen über den Berg hinwegflatterten. „Komm, mein Junge!“
Er ritt an, und der junge schlanke Mann mit den langen schwarzen Haaren folgte ihm. Sein Sohn Sky. Sie verhielten auf dem Berg und sahen den Toten inmitten der Gebeine.
„Ein Minneconjou, Vater?“, flüsterte Sky, während sich seine weichen braunen Augen verdunkelten.
Der eiserne Dan stieg vom Pferd. Mit den scheinbar plumpen Bewegungen eines Bären schritt er über die Bergkuppe und verharrte vor dem toten Greis. Er sah den von der Kugel zerschmetterten Schädel mit dem schneegrauen Haar, das voller Blut war, und er entdeckte im kaum noch erkennbaren Gesicht des Indianers wulstige Flecken.
„Nein, Sky“, sagte er mit schleppender Stimme und wandte sich seinem erwachsenen jungen Sohn zu. „Das ist kein Minneconjou. Er gehört zum Stamm der Piegan Blackfoot.“
Sky bewegte sich nicht im Sattel. „Was hat ein Piegan hier gewollt, Dad? Befindet sich der Stamm nicht am Marias River?“
„Doch, aber dieser alte Indianer wollte auf diesem Berg sterben. Er wollte zwischen den Gebeinen auf sein Ende warten. Es ist ein Berg des Sterbens. Vor diesem Greis sind schon viele andere auf diesen Berg gekommen, aber dieser Greis wurde erschossen! Siehst du die Spuren, Sky? Eindrücke von Hufeisen. Es war ein weißer Mann, der den Greis ermordet hat!“
„Aber warum, Dad? Er wollte doch sterben! Der Weiße brauchte ihn nicht zu töten!“
Düster blickte Dan über die Täler und Wälder, auf denen bleich das kalte Sternenlicht lag. „Er war hinter dem Skalp her“, sagte er leise und dumpf. „Er wollte ihn skalpieren, hatte sich schon niedergekniet, aber dann ergriff er die Flucht.“
„Vielleicht hat er uns gehört?“
„Nein.“ Oakland kam gebeugt zurück und zog sich in den Sattel. „Sieh dir das Gesicht an, mein Junge. Eine tückische Krankheit hat den Greis befallen.“
Sky blickte hinüber und verfärbte sich. „Pocken.“
„Ja.“ Langsam zog Dan sein Pferd herum. „Komm, hier ist kein Platz für uns. Reiten wir zum Marias River.“
* * *
Lautlose Schatten huschten durch die Dämmerung. Langes schwarzes Haar wehte über die Schultern hinweg. Weiche Mokassins glitten über den Boden. In den dunklen Augen der Indianer spiegelte sich das ferne Feuer.
Die Planen der Wagen wurden von den Lagerfeuern rot angestrahlt. Unruhig zuckte der Flammenschein über die Wagen hinweg. Blechgeschirr klapperte. Soldaten in blauen verwaschenen Uniformen saßen an den Feuern, tranken heißen Kaffee, aßen Bohnenbrei und sprachen miteinander.
Stimmen tönten leise und verworren zu den Indianern herüber. Sie duckten sich, standen still und beobachteten. Wachposten schritten um die Wagen, hatten die Gewehre geschultert und machten ihre stets gleichen Runden.
Langsam schlichen die Indianer näher. Sträucher, Bäume und Felsen verbargen sie. Kein Zweig brach, kein Fuß stieß gegen Steine. Der Nachtwind kam den Indianern entgegen. Die abseits von den Wagen in einem Seilkorral zusammengetriebenen Maultiere konnten die Blackfoot nicht wittern.
Ein Offizier richtete sich an einem der Feuer auf. „Essen beenden“, rief er. „Nachtruhe!“
Die Soldaten murrten, standen auf, warfen die Blechgeschirre in die Schüssel mit Wasser und holten ihre Decken von den Wagen, breiteten sie am Boden aus und legten sich nieder. Nachtruhe. Befohlener Schlaf.
Allmählich sanken die Flammen der Feuer zusammen. Immer wieder kamen die Wachposten vorbei, legten etwas Holz nach, damit die Glut nicht erlosch, und schritten weiter.
Weit abseits rief ein Kauz. Der Wind spielte mit den niederen Flammen und bewegte die trockenen Blätter der Bäume. Die Maultiere standen nahezu reglos im Korral.
Zwei Posten trafen sich. „Beschissene Nachtwache. Hast du Tabak?“
„Du darfst doch jetzt nicht rauchen, Mann! Oder willst du ins Loch?“
„Mach nicht gleich in den Frack, Angsthase! Los, gib schon her. Ich reib’ mir den Tabak in die Augen. Das brennt höllisch, aber hält wach. Ich bin hundemüde.“ Sie schwiegen, trennten sich und stapften missmutig umher.
Auf allen vieren krochen die Indianer näher, erreichten den Rand des Lagerplatzes und duckten sich. Die Glut der Feuer strahlte herüber und berührte mit schwachem rotem Schein die Gesichter, und in diesen Gesichtern waren wulstige Flecken.
Plötzlich wurden die Maultiere unruhig. Ein scharfes Messer durchtrennte das Seil. Mehrere Indianer glitten in den Korral. Auf einmal trotteten mehrere Maultiere davon, von Indianern weggezogen.
„He“, schrie ein Posten. „Was ist mit den Maultieren los?“
Gewehre wurden durchgeladen. Schüsse peitschten über die hochfahrenden Soldaten hinweg. Zwischen den Bäumen klappte ein Indianer zusammen. Die Maultiere brachen aus dem Seilkorral hervor und rannten störrisch umher, behinderten die Soldaten und röhrten dumpf.
Die Soldaten liefen nach allen Seiten in die dunkle Nacht hinein. Wieder fielen Schüsse. Fluchend wurden die Maultiere zusammengetrieben. Mehrere Tiere fehlten. Zwei Soldaten schleiften den toten Indianer in den Schein eines nun lodernden Feuers.
„Diese verdammten Sauhunde!“ Der Offizier stand breitbeinig vor dem toten Blackfoot. „Sie haben uns ein paar Maultiere gestohlen, diese Dreckskerle!“ Wütend starrte er umher. „Wer hatte Wache? Herkommen!“
Leblos lag der Blackfoot am Boden. Sein Gesicht war glatt, ohne Pocken.
„Ich sollte euch alle einsperren lassen!“, schrie der Offizier die Wachposten an. „Ihr habt es zugelassen, dass die Indsmen uns ein paar Maultiere raubten! Aber eins sage ich euch schon jetzt, ihr werdet nicht glimpflich davonkommen! Major Baker wird das entscheiden, nicht ich! Wegtreten!“
Die Indianer waren mit den Maultieren verschwunden. Sie hätten die Posten töten und so manchen Soldaten im Schlaf niedermachen können, doch sie hatten nur diese wenigen Tiere gewollt, nicht das Leben der Blauröcke. Diese Erkenntnis aber kam keinem der Männer in Uniform. Der Transport zog weiter, und aus einem Maultierdiebstahl wurde ein blutiger Überfall gemacht.
* * *
Der Schrei eines Vogels tönte durch die Wildnis, durchdringend und warnend. Über den Bäumen flatterte es hart, dann herrschte wieder Stille.
Im Morgendunst ritten Dan und sein Sohn Sky durch die Bergfalte. Vor ihnen tauchte jäh ein Wigwam auf. Die indianische Behausung stand völlig allein zwischen den Bergzügen. Der Rauch eines Feuers im Wigwam stieg aus der oberen Öffnung zwischen den spitzen Zeltstangen hervor und löste sich im Dunst auf.
Vor dem Wigwam ragte eine Lanze hervor, und zwei alte Skalps hingen daran. Schlaff hingen die Felle vor dem Eingang. Leises Summen ertönte, und die zitternde Stimme eines weinenden Kindes war zu hören.
Weder Dan noch sein Sohn zog die Winchester hervor. Sie zügelten die Pferde und warteten. Stilles, versonnenes Lächeln verklärte das Gesicht des Trappers und Mountain Man Dan Oakland, und in diesem Augenblick war ihm seine große Gutmütigkeit wieder anzusehen. Sein Leben lang war er in den Wäldern umhergestreift, hatte das Wild an den großen Seen und klaren Flüssen gejagt und war immer ein Freund der indianischen Völker gewesen und geblieben. Die Sioux hatten ihm den Namen Catch-the-Bear gegeben, damals, vor langer Zeit, als sein Sohn den schützenden Leib einer jungen schönen Sioux-Indianerin verlassen hatte.
An diesem Morgen begegnete Dan neuem Leben. Er sah, wie ein Piegan Blackfoot das Zelt verließ, wie er sich aufrichtete und die Schultern straffte. Sein Alter war nicht zu ermessen. Falten durchzogen das braune Gesicht. Er blickte Dan Oakland und Sky forschend an, und als Dan die Sioux-Zeichen der Freundschaft machte, grüßte er zurück. „Seid willkommen.“
„Es ist ein guter Tag“, erwiderte Dan, „denn es ist ein Tag der Freundschaft.“
„Standing Bull hat schon viel gehört über Catch-the-Bear. Sein Herz hat wilde Sprünge gemacht wie ein junges Pony vor Freude, denn es gibt nur wenige Weiße, die die Wahrheit auf den Lippen und im Herzen tragen.“
Sie stiegen von den Pferden, folgten Standing Bull und betraten das Zelt, und jetzt erblickten sie die junge Squaw dieses Häuptlings. Sie saß auf weichen Büffelfellen und nährte das neugeborene Kind mit ihrer Muttermilch. Weiches Lächeln lag auf ihrem Gesicht. Die schwere Geburt war ihr noch deutlich anzumerken.
„Mein Sohn“, sagte Standing Bull nicht ohne Stolz, kniete nieder und nahm das Baby von der Brust der Mutter. „Er wird hören wie ein Reh, wittern wie ein Wolf und kräftig sein wie ein Grizzly, und er wird schnell sein wie ein Pfeil, klug wie ein Elch und tapfer wie alle Sioux.“
„Du hast einen kräftigen Sohn, Häuptling. Es soll so sein, wie du sagst.“
Lächelnd reichte der Häuptling das Baby seiner Mutter und lud Dan und Sky zum Sitzen ein. Während draußen der Tag heraufzog und die Sonne des Spätherbstes das Land verzauberte, sprach Standing Bull über das Leid und Elend, das über den Stamm der Piegan Blackfoot gekommen war.
„Die Krieger jagen das letzte Wild. Sie müssen weit umherstreifen und werden viele Monde fort sein, und die Squaws, Kinder und Greise werden lange auf Essen warten müssen. Sie sind geschwächt, und ein böser Geist hat sie gezeichnet. Ihre Gesichter verändern sich, und wir wissen nicht, warum. Der Große Geist hat uns verlassen. Die Kinder sterben wie Vögel in eisiger Kälte, die tot von den Bäumen fallen, und es gibt keine fröhlichen Lieder mehr. Sag mir, Catch-the-Bear, was mit meinem Volk geschieht. Du wirst die Wahrheit sagen. Wie können wir diesen bösen Geist besiegen, der uns heimgesucht hat?“
Dan senkte den Blick und sah in das Feuer. „Die Weißen nennen es die Pockenkrankheit. Sie ist schlimm, furchtbar, sie zerstört den Körper und die Seele, sie frisst und wütet, und sie tötet. Sie ist schlimmer als die Krankheit Malaria, die nach den Verwundungen kommt, und viel schlimmer als Skorbut, der die Augen rötet. Die gesunden Krieger, Squaws und Kinder müssen sich auf den Weg machen, sie dürfen nicht mit den Kranken zusammenleben, und wer diese Zeichen im Gesicht bekommt, der muss die Gesunden verlassen. Sonst werden sie alle sterben.“
Standing Bull atmete schwer und blickte auf seinen Sohn. „Ich hatte einen Traum. Ich sah, wie meine Brüder und Schwestern ganz schwarz wurden, wie nur noch die Haut ihre Knochen umgab, und ich hörte eine Stimme, die mir sagte, dass ich fortziehen sollte mit meiner Squaw, damit das Kind gesund bleibt. Ich habe es getan.“
„Du hast richtig gehandelt, Häuptling. Es gibt nur diesen Weg.“
„Aber meine Krieger haben es nicht verstanden. Sie glauben, dass ich sie verlassen hätte mit meinem Herzen und meiner Stimme. Doch so ist es nicht! Ich weiß nicht, wer nun ihr Häuptling ist. Aber ich werde zurückkehren und zu meinem Volk sprechen. Und ich werde den Großen Geist anrufen, damit er endlich sieht und hört!“
Dan schwieg, und neben ihm hockte Sky und atmete hörbar. Sie sahen, wie Standing Bull seinen kleinen Sohn streichelte, wie er ihn liebte und stolz auf ihn war, und sie konnten das Schweigen nicht brechen, denn sie wollten nicht stören.
Als sie aufbrachen, begleitete Standing Bull sie ein Stück des Weges. „Kommt zurück und sagt mir, was ihr gesehen habt, am Marias River. Und bleibt in unserem Land. Es gehört auch euch.“
* * *
Die letzten Beeren leuchteten an fast blattlosen Sträuchern. Junge Menschen pflückten sie, bargen sie in kleinen ledernen Beuteln und bewegten sich dabei langsam den Hang des Berges empor.
Sie hielten ihre Gewehre schussbereit und beobachteten die Blackfoot-Jünglinge. „Keine Weiber hier“, knurrte Don Flint und stierte mit flackernden Augen abwärts. „Möchte wissen, wo die Indianerweiber sind!“
Er legte das Gewehr ab und rieb sich die hässliche Narbe, die schräg über das ganze Gesicht lief, als hätte ihn einst ein Hieb mit einem Säbel getroffen.
Neben ihm lag der blonde Quinn Ferguson und beobachtete mit hellen Augen die jungen Indianer. „Für Weiberskalpe kriegst du später nicht so viel, Flint. Sieh dir diese Burschen an! Sie haben prächtige lange Haare!“
„Noch gibt es keine Skalpprämie“, entgegnete Flint. „Ich weiß noch nicht einmal, ob wir die Zeit nicht vergeuden, und darum habe ich an die Indianerweiber gedacht. Die können es nämlich verdammt gut.“
Trowman Culver verzog grinsend das brutale Gesicht. „Du bist ein Schwein, Flint“, sagte er, doch es klang nicht gehässig, eher anerkennend. „Du denkst immer an so was.“
„Ist das ein Wunder? Wir treiben uns schon wochenlang in diesem Gebiet herum! Ich kriegw langsam einen Koller.“
„Warte es nur ab, Flint.“ Trowman Culver war sich der Sache sicher. „Es dauert nicht mehr lange, und dann werden Prämien auf die Skalps der Rothäute ausgesetzt. Bis dahin haben wir schon eine Menge Skalps zusammen.“
„Ja, und dann können wir uns noch ein paar Burschen kaufen, die für uns nach Skalps jagen!“, sagte Ferguson grinsend. „Das wird ein Riesengeschäft!“
Sie schwiegen und warteten. Unter ihnen glitten die jungen Blackfoot umher und sammelten die Beeren. Die Indianer trugen kaum eine Waffe. Nur zwei von ihnen hatten Pfeile und einen Bogen. Diese jungen Menschen dachten nicht an Kampf und Krieg, nicht an Weiße, sie dachten an die hungernden Frauen, Mädchen und Kinder im Lager.
Plötzlich hielt einer der Jungen inne und blickte über den Hang abwärts. Aufgeregt deutete er auf einen Elch, der aus dem Unterholz hervorgetreten war.
Die beiden bewaffneten Blackfoot duckten sich sofort, während die anderen völlig stillstanden, als wären sie erstarrt. Dann schnellten auch schon die Pfeile von den Bogensehnen und trafen den Elch, bohrten sich in Brust und Hals. Das mächtige Tier zuckte zusammen, bewegte sich, lief ein paar Meter, zuckte und zitterte, röhrte und atmete schwer, dann brach es zusammen.
Wie Kinder lachten die Jünglinge auf, freuten sich, riefen durcheinander und wollten zum erlegten Elch laufen, denn sie brauchten keine Beeren mehr zu suchen.
Hinter ihnen richteten sich drei Weiße auf. Gewehre ragten in die Tiefe. Augen glitzerten kalt und gemein. Auf dem Metall der Gewehre brach sich der Sonnenschein. Braungebrannte Oberkörper bewegten sich um die Sträucher. Gewehrläufe folgten den Bewegungen.
„Los!“, fauchte Trowman Culver.
Sie schossen, als wären die jungen Indianer Hasen. Sie jagten das Blei in die Rücken dieser Jungen hinein, dass das Blut spritzte und die Sträucher befleckte. Sie feuerten die Kugeln in Köpfe und Rücken. Sie töteten erbarmungslos, sie schlachteten die Indianer ab! Aufgerissene Körper fielen in das Geäst. Hände zuckten zum Himmel und wurden durchschossen.
„Nicht in die Haare schießen!“, brüllte Trowman Culver besorgt.
Schüsse löschten das junge Leben aus. Dunkle Augen weiteten sich und brachen. Lippen zitterten, und Schreie erstarben. Und ein einziger junger Blackfoot irrte durch den Kugelhagel, warf sich unter die Sträucher, hetzte umher, entging immer wieder den Schüssen, schrie gellend in Todesangst, kroch um die Felsen am Hang.
„Tötet das Schwein!“, schrie Culver. „Lasst ihn nicht entwischen!“
Sie rannten abwärts, durchbrachen das Gestrüpp. Ein niedergeschossener Blackfoot rührte sich noch schwach. Ferguson drückte ab. Tot lag der Junge am Hang. Stiefel wühlten die Erde auf. Gewehre stießen durch die Sträucher. Zweige schlugen gegen die Beine der Männer. Blutflecken waren am Boden. Lederbeutel mit Beeren lagen daneben.
Wieder peitschten Schüsse durch die Bergfalte. Eine Kugel traf den jungen Indianer, riss die Schulter auf. Er schrie erstickt auf, und der Knall der Schüsse übertönte seine Stimme. Wie ein todwundes Tier kroch er in der Deckung der Sträucher weiter.
Zweige brachen. Wie Berserker kamen die drei Weißen näher. Bebend kauerte der Indianer zwischen den Felsen. Die Weißen wollten ihn töten, und er konnte nicht die Nervenkraft aufbringen, in seinem Versteck auszuharren. Zu groß war die Todesangst. Er quälte sich weiter, und das Blut rann am Arm abwärts und hinterließ eine Spur.
Flint entdeckte sie, schrie und winkte, und die Komplizen rannten zu ihm, starrten auf die Blutspur und grinsten.
„Den haben wir gleich!“, flüsterte Trowman Culver.
Der junge Blackfoot sah, wie sie ihm folgten. Nur sekundenlang tauchte er zwischen den Sträuchern auf, die schon viel zu licht geworden waren, um ihn zu verbergen und Schutz zu geben. Verzweifelt krallte er die Hand in den Boden und riss Erde hervor, schlug sie auf die offene Wunde, deckte sie mit Erde zu.
Dann hastete er weiter und abwärts, und dort zwischen den aus dem Boden gerissenen Wurzeln der Fichten verkroch er sich. Eine heftige Sturmbö hatte die Fichten umgerissen, und jetzt waren diese Wurzeln sein einziger Zufluchtsplatz, seine einzige Rettung vielleicht vor dem Tod.
Die drei Weißen stöberten umher. Sie hatten seine Blutspur verloren, sie fluchten und horchten immer wieder, doch kein Knacken und keine hastenden Schritte verrieten ihnen den Fluchtweg des jungen Indianers.
„Wir haben ihn erwischt, und er wird verrecken!“, schnaufte Culver. „Wir müssen von hier verschwinden!“
Zitternd kauerte der Blackfoot zwischen den Baumwurzeln und hörte die Schritte der Weißen. Ein furchtbarer Schmerz am Oberarm lähmte ihn. Dennoch konnte er sich halb aufrichten und stierte mit geweiteten Augen zum Hang hinüber. Dort hatten sich die Weißen verteilt. Ganz deutlich sah er, wie sie seine toten Freunde hochrissen, wie sie die Messer ansetzten.
Seine Zähne schlugen aufeinander. Das Grauen entstellte sein Gesicht. Er stöhnte so leise wie der Wind. Seine Freunde wurden skalpiert und liegengelassen. Die drei Weißen bewegten sich den Berghang empor und verschwanden. Er harrte aus vor Angst.
Sie kamen wieder, diesmal zu Pferde, ritten abwärts und erreichten den Elch, saßen ab und schlugen das Tier mit ihren Messern auseinander, rissen Fleischbrocken hervor und bargen sie in Lederdecken, die sie zuschlugen und hinter den Sätteln befestigten. Worte tönten herüber. Er konnte sie nicht verstehen. Sie stiegen auf die Pferde und trieben sie an. Der Hufschlag erstarb jenseits des Bergzuges.
Niemals würde der Junge diese Gesichter vergessen. Er kroch hervor und schwankte durch die Bergfalte. Seine Bewegungen wurden immer langsamer. Plötzlich stolperte er und stürzte. Blut floss. Zitternd quälte er sich unter die Fichten auf der anderen Seite der Bergfalte. Hier brach er zusammen.
* * *
Überall flatterten die Aaskrähen über den Strauchgruppen am Berghang. Kalte Winde fassten unter die Schwingen der Vögel, trieben sie aufwärts, ließen die Fichten schwanken.
Mit steinernem Gesicht blickte Dan umher. „Nein“, flüsterte er nur. „Nein ...“
Es war ein fast lautloser Aufschrei gegen diesen Mord, gegen dieses Abschlachten junger Indianer. Wie von einer fremden Hand geleitet, ging er mit schweren, erdhaften Schritten umher und blickte auf die skalpierten Blackfoot.
Sky löste die Hand von den Zügeln der Pferde und wandte sich mit aschgrauem Gesicht ab. Einst war er in die Schule der Weißen gegangen. Er konnte lesen und schreiben. Er hatte die Welt der Weißen kennengelernt, doch er konnte diese Weißen schon lange nicht mehr verstehen. Er wollte es auch nicht mehr. Sein Zuhause war die Wildnis.
Weil er auch das Blut eines Weißen in den Adern hatte, hatten die Weißen ihn gewaltsam als Soldat in ihren verdammten Bürgerkrieg getrieben. Die Zeit unter den Weißen hatte ihn nicht ändern können. Es war nicht Hass, was er den Weißen gegenüber empfand, es waren Ekel, tiefste Verachtung und Abscheu.
Dan Oakland hörte seinen Sohn plötzlich leise rufen. Er drehte sich um und sah, wie Sky neben einer reglosen schlanken Gestalt niederkniete. Da rannte Dan los und erreichte Sky und den Blackfoot.
Und ihr fieberhaftes Ringen um das Leben des jungen Indianers begann. Sie stoppten das Blut, reinigten die klaffende Armwunde, entfernten die blutdurchtränkte Erde, streuten trockenes Pulver auf die Wunde, brannten es ab und töteten dadurch alle bösartigen Keime in der Wunde. Der Junge zuckte und stöhnte, und während Sky ihn festhielt, legte Dan den Verband an. Sie flößten dem Jungen Wasser ein, brachten ihn zu sich und hoben ihn auf Skys Pferd.
„Bring ihn zu Standing Bull, mein Junge“, flüsterte Dan mit belegter Stimme.
Sky nickte, schwang sich hinter dem Jüngling auf das Pferd, hielt ihn mit dem linken Arm fest und ritt den Weg, den sie gekommen waren, zurück.
Die Nacht legte ihren dunklen Mantel um die beiden Menschen, und Dan war allein. Der Wind war sein ständiger Begleiter. Der Mond, der über den bewaldeten Bergen emporstieg, war Zeuge, als er die leblosen Indianer zusammentrug und am Bau eines hohen Gerüstes begann.
Zuvor hatte er nach Spuren gesucht, doch die Mörder hatten schon jenseits des Bergzuges die Spuren verwischt. Sie wollten lebend entkommen, um später erneut mit der Jagd auf Indianerskalps beginnen zu können.
Erst nach Stunden hatte Dan das Gerüst fertig. Es ragte mitten in der Bergfalte empor. Behutsam legte er die Toten darauf. Er gab ihnen kein Grab, wie es unter den Weißen üblich war. Er bahrte sie auf, so wie es die Sioux taten. Und er deckte sie mit Fellen und Zweigen der Fichten zu. Kein Wolf konnte die Toten erreichen. Hier würden sie von nun an bis in alle Ewigkeit ruhen.
Als alles getan war, was Dan hatte tun können, stieg er auf sein Pferd und lenkte es bergan. Dort oben verhielt er und sah über die Wildnis. Dann ritt er weiter, voller Zorn und Ekel. Er war einsam und sprach seine Gedanken aus. Bittere Worte eines erfahrenen Mannes, der die Indianer und die Weißen kannte und es vorzog, unter den Indianern zu leben, für sie zu kämpfen und notfalls auch sein Leben für sie zu lassen.
Eines fernen Tages würde sich vielleicht kein Mensch mehr an die Namen der Stämme erinnern, an die Minneconjou, Santee, Hunkpapa, Brule, Blackfoot und Oglala, an die Teton, Arapaho, Cheyenne.
Was er tun konnte, wollte er tun.
* * *
Fort Ellis, Montana. Kalte Bodennebel türmten sich vor den Palisaden auf und umhüllten wie weißgewordener Atem die patrouillierenden Wachsoldaten. Wild zerrte an der Flagge am hohen Mast.
Soldaten schritten über den Platz. Jemand spielte in der Unterkunft der Mannschaften auf einer Mundharmonika. Gelber Lichtschein fiel aus dem Fenster der Kommandantenbaracke. Gardinen fehlten. Soldaten, die vorbeikamen, sahen Major Eugene M. Baker am Tisch sitzen. Baker hatte eine Landkarte vor sich ausgebreitet liegen und betrachtete sie. Er blickte nicht zu dem Offizier auf, der neben der Tür abwartend verharrte.
„So, Diebstahl von armeeeigenen Maultieren? Interessant. Sagen Sie mal, Captain, wann bricht gewöhnlich der Winter in Montana ein?“
„In diesem Jahr wahrscheinlich etwas später, Sir. Das heißt, in drei Wochen.“
Der Major lehnte sich an die Rückenlehne des Stuhls und sah in die blakende Lampe. Sein Gesicht war erschlafft, als wäre er müde, doch er dachte nach.
„Winter in Montana. Ein grimmiger Winter, und Zeit für den Winterfeldzug gegen die Indianer, Captain. Um diese Zeit hocken sie in ihren Wigwams, weil es draußen zu kalt geworden ist. Sie sind also alle zusammen und denken nicht an Jagd und Krieg.“
„Ja, Sir.“
„Ist der Agent der Blackfoot in Fort Ellis, Captain?“
„Nein, Sir. Lieutenant Pease ist unterwegs. Er hat von Pockenerkrankungen der Blackfoot gehört.“
„Pocken? Das fehlt uns noch! Ich will nicht, dass meine Soldaten an Pocken erkranken, nur weil diese dreckigen Indianer die Pocken haben!“
„Es ist Vorsorge getroffen worden, Sir. Fort Ellis bleibt gesund.“
„Gut, Captain, sehr gut. Aber diese tückische Krankheit kann sich schnell ausbreiten. Man müsste die Krankheit an der Wurzel zerstören und besiegen. Kein leichtes Brot, nicht wahr?“
„Sie sagen es, Sir.“
„Hm.“ Major Baker richtete sich auf und schritt mit auf dem Rücken verschränkten Armen umher. „Ich habe was läuten hören, Captain, über diesen ersten Indianerkommissar, nur weiß ich nicht, wo die Glocke hängt. Wissen Sie Näheres?“
„Sir, Sie meinen Lieutenant Colonel Parker? Ely Samuel Parker, diesen ehemaligen Häuptling der Seneca-Indianer, den der Präsident zum Kommissar für indianische Angelegenheiten gemacht hat?“
„Ja, verdammt! Ich weiß nicht, ob er noch Colonel oder schon General ist, zum Teufel. Aber ich weiß, dass dieser Kommissar was für die Indianer übrighat, weil er selber ein Indianer ist! Diesen Kerl brauchen wir hier nicht.“
„Soviel ich weiß, Sir, ist er am Missouri entlanggereist. Offensichtlich will er sich mit dem Oglala-Sioux Red Cloud treffen und ihn nach Washington einladen.“
„Das kann doch nur ein Witz sein, Captain! Präsident Grant sollte bereit sein, einen Indianer zu empfangen? Unmöglich.“
„Es scheint aber so zu sein, Sir.“
„Mist, verdammter Mist! Schweigen Sie über die Unterredung, Captain! Gehen Sie jetzt, ich muss nachdenken.“
„Jawohl, Sir.“
* * *
Kalt fauchte es durch die Bäume. Nebelfetzen wirbelten über den Marias River. Stöhnend sank eine Squaw abseits des Lagers zu Boden, gebar ein Kind und durchbiss die Nabelschnur, hüllte das Kind in wärmende Felle ein und schleppte sich zum Lager zurück, verschwand mit dem Kind in einem Wigwam. Trügerischer Frieden lag über dem Zeltlager der Bergindianer. Lagerfeuer schwelten und qualmten. Rauch wirbelte über die Wigwams der Piegan Blackfoot. Es war nur eins der Lager, und hier waren die Pocken ausgebrochen.
Dan Oakland verhielt auf dem Berg und blickte in das Flusstal hinunter. Das hohe Gras am Hang war vertrocknet und grau geworden. Ponys standen am Rande des Lagers.
Er sah nicht viele Krieger und Jäger. Hier lebten wohl knapp über zweihundert Blackfoot. Die meisten von ihnen waren Frauen und Kinder und Greise. Mitten im Lager befanden sich ein paar abgesessene Soldaten. Dan erkannte an der blauen Uniform des einen Mannes die Rangabzeichen eines Lieutenants. Sie sprachen mit den Indianern.
Langsam ritt Dan hinunter. Niemand stellte sich ihm in den Weg. Die Blackfoot hielten sich zurück. Vielleicht hatte die Krankheit sie geschwächt, vielleicht waren sie des ewigen Misstrauens müde geworden.
Er blieb im Schutz der Wigwams und hörte den Lieutenant sagen: „Es ist die Wahrheit. Der Große Weiße Vater hat euch einen Kleinen Weißen Vater gegeben, Donehogawa! Er ist ein Häuptling der Seneca gewesen. Er ist im Tonawanda-Reservat aufgewachsen, in einem Staat, den wir Weißen New York nennen, damals, vor vielen Jahren, als die Seneca-Irokesen dort gelebt hatten. Er ist ein guter Mann, meine Freunde.“
Der Lieutenant war William Pease, Agent der Indianer, jung und aufrecht, der an seine Sache glaubte.
„Dann ist es also wahr“, erwiderte ein Blackfoot. „Das, was an den Feuern unserer Brüder im Süden gesprochen wird. Es gibt diesen Kleinen Vater der Indianer?“
„Ja. Es gibt den Großen Weißen Vater und den Kleinen Weißen Vater der Indianer. Aber er ist nicht weiß. Er trägt eure Hautfarbe, er kann lesen und schreiben, er ist der erste Indianer für alle Indianer, versteht ihr das? Sein Herz gehört euch. Er redet nicht mit gespaltener Zunge!“
„Es ist gut, das zu hören“, antwortete der Blackfoot leise. „Wenn du gehst, werden wir hier ruhig lagern und hoffen, dass eine andere und bessere Zeit beginnt. Dein Großer Weißer Vater ist ein mächtig kluger Mann, weil er sich einen Kleinen Vater genommen hat.“
Dan Oakland ritt hervor, als Lieutenant Pease das Lager verlassen hatte und mit seinen Soldaten verschwunden war. Er konnte und wollte den Indianern keine Versprechungen machen. Er kam mit leeren Händen und einer schlimmen Nachricht.
Schweigend standen sie um ihn herum. Viele hatten schon von seinem Namen gehört. Einst hatten die Blackfoot erbittert gegen die Prärieindianer gekämpft, gegen die Sioux und Cheyenne. Längst war die alte Feindschaft und damit das Kriegsbeil begraben. Die Indianer waren tapfere Menschen, demütig im Gebet zu ihrem Großen Geist, entsagungsbereit und ehrlich. Wie überall, gab es auch unter ihnen Männer, die bis zum letzten Blutstropfen kämpfen wollten, die auch heimtückisch ihre Gegner überfielen, doch alle diese Stämme des Nordens bewiesen immer wieder große Bereitschaft zum Frieden, zur Einhaltung der Verträge und der Abmachungen. Sie waren stolz und sauber. Ein Volk vieler Stämme.
Der Tod der Jünglinge erfüllte sie mit Trauer und hilflosem Zorn. Sie verstanden diese Untat nicht. „Wir wollen Frieden. Unsere Jünglinge sollen in Frieden leben. Warum tötet der Weiße sie?“
Dan wollte nicht lügen. „Weil viele Weiße gemein sind, hinterhältig und rachsüchtig, weil sie das, was sie Geld nennen, höher schätzen als das Leben anderer! Weil sie immer mehr an sich reißen wollen und in euch keine Menschen ihres Gottes sehen.“
„Du bist ein Weißer, Catch-the-Bear.“
„Ich habe mich nicht selber erschaffen, Häuptling. Wenn ich es hätte tun können, ich wäre ein Indianer geworden!“
Furchen durchzogen Dans Gesicht. In den grauen Augen war es unruhig. Viel Bitterkeit prägte seinen Gesichtsausdruck. Er hörte das Klagen der Squaws um ihre ermordeten Söhne und das Weinen der Mädchen um ihre Brüder, und er hatte den unbändigen Wunsch, zum Himmel emporzuschreien und das zu verfluchen, was Gerechtigkeit genannt wurde, denn es gab wohl diese Gerechtigkeit nicht für die Indianer.
Der Schmerz der Frauen schnitt tief in sein Herz. Als er davonritt, saß er gebeugt im Sattel. Er verließ Menschen, denen er nicht helfen konnte. Aber eines konnte er tun, diese Skalpjäger suchen und töten!
* * *
Dan wollte nach dem Gesetz der Wildnis handeln. Er war nicht in Wut und nicht Hass. Er war entschlossen, diese drei Weißen für immer unter die Erde zu bringen.
„Hast du sie gesehen, mein Junge? Erinnerst du dich an die Gesichter dieser Weißen? Mach die Augen zu, lass dir Zeit und denke nach. Du bist mit den anderen Jungen beim Beerensuchen am Hang gewesen. Ihr habt einen Elch gesehen, und dann ...“
Dan schwieg und blickte in das graue eingefallene Gesicht des jungen Blackfoot, der schlaff und kraftlos im Wigwam von Standing Bull lag. Das Feuer glühte, und draußen tanzten die weißen Flocken des ersten Schnees durch die Bergfalte, stampften die Pferde und flatterten die Skalps an der Lanze.
Starr blickte der Jüngling ihn an. Er sah das zerfurchte, verwitterte Gesicht eines weißen Mannes, und auf einmal spürte er Standing Bulls Hand auf der Stirn.
„Sprich zu ihm, Tahtonka!“, sagte der Häuptling leise und eindringlich. „Er ist unser Freund. Catch-the-Bear und sein Sohn haben dich gefunden. Sag ihm, was du gesehen hast.“
Büffel, so hatte Standing Bull den Jungen genannt, ein Name, der einen Krieger ehren würde.
In den dunklen Augen des jungen Indianers erschienen die tiefen Abgründe der Erinnerung an die Angst, an mörderische Schüsse, blutige Körper und blutende Skalpe. Er konnte nicht reden.
Stilles, ernstes Lächeln zog über Dans Gesicht. „Ruh dich aus. Du wirst mich sehen, wenn du reden willst. Und du wirst es mir sagen, weil ich diese Weißen suchen will, Tahtonka.“
Er erhob sich und verließ das Zelt. Standing Bull blieb mit dem jungen Blackfoot, seiner Squaw und dem kleinen Baby im Wigwam zurück. Schnee tanzte über die Berge und haftete an den Fichten. Sky hatte unter den Bäumen aus vielen Zweigen und Fellen ein Wigwam gemacht und für die Pferde einen schützenden Unterstand errichtet. Gebeugt betrat Dan die primitive Behausung und ließ sich am wärmenden Feuer nieder. Sky sah ihn nur fragend an und wusste, dass sie warten mussten. Draußen hatte der Winter begonnen.
* * *
Schnee stiebte über die ausgefahrene Straße von Three Oaks, wirbelte unter die Vordächer der Häuser und haftete an den Fenstern, wo langsam die Eisblumen stiegen. Grauer Herdrauch wehte mit dem Schneetreiben über die Dächer.
Männer mit hochgeschlagenem Kragen, in dicke Jacken und Mäntel gehüllt, stapften über die Straße und betraten den verräucherten Saloon. Hier saßen sie alle, die Männer der Stadt, der Prärie und der Berge. Gleich nebenan im Store konnten sie alles kaufen, was sie für die Jagd brauchten, für die Mußestunden weit draußen in den einsam gelegenen Hütten.