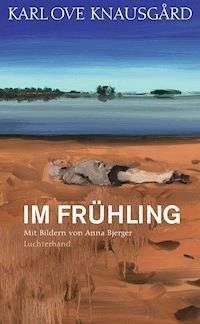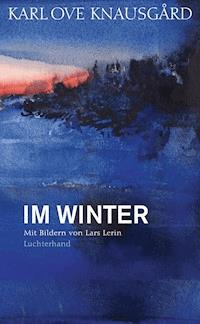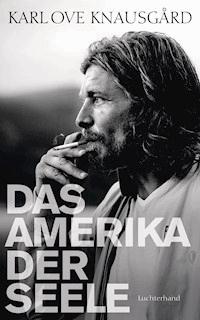
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Essays von Karl Ove Knausgård
Warum schreiben, warum malen, warum fotografieren? Warum lesen, warum Gemälde betrachten, warum in Galerien gehen? Kann es dabei um etwas anderes gehen als um die großen Fragen des Lebens? Und was hat diese Auseinandersetzung mit dem alltäglichen Leben zu tun?
Das Amerika der Seele ist eine Sammlung von Texten, die einen weiten Bogen spannen: von der Gnade, die darin liegen kann, der Beerdigung des eigenen Vaters beizuwohnen, bis zur Bedeutung der Einsamkeit in den Bildern der US-amerikanischen Fotokünstlerin Francesca Woodman. Vom Massaker auf Utøya bis zu Knut Hamsuns missglücktem Meisterwerk »Mysterien«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 587
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
KARL OVE KNAUSGÅRD
DAS AMERIKA DER SEELE
ESSAYS
Aus dem Norwegischen von Paul Berf und Ulrich Sonnenberg
Luchterhand
INHALT
ZEHN JAHRE
ALLES, WAS AM HIMMEL IST
AUGEN
WILLKOMMEN IN DER WIRKLICHKEIT
DER MONOFONE MENSCH
SANDHORNET
DAS AMERIKA DER SEELE
AM GRUND DES UNIVERSUMS
DER SCHWEINEMENSCH
DER BRAUNE SCHWANZ
IDIOTEN DES KOSMOS
BIBELHELFER
GNADE
DAS FÜR ALLE GLEICHE
DAS LEBEN IN DER UNENDLICHEN SPHÄRE DER RESIGNATION
DIE LITERATUR UND DAS BÖSE
DAS UNERSCHÖPFLICH PRÄZISE
DORTHIN, WOHIN DIE ERZÄHLUNG NICHT KOMMT
Quellenangaben und Literaturhinweise
ZEHN JAHRE
VOR DER TOILETTENSCHÜSSEL KNIEND versuche ich, mich möglichst lautlos zu übergeben, was sich jedoch als unmöglich erweist; die Krämpfe, die meine Bauchmuskeln zusammenpressen, lassen mich aufstöhnen. Erbrochenes spritzt gelb auf den weißen Porzellanrand. Aus dem Wohnzimmer dringen Schritte an mein Ohr, und ich beeile mich abzuziehen. Als er die Tür öffnet, stehe ich über das Becken gebeugt und wasche mir mit kaltem Wasser das Gesicht. Er sieht zunächst mich an, lässt dann den Blick durch den Raum schweifen. Ich halte die Luft an, schaue auf das Wasser hinunter, das in den Abfluss rinnt. Wortlos schließt er die Tür. Seine Schritte entfernen sich die Treppe hinab, ich drehe das Wasser ab und trockne mein Gesicht mit einem Handtuch. Dann ziehe ich den Vorhang am Fenster auf. Die Schneehaufen entlang der Straße sind im Laufe des Tages langsam eingesunken. Der schwarze Asphalt glänzt regennass. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite ist auf dem gepflasterten Hof ein Mülleimer umgekippt. Einige Elstern sind dabei, Löcher in eine der Plastiktüten zu reißen, mit flatternden Flügeln und hackenden Schnäbeln wühlen sie sich durch den Müll: Kaffeesatz, Verpackungen, Eierschalen, Brotkanten. Als er unter mir die Tür öffnet und zum Auto geht, fliegen sie auf, steigen in der Luft mühelos zu den Telefonleitungen hoch, die in Schwingung geraten, als die Vögel sich auf ihnen niederlassen.
Noch lange, nachdem er gefahren ist, bleibe ich stehen und beobachte sie. Die schwarzen Augen, ihre im matten Regenlicht glänzenden Krallen, ihre Schnäbel, die sich bei jedem ihrer Rufe heben. Vollkommen regungslos hocken sie dort, wenn der hässliche Laut in die Landschaft hinausschallt, als würden sie sich erst durch ihn ihrer selbst gewahr werden, und dass dies der Ort ist, an dem sie sich befinden.
ALLES, WAS AM HIMMEL IST
VOR EINIGEN TAGEN VERÖFFENTLICHTEN einige Zeitungen im Internet ein Bild, das aus einer ärztlichen Untersuchung stammte, es war eine Ultraschallaufnahme der Hoden eines Mannes; klar und deutlich war darin ein Gesicht zu erkennen mit Augen, Nase und Mund, eindeutig ein Kind, das unruhig aus seiner Dunkelheit in der Tiefe des Körpers starrte. Das Phänomen ist nicht ungewöhnlich, häufig wird es mit Christus in Zusammenhang gebracht, wohl auch deshalb, weil es sich nur bei seinem Abbild lohnt, es an andere weiterzuvermitteln. Das Antlitz von Jesus kann sich in einer Marmorplatte zeigen, einer verkohlten Scheibe Toast, auf einem fleckigen Kleidungsstück. Im Herbst wurde ich in Göteborg auf der Straße von einer Frau aufgehalten, die mir ein Foto geben wollte, es zeigte Jesus Christus in einer Felswand irgendwo in Schweden. Diese kursierenden Bilder sind nicht bloß Andeutungen, die unsere Fantasie vervollständigt, sondern völlig überzeugend; was aus den Hoden herausstarrt, ist ohne jeden Zweifel ein Kind, und der männliche Körper, der sich im Fels zeigt, die Hand in einer fast einladenden Geste ausgestreckt, ist tatsächlich ein Bild von Jesus Christus, wie es zu einer Ikone geworden ist. Dies ist so, weil die Formen des Universums begrenzt sind, und das menschliche Gesicht und der menschliche Körper bilden eine der Formen in der Natur. Sie können sich ebenso gut in einem Sandhaufen wie in einem Zellhaufen zeigen.
Liegt man an einem Sommertag auf dem Rücken und schaut in den Himmel hinauf, vergehen nur wenige Minuten, bis man in den Wolken über einem vertraute Formen sieht. Einen Hasen, eine Badewanne, ein Felsplateau, einen Baum, ein Gesicht. Beständig sind diese Bilder nicht; sie verwandeln sich vielmehr langsam und werden zu etwas anderem, im Gegensatz zu dem, der sie liegend betrachtet und dessen Gesicht und Körper unverändert bleiben, sowie im Gegensatz zu der Umgebung, von wo aus sie erblickt werden, die Böschung mit ihrem Gras und den Bäumen, die auf ihr wachsen, die ebenfalls unverändert bleiben. Doch diese Unveränderlichkeit trügt, auch das Gesicht, der Körper, das Gras und die Bäume wandeln sich; kehrt man fünfzehn Jahre später an dieselbe Stelle im Wald zurück, wird sie ganz anders sein, wird ihre Form neu sein, und auch das Gesicht und der Körper werden sich verändert haben, wenngleich nicht bis zur Unkenntlichkeit. In einem größeren zeitlichen Rahmen wird allerdings auch das der Fall sein; über einen Zeitraum von zweihundert Jahren hinweg betrachtet, werden Gesicht und Körper entstanden, geformt, deformiert und aufgelöst worden sein, in Formveränderungssequenzen, die denen von Wolken nicht einmal so unähnlich sind, nur wesentlich langsamer, da sie sich im kompakten Fleisch abspielen und nicht im luftigen Äther.
Wenn wir die Welt nicht so sehen, als Materie in der Gewalt alles umwälzender Kräfte, so liegt es nur daran, dass uns dieser Blickwinkel verschlossen bleibt, wir sind in unserer eigenen, menschlichen Zeit eingeschlossen und sehen jede Veränderung aus ihr heraus. Die Veränderungen der Wolken nehmen wir wahr, die der Berge nicht. Das bildet den Ausgangspunkt für unsere Auffassung von Beständigem und Beständigkeit, von Veränderung und Veränderlichkeit. Wir behalten die Form des Berges von jenem Tag an in Erinnerung, an dem wir vor ihm standen, nicht jedoch die Form der Wolken, die in diesem Moment über dem Berg hingen. Unser Körper befindet sich an einem Ort zwischen diesen Vergänglichkeitsmonitoren, die das Tempo unseres Lebens wiedergeben. Unsere eigene Zeit, die Veränderung, die wir selbst hier, mitten in der Welt stehend überblicken können, ist, abgesehen von den Bewegungen des Körpers, fast immer mit Wasser und Wind verbunden. Die Tropfen, die sich von der Dachrinne lösen, das Blatt, das in die Luft gewirbelt wird, die Wolken, die über den Bergkamm gleiten, das Wasser im Bach, das zum Fluss hinabfließt, der Fluss, der ins Meer mündet, die Wellen, die dort in einem immerwährend veränderlichen Reich einmaliger Formen entstehen und vergehen. Das können wir sehen, denn die Zeit der Bewegungen verläuft synchron zur Zeit unseres eigenen Seins. Jener Zeit, die wir den Augenblick nennen. Und was in diesem Augenblick in uns selbst vorgeht, ist nicht ohne Gleichheitszeichen zu den Bewegungen außerhalb: Auch in uns gibt es etwas, was kontinuierlich entsteht und einstürzt und dessen Bewegungen niemals aufhören, solange wir leben: Gemeint sind die Gedanken. Am Himmel des Selbst segeln sie heran, jeder einzelne von ihnen einzigartig, schieben sich über den Rand des Vergessens und verschwinden, um in genau dieser Form niemals wiederzukehren.
Die Vorstellung von einer Verbindung zwischen Gedanken und Wolken, zwischen Seele und Himmel, ist alt, und ihre Entsprechung, oder Verankerung, bestand stets in der Verbindung zwischen Körper und Erde. Das Flüchtige, Ätherische, Freie ist das Ewige gewesen; das Beständige, Materielle, Gebundene ist das Vergängliche gewesen. Als der modernen Wissenschaft im siebzehnten Jahrhundert der Durchbruch gelang und sie die Grenzen des menschlichen Auges durch Mikroskop beziehungsweise Teleskop erweiterte und in der westlichen Welt schließlich Körper seziert wurden, bestand eine der größten Herausforderungen in der Frage, was in diesem System aus Zellen und Nerven das Denken war. Was war in dem mit Muskellinien bespannten Puppenkörper die Seele? Der französische Philosoph Descartes öffnete in seinen Amsterdamer Wohnungen Tierleiber, er wollte die Seele lokalisieren, die er in einer der Drüsen vermutete, und er wollte die Gedanken lokalisieren, von denen er annahm, dass sie durch die winzig kleinen Röhrchen des Gehirns wehten. In den gut dreihundert Jahren, die seit Descartes vergangen sind, ist die Wissenschaft einer genauen Bestimmung von Gedanken und Seele nicht näher gekommen, denn der Unterschied zwischen einem Ich, das Ich denke, also bin ich sagt, und einem, in dem der Satz zuerst gedacht, anschließend von dort kommend ausgesprochen wird, das biologisch-mechanische Gewirr des Gehirns aus Zellen, Chemie und Elektrizität, ist unüberwindlich, wie einer von Descartes’ Zeitgenossen, nur ein paar Häuserblocks entfernt, der Maler Rembrandt, in einem seiner Gemälde von Obduktionen zeigt, auf dem der obere Teil einer Schädeldecke abgehoben und von einem Assistenten wie eine Tasse gehalten wird, während der Arzt vorsichtig in das freigelegte Gehirn der Leiche schneidet. Keine Gedanken, nur die Gefäße der Gedanken, keine Seele, nur die Hülle der Seele. Was waren die Gedanken und die Seele? Das, was sich darin bewegte.
In seinem Essay Der cartesische Taucher, einer inhaltsreichen und fast schon wütend zu nennenden Verteidigung Descartes’, schreibt Durs Grünbein über eine der Obduktionen des französischen Barockphilosophen, und zwar von einem Ochsen, bei der Descartes im Auge des Ochsen ein Bild dessen erblickte, was der Ochse in seinem letzten Moment auf Erden gesehen hatte. Descartes schreibt: »Wir haben uns dieses Bild in dem Auge eines toten Tiers angesehen, und zweifellos erscheint es im Auge eines lebenden Menschen ganz ähnlich auf der inneren Haut.« Über diesen eigentümlichen Gedanken schreibt Grünbein: »Descartes, der sich die Netzhaut wie ein Stück Papier vorstellt, dünn und lichtdurchlässig wie eine Eierschale, glaubt denn auch wirklich, das Gesehene sei auf ihr gleichsam aufgedruckt.«
Wir sehen nicht die Welt, wir sehen das Licht, das sie zurückwirft, und der Gedanke, dass dieses Licht irgendwie im Inneren des Auges festgehalten oder fixiert wird, ist nicht so weit hergeholt, denn wenn wir die Augen zumachen und das Licht der Welt ausschließen, können wir in der Dunkelheit des Schädels problemlos ein Bild von ihr heraufbeschwören. Dass dies nicht so geschieht, wie Descartes es sich vorstellte, als eine Art Vexierbild auf der Hornhaut, ändert nichts daran, dass die Welt in uns in Gestalt von Bildern festgehalten ist, denn von den Lichtwürfen aller Dinge und Phänomene, die uns durchströmen, wird der Abdruck mancher immer bleiben, und dass diese Abdrücke eine objektive Existenz haben sollen, sichtbar für andere, nicht nur für das innere Ich, ist auch keine abwegigere Vorstellung, als zu sagen, die Seele führe eine eigene, selbständige Existenz in dem Körper, durch den sie sich ausdrückt.
Im Barock existierte das mechanische Bild, also die Fotografie, die Fixierung des Lichts in der Zeit, noch nicht, die von Descartes’ verkleinertem Bild im Auge des Ochsen in gewisser Weise vorweggenommen wurde und von der das Leichentuch von Turin eine Variante bildete; nein, der Weg aller Abbildungen führte über das Menschliche im Sinne seiner inneren Welt aus Bildern, Gedanken, Gefühlen, Wahrnehmungen, Intuition, Erfahrung, umgesetzt und objektiviert in Gestalt von Farben auf einer Leinwand. Was dem Äußeren und was dem Inneren angehört, hängt vom sehenden Auge ab. Auch darum geht es in Rembrandts Obduktionsbild. Das Auge sieht nur die Oberflächen, alles, was das Licht reflektiert, und diese Oberfläche ist der Gegenstand und die Begrenzung der Malerei. Die Gedanken und die Seele gehören zum Inneren und lassen sich als solche unmöglich abbilden, sie sind unsichtbar. Wenn sie gezeigt werden sollen, müssen sie als etwas anderes repräsentiert werden, das heißt als Oberfläche. Im Mittelalter und in der frühen Renaissance wurden heilige Menschen, die im Kontakt zum Göttlichen standen oder gestanden hatten, mit einer Glorie um den Kopf gemalt. Engel, die Boten des Heiligen, Gottes Stellvertreter, wurden mit Flügeln gemalt. In vielen dieser Bilder öffnet sich der Himmel, und Körper mit Flügeln und Glorien wälzen sich über die Erde, in Kaskaden aus Licht und Wolken. Im Mittelalter verkörperten die heiligen Gesichter Gesichter, verkörperten die heiligen Körper Körper, verkörperte das Licht Licht. Jeder Körperteil und jeder Gesichtszug war formalisiert, und diese Verneinung des Individuellen wurde zusätzlich noch dadurch verstärkt, dass das Licht nicht spezifisch war, denn so gehörte es zu keinem speziellen Augenblick, sondern zu allen Augenblicken, und damit zur Ewigkeit. Was diese ikonischen Bilder ausdrückten, war das Unveränderliche und ewig Gültige. In der Renaissance wird das Licht, das die Form der Zeit ist, immer deutlicher bestimmt, kommen die Gesichter bestimmten Gesichtern, die Körper bestimmten Körpern, die Landschaften bestimmten Landschaften immer näher. Die Malerei tritt in die menschliche Zeit ein und verkörpert das Heilige in ihr: Christus wirft einen Schatten. Noch immer öffnet sich der Himmel voller Körper aus dem Göttlichen, aber der Himmel ist nicht mehr unbestimmt, er gleicht dem Himmel, wie wir ihn kennen, mit seinem langsamen Wirbel aus Wolken, Grautönen, Licht und Dunkel, und gemeinsam mit den anatomisch korrekten Körpern, die ihn bevölkern, wird er immer weiter zur Wirklichkeit herabgezogen, also zur Welt, wie sie sich für unsere Augen darstellt, die nicht die Ewigkeit kennen, nur den Augenblick, und das, was sich genau hier, genau jetzt, vor uns entfaltet.
Das Bild Anatomische Vorlesung des Dr. Deyman, das Rembrandt 1656 malte und das später bei einem Feuer beschädigt wurde, so dass nur der Mittelteil des Gemäldes erhalten geblieben ist, muss wohl als der Endpunkt dieser Bewegung betrachtet werden, aber nicht, weil es eine Obduktion zeigt, sondern weil der Sezierte in der gleichen Pose, mit der gleichen radikalen Verkürzung abgebildet ist, wie es in Mantegnas Gemälde Beweinung Christi geschieht. Der sezierte Mensch ist nicht Christus, aber Christus-ähnlich, und mit diesem Bild ist das Christus-Ähnliche nicht nur auf die Erde und in die unbarmherzige Fesselung des Körpers an die Materie gebracht worden, sondern auch sein Inneres liegt entblößt, und nicht etwa nur das Innere in Gestalt der lebenserhaltenden Organe im Torso, sondern der Sitz der Gedanken, das Gehirn. Schau her, keine Seele. Schau her, keine Gedanken. Was anderes sind die Seele und die Gedanken als der Himmel des Einzelnen? In der schwindelerregenden Verdichtung dieses Bilds ist sowohl der Himmel des Toten als auch unser aller Himmel fort, geblieben ist allein das nicht-transzendente, weltliche Leben: die Welt, wie sie sich jemandem zeigt, der sieht.
Zu den interessantesten Merkmalen der Gemälde Rembrandts gehört, dass kaum eines Wolken oder Himmel enthält. Motive, die nicht in Interieurs abgebildet sind, werden unter einem schwarzen Nachthimmel gezeigt. Es gibt Ausnahmen, aber typisch für die wenigen Wolken, die Rembrandt malte, ist das Vage und Unbestimmte an ihnen, im Gegensatz zu vielen seiner zeitgenössischen Kollegen, für welche die Landschaft außerhalb der vier Wände ihres Ateliers eine große Verlockung darstellte und offenbar auch von einer befreienden Kraft erfüllt war, denn sie malen ihre Landschaften, als wären sie die Ersten, die diese Welt sehen.
Die Bilder Jacob van Ruisdaels werden vom Himmel dominiert, ihr auffälligstes Element sind Wolken, so etwa in dem grandiosen Landschaftsgemälde Die Bleichen bei Haarlem, acht Jahre vor Rembrandts Obduktionsgemälde entstanden, auf dem der Himmel mit seinen gewaltigen, sich vorüberwälzenden Wolken zwei Drittel der Bildfläche einnimmt. Es gibt ein Gewässer, es gibt einen Wald, es gibt Häuser, und es gibt Türme, verteilt in der vollkommen flachen Ebene, aber sie bilden, so scheint es jedenfalls, nur den Grund, in dem das eigentliche Anliegen des Bildes verankert ist. Der Himmel ist wie ein Saal, ein Schauplatz, ein Schlachtfeld, aber nicht für etwas Göttliches oder Mythologisches, sondern für die unterschiedlichen Formen des Wasserdampfes, wie sie sich in diesem ganz bestimmten Moment, an einem Tag im siebzehnten Jahrhundert, über der niederländischen Stadt Haarlem zeigten. Die Barockmaler, die weiter südlich auf dem Kontinent tätig waren wie Claude Lorrain, malten auch Wolken, aber die Landschaften, über denen sie vorüberzogen, waren archaisch oder religiös. In ihnen war die Vorstellung dem Anblick übergeordnet, der Gedanke dem Auge. In Ruisdaels Landschaften treten die Vorstellung und der Gedanke in den Hintergrund und überlassen die Manege dem Auge. Dieses Auge, dessen Eindruck die Hand wiedergibt, sieht das, was ist, die Ebene mit ihren verstreut stehenden Häusern und Bäumen, mit dem Blau des Himmels und den weißen, aufgetürmten Wolken in ihm. Wenn das Auge in dieser Weise den Vorrang hat, lautet die Frage des Bildes nicht nur, was die Welt ist, sondern auch, was ein Auge ist. Die Wolken, die Ruisdael malte, mag man sich vorstellen, hätten sich auch in den Augen eines Toten zeigen, hätten auch als ein schwacher Widerschein über alle reflektierenden Flächen der Landschaft gleiten können. Die in jener Zeit einsetzende Mechanisierung der Optik und des Körpers befreite in gewisser Weise den Blick von der Seele, als könne das Gesehene etwas in sich selbst sein. Als August Strindberg seine Kamera auf die Erde legte und sie Bilder von den Wolken am Himmel machen ließ, war es diese Bewegung, die er weiterführte und zu vollenden trachtete, hin zur Welt außerhalb des Menschlichen, wie sie in sich selbst ist, betrachtet von einem seelenlosen Auge. Damit war die jahrhundertelange Leerung des Himmels vollendet: Die Wolken waren nicht gemalt, nicht komponiert, nicht einmal gesehen, nur registriert worden, von einem mechanischen Apparat ohne Willen oder Denken, von einer Willkürmaschine, die das Willenloseste, Gedankenloseste und Willkürlichste von allem abbildete: die Formen der Wolken. In diesem Bild zeigt sich ein Ort, aber es ist nicht die Welt, sondern der Mensch, der sich zeigt, denn die Welt ist nicht das, was ist, die Welt ist das, was wird, und alle Bilder von der Welt, wie sie ist, sind deshalb im eigentlichen Wortsinn utopisch: Sie sind Nicht-Orte. Also Kunst.
Eine der Aufnahmen des schwedischen Fotografen Thomas Wågström zeigt ein Flugzeug unter einer großen Wolkenformation. Das Flugzeug befindet sich etwa in der Bildmitte. In gleicher Höhe, jedoch am rechten Bildrand, sieht man einen Vogel. Er ist groß, sieht aus wie ein Raubvogel und muss dem Standort des Fotografen bedeutend näher sein als das Flugzeug, denn auf dem Bild sind Vogel und Maschine ungefähr gleich groß. Das Wolkenmassiv ist riesig, das Flugzeug klein. Dennoch lassen sich einzelne Details erkennen, zum Beispiel, dass der Kondensstreifen sich rechts hinter ihm befindet und das Flugzeug auf dem Weg nach links ist, mit hoher Geschwindigkeit am Himmel, vor dem Hintergrund des gewaltigen Wolkenmassivs. So sehe ich dieses Bild, ein Flugzeug, unterwegs am Himmel, eingefangen im Augenblick. Und so muss es auch in der Wirklichkeit gewesen sein, der Fotograf muss das Flugzeug und den Vogel und die Wolkenmassen gesehen, die Kamera ans Auge gehoben und ein Bild von diesem Motiv gemacht haben, und als er sie wieder senkte, setzte die Maschine ihren Weg fort, schon bald außer Sichtweite, während der Vogel vielleicht noch eine Weile auf den Luftströmungen weiterschwebte, ehe auch er verschwand. Nichts davon gehört jedoch zu diesem Bild. Tatsächlich steht das Flugzeug vollkommen still. Ja, es hängt regungslos unter dem Wolkenmassiv, und der Vogel hängt regungslos gleich dahinter. Andererseits lässt sich unmöglich erkennen, dass die Maschine stillsteht. Die Erwartungen an das Flugzeug sind so mächtig, dass sie die Fakten des Fotos übertrumpfen. Ich sehe das Flugzeug auf seinem Weg. Ich sehe den nächsten Augenblick. Er ist in mir, nicht in dem Bild, denn auf ihm steht die Maschine vollkommen still. Auf dem Foto gibt es keinen nächsten Augenblick. Und in der Wirklichkeit gab es nicht den Augenblick des Bilds, denn nie ist die Welt oder etwas in ihr unbeweglich gewesen. Jedes Foto, jedes Gemälde ist ein Fall, und woraus es fällt, das ist die Welt. Ich weiß nicht, wie Descartes sich das Verhältnis zwischen Licht und Netzhaut vorstellte, aber er dachte sicher nicht, dass sich jeder einzelne Augenblick einbrannte wie die Miniaturfotografie, die er im Auge des Ochsen sah; vermutlich stellte er sich eher etwas Fließendes und Fluktuierendes vor, das erst im Tod fixiert wurde. Eine solche Vorstellung ist dem Wesen der Fotografie verwandt, die das Licht nur in einem Bild dessen festhalten kann, was bereits vergangen ist.
In der norwegischen Bibel wird der Name Gottes mit »ich bin, der ich bin« und »ich bin« übersetzt; er könnte auch mit »ich bin, was ich bin« übertragen werden. Der kanadische Literaturwissenschaftler Northrop Frye schreibt, manche Forscher seien der Ansicht, eine korrektere Übersetzung laute in etwa »ich werde werden, was ich werden werde«. Das ist eine präzise Formel für das Universum. Die uns umgebende Regungslosigkeit ist nur scheinbar, also etwas, was innerhalb der Grenzen unserer Sinne existiert, außerhalb dagegen nicht. Außerhalb der Grenzen unserer Sinne ist alles in Bewegung. Manches da draußen bewegt sich so schnell, anderes so langsam, dass wir unfähig sind, diese Bewegungen wahrzunehmen. So wie wir auch Töne nicht hören können, die ober- oder unterhalb unseres Frequenzbereichs liegen, oder Objekte nicht sehen können, die kleiner sind als das, was unser Auge erfasst. Das Wachsen des Baumes, das Faulen des Obstes im Gras, die Verwitterung des Gebirges sind unsichtbare Prozesse, die uns nur mit Hilfe der Erinnerung bekannt sind, der eigenen oder der kollektiven. Und die Moleküle, die Atome, die Elektronen: unfassbar wild sind ihre Bahnen. Wir leben in einem Ausschnitt der Welt, wir leben in einer Nische der Wirklichkeit, in der sich ihre fortwährende Neuordnung, ihre laufenden Entstehungsprozesse und Zusammenbrüche in Mustern zeigen, die wir als vorhersehbar erleben. Das Sinnbild dafür, das sich unser Leben lang tagtäglich einige hundert Meter über uns zeigt, sind die Wolken. Langsam zieht Gebilde für Gebilde vorüber, sie nehmen verschiedene Muster und Formen an, die sich nie, kein einziges Mal wiederholen. Ihre Zeit ist unsere Zeit. Das sehen wir nicht in ihnen, da sie für uns nichts an sich sind, sondern in unserem Bild von ihnen.
Sommer 1985, Kjevik, der Flughafen von Kristiansand. Ich bin sechzehn Jahre alt und gehe den Mittelgang des Flugzeugs entlang, das mich nach Bergen bringen soll, bleibe an einer der hintersten Sitzreihen stehen und setze mich auf den Fensterplatz. Ich bin in meinem Leben so selten geflogen, dass ich mich an jeden einzelnen Flug erinnere. Alle haben mich von Kristiansand nach Bergen und zurück geführt. Ich fürchte mich an Bord eines Flugzeugs, da ich denke, dass es abstürzen könnte, und sitze deshalb ganz hinten, weil ich einmal gehört habe, dort seien die Überlebenschancen am größten. Gleichzeitig ist es aber auch ein Abenteuer, eine Busfahrt im Himmel, und ich liebe alles, was dazugehört, vom Wiegen und Einchecken des Gepäcks über die Präsentation der Sicherheitsvorkehrungen durch die Stewardessen, während die Maschine sich auf das Ende des Rollfelds zubewegt, bis zu dem flauen Gefühl im Magen, wenn die Kräfte der Motoren entfesselt werden und die große Maschine zitternd und bebend den Asphaltstreifen hinabrollt, um sich auf ihre wundersame Art plötzlich vom Boden zu lösen und in der Luft zu sein. Dann ist meine Angst am größten, denn der Mittelgang verläuft nicht mehr eben, sondern aufwärts, und meine Freude am intensivsten, denn wir sind in der Luft, und die gesamte mir bekannte Welt, durch die ich täglich gehe, radele, mit Bus oder Auto fahre, bleibt zurück. Der Strand an der Flussmündung, der Campingplatz dahinter, und hinter diesem die Siedlung. Die Brücke über den Sund, die Häuser, die das rechtwinklige Straßennetz der Stadt säumen, die Vorstädte, die sie umringen.
Das Flugzeug steigt, dann wendet es langsam. Mein Blick folgt dem Fluss, um das Haus zu sehen, in dem ich wohne und das nun leer steht, es liegt am Waldrand, da!
Wir steigen weiter, höher und höher geht es, kleiner und kleiner wird die Landschaft unter uns, bis alle Details in ihr verschwunden sind und sie nur noch aus Wald, Wasser, Bergen, Tälern, Meer besteht. Über uns ist der Himmel blau, unter uns schweben Wolken, leichte Sommerwolken, zwischen denen grün und blau die Landschaft in das Licht der riesigen Sonne getaucht liegt.
Ich sehe sie, die Wolken, die Landschaft unter ihnen, und in mir geschieht etwas.
Ich empfinde etwas, was ich so nie zuvor empfunden habe.
Wenn man sechzehn ist, gibt es vieles, was man nicht gedacht, und vieles, was man nicht verstanden hat. Dagegen gibt es nicht viel, was man nicht gefühlt hat, weil es nun einmal nicht so viele unterschiedliche Gefühle gibt. Im Alter von fünf Jahren durchströmen uns dieselben Gefühle wie mit fünfzig, möglicherweise etwas ungeordneter, aber im Grunde sind es dieselben. Freude, Trauer, Betrübnis, Zufriedenheit, Ohnmacht, Stärke. Eifersucht, Wut, Angst, Lust, Begierde. Alle Gefühle sind Nuancen und Variationen derselben Grundgefühle. Ein neues Gefühl ist deshalb eine Sensation. Damals, mit sechzehn, fühlte ich zum letzten Mal etwas, was ich nie zuvor gefühlt hatte. Und das war wirklich eine Sensation. Ich blickte aus dem Fenster, sah die Wolken, die Landschaft unter ihnen, und bekam ein intensives Gefühl für die Welt. Es kam mir so vor, als hätte ich sie vorher nie gesehen. Die Welt war ein Planet, der von Gasen umgeben war. Diese Erkenntnis, die unbeschreiblich bleibt, erfüllte mich mit Glück, aber auch mit Ungeduld und Verlangen. Der Augenblick ging vorüber, das Flugzeug landete, und ich nahm das Boot zu meinen Großeltern hinaus, aber ich habe ihn nie vergessen. Insgeheim nannte ich ihn »das Weltgefühl«. In meinen Gedanken war es ein »künstlerisches« Erlebnis gewesen, mein erstes. Deshalb verband ich es mit dem Schreiben. So muss ich schreiben, dachte ich. Ich musste etwas schreiben, das mit »dem Weltgefühl« verbunden war.
Fünfundzwanzig Jahre später habe ich noch mehrere solcher Weltgefühlerlebnisse gehabt, aber keines ist so intensiv gewesen wie dieses erste, und im Unterschied zu ihm wurden die späteren von Bildern der Welt ausgelöst, nicht von der Welt selbst. Das ist nicht weiter verwunderlich, denn dieses erste Weltgefühl enthielt zwei unterschiedliche, in ihre jeweilige Richtung ziehende Größen. Es ging zum einen um eine Präsenz im Augenblick, im Hier und Jetzt, das sich in seiner wahren Form zeigte, ohne Vergangenheit oder Zukunft, während es zum anderen um das Gegenteil ging, also um Abstand und darum, sich außerhalb von etwas zu befinden und es als abgetrennt zu betrachten, und folglich kein Teil davon zu sein. Und das, die Gleichzeitigkeit von Präsenz im Augenblick und Abstand von der Welt, ist der Ort der Kunst.
Das meditativ und religiös gefärbte Erlebnis des Jetzt, diese ungeheure Konzentration auf den Augenblick, die enorme Wellen von Verbundenheitsgefühlen mit der Welt auslöst, und vielleicht nichts weiter sagt als »ich existiere«, ist nur möglich, wenn die Welt sichtbar wird als Welt und nicht als die Welt des Ichs, und das tut sie nur, wenn dieses Ich außerhalb von ihr steht. In ein und derselben Bewegung entfernt die Kunst uns von der Welt und führt uns näher zu ihr heran, zu dieser himmelumspannten und sich langsam bewegenden Materie, aus der auch unsere Träume sind.
AUGEN
IN DEN WINTERFERIEN 2008 WAREN WIR INBERLIN und besuchten unsere Freunde Axel und Linn, die eine Wohnung in der Kantstraße gemietet hatten. Sie haben wie wir kleine Kinder, so dass wir nie den Ehrgeiz entwickelten, mehr von der Stadt zu erleben, als einem möglich ist, wenn man einen Kinderwagen schieben muss, also die Atmosphäre in den Straßen aufzunehmen, ein paar historische Bauten an den Fenstern der S-Bahn vorbeiziehen zu sehen, vielleicht in einer nahe gelegenen Kneipe abwechselnd ein Bier trinken zu gehen, sobald die Kinder schliefen. Was ich für den Höhepunkt für die Kinder gehalten hatte, die wilden Tiere im Zoo, interessierte sie so gut wie gar nicht. Dem Löwengehege kehrten sie den Rücken zu, stattdessen weckte ein Teich mit ein paar kleinen Goldfischen ihre Neugier. Vielleicht lag es daran, dass die Tiere ihnen aus den vielen Bilderbüchern vertraut waren, die wir gelesen hatten, und sie noch nicht alt genug waren, um den Unterschied zwischen der Welt in den Bildern und der Welt in der Wirklichkeit zu würdigen. Oder es liegt daran, dass Fische sie tatsächlich am meisten begeistern. Jedenfalls quengelte die Älteste in dem idiotischen Bollerwagen sitzend, den wir uns geliehen hatten und den ich hinter mir herzog, während wir an Elefanten und Giraffen, Bergziegen und afrikanischen Hunden vorbeigingen, sie sei hungrig, sie wolle etwas Süßes haben, sie wolle ein Eis essen, sie wolle den kleinen Eisbären Knut sehen, sie friere, sie wolle »nach Hause in die Wohnung«. Als wir dann jedoch ins Aquarium kamen, vergaß sie das alles. Zusammen mit den anderen Kindern lief sie von Becken zu Becken, presste ihr Gesicht gegen das Glas, starrte, lachte, zeigte, redete wie ein Wasserfall. Am hinteren Ende der Halle, neben den Haien, die zu ihrer großen Freude immer im Kreis schwammen, und den Rochen, die mit langsamen, flatternden Bewegungen über den Grund glitten, lag ein Aquarium mit Fischen aus Südamerika. Darunter eine Art, die ich nie zuvor gesehen hatte und von der ich einfach nicht die Augen lassen konnte. Es schien sich bei ihnen um eine Art Urfische zu handeln. Sie waren mehr als menschengroß, ihre Körper waren von teils blanken, teils grünspanfarbigen Schuppen bedeckt und verjüngten sich jäh zum Kopf hin, der mit seiner langgestreckten, schmalen Form mit dem restlichen Körper kaum in Verbindung gebracht werden konnte. Über den Nacken und den oberen Teil des Kopfs verlief eine Reihe von Linien, zwischen denen sich kleine Flecken abzeichneten, auch sie grünspanfarbig und so geformt, dass sie einem handgemacht vorkamen, als wären diese Köpfe in Bronze gegossen worden. Und das von einem Meister seines Fachs, irgendwann im siebzehnten Jahrhundert, denn der Kontrast zwischen den kolossalen Körpern und diesen feinen Ziselierungen an den Köpfen brachte einen unwillkürlich auf den Gedanken, dass diese lebendigen Formen von Menschenhand erschaffen worden waren, und zwar im Barock. Das Prunkvolle erhielt den Vorzug vor dem Eleganten, das Überbordende vor dem Feingeschnittenen, es ging um die Bündelung aller Zeit in einem Punkt: Die Geschichte der Art war uralt, sie reichte bis in die Urzeit zurück, aber die Exemplare, die sie heute vertraten, waren in meiner Lebensspanne geboren worden.
Ich war nicht der Einzige, der wie gebannt vor ihnen stand, auch die Kinder starrten immer wieder minutenlang diese eigentümlichen Riesenfische an, die hinter der Glaswand vollkommen regungslos im Wasser lagen. Oh, sie waren schön. Nach einer Weile bemerkte ich eine Bewegung unter der Decke, wo einer der Angestellten über die Bretter dort ging. Er hielt einen Eimer in der Hand und begann im nächsten Moment, Fische in das Becken zu werfen. Die schweren Fische bewegten sich blitzschnell, ihre Schwanzflossen peitschten das Wasser, und wir wichen einen Schritt zurück. Die Kleinen kreischten. Dann entdeckte ich, dass die raubtierhafte Präzision, die ich ihnen zugeschrieben hatte, nur scheinbar zutraf, denn sie verschlangen die Fische gar nicht sofort, ihre Kiefer schlossen sich mehrere Meter von ihnen entfernt, so dass sie zwei oder drei Versuche benötigten, bis sie die Tiere erwischten, wodurch mir bewusst wurde, dass sie fast blind waren. Ich betrachtete ihre Augen. Sie waren weiß und blass. Im Gegensatz zu Tieraugen verströmen Fischaugen nichts von dem Leben, dem sie angehören. In Fischaugen zu schauen ist wie ein Blick in gefärbtes Glas, sie enthalten nicht mehr als sich selbst. Sieh dagegen einem Affen in die Augen, und du siehst ein ganz bestimmtes Geschöpf. Nur eine halbe Stunde zuvor waren wir in dem großen Affenhaus gewesen, wo ich zwei fünfzig Jahre alte Schimpansen beobachtet hatte, die mit dem Rücken zum Publikum jeder auf einem Felsbrocken saßen, und die wenigen Male, die sie kurz zu den Leuten herüberblickten, leuchtete in ihren Augen das Unbehagen darüber auf, beobachtet zu werden. Katzen, Hunde, Kühe, Pferde, Schweine, sie alle treten in ihren Augen in Erscheinung. Für Vögel gilt dies dagegen ebenso wenig wie für Fische. Die Augen dieser Fische besaßen nicht einmal die Klarheit anderer Fischaugen, sie waren eher verschwommen. Anfangs dachte ich, sie wären degeneriert, und es erschien mir einigermaßen grotesk, dass diese riesigen Körper, so geschmeidig und motorisch effektiv, im Besitz solch großer Schönheit, fast blind und kaum in der Lage sein sollten, auch nur einen toten Fisch zu fangen. Degeneration war jedoch der falsche Ausdruck, es ging eher darum, dass die Entwicklung ihrer Augen auf einer bestimmten Stufe aufgehört hatte, die für die Umgebung, in der sie lebten, völlig ausreichte. Vielleicht sahen sie Schatten, das schwache Schimmern von Licht, Bewegungen. Das Sehvermögen gehört zum Primitiven, zu dem, woran alle heute lebenden Geschöpfe teilhaben, mit Ausnahme jener, die es nicht benötigen, weil sie in absoluter Dunkelheit leben, und jener, die in absoluter Unbeweglichkeit leben wie Pflanzen und Bäume.
Was will ein Baum auch mit Augen? Sich tagaus, tagein dasselbe anschauen, ohne die Möglichkeit zu haben, darauf reagierend zu handeln? Nein, Bäume haben keine Augen, aber alle Tiere, die sich in ihm aufhalten, selbst die kleinsten Insekten, haben Augen. Die Fähigkeit zu sehen, ist nicht selbstverständlich, aber als sie erst einmal entstanden war, ist es angesichts der vielen Vorteile, die das Sehvermögen bot, nicht weiter verwunderlich, dass es sich ausbreitete. So wurde auch die Aufklärung erst möglich, als Teleskop und Mikroskop erfunden wurden. Wir sahen mehr vom Großen und vom Kleinen, und wir verstanden mehr. Worauf die Evolutionstheorie einem jedoch keine Antwort gibt und womit sich die Aufklärung niemals beschäftigte, ist das andere, was in den Augen liegt, und das man sieht, wenn man dem Blick eines anderen Menschen oder Tiers begegnet, das, was die Augen »senden«. Was ist es? Wenn ich in einer halben Stunde diesen Raum verlasse, in dem ich schreibe, um die Kinder abzuholen, den Aufzug sieben Stockwerke nach unten nehme, die Haustür öffne und in das Menschengewimmel auf dem Platz hinaustrete, wird es das sein, was auf mich einströmt. Überall werden Augen vorbeigleiten, sie leuchten wie kleine Laternen in den ansonsten steifen, grobschlächtigen Gesichtern, und wenn ich in eines von ihnen blicke, werde ich jedes Mal das Gefühl einer besonderen Gegenwart bekommen. Selbst wenn die Gefühle dies völlig übertünchen mögen und die Augen sich vor Wut verfinstern oder vor Freude leuchten können, senden die Augen dennoch keine Gefühle aus und ganz bestimmt keine Gedanken, sondern etwas anderes. Der Gedanke, dass die Augen der Menschen, die über den Platz gehen, wie die von Fischen sein könnten, oder so weiß wie an antiken Statuen, ist ein Alptraum. Dennoch werden zu einem bestimmten Zeitpunkt alle, die dort gehen, so werden, denn das geschieht, wenn man stirbt, das Licht in den Augen erlischt, was sie aussenden, hört auf. War es also das Leben, was sie aussendeten? Nein, die Insekten, Fische, Vögel, Amphibien leben auch. Es war dieses Leben, ob nun dumm oder klug, brutal oder sanft, geizig oder großzügig, gierig oder genügsam, gut oder schlecht, groß oder klein, was sich zeigte, so wie es genau dort,genau da war, unterwegs in einer Menschenmenge auf einem Platz in einer schwedischen Stadt, als es sich ungesehen wähnte.
WILLKOMMEN IN DER WIRKLICHKEIT
BILDER FRANCESCA WOODMANS SAH ICH ZUM ersten Mal in einem Fotoband, den Linda gekauft und im Wohnzimmer in das Regal mit den Kunstbüchern gestellt hatte. Auf dem Schutzumschlag war eine junge Frau abgebildet, die am Bildrand hockte, das Kinn auf eine Hand gestützt, und mich direkt anstarrte. Die Wand hinter ihr war weiß, aber schäbig, voller Risse und Flecken, und auf dem Holzboden, grob und uneben, lagen abgebröckelter Putz, Staub, abgeblätterte Farbe. Der Blick der Frau war einerseits fragend, andererseits abschätzend. So, so, du siehst mich an? Sie trug ein unifarbenes Kleid mit einem Muster aus kleinen und großen schwarzen Punkten. Oder sagte ihr Blick »ach, mach schon, guck einfach«? In diesen Augen lagen eine Selbstsicherheit und Offenheit, der das Fragende in ihrem Blick eine Grenze setzte.
Ich schlug das Buch auf und blätterte darin. Das erste Bild zeigte eine nackte Frau, sie saß mit gespreizten Beinen, eine Glasscheibe gegen ihren Bauch und den behaarten Schoß gepresst, auf einem schmutzigen Stuhl, den Kopf vorgebeugt, vollständig verdeckt von langen Haaren. Ich blätterte weiter und sah eine Frau, nur mit Strümpfen und Schuhen bekleidet, die mit gespreizten Beinen neben einer Pflanze saß, hängende Brüste, ein bleicher, teigiger Bauch, das Gesicht der trompetengleichen Blüte zugewandt, die Nase beinahe in ihr, die Augen geschlossen. Am rechten Bildrand, neben einem abgeschnittenen Spiegel, hing dasselbe Kleid wie auf dem Umschlagbild. Am linken Bildrand eine durch Feuchtigkeit beschädigte Tür, ganz unten dunkel, als würde sie schon faulen. Ich blätterte weiter, sah ein Bild von einer unscharfen Gestalt, die unter eine Art Möbel gekrochen war, in einem verfallenen Zimmer, in dem die Tapete in Fetzen hing. Das reichte mir, jetzt war es gut, gereizt schlug ich das Buch zu und stellte es fort, erfüllt von etwas, was an Abscheu erinnerte. Dieses Frauenzeug, das mir direkt ins Gesicht geschleudert wurde, ging mir auf die Nerven.
Am ersten Mai dieses Jahres sah ich in New York zum zweiten Mal Bilder von Francesca Woodman. Da hatte ich nicht nur ihre Bilder, sondern auch ihren Namen längst vergessen und verband nichts mit ihm, als Asbjørn vorschlug, ins Guggenheim zu gehen, um sich dort eine Fotoausstellung anzusehen. Asbjørn ist Experte für alles, was in der Welt der Kunst und Literatur vor sich geht, so dass ich wusste, wenn er eine solche Empfehlung aussprach, war die Ausstellung einen Besuch wert. Auf dem Weg dorthin erzählte er mir, sie habe sich mit nur zweiundzwanzig Jahren das Leben genommen. Ich sah eine Sarah Kane-artige Bildwelt vor mir, dunkel und chaotisch und unschön, und meine Lust verflüchtigte sich ein wenig. Dennoch ging ich mit. Jill, Lektorin in dem amerikanischen Verlag, der meine Bücher herausgibt, begleitete uns und sagte, sie habe eine Freundin, die Woodman gekannt habe, und offen für die hohe Qualität und große Bedeutung der Bilder ging ich von Wand zu Wand und starrte sie an. Ein steter Zusammenprall von Körper und Raum. Offenbar seit langem verlassene Räume, darin ein stehender, sitzender, liegender, kriechender oder hängender Körper, häufig nackt, häufig gesichtslos, in mehr oder weniger verdrehten, oft auffallend inszenierten Posen. Sie gaben wenig preis, hingen fast stumm vor mir, waren nur, was sie waren, aber ich sah trotzdem, dass sie mir gefielen, und versuchte, mich der Welle der Begeisterung anzuschließen, mit der die anderen hinterher über die Bilder sprachen. In der Museumsbuchhandlung kaufte ich ein Buch von Woodman. Erst als ich im Hotelzimmer darin blätterte, erkannte ich die Bilder wieder. Ich rief Linda an, hatten wir zu Hause eventuell ein Buch von Woodman? Linda lachte und antwortete, das hätten wir, was los sei, interessierte ich mich jetzt plötzlich für sie?
Zwei Tage später kehrte ich in das Museum zurück und sah mir die Bilder allein an. Anschließend ging ich in die ständige Ausstellung in der ersten Etage hinunter, wo Gemälde vom Anfang des 20. Jahrhunderts hängen, ausschließlich Klassiker, Pissarro, Picasso, Manet, Monet, Cézanne, van Gogh, Gauguin, und diese Gemälde, so farbsprühend, erschienen mir plötzlich wie etwas aus einer anderen Zeit, ohne jede Relevanz für das, was in mir und um mich herum vorging. Sie waren Museumsobjekte, sagte mir mein Gefühl. Es war ein intensives Gefühl, und es war neu, denn die Bilder der Impressionisten und Post-Impressionisten haben mich immer sehr angesprochen, sie bildeten nicht nur einen Höhepunkt in der Geschichte der Malerei, zwischen Altem und Neuem oszillierend, voller Leben, sondern hatten eine persönliche Bedeutung für mich besessen, weil sie sich immer mit meinen Gefühlen verbunden, meinen Augenblick mit dem ihren gefärbt hatten. Jetzt waren sie tot. Selbst Monets Bilder, die trotz des hohen Kitschfaktors, den die zahllosen Poster und Reproduktionen seinen Werken verliehen haben, dem bestimmten Augenblick so nahe gewesen waren, dem Licht darin, zum Beispiel an einem Sommernachmittag an der Küste der Normandie, dass sie stets die Zeit überbrückten, die zwischen dem Augenblick des Bildes und dem Augenblick des Betrachters lag, denn wir alle kennen das Licht über dem Meer an einem Sommernachmittag, es ist auch unser Licht, das jederzeit in uns aufsteigen und auf diese Weise die Verbindung zwischen der Vergangenheit, unserer eigenen und der geschichtlichen einerseits, und der Gegenwart andererseits herstellen kann, durch die Gefühle, die das sind, wodurch wir die Welt am tiefsten erleben. Wir waren, und wir sind, und wir werden, das sind die Gefühle, die Monets Bilder in mir ausgelöst haben. Allerdings nicht vorbehaltlos, denn im Registrieren von Licht und Farben des Augenblicks liegt immer auch etwas Fremdes, eine Art Versachlichung der Welt, etwas Fernes und Objektives, das wir nicht mit uns verknüpfen können, weder im Augenblick selbst noch in seiner Wiedererschaffung durch die Kunst, und das große Verdienst des Impressionismus bestand darin, dass er, möglicherweise, ohne es überhaupt zu wissen, diesen Abgrund im Licht zeigte und nicht im Dunkeln, wie es etwa die Gemälde des Barock taten. Der Tod im Licht, der Tod im grünen Laub, der Tod im blauen Himmelsgewölbe. Das war die Relevanz Monets und seiner Zeitgenossen: Durch die Einkreisung des Augenblicks verbanden sie uns mit ihm, ließen sie uns seine Schönheit sehen und erfüllten uns mit einem Gefühl dafür, was es heißt, zu leben, aber auch dafür, was es heißt, nicht zu leben.
Diese Relevanz ist universell, sie hat nichts damit zu tun, was in der gesellschaftlichen und politischen Sphäre entstehen mag; die Lichtreflexe auf einer Wasserfläche glitzern unabhängig davon, ob wir das Essen salzen oder es im Kühlschrank aufbewahren, ob wir Sozialdemokraten oder Neokonservative sind, ob wir zu Pferde reiten oder Auto fahren, ob wir Briefe verschicken oder Textnachrichten. Jedenfalls habe ich das immer gedacht, aber an jenem Nachmittag im Guggenheim-Museum in New York war diese Relevanz verschwunden.
Ich verließ die Museumsräume und ging die 5th Avenue hinunter, erst an dem großen Park entlang, danach unter den gewaltigen Wolkenkratzern, so traumgleich in ihrer Unzugänglichkeit, und dachte dabei die ganze Zeit an das, was ich soeben erlebt hatte: Warum empfand ich plötzlich Francesca Woodmans Fotografien, so jugendlich schlicht, als relevant, und warum schienen mir die großen Maler des frühen 20. Jahrhunderts plötzlich irrelevant zu sein? Hatten Woodmans Bilder mich auf etwas aufmerksam gemacht, was es bei Monet oder van Gogh nicht gab und was demnach ausschließlich zu uns gehören musste, zu dieser Welt aus gelben Taxis mit Fernsehbildschirmen in den Rückenlehnen der Sitze, schwebenden Hubschraubern und Menschen, deren Blicke auf ihren Mobiltelefonen klebten, zwischen denen ich an diesem Nachmittag im Mai hindurch gehastet war, während die Sonne am Himmel über den Wolkenkratzern immer tiefer stand und schon bald hinter ihnen untergegangen sein würde? Oder war es so, dass der Gedanke an die Universalität mit dem verbunden ist, was bereits etabliert ist, und mit diesem erstarrt, und deshalb ständig neu erobert werden muss, um gültig zu bleiben, und ständig neues Territorium erobern muss, um uns mit seiner vollen, lebendigen Kraft zu treffen?
Ein Bild von einem schlanken Körper in einem schwarzweißgepunkteten Kleid, die nackten Arme an den Seiten herabhängend, in der einen Hand ein zylinderförmiger Gegenstand, der sich bei genauerem Hinsehen als ein Birkenholzscheit erweist, das ungefähr die gleiche Länge und den gleichen Durchmesser hat wie der Unterarm. Der Körper ist an Schultern und Beinen beschnitten, so dass weder das Gesicht noch die Füße sichtbar sind. Menschen identifizieren wir durch das Gesicht, ohne es wird der Körper zu einem beliebigen Körper, und durch das Gesicht lesen wir andere Menschen. Sehen wir ein Gesicht, stellen wir eine Verbindung zu ihm her. Dieses Foto verweigert uns eine solche Identifikation und zwingt den Blick so, sich auf die Suche nach anderen Identifikationsangeboten zu machen, sie bewegen sich von, wer sie ist, der ersten Frage, die wir dem Gesicht stellen, dazu, was sie ist. Oder besser, was das ist. Ein Torso, mit Stoff bekleidet, zwei nackte Arme, ein Birkenholzscheit? Das Muster auf der Rinde ähnelt dem auf dem Kleid, die Verbindung ist ebenso unumgänglich wie simpel, dieser Körper ist wie ein Baum.
Die Aufnahme, entstanden 1980 in der MacDowell Colony in New Hampshire, gehört zu einer Serie von Bildern, die um dasselbe Thema kreist, Körper und Baum. Acht nebeneinander gestellte Bilder von einer Reihe heller Birkenstämme vor einem dunklen Waldhintergrund. Auf einem ist ein langgestreckter, unscharfer Körper mit hochgereckten Armen als direkte Verlängerung des Stamms hineingeschnitten worden. Auf einem anderen streckt sich ein in Birkenrinde gewickelter Arm den Stamm hinauf, und auf dem letzten, dunkel und fast lichtlos, steht eine entkleidete Gestalt, dem Betrachter den Rücken zukehrend und die Arme hochgestreckt, auch sie in einer Weise in Rinde gehüllt, die es auf den ersten Blick schwierig macht zu erkennen, was die Arme der Gestalt und was die Stämme der Bäume sind. Und schließlich eine letzte Variante: Die Arme in Rinde gewickelt und eng an den Körper angelegt, steht Francesca Woodman vor einer Wand in einem Zimmer, die Augen geschlossen und den Kopf zur Seite geneigt, wie eine Krone.
Wie sollen wir diese Bilder verstehen?
Sie sind verspielt, und sie sind jugendlich, ich kann mir kaum vorstellen, dass ein erfahrenerer Künstler es wagen würde, sich in eine so schlichte Verschiebung hineinzubegeben, aber Woodman war erst einundzwanzig, hatte kein Prestige zu verlieren, war somit frei. Sie interessierte sich für das Stoffliche, Kleider sind ein Thema, das sie immer wieder aufgreift, und vielleicht war ihr einfach ins Auge gefallen, welches Muster die Rinde hatte und wie schlank die Stämme waren. Aber ihr Name, Woodman, enthält sowohl Holz als auch Wald und Mensch, und die Selbsterforschung spielt eine so zentrale Rolle in ihren Bildern, dass sie natürlich auch daran gedacht haben muss, als sie ihre Arme in Rinde wickelte und im Wald himmelwärts streckte. Das Motiv weckt zudem kunstgeschichtliche Assoziationen; der Wald der Romantik kann dadurch, dass Menschen in ihm verschwinden, ein Bild für den Tod oder das Universum (Friedrich), für das Leben, die Beharrlichkeit, die Kraft der Natur (J. C. Dahl), oder aber für das rätselhafte Andere (Hertervig) sein. Woodman konkretisiert die symbolische Verknüpfung von Baum und Mensch und macht sie materiell, das heißt unüberwindbar. Auffallend viele ihrer Bilder beschäftigen sich mit dieser unüberwindbaren Grenze zwischen Materiellem und Immateriellem. Bild für Bild arbeitet Ähnlichkeiten heraus – eines zeigt zwei gespreizte Beine auf einem Stuhl, die sich in einem gleichartigen Muster aus zwei Rissen im steinernen Fußboden spiegeln, auf einem anderen sieht man Woodman selbst, nackt auf einem Stuhl sitzend, annähernd wiederholt in einem schattenhaften, körperähnlichen Muster auf dem Fußboden, ein drittes zeigt eine gesichtslose Frau in einem weißen Kleid neben einem großen, weißen Vogel im Dunkeln, einen Arm lässt sie an ihrer Seite herabhängen, die Hand leicht gebeugt, so dass er einem Schnabel gleicht, die andere hält sie über den Vogelkopf – doch obwohl diese Korrespondenzen, die an manchen Stellen spielerisch und ironisch erscheinen, an anderen belastet von einer Art Verzweiflung, und die sich auf allen Ebenen der Bilder finden lassen, offensichtlich in einer Verbindung zur Romantik stehen, wird diese Affinität niemals eingelöst, kommt sie niemals in einer Form von Gleichheit oder Versöhnung zur Ruhe, im Gegenteil, die Kraft der Bilder entspringt zu einem Großteil der Unvereinbarkeit, der Differenz zwischen der Ordnung der Dinge und der des Menschen. Die eigenständige Kraft der Dinge ist auf diesen Bildern so groß, dass kein Blick oder Wille sie sich unterordnen kann.
Die Vorstellung von Engeln, diesen ebenso schönen wie furchterregenden Geschöpfen, die sich einst zwischen dem Menschlichen und Göttlichen aufhielten, untersucht Woodman in einer Serie von Bildern, die auch um die körperliche Ähnlichkeit kreist: Auf einem liegt sie von Papier bedeckt auf einem Tisch, die nackten Beine sichtbar, aber unscharf, wie in Bewegung. Neben ihr liegt ein toter schwarzer Vogel. Die Zusammenführung von menschlichem Körper und Vogelkörper ist so einfach wie die von menschlichem Körper und Baum. Doch da der Engel in der Kunst tatsächlich einen Körper besessen hat und in der Kunst nicht wie Baum und Wald bloß ein vages Bild für eine Sehnsucht im Menschen gewesen ist, bleibt der Abstand zwischen der Realität, bestehend aus den beiden biologisch-materiellen Geschöpfen, Mensch und Vogel, und dem Traum von der Realität, bestehend aus der Vorstellung vom Engel, in diesem Foto wesentlich brutaler und akuter. In derselben Engelserie liegt sie über den Tisch gelehnt, nackt, wir sehen ihren Rücken, die Wirbelsäule tritt unter der Haut deutlich hervor, ihren Nacken, ein wenig von den Haaren, einen ausgestreckten Arm, von dem ein schwarzes Kabel, wahrscheinlich zum Selbstauslöser, ausgeht. Folgt man ihm mit den Augen über den Tisch, fällt der Blick auf ein Blatt Papier mit aufgeklebten Vogelfedern. Es ist, als liefe der Wille, das Materielle zu überschreiten, den diese Inszenierung zum Ausdruck bringt, und damit der Glauben an die Kunst, entlang dieses Kabels.
Aber das Immaterielle, das in der Vorstellung, das im Blick liegt und damit eine innere Größe ist, existiert nicht nur in den offensichtlich existenziellen und ästhetischen Anziehungskräften, denn dieselbe Spaltung vollzieht sich im Verhältnis zwischen dem Körper, so wie er an sich ist, materiell und biologisch, und den Erwartungen des Betrachters an ihn, die in den Rollen sichtbar werden, in die er schlüpft, den Posen und Zusammenhängen, in die Francesca Woodman sich selbst stellte, als die Bilder aufgenommen wurden – etwa in dem Moment, in dem sie sich vorbeugte und eine Glasplatte gegen Bauch und Schoß presste.
Warum empfand ich Abscheu, als ich das sah? Das ist eine heftige Reaktion. Wodurch wurde sie ausgelöst? In meinem Gefühl verbarg sich offenbar der unbewusste Wunsch, das Gegenteil zu sehen, also etwas Schönes und Kontrolliertes, und da ich das von der Kunst an sich nicht erwarte, kann es nicht die Hässlichkeit der Kunst gewesen sein, auf die ich reagierte und von der ich mich innerlich distanzierte, sondern das spezifisch weiblich Hässliche. Dem männlich Hässlichen stehe ich neutral gegenüber, es bedroht mich nicht, ist Teil meiner selbst. Dem weiblich Hässlichen stehe ich nicht neutral gegenüber, ich weise es von mir, wenn ich es sehe. Ich verweigere mich ihm. Warum? Offenbar wirkt es bedrohlich. Aber warum? Worin besteht die Bedrohung? Und was bedroht es?
Während ich dies schreibe, wird mir bewusst, dass mich das Wort »hässlich« beschützt, einen Filter vor das schiebt, was ein Wort wie »Ekel« ans Licht gebracht hätte. Ekel ist der wahre Gegensatz des Heiligen, denn die Reaktion auf das Ekelhafte gehört zum Körper, dem Körperlichen, der Erde und dem Irdischen. Stuhlgang (noch so ein Euphemismus) – also Scheiße, ist ekelhaft, Kotze ist ekelhaft, Körpersäfte sind ekelhaft, verdorbenes Essen ist ekelhaft. All das stoßen wir von uns, rein körperlich, aber auch, indem wir nicht darüber sprechen oder Bilder davon zeigen. Wir verabscheuen es. Der Gegensatz zur Abscheu ist die Lust, und wenn wir begehren und vögeln, verändern sich die Leiber, Körpersäfte und Abführkanäle werden durch das Licht der Lust gesehen und werden zu etwas zutiefst Begehrenswertem. Eine ähnliche Doppelung gibt es im Tod, der einerseits eine abstrakte Größe ist, etwas Dunkles und zuweilen auch Anziehendes, vergoldet von der Romantik all der jungen Toten, und der andererseits das Abstoßendste und Ekelhafteste von allem ist, so voller verwesendem und zerfließendem Fleisch, Gestank und Maden, wie der tote Körper nun einmal ist. In dieser Doppelung, zwischen dem Blick und seinem verschönernden Himmel aus Bildern einerseits, und dem Körper andererseits führen wir unser Leben.
Ich erwartete mit anderen Worten, eine Frau zu sehen, nicht einen Körper. Und die Erwartung des Weiblichen kollidiert in diesen Bildern in ähnlicher Weise mit dem Körper der Wirklichkeit wie die Erwartung des Engels oder des Baums, etwas, dem sich der biologische Körper nähern oder von dem er sich entfernen kann. Er nähert sich im Bild eines Frauenkörpers auf einer Couch, nur mit Hüfthaltern und Strümpfen bekleidet, mit dem Rücken zum Betrachter, in körniges Licht getaucht, das es zum einen einer erotischen Fotografie vom Beginn des vorigen Jahrhunderts, zum anderen einer von Man Rays Arbeiten ähneln lässt. Er nähert sich in dem Bild eines unscharfen, sitzenden Frauenkörpers, die Arme hinter den Kopf gehoben, den Kopf zur Seite gewandt, die Brust herausgedrückt, was an die Pose erinnert, in der Munch sein Madonnenbild malte. Und er entfernt sich in den vielen Bildern, auf denen der oft gesichtslose Frauenkörper verrenkte, gelegentlich fast groteske Posen einnimmt, oder in den Bildern, auf denen der Körper gleichsam neutral dargestellt wird, nicht offensichtlich ästhetisiert oder inszeniert, sondern bloß liegend oder sitzend oder stehend, ein Körper in einem Raum, Natur in Kultur, ein junges, vorgebeugtes Mädchen mit langen Haaren, das eine Glasplatte auf seinen Schoß presst.
In dem beeindruckendsten und verstörendsten Bild Francesca Woodmans werden diese Themen und Bewegungen in einem Punkt gebündelt: ein unscharfer, auf dem Fußboden liegender Körper, so beschnitten, dass ihm Kopf und Füße fehlen, neben dessen Hüftkurve eine Schüssel platziert wurde, aus der sich der Po hochzuwölben scheint. In der Schüssel liegt ein zusammengerollter Aal. Die Kraft in dieser Zusammenführung ist schier unbeschreiblich, da sie ganz dem Bild angehört, das direkt in den Körper des Betrachters eindringt, im Gegensatz zur Sprache, die den Umweg über das Denken nimmt. Bedrohlich ist das, weil es unmöglich ist, den scharf konturierten Aal an der Seite des unscharfen Frauenkörpers zu sehen, ohne an Penetration zu denken, was ein grotesker Gedanke ist, denn der Aal gehört zu einer gänzlich anderen Ordnung als der Mensch. Außerdem stellt es die anderen Objekte auf den Kopf, neben die sich dieser Körper metonymisch gestellt hat und bei denen die Bewegung, also die Sehnsucht, vom Körper ausgeht – zum Baum, zum Wald, zum Vogel, zum Engel, zur Dunkelheit, zum Tod hin –, während sie hier vom Objekt, dem Aal ausgehend in den Körper führt. Es ist eine andere, absolut unerhörte Vereinigung. Doch auch diese Vereinigung ist nicht Teil des Bildes, sie ist ein Teil von mir, ich bin es, der an die Penetration denkt und den Körper des Aals als Biologie, den menschlichen Körper als Biologie sieht, zwei Körper, und ich bin es, der denkt, dass dies ungeheuerlich, monströs, grotesk ist.
In Woodmans Bildern ist eine starke Inspiration durch den Surrealismus spürbar, und gerade er schuf eine Instabilität im Raum zwischen den Kategorien, indem er Objekte aus verschiedenen Sphären nebeneinander stellte wie Dalí, wenn er einen Hummer zu einem Telefonhörer werden lässt, oder Meret Oppenheim, wenn sie Tassen und Teller in Pelz kleidet. Das ist humoristisch, verspielt, was für Woodmans Bild jedoch nicht zutrifft, das sich nicht nur zum biologischen Abgrund der Sexualität öffnet, sondern auch zu dem des Todes, in dem der Körper buchstäblich von Maden und Ungeziefer penetriert wird. Dies geschieht mit einer Art Unschuld in der Bildsprache, mit der Schlichtheit der Jugend, in der die Grenzen, zu denen es den Körper zieht oder zu denen er gezogen wird, nicht verdunkelt oder in Zwielicht getaucht werden, wie sie es gegenüber dem Wald oder dem Überirdischen werden, sondern in ein grelles und realistisches Licht getaucht sind: ein Aal, ein Po.
Die meisten dieser Fotos machte Woodman als Jugendliche. Ich selbst war als Jugendlicher blind für die Zusammenhänge, von denen ich ein Teil war, blind für all das, was mich bestimmte, voller Gefühle und Sehnsüchte, die ich mir nicht eingestand und so von dem Hunger nach Erkenntnis trennte, der mich in das Land der banalen und allgemeinen Wahrheiten trieb. Ein achtzehnjähriges Mädchen, das sich und seinen Körper in so ausgeklügelter und erkenntnisfördernder Weise inszenieren konnte, dass einem die Bilder noch heute, dreißig Jahre nach ihrer Entstehung, aktuell, wichtig und relevant erscheinen, ist aus diesem Blickwinkel betrachtet im Grunde unfassbar. Dass ich mich als Achtzehnjähriger ausgezogen, mich auf einen Stuhl gesetzt, eine Glasplatte gegen meinen Schwanz gepresst, dies fotografiert und das Bild anschließend ausgestellt hätte, so dass all meine Freunde und Bekannten es sich hätten anschauen können, wäre nicht nur unvorstellbar, sondern buchstäblich unmöglich gewesen, ebenso unmöglich wie das Verfassen von Gedichten auf dem Niveau eines Rimbaud, wenngleich auf andere Art, denn die Mauer aus Konventionen, die mich daran hinderte, meinen Körper zu exponieren und mich im Verhältnis zu ihm so gehemmt sein ließ, war in erster Linie eine soziale, reguliert von Scham, während das, was mich bis heute daran hindert, auf Rimbauds Niveau zu schreiben, eine intellektuelle Unfreiheit war und ist. In ihren Bildern befreite sich Francesca Woodman von den sozialen und intellektuellen Begrenzungen, und gerade in dieser Freiheit werden die Begrenzungen der Kultur, und welche Auswirkungen sie auf unsere Identität haben, sicht- und identifizierbar, gleichzeitig wird aber auch die Sehnsucht nach ihrer Überschreitung, die Transzendenz, gestaltet, und irgendwo dort, zwischen der Freiheit der Kunst, den Zwängen des Lebens und der Sehnsucht nach deren Überwindung, die in letzter Konsequenz der Tod ist, bewegen sich diese Fotografien. Die Freiheit, die diese Bilder ermöglichte, war die Freiheit vom Blick des anderen, und diese Freiheit, also die Freiheit der Kunst, verlangt Einsamkeit.
Dieser Gedanke ermöglichte es mir, ihre Bilder plötzlich zu sehen. Sie ist es, die betrachtet wird und zugleich betrachtet. Alle Blicke sind in ihr. Dass die Räume, in denen sich dieses Drama zwischen Blick und Körper, Körper und Identität abspielt, so verfallen und allem Anschein nach unbewohnt sind, verstärkt das Gefühl von Vereinsamung noch, doch unter einem der Bilder im Guggenheim-Museum las ich, dass Woodman tatsächlich in ihnen wohnte. Francesca Woodman zog in die Kunst ein und lebte in ihr. Sie allein mit allen Blicken. Als würde sie sich in der Erwartung in sie hinauswerfen, dass jemand sie auffängt. Und dieser jemand, das sind wir, die wir sehen.
DER MONOFONE MENSCH
HEUTE VOR EINEM JAHR ZÜNDETE EIN mit einer Polizeiuniform bekleideter Mann zunächst eine Bombe im Regierungsviertel von Oslo und fuhr anschließend, während die katastrophalen Bilder des Attentats in alle Welt übertragen wurden, nach Utøya hinaus, um im Laufe eines einstündigen Massakers neunundsechzig junge, wehrlose Teilnehmer des dort stattfindenden Sommercamps abzuschlachten. Die Tat war politisch motiviert, der Täter erklärte, wir befänden uns im Krieg, er bekämpfe die Auflösung traditioneller Werte, des männlichen Rollenverständnisses und des Nationalstaats, der Feind seien die Muslime und der Multikulturalismus, und die Abschlachtung von Mitgliedern der Jugendorganisation der Norwegischen Arbeiterpartei sei als Weckruf zu verstehen. Er wolle Norwegen retten. Nur wenige Stunden, bevor er das Auto vor dem Regierungsviertel parkte und die Bombe detonieren ließ, hatte er an über tausend Empfänger ein Manifest gesandt, in dem er detailliert seine Ansichten und seine Haltung darlegte. Außerdem hatte er ein Video gedreht, das mit propagandistischer Einfachheit und in der Bildsprache der vierziger Jahre zeigte, was angeblich in Europa vorging, die Invasion der Muslime. Ganz Norwegen stand unter Schock. Nichts hatte das Land auf etwas Derartiges vorbereitet, diese Möglichkeit hatte in den Köpfen der Menschen schlichtweg nicht existiert: Die schwerwiegendste politisch motivierte Tat nach Kriegsende waren bis dahin die sogenannten Hadelands-Morde gewesen, bei denen zwei junge Männer in einem kleinen faschistischen Untergrundmilieu, »Germanische Armee Norwegens« genannt, hingerichtet worden waren. Diese Morde ereigneten sich 1981 und waren damals eine große Sache gewesen, aber das hier war etwas radikal anderes. Es war so unerhört, dass es alle Schutzmechanismen durchbrach. Die Berichterstattung des Fernsehens von der Katastrophe war chaotisch, die Journalisten und Moderatoren standen genauso unter dem Eindruck der Ereignisse wie die Menschen, die sie interviewten, in ihren Augen und ihrer Körpersprache las man Ungläubigkeit, Schock, Verwirrung. Die gewöhnlich herrschende Distanz, mit der Nachrichten vermittelt werden, war aufgehoben worden. Alles war nah, für alle. Ja, die Welt schien in jenen Tagen offen zu stehen.
Heute ist das kaum noch zu glauben. Nach dem Schock der ersten Tage und den Nachwehen der Trauer in den folgenden Wochen schlossen sich die Ereignisse des 22. Juli, sie wurden zu etwas, worüber man sprach und worauf man verwies; sie wurden vielleicht nicht unbedingt normalisiert, aber doch zu etwas, woran wir uns gewöhnten. Breiviks Leben, durchleuchtet bis ins kleinste Detail, wurde zu etwas, was Zeitungen verkaufte, sein Gesicht zu einem Teil des kollektiven Bewusstseins. In den Medien bewegte sich der Fall rasch vom Kern der finsteren Tat zu ihren politischen und ideologischen Implikationen. Breivik wurde zu einem Symbol für etwas.
Was ist ein Symbol? Ein der Wirklichkeit beraubtes Ereignis, eine Schale aus Sinn. In Schweden sind im Laufe des vergangenen Jahres nicht wenige Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens mit Breivik verglichen worden, was nur möglich ist, wenn man den Namen Anders Behring Breivik von der Person entkoppelt, die am Nachmittag des 22. Juli in einem der Gebäude auf Utøya stand und den Jugendlichen, die sich darin aufhielten, in den Kopf schoss. Einige von ihnen standen an der Wand, andere lagen zusammengerollt wie Föten auf dem Boden, alle waren vor Furcht wie gelähmt, und die Kugeln schlugen in ihre Körper ein, sie starben dort, in Blut schwimmend, und er, Anders Behring Breivik, trat näher heran und schoss ihnen in den Kopf, ehe er sich umdrehte und auf der Suche nach weiteren Menschen, die er abschlachten konnte, das Haus verließ. Dass ihn manche mit Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens vergleichen, die eine andere Meinung vertreten als sie, ist nicht völlig unverständlich, denn wir leben in einer Zeit, in der alles, was geschieht, in Bilder verwandelt wird, die losgelöst von ihren konkreten Umgebungen am Himmel über unseren Köpfen schweben, als dieses endlose Gewimmel aus neuesten Nachrichten und prominenten Gesichtern, Leben und Schicksalen, an denen wir tagtäglich unverbindlich teilhaben, da ihre Gegenwart in unserer Wirklichkeit abstrakt ist und ebenso wenig Konsequenzen hat wie Fiktionen. Für alle außer den Betroffenen ist Utøya heute ein Teil dieser Welt.