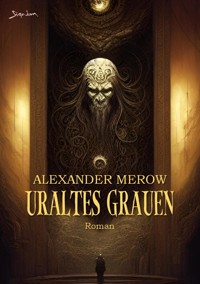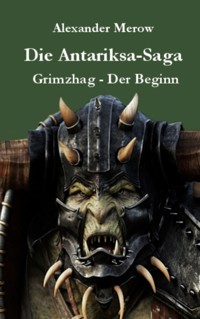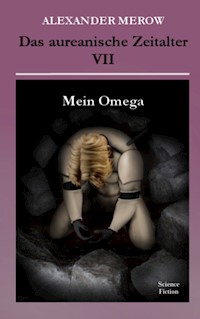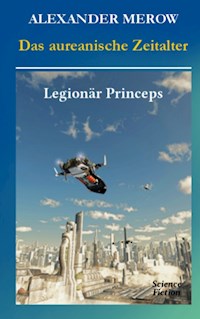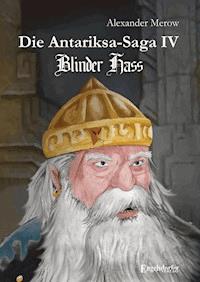Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Nach dem von Misellus Sobos eingeleiteten Magmabombenangriff ist der größte Teil von Leukos Armee vernichtet. Abgeschnitten vom Nachschub kämpfen Flavius und die letzten Loyalisten in der nördlichen Marswüste ums nackte Überleben, bedrängt von einem übermächtigen Gegner. Das nahende Ende vor Augen, verliert auch Flavius jede Hoffnung auf Rettung. Dennoch befiehlt Leukos einen Großangriff, um die feindliche Umklammerung zu durchbrechen. Mit dem Mut der Verzweiflung rückt das Loyalistenheer vor, während das Land in tödlichen Gasnebeln versinkt ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 327
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Die verlorene Armee
Verzweifelter Ausbruch
Freunde von 592
Unerwarteter Besuch
Ernüchterung
Gräuelpropaganda
Der alte Freund
Rodmillas neuer Auftrag
Blutige Säuberungen
Wiedersehen mit Eugenia
Mit dem Rücken zur Wand
Die Schlange kommt näher
Unmut im Hinterland
Den Tod im Nacken
Wofür kämpfe ich?
Guntroggs Ehrgeiz
Die Offenbarung
Die verlorene Armee
„Es ist noch schlimmer, als ich gedacht habe. Wir sind am Ende“, murmelte Aswin Leukos, während er seinen leeren Blick auf Throvald von Mockba richtete. Der Stellvertreter des Oberstrategos starrte mit versteinerter Miene zurück.
„Wie viele Soldaten sind uns wohl noch geblieben?“, fragte von Mockba dann.
Leukos Gesichtszüge spiegelten eine düstere Resignation wider. Er ließ ein Kopfschütteln folgen.
„Das kann ich nicht genau sagen. Niemand kann das. Die Überlebenden versuchen derzeit, sich zu sammeln. Anschließend werden sie sich nach Norden zurückziehen. Vielleicht sind es noch 80000 Mann. Wenn wir Glück haben, auch noch 100000. Der Rest unserer Streitkräfte ist ausgelöscht worden. Das ist die traurige Wahrheit, mein treuer Throvald.“
Leukos Raumflotte verharrte in der Nähe der Sonnenkorona, wo sie sich Schutz vor feindlicher Ortung erhoffte. Hier war die energetische Strahlung dermaßen stark, dass es den terranischen Kriegsschiffen schwerfiel, die Kreuzer der Loyalisten ausfindig zu machen. Allerdings konnte die Flotte nirgendwo allzu lange im Strahlungskranz des Gestirns bleiben, ohne selbst Schaden zu erleiden. Immer wieder musste sie sich von der gefährlichen Korona entfernen, auch wenn sie dann Gefahr lief, von den Tiefentastern ihrer Feinde aufgespürt zu werden.
Im Grunde wusste Leukos nicht mehr, was er noch tun sollte. Misellus Sobos, der Sohn des verhassten Verräterkaisers Juan Sobos, hatte den größten Teil seiner Invasionsarmee mit Magmabomben ausradiert. Und die Tatsache, dass Leukos im Gegenzug selbst Hunderttausende von feindlichen Soldaten mit seinen Raketen vernichtet hatte, änderte wenig an der katastrophalen Ausgangslage.
„Ich bin so ratlos wie noch niemals zuvor in meinem Leben. Diesmal weiß ich nicht, wie wir das Blatt noch zu unseren Gunsten wenden können. Soll ich den Rest unserer Soldaten mit den Schiffen zu retten versuchen? Sollen wir uns wieder ins Proxima Centauri System zurückziehen?“, fragte Leukos.
„Meiner Ansicht nach sollten wir uns weiter südlich ein leicht zu eroberndes Ziel suchen und uns dort einnisten“, meinte von Mockba.
Leukos sah den blonden Offizier skeptisch an. „Es wird uns nicht viel nützen, wenn wir eine Reihe kleinerer Siedlungen in unsere Gewalt bringen. Der Feind wird sich bald neu formiert haben und uns dann mit seiner Übermacht den Rest geben. Außerdem mangelt es uns an Vorräten und Kriegsgerät. Ich habe nicht damit gerechnet, dass unsere Gegner so leichtfertig Magmabomben einsetzen“, antwortete der Oberstrategos.
Langsamen Schrittes ging der General zu einem der Außenfenster auf der Kommandobrücke der Lichtweg, um hinaus in den Weltraum zu blicken. Rotgelb leuchtete die Sonne, wabernde Flammententakel tanzten auf ihrer Oberfläche wie verrückte Derwische.
„Wie viele kleine Seelen sind von unseren Magmabomben ins Jenseits geschickt worden? Zehn Millionen? Dreißig Millionen?“, flüsterte Leukos. Throvald von Mockba schwieg. Betreten sah er seinen Herrn an.
„Unsere Legionen sind vernichtet worden. Das ist das Einzige, das mich wirklich quält. Außerdem hat Misellus Sobos mit dem Wahnsinn angefangen und nicht wir“, erwiderte er daraufhin.
Leukos wandte sich seinem Stellvertreter zu. „Wir haben diesen Krieg verloren, alter Freund. Es ist vorbei.“
„So lange wir leben, kämpfen wir, Herr!“, gab von Mockba grimmig zurück.
Mit letzter Kraft rang sich Aswin Leukos ein ausdrucksloses Lächeln ab. Blutleer, bleich, hohlwangig, beinahe gräulich war sein Antlitz geworden. Traurige Augen, denen alle Hoffnung verlustig gegangen war, schauten aus dem eingefallenen Gesicht des Feldherrn hervor. Er hatte in den letzten Tagen mehrfach angedeutet, dass er daran dachte, sein Leben in absehbarer Zeit zu beenden. Bevor ihn der übermächtige Feind in die Finger bekam und ihn wie einen gefangenen Tiger in den Straßen von Asaheim vorführte, wollte er auf eine Giftkapsel beißen und den Zeitpunkt seines Endes selbst bestimmen. Die hölzernen Versuche, die sein Stellvertreter immer wieder unternahm, um das zerbrochene Gemüt seines Gebieters zu heilen, schienen nutzlos zu bleiben.
„Ich habe es zumindest mit all meinen Mitteln versucht. Das war ich Platon, dem Imperium und meiner Kaste schuldig“, wisperte sich Leukos so leise zu, dass es von Mockba nicht hören konnte. Dann schaute er wieder hinaus in den Weltraum, betrachtete die Sonne, und sein Blick versank in ihrer endlosen Glut.
Dicht gedrängt hockten die Legionäre in den finsteren Schützengräben, die sie vor ein paar Tagen in den Wüstenboden gewühlt hatten. Flavius, Kleitos und Zenturio Sachs saßen vor einem Thermostrahler und starrten die flackernden Fusionslichter im Inneren des zylinderförmigen Gerätes an. Sie schwiegen. Angst regierte in den Reihen derer, die die Magmabombenhölle überlebt hatten.
Derweil begannen die Schatten der Abenddämmerung über das hastig ausgehobene Grabensystem zu kriechen. In alle Himmelsrichtungen erstreckte sich das Netzwerk aus Befestigungen und Kampfstellungen, welches die letzten Kämpfer der Loyalistenarmee angelegt hatten.
„Dort oben ist wieder so ein Ding!“, sagte Flavius und deutete zum Himmel.
Kleitos und Manilus Sachs hoben ihre Köpfe; über ihnen zog eine unbemannte Flugdrohne ihre Bahnen.
„Sie behalten uns immer im Auge, diese Klonschweinficker“, brummte ein rothaariger Legionär, der sich neben Kleitos auf eine Metallkiste gesetzt hatte.
Flavius stand auf, er drückte den Rücken durch und hörte seine Wirbelsäule knacken.
„Wo willst du hin, Princeps?“, wollte Sachs wissen.
„Will mir bloß ein wenig die Beine vertreten. Muss mich bewegen.“
„Ich kann fast überhaupt nicht mehr schlafen, obwohl ich so erschöpft bin, dass ich eigentlich tot umfallen müsste. Das hier oben gibt mir den Rest. Selbst auf Colod habe ich mich nicht so elend gefühlt“, meinte Sachs.
Flavius fummelte an dem zerkratzten Brustpanzer seiner Legionärsrüstung herum. Inzwischen war sein Körperschutz stark ramponiert. Zahlreiche Risse und Schrammen bedeckten die Panzersegmente, überall blätterte die Farbe ab.
Kleitos Jarostow, der bullige Legionär aus dem hyboranischen Norden, blieb indes im Graben bei den anderen Soldaten, während Manilus Sachs seinem jungen Freund folgte. Stumpfsinnig glotzte Kleitos auf den pulsierenden Leuchtkern des Thermostrahlers, der mitten im Grabendurchgang stand. So war es bereits seit Tagen. Zwar hatten die Angriffe der Optimaten erst einmal aufgehört, nachdem Aswin Leukos dem Feind bewiesen hatte, dass auch er bereit war, Magmabomben einzusetzen, doch änderte dies nicht viel an den Machtverhältnissen auf dem Mars.
Den ausgehungerten Resten des Loyalistenheeres stand nach wie vor eine unüberwindlich erscheinende Übermacht feindlicher Truppen gegenüber.
„Wenn ich doch nur eine einzige Nachricht verschicken dürfte. Nur einmal meinen Kommunikationsboten rausholen, um meinen Eltern mitzuteilen, dass ich noch am Leben bin“, sagte Flavius.
„Das würde ich meinen Kindern auch gerne sagen, Princeps. Aber meine verfluchte Ex-Frau hat mir damals nicht einmal ihre Verbindungscodes hinterlassen“, erwiderte Manilus mit einem bitteren Grinsen.
„Naja, vielleicht ist es besser, wenn auch ich keinen Kontakt zu meinen Eltern aufnehme. Abgesehen von der Tatsache, dass man mir den Kopf abreißen würde, weil ich gegen das Kommunikationsverbot des Oberkommandos verstoßen habe. Dann würde sich meine Familie doch nur falsche Hoffnungen machen, denn lebend kommen wir hier sowieso nicht mehr raus.“ Princeps spuckte neben sich auf den sandigen Boden, Sachs nickte wortlos.
Der Zenturio setzte sich auf einen kleinen, rotbraunen Felsen. Hier oben, in der Nähe der vereisten Polregion, war der Mars noch immer so lebensfeindlich wie in den alten Zeiten, als die Menschheit zum ersten Mal ihren Fuß auf diese Welt gesetzt hatte.
„Was soll`s. Es ist alles im Arsch. Ganz ehrlich“, fuhr Manilus mit gedämpfter Stimme fort, „wenn ich eine Möglichkeit sähe, dass wir es schaffen zu überleben, dann würde ich einfach meine Rüstung wegwerfen und versuchen, mich nach Süden durchzuschlagen. Irgendwo in einer Megastadt untertauchen und dann ab nach Terra. Vielleicht mit einem Frachtraumer oder so etwas.“
„Du denkst über Fahnenflucht nach?“, wunderte sich Flavius.
„Weiß nicht, keine Ahnung. Dieser ganze Feldzug war und ist doch nur eine Aneinanderreihung von tragischen Umständen. Ich habe den Glauben daran verloren, dass wir noch siegen können, auch wenn du das vielleicht nicht hören willst, Junge. Vermutlich kommen wir längst zu spät und das Imperium kann nicht mehr gerettet werden. Der Feind ist viel zu stark, zu mächtig für uns dumme, kleine Soldaten.“
„Was würde Gutrim Malogor jetzt sagen? Auch er stand mehrmals am Abgrund, doch hat er niemals aufgegeben“, sagte Princeps.
„Malogor?“, zischte Sachs mit einem gehässigen Lachen auf den Lippen. „Der ist seit Jahrhunderten nur noch ein Haufen zerbröselter Knochen. Also sagt er gar nichts mehr. Die alten Geschichten können uns hier oben nicht helfen. Im Grunde konnten sie das noch nie.“
„Vielleicht hast du Recht“, murmelte Flavius und strich sich nachdenklich eine Haarsträhne von der Stirn. Er ging noch ein wenig von der Grabenanlage weg und sah hinauf zum dunklen Nachthimmel, an dem die Sterne stets auf die gleiche Weise leuchteten.
Plötzlich stand Sachs hinter ihm, der Hüne legte ihm die Hand auf den Schulterpanzer und blickte ihn ernst an.
„Nach wie vor bin ich dein Vorgesetzter, Princeps. Du hast also die Worte eben niemals aus meinem Mund gehört“, knurrte der Zenturio.
Flavius drehte sich um. „Glaubst du vielleicht, dass ich das einem der Legaten erzählen würde? Ich verstehe doch nur zu gut, wie du dich fühlst. Mir geht es nicht anders, wenn ich ehrlich bin. Manchmal bin ich so deprimiert, dass ich mir am liebsten einen Blaster an den Schädel halten würde. Alles, was wir aufgebaut haben, die ganzen Siege auf Thracan – alles ist umsonst gewesen. Diese Ratten haben uns mit ihren Magmabomben kalt erwischt, sie haben unsere Streitkräfte einfach ausgelöscht, als hätten sie nie existiert.“
„Ich wollte das auch nur gesagt haben!“, meinte Sachs. Der breitschultrige Offizier mit dem kantigen Gesicht trottete wieder in Richtung der Grabenanlage davon. Traurig sah ihm Flavius nach. Er tastete nach dem Griff seines Gladius und fragte sich, wie es wohl wäre, wenn er sich damit selbst die Kehle aufschlitzte.
„Dann wäre es zumindest endlich vorbei…“, sprach er kaum hörbar in die kalte Dunkelheit, die allmählich in jeden Winkel des Grabensystems zu kriechen begann.
Dem Magmabombenabwurf des Feindes waren Verzweiflung und Mangel gefolgt wie Haie einem blutenden Beutetier. Misellus Sobos, der verdorbene Sproß des Archons, hatte wider allen Erwartungen ohne zu zögern mit dem Einsatz von Massenvernichtungswaffen reagiert, um die Loyalistenrevolte im Keim zu ersticken. Dabei hatte der Statthalter des Mars jedoch nicht nur Zehntausende von Legionären, sondern auch unzählige Einwohner der Megastädte Crathum, Brisk und Daahl mit in den Tod gerissen.
Mehrere Millionen imperiale Bürger waren von den Flammenmeeren der schrecklichen Bomben bei lebendigem Leib geröstet worden. Ganze Stadtteile sahen aus, als hätte sie der Teufel selbst mit seinem Höllenfeuer versengt. Auch Flavius und Kleitos, die die Katastrophe nur durch eine Reihe glücklicher Zufälle überlebt hatten, waren noch immer vollkommen traumatisiert.
Jetzt wartete auf sie ein qualvolles Dahinsiechen in der trostlosen Marswüste des Nordens. Jeder Tag, den sie in diesem grimmigen Ödland verbringen mussten, war eine erneute Tortur. Auf sich allein gestellt, abgeschnitten von Nachschub, Rettung und Hoffnung. Über den Köpfen der Legionäre flogen die feindlichen Drohnen dahin, während alle froren und litten. Die Spähflieger beobachteten die Todgeweihten wie Raubvögel und gaben ihnen zugleich das allgegenwärtige Gefühl, dass es vor dem endgültigen Untergang kein Entrinnen mehr gab.
Flavius haderte mit seinem Schicksal und dachte häufig daran, sich das Leben zu nehmen, um die grausame Welt endlich hinter sich zu lassen. Um ihn herum entschlossen sich mit jedem verstreichenden Tag weitere Kameraden, der Hölle des Krieges durch Selbsttötung zu entfliehen. Sie schluckten Gift oder jagten sich einen Blasterstrahl durch den Schädel. Kein Befehl und keine noch so grausame Strafe konnten diese Verzweifelten daran hindern, dem Verhungern und Verrecken in der Nordwüste durch den Freitod zuvor zu kommen.
Welche Hoffnung sollte es jetzt noch geben? Diese Frage zerfraß nicht nur Princeps Verstand, sondern peinigte jeden Legionär, der es bis zum roten Planeten geschafft hatte, nur um hier erbärmlich zu Grunde zu gehen. Weiter im Süden wartete der Feind. Er sammelte sich erneut, denn die Legionen, die Leukos im Gegenzug mit seinen Magmabomben vernichtet hatte, konnten mühelos durch neue ersetzt werden.
Draußen, nahe der Sonne, stand die Kriegsflotte des Oberstrategos, doch auch sie hatte nicht die Macht, das Blatt noch zu wenden. Die Loyalisten befanden sich in einer so gut wie ausweglosen Lage. Doch Gnade wollte ihnen Juan Sobos nicht gewähren, das hatte er bereits öffentlich verkündet. Die als Verbrecher gebrandmarkten Legionäre des Leukos würden keine Chance auf Vergebung erhalten. Sobos schien den Untergang seiner Feinde sogar noch hinauszögern zu wollen, dachte Flavius manchmal, wenn ihn die Verzweiflung wie ein dunkler Schleier einhüllte und er den Tod regelrecht herbeisehnte. Man würde sie in dieser schrecklichen Wüste langsam und qualvoll sterben lassen, während das gesamte Goldene Reich dabei zusah. Satte und zufriedene Aureaner würden vor ihren Simulations-Transmittern sitzen und allabendlich verfolgen, wie Leukos letzte Soldaten nach und nach in ihren Gräben verhungerten, erfroren und krepierten.
Noch rang Flavius in seinem Inneren mit den Dämonen, die ihm einflüsterten, dass ihm der Selbstmord endlich den so lang ersehnten Frieden schenken würde, doch spürte er, wie sein Wille täglich ein wenig schwächer wurde. Die Priester in den Tempeln Terras verurteilten den Suizid als Todsünde gegen die göttliche Ordnung, während ihn Malogor als ehrlos verachtet hatte. Wenn schon, so hatte es der große Führer der aureanischen Kaste einst gepredigt, müsse ein Mann aufrecht und kämpfend untergehen.
Flavius Glaube aber war brüchig geworden. Er fühlte sich ausgebrannt und leer, hilflos und von allem Glück verlassen. Seit Jahren kämpfte er nun schon unter den Standarten der Legion für das Goldene Reich, doch hatte er für alle seine Opfer niemals Dank erfahren und war allmählich nicht mehr bereit, noch mehr Leid zu erdulden.
Sollten die Aureaner doch untergehen! Warum sollte er weiter für sie kämpfen, wenn es sie nicht einmal interessierte? Sollten diese dekadenten und übersättigten Goldmenschen doch ihr eigenes Grab schaufeln, indem sie Sobos tatenlos gewähren ließen. Sie waren instinktlos, ehrlos und erbärmlich geworden, dachte Flavius voller Ingrimm, wenn sein Magen knurrte und er wie eine Ratte in einem Grabenloch hausen musste. Das war das Schlimmste für den leidgeprüften Kohortenführer. Die Ignoranz seiner eigenen Kastenbrüder, für deren Zukunft Flavius schon so oft sein Leben eingesetzt und unzählige Male im mörderischen Feuer gestanden hatte.
Kleitos, Flavius bester Freund, hatte sich in den letzten Monaten ebenfalls verwandelt. Er war eine zutiefst verbitterte und zynische Gestalt geworden, der längst alles egal war. Das Goldene Reich, Malogors Gebote oder irgendwelche Sprüche von Soldatenstolz und Ehre interessierten Jarostow nicht mehr. Das einzige, was ihn daran hinderte, sein Gladius fort zu werfen und durch die Nordwüste zu fliehen, war die Tatsache, dass ihn die Feinde mit hoher Wahrscheinlichkeit sofort töten würden, wenn sie ihn in die Finger bekamen. Somit hielt es Kleitos dann doch für besser, die Möglichkeit zu haben, sich selbst den Blaster an den Kopf halten zu können, wenn das Dahinsiechen unerträglich geworden war. Und dieser finstere Tag würde nicht mehr allzu fern sein, hatte Jarostow seinem Freund Flavius bereits gestanden. In seinen Augen gab es keine Hoffnung mehr auf Rettung, was bedeutete, dass der Tod bereits auf der Türschwelle stand. Die Frage war bloß, wann er seine Sense niedersausen ließ.
Das speckige Gesicht des Archons füllte den holographischen Bildschirm beinahe gänzlich aus. Misellus Sobos, der älteste Sohn des Kaisers und Statthalter des Mars, biss sich auf die Unterlippe, während ihn sein Vater mit grenzenlosem Zorn anstarrte. Juan Sobos Gesicht glich einer gewaltigen, rot angelaufenen Melone; der Imperator fletschte die Zähne, sein Zeigefinger schoss gleich einem Speer nach oben.
„Du musst vollkommen wahnsinnig geworden sein, du elender Schwachkopf!“, schrie er. „Wie konntest du so dumm sein und diese verdammten Magmabomben einsetzen?“
Misellus versuchte, der geballten Aggression, die ihm aus dem vor seinen Augen schwebenden Bildschirm entgegenströmte, irgendwie standzuhalten. Instinktiv ging er ein paar Schritte zurück, der böse Blick seines Vaters folgte ihm wie ein Meuchelmörder seinem Opfer.
„Sag etwas, du wertloser Haufen Scheiße!“, kreischte der Archon.
„Ich wollte…ich wollte…“, stammelte Misellus. „Ich wollte die Propagandasendungen, die Leukos ausstrahlt, endlich zum Schweigen bringen. Diese Rebellion sollte im Keim erstickt werden, bevor sie sich noch weiter ausbreitet…“
„Und dabei hast du gleich drei Megastädte mit Magmabomben in Schutt und Asche gelegt? Du bist noch viel dümmer, als ich es jemals für möglich gehalten habe, Misellus!“
„Aber was hätte ich denn tun sollen? Leukos Soldaten hatten sich dort oben im Norden eingegraben, die Vorräte aus den Megastädten hätten sie viele Jahre lang ernähren können. Außerdem hat Leukos doch auch Magmabomben eingesetzt“, verteidigte sich der Statthalter des Mars verzweifelt.
„Du elender Drecksack hast aber damit angefangen!“, donnerte Juan Sobos dazwischen.
„Wir können doch alles Leukos in die Schuhe schieben. Immerhin kontrollieren wir Optimaten die Transmitter-Netzwerke und können alles so darstellen, wie wir es brauchen.“
„Pah!“, keifte der Archon voller Verachtung für die Kleingeistigkeit seines Erben.
„Dein Fehler ist kaum wieder gut zu machen, du Hohlkopf! In den Kommunikationsnetzwerken des gesamten Sol-Systems redet man jetzt schlecht über mich. Und erst recht über dich, Misellus. Die breite Masse der Aureaner sieht es nämlich nicht gern, wenn Millionen Zivilisten durch Magmabomben getötet werden. Solche Waffen setzt man nur im äußersten Notfall ein, aber nicht, wenn man zu faul ist, ein paar Schützengräben zu berennen.“
„Ich denke, dass ich gar nicht so falsch gehandelt habe“, antwortete der älteste Sohn des Kaisers, während er sich bemühte, seinen Trotz wieder zu finden.
„Du sollst nicht denken, sondern nachdenken!“, schrie Juan Sobos. „Unser Regiment soll ein Regiment des Friedens sein! Deshalb setzen wir auch keine Magmabomben ein, außer der Feind hat damit angefangen! Diese Einfältigkeit musst du von deiner Mutter geerbt haben, dieser debilen Fotze! Hätte ich mein Schwanzstück damals doch in eine intelligentere Nobile gesteckt!“
Misellus richtete seinen ängstlichen Blick zu Boden. Er stieß ein unwilliges Brummen aus, wagte es jedoch nicht noch einmal, seinem wütenden Vater zu widersprechen.
„Ich werde tun, was ich kann, um unser Ansehen zu retten. Wir stehen erst am Beginn unserer Herrschaft, mein Sohn, was bedeutet, dass sich die Leute unter unserem Regiment wohlfühlen sollen. Allerdings passen Magmabomben nicht zu der Atmosphäre aus Frieden und Wohlstand, die ich zu schaffen gedenke.“
Die Gesichtszüge des Archons entspannten sich. Plötzlich lächelte er und wirkte dabei wieder etwas gelöster. Er nickte seinem Sohn zu und dieser nickte zurück. Dann faltete der Kaiser die Hände, wobei er den Kopf ein wenig nach hinten schnellen ließ.
„Misellus, das sage ich dir jetzt nur ein einziges Mal. Ich habe genug Söhne gezeugt, dass ich auf einen Idioten wie dich verzichten kann, wenn es sein muss. Wenn du erneut eine solche Scheiße hinterlässt, dann lasse ich dich für immer verschwinden. Hast du das verstanden?“, sagte der Imperator mit eisiger Ruhe.
Indes wich die Farbe aus dem Gesicht seines ältesten Sprösslings, während Misellus ein gewaltiger Kloß die Luft zum Atmen nahm. Bevor er noch etwas entgegnen konnte, wischte der Kaiser den holographischen Bildschirm aus der Luft.
Misellus Sobos griff sich an die Kehle und riss den Mund auf. Entsetzt ließ er sich auf einem Prunksessel nieder, wo er apathisch ins Leere starrte. Der dickliche Statthalter des Mars kämpfte gegen die aufkommende Panik an, doch es gelang ihm nicht, sie noch länger zurückzuhalten. Keuchend schnappte er nach Luft, während sein Herz zu hämmern begann und sich kleine Schweißtropfen auf seiner Stirn bildeten.
Sein Vater war niemand, der einen Fehler zwei Mal tolerierte oder es nur bei leeren Drohungen beließ. Das wusste der älteste Sohn der Sobos Sippe besser als jeder andere. Was der Archon soeben gesagt hatte, war mehr als bloß eine kleine Warnung gewesen, denn Misellus war klar, wozu sein Erzeuger fähig war. Skrupel und Gewissensbisse waren dem neuen Herrscher des Goldenen Reiches fremd.
Im Hintergrund summten die Datenaufzeichner und Analysegeräte. Eugenia Gotlandt hatte sich längst an die ewig gleich klingende Geräuschkulisse in Dr. Phyrrus Praxisraum gewöhnt. Die dunkelhaarige Krankenschwester mit den himmelblauen Augen und dem hübschen, schmalen Gesicht hatte in dieser Kammer schon Jahre ihres Lebens verbracht. Mittlerweile kam es Eugenia so vor, als ob sie schon seit einer halben Ewigkeit im Inneren der Polemos verharrte.
Das riesenhafte Lictor Schlachtschiff stand seit Wochen im Sonnenorbit und ruhte nahe der Gluthitze wie ein schlafender Titan im All. Flavius, der Mann, den Eugenia über alles liebte, kämpfte derweil auf dem roten Planeten; einer Welt, die schon vor langer Zeit nach dem Kriegsgott eines längst ausgestorbenen Urmenschenstammes benannt worden war.
„Woran denken Sie, Fräulein Gotlandt?“, vernahm Eugenia die Stimme von Dr. Phyrrus, der hinter ihr an einem Schreibtisch saß und nanomolekulare Strahlungsmuster begutachtete.
„Ach, an nichts…“, murmelte Eugenia.
„Nichts?“
„Immer das Gleiche. Ich würde dieses Schiff einfach gerne einmal verlassen dürfen.“
Dr. Phyrrus lachte leise. „Seit Jahrzehnten bin ich Arzt bei der Flotte. Diesen Beruf zu wählen, war damals eine Lebensentscheidung gewesen. Ich entschloss mich einst, im Inneren eines Raumschiffes durch die Weiten des Kosmos zu fliegen und endlose Jahre in Kälteschlafkammern zu verbringen. Alles schon lange her, damals war ich noch jung und ehrgeizig und recht naiv. Naja, aber was soll`s. Es ist jetzt nicht mehr zu ändern.“
Eugenia sagte nichts. Schweigend und in sich gekehrt sortierte sie medizinische Geräte.
„Inzwischen kenne ich Sie lange genug, Fräulein Gotlandt. Leider kann auch ich nicht sagen, ob Flavius noch am Leben ist. Es ist für uns alle eine Katastrophe gewesen. Magmabomben! Nur Geisteskranke tun so etwas!“, sagte Dr. Phyrrus zerknirscht.
Eugenia wischte sich eine Träne aus dem Augenwinkel. Die Ungewissheit war das Schlimmste. Kontakt zu den auf dem Mars befindlichen Soldaten war nur auf Kanälen erlaubt, die Aswin Leukos persönlich freigegeben hatte, da die Abhörgefahr allgegenwärtig war. Also war es nicht möglich, Flavius per Kommunikationsboten zu rufen, wenn er denn überhaupt noch unter den Lebenden weilte. Eugenia schleuderte einen Cerebrotaster in eine Schublade und knallte sie lautstark zu. Der weißhaarige Medicus betrachtete die Krankenschwester, die zwischen Trauer und verzweifelter Wut pendelte, mit nachdenklich gerunzelter Stirn.
„Dieses Raumschiff kommt mir langsam wie ein schwebendes Gefängnis vor. Ich kann diese roten und grauen Wandverkleidungen nicht mehr sehen, ich kann diese langen Korridore nicht mehr sehen, ich kann meine Schlafkabine nicht mehr sehen und mir wird schlecht, wenn ich die wabernde Sonnenglut dort draußen betrachten muss.“ „Behalten Sie die Nerven, Fräulein Gotlandt. Wir haben doch schon die schlimmsten Krisen überstanden und werden auch diese überstehen“, antwortete der Arzt.
„Wenn ich gewusst hätte, was mich erwartet, dann hätte ich niemals eine Stelle als Krankenschwester bei der Flotte angenommen“, zischte Eugenia weinend.
Dr. Phyrrus suchte nach einer Erwiderung, die sie aufbaute, doch auch ihm, dem ansonsten so gefassten und weisen Mentor, fiel in diesem Moment nichts Passendes ein. Mit Tränen in den Augen fuhr Eugenia mit ihrer Arbeit fort.
Verzweifelter Ausbruch
„Ich bin Guntrogg. Ich bin ein Grushlogg“, kam es über die dunkelgrünen Lippen des Stammesführers.
Vor dem hünenhaften Außerirdischen hockte das Menschenweibchen, das ein paar Krieger vor einer Weile eingefangen hatten. Inzwischen war es den Geistesbegabten gelungen, mehrere Worte der Udantoksprache bezüglich ihrer Bedeutung zu entschlüsseln. Guntrogg war unglaublich stolz, dass er endlich ein paar Sätze in der vollkommen fremdartig klingenden Sprache formulieren konnte.
„Wer du sein?“, fragte der grauäugige Grushlogg und sah auf die junge Frau mit dem blonden Haar hernieder, die apathisch ins Leere stierte.
Neben Guntrogg stand einer der Grushloggdenker, der sich seit Tagen damit abmühte, hinter die Geheimnisse der Udantoksprache zu kommen.
„Die Brüterkreatur ist wieder einmal abwesend, sie hat ihren Geist erneut abgeschaltet und möchte offenbar nicht kommunizieren. Vermutlich hat sie noch immer Angst vor Euch, Wütender“, erklärte er.
„Das macht mich ärgerlich“, knurrte Guntrogg, was nicht dazu beitrug, dass sich die Gefangene entspannte.
„Mit mir hat sie heute Morgen ein paar Worte gewechselt und sogar einige Schriftzeichen aufgemalt“, sagte der Geistesbegabte.
„He, du, ich Freund“, versuchte sich Guntrogg erneut an der Udantoksprache. Sanft tippte er die Gefangene mit der Kralle seines Zeigefingers an.
Plötzlich begann die Menschenfrau zu zittern. Sie richtete den Blick auf die beiden Grushloggs, ruderte mit den Armen und kreischte: „Verschwindet endlich aus meinem Kopf! Geht aus meinem Kopf! Haut endlich ab!“
Verwirrt ging Guntrogg einen Schritt zurück, wobei seine gepanzerten Stiefel über den Metallboden des Raumes polterten.
„Dieses Geschrei tut mir in den Ohren weh! Was soll das?“, grollte der grünhäutige Nichtmensch in Richtung des Geistesbegabten. Dieser jedoch würgte lautstark, was bedeutete, dass auch er nicht wusste, was mit der Brüterkreatur los war.
„Ich glaube, dass dies eine Angstreaktion ist“, mutmaßte der schmächtige Grushloggdenker dann.
„Mein Name ist Gartha Svartbach, ich mache eine Ausbildung zur Klangwürfeltherapeutin und wohne im Habitatskomplex 56-3457 in Morapeaks. Mein Name ist Gartha Svartbach, ich mache eine Ausbildung zur Klangwürfeltherapeutin und wohne im Habitatskomplex 56-3457 in Morapeaks. Mein Name ist Gartha Svartbach, ich mache eine Ausbildung zur Klangwürfeltherapeutin und wohne im Habitatskomplex 56-3457 in Morapeaks“, wisperte die Gefangene mit leerem Blick vor sich hin, während sie wie ein panisches Tier auf dem Boden hockte.
„Jetzt reicht es mir!“, brüllte Guntrogg und ergriff das Udantokweibchen mit seiner gewaltigen Klauenhand. Er hob es hoch und schob die Fangzähne knurrend nach vorne. Doch die Gefangene erschlaffte; wie ein abgestorbenes Blatt hing sie in der Luft.
„Ihr Kreislauf ist wieder zusammengebrochen. Bitte legt die Brüterkreatur einfach auf den Rücken, sonst geht sie irgendwann kaputt“, warnte der Denker.
„Großartig!“, grummelte Guntrogg. Er ließ das Udantokweibchen auf den Boden fallen.
„Ihr dürft nicht so grob mit diesem Wesen umgehen. Es ist sehr empfindlich. Den Arm, den ihr die Krieger versehentlich gebrochen haben, habe ich inzwischen geheilt, aber trotzdem gehen diese Udantokbrüterinnen sehr schnell zu Bruch, wenn man nicht vorsichtig ist.“
„Dabei wollte ich mich bloß unterhalten!“
„Natürlich, selbstverständlich, mächtiger Brüller des Todes, aber ich bitte um etwas Geduld. Ich habe den Eindruck, dass das Exemplar noch ein wenig unter Schock steht. Wir Grushloggs sind für sie eine völlig fremde Art“, appellierte der Geistesbegabte an die Empathie seines Gebieters.
„Fremde Art? Pah! Wir sind Grushloggs! Sehen wir vielleicht nicht normal aus? Ich wollte mich bloß mit dem Wesen unterhalten“, schimpfte der Stammesführer vor sich hin.
„Nicht jede Spezies freut sich über den Besuch einer anderen. Diese Udantok haben offenbar noch keinen Kontakt zu anderen Arten gehabt, das ist das Problem. Unser Anblick ist für das Weibchen ungewohnt“, erläuterte der Geistesbegabte.
„Auch wenn wir anders aussehen, heißt das nicht, dass man unhöflich sein muss!“, brüllte ihn Guntrogg an. Dann versetzte er der schmächtigen Grünhaut einen Schubs, so dass sie gegen die Wand torkelte und vor Schmerzen aufheulte.
„Diesem Wesen, das scheinbar den Namen „Gartha“ hat, solltet ihr nicht mit Geschrei und Drohgebärden gegenübertreten. Davon kann ich wirklich nur abraten, allmächtiger und unbezwingbarer Gebieter.“ Der Denker machte zahlreiche Beschwichtigungsgesten und stieß eine Reihe von Brummlauten aus.
„Ich wollte mich bloß unterhalten und habe auch nicht gebrüllt!“, kam zurück. „Zumindest nicht sonderlich laut!“
„Äh, nein…ich meine…ja…“, stammelte der Geistesbegabte und bemühte sich, beruhigend auf seinen Herrn einzuwirken. „Achtet in Zukunft einfach noch etwas mehr darauf, mit sanfter und ruhiger Stimme zu dem Udantokweibchen zu sprechen. Und hebt es bitte nicht einfach hoch. Ich fürchte, diese Wesen sind nicht sonderlich stabil.“
Guntrogg schob den Unterkiefer knurrend nach vorne und seine hellgrauen Augen leuchteten bedrohlich in Richtung des Denkers. Ohne noch etwas zu sagen, stampfte der hünenhafte Stammesführer aus dem Raum heraus und ließ seinen Artgenossen mit der gefangenen Menschenfrau allein.
Sechs weitere Wochen, in denen die Legionäre der Loyalistenarmee in ihren Stellungen gefroren und gehungert hatten, waren verstrichen. Inzwischen hatte Leukos den Energieknoten Rothkamm räumen lassen. Aufgrund der feindlichen Übermacht, die sich rund um den Reaktorkomplex postiert hatte, war es unmöglich geworden, das Objekt noch länger zu halten. Rothkamm war in einer gewaltigen Magmabombenexplosion vergangen, was bedeutete, dass der Energieknoten nun auch für den Gegner keinen Wert mehr hatte.
Derweil grübelten Aswin Leukos und seine Offiziere darüber nach, wie sie ihre verbliebenen Soldaten vor dem endgültigen Untergang bewahren konnten. Doch guter Rat war teuer. Etwa 30 Marslegionen und eine Viertelmillion Milizsoldaten hatten damit begonnen, die Grabensysteme der Loyalisten weiträumig zu umschließen. Eingekesselt und ohne ausreichenden Nachschub war es nur noch eine Frage der Zeit, bis Leukos Truppen vernichtet waren. Jeden Tag hämmerte ein unbarmherziges Artilleriefeuer auf die Stellungen der Eingeschlossenen ein, während Hunger, Durst und Entkräftung ihre ersten Opfer forderten. Zudem hatte Juan Sobos den einfachen Legionären in Leukos Heer plötzlich doch zugesichert, dass sie verschont würden, wenn sie freiwillig die Waffen streckten. Diese scheinbare Milde zerfraß die Moral der Legionäre wie eine ätzende Säure und machte Leukos mehr zu schaffen als die katastrophale Versorgungslage selbst. Verrat und Fahnenflucht waren nach sechs Wochen an der Tagesordnung; daran änderten selbst drakonische Strafen, brutale Dezimierungen oder öffentliche Erschießungen wenig.
Der Oberstrategos musste versuchen, den Kessel, den die Marslegionen um seine verbliebenen Streitkräfte gelegt hatten, irgendwie zu durchbrechen. Nur im Angriff konnte überhaupt noch ein Funken Hoffnung liegen. So rang sich der terranische General schließlich zu einer schweren Entscheidung durch und setzte, den drohenden Untergang vor Augen, alles auf eine Karte.
Dutzende Caedes Bomber verließen die Loyalistenschiffe, die sich noch immer in der Nähe der Sonne aufhielten, um den Mars anzufliegen und eine furchtbare Saat des Verderbens abzuwerfen. Sie trugen eine Fracht zum roten Planeten, die im ganzen Goldenen Reich das Sinnbild des Grauens war; Bomben, die tödliche, alles Leben erstickende Gasnebel entfachen konnten.
Als sich die heulenden Ceades Bomber aus dem trüben Marshimmel hinab in die Tiefe warfen und ihre Geschosse niederregnen ließen, trafen sie die siegessicheren Streitkräfte der Optimaten hart. Den Explosionen der Bomben folgte ein Gasnebel, der sich mit rasender Geschwindigkeit in alle Richtungen ausbreitete und gleich einem riesenhaften Leviathan die feindlichen Soldaten zu Tausenden verschluckte. Bald waren ganze Frontabschnitte unter einer gelblichen Giftwolke verschwunden und das Massensterben setzte ein. Würgend, keuchend und hustend verreckten ganze Legionen auf einen Schlag. Alles versank unter einer Gasglocke, die sich viele Kilometer weit aufblähte und am Ende ein gewaltiges Grab hinterließ.
Das Risiko, das die Optimaten als Rache für diesen Vernichtungsschlag nun selbst Magmabomben oder Giftgas einsetzten, ging Leukos diesmal bewusst ein. Er wusste, dass seine Soldaten der feindlichen Übermacht ohne den Einsatz derartiger Mittel nichts mehr entgegensetzen konnten.
Schließlich fraßen sich die gelblichen Gasnebel durch die Abwehrfront, die Antisthenes rund um die loyalistischen Stellungen aufgebaut hatte. Ihre tödlichen Schwaden griffen mit ihren Nebelfingern nach Abertausenden von Legionären, um sie hinab in die Hölle zu ziehen. Aswin Leukos dachte noch immer nicht daran zu kapitulieren. Schließlich gab er seinen Soldaten den Befehl, einen letzten Ausbruch aus der Umklammerung zu wagen.
„Diese Tropfen sind nutzlos! Ich bin noch immer total wütend!“, brüllte Guntrogg, wobei er wie ein Grizzlybär durch den Raum stampfte.
„Mächtiger und übellauniger und größter Kriegsherr und so weiter, es dauert immer eine Weile, bis die Substanz zu wirken anfängt“, wimmerte ein zutiefst eingeschüchterter Geistesbegabter, der sich hinter einer Maschine versteckt hatte; hoffend, vor der Wut seines Herrn in Sicherheit zu sein.
„Sie töten sich gegenseitig mit Feuerbällen, aber richtig kämpfen wollen sie nicht mehr! Diese Udantok benehmen sich wie feige Snags und wir können hier untätig warten! Und ich rege mich schon wieder auf! Alles die Schuld der Weichfleischigen!“
„Ihr habt ja so recht, Gewalttätiger. Ihr habt immer Recht, ganz ehrlich…“, ertönte eine zaghafte Stimme hinter der Maschine.
„Und wann wirken diese Beruhigungstropfen?“
„Sie müssten jeden Moment anfangen zu wirken, mächtiger und mutiger Guntrogg.“
„Aber davon merke ich nichts!“, schrie der Stammesführer. Mit polternden Schritten kam er auf die Maschine zu, beugte sich herab und ergriff den zitternden Grushloggdenker mit seiner Pranke. Dann zog er den vor Angst laut schnaufenden Geistesbegabten hoch.
Guntrogg schnappte sich die Vibrationssichel, die an seinem Rückenpanzer hing, und fuchtelte damit vor den Augen des schmächtigen Heilkundigen herum. Dieser stieß einen langgezogenen Klagelaut aus.
„Ich bin kein Denker, sondern ein Krieger! Ich muss kämpfen, aber die Udantok verkriechen sich in ihren Höhlen! Und das, obwohl wir eine so weite Strecke geflogen sind, um sie zu besuchen und gegen sie zu kämpfen! In was für Zeiten leben wir eigentlich?“, grollte der monströse Grushlogganführer.
„Aber ich kann doch nichts dafür. Ich bin nur ein harmloser Diener, übermächtiger Tyrann zwischen den Sternen“, winselte der Denker.
Guntrogg schleuderte ihn zur Seite, so dass er mit dem Rücken gegen die Maschine krachte. Vor Schmerz jammernd blieb der Heilkundige auf dem Boden liegen.
„Ich will, dass der Krieg der Udantok weiter geht! Ich will, dass sie endlich gegeneinander kämpfen! Ich will, dass sie sich endlich ehrenvoll verhalten!“
„Ja, dafür habe ich das vollste Verständnis, Wütender.“
„Und wann wirken diese verdammten Tropfen?“
„Eigentlich…eigentlich hätten sie längst wirken müssen, großer Guntrogg.“
„Und warum passiert dann nichts?“
„Ich kann es mir nicht erklären. Vielleicht war die Dosis nicht hoch genug.“
„Allerdings sind allein die Udantok an meiner schlechten Laune schuld! So unausgeglichen bin ich sonst nie!“ Guntrogg trat gegen die Maschine aus schwarzem Metall. Krachend brach ein Stück ihrer Verkleidung ab und fiel scheppernd auf den Boden.
„Nein, natürlich nicht! Was immer Ihr sagt, unbesiegbare Faust!“
„Was meinst du damit, Weitdenker? Hältst du mich für einen Snag?“
„Ja…ich meine…nein…auf gar keinen Fall, Gebieter…“, rief der Geistesbegabte entsetzt, während er langsam in Richtung Ausgang kroch.
Plötzlich jedoch ließ Guntrogg die Arme sinken. Er begann schwer zu atmen und brummte leise. Entspannt entblößte der Stammesführer seine Fangzähne, dann hielt er sich verdutzt den Kopf.
„Was ist denn jetzt passiert?“
„Das sind die Tropfen. Sie wirken beruhigend“, erklärte der Grushloggdenker, dem buchstäblich ein Stein von seinen zwei Herzen fiel.
„Muss mich setzen.“ Guntrogg ließ sich neben der zertrümmerten Maschine nieder, er stöhnte und sah sich verwirrt um.
„Alles gut, es sind die Tropfen. Endlich beruhigt Ihr Euch, Mächtiger“, sprach die heilkundige Grünhaut mit sichtbarer Erleichterung.
„Wie lange bleibt das denn so?“
„Das kann jetzt eine kleine Periode dauern, Herr.“
„Aha…“ Auf einmal wirkte Guntrogg regelrecht benebelt. Seine lilafarbene Zunge hing ihm seitlich aus dem Maul heraus. Brummend legte er sich auf den Rücken und schloss die Augen.
„Preiset die Höheren! Endlich wirkt das Zeug“, flüsterte sich der Geistesbegabte selbst zu, während er auf seinen Gebieter zuging.
Im nächsten Augenblick schob sich die Tür des Raumes auf und der Denker drehte sich verdutzt um. Ein Rottenführer in voller Kampfrüstung kam in die Kammer hineingestürmt, er gestikulierte wild mit den Armen. Es war Craglakk, Guntroggs bester Kriegerfreund.
„Die Udantok haben wieder angefangen, gegeneinander zu kämpfen! Es geht los! Es geht los!“, schrie er völlig euphorisch.
„Das darf doch nicht wahr sein“, sagte der Geistesbegabte entnervt.
Craglakk deutete auf seinen Herrn, der reglos auf dem Boden lag und sich nicht mehr rührte.
„Er hat Rullgtropfen bekommen, damit er sich beruhigt“, erläuterte der Denker.
„Beruhigt? Guntrogg muss kämpfen! Die Horde wartet!“, brüllte Craglakk.
„Langsam reicht es mir!“, giftete der Heilkundige zurück, um an dem Rottenführer vorbei zu rennen.
„Wo willst du hin, Tiefdenker?“, wollte Craglakk wissen.
„Ich hole etwas, damit unser Gebieter wieder auf die Beine kommt.“
„Was ist denn mit Guntrogg los?“
„Das geht niemanden etwas an. Als Heilkundiger bin ich verpflichtet, bei solchen Fragen das Maul zu halten.“
„Aber hoffentlich nichts Ernstes, oder?“, meinte Craglakk.
Der Geistesbegabte würgte verneinend, um sich dann schnellen Schrittes zu entfernen.
„Nein, nur das Übliche, sonst nichts!“, rief er, als er verschwand.
Der Großangriff hatte begonnen. Wieder einmal stellte sich Flavius die Frage, ob es nicht besser gewesen wäre, wenn er sich einen Blasterstrahl durch den Schädel gejagt hätte. Dann wäre der endlose Wahnsinn zumindest vorbei, haderte er mit sich selbst.
Im Laufschritt rückten die Legionäre vor und Zenturio Sachs befahl, weiterhin eine lockere Formation beizubehalten. Inzwischen war der Biophagingasnebel nicht mehr tödlich, was bedeutete, dass die Filterungsanlagen im Inneren der Legionärshelme ausreichten, um den Soldaten atembare Luft zu schenken. Unmittelbar neben Princeps rannte Kleitos mit erhobenem Schild und entsichertem Blaster durch den milchigen Nebel, der nach dem Gasangriff übrig geblieben war.
Schließlich erreichten die Männer den ersten Graben. Rund um die Stellungen lagen Dutzende von toten Milizsoldaten und Legionären. Eine ganze Woche lang hatten die Gasschwaden wie eine todbringende Glocke über diesem Gebiet gehangen und jedes Leben auf dem Boden ausgelöscht. In einem Umkreis von fast zehn Kilometern regte sich nichts mehr.
Verstört schritt Flavius an noch mehr Toten vorbei. Überall lagen feindliche Legionäre, die sich in ihrer Panik an die Hälse gegriffen hatten, nur um qualvoll an den Blutströmen aus ihren aufgeplatzten Lungen zu ersticken. Das hochgiftige Biophagingas, welches tagelang über einem Gebiet stehen konnte, bevor es sich wieder langsam zersetzte, hatte einst Gutrim Malogor benutzt, um die Anaureanerstämme auf der pontischen Halbinsel auszurotten. Er hatte die schrecklichen Giftnebel ganze Landstriche bedecken lassen und sie dadurch innerhalb weniger Tage entvölkert. Jetzt sah Flavius, der in einem Geschichtsbuch etwas darüber gelesen hatte, mit eigenen Augen, was es bedeutete, Biophagingas einzusetzen.
Mehrere Plasmageschütze standen herrenlos jenseits der Grabenstellungen. Dahinter lagen die Geschützbesatzungen zusammengekrümmt auf dem Boden. Flavius erinnerten die seltsam verdrehten Toten an Säuglinge im Mutterleib.
„Das Gas hat unglaublich gewütet. Ich hoffe nur, dass wir hier heil durchkommen“, hörte Flavius seinen Freund Manilus auf dem persönlichen Vox-Kanal sagen.
„Ich hätte auch nicht gedacht, dass dieses Gift dermaßen effektiv ist. Hier lebt nicht einmal mehr eine Maus. Ein echtes Teufelszeug. Aber so lange es nicht unsere Lungen zerfrisst…“, antwortete Princeps.
„Hauptsache, es gelingt uns endlich, aus diesem Kessel herauszukommen. Doch das steht noch in den Sternen, selbst wenn der Feind hier vernichtet worden ist“, sagte Sachs, um den Kommunikationskanal dann wieder zu schließen.
Die loyalistischen Legionäre kletterten noch eine halbe Stunde lang über verlassene Gräben und Stellungen, wobei sie über die Toten stiegen, die den Boden zu Hunderten bedeckten. Noch immer stand ein verdünnter Gasnebel über dem Gebiet und Flavius erschauderte bei dem Gedanken, was die Giftschwaden auch mit ihm anrichten würden, wenn sie hochkonzentriert waren.
Als Princeps und seine Kameraden bereits glaubten, dass sie es aus dem Belagerungskessel heraus schaffen konnten, wurden sie plötzlich eines Besseren belehrt. Es ging alles dermaßen schnell, dass die meisten Legionäre nicht einmal begriffen, was um sie herum geschah.
„Sucht euch irgendwo Deckung! Schnell!“, schrie ein Veteran direkt hinter Flavius und fuchtelte mit dem Gladius herum.
Princeps drehte sich um, rannte los und sprang in einen der Gräben hinein. Er landete zwischen ein paar toten Milizsoldaten; Kleitos rutschte neben ihm durch den Staub. Schon in der nächsten Sekunde brach die Hölle los. Ungezählte Plasmagranaten hagelten vom Himmel herab, sonnenheiß glühende Wolken breiteten sich zwischen den Legionären aus und der Boden erbebte unter den Einschlägen. Irgendwo ertönten langgezogene, gequälte Schreie, Steine und Erdbrocken flogen durch die Luft.
„Diese elenden Ratten haben nur darauf gewartet, dass wir hier durch kommen!“, meldete sich Sachs.
„Ja, aber was hätten wir sonst tun sollen? In unseren Stellungen wären wir einfach verhungert“, erwiderte Flavius.
Zenturio Sachs schaltete wieder auf den Allgemeinkanal um, so dass ihn alle seine Legionäre hören konnten.
„Raus aus den Gräben und Deckungen! Es wird weiter gestürmt! Es hat keinen Sinn, dass wir uns hier zusammenbomben lassen!“
„Aber das ist verfluchter Selbstmord!“, funkte Flavius entsetzt dazwischen.
„Das ist ein Befehl, Kohortenführer Princeps! Ich bin Ihr Vorgesetzter! Also tun Sie, was ich Ihnen befehle!“, brüllte Sachs mit sich überschlagender Stimme über die allgemeine Vox-Verbindung zurück.
Flavius taten die Ohren weh. Fluchend richtete er sich auf, griff nach den Pila, dem Schild und dem Blaster.
„Männer, ich befehle, den Vorstoß fortzusetzen! Ich habe gerade ein paar Informationen von der Luftaufklärung erhalten! Die feindlichen Geschütze sind etwa drei Kilometer von uns entfernt! Sie befinden sich in Quadrat T-67 hinter der kleinen Hügelkette. Dort müssen wir hin, um diesen Schweinen die Hälse durchzuschneiden!“
Sich an der Grabenwand entlang tastend, bewegte sich Flavius durch einen halb verschütteten Unterstand. Dabei stieß er mit dem Fuß gegen den Helm eines toten Milizsoldaten; entsetzt drehte er sich um und sah in die glasigen Augen der Leiche, die auf dem Grund des langen Grabens lag. Dann schnellte er flink nach oben, kletterte eine eiserne Leiter hoch und kroch schließlich in Richtung einiger Felsen. Kleitos, der sich sein Schild panisch vor den Körper hielt, als ob er auf diese Weise eine Plasmagranate abhalten könnte, folgte ihm nach.