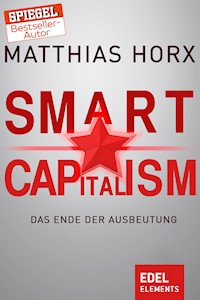Inhaltsverzeichnis
Widmung
Ouvertüre
1 DIE GROSSE TRANSFORMATION - Eine kurze Geschichte der Zivilisation
Wie alles anfing
Eine nachhaltige Gesellschaft
Krankheit, Klimawandel, Hoffnung: Der Wandel beginnt
Die agrarische Transformation: Planung, Bewässerung, Überschüsse
»Big Men«-Kulturen: Konkurrenz, Krieg, Charisma
Die Imperien: Organisation, Kommunikation, Kontrolle
Europas Aufstieg: Regen, Gattenehe, Vielfalt
Die Stadt: Markt, Handel, Rechte
Copyright
Für Oona, die irische Prinzessin aus dem Meer des Wandels
Ouvertüre
IM HAUS DER SCHMETTERLINGE
Die wahre Entdeckungsreise besteht nicht darin, dass mannach neuen Landschaften sucht. Sondern dass man mit neuenAugen sieht.
Marcel Proust
Das Wiener Schmetterlingshaus ist ein Ort der Verwandlung. 1901 im Stil der Art-déco-Stahlkonstruktionen der Jahrhundertwende errichtet, trägt es auch heute noch alle Attribute einer Zeit, die von einer neuen Verbindung von Fortschritt und Schönheit träumte. Seine sanft gewölbten türkisblauen Streben geben dem Bau eine lichte Größe, die dennoch immer auf menschliches Maß bezogen bleibt. Die Leichtigkeit und Transparenz bildet einen eleganten Kontrast zur imperialen Hofburg, die sich gleich dahinter wie ein gigantisches Borg-Raumschiff in den Himmel erhebt. Aus diesem Steingebirge heraus wurde einige Jahrhunderte lang das größte europäische Imperium, Österreich-Ungarn, regiert. Auf dem Balkon, der zum Heldenplatz weist, hielt Hitler im März 1938 seine Schreirede zur Einverleibung Österreichs ins Deutsche Reich.
Als meine beiden Söhne noch klein waren, besuchten wir zusammen oft jenen 300 Quadratmeter großen künstlichen Dschungel der Schmetterlinge, der sich heute als Touristenattraktion in einem Teil des Gebäudes befindet. Die Kinder gruselten sich königlich in einer dunklen Höhle und spielten mit Hingabe Verstecken hinter hohlen Baumriesen-Wurzeln aus täuschend echt wirkendem Kunstharz. Wasser tropfte in Kaskaden in mehrere Becken, in denen träge Kois trieben. Es roch schwül nach Tropen. Und überall, an den Glasflächen, an den Stahlträgern, saßen die riesigen Schönheiten der tropischen Falter. Handgroße Blaue Morphos in strahlendem Ultramarin, zarte Große Kuriere in rot-schwarz-gelben Dekors, vornehme Eulenfalter in melierendem Graubraun, verziert mit ganzen Reihen von Augen, elegante Zebrafalter aus dem Amazonasbecken. Manchmal, mit einem sanften Windhauch, landeten sie auf der Schulter oder unbemerkt auf den Schuhen, wo sie Salz rochen, und klappten ihre Flügel auf und zu. Wesen wie von einem fremden Stern.
Am meisten faszinierte uns jedoch jener Glaskasten gleich neben dem Eingang, in dem in kaltblauem Licht die nächsten Schmetterlingsgenerationen ausgebrütet wurden. Dort hingen die grellgrünen, mattschwarzen, filzigen oder glatten Larven in langen Reihen an Holzstäben. Die Kokons wirkten auf beängstigende Art und Weise hässlich, obszön, wie eine plastikhafte, schillernde Monstersaat aus dem All. Manchmal zuckten die harten Schalen, als würden in ihrem Inneren Krämpfe toben. Und bisweilen konnte man Zeuge werden, wie die fertigen Falter plötzlich, innerhalb weniger Minuten, zuckend ihrer Hülle entstiegen. Torkelnd und zitternd, wie verkrüppelt von der Arbeit der Metamorphose, bedeckt mit feinem weißen Staub, krochen sie einige Zentimeter an den Stangen entlang. Um dann wieder, wie geblendet von ihrer neuen Existenz, stundenlang zu erstarren. Und sich dann mit einem Mal in die Luft zu erheben. Vier, fünf, vielleicht acht Wochen würden sie leben, nicht mehr.
Was will uns die Natur mit der Metamorphose der Schmetterlinge sagen? Dass wir alle unansehnliche Raupen sind und aller Wandel, alle Schönheit nur durch radikale Zerstörung zu erreichen ist? Die Raupe ist ein robustes Lebewesen, das sich stoisch durch seine biologische Umgebung frisst. Diese Gier und Verfressenheit gilt allein dem Kraftgewinn für die entscheidende Phase der Verwandlung. Dem großen Sprung vom kriechenden Raupendasein zum leuchtenden evolutionären Statement eines Schmetterlings. In der Phase der Verpuppung, als sogenannte Chrysalis, ist die Larve hilflos jedem Außenreiz ausgesetzt. Wind, Sonne, Regen, jegliche Berührung oder Störung kann sie zum Absterben bringen. Bei ihrer Transformation »verdaut« sich die Raupe selbst, sie wird molekular radikal umgebaut - ein Prozess, der sich Histolyse nennt, die radikalste Form der Veränderung, die sich vorstellen lässt.
Kennen wir nicht solche Verpuppungen allzu gut? In der Pubertät verhalten sich unsere Kinder wie übergroße Larven - sie schlafen bis mittags und sind in einen Kokon aus Trotz und Abwehr eingesponnen. Auch wenn Menschen sich in Phasen außergewöhnlicher Kreativität befinden, begeben sie sich in einen Zustand der Unerreichbarkeit. Und warum wandern heute so viele Menschen auf Pilgerpfaden? Die Sehnsucht nach innerer Wandlung ist groß. Aber der Weg zum Schmetterling ist mühsam und steinig. Tiki Küstenmacher (dem ich diese Metapher des Verpuppens verdanke) schreibt in seinem Bestseller »Simplify your life«:
»Viele Menschen bleiben Raupe, weil sie Angst vor der Veränderung haben. Sie wollen die Komfortzone nicht verlassen. Eine Raupe hat aber nur eine Chance, um Schmetterling zu werden: die große Krise, den kleinen Tod. Das Lebensziel erreicht nur, wer den Weg in die Dunkelheit wagt. Wer loslässt und sich verpuppt.«
Der Weg in die Dunkelheit. Loslassen. Wandel macht Angst, zumal wir nicht immer wissen können, wohin die Reise geht. Bei meinen Vorträgen, die sich mit dem Thema Zukunft befassen, kommt es immer wieder zum selben Punkt der ratlosen Stille im Raum. Viele teilen meine Analysen und Bilder der Zukunft. In welche Richtung sich unsere Gesellschaft, unsere Welt »objektiv« verändert - oder verändern sollte -, lässt sich ja durchaus plausibel beschreiben.
Völlig im Nebel erscheint hingegen, wie man dort hingelangt. Und die Fragen sind immer gleich:
Glauben Sie ernsthaft, dass Menschen sich verändern können?
Bleiben Menschen nicht immer die gleichen alten Urzeitmenschen, jederzeit bereit, ihre Umwelt zu plündern und sich gegenseitig den Schädel einzuschlagen?
Muss es den Menschen nicht erst mal viel schlechter gehen, damit sie sich ändern?
Geschehen die Veränderungen heute nicht viel zu schnell, als dass wir etwas dabei zu sagen hätten?
Solche Fragen enthalten bereits ihre - meist negativen - Antworten. Bei der anschließenden Debatte gibt es immer zwei Fraktionen: die Alarmisten und die Stoiker. Die Alarmisten leben in einer Welt, in der alle Züge eigentlich längst abgefahren sind. Die »Menschheit« hat sich für den Weg in den Untergang entschieden; nichts (oder nichts, was man sich heute politisch zu fordern traut) kann sie davon abhalten, den Planeten zu verwüsten und danach die verseuchten Reste an ein internationales Gangstersyndikat auf dem Mond zu verkaufen. Diese angstgeführte und kulturpessimistische Weltsicht scheint heute Mehrheitsmeinung zu sein, im politischen Spektrum von ganz links bis ordentlich konservativ und auch in der Mitte.
Die andere Haltung kommt heiter-melancholisch daher: Redet ihr nur! Alles bleibt doch sowieso beim Alten! Vom Steinzeitmenschen bis zum Bewohner der modernen Fernsehhöhle hat sich im Grunde nichts geändert. Demokratie? Technologie? Kultur? Alles Trugbilder einer hybriden Selbstillusion, Kompensationen der Grundbedürfnisse: Essen, Sex und Macht. Es geht ums Überleben und sonst nichts. In diesem Spiel siegt mal die eine, mal die andere Fraktion. Aber im Grunde bleiben die Anteile etwa gleich.
Es gibt noch eine dritte Gruppe, ich möchte sie die »Wandelhektiker« nennen. Peter Sloterdijk hat in seinem Buch »Du musst dein Leben ändern!« eine zeitgemäße Parole dazu geliefert. In der Welt der Wandelhektik reagiert der Imperativ. Alles galoppiert in eine sensationell neue Zukunft, ein wahres Wunderland von Technik und Umwälzung, Drama und Potenz. Das Mantra lautet »noch nie« und »immer mehr«. Die Zukunft lässt keinen Stein auf dem anderen, sie fordert unsere ganze Kraft. Deshalb müssen Menschen unentwegt enorme Anpassungsleistungen vollbringen, »Übungen in Unmöglichkeiten«, wie Sloterdijk formuliert. Der Fortschritt galoppiert, und es bleibt uns nichts übrig, als auf seinem Rücken akrobatische Verrenkungen zu vollziehen. Als würde am Eingang des magischen Welttheaters ein großes Schild mit folgendem Wortlaut hängen:
Achtung WANDELZWANG!
Wer sich nicht innerhalb von 24 Stunden radikal gründlich ändert, wird mit Einkommens- und Wohlstandsverlust, mit Unglück, Versagen und Minderwertigkeit bestraft!
Dieses Buch ist ein Diskurs über den Wandel in all seinen Facetten und Dimensionen: über gesellschaftlichen Wandel, ökonomischen, individuellen, kulturellen Wandel, mentalen Wandel. Wie hängt eines vom anderen ab? Unter welchen Bedingungen gelingt, unter welchen scheitert persönliche und kulturelle Evolution? Wann kommt es zu notwendigen Brüchen, Aufschwüngen, Überraschungen? Wie können wir die Regeln für das Gelingen von Wandlungsprozessen beschreiben? Wie biegsam ist Wandel?
Dabei ist es mir wichtig, dass wir zwischen Wandel und bloßer Veränderung unterscheiden. Veränderung ist ein externer Prozess, sie entsteht aus Zwängen, ökonomischen Prozessen oder technischen Trends, die »über uns kommen«. Diesen Prozessen können wir uns anpassen, aber das ist eine Zwangslösung, die uns weder glücklich macht noch wirklich weiterbringt. Spannend wird es erst, wenn wir selbst als Akteure und Gestalter auf den Plan treten. Echter Wandel beginnt erst dort, wo wir durch einen Prozess der freien Wahl, der aufsteigenden Freiheit, des wachsenden Bewusstseins uns selbst zu verändern beginnen. Wandel heißt, dass wir uns mit Hilfe der vielfältigen Veränderungen der Welt auch innerlich verwandeln.
»Change we can believe in« lautet die Parole von Barack Obama. Vielleicht kann man so einen unglaublich frech und optimistisch daherschlendernden Satz am Ende nur in einem Land formulieren, in dem einst die aus dem feudalen Europa Geflüchteten landeten, das zwölf seiner Bürger auf den Mond schickte und lauter Kriege »im Namen der Freiheit« führte. Aber genau darum geht es. Um die Hoffnung, dass wir eben nicht nur reflexhaft auf Veränderungen reagieren, die uns die Umwelt auferlegt. Dass wir - anders als die Raupe - eine Chance haben, den Wandel bewusst zu gestalten, uns Ziele zu setzen und auf dem Weg zu ihnen zu wachsen.
Der Weg in die Zukunft erfordert einen neuen Blick auf Bekanntes, ein neues Verständnis des Wandels. Mit den wunderbaren Worten Karl Poppers:
»Wir sollten vorsichtig den Grund unter uns erfühlen, wie es Küchenschaben tun, und versuchen, die Wahrheit in aller Bescheidenheit zu erlangen.«
Wien, Sommer 2009
1DIE GROSSE TRANSFORMATION
Eine kurze Geschichte der Zivilisation
Die Grenze zwischen Zivilisation und Barbarei ist nurschwer zu ziehen: Stecken Sie sich einen Ring in Ihre Nase,und Sie sind eine Wilde; stecken Sie sich zwei Ringe inIhre Ohren, und Sie sind zivilisiert.
Pearl S. Buck
Wir sehen nichts von diesen langsam fortschreitenden Ver-änderungen, bis die Hand der Zeit auf eine abgelaufeneWeltperiode hindeutet, und dann ist unsere Einsicht in dielängst verfl ossenen Zeiten so unvollkommen, dass wir nurnoch das Eine wahrnehmen - dass die Lebensformen jetztverschieden von dem sind, was sie früher gewesen sind.
Charles Darwin
Fortschritt ist das Werk der Unzufriedenheit.
Jean-Paul Sartre
Wie alles anfing
Die Kultur der!Kung-San ist eine der letzten intakten Jäger-und-Sammler-Kulturen der Erde. Die!Kung - ausgesprochen mit einem Klicklaut zu Beginn, deshalb das vorgestellte Ausrufezeichen - leben in halbnomadischen Gruppen von 20 bis 100 Menschen im kargen Buschland des Grenzgebiets zwischen Botswana, Namibia und Südafrika. Seit vielen tausend Jahren ziehen sie dort, den Regen- und Trockenzeiten folgend, langsam durch ein mehr als 10 000 Quadratkilometer großes Gebiet. Monate-, manchmal auch jahrelang bleiben sie in einfachen Strohhütten am selben Ort, um dann, wenn Tiere oder Pflanzen in der Gegend rar geworden sind, plötzlich aufzubrechen und weiterzuziehen.1
Das Alltagsleben der!Kung könnte man mit dem Motto »entspannte Emsigkeit« beschreiben. Die Männer als »Bringer des Fleisches« leiden deutlich seltener an Rollenkonflikten als gestresste Softie-Männer in städtischen Ballungsgebieten des 21. Jahrhunderts. Ihr Job ist klar: Sie sorgen für die Nahrungsgrundlage Fleisch. Sie gehen ausgiebig mit Pfeil und Bogen jagen; meist aber keine gefährlichen Raubtiere oder Elefanten, sondern Stachelschweine, Kudus, Antilopen. Auf ihren Jagdzügen sind sie tage- oder wochenlang unterwegs, ohne Ärger mit ihren Ehefrauen oder ihrer Sippe zu bekommen.
!Kung-Männer wie -Frauen sind sehnig, dürr; ihre Hautfarbe scheint das Ocker der Landschaft angenommen zu haben. Ihre körperliche Ausdauer ist enorm. Während die Männer marathonähnliche Distanzen durchlaufen, sammeln die Frauen mit den Kindern auf dem Rücken den halben Tag lang Beeren und Mongongos (eine in der Region verbreitete Nussart), oder sie graben schmackhafte Wurzeln aus. Bisweilen legen sie auch Fallen für Kleintiere.2 Die Jagd der Männer ist deshalb so langwierig und weiträumig, weil die!Kung keine unmittelbar tödliche Jagdtechnik kennen. Eine Giraffe oder ein Kudu wird erst mit Pfeilen beschossen, deren Spitze mit dem Gift der Diamphidia-Larven bestrichen ist. Durch die leicht lähmende Wirkung des Giftes verlangsamt sich die Beute - so ist es einfacher, das Tier nach Verfolgungsjagden über manchmal Hunderte von Kilometern und mehrere Tage mit dem Speer zu erlegen. Diese Art der »Erschöpfungsjagd« gibt es nur noch ganz selten auf der Erde - sie zeichnet die originären Jäger-und-Sammler-Kulturen der Savannengebiete aus.
So wie bei den!Kung fing alles an.
Wer eine der traditionellen!Kung-Siedlungen besucht, meist eine Ansammlung von fünf bis zehn Strohhütten (es gibt inzwischen auch etliche Dörfer mit permanenten Blechdach-Häusern), sieht jede Menge Muße und Nichtstun, was schon angesichts der erbarmungslos brennenden Sonne eine angemessene Verhaltensform ist.3 Abends beginnen so gut wie immer ausgedehnte Rituale, die in den losen Gruppen für sozialen Zusammenhalt sorgen, Heilrituale zum Beispiel. Krankheiten, so glauben die!Kung, entstehen dadurch, dass Geister verzauberte Pfeile auf ein Mitglied der Sippe lenken. Durch Trancetänze, die tagelang dauern, wollen sie dem Leiden beikommen. Zahlreiche Fleischund Beutetänze dienen obendrein der Kommunikation zwischen Verwandten oder befreundeten Sippen in der Nachbarschaft.
Die!Kung als »primitive Unwissende« zu bezeichnen, fällt nur einem Ignoranten ein. Sie kennen die sie umgebende Natur bis ins feinste Detail - 350 Tierarten und ihre Gewohnheiten sind ihnen vertraut, 250 Pflanzenarten nutzen sie auf die eine oder andere Weise. Ethnologen berichten von erstaunlichen Fähigkeiten, wie die, dass Jäger Tiere und ihre Bewegungen über viele Kilometer hinweg wahrnehmen können, obwohl kein Sichtkontakt besteht. Ihre Sensibilität für Wetterereignisse ist extrem ausgeprägt. Die!Kung besitzen keine »Technologie« in unserem Sinne, und die Gebrauchsgegenstände sind primitiv. So nutzen sie Straußeneier als Behältnisse für Wasser und Essen und gegerbte Antilopenmägen als tragbare Wasserbehälter. Aber sie verfügen über erhebliche handwerkliche Fertigkeiten, etwa bei der Konstruktion von Speeren.4
Faszinierend ist vor allem, wie die!Kung mit Besitz und Macht umgehen. Ihre Großzügigkeit ist legendär. Mit Eigentum können sie offenbar wenig anfangen. Sie sind regelrecht davon besessen, Fleisch loszuwerden, schon deshalb, weil man es nicht konservieren kann. »Nur der unerfolgreiche Jäger hat noch Fleisch!«, lautet eine!Kung-Weisheit. Es gibt keine Häuptlinge, keine dauerhaften Führer, allenfalls zeitliche Sprecher.5 Die!Kung scheinen Hierarchien und Konflikte zu fürchten. Sie pflegen eine zeitaufwendige Palaverkultur, gegen die jede studentische Wohngemeinschaft wie ein Ausbund an kommunikativer Effizienz wirkt. Bei den Debatten unterstützen die meisten Redner den Vorredner nicht im Geringsten. Alle kritisieren alles Mögliche und das wild durcheinander. Am Ende lösen sich die Aggressionen zumeist in Wohlgefallen auf.6
Die ausgeprägten Egalitätsrituale der!Kung haben über Jahrhunderte Ethnologen und Anthropologen zur Verzweiflung gebracht. Bereits die Kontaktaufnahme erwies sich als äußerst schwierig. Fremde werden meist mit einer Mischung aus Misstrauen und wohlwollender Ignoranz wahrgenommen. Schmuck oder Edelmetalle zählen in der Kalahari eher zur Kategorie »überflüssiger Müll«.
Da Fleisch eine herausragende Bedeutung spielt, näherten sich die Forscher also mit Fleischgaben. Sie spendeten einen Ochsen. Ein dickes Schwein. Oder eine besonders fette Gazelle. Was sie ernteten, war Gelächter. Schallendes, grölendes Gelächter! Die Gaben wurden abgelehnt. Kommt nicht in Frage! Spinnt ihr? Viel zu viel Fleisch!
»Wenn ein Mann zu viel Fleisch erlegt«, so sagen die!Kung, »neigt er zu Hochmut und Arroganz. Dann glaubt er, er ist ein Häuptling oder Großer Mann. Und wir anderen sind seine Sklaven. Eines Tages wird sein Hochmut ihn dazu bringen, einen Menschen zu töten. Deshalb reden wir immer vom vielen Fleisch, das wertlos ist. So kühlen wir sein Herz und machen ihn freundlich!«7
Eine nachhaltige Gesellschaft
Für jeden Globalisierungskritiker, Greenpeace-Anhänger, Naturromantiker, Zivilisationskritiker (wer wäre das heute nicht?) müsste in der namibischen Wüste das Ziel der Träume erreicht sein. Ist das nicht eine wunderbar egalitäre, mit der Natur in Einklang lebende Kultur? (Außer den!Kung gibt es noch einige andere Jäger und Sammler wie die Nunamiut in Alaska, die Yanomami im venezolanisch-brasilianischen Urwald, die Hadza in Tansania, um nur drei zu nennen.) Kein Geldsystem, keine Spekulation, kein nennenswertes Eigentum, kein Stress, kein überflüssiger Konsum - dafür reichlich Bewegung und soziales, solidarisches Zusammensein. Obwohl zwischen Männern und Frauen eine gewisse Arbeitsteilung herrscht, ist diese nicht strikt und führt nie zu klassischen Patriarchatsverhältnissen; die Geburtenrate regelt sich auf geheimnisvolle Weise von selbst (in Trockenzeiten sind!Kung-Frauen praktisch unfruchtbar).8
Müsste sie nicht genau so aussehen, die ideale nachhaltige Gesellschaft?
Derrick Jensen zum Beispiel sieht das so. Der 40-jährige amerikanische Radikalökologe wirkt wie ein fröhlicher ewiger amerikanischer College-Student. Ein bisschen Teddybär, Mutters Liebling, Typ lieber Hippie. Derzeit wird er von einem Vortragssaal in den nächsten geschoben, um vor betuchten Bürgern aus den wohlhabenden Suburbs der USA die Rückkehr zu Jäger-und-Sammler-Lebensweisen zu predigen.
In seinem auch auf Deutsch erschienenen Buch »Endgame« plädiert er für die Beendigung des »missglückten Experiments Fortschritt«. In »Das Öko-Manifest - wie nur 50 Menschen das System zu Fall bringen und unsere Welt retten können« rät er ganz ernsthaft zur Sprengung aller lebenswichtigen Versorgungslinien der Zivilisation - Staudämme, Kraftwerke, Brücken. Jensen, der sich selbst als »Anarcho-Primitivisten« sieht, beschreibt Zivilisation als »permanenten Holocaust« und findet, »dass wir wieder zum Tier werden sollten«. Die Gesellschaft muss radikal entindustrialisiert, Arbeitsteilung, Spezialistentum und Großtechnologien komplett aufgegeben werden. Er plädiert für eine »vollständige und nachhaltige Befreiung des Planeten von der Zivilisation«. Mit anderen Worten: für den!Kung-Lebensstil.
Charles Darwin schrieb im Jahre 1839 über die Bewohner der Tierra del Fuego: »Sogar ein Stück Stoff wird in Streifen zerrissen und verteilt; kein Individuum wird reicher als das andere.« Aber er fügte auch hinzu: »Eine solche perfekte Gleichheit muss diese Kultur für lange Zeit in retardiertem Zustand halten.«9
Auch für Karl Marx, diesen bürgerlichen Bohemien, wären die!Kung wahrscheinlich faszinierend gewesen (in der Tat beschäftigte er sich in vielen Werken mit den »Wilden-Kulturen«). Marx kannte Darwin, dem er 1867 sogar den ersten Band des »Kapitals« widmen wollte (was dieser dankend ablehnte).10 Er bewunderte den Naturromantiker Rousseau, der den Menschen als durch die Zivilisation verdorbenes und vergewaltigtes Naturwesen definierte. Obwohl - oder gerade weil - er Religion verachtete, war Marx durch und durch ein Kind der christlichjudäischen Denktradition. In dieser Tradition existierte in der Vergangenheit ein Zustand der Harmonie und Balance zwischen Mensch und Natur, Gott und Erde, der durch einen »Sündenfall« zerstört wurde. Für Marx war das Privateigentum der Sündenfall, und der Kommunismus würde, analog zum Gottesgericht, den »verderbten« Zustand beenden. Und so scheinen die eigentumslosen Heiden der Kalahari mit jenem Zustand der kommunistischen Utopie identisch, den Marx in seinen typischen Bandwurmsätzen in der »Deutschen Ideologie« von 1845 formulierte:
»Und endlich bietet uns die Teilung der Arbeit gleich das erste Beispiel davon dar, dass … die eigne Tat des Menschen … ihn unterjocht, statt dass er sie beherrscht. Sowie nämlich die Arbeit verteilt zu werden anfängt, hat Jeder einen bestimmten ausschließlichen Kreis der Tätigkeit, der ihm aufgedrängt wird, aus dem er nicht heraus kann; er ist Jäger, Fischer oder Hirt oder kritischer Kritiker und muss es bleiben, wenn er nicht die Mittel zum Leben verlieren will - während in der kommunistischen Gesellschaft … die Gesellschaft die allgemeine Produktion regelt und mir eben dadurch möglich macht, heute dies, morgen jenes zu tun, morgens zu jagen, nachmittags zu fischen, abends Viehzucht zu treiben, nach dem Essen zu kritisieren, wie ich gerade Lust hab …«
Jäger, Fischer, Hirt, nach dem Essen Palaver: Marx’ Utopie einer nichtarbeitsteiligen Gesellschaft ähnelt erstaunlich der Realität von Jäger-und-Sammler-Kulturen. Die!Kung jagen, sammeln und kritisieren, »jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder nach seinen Talenten, jeder nach seinem Bedarf.«
Wie alle indigenen Kulturen ist auch die der!Kung von der modernen Zivilisation existentiell bedroht. Die willkürlichen Grenzziehungen der afrikanischen Nationalstaaten behindern zunehmend den Zug der Tiere. Die jungen!Kung haben zudem immer weniger Lust auf das traditionelle Leben in der Strohhütte. Wer einmal weggeht, kommt kaum wieder. Viele der jungen Leute scheitern in den Slums von Johannisburg oder Luanda.
Natürlich lässt sich dieser Trend leicht auch auf die postkolonialistischen Bestrebungen der Regierungen im Süden Afrikas zurückführen, die Buschmänner zum Vorteil der Rohstoffausbeutung zu »zivilisieren« (obwohl sie sich inzwischen zu einem einträglichen Tourismusgeschäft entwickelt haben). Aber wie immer sind die Dinge nicht ganz so einfach.
Von Egon Friedell stammt der schöne Satz: »Zivilisation ist Reichtum an Problemen.« In dieser Hinsicht sind und waren die!Kung in der Tat arm. Sie haben kein Problem!
Aber dies gilt nur so lange, wie das Korsett des Mangels jede Wahlmöglichkeit des Individuums radikal einschränkt. An die Ressourcenknappheit der Halbwüste hat sich die!Kung-Kultur evolutionär perfekt angepasst. Eine Hierarchie und die damit verbundenen Kosten für das Gemeinwesen aufgrund der Verschwendung einer kleinen Gruppe wären hier existenzbedrohend. Vertikale soziale Differenzierung würde den Rahmen der bescheidenen Subsistenzwirtschaft sprengen.
Das Bild des durch und durch »friedlichen Wilden« mag durch viele Studien inzwischen revidiert sein. Doch meistens bleiben die!Kung fröhliche, freundliche, optimistische Menschen. Sie zeigen uns, wie anpassungsfähig der menschliche Geist ist. Warum sollte man schlechte Laune haben, wenn die Tiere üppig Fleisch bieten, das Wasserloch noch etwas Wasser hat und die Geister gnädig bleiben?
Die Dinge sind, wie sie sind!
Die Tiere kommen und gehen.
Die Geister sind mit uns - wenn wir tanzen!
Krankheit, Klimawandel, Hoffnung: Der Wandel beginnt
Warum, so müssen wir weiter hartnäckig fragen, sind Menschen nicht einfach Jäger und Sammler geblieben? Wieso haben sie eine Lebensweise verlassen, die der Anthropologe Marshall Salins einmal als die »ursprüngliche Überflussgesellschaft« bezeichnete? Warum hat Homo sapiens all das, was danach kam, auf sich genommen - den langen Weg von den Savannen über die Reisfelder bis zu den mittelalterlichen Frondiensten? Um schließlich bei den Segnungen von McDonald’s, Rückenschmerzen, Übergewicht und Dieter Bohlen in 300 Fernsehprogrammen zu landen?
Im Paradies waren die Menschen nackt und die Tiere ohne Furcht. Alles war im Überfluss vorhanden. Unser biblisches Bild des Paradieses repräsentiert nichts anderes als die archaische Vision einer Jäger-und-Sammler-Gesellschaft in einer besonders üppigen, regen- und tierreichen Topographie.
Doch was könnte in diesem Bild die reale Analogie für den »Sündenfall« sein, das Knabbern am verbotenen Apfel? Die Antwort lautet: Krankheit und Klimawandel.
Vor rund 90 000 Jahren machten sich vom Norden des afrikanischen Kontinents aus die ersten Jäger und Sammler auf den Weg über die Grenzen des Kontinents hinaus. Sie durchquerten die nördlichen Wüstengebiete und drangen in Richtung arabische Halbinsel, Mesopotamien und das östliche Mittelmeer vor.11 Dort trafen sie auf einen alten Verwandten: den Neandertaler. Sie begannen die Wanderung, weil es im nördlichen Teil von Afrika vor 80 000 Jahren trockener wurde, der Regen und die Tiere ausblieben. Weil Krankheiten wie die Schlafkrankheit12 den Tod brachten - so die These des Evolutionsbiologen Josef H. Reichholf.13
Vielleicht waren es einige junge Heißsporne. Vielleicht aber auch erfahrene ältere Männer. Oder eine Gruppe hellwacher Frauen, die sich nicht damit abfinden wollten, dass ihre gerade geborenen Kinder unwiderruflich den »Geistern der heißen Winde« anheimfallen sollten. Die es satthatten, gegen das um sich greifende Sterben nur zu tanzen und zu trommeln und Tiere zu opfern, wie es die Alten aus Tradition taten. Und stattdessen entschlossen die Bündel packten. Etwas Besseres als den Tod werden wir allemal fi nden!
»Diejenigen steigen auf, die hinausgeworfen werden aus dem Identischen«, schrieb Henning Mankell im »Auge des Leoparden«.14
Und so ging alles weiter.
Die agrarische Transformation: Planung, Bewässerung, Überschüsse
Noch vor 100 000 Jahren zählte die Menschheit kaum mehr als 100 000 Köpfe. Homo sapiens war eine nicht sehr erfolgreiche Spezies, eingeklemmt in einigen afrikanischen Ökotopen. Andere Menschenarten, wie der Homo erectus, der australopicteus, der ergaster oder Homo habilis hatten sich schon eine halbe Million Jahre über den ganzen Planeten ausgebreitet und erfolgreich in den unterschiedlichen Klimazonen behauptet.
Auch in der ersten Zeit der »großen Wanderung«, der langsamen Ausbreitung des Homo sapiens über den Planeten, wuchs die Kopfzahl nur langsam. Nomaden hatten noch nie viele Kinder, denn die Notwendigkeiten der Mobilität beschränken die Fruchtbarkeit (in nomadischen Gesellschaften werden Kinder oft bis zum 4. Lebensjahr gestillt). Viele zehntausend Jahre nach dem Exodus aus Afrika blieben unsere Vorfahren der nomadischen Lebensform treu. Sie breiteten sich erst im Nahen Osten aus, von da aus über Indien nach Australien, wo sie vor 50 000 Jahren ankamen, Europa wurde vor 35 000 Jahren besiedelt. Erst vor rund 12 000 Jahren wanderten Menschen von Asien über die damals noch existierende Landbrücke nach Nordamerika.
Unsere Jäger-und-Sammler-Vorfahren lernten auf diesem Weg, sich gegen kalte Temperaturen zu schützen, wie die Inuit. Sie perfektionierten die Jagdwaffen, um große und gefährliche Tiere zu erlegen. Auch wenn sie sich an Flussbiegungen, geschützten Hängen, in Höhlengebieten vorübergehend niederließen - sie blieben immer Wanderer, deren zentrale Überlebensstrategie bei Knappheiten, Katastrophen und Klimawandeln das Weiterziehen war. So zerstreute sich die zahlenmäßig geringe Menschheit auf dem riesigen Planeten. Unser großes Hirn half uns, die Techniken der Jagd und der Pflanzensuche allmählich zu verfeinern. Unser großes Hirn war aber auch gleichzeitig unser größtes Handicap. Weil es Geburten schwierig und riskant machte. Weil Homo-sapiens -Kinder viel länger hilflos bleiben als Affenbabys oder Neandertalerkinder.
Jagen und Sammeln ist eine dem menschlichen Organismus »genuine« Tätigkeit. Wir haben uns im Lauf der Evolution zum Savannenläufer entwickelt (ein Grund, weshalb bei den sehnigen!Kung die Herzinfarktraten bei null liegen). Bei Jagd- und Sammeltätigkeiten sind unsere Muskel-, Skelett- und Kognitionsfähigkeiten perfekt ausgelastet; Ausruhen und Anstrengen, Spähen und Orientieren, Flüchten und Koordinieren - Adrenaline und Dopamine, die »neuronalen Treibstoffe« unseres Gehirns, bleiben auf diese Weise im Training und im Gleichgewicht. Als Jäger und Sammler konnte der Mensch auch die klimatischen Extremregionen besiedeln: Wo tierisches Eiweiß in Form großer Beutetiere vorkommt, kann die Ernährung von kleinen Gruppen über längere Zeit sichergestellt werden. In feuchtwarmen Gegenden, etwa in Polynesien, bieten Fisch und tropischer Wald ausreichende Nahrungsquellen. Kein Wunder also, dass Jagen und Sammeln eine halbe Million Jahre die einzige »Produktionsform« des Menschen darstellten.
Doch dann, beginnend vor 13 000 Jahren, explodierte die Menschenzahl plötzlich um das 1000-Fache - in nur 500 Generationen. In jener Zeit veränderte sich das Klima auf dem ganzen Planeten. Die Zwischeneiszeit wich einer Warm- und Trockenzeit. Die großen Tiere auf der Nordhalbkugel, die von den Jägern bis dahin sehr erfolgreich gejagt worden waren, die Mammuts, Wollnashörner und Riesenbären, starben aus. Damit brach die nächste Epoche der Menschheitsgeschichte an: die neolithische Revolution.
Vieles spricht dafür, dass der Übergang in die agrarische Lebenskultur mit Beginn der Jungsteinzeit der Menschheit zuerst eher Nachteile als Vorteile brachte. Ausgrabungen in Göbekli Tepe in Ostanatolien und anderen Pionierorten der Bauernkultur zeigen, dass die frühzeitlichen Bauern gegenüber den Jägern und Sammlern gesundheitlich und kräftemäßig eher schlechter gestellt waren - der Nährwert des Getreides, das damals noch weitgehend den Gräser-Wildformen entsprach, reichte nicht aus. Die Menschen wurden kleiner und die Lebenserwartung sank. Die Kindersterblichkeit nahm zu.15
Der Evolutionsanthropologe Robert Wright formulierte die Gründe für die agrarische Transformation lapidar: »Weil es einfach eine gute Idee war!«16 Man muss hinzufügen: Zu bestimmten Zeiten war es die zentrale Überlebensidee. Vor 10 000 Jahren wurde das Klima in den Übergangsbreiten feuchter und regenreicher. Die großen Tiere verschwanden, die Pflanzenmasse explodierte. Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Jäger und Sammler darauf reagieren mussten. Wahrscheinlich entwickelten sich die ersten Agrikulturen in Zusammenhang mit der Domestizierung von Haustieren - Pflanzen, die man nicht essen konnte, konnte man Tieren verfüttern. Aus Jägern und Sammlern wurden also Bauern und Viehzüchter und Hirten. Dazu Robert Wright: »Die Frage ist nicht, warum die Jäger und Sammler Landwirtschaft ›wählten‹, sondern warum sie den langen Weg dorthin mit kleinen Schritten gingen … Ein Teil der Antwort ist, dass diese Jäger und Sammler Menschen waren. Menschen sind neugierig. Sie experimentieren mit der Natur und versuchen sie in ihrer Weise zu beeinflussen.«17
Josef H. Reichholf führt in »Warum die Menschen sesshaft wurden« noch ein weiteres, nur scheinbar abwegiges Argument ins Feld: Alkohol. »Keine menschliche Kultur war und ist offenbar ganz frei von Anregungs- und Suchtmitteln. Am umfangreichsten bedient man sich ihrer gemeinsam in der Gruppe.«18 Irgendwann merkten halbsesshafte Gruppen, dass Getreide und Früchte, die sie zu lange lagerten, bei ihrem Genuss seltsame Seelenzustände erzeugten. Danach scheint Alkohol einen Entwicklungsschub bewirkt zu haben, weil er Gemeinschaftsrituale stimulierte und weil die Menschen, um zuverlässig Alkohol zu erhalten, Getreide anbauten zur Gewinnung von Bier.
Die ersten Bauern siedelten in einem breiten Bogen vom heutigen Israel über Ostanatolien und das kurdisch-iranische Grenzgebiet bis an das Flussgebiet des Euphrat, im »fruchtbaren Halbmond«. Sie begannen die zweite Phase des Großen Menschheitsexperiments mit einer Art »genetischem Handicap«: Nutzpflanzen und Nutztiere blieben in ihrem Eiweiß- und Kaloriengehalt noch lange nahe an den Wildformen. Bis sich ertragreiche Getreidesorten, fette domestizierte Schafe und milchintensive Kühe aus den Rohformen der Natur »herausgemendelt« hatten, brauchte es viele Zuchtversuche.
Die gebückte Haltung der Bauern beim Ackern, die Erdarbeit durch pure Körperkraft ist in unseren inneren Bildern von Arbeit tief eingebrannt. In vielen heiligen Schriften wird der Übergang zur bäuerlichen Kultur ja auch als eine Art göttlicher Bestrafung interpretiert. Womöglich war jedoch gerade die Mühsal der Grund für den erstaunlichen Fortschritt der Bauernkultur. Innerhalb weniger Jahrhunderte erlernten Menschen überall auf der Welt eine Vielfalt von technischen Fähigkeiten, die die neuen Lebens- und Ernährungsgrundlagen verbesserten: Pflügen, Töpfern, Backen, Metallbearbeitung, Steinbearbeitung, Lederverarbeitung, Textilien, Färben und Malen, Konservieren, Hausbau, Bootsbau, erste Formen der Düngung, der Einzäunung - den neolithischen Wandel nannte man nicht zu Unrecht eine »Revolution«.
Jede neue Lebensgrundlage erzeugt neue Verhaltensweisen und Mentalitäten. Agrarkulturen unterschieden sich von den Tribalkulturen schon durch ihren Sichtwinkel auf die Welt. Es ist kein Wunder, dass in vielen Regionen Jäger-und-Sammler-Kulturen und Bauern nebeneinanderherlebten, ohne sich zu vermischen. Wer sesshaft wird, fängt an, die Welt in einer neuen Zeitfolge zu sehen. Die zyklische »Traumzeit«, wie sie bei vielen tribalen Kulturen herrscht, wird durch lineare Zeithorizonte abgelöst, in denen Planung und Erwartung eine große Rolle spielen. Von da ist es zum Zahlenwesen nicht mehr weit. So entstand rund um die Hauswirtschaft des Bauerntums ein neues Kognitionssystem. Und zum ersten Mal in der Geschichte gab es zumindest in guten Jahren etwas, das den weiteren Weg der menschlichen Geschichte fundamental beeinflussen sollte: Überfluss.
»Big Men«-Kulturen: Konkurrenz, Krieg, Charisma
Als die ersten französischen Siedler vor rund dreihundert Jahren in die mückenverseuchten Sümpfe des unteren Mississippi vordrangen, begegneten sie einem Indianerstamm, dessen Häuptling ein extremes Selbstbewusstsein an den Tag legte. Ein jesuitischer Priester bemerkte empört: »Er kennt nichts Edleres und Erleseneres auf der Erde als sich selbst!« Da die Natchez als zentrale Gottheit die Sonne verehrten, nannte sich der Häuptling »Bruder der Sonne«. Sein Volk, immerhin einige tausend Köpfe stark, war geübt in Sonnenverehrung. Und fand offensichtlich wenig daran auszusetzen, dass der gesamte Hofstaat des Häuptlings nach dessen Tod erst große Mengen Tabak aß, bis die Leute das Bewusstsein verloren, um dann von den anderen Stammesmitgliedern stranguliert zu werden. Im Namen der Sonne!19
Wieso entwickelten sich in einigen Regionen der Erde Kulturen, in denen plötzlich steile Hierarchien vorherrschten, mit mächtigen, ja größenwahnsinnigen Herrschern? Welche Kräfte führten zur Differenzierung der Gesellschaft? Eine mögliche Antwort lautet: Krieg und Nahrungskonkurrenz.
Nomadische Kulturen können Konflikten ausweichen. Sie arrangieren sich wie die!Kung auf einem weiträumigen Terrain und halten ihre Bevölkerungszahlen stabil. Für Menschengruppen außerhalb dieses Territoriums ist es nicht sehr lukrativ, in diese Gebiete einzuwandern, sie zu erobern, die Bewohner auszurotten oder zu unterwerfen.
Bei steigender Bevölkerungszahl geht die Rechnung jedoch bald nicht mehr auf. Dort, wo sich Fauna und Flora zu höheren Proteinvorkommen verdichteten, in den fruchtbaren, nicht zu heißen Waldgebieten, den Flussdeltas, den großtierreichen Savannen, entstanden bald Territorialkonkurrenzen. Ein Stamm, eine besonders starke Horde begann, ihre Jagd- und Sammelgründe auszuweiten. Und wurde mit Bevölkerungswachstum belohnt. Irgendwann stießen sie an innere und äußere Grenzen. Nach innen, weil die steigende Anzahl der Menschen zu sozialen Konfusionen und Konflikten führte.
Wie wir aus jedem Strategiespiel wissen - von Monopoly über Siedler bis zu entsprechenden Computer-Simulationsspielen - ist der Erfolg kriegerischer Aktivitäten von Koordinationsfähigkeiten abhängig. Man kann Feldzüge nicht gewinnen, wenn alle unorganisiert aufeinander einprügeln. Konflikt bedeutet Organisation von Ressourcen, erfolgreicher Krieg hat (neben der Waffentechnik) mit der Kunst zu tun, Verbündete zu gewinnen. Taktik und Strategie bedingen effektive Kommunikation. Zum Kriegführen benötigt man zudem ein komplexeres Zeichensystem: Insignien der Gemeinsamkeit, Symbole und Rituale der Furchtbannung, um die Todesangst zu überwinden und den Feind zu dämonisieren.
»Big Men«, also starke Führer, brachten in einer bestimmten Phase der menschlichen Entwicklung Überlebensvorteile. Wer sich ihnen anschloss, hatte Vorteile gegenüber denjenigen, die in kleinen, unstrukturierten Gruppen blieben. Während agrarische Techniken die Lebensweisen territorialer machten und Überschüsse zu Vorräten und schließlich Reichtümern führten, breiteten sich parallel zu den agrarischen Kulturtechniken die Big-Men-Hierarchien auf dem Planeten aus, große Stämme mit einem reichen, mächtigen Oberhaupt und dessen Entourage an der Spitze.
Was brachte Menschen einstmals dazu, die üppige Verschwendung, die mit dem Erscheinen eines Big Man verbunden ist, zu tolerieren oder zu unterstützen, anstatt sich Beute und Ernte wie in der guten alten Zeit brüderlich zu teilen? Robert Wright beschreibt den Südsee-Typus der Big-Men-Gesellschaften:
»Der Big Man war der Chefplaner eines Klans, vielleicht eines Dorfes. Er organisierte den Bau von Lachsfallen oder Fischkellern und sorgte dafür, dass sich einige Dorfbewohner spezialisierten, zum Beispiel auf die Herstellung von Kanus. Dafür erhielt er zwischen einem Fünftel und der Hälfte aller Jagdausbeuten. Ein Teil dieser Einkünfte kehrte in Form von Festessen zu den Menschen zurück … Er lebte in einem überdurchschnittlich schönen Haus und verfügte über eine überdurchschnittlich ausgestattete Garderobe.«20
Ein mächtiger Häuptling, oft polygam privilegiert, nimmt also einen großen Anteil der Ressourcen an sich - Frauen, Fleisch, Land, das schönste Haus in der schönsten Lage, mit der besten Sicht über die Lagune. Sind alle verrückt geworden, dass sie sich das gefallen lassen? Was bietet er den auf diese Weise »Erleichterten« im Gegenzug an? Die Antwort lautet: Komplexitätsreduzierung. Er entscheidet jene Prozesse, die sich in der sozialen Selbstregulation des Stammes oder der Ethnie nicht mehr so leicht regeln lassen. Im Ausgleich für sein »Parasitentum« liefert der Big Man soziale Vorteile: Er koordiniert komplexere Vorhaben, die dem ganzen Stamm zugutekommen. Er fungiert als Diplomat, der Kriegszüge vorbereitet oder durch Verhandlungen verhindert. Er ermöglicht den Mitgliedern des Stammes, ihre Angst vor dem Unerwarteten zu kontrollieren; er wird sich darum kümmern. Er dient als Projektionsfläche, in die das Kollektiv seine Ängste und Erwartungen projizieren kann. Er garantiert bestimmte Disziplinierungsmaßnahmen, die in komplexeren Kulturen entstehen müssen, um die Übertretung von Gruppenregeln zu ahnden. Und er dient dem Statusbedürfnis: Ein reicher Häuptling, der viele rauschende Feste feiert, suggeriert seinen »Untertanen« Stolz und Wertigkeit. Grundsätzlich gilt natürlich, dass die Vorteile hierarchischer Kooperation die Nachteile ausgleichen müssen, die der Status des Führers als Kosten mit sich bringt.21
Big-Men-Häuptlinge der ersten Stunde waren noch »funktionale Parasiten«, die allerdings in einem prekären Status gehalten wurden - es gab durchaus demokratische Elemente auch in der hierarchischen Stammesgesellschaft. Ein Häuptling konnte abgesetzt und sogar getötet werden, wenn ihm das Kriegsglück abhold blieb oder wenn er für das Wohl des Stammes keine Vorsorge traf. Was aber, wenn er sich weigerte? Wenn er seine Macht so massiv ausbaute, dass er irgendwann unberührbar wurde?
Big Men erlernten im Laufe der Zeit Kulturtechniken, die ihre Macht befestigten. Sie entwickelten Charisma - jene psychologische Energie, durch die Menschengruppen ihr Heil in eine idealisierte Gestalt projizieren (wir können sie bis heute auf frenetischen Popkonzerten besichtigen). Ein Schlüssel zur nächsten Stufe der Machtfestigung und Hierarchie war die Religion. In »klassischen« Big-Men-Kulturen herrschte noch eine intakte Arbeitsteilung zwischen weltlicher und spiritueller Macht. Priester, Schamanen und Big Men befinden sich in verschiedenen Gebäuden und Machtsphären. Irgendwann aber verschmelzen religiöse und weltliche Macht zur totalen Herrschaft.
Die steinernen Zeugen dieser Fusionsphase zwischen weltlicher Macht und magischer Welt können wir in Stonehenge besichtigen, auf den Osterinseln, in den gigantischen Tempelanlagen von Angkor Wat oder den Steinpyramiden der Mayas und Tolteken. Sie waren, wenn man so will, Potenzsymbole von Big Men. Hier findet sich auch die Nahtstelle zu einem weiteren Wegabschnitt der menschlichen Kultur: den Imperien. In ihnen wuchsen die Autoritätssysteme zu mächtigen Herrschaftsgebilden heran. Ein erster Typus von Massengesellschaft entstand, mit strikten Arbeitsteilungen (Bauern, Krieger, Priester). Und einer eben nicht mehr von der gesellschaftlichen Basis kontrollierbaren Macht eines kultisch verehrten Herrschers.
Die Imperien: Organisation, Kommunikation, Kontrolle
Aus manchen Big-Men-Kulturen wuchsen im Laufe der Zeit regelrechte Großreiche heran. Die Sumerer kontrollierten ein Einflussgebiet in einem Bogen von Mesopotamien bis ins Niltal. Ihnen folgten die Hethiter und die benachbarten Assyrer. Den ägyptischen Pharaonen gelang es, ihr Reich über fast 3000 Jahre zu stabilisieren und zu entwickeln. Ökonomische Basis ihrer Herrschaft war eine hocheffiziente Irrigationsökonomie im Nildelta, ein ausgeklügeltes, zentral gesteuertes Bewässerungssystem, das mittels wiederkehrender Schlammlieferungen des Nil enorme Produktivitätsraten ermöglichte. Diese technologische Basis einer bis dahin unbekannten agrarischen Produktivität erzeugte von Anfang an strenge Machtstrukturen: Wer das Bewässerungssystem beherrschte, verfügte über fast grenzenlose Macht - die biblische Erzählung des Volkes Israel handelt von der dazugehörigen Unterwerfungs- und Rebellionsgeschichte.
Damit und mit einer ausgedehnten Viehwirtschaft - die Ägypter züchteten sogar Gazellen - konnte man nicht nur Zigtausende von Arbeitern und Sklaven ernähren, sondern auch eine superreiche und von einem hochartifiziellen Totenkult besessene Herrscherkaste alimentieren.
Woher stammte die erstaunliche Stabilität der antiken Imperien? Sie basierten auf einer Art »Madoff-Strategie mit Menschenkraft«. 22 Wie der New Yorker Börsenspekulant, der zum Höhepunkt der Finanzkrise 50 Milliarden Dollar seiner Kunden verspielt hatte, indem er die Zinsen stets mit den späteren Einlagen weiterer Anleger bezahlte, lösten die Imperien ihre zentrale Knappheit, nämlich Arbeitskraft, mit einem Schneeballsystem billiger Arbeitskräfte, die durch immer neue Feldzüge und Unterwerfungen herangeschafft wurden. Imperien mussten nach außen dauerhaft grausam sein, um sich nach innen zivil organisieren zu können.
Anders als in den Dschungeln der Amerikas, die vergleichsweise spät besiedelt wurden, lebten in den an Ägypten angrenzenden Wüstenregionen, aber auch in den »barbarischen« Regionen Europas und Asiens mehr als genug Menschen, deren Lebensgrundlage und Verteidigungskraft zu schwach war, als dass sie sich gegen Unterwerfung hätten wehren können. So fanden die Imperien Persiens, Athens, Roms und Ägyptens über Jahrhunderte immer genug Menschennachschub, um den enormen Verschleiß an menschlicher Arbeitskraft auszugleichen. Bürger der antiken Großreiche waren verpflichtet, den Ruhm und die Stärke des Imperiums zu mehren, indem sie siegreiche Feldzüge unternahmen - eine ausgeklügelte Sozioökonomie von Geben und Nehmen (auf die nicht zufällig die Nationalsozialisten in ihrem kriegerischen Herrenmenschentum 2000 Jahre später zurückgreifen sollten).
Ein weiteres Stabilisierungselement erfolgreicher Imperialkulturen war die innere Konfliktmoderation via »Checks and Balances«. Im antiken Griechenland hatte sich schon 400 vor Chr. eine »Kultur der Rechte« entwickelt. Das Römische Reich erwuchs zunächst aus der Regierungsform der Republik, bevor sich in der Nachfolge Caesars das Imperatorentum etablierte. Mit diesen Frühformen der Demokratie wurde die instabile Dynamik der dynastischen Herrschaft mit ihrem Hang zu Intrigen, Meuchelmorden und frühen Toden zumindest teilweise gebrochen.
Doch der Kern jeder imperialen Stabilität blieb stets die Fähigkeit zur militärischen Organisation. Die Macht des Römischen Reiches ruhte auf der Leistung, 35 Legionen mit je 5500 Soldaten aus 100 Kulturen über mehrere Kontinente hinweg kontinuierlich zu unterhalten und zu kontrollieren, auszurüsten und zu trainieren. Die fast schon industrielle Nutzung von Kriegstechniken und Versorgungslinien, die kontinentale Verlegung von Wasserleitungen und Straßen, aber auch die ausgeklügelte Verwaltungstechnik der Provinzen war die Basis des historischen Erfolgs des römischen Imperiums: Bis zu 40 Provinzen zu regieren, mit derselben konsularischen Prozedur und denselben Verwaltungsmethoden, mit Städten, die sich bis in die öffentlichen Bauten hinein glichen - das Römische Reich ähnelte einem gewaltigen Franchise-Unternehmen und war ein geschlossener Wirtschaftsraum. »Rom« konnte die Brotpreise in Pergamon bestimmen, aber auch in Londinium. Hinzu kamen die verbindende Kraft der klaren lateinischen Sprache und die von den Griechen und Arabern übernommene Mathematik. Manche Kulturtechniken von heute strukturierten schon die damalige Welt.
Erstaunlicherweise gilt das Römische Reich heute weniger als Beispiel für Fortschritt und Erfindungsreichtum, vielmehr lesen wir seine Geschichte als Symbol eines dramatischen Untergangsprozesses - sein Ende und die danach folgenden chaotischen Zeiten des Mittelalters werden als Allegorie für das Scheitern von Zivilisation an sich gedeutet. Doch das römische Imperium überdauerte mehr als 500 Jahre (mehr als zehnmal so lang wie das amerikanische in der Neuzeit), bevor es sich in Ost-Rom neu gründete und noch einmal einige hundert Jahre Bestand hatte. Die zivilisatorischen Errungenschaften der Römer finden sich in der Kultur, der Technik- und Geistesgeschichte, der Architektur, Sprache und Ästhetik bis heute. In der Geschichte des Wandels gibt es kein völliges »Verschwinden« oder doch nur höchst selten. Kulturformen, Ideen, Soziotechniken werden in Folge-Epochen auf vielfältige Art recycelt und variiert. Sie formen sich in »Meme« um - in durch Schrift, Sprache, kollektive Erinnerung von Generation zu Generation transportierte »geistige Replikatoren«. Wie die Gene in der biologischen Evolution bilden diese Meme die Bausteine, aus denen sich die Kulturformen der Zukunft zusammensetzen. Kulturgeschichte ist die Rekombination solcher Meme unter neuen historischen und technischen Bedingungen.23
Das römische Imperium scheiterte mit Sicherheit nicht an einer Ursache allein. Manche machen die Bekehrung Konstantins zum Christentum im Jahre 312 verantwortlich. Andere, wie Max Weber, die Erosion der Sklavenwirtschaft. Immer wieder wird mit der Überdehnung des Imperiums, mit der Dekadenz und Korruption der herrschenden Schichten argumentiert. Einen erheblichen Anteil hat jedoch eine Lebensweise, die ich in dieser Chronik des Wandels nur streifen kann: das »pastorale Nomadentum«. Jene Hirten- und Reitervölker, die in den ersten Jahrhunderten nach Chr. von Zentralasien nach Europa vordrangen: Hunnen, Tataren und Mongolen spielten beim Niedergang Roms eine Schlüsselrolle.
Diese Reiterkulturen waren eine interessante Mischung aus mehreren Organisationsformen, die die Menschheit bis dahin entwickelt hatte. Vom Nomadentum stammte die eher antihierarchischen Organisation - junge, männliche Krieger bildeten zusammen eine mobile soziale Einheit, die Bindungen der Generationen blieb lose und informell. Politisch waren die Reitervölker tolerant, wenn sie ein Gebiet erst einmal erobert hatten. Die »Pax mongolica«, die mongolische Friedensgewähr, sicherte in weiten Teilen Eurasiens über hundert Jahre freien Handel, Kulturaustausch und Religionsfreiheit. Andererseits gab es in dieser dynamischen Kultur Big Men im Stile eines Dschingis Khan (etwa ein Zehntel der osteuropäischen Bevölkerung soll angeblich Gene vom großen Khan in sich tragen). Die Reitervölker waren eine Zeitlang so erfolgreich, weil sie dezentrale und zentrale Strukturen effektvoll miteinander kombinierten. Ihre Eroberungslust sollte auch in der Evolution einer anderen Zivilisation eine zentrale Rolle spielen: des Großen und Ewigen China, das sie im 12. Jahrhundert fast vollständig überrannten.
Europas Aufstieg: Regen, Gattenehe, Vielfalt
Was ließ Europa im Rennen um den technischen, kulturellen und sozialen Fortschritt am Ende den nächsten Etappensieg davontragen? Zunächst ganz banal: das Klima.
Während Chinas fruchtbare Reisfelder in einer gemäßigten Zone mit milden, regenreichen Wintern und warmen Sommern liegen, ist Westeuropa, der »Auswuchs« des eurasischen Kontinents, den atlantischen Winden und Wetterwechseln ausgesetzt. Kurze, wachstumsintensive Sommer wechseln sich mit kalten Wintern ab. Das verhindert die allzu große Vermehrung von Insekten und Krankheitserregern. Es erzwingt die Errichtung fester Häuser, was die Bautechniken fördert. Der Wechsel der Temperaturen und Jahreszeiten bringt auch diversere Kultur hervor: Kleider müssen mal warmer, mal kalter Witterung entsprechen, deshalb differenzieren sich Stoffe, Materialien und Stile aus. Europas Topographie ist zerklüftet und vielfältig; auf relativ geringer Fläche finden sich viele verschiedene Klimazonen, was die Biodiversität erhöht. Nicht ein Grundnahrungsmittel wie der Reis setzte sich in den kleinteiligen Landschaften durch, sondern es gibt eine ganze Reihe - Mais, Gerste, Weizen, Roggen, Hafer, Dinkel. Nicht nur Schwein und Ziege wie in China, sondern auch Rind, Pferd und Schaf konnten hier heimisch werden. Felder konnten in Europa durch Rodung der Wälder beliebig gewonnen werden, Bauern ihre Höfe individuell ausweiten - ganz anders als in China, wo das Terrassensystem Grenzen setzte und Erweiterungen der Anbaufläche allenfalls über kollektive Beschlüsse möglich waren.
Europa ist der einzige Kontinent auf der Erde, der moderate, kontinuierliche Regenfälle rund ums Jahr aufweist, was die landwirtschaftliche Arbeit erleichtert. Alle anderen kennen lange Trockenzeiten, die zur Bewässerung zwingen, und intensive Regenzeiten, in denen alle Transportwege monatelang unpassierbar und die Flüsse reißend sind. In weiten Teilen Asiens und Afrikas bedeutet Regen eine temporäre Sintflut, die die Landschaft eher verwüstet als wässert. In Europa fließen die Flüsse das ganze Jahr über, die kleineren wie die größeren, auch das ein Vorteil.
Die Kraft der Wasser- und Windmühlen bildeten eine wichtige Grundlage der technischen Evolution. Die ersten Wassermühlen nahmen in Europa bereits im 12. Jahrhundert ihren Betrieb auf, ihre Technik verbreitete sich rasch entlang der mitteleuropäischen Flussläufe.24 Mühlen übernahmen alle Arbeiten, die Menschen auch bei schwerer körperlicher Anstrengung nicht oder nur sehr mühsam schafften: Hämmern, Stoßen, Stampfen, Mahlen. Mühlen eröffneten den Weg ins »mechanische Zeitalter«. Wo sie am emsigsten klapperten, entlang mittelgroßer Flüsse mit mäßiger Flussgeschwindigkeit, entwickelten sich auch die Kerne der innovativen Handwerkskulturen. Die Uhrmacher, Holzverarbeiter, Instrumentenbauer, Metallurgen, die die entscheidenden Vorstufen zur Maschine schufen, wohnten und werkelten in Mühlenregionen.
Während die höchste Ehre und das höchste Ziel eines chinesischen Handwerkers in der Herstellung der perfekten Kopie lag, ging es in den innovativen Zentren Europas schon frühzeitig um die Erfindung des Neuen. Basis bildeten die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die seit der Renaissance einsetzten; sie schufen den dynamischen Rahmen für eine Innovationskultur, die sich aus dem Wissen und Streben nach Erkenntnis ebenso speiste wie aus wirtschaftlichen Interessen. Europas Künstler, Philosophen und Techniker waren eben nicht nur Lakaien höherer Mächte, auch wenn Kirche und Hof zunächst eine wichtige Rolle bei der Auftragsvergabe spielten. In Europa stritten sich viele Herrscher seit den Völkerwanderungen munter und bisweilen blutig um Territorien, um Macht und Einfluss. Wissenschaftler, Künstler und Gelehrte, aber auch Erkenntnisse und Patente wurden in diesem Wettstreit bald zu einem Aktivposten. Konkurrenz belebt bekanntlich das Geschäft. Fiel ein hervorragender Denker, Dichter oder Komponist in einem Fürstentum in Ungnade, bekam er aus dem nächsten garantiert ein besseres Angebot (in China und anderen monolithischen Imperien sah die Sache anders aus; Verbannung war noch die Positivste aller Möglichkeiten). So befeuerte die Konkurrenz der Kleinstaaten die Künste, die Wissenschaft und technologischen Fortschritt. Die lange Geschichte des feudalen Mäzenatentums, von den Tagen Michelangelos und Keplers bis in die Zeit Mozarts, spricht Bände. So entstand eine »Kultur des Wandels«, weil Europa ein Kontinent der dynamischen Ungleichgewichte war - des ständigen Kampfes zwischen Alt und Neu, Peripherie und Zentrum, Zentralität und Dezentralität.25
Andere Faktoren kamen hinzu. Europas Schrift, aus dem Lateinischen entstanden, bot anders als die chinesische, arabische oder die der indianischen Hochkulturen einen »Quellcode«, der sich gleichermaßen für Dokumentation und Kommunikation eignete. Chinesische Schriftzeichen erfordern die elitäre Kunst von Schriftgelehrten, bis zu 10 000 Zeichen müssen erlernt werden, um flüssige Texte zu schreiben. In Europa unternahmen die christlichen Kirchen in der Reformationszeit die ersten Initiativen zur Alphabetisierung des Volkes. So konnte sich der Buchdruck ungleich besser entwickeln - und kulturelle Emanzipationswirkung erzeugen.
Europas Religion, das ständig »mutierende« Christentum, fand, anders als die transzendentalen Religionen des Fernen Ostens, immer wieder Anschluss an die Lebenswirklichkeit der Menschen. Christliche Klöster des Mittelalters waren immer auch Zentren von Wirtschaftstätigkeiten. Das Christentum war es auch, das die genealogischen Strukturen von innen heraus veränderte. Im Zentrum des christlichen Familienbildes steht die »Gattenehe«, also die heilige Einheit von Mann und Frau. In den traditionalen Gesellschaften und Ahnenkulturen, wie wir sie heute noch vor allem in der islamischen Welt kennen, sind Paare fest in den »Schwarm der Sippe« integriert. Großeltern, Tanten, Onkel, Cousinen, Großonkel, Vettern ersten, zweiten, dritten Grades - alle haben mitzureden und mitzubestimmen, was das Ehepaar unternimmt, wie es sich kleidet, wohnt, seine Sexualität gestaltet. Oft sind es die Ältesten, die ganz und gar das Sagen haben (in der klassischen Ahnenkultur Asiens und Afrikas sogar noch dann, wenn sie tot sind). Durch die »Gattenehe« entstand im Herzen der christlichen Kultur Privatheit, die Autonomie einer kleineren Kernfamilie und eine kommunikative Distanz zwischen den Generationen.26
Die Stadt: Markt, Handel, Rechte
Wo Menschen auf engem Raum leben, ändern sich die Regelsysteme. Städte erzeugen Freiheiten, Nischen, Entkoppelungen von Traditionen, und sie erzwingen neue soziale Differenzierungen. Und deshalb gilt von Babylon bis Manhattan, von Buxtehude bis Berlin: Stadtluft macht frei und klug.27 Nicht jeden und nicht sofort. Aber auf Dauer bieten größere Ansammlungen von Menschen ungleich mehr Optionen, Nischen, Chancen für den Einzelnen. Städte erlauben Menschen, schneller voneinander zu lernen. Sie sind vor allem für diejenigen, die darauf angewiesen sind, Verbindungen und Innovationen herzustellen - Händler, Geschichtenerzähler, Gastronomen, Künstler, Tüftler -, das ideale Soziotop.
Lebendige Städte bergen in ihrem Kern zudem eine alte Institution des Wandels: den Markt. Märkte bringen Menschen aus unterschiedlichen Kulturen zusammen und zwingen sie zu Verhandlungen und Kooperationen (natürlich kann man sein Gegenüber übers Ohr hauen - aber nicht lange!). Güteraustausch über weite
1. Auflage
Copyright © 2009 Deutsche Verlags-Anstalt, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Grafiken: © Peter Palm, Berlin
Gesetzt aus der Garamond
eISBN : 978-3-641-03905-9
www.dva.de
Leseprobe
www.randomhouse.de