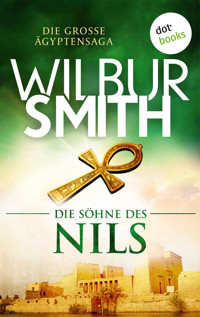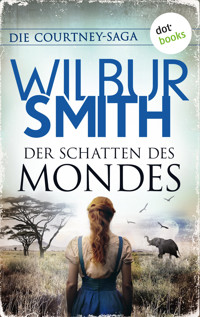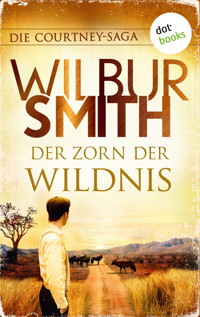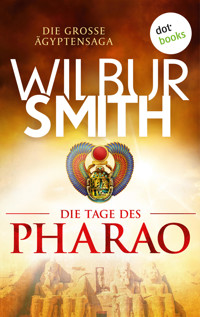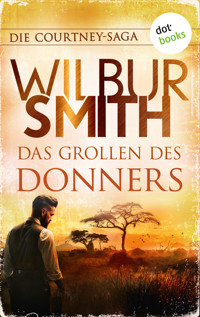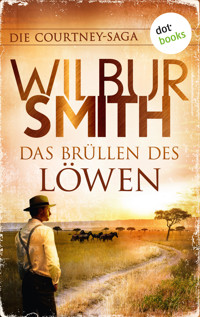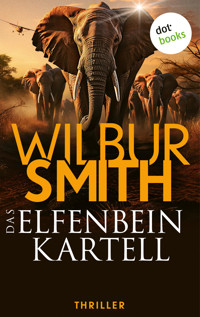
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein Kontinent voll wilder Schönheit – ein Verbrechen, das nach Vergeltung schreit Dr. Daniel Armstrong, Ökologe und Dokumentarfilmer, hat sein Leben dem Schutz der Tiere und des Regenwaldes in Afrika gewidmet. Doch als eine Bande von Wilderern seinen Jugendfreund, den Chefaufseher des Nationalparks, ermordet und die von der Regierung geschützten Elfenbeinlager stiehlt, schwört Daniel bittere Rache. Unterstützt wird er auf seiner Suche von der leidenschaftlichen Anthropologin Kelly Kinnear, die nicht länger mit ansehen will, wie die Lebensweise der einheimischen Bevölkerung durch die Gier von Männern am anderen Ende der Welt zerstört wird. Als sie sich an die Fersen der Wilderer heften, kommen sie schon bald etwas viel Schrecklicherem als Mord auf die Spur … Wird es ihnen gelingen, das Land und die Menschen, die sie lieben, vor der zerstörerischen Macht von Gier und Korruption zu retten? »Die einzigartige Mischung aus Action, Abenteuer und exotischen Schauplätzen macht Wilbur Smith zu einem faszinierenden Leseerlebnis.« The Mirror Der nervenaufreibende Action-Thriller »Das Elfenbein-Kartell« von Bestseller-Autor Wilbur Smith wird alle Fans von Clive Cussler begeistern!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 896
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über dieses Buch:
Dr. Daniel Armstrong, Ökologe und Dokumentarfilmer, hat sein Leben dem Schutz der Tiere und des Regenwaldes in Afrika gewidmet. Doch als eine Bande von Wilderern seinen Jugendfreund, den Chefaufseher des Nationalparks, ermordet und die von der Regierung geschützten Elfenbeinlager stiehlt, schwört Daniel bittere Rache. Unterstützt wird er auf seiner Suche von der leidenschaftlichen Anthropologin Kelly Kinnear, die nicht länger mit ansehen will, wie die Lebensweise der einheimischen Bevölkerung durch die Gier von Männern am anderen Ende der Welt zerstört wird. Als sie sich an die Fersen der Wilderer heften, kommen sie schon bald etwas viel Schrecklicherem als Mord auf die Spur … Wird es ihnen gelingen, das Land und die Menschen, die sie lieben, vor der zerstörerischen Macht von Gier und Korruption zu retten?
Über den Autor:
Wilbur Smith (1933–2021) wurde in Zentralafrika geboren und gehört zu den erfolgreichsten Schriftstellern der Gegenwart. Der Debütroman seiner Jahrhunderte umspannenden Südafrika-Saga um die Familie Courtney, begründete seinen Welterfolg als Schriftsteller. Seitdem hat er über 50 Romane geschrieben, die allesamt Bestseller wurden, und in denen er seine Erfahrungen aus verschiedenen Expeditionen in die ganze Welt verarbeitete. Seine Bücher wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt und mehrfach verfilmt. Wilbur Smith starb 2021 in Kapstadt im Kreise seiner Familie.
Die Website des Autors: www.wilbursmithbooks.com/
Die Autorin/der Autor bei Facebook: www.facebook.com/WilburSmith/
Die Autorin/der Autor auf Instagram: www.instagram.com/thewilbursmith/
Die große Südafrika-Saga des Autors um die Familie Courtney erscheint bei dotbooks im eBook. Der Reihenauftakt »Das Brüllen des Löwen« ist auch als Hörbuch bei SAGA Egmont erhältlich.
Die große Ägypten-Saga über den Eunuchen Taita ist bei dotbooks als eBook erhältlich. Der Reihenauftakt »Die Tage des Pharao« ist auch als Hörbuch bei SAGA Egmont erhältlich.
Außerdem bei dotbooks erschienen der Abenteuerroman »Der Sonnenvogel« sowie die Action-Thriller »Greed – Der Ruf des Goldes«, »Blood Diamond – Tödliche Jagd«, »Black Sun – Die Kongo-Operation«, »Das Elfenbein-Kartell« und »Atlas – Die Stunde der Entscheidung«. Weitere Bände in Vorbereitung.
***
eBook-Ausgabe Januar 2025
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1991 unter dem Originaltitel »Elephant Song« bei Macmillan Ltd., London. Die deutsche Erstausgabe erschien 1992 unter dem Titel »Das Lied der Elefanten« bei Blanvalet.
First published in 1991 by Macmillan Publishers Ltd
Copyright © Wilbur Smith 1991
Copyright © 1992 der deutschen Erstausgabe bei Blanvalet Verlag GmbH, München
Copyright © der eBook-Ausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von AdobeStock/JKLoma und shutterstock/Johan G
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (vh)
ISBN 978-3-98952-475-0
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. In diesem eBook begegnen Sie daher möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Diese Fiktion spiegelt nicht automatisch die Überzeugungen des Verlags wider oder die heutige Überzeugung der Autorinnen und Autoren, da sich diese seit der Erstveröffentlichung verändert haben können. Es ist außerdem möglich, dass dieses eBook Themenschilderungen enthält, die als belastend oder triggernd empfunden werden können. Bei genaueren Fragen zum Inhalt wenden Sie sich bitte an [email protected].
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Wilbur Smith
Das Elfenbein-Kartell
Thriller
Aus dem Englischen von Hartmut Huff
dotbooks.
Widmung
Für meine Frau und geliebte Gefährtin
Danielle Antoinette
Kapitel 1
Es war ein fensterloses, strohgedecktes Haus aus geglätteten Sandsteinblöcken, das Daniel Armstrong vor fast zehn Jahren mit eigenen Händen gebaut hatte. Damals war er gerade Wildhüter in der Verwaltung des Nationalparks geworden. Jetzt hatte man das Gebäude in ein regelrechtes Schatzhaus verwandelt.
Johnny Nzou steckte seinen Schlüssel in das schwere Vorhängeschloß und öffnete die Doppeltüren aus einheimischem Teak. Johnny war der Oberwildhüter des Chiwewe Nationalparks. Früher war er Daniels Spurensucher und Gewehrträger gewesen, ein aufgeweckter junger Matabele, dem Daniel am Licht Tausender Lagerfeuer Englisch lesen, schreiben und fließend zu sprechen gelehrt hatte.
Daniel hatte Johnny das Geld geliehen, um seinen ersten Fernkurs an der Universität von Südafrika zu belegen, der schließlich zu einem Abschluß als Bakkalaureus der Naturwissenschaften geführt hatte. Die beiden jungen Männer, der eine schwarz, der andere weiß, hatten gemeinsam, oft zu Fuß oder mit dem Fahrrad, in den unendlichen Weiten des Nationalparks patrouilliert. In der Wildnis hatten sie eine Freundschaft geschmiedet, der auch die folgenden Jahre der Trennung nichts anhaben konnten.
Jetzt schaute Daniel in das düstere Innere des Gebäudes und pfiff leise.
»Teufel auch, Johnny, du hast während meiner Abwesenheit die Hände wirklich nicht in den Schoß gelegt.«
Der Schatz war bis zu den Dachsparren hochgestapelt und Hunderttausende Dollar wert.
Mit zusammengekniffenen Augen musterte Johnny Nzou Daniels Gesicht, um zu sehen, ob sich Kritik in der Miene seines Freundes abzeichnete. Doch diese Reaktion war nichts als ein Reflex, denn er wußte, daß Daniel ein Verbündeter war, der sich des Problems noch bewußter war als er selbst. Dennoch war das Thema derart emotional geladen, daß ihm die Erwartung von Gefühlsumschwüngen und Kritik zur zweiten Natur geworden war.
Daniel aber hatte sich bereits wieder seinem Kameramann zugewandt. »Können wir hier einen Scheinwerfer anbringen? Ich möchte ein paar gute Innenaufnahmen haben.«
Der Kameramann schleppte sich unter dem Gewicht der schweren Akkus, die an seiner Hüfte befestigt waren, vorwärts und schaltete die Bogenlampe in seiner Hand ein. Die hohen Stapel des Schatzes wurden von einem grellen, blauweißen Licht beleuchtet.
»Jock, folge mir und dem Wildhüter durchs ganze Lagerhaus«, wies Daniel den Kameramann an. Der nickte und trat näher heran, wobei er die glänzende Sony-Videokamera auf seiner Schulter balancierte. Jock war Mitte Dreißig. Er trug nur eine kurze Khakihose und offene Sandalen. In der Hitze des Sambesi-Tales glänzte seine nackte Brust vor Schweiß. Sein langes Haar hatte er mit einem Lederriemen im Nacken zusammengebunden. Er sah aus wie ein Popstar, war aber ein Künstler mit der großen Sony-Kamera.
»Verstanden, Boß«, sagte er und schwenkte die Kamera über den unordentlichen Haufen von Elefantenstoßzähnen, um bei Daniels Hand zu verharren, die über die elegante Krümmung eines leuchtenden Stücks Elfenbein glitt. Dann trat er zurück, um Daniel in die Totale zu bekommen.
Daniel war nicht allein wegen seines Doktortitels in Biologie, seiner Bücher und Vorlesungen zu einer internationalen Autorität und zum Wortführer der afrikanischen Ökologen geworden. Er verfügte außerdem über das gesunde Aussehen eines Mannes, der viel draußen in der Natur ist, und strahlte jene Art von Charisma aus, die sich so gut auf dem Fernsehschirm macht. Seine Stimme war tief und fesselnd, und in seinem Akzent klangen noch genügend Sandhurst-Untertöne mit, um die klanglosen, unmelodischen Vokale der Kolonialsprache weicher zu machen. Sein Vater war während des Zweiten Weltkriegs Stabsoffizier in einem Regiment der Guards gewesen und hatte in Nordafrika unter Wavell und Montgomery gedient. Nach dem Krieg ging er nach Rhodesien, um Tabak anzubauen. Daniel war in Afrika geboren worden, wurde aber nach England geschickt, um seine Ausbildung in Sandhurst zu beenden, bevor er wieder nach Rhodesien zurückkehrte, um in den National Parks Service einzutreten.
»Elfenbein«, sagte er jetzt, während er in die Kamera blickte, »seit der Zeit der Pharaonen eine der schönsten und kostbarsten Natursubstanzen. Die Zierde des afrikanischen Elefanten – und sein schreckliches Verhängnis.«
Daniel begann an den Reihen der gestapelten Stoßzähne entlangzugehen, und Johnny Nzou trat neben ihn und hielt mit ihm Schritt. »Zweitausend Jahre lang hat der Mensch den Elefanten gejagt, um dieses lebende weiße Gold zu bekommen. Und trotzdem hat es vor nur einem Jahrzehnt noch über zwei Millionen Elefanten auf dem afrikanischen Kontinent gegeben. Die Elefantenpopulation schien eine unerschöpfliche Ressource zu sein, ein Vermögen, das geschützt, geerntet und kontrolliert wurde – bis dann etwas auf schreckliche und tragische Weise fehlschlug. In den vergangenen zehn Jahren sind fast eine Million Elefanten abgeschlachtet worden. Es ist kaum vorstellbar, daß dies zugelassen werden konnte. Wir sind hier, um herauszufinden, was fehlgeschlagen ist und wie der afrikanische Elefant, der kurz vor der Ausrottung steht, gerettet werden kann.«
Er sah Johnny an. »Heute ist Mr. John Nzou bei mir, Chefwildhüter des Chiwewe Nationalparks und ein Vertreter der neuen Generation afrikanischer Umweltschützer. Zufällig bedeutet Nzou in der Sprache der Shona Elefant. Doch nicht nur dem Namen nach ist John Nzou Mr. Elefant. Als Wildhüter des Chiwewe ist er für eine der größten und gesündesten Elefantenherden verantwortlich, die es in der afrikanischen Wildnis noch gibt. Sagen Sie uns, Herr Reservatsaufseher, wie viele Stoßzähne haben Sie hier, in diesem Lagerraum des Chiwewe Nationalparks?«
»Derzeit sind hier fast fünfhundert Stoßzähne gelagert – vierhundertsechsundachtzig, um genau zu sein – mit einem Durchschnittsgewicht von sieben Kilo.«
»Auf dem internationalen Markt ist ein Kilo Elfenbein dreihundert Dollar wert«, fiel Daniel ein, »so daß der Gesamtwert des hier lagernden Elfenbeins über eine Million Dollar beträgt. Wo kommt das alles her?«
»Einige Stoßzähne sind Funde – Elfenbein von Elefanten, die tot im Park entdeckt wurden. Einiges ist illegales Elfenbein, das meine Ranger von Wilderern konfisziert haben. Aber der Großteil dieser Stoßzähne stammt aus den Auslese-Operationen, die meine Abteilung durchzuführen gezwungen ist.«
Die beiden blieben am anderen Ende des Ganges stehen, machten kehrt und blickten wieder in die Kamera. »Über das Ausleseprogramm werden wir später sprechen, Herr Reservatsaufseher. Aber können Sie zuerst ein wenig mehr über die Aktivitäten der Wilderer in Chiwewe erzählen? Wie schlimm ist das?«
»Es wird jeden Tag schlimmer.« Johnny schüttelte traurig den Kopf. »Da die Elefanten in Kenia, Tansania und Sambia praktisch ausgerottet sind, richten die Profis ihre Aufmerksamkeit auf unsere gesunden Elefantenherden weiter südlich. Sambia liegt direkt auf der anderen Seite des Sambesi, und die Wilderer, die auf diese Seite hinüberkommen, sind organisiert und besser bewaffnet als wir. Sie schießen, um zu töten – auf Menschen ebenso wie auf Elefanten und Nashörner. Wir sind gezwungen, das gleiche zu tun. Wenn wir auf eine Bande Wilderer stoßen, schießen wir zuerst.«
»Und alles hierfür ...« Daniel legte seine Hand auf den nächsten Stapel Stoßzähne. Es gab keine zwei Elfenbeinschäfte, die identisch waren. Jeder Zahn war anders geschwungen. Einige waren fast gerade, lang und dünn wie Stricknadeln. Andere waren wie ein gespannter Langbogen geschwungen. Einige waren so scharfspitzig wie Speere, andere wieder flach und stumpf. Es gab perlengleiche Zähne und andere im Farbton dunkelgelben Alabasters; wieder andere waren durch Pflanzensäfte dunkel gefleckt und durchs Alter zernarbt und abgewetzt.
Das meiste Elfenbein stammte von Elefantenkühen oder Jungtieren. Ein paar Stoßzähne waren nicht länger als der Unterarm eines Mannes. Sie stammten von jungen Kälbern. Nur sehr wenige waren prächtig geschwungene, herrliche Schäfte – das schwere, reife Elfenbein alter Bullen.
Daniel strich über einen dieser Stoßzähne, und sein Gesichtsausdruck galt nicht nur der Kamera. Wieder einmal spürte er die ganze Schwere der Melancholie, die ihn überhaupt erst dazu bewegt hatte, über das Dahinschwinden und die Zerstörung des alten Afrikas und seiner zauberhaften Tierwelt zu schreiben.
»Ein kluges und großartiges Tier ist auf dies hier reduziert worden.« Seine Stimme senkte sich zu einem Flüstern. »Selbst wenn sie unvermeidlich sind, können wir doch die Augen nicht völlig vor den tragischen Veränderungen in der Natur, die diesen Kontinent erschüttern, verschließen. Ist der afrikanische Elefant symbolisch für sein Land? Der Elefant stirbt. Stirbt Afrika?«
Seine Ehrlichkeit war unbestreitbar. Die Kamera zeichnete alles getreu auf. Es war diese Ehrlichkeit, die die enorme Wirkung seiner Fernsehsendungen in aller Welt ausmachte.
Jetzt faßte sich Daniel mit offensichtlicher Mühe und wandte sich wieder an Johnny Nzou. »Was meinen Sie, Herr Oberaufseher, ist der Elefant zum Untergang verurteilt? Wie viele dieser wundervollen Tiere gibt es in Simbabwe, und wie viele davon leben im Chiwewe Nationalpark?«
»In Simbabwe gibt es schätzungsweise zweiundfünfzigtausend Elefanten. Unsere Zahlen für Chiwewe sind weit genauer. Erst vor drei Monaten konnten wir im Park eine Zählung vom Flugzeug aus durchführen, die von der Internationalen Union für Naturschutz gefördert wurde. Das ganze Parkareal wurde fotografiert, und die Tiere wurden auf den Vergrößerungen gezählt.«
»Wie viele?« fragte Daniel.
»Allein in Chiwewe sind es achtzehntausend Elefanten.«
»Das ist eine riesige Population, fast ein Drittel aller übriggebliebenen Tiere in diesem Land – alle in diesem Gebiet.« Daniel hob eine Augenbraue. »In einem Klima, das von Hoffnungslosigkeit und Pessimismus beherrscht wird, muß das sehr ermutigend für Sie sein.«
Johnny Nzou runzelte die Stirn. »Im Gegenteil, Doktor Armstrong, wir sind wegen dieser Zahlen überaus besorgt.«
»Können Sie uns das bitte erklären?«
»Ganz einfach, Doktor. So viele Elefanten können wir nicht ernähren. Wir schätzen, daß dreißigtausend Elefanten eine ideale Population für ganz Simbabwe wären. Ein einziges Tier benötigt täglich bis zu einer Tonne pflanzlicher Nahrung. Um dieses Futter zu bekommen, stößt es jahrhundertealte Bäume um, selbst Bäume mit einem Stammdurchmesser von über einem Meter.«
»Was wird geschehen, wenn Sie zulassen, daß diese riesige Herde weiter gedeiht und zunimmt?«
»Ganz einfach. In sehr kurzer Zeit wird sie diesen Park in ein Trockengebiet verwandeln, und wenn das geschieht, wird die Elefantenpopulation eingehen. Uns wird nichts mehr bleiben – weder Bäume noch Park, noch Elefanten.«
Daniel nickte aufmunternd. Wenn er den Film bearbeitete, würde er an dieser Stelle eine Reihe von Szenen einbauen, die er einige Jahre zuvor im Amboseli Park in Kenia aufgenommen hatte. Es waren erschreckende Dokumente der Verwüstung. Bilder von nackter, roter Erde und toten, schwarzen Bäumen, die ihre kahlen Äste in verzweifeltem Flehen in den erbarmungslos blauen afrikanischen Himmel reckten, während die ausgedorrten Kadaver der großen Tiere wie ausrangierte Ledertaschen dort lagen, wo Hunger und Wilderer sie getötet hatten.
»Haben Sie eine Lösung dafür?« fragte Daniel leise.
»Eine drastische, fürchte ich.«
»Werden Sie sie uns zeigen?«
Johnny Nzou zuckte die Achseln. »Es ist nicht sehr schön, dabei zuzuschauen, aber ja, Sie können Zeuge dessen sein, was getan werden muß.«
Daniel erwachte zwanzig Minuten vor Sonnenaufgang. Selbst die Jahre, die er in Städten außerhalb Afrikas verbracht hatte, und die vielen Dämmerungen in nördlichen Klimazonen oder in den fließenden Zeitzonen bei Reisen mit Düsenflugzeugen, hatten ihn die Gewohnheit nicht vergessen lassen, die er in diesem Tal angenommen hatte. Natürlich war diese Gewohnheit während der Jahre des schrecklichen rhodesischen Buschkrieges, als er seiner Wehrpflicht bei den Sicherheitskräften nachkommen mußte, nur verstärkt worden.
Für Daniel war die Morgendämmerung die magischste Zeit eines jeden Tages – besonders in diesem Tal. Er kroch aus seinem Schlafsack und langte nach seinen Stiefeln. Seine Männer und er hatten voll bekleidet auf der von der Sonne ausgedörrten Erde geschlafen. Inmitten ihrer hingestreckten Gestalten glühte das Lagerfeuer. Sie hatten kein boma aus Dornenzweigen zu ihrem Schutz errichtet, obwohl während der Nacht an dem Steilhang Löwen geknurrt und gebrüllt hatten.
Daniel schnürte seine Stiefel zu und verließ leise den Kreis der schlafenden Männer. Der Tau, der wie Perlen an den Grashalmen hing, durchnäßte seine Hosenbeine bis zu den Knien, während er sich zu dem felsigen Vorgebirge am Rand der Klippe bewegte. Auf der harten, grauen Granitkuppe fand er einen Platz, wo er sich niederkauerte.
Die Dämmerung kam mit verstohlener und trügerischer Schnelligkeit und tauchte die Wolken über dem Fluß in puderfeine Schattierungen von Rosa und Grau. Über den dunkelgrünen Wassern des Sambesi wogte der Flußnebel und pulsierte wie ein geisterhaftes Ektoplasma, und die fliegenden Enten zeichneten sich dunkel und hart gegen den blassen Hintergrund ab. Ihre Formationen waren exakt, und ihre Flügelschläge zuckten wie Messerklingen im unsicheren Licht.
In nächster Nähe brüllte ein Löwe, abrupte Geräuschsalven, die in einer abnehmenden Reihe von stöhnendem Grunzen erstarben. Daniel erschauerte unter der Erregung, die dieses Geräusch auslöste. Obwohl er es schon unzählige Male gehört hatte, war die Wirkung auf ihn unverändert. Auf der ganzen Welt gab es nichts Vergleichbares. Für ihn war es die wahre Stimme Afrikas.
Dann machte er die Gestalt der großen Katze unter sich am Rande des Sumpfes aus. Dickbäuchig und dunkelmähnig, trug sie ihren massigen Kopf tief und schwang ihn im Rhythmus ihres gleichmäßig arroganten Ganges von Seite zu Seite. Ihr Maul war halb geöffnet, und ihre Fänge glitzerten hinter den schmalen schwarzen Lefzen. Er sah sie im dichten Ufergebüsch verschwinden und seufzte vor Freude über den Anblick, den er genossen hatte.
Dicht hinter ihm war ein leises Geräusch vernehmbar. Als er zusammenzuckte, berührte Johnny Nzou seine Schulter, um ihn zu beruhigen, und setzte sich neben ihn auf die Granitkuppe.
Johnny zündete sich eine Zigarette an. Daniel hatte ihn nie dazu bringen können, diese Gewohnheit aufzugeben. Sie saßen wie sooft zuvor in geselligem Schweigen und schauten zu, wie sich die Dämmerung jetzt immer schneller dem andächtigen Augenblick näherte, in dem die Sonne ihren brennenden Strahlenkranz über die dunkle Masse des Waldes wirft. Das Licht änderte sich, und die ganze Welt war gleißend und strahlend wie ein kostbares Keramikgefäß, daß gerade aus dem Brennofen kommt.
»Die Spurensucher sind vor zehn Minuten ins Lager gekommen. Sie haben eine Herde gefunden«, brach Johnny das Schweigen und damit die Stimmung.
Daniel bewegte sich und schaute ihn an. »Wie viele?« fragte er.
»Etwa fünfzig.« Das war eine akzeptable Menge. Mehr würden sie nicht verarbeiten können, da Fleisch und Haut in der Hitze des Tales schnell verwesten, und eine kleinere Menge hätte den ganzen Einsatz von Menschen und Gerät nicht gerechtfertigt.
»Bist du sicher, daß du das filmen willst?« fragte Johnny.
Daniel nickte. »Ich habe gründlich darüber nachgedacht. Zu versuchen, das zu verheimlichen, wäre unaufrichtig.«
»Die Menschen essen Fleisch und tragen Leder, aber sie wollen nicht ins Schlachthaus sehen«, meinte Johnny.
»Wir haben es hier mit einem komplexen und emotionsgeladenen Thema zu tun. Die Menschen haben ein Recht darauf, das zu wissen.«
»Bei jedem anderen würde ich journalistische Sensationslust vermuten«, murmelte Johnny, und Daniel runzelte die Stirn.
»Du bist wahrscheinlich der einzige Mensch, von dem ich mir das sagen lasse – weil du es besser weißt.«
»Ja, Danny, ich weiß es besser«, stimmte Johnny ihm zu. »Du haßt das ebensosehr wie ich, und doch hast du mich als erster gelehrt, daß es nötig ist.«
»Gehen wir an die Arbeit«, schlug Daniel barsch vor. Sie standen auf und spazierten schweigend dahin zurück, wo die Lastwagen geparkt standen. Das Lager war aufgewacht, und auf dem offenen Feuer wurde Kaffee gekocht. Die Ranger rollten ihre Decken und Schlafsäcke zusammen und überprüften ihre Gewehre.
Vier Ranger waren da, zwei Farbige und zwei Weiße, alle in den Zwanzigern. Sie trugen die schlichte Khakiuniform mit grünen Schulterabzeichen des Park Department, und während sie mit der lässigen Kompetenz von Veteranen ihre Waffen handhabten, plauderten sie fröhlich. Schwarz und Weiß gingen kameradschaftlich miteinander um, obwohl sie gerade in dem Alter waren, in dem sie im Buschkrieg gekämpft hätten und wahrscheinlich auf verschiedenen Seiten gewesen wären. Immer wieder erstaunte es Daniel, daß so wenig Bitterkeit geblieben war.
Jock, der Kameramann, filmte bereits. Oft erschien es Daniel, als sei die Sony-Kamera ein natürlicher Auswuchs seines Körpers, ähnlich einem Buckel.
»Ich werde dir vor der Kamera ein paar dumme Fragen stellen, und vielleicht stichle ich dich ein bißchen«, warnte Daniel Johnny. »Wir beide kennen die Antworten auf die Fragen, aber wir müssen so tun, als ob. Okay?«
»Schieß los.«
Johnny machte im Film eine gute Figur. Daniel hatte sich die Aufnahmen vom vergangenen Abend angesehen. Einer der Vorteile der Arbeit mit moderner Videoausrüstung war, daß man jeden Filmmeter sofort wieder abspielen konnte. Johnny hatte eine gewisse Ähnlichkeit mit dem jungen Cassius Clay, bevor dieser Mohammed Ali wurde. Jedoch war sein Gesicht schmaler und sein Knochenbau feiner, und er war fotogener. Sein Gesichtsausdruck war lebhaft und ausdrucksvoll, und seine Hautfarbe war nicht so dunkel, daß der Kontrast zu hart und die fotografische Wiedergabe damit erschwert wurde.
Sie hockten sich vor das rauchende Lagerfeuer, und Jock filmte sie in Nahaufnahme.
»Wir lagern hier am Ufer des Sambesi. Die Sonne geht gerade auf, und nicht weit entfernt im Busch sind Ihre Spurensucher auf eine Herde von fünfzig Elefanten gestoßen«, sagte Daniel zu Johnny, der nickte. »Sie haben mir erklärt, daß der Chiwewe Park derartig große Herden dieser riesigen Tiere nicht ernähren kann und daß allein in diesem Jahr mindestens tausend aus dem Park entfernt werden müssen. Nicht allein aus Gründen des ökologischen Gleichgewichts, sondern auch, damit die übrigen Elefantenherden überleben können. Wie beabsichtigen Sie die Tiere zu entfernen?«
»Wir müssen sie aussondern«, sagte Johnny kurz.
»Sie aussondern?« fragte Daniel. »Das bedeutet doch töten?«
»Ja. Meine Ranger und ich werden sie erschießen.«
»Alle? Sie wollen heute fünfzig Elefanten erschießen?«
»Wir werden die ganze Herde aussondern.«
»Was ist mit den Jungtieren und den trächtigen Kühen? Werden Sie denn kein einziges Tier verschonen?«
»Sie müssen alle ausgesondert werden«, beharrte Johnny.
»Aber warum? Könnten Sie die Tiere nicht einfangen, sie betäuben und an einen anderen Ort transportieren?«
»Die Transportkosten für ein Tier von der Größe eines Elefanten sind gewaltig. Ein großer Bulle wiegt sechs Tonnen, eine durchschnittliche Kuh etwa vier. Sehen Sie sich das Gelände unten im Tal einmal an.« Johnny deutete auf die bergigen Höhen des Steilabbruchs, die zerklüfteten felsigen Kopjes und den Urwald. »Wir würden Speziallastwagen brauchen, und wir müßten Straßen bauen, um hinein und wieder hinauszukommen. Und selbst wenn das möglich wäre, wo sollten wir sie hinbringen? Ich habe Ihnen erzählt, daß wir in Simbabwe einen Überschuß von fast zwanzigtausend Elefanten haben. Wo sollen wir mit diesen Elefanten hin? Es gibt einfach keinen Platz für sie.«
»Demnach, Herr Oberaufseher, befinden Sie sich in einer Catch-22- Situation, anders als die anderen Länder im Norden, wie beispielsweise Kenia und Sambia, deren Elefantenherden durch Wilderei und unkluge Umweltschutzpolitik fast ausgerottet wurden. Sie haben Ihre Elefantenherden zu gut betreut. Jetzt müssen Sie diese wundervollen Tiere nutzlos töten.«
»Nein, Doktor Armstrong, ganz ohne Nutzen ist das nicht. Wir werden die wertvollen Teile der Kadaver, also Elfenbein, Häute und Fleisch, verkaufen und damit Kosten decken. Die Erlöse kommen wieder dem Umweltschutz zugute, um Wilderei zu verhindern und unsere Nationalparks zu schützen. Der Tod dieser Tiere ist in dem Sinne keine Gräueltat.«
»Aber warum müssen Sie Mütter und ihre Babys töten?« beharrte Daniel.
»Sie mogeln, Doktor«, warnte Johnny ihn. »Sie benutzen die emotionale, tendenziöse Sprache der Tierschutzgruppen, wenn Sie ›Mütter und Babys‹ sagen. Nennen wir sie einfach Kühe und Kälber, und geben wir doch zu, daß eine Kuh ebensoviel frißt und ebensoviel Platz braucht wie ein Bulle, und daß Kälber sehr schnell auswachsen.«
»Sie glauben also ...«, setzte Daniel an, doch Johnny war trotz der vorangegangenen Warnung wütend geworden.
»Augenblick!« schnappte er. »Es geht um viel mehr. Wir müssen die ganze Herde aussondern. Es ist überaus wichtig, daß es keine Überlebenden gibt. Eine Elefantenherde ist eine komplexe Familiengruppe. Fast alle ihre Angehörigen sind Blutsverwandte, und innerhalb der Herde gibt es eine hochentwickelte Sozialstruktur. Der Elefant ist ein intelligentes Tier, wahrscheinlich das intelligenteste nach den Primaten, sicherlich intelligenter als eine Katze oder ein Hund oder sogar ein Delphin. Sie wissen – ich meine, sie verstehen wirklich ...« Er brach ab und räusperte sich. Seine Gefühle hatten ihn überwältigt, und Daniel hatte ihn noch nie lieber gemocht und mehr bewundert als in diesem Augenblick.
»Die schreckliche Wahrheit ist«, Johnnys Stimme war belegt, als er fortfuhr, »daß wenn auch nur ein Tier dieser Aussonderung entginge, es seine Angst und Panik den anderen Herden im Park mitteilen würde. Es würde einen Zusammenbruch im Sozialverhalten der Elefanten geben.«
»Ist das nicht ein bißchen an den Haaren herbeigezogen?« fragte Daniel sanft.
»Nein, das ist schon früher passiert. Nach dem Krieg gab es im Wankie Nationalpark einen Überschuß von zehntausend Elefanten. Damals wußten wir sehr wenig über die Techniken oder Auswirkungen massiver Aussonderungsoperationen. Wir lernten das bald. Mit unseren ersten ungeschickten Versuchen hätten wir fast die gesamte Sozialstruktur der Herden zerstört. Indem wir die älteren Tiere erlegten, nahmen wir den Herden ihren Fundus an Erfahrung und vermittelbarem Wissen. Wir störten damit ihr Wanderverhalten, die Hierarchie und Disziplin unter den Tieren, sogar ihr Fortpflanzungsverhalten. Die Bullen begannen die kaum erwachsenen, jungen Kühe zu decken, bevor diese geschlechtsreif waren, gerade so, als ob sie wüßten, daß ihre Vernichtung bevorstand. Eine Elefantenkuh ist ähnlich wie eine Frau frühestens im Alter von fünfzehn oder sechzehn Jahren geschlechtsreif. Unter dem schrecklichen Streß, der durch das Aussondern verursacht wurde, deckten die Bullen in Wankie Kühe, die erst zehn oder elf Jahre alt waren, also praktisch noch in der Pubertät, und die Kälber, die daraufhin geboren wurden, waren verkümmerte Zwerge.« Johnny schüttelte den Kopf. »Nein, wir müssen die ganze Herde auf einen Schlag auslöschen.«
Fast erleichtert blickte er zum Himmel hoch. Beide hörten sie in der Ferne das insektengleiche Summen eines Flugzeugmotors.
»Da kommt das Suchflugzeug«, sagte er ruhig und griff nach dem Mikrofon des Funkgeräts.
»Guten Morgen, Sierra Mike. Wir sehen euch schätzungsweise vier Meilen südlich unserer Position. Ich werde euch ein gelbes Rauchsignal geben.«
Johnny nickte einem seiner Ranger zu, der daraufhin die Lasche einer Rauchpatrone zog. Schwefelgelber Rauch trieb in einer dichten Wolke über die Baumwipfel.
»Roger, Parks. Ich sehe euren Rauch. Gebt mir bitte eine Angabe für das Ziel.«
Johnny runzelte bei dem Wort »Ziel« die Stirn und legte bei seiner Antwort Betonung auf das alternative Wort. »Gestern abend bei Sonnenuntergang bewegte sich die Herde in Richtung Norden auf den Fluß zu, fünf Meilen südöstlich von dieser Position. Es sind etwas über fünfzig Tiere.«
»Danke, Parks. Ich melde mich wieder, sobald wir gesichtet haben.«
Sie schauten zu, wie das Flugzeug ostwärts abdrehte. Es war eine alte, einmotorige Cessna, die wahrscheinlich zum Krankentransport eingesetzt worden war und während des Buschkrieges als Kampfflugzeug gedient hatte.
Fünfzehn Minuten später rauschte es wieder im Funkgerät.
»Hallo, Parks. Ich habe eure Herde. Etwas über fünfzig Tiere und acht Meilen von eurer derzeitigen Position entfernt.«
Kapitel 2
Die Herde hatte sich über beide Ufer eines trockenen Flusses verteilt, der sich seinen Weg durch niedrige Feuersteinhügel gegraben hatte. Hier, wo die tiefreichenden Wurzeln unterirdisches Wasser gefunden hatten, war der Wald grüner und üppiger. Die Akazien beugten sich unter dem Gewicht der Früchte. Die Schoten sahen wie lange, braune Biskuits aus, die in gut zwanzig Meter Höhe in Trauben über dem Boden hingen.
Zwei Kühe bewegten sich auf einen der schwerbeladenen Bäume zu. Sie waren die Herrinnen der Herde, beide über siebzig Jahre alt, hagere alte Witwen mit zerfetzten Ohren und wässerigen Augen. Das Band zwischen ihnen hatte sich über ein halbes Jahrhundert gefestigt. Sie waren Halbschwestern. Abkömmlinge derselben Mutter. Die ältere war bei der Geburt ihrer Schwester schon entwöhnt gewesen und hatte so zärtlich geholfen, diese aufzuziehen. Gemeinsam konnten sie auf ein langes Leben zurückblicken, in dem sie einen Schatz an Erfahrung und Weisheit gesammelt hatten, der jenen ausgeprägten Instinkt bereicherte, mit dem sie beide bei der Geburt ausgestattet worden waren.
Sie waren schon lange nicht mehr fortpflanzungsfähig, doch immer noch galt ihre Hauptsorge der Herde und deren Sicherheit. Die jüngeren Kühe und die neuen Kälber, die ihre Blutlinie fortsetzten und für die sie die Verantwortung trugen, waren ihre Freude und ihr Lebenssinn.
Vielleicht war es unrealistisch, hirnlosen Tieren solch menschliche Gefühle wie Liebe und Respekt zuzusprechen oder zu glauben, sie wüßten, was Blutsverwandtschaft oder der Fortbestand ihrer Familie bedeutete. Doch wer gesehen hatte, wie die alten Kühe die tobenden Jungen mit erhobenen Ohren und einem scharfen, ärgerlichen Trompeten zur Ruhe mahnten oder wie die Herde deren Führung mit bedingungslosem Gehorsam folgte, konnte die Autorität dieser Kühe kaum bezweifeln. Wer gesehen hatte, wie sie die jüngeren Kälber sanft mit dem Rüssel streichelten oder sie über die steilen und schwierigen Stellen der Elefantenpfade hoben, konnte ihre Fürsorglichkeit nicht in Frage stellen. Wenn Gefahr drohte, drängten sie die Jungen hinter sich und stürmten zur Verteidigung mit abgespreizten Ohren und eingerollten Rüsseln vorwärts.
Die großen Bullen mit ihrem massigen Umfang mochten diese Kühe an Größe übertreffen, nicht aber an Klugheit und Wildheit. Die Stoßzähne der Bullen waren länger und dicker und wogen manchmal weit über hundert Pfund. Die beiden alten Kühe trugen dürres, mißgestaltetes Elfenbein, zerfurcht, rissig und dunkel vom Alter, und ihre Knochen waren durch die zernarbte graue Haut zu sehen, doch ihrer Pflicht für die Herde gingen sie unbeirrt nach.
Die Bullen hielten zur Herde nur losen Kontakt. Wenn sie älter wurden, zogen sie es oft vor, sich von der Herde zu trennen und kleinere Junggesellengruppen von zwei oder drei männlichen Tieren zu bilden und die Kühe nur zu besuchen, wenn sie vom durchdringenden Brunftgeruch angezogen wurden. Die alten Kühe jedoch blieben bei der Herde. Sie bildeten das solide Fundament, das Grundlage für die Sozialstruktur der Herde war.
Jetzt bewegten sich die beiden Schwestern in perfektem Einklang auf die riesige Akazie zu, die mit Saatschoten beladen war. Jede bezog ihre Position auf einer Seite des Stammes. Sie lehnten ihre Stirnen gegen die rauhe Rinde. Der Stamm durchmaß über einen Meter und war so unnachgiebig wie eine Marmorsäule. Dreißig Meter über dem Boden bildeten die hohen Äste ein kunstvolles Maßwerk, und die Schoten und Blätter rundeten sich zur Kuppel einer Kathedrale gegen den Himmel.
Die beiden alten Kühe begannen sich gleichzeitig hin und her zu wiegen, den Baumstamm zwischen ihren Stirnen. Zuerst war die Akazie starr, widerstand sogar ihren gewaltigen Kräften. Doch die Kühe arbeiteten hartnäckig weiter. Zuerst warf die eine, dann die andere ihr Gewicht in die entgegengesetzte Richtung, und ein winziger Schauer durchrann den Baum bis in seine Spitze, so daß die höchsten Zweige zitterten, als habe ein Windhauch sie gestreift.
Rhythmisch arbeiteten sie weiter, und der Stamm begann sich zu bewegen. Eine einzelne reife Schote löste sich von ihrem Zweig, fiel dreißig Meter tief direkt auf den Schädel einer der Kühe. Sie schloß ihre wässerigen Augen fest, ohne aber ihren Stemmrhythmus zu unterbrechen. Der Baumstamm zwischen ihnen schwankte und zitterte, schwerfällig zunächst, dann immer stärker. Schote um Schote fiel so schwer herunter wie die ersten Tropfen eines Gewitterregens.
Die jüngeren Tiere der Herde begriffen, was sie vorhatten, schlugen aufgeregt mit den Ohren und stürmten vorwärts. Die sehr proteinhaltigen Akazienschoten gehörten zu ihren Lieblingsdelikatessen. Erwartungsvoll sammelten sie sich um die beiden Kühe, schnappten die herunterfallenden Schoten und stopften sie mit ihren Rüsseln tief in ihre Kehlen. Inzwischen wippte der große Baum hin und her, seine Zweige wankten wild, und das Laub raschelte. Schoten und lose Zweige regneten herunter, prasselten und hüpften von den Rücken der Elefanten, die sich unter dem Baum drängten.
Die beiden Kühe, immer noch wie zwei Buchstützen versteift, machten hartnäckig weiter, bis der Regen der herabfallenden Schoten zu versiegen begann. Erst als die letzte Schote von den Zweigen geschüttelt war, traten sie vom Baumstamm zurück. Ihre Rücken waren mit toten Blättern und Zweigen, Stücken trockener Rinde und samtigen Schoten übersät, und sie standen knöcheltief in den herabgefallenen Stücken. Mit den geschickten, fleischigen Spitzen ihrer Rüssel langten sie nach unten, hoben behutsam die goldenen Schoten an und rollten die Rüssel in ihre klaffenden Mäuler, wobei sich ihre dreieckigen Unterlippen weit öffneten. Die Feuchtigkeit ihrer Gesichtsdrüsen netzte ihre Wangen wie Freudentränen, und sie begannen zu fressen.
Die Herde hatte sich dicht um die beiden Kühe geschart, um das Festmahl zu genießen, das sie ausgebreitet hatten. Während ihre langen, schlangengleichen Rüssel schwangen und sich rollten und die Schoten in ihre Kehlen geschaufelt wurden, war ein leises Geräusch zu hören, das in jeder der großen, grauen Gestalten widerzuhallen schien. Es war ein sanftes Knurren in vielen verschiedenen Tonarten, und dieses Geräusch war von einem winzigen knirschenden, gurgelnden Quietschen durchsetzt, das für das menschliche Ohr kaum vernehmbar war. Es war ein seltsam zufriedener Chor, in den selbst die jüngsten Tiere einfielen. Es war ein Klang, der Lebensfreude auszudrücken schien und das enge Band bestätigte, das alle Angehörigen der Herde miteinander verband.
Es war das Lied der Elefanten.
Eine der alten Kühe entdeckte als erste eine Bedrohung für die Herde. Sie übermittelte den anderen ihre Besorgnis mit einem Geräusch, das außerhalb des menschlichen Hörvermögens lag, und die ganze Herde erstarrte. Selbst die ganz jungen Kälber reagierten sofort. Die Stille nach dem fröhlichen Lärm des Festmahls war unheimlich, und das Summen des Suchflugzeugs in der Ferne bildete einen lauten Kontrast.
Die alten Kühe kannten das Motorengeräusch der Cessna. In den letzten Jahren hatten sie es viele Male gehört. Inzwischen verbanden sie es mit den Perioden verstärkter menschlicher Aktivität, mit Spannung und einer unerklärlichen Angst, die irgendwie telepathisch von den anderen Elefantengruppen im Park durch die Wildnis übertragen wurde.
Sie wußten, daß dieses Geräusch in der Luft das Vorspiel zu einem knallenden Chor von fernem Gewehrfeuer und dem Geruch von Elefantenblut in den heißen Luftströmungen am Rande des Steilabfalls war. Wenn die Geräusche des Flugzeugs und des Gewehrfeuers verebbt waren, hatten sie oft ausgedehnte Flächen von mit getrocknetem Blut verklebtem Waldboden passiert. Sie hatten den Geruch von Furcht, Schmerz und Tod gewittert, abgesondert von Angehörigen ihrer Art, der sich noch immer mit dem Gestank von Blut und verwesenden Eingeweiden vermischte.
Eine der alten Kühe wich zurück und schüttelte wütend ihren Kopf in Richtung auf das Geräusch am Himmel. Ihre zerfetzten Ohren klatschten laut gegen ihre Schultern. Es war wie das Geräusch des Großsegels eines Schiffes, das sich mit Wind füllt. Dann machte sie kehrt und veranlaßte die Herde, davonzustürmen.
In der Herde befanden sich zwei ausgewachsene Bullen, doch beim ersten Anzeichen von Gefahr trennten sie sich von ihr und verschwanden im Wald. Instinktiv erkannten sie, daß die Herde verwundbar war. Sie suchten Sicherheit, indem sie allein flohen. Die jüngeren Kühe und die Kälber drängten sich hinter den beiden alten Kühen und flohen. Die Kleinen rasten, um mit dem längeren Schritt der Muttertiere mithalten zu können. Unter anderen Umständen hätte ihre Hast vielleicht komisch ausgesehen.
»Hallo, Parks. Die Herde bricht südwärts zum Imbelesi-Paß aus.«
»Roger, Sierra Mike. Treibt sie bitte zur Mana-Pools-Abzweigung.«
Die alte Kuh führte die Herde auf die Hügel zu. Sie wollte aus dem Talgrund in das unwegsame Gelände gelangen, wo eine Verfolgung durch Felsen und starkes Gefälle erschwert wurde, doch das Geräusch des Flugzeugs, das vor ihr summte, schnitt sie vom Zugang des Passes ab.
Verunsichert blieb sie stehen und hob den Kopf zum Himmel, wo sich riesige, silbrige Gebirge von Kumuluswolken türmten. Sie spreizte ihre Ohren und drehte ihren alten Kopf, um dem schrecklichen Geräusch zu folgen.
Dann sah sie das Flugzeug. Das frühe Sonnenlicht blitzte von seiner Windschutzscheibe, als es steil vor ihr in Schräglage ging, abdrehte und dann wieder auf sie zuschoß, diesmal knapp über den Wipfeln der Bäume, und das Geräusch des Motors steigerte sich zu einem Brüllen.
Gleichzeitig wirbelten die beiden alten Kühe herum und rasten zum Fluß zurück. Hinter ihnen wendete die Herde wie eine ungeordnete Kavallerieabteilung, und während sie rannten, stieg der Staub in einer feinen, blassen Wolke hoch über die Baumwipfel hinweg.
»Parks, die Herde rennt jetzt in Ihre Richtung. Fünf Meilen von der Abzweigung.«
»Danke, Sierra Mike. Haltet sie vorsichtig weiter am Laufen, aber treibt sie nicht zu schnell.«
»Verstanden, Parks.«
»An alle K-Trupps.« Johnny Nzou wechselte das Rufzeichen. »An alle K-Trupps, Annäherung an Mana-Pools-Abzweigung.«
Die K-Trupps oder Kill-Trupps, die Tötungstrupps, waren die vier Landrover, die am Hauptweg bereitstanden, der vom Chiwewe-Hauptquartier am Steilabfall zum Fluß führte. Johnny hatte sie zu einer Barriere auffahren lassen, um die Herde aufzuhalten, falls sie durchging. Jetzt sah es so aus, als sei das nicht nötig. Das Suchflugzeug trieb die Herde mit professionellem Geschick in die richtige Position.
»Sieht aus, als würden wir’s im ersten Anlauf schaffen«, murmelte Johnny, während er den Landrover um volle 180 Grad wendete und dann mit Vollgas auf den Weg steuerte. Ein Grasrücken zwischen den sandigen Radspuren ließ den Landrover buckeln und mehrfach aufsetzen. Der Wind sauste um ihre Köpfe, und Daniel nahm seinen Hut ab und stopfte ihn in seine Tasche.
Jock filmte über seine Schulter, als eine durch den Lärm des Landrovers aufgescheuchte Büffelherde aus dem Wald gejagt kam und den Weg direkt vor ihnen kreuzte.
»Verdammt!« Johnny trat auf die Bremse und schaute auf seine Armbanduhr. »Diese blöden nyati verderben uns alles.«
Hunderte dunkler Rinder kamen in massiver Phalanx herangaloppiert, wirbelten weißen Staub auf, grunzten und brüllten und verspritzten flüssigen grünen Kot auf dem Gras, den sie dann flachtraten.
Binnen weniger Minuten waren sie vorbeigerast, und Johnny fuhr mit Vollgas in die schwebende Staubwolke und rappelte über die lose Erde, die die Herde mit ihren schweren Hufen aufgerissen hatte. Hinter einer Wegbiegung sahen sie die anderen Fahrzeuge an der Kreuzung stehen. Die vier Ranger standen in einer Gruppe daneben und schauten mit den Gewehren in ihren Händen erwartungsvoll drein.
Johnny brachte den Landrover rutschend zum Halt und griff nach dem Mikrofon seines Funkgerätes. »Sierra Mike, gebt mir bitte eine Positionsmeldung.«
»Parks, die Herde ist zwei Meilen von euch entfernt. Sie nähert sich gerade Long Vlei.«
Vlei ist ein Ausdruck für offenes Grasland, und Long Vlei zog sich meilenweit am Fluß entlang. Während der Regenzeit war es Marschgebiet, jetzt aber war es das ideale Gelände zum Töten. Sie hatten es schon früher dazu benutzt.
Johnny sprang vom Fahrersitz und nahm sein Gewehr aus der Halterung. Er und all seine Ranger waren mit billigen, in Massen produzierten .375 Magnums bewaffnet, die mit Vollmunition geladen wurden, um Knochen und Gewebe optimal zu durchschlagen. Seine Männer waren wegen ihrer großartigen Treffgenauigkeit für diese Aufgabe ausgewählt. Das Töten mußte so schnell und human wie möglich erfolgen. Sie würden auf das Hirn schießen und nicht den einfacheren, aber schleppenden Körperschuß wählen.
»Gehen wir!« schnappte Johnny. Es war unnötig, Anweisungen zu geben. Dies waren harte junge Profis. Doch obwohl sie diese Arbeit schon viele Male verrichtet hatten, waren ihre Mienen ernst. In ihren Augen war keine Erregung, keine Vorfreude zu sehen. Dies war kein Sport. Ganz offensichtlich genossen sie die Aussicht auf die blutige Arbeit, die vor ihnen lag, nicht.
Sie waren bis auf Shorts und Velskoen, leichte Schuhe ohne Socken, entkleidet. Die einzigen schweren Gegenstände, die sie trugen, waren ihre billigen Waffen und die Patronengurte, die sie um ihre Hüften geschlungen hatten. Sie alle waren schlank und muskulös, und Johnny Nzou war ebenso konditionsstark wie die anderen. Sie rannten der Herde entgegen.
Daniel folgte Johnny Nzou. Er glaubte, sich mit ständigem Joggen und Training fit gehalten zu haben, hatte aber vergessen, was es bedeutete, durch Jagen und Kampf fit zu sein wie Johnny und seine Ranger.
Sie liefen wie Hunde, eilten mühelos durch den Wald, wobei ihre Füße wie von selbst den Weg zwischen Unterholz, Felsen, herabgestürzten Ästen und Ameisenbärlöchern zu finden schienen. Sie berührten im Lauf kaum den Boden. Früher einmal hatte auch Daniel so laufen können, aber jetzt behinderten ihn seine Stiefel, und er taumelte ein- oder zweimal in dem unwegsamen Gelände. Er und der Kameramann begannen zurückzufallen.
Johnny Nzou gab ein Handzeichen, und seine Ranger schwärmten zu einer langen Schützenlinie aus, in der sie jeweils fünfzig Meter voneinander getrennt standen. Vor ihnen wich der Wald abrupt dem offenen Gelände des Long Vlei. Es war dreihundert Meter breit. Das trockene, beigefarbene Gras stand hüfthoch.
Die Linie der Killer blieb am Waldrand stehen. Sie schauten zu Johnny, der sich in ihrer Mitte befand, doch er hatte den Kopf zurückgeworfen und beobachtete das Suchflugzeug, das über dem Wald flog. Es ging in eine Steilkurve und stand vertikal auf einer Tragfläche.
Schließlich erreichte Daniel die Linie und stellte fest, daß er und Jock schwer atmeten, obwohl sie weniger als eine Meile gelaufen waren. Er beneidete Johnny.
»Dort sind sie«, rief Johnny leise. »Man kann den Staub sehen.« Er lag als Schleier auf den Baumwipfeln zwischen ihnen und dem kreisenden Flugzeug. »Sie kommen schnell näher.«
Johnny schwenkte seinen rechten Arm, und die Schützenlinie veränderte sich gehorsam zu einer konkaven Form, ähnlich dem Horn eines Büffelbullen, in deren Mitte Johnny stand. Auf das nächste Signal hin trotteten sie auf die Lichtung hinaus.
Eine leichte Brise wehte in ihre Richtung. Die Tiere würden sie nicht wittern. Obwohl die Herde ursprünglich gegen den Wind geflohen war, um nicht in eine Gefahr hineinzulaufen, hatte das Flugzeug sie in Windrichtung zurückgetrieben.
Elefanten können nicht gut sehen. Sie würden die Menschenlinie erst erkennen, wenn es zu spät war. Die Falle war gestellt, und die Elefanten rannten, gehetzt und getrieben von der tieffliegenden Cessna, direkt hinein.
Die beiden alten Kühe brachen in vollem Lauf aus der Baumgrenze. Ihre knochigen Beine flogen. Sie hatten die Ohren nach hinten angelegt, und die losen grauen Falten ihrer Haut zitterten und wabbelten bei jedem Fehltritt. Der Rest der Herde folgte weit auseinandergezogen. Die jüngsten Kälber ermüdeten, und ihre Mütter stießen sie mit ihren Rüsseln vorwärts.
Die Linie der Scharfrichter erstarrte, stand in einem Halbkreis wie die Öffnung eines Netzes, das bereit ist, einen Fischschwarm zu verschlingen. Die Elefanten würden eher eine Bewegung wahrnehmen, als daß sie mit ihren schwachen, durch Panik getrübten Augen die verschwommenen Menschengestalten erkennen könnten.
»Nehmt zuerst die beiden Großmütter«, rief Johnny leise. Er hatte die Matriarchinnen erkannt, und er wußte, daß die Herde völlig durcheinander und unentschlossen sein würde, sobald sie erlegt waren. Sein Befehl wurde in der Linie weitergegeben.
Die Leitkühe trabten direkt auf die Stelle zu, an der Johnny stand. Er ließ sie herankommen und hielt sein Gewehr hoch vor der Brust. In einer Entfernung von hundert Metern begannen die beiden älteren Damen nach links abzubiegen, und Johnny bewegte sich zum ersten Mal.
Er hob sein Gewehr, schwenkte es über seinem Kopf und rief auf Sindebele: »Nanzi Inkosikaze! Hier bin ich, ehrenwerte alte Dame.«
Jetzt erkannten die beiden Elefanten, daß er kein Baumstumpf, sondern ein tödlicher Feind war. Sofort schwenkten sie wieder auf ihn zu. Sie konzentrierten all ihren Haß, ihre Angst und ihre Sorge um die Herde auf ihn und rasten mit voller Wucht in seine Richtung.
Sie trompeteten ihm ihren Zorn entgegen und machten größere Schritte, so daß der Staub unter ihren gewaltigen Fußsohlen aufwirbelte. Ihre Ohren waren an den Rändern – ein sicheres Zeichen ihrer Wut – eingerollt. Sie überragten die Gruppe der winzigen menschlichen Gestalten. Daniel wünschte sich inbrünstig, sich vorsichtshalber auch bewaffnet zu haben. Er hatte vergessen, wie angsterregend dieser Augenblick war, als die erste Kuh mit einer Geschwindigkeit von vierzig Meilen pro Stunde auf ihn zuraste und nur noch fünfzig Meter entfernt war.
Jock filmte weiter, obwohl das wütende Trompeten der beiden Kühe vom Rest der Herde aufgenommen worden war. Sie donnerten wie eine Lawine grauen Granits auf sie zu.
Als sie dreißig Meter entfernt waren, hob Johnny Nzou das Gewehr an seine Schulter und beugte sich vor, um den Rückstoß aufzufangen. Auf dem blauschimmernden Stahllauf war kein Zielfernrohr befestigt. Für Naharbeit wie diese brauchte er nur sein scharfes Auge.
Seit ihrer Einführung im Jahre 1912 hatte sich die .375 Holland & Holland bei Sport- wie Berufsjägern als das vielseitigste und effektivste Gewehr bewährt, das je nach Afrika importiert worden war. Es zeichnete sich durch stete Zielgenauigkeit und schwachen Rückstoß aus, und außerdem war das 300 Gran Vollgeschoß mit seiner flachen Flugbahn und außerordentlichen Durchschlagskraft ein ballistisches Wunder.
Johnny zielte auf den Kopf der Leitkuh, auf die Rüsselfalte zwischen den kurzsichtigen alten Augen. Der Knall war so scharf wie das Zucken einer Bullenpeitsche, und eine Straußenfeder Staub hob sich von der Oberfläche ihrer verwitterten grauen Haut genau über der Stelle ihres Schädels, auf die er gezielt hatte.
Die Kugel durchschlug ihren Kopf so leicht wie ein stählerner Nagel einen reifen Apfel. Sie radierte den oberen Teil ihres Hirns weg, und die Vorderbeine der Kuh knickten unter ihr ein. Daniel spürte, wie die Erde unter seinen Füßen erzitterte, als sie in einer Staubwolke zusammenbrach.
Genau in dem Augenblick, als sie auf Höhe des Kadavers ihrer Schwester war, richtete Johnny sein Korn auf die zweite Kuh. Er repetierte, ohne den Gewehrkolben von seiner Schulter zu nehmen, indem er den Verschluß nur vor und zurück bewegte. Die Patronenhülse wurde in einer glitzernden Parabel herausgeschleudert, und er feuerte wieder. Die Geräusche der beiden Schüsse verschmolzen miteinander. Sie waren so schnell abgegeben worden, daß sie das Gehör täuschten und wie eine einzige lange Detonation klangen.
Wieder traf das Geschoß genau dort, wohin es gezielt war, und die Kuh starb genau wie die andere augenblicklich. Ihre Beine knickten ein, sie stürzte und fiel auf ihren Bauch, und ihre Schulter berührte die ihrer Schwester. In der Mitte ihrer beiden Stirnen spritzte eine neblige, rosarote Blutfahne aus den winzigen Schußlöchern.
Die Herde hinter ihnen geriet in Verwirrung. Die verstörten Tiere irrten umher und liefen im Kreis, trampelten das Gras flach und wirbelten einen Staubvorhang auf, der über ihnen kreiste und die Szene so verhüllte, daß ihre Gestalten ätherisch und unscharf wirkten. Die Kälber drängten sich schutzsuchend unter die Bäuche ihrer Mütter, hatten die Ohren voller Entsetzen dicht angelegt, während sie durch die hektischen Bewegungen der Muttertiere gestoßen, getreten und herumgeworfen wurden.
Die Ranger rückten ständig feuernd näher. Das Geräusch des Gewehrfeuers war ein lang anhaltendes Knattern, wie Hagel auf einem Wellblechdach. Sie schossen auf das Hirn. Bei jedem Schuß zuckte eines der Tiere zusammen oder riß seinen Kopf hoch, wenn die Vollgeschosse den Schädelknochen mit dem Geräusch eines exakt getroffenen Golfballs durchschlugen. Mit jedem Schuß fiel eines der Tiere tot oder benommen zu Boden. Die sofort Getöteten, und das waren die meisten, knickten erst mit den Hinterbeinen ein und fielen dann wie schwere Maissäcke um. Wenn die Kugel das Gehirn verfehlte und nur dicht daran vorbeischlug, drehte sich der Elefant im Kreis, schwankte und ging dann um sich tretend zu Boden, um sich schließlich mit einem entsetzlich verzweifelten Stöhnen auf die Seite zu rollen und den erhobenen Rüssel hilflos zum Himmel zu strecken.
Eines der jungen Kälber wurde unter dem zusammenbrechenden Kadaver seiner Mutter begraben und lag mit gebrochenem Rückgrat und voller Schmerz und Panik trompetend da. Einige Elefanten sahen sich durch eine Palisade gestürzter Tiere eingeengt und versuchten, darüber hinwegzuklettern. Die Scharfschützen schossen sie nieder, so daß sie auf die Körper der bereits toten Tiere fielen, worauf andere versuchten, auch darüber hinwegzuklettern, und ihrerseits niedergeschossen wurden.
Es ging schnell. Innerhalb weniger Minuten waren alle erwachsenen Tiere zu Boden gegangen, lagen dicht beieinander oder in blutenden Haufen aufeinander. Nur die Kälber rannten noch immer entsetzt im Kreis herum und stolperten über die Körper der Toten und Sterbenden, trompeteten kreischend und zupften an den Kadavern ihrer Mütter.
Die Gewehrschützen rückten langsam vor, wobei sie feuerten und nachluden und wieder feuerten. Sie schossen die Kälber einzeln ab, und als kein einziges Tier mehr auf den Beinen war, begaben sie sich schnell unter die Herde, krochen über die gigantischen ausgebreiteten Körper hinweg und blieben nur stehen, um einen Fangschuß in jeden der riesigen blutenden Köpfe zu geben. Meistens erfolgte keine Reaktion auf die zweite Kugel ins Hirn, doch gelegentlich erzitterte ein Elefant, der noch nicht tot war. Seine Gliedmaßen streckten sich, und er blinzelte, bevor er leblos erschlaffte.
Sechs Minuten nach Johnnys erstem Schuß senkte sich Schweigen auf das Schlachtfeld von Long Vlei. Nur in ihren Ohren hallte noch die brutale Erinnerung an das Gewehrfeuer. Nichts regte sich mehr. Die Elefanten lagen in Reihen wie Unkraut hinter den Klingen der Mähmaschine, und die trockene Erde saugte ihr Blut auf. Die Ranger standen noch immer voneinander entfernt, bedrückt und voller Scheu vor der Vernichtung, die sie gebracht hatten. Sie starrten auf das Gebirge von Tod. Fünfzig Elefanten, ein Blutbad von zweihundert Tonnen.
Johnny Nzou brach den tragischen Bann, der sie erfaßt hielt. Er schritt langsam dorthin, wo die zwei alten Kühe am Kopf der Herde lagen. Sie lagen Seite an Seite, ihre Schultern berührten sich, und ihre Beine waren sauber unter ihnen eingeknickt. Sie knieten, als lebten sie noch, und nur die pulsierenden Blutfontänen aus ihren Stirnen störten diese Illusion.
Johnny setzte den Kolben seines Gewehrs auf den Boden, stützte sich darauf und musterte die beiden alten Matriarchinnen für einen langen Augenblick voller Bedauern. Er merkte nicht, daß Jock ihn filmte. Seine Handlungsweise und seine Worte waren weder einstudiert noch geprobt.
»Hamba gahle, Amakhulu«, flüsterte er. »Geht in Frieden, alte Großmütter. Ihr seid im Tod so zusammen, wie ihr es im Leben wart. Geht in Frieden und vergebt uns, was wir eurem Stamm angetan haben.«
Er entfernte sich und ging bis zur Baumgrenze. Daniel folgte ihm nicht. Er begriff, daß Johnny jetzt eine Weile allein sein wollte. Die anderen Ranger mieden sich ebenfalls. Es gab weder Geplauder noch Glückwünsche. Zwei von ihnen wanderten mit seltsam untröstlichen Mienen zwischen den Toten umher. Ein dritter hockte sich da hin, wo er den letzten Schuß abgefeuert hatte, rauchte eine Zigarette und starrte auf den staubigen Boden zwischen seinen Füßen. Der letzte hatte sein Gewehr beiseitegelegt und starrte mit den Händen in den Hosentaschen und gesenkten Schultern zum Himmel, wo die Geier sich sammelten.
Zuerst waren die Aasvögel nur winzige Flecken vor den funkelnden Bergen der Kumuluswolke, wie Pfefferkörner, die auf einem Tischtuch verstreut sind. Dann segelten sie näher heran, bildeten hoch droben kreisende Schwadronen, schwebten in ordentlicher Formation, ein dunkles Rad des Todes hoch über diesem Schlachtfeld.
Vierzig Minuten später hörte Daniel das Rumpeln der nahenden Lastwagen und sah sie langsam durch den Wald kommen. Eine Abteilung halbnackter Axtträger eilte dem Konvoi voraus, zerschlug das Dickicht und schaffte so einen Weg für die Lastwagen. Johnny erhob sich mit sichtlicher Erleichterung von seinem Platz am Waldrand und kam heran, um das Schlachten zu überwachen.
Die Haufen der toten Elefanten wurden mit Winden und Ketten auseinandergezogen. Dann wurde die runzlige graue Haut der Länge nach an Bauch und Rücken durchgeschnitten. Wieder wurden die elektrischen Winden eingesetzt, und die Haut wurde mit einem knisternden Geräusch vom Kadaver abgezogen. Sie löste sich in langen grauen Streifen, die an der Außenseite geronnen waren und innen weiß leuchteten. Die Männer legten jeden Streifen auf den Boden und häuften grobkörniges Salz darauf.
Im grellen Sonnenlicht wirkten die nackten Kadaver seltsam obszön, feucht und marmoriert mit dem weißen Fett und freigelegten scharlachroten Muskeln. Die geschwollenen Bäuche wölbten sich, als wollten sie die Abspeckmesser zum Schneiden einladen.
Ein Abhäuter schob die geschwungene Spitze des Messers an der Stelle, wo das Brustbein ansetzt in den Bauch einer der alten Kühe. Vorsichtig die Tiefe des Einschnitts kontrollierend, um die Eingeweide nicht zu beschädigen, ging er dann an dem ganzen Kadaver entlang, wobei er die Klinge wie einen Reißverschluß über die Bauchhöhle zog, so daß sie aufklaffte und der Magen, wie Fallschirmseide glänzend, herausquoll. Dann rutschten die ungeheuren Windungen der Gedärme hinterher. Sie schienen ein Eigenleben zu besitzen. Wie der Leib einer erwachenden Python drehten und entfalteten sie sich unter der Schwere ihres eigenen, schlüpfrigen Gewichtes.
Die Männer mit den Kettensägen machten sich an die Arbeit. Das aufdringliche Getöse der Zweitaktmotoren schien an diesem Ort des Todes fast ein Sakrileg zu sein, und aus dem Auspuff der Maschinen stieg fauchend blauer Qualm in die klare Luft. Sie trennten die Gliedmaßen von jedem Kadaver, und ein feiner Brei von Fleisch und Knochensplittern flog von den Zähnen der rotierenden Stahlketten. Dann gruben sie sich surrend durch Rückgrat und Rippen, und die Kadaver fielen in Einzelteile auseinander, die mit Winden in die wartenden Tiefkühlwagen gezogen wurden.
Eine Spezialgruppe ging mit langen Bootshaken von Kadaver zu Kadaver und stocherte in den feuchten Haufen der ausgelaufenen Innereien, um die Gebärmütter der Kühe herauszuziehen. Daniel beobachtete, wie sie eine der verschlungenen Gebärmütter aufschlitzten, die durch die angeschwollenen Blutgefäße dunkelrot war. Aus der Fruchtblase glitt ein Fötus, der die Größe eines großen Hundes hatte, in einer Flut von Fruchtwasser heraus und lag auf dem zertrampelten Gras.
Er war nur ein paar Wochen vor der Geburtsreife, ein fertiger kleiner Elefant, der mit einem Mantel rötlichen Haares bedeckt war, das er kurz nach seiner Geburt verloren hätte. Er lebte noch und bewegte schwach seinen Rüssel.
»Tötet ihn!« befahl Daniel barsch auf Sindebele. Es war unwahrscheinlich, daß er Schmerz empfinden konnte, aber er wandte sich erleichtert weg, als einer der Männer den winzigen Kopf mit einem einzigen Schlag seines Panga abtrennte. Daniel verspürte Übelkeit, aber er wußte, daß nichts bei der Aussonderung vergeudet wurde. Die Haut des ungeborenen Elefanten würde feingegerbt und kostbar werden. Als Handtasche oder Aktenkoffer würde sie ein paar hundert Dollar wert sein.
Um sich abzulenken, spazierte er über das Schlachtfeld davon. Jetzt waren nur noch die Köpfe der großen Tiere und die schimmernden Haufen ihrer Eingeweide übriggeblieben. Daraus konnte nichts Wertvolles gewonnen werden, und sie blieben als Fressen für die Geier, Hyänen und Schakale zurück.
Die Elfenbeinstoßzähne, die noch immer in ihren Knochenbetten steckten, waren der kostbarste Teil der Aussonderung. Die Wilderer und die Elfenbeinjäger vergangener Tage hätten es nicht riskiert, sie mit einem achtlosen Axthieb zu beschädigen, und gewöhnlich beließ man das Elfenbein im Schädel, bis die Knorpelschicht, die sie umschloß, verrottet und weich geworden war und sich löste. Meistens konnte man die Stoßzähne nach vier oder fünf Tagen völlig unbeschädigt mit der Hand herausziehen. Für diese Prozedur fehlte jedoch die Zeit. Die Stoßzähne mußten mit der Hand herausgeschnitten werden.
Die Abdecker, die das taten, waren die erfahrensten Männer. Sie waren älter, hatten graue, wollhaarige Köpfe und trugen blutbefleckte Lendenschurze. Sie hockten sich neben die Köpfe und schlugen geduldig mit ihren einfachen Äxten zu.
Während sie mit dieser ermüdenden Arbeit beschäftigt waren, stand Daniel mit Johnny Nzou zusammen. Jock hielt die Sony-Kamera auf sie gerichtet, während Daniel kommentierte: »Ein blutiges Werk.«
»Aber notwendig«, stimmte Johnny kurz zu. »Im Durchschnitt wird jeder erwachsene Elefant mit Elfenbein, Haut und Fleisch etwa dreitausend Dollar einbringen.«
»Für viele Menschen wird das ziemlich kommerziell klingen, besonders, da sie gerade Zeugen der brutalen Wirklichkeit der Aussonderung geworden sind.« Daniel schüttelte seinen Kopf. »Sie sollten wissen, daß es unter der Leitung von Tierschutzgruppen eine sehr große Kampagne gibt, die den Elefanten unter Anhang Eins der CITES stellen will, das bedeutet, unter die Schutzvorschriften für Wildtiere und -pflanzen im Rahmen des Washingtoner Artenschutzabkommens.«
»Das weiß ich.«
»Wenn das erreicht wird, würde der Handel mit jedweden Elefantenprodukten, also Haut, Elfenbein oder Fleisch, verboten sein. Was halten Sie davon?«
»Das macht mich sehr zornig.« Johnny ließ seine Zigarette fallen und trat sie mit seinem Absatz aus. Sein Gesichtsausdruck war wild.
»Das würde doch aber weitere Aussonderungsoperationen überflüssig machen, nicht wahr?« beharrte Daniel.
»Überhaupt nicht«, widersprach Johnny ihm. »Wir wären dennoch gezwungen, die Größe der Herden zu kontrollieren. Wir wären weiterhin zum Aussondern gezwungen. Der einzige Unterschied wäre, daß wir die Elefantenprodukte nicht verkaufen können. Sie würden vergeudet werden, und das wäre eine tragische, geradezu kriminelle Vergeudung. Wir würden Millionen Dollar an Erlösen verlieren, die wir derzeit dazu benutzen, die Wildreservate zu beschützen, zu vergrößern und zu unterhalten ...« Johnny brach ab und beobachtete, wie ein Stoßzahn von zwei Abdeckern aus dem Kanal im schwammigen Knochen des Schädels gezogen und vorsichtig auf das trockene, braune Gras gelegt wurde. Geschickt zog einer der beiden aus dem offenen Ende den Nerv heraus, einen weichen, grauen, gelatineartigen Faden. Dann fuhr Johnny fort: »Dieser Stoßzahn macht es für uns leichter, die Existenz der Parks und damit der Tiere, die in ihnen leben, gegenüber den einheimischen Stämmen zu rechtfertigen.«
»Das verstehe ich nicht«, gab Daniel ihm ein Stichwort. »Wollen Sie damit sagen, daß die Stämme der Einheimischen die Parks und die Tierpopulationen ablehnen?«
»Nicht, solange sie persönlichen Nutzen daraus ziehen. Wenn wir ihnen beweisen können, daß eine Elefantenkuh dreitausend Dollar wert ist und daß ein ausländischer Safarijäger bereit ist, für die Jagd auf einen großen Bullen fünfzig- oder sogar hunderttausend Dollar auszugeben, wenn wir ihnen zeigen können, daß ein einziger Elefant das Hundertfache, ja vielleicht das Tausendfache ihrer Ziegen oder ihrer ausgemergelten Rinder wert ist, und wenn sie sehen, daß das Geld dafür ihnen und ihrem Stamm zugutekommt, dann werden sie begreifen, warum wir die Herden schützen.«
»Soll das heißen, daß die einheimischen Bauern es für unwichtig halten, Wildtiere um ihrer selbst willen zu erhalten?«
Johnny lachte bitter. »Das ist ein Luxus und eine Gemütsbewegung der Ersten Welt. Die Stämme hier leben ständig an der Grenze zum Existenzminimum. Dabei sprechen wir von einem durchschnittlichen Familieneinkommen von hundertundzwanzig Dollar im Jahr, also zehn Dollar monatlich. Sie können es sich nicht leisten, Acker- und Weideland abzutreten, damit darauf zwar schöne, aber nutzlose Tiere leben können. Wenn das Wild in Afrika überleben soll, muß es für sein Fressen zahlen. In diesem harten Land gibt es nichts umsonst.«
»Man sollte glauben, daß durch ein so naturnahes Leben bei den Einheimischen ein instinktives Gefühl dafür vorhanden ist«, hakte Daniel hartnäckig nach.
»Ja, natürlich, aber es ist völlig pragmatisch. Millionen Jahre lang hat der primitive Mensch, der in der Natur lebte, diese als sich ständig erneuernde Quelle behandelt. Als der Eskimo sich von Karibu, Robbe und Wal ernährte oder der nordamerikanische Indianer von den Büffelherden, begriffen sie die Zusammenhänge instinktiv, auf eine Weise, wie wir es nie schaffen werden. Sie lebten in Harmonie mit der Natur, bis der weiße Mann mit seiner Sprengharpune und seinem Gewehr kam oder, wie hier in Afrika, mit seiner elitären Wildverwaltung und Wildgesetzen, durch die der schwarze Stammesangehörige zum Verbrecher wurde, wenn er auf seinem eigenen Land jagte. Die Wildtiere Afrikas blieben so nur wenigen Auserwählten vorbehalten, die sie anschauen und darüber in Begeisterungsrufe ausbrechen durften.«
»Sie sind ein Rassist«, tadelte Daniel ihn behutsam. »Das alte Kolonialsystem hat die Wildtiere bewahrt.«
»Und wie haben die Wildtiere Millionen Jahre überlebt, bevor der weiße Mann nach Afrika kam? Nein, das Kolonialsystem der Wildtierverwaltung war tierschützend, nicht arterhaltend.«
»Ist das nicht das gleiche, Tierschutz und Arterhaltung?«
»Das sind zwei diametral entgegengesetzte Dinge. Der Tierschützer leugnet das Recht des Menschen darauf, die Schätze der Natur zu nutzen und zu ernten. Er würde sogar leugnen, daß der Mensch das Recht hat, ein lebendes Tier zu töten, selbst wenn er dadurch das Überleben der gesamten Spezies sichern würde. Wäre heute ein Tierschützer hier, würde er uns an dieser Aussonderung hindern, und er würde auch nicht die letzte Konsequenz dieser Art von Tierschutz sehen wollen, die, wie wir gesehen haben, schließlich zur Auslöschung der gesamten Elefantenpopulation und der Zerstörung dieses Waldes führt.
Der verhängnisvollste Fehler aber, den die alten Kolonialtierschützer gemacht haben, war es, die schwarzen Stammesangehörigen an den Vorteilen kontrollierter Arterhaltung nicht teilhaben zu lassen, womit sie bei ihnen die Ressentiments gegen Wildtiere erst weckten. So zerstörten sie seinen natürlichen Instinkt für den Umgang mit seinen Ressourcen. Sie nahmen ihm die Kontrolle über die Natur und machten ihn zum Konkurrenten der Tiere. Endergebnis ist, daß der durchschnittliche schwarze Bauer dem Wild gegenüber feindlich eingestellt ist. Die Elefanten plündern seine Gärten und zerstören die Bäume, die er als Feuerholz braucht. Die Büffel und Antilopen fressen das Gras, auf dem er sein Vieh weidet. Das Krokodil hat seine Großmutter gefressen, und der Löwe hat seinen Vater getötet ... Natürlich muß er sich über die Wildherden ärgern.«
»Und die Lösung, Herr Wildhüter? Gibt es eine?«
»Seit der Entlassung in die Unabhängigkeit haben wir versucht, das Verhalten unseres Volkes zu ändern«, erläuterte Johnny. »Zuerst verlangten die Menschen das Recht auf Zutritt zu den Nationalparks, die der weiße Mann eingerichtet hatte. Sie wollten die Erlaubnis, hineingehen und Bäume fällen, ihr Vieh weiden und Dörfer bauen zu dürfen. Wir haben ihnen jedoch recht erfolgreich den Wert von Tourismus und Safarijagden und kontrollierter Aussonderung vermittelt. Zum ersten Mal partizipieren sie an den Erträgen, und sie haben ein anderes Verständnis für Arterhaltung und behutsame Verwertung entwickelt, vor allem Menschen der jüngeren Generation. Wenn aber die tierschützenden Weltverbesserer aus Europa und Amerika Erfolg hätten und Safaris und der Verkauf von Elfenbein verboten werden würden, wäre das ein Rückschlag für all unsere Bemühungen. Das wäre wahrscheinlich der Todesstoß für den afrikanischen Elefanten und bedeutete schließlich das Ende aller Wildtiere.«
»Ist das am Ende alles eine Frage der Ökonomie?« fragte Daniel.