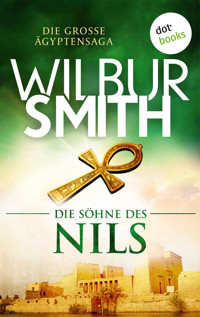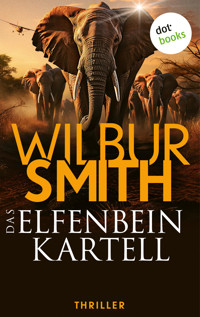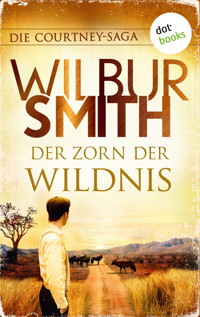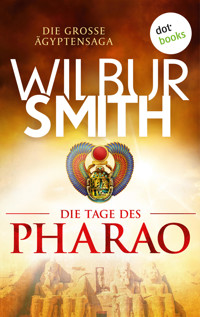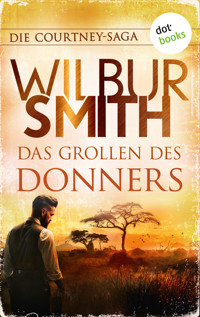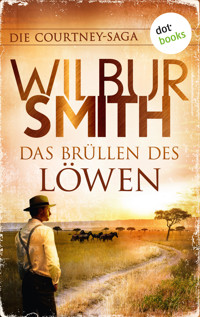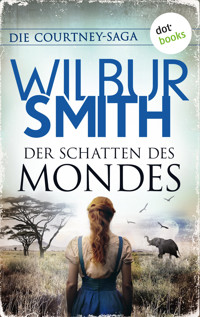
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Das internationale Phänomen, das den Weltruhm des Autors begründet hat: »Ein meisterhafter Geschichtenerzähler!«, urteilt die Sunday Times. Ein letzter Wunsch – ein riskantes Abenteuer … Die Savanne von Simbabwe in den 80ern: Sean Courtney, ein ehemaliger Guerillakämpfer mit einer gewalttätigen Vergangenheit, hat den Pfad des Friedens eingeschlagen und leitet nun Safaris für wohlhabende Männer. Gemeinsam mit seinem todkranken Freund Monterro begibt er sich ins Grenzgebiet zu Mosambik, um dessen letzten Wunsch zu erfüllen: Die Jagd eines legendären Elefantenbullen. Begleitet werden sie von dessen Tochter Claudia, der als Tierschützerin das Töten von Löwen und Elefanten ein Gräuel ist. Sean und die junge Frau fühlen sich sogleich zueinander hingezogen, und das erste Mal in seinem Leben stellt der Großwildjäger seine neue Bestimmung infrage. Doch als sie von skrupellosen Freiheitskämpfern gefangen genommen werden, müssen Sean und Claudia ihr Leben – und ihre Liebe – aufs Spiel setzen, um zu entkommen … Der dramatische Afrika-Roman »Der Schatten des Mondes« von Bestseller-Autor Wilbur Smith ist der siebte Band seiner epochalen historischen Familiensaga um die Familie Courtney – Fans von Jeffrey Archer und James Clavell werden begeistert sein!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 870
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über dieses Buch:
Die Savanne von Simbabwe in den 80ern: Sean Courtney, ein ehemaliger Guerillakämpfer mit einer gewalttätigen Vergangenheit, hat den Pfad des Friedens eingeschlagen und leitet nun Safaris für wohlhabende Männer. Gemeinsam mit seinem todkranken Freund Monterro begibt er sich ins Grenzgebiet zu Mosambik, um dessen letzten Wunsch zu erfüllen: Die Jagd eines legendären Elefantenbullen. Begleitet werden sie von dessen Tochter Claudia, der als Tierschützerin das Töten von Löwen und Elefanten ein Gräuel ist. Sean und die junge Frau fühlen sich sogleich zueinander hingezogen, und das erste Mal in seinem Leben stellt der Großwildjäger seine neue Bestimmung infrage. Doch als sie von skrupellosen Freiheitskämpfern gefangen genommen werden, müssen Sean und Claudia ihr Leben – und ihre Liebe – aufs Spiel setzen, um zu entkommen …
Über den Autor:
Wilbur Smith (1933–2021) wurde in Zentralafrika geboren und gehört zu den erfolgreichsten Schriftstellern der Gegenwart. Der Debütroman seiner Jahrhunderte umspannenden Südafrika-Saga um die Familie Courtney, begründete seinen Welterfolg als Schriftsteller. Seitdem hat er über 50 Romane geschrieben, die allesamt Bestseller wurden, und in denen er seine Erfahrungen aus verschiedenen Expeditionen in die ganze Welt verarbeitete. Seine Bücher wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt und mehrfach verfilmt. Wilbur Smith starb 2021 in Kapstadt im Kreise seiner Familie.
Die Website des Autors: wilbursmithbooks.com/
Die Autorin/der Autor bei Facebook: facebook.com/WilburSmith/
Die Autorin/der Autor auf Instagram: instagram.com/thewilbursmith/
Die große Südafrika-Saga des Autors um die Familie Courtney erscheint bei dotbooks im eBook. Der Reihenauftakt »Das Brüllen des Löwen« ist auch als Hörbuch bei SAGA Egmont erhältlich.
Die große Ägypten-Saga über den Eunuchen Taita ist bei dotbooks als eBook erhältlich. Der Reihenauftakt »Die Tage des Pharao« ist auch als Hörbuch bei SAGA Egmont erhältlich.
Außerdem bei dotbooks erschienen der Abenteuerroman »Der Sonnenvogel« sowie die Action-Thriller »Greed – Der Ruf des Goldes«, »Blood Diamond – Tödliche Jagd«, »Black Sun – Die Kongo-Operation«, »Das Elfenbein-Kartell« und »Atlas – Die Stunde der Entscheidung«. Weitere Bände in Vorbereitung.
***
eBook-Ausgabe Januar 2025
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1989 unter dem Originaltitel »A Time to Die« bei William Heinemann Ltd., London. Die deutsche Erstausgabe erschien 1996 unter dem Titel »Heller Schatten, Dunkler Mond« bei Wilhelm Goldmann.
First published in 1989 by William Heinemann Limited
Copyright © Wilbur Smith 1989
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1996 beim Wilhelm Goldmann Verlag, München
Copyright © der eBook-Ausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: GRAFIKERIN unter Verwendung von …
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (vh)
ISBN 978-3-98952-477-4
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. In diesem eBook begegnen Sie daher möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Diese Fiktion spiegelt nicht automatisch die Überzeugungen des Verlags wider oder die heutige Überzeugung der Autorinnen und Autoren, da sich diese seit der Erstveröffentlichung verändert haben können. Es ist außerdem möglich, dass dieses eBook Themenschilderungen enthält, die als belastend oder triggernd empfunden werden können. Bei genaueren Fragen zum Inhalt wenden Sie sich bitte an [email protected].
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Wilbur Smith
Der Schatten des Mondes
Die Courtney-Saga 7
Aus dem Englischen von Fred Schmitz
dotbooks.
Widmung
Für meine Frau Danielle Antoinette
mit all meiner Liebe
Kapitel 1
Sie saß nun schon über zwei Stunden da, ohne sich zu bewegen, die Qual war kaum noch zu ertragen. Jeder einzelne Muskel schien bebend darauf zu warten, sich wieder strecken zu können. Ihr Gesäß war gefühllos geworden, und trotz dringender Empfehlung hatte sie ihre Blase nicht entleert, bevor sie ins Versteck gegangen waren. Die Männer hatten sie irgendwie gestört, und noch war sie im afrikanischen Busch zu unsicher, um sich ein verstecktes Plätzchen zu suchen. Jetzt bereute sie ihre Scham und ihre Ängstlichkeit.
Durch den Sehschlitz in der rohen Grasverkleidung des Anstands starrte sie in einen schmalen Korridor, den die Gewehrträger durch das Dickicht geschlagen hatten, sehr sorgfältig, denn schon der kleinste Zweig lenkt ein Geschoß ab, das tausend Meter in der Sekunde fliegt. Der Korridor war sechzig Meter lang, so genau abgemessen, daß das Zielfernrohr präzise eingestellt werden konnte.
Ohne den Kopf zu drehen, blickte Claudia seitwärts auf ihren Vater. Sein Gewehrlauf ruhte in einer Astgabel vor ihm, die rechte Hand lag locker auf dem Schaft, zum Zielen brauchte er das Gewehr nur ein wenig anzuheben.
Selbst in ihrer unbehaglichen Position wurde sie wütend bei der Vorstellung, daß ihr Vater dieses unheilvoll glänzende Ding abfeuern könnte. Aber er hatte immer schon die heftigsten und widersprüchlichsten Gefühle in ihr ausgelöst, und nichts, was er tat oder sagte, ließ sie unberührt. Er bestimmte ihr Leben, und sie haßte und liebte ihn deswegen. Immer wieder versuchte sie auszubrechen, und immer wieder zog er sie mühelos an sich. Sie wußte, was die Ursache dafür war, daß sie mit sechsundzwanzig Jahren noch nicht verheiratet war, trotz ihres Aussehens, trotz ihrer Leistungen und obwohl sie zahllose Anträge bekommen hatte, darunter zumindest von zwei Männern, die sie damals zu lieben geglaubt hatte. Die Ursache dafür war der Mann, der neben ihr saß. Sie hatte einfach noch niemanden gefunden, der sich mit ihm vergleichen ließ.
Colonel Riccardo Monterro, Soldat, Ingenieur, Wissenschaftler, Feinschmecker, Multimillionär, Geschäftsmann, Bonvivant, Liebling der Frauen und Sportsmann – so viele Attribute paßten auf ihn, und dennoch beschrieb ihn keines so, wie sie ihn kannte. Keines erfaßte seine Güte und seine Stärke, die ihre Liebe entfachten, keines seine Härte und Grausamkeit, die ihren Haß entflammten. Keines enthüllte, was er ihrer Mutter angetan hatte, die am Ende nur noch eine mißachtete Trinkerin gewesen war. Claudia wußte, daß er fähig war, sie ebenso zu zerstören, wenn sie zuließ, daß er sie erdrückte. Er war der Stier und sie der Matador. Er war ein gefährlicher Mann, und gerade darauf beruhte seine Anziehungskraft.
Jemand hatte ihr einmal gesagt: »Es gibt Frauen, die fallen immer wieder auf die gemeinsten Schufte herein.« Sie hatte das sofort spöttisch beiseite gewischt, aber als sie später noch einmal darüber nachdachte, mußte sie dem Mann teilweise recht geben. Weiß Gott, Vater war auch so einer. Ein ganz gemeiner Schuft, wild, lärmend, mit all dem Charme, den aufblitzenden goldbraunen Augen und den strahlend weißen Zähnen seiner romanischen Vorfahren, der singen konnte wie Caruso und soviel Pasta aß, wie sie ihm nur auf den Teller häufte. Obwohl in Mailand geboren, war er im Grunde Amerikaner, denn Claudias Großeltern waren aus dem Italien Mussolinis nach Seattle ausgewandert, als Riccardo noch ein kleiner Junge war.
Sie hatte verschiedene körperliche Merkmale von ihm geerbt, die Augen, die Zähne und die schimmernde olivfarbene Haut. Aber sie versuchte, jede seiner Wertvorstellungen zurückzuweisen, die ihr Gefühl verletzten, und jeweils das Gegenteil zu tun. Sie hatte sich entschieden, Jura zu studieren, und trotzte damit seiner gesetzlosen Ader, und nur weil er Republikaner war, hatte sie sich, lange bevor sie etwas von Politik verstand, als Demokratin bekannt. Weil er Reichtum und Besitz so sehr schätzte, hatte Claudia nach Abschluß ihres Studiums den ihr angebotenen 200 000-DoIlar-Job ausgeschlagen und dafür eine Stellung für 40 000 Dollar in einer Bürgerrechtsinitiative angenommen. Weil Papa ein Pionierbataillon in Vietnam befehligt hatte und immer noch von »Schlitzaugen« sprach, kümmerte sie sich um die Inuits in Alaska, und die Arbeit befriedigte sie umso mehr, als er sie mißbilligte. Auch die Eskimos waren für ihn nichts als Schlitzaugen. Nun war sie aber auf seine Bitte hin nach Afrika gekommen, und das Schlimmste war, daß er nur hier war, um Tiere abzuknallen, und sie sich wie seine Komplizin vorkommen mußte.
Zu Hause widmete sie ihre ganze Freiheit der ehrenamtlichen Arbeit für die »Alaskan Nature and Wildlife Conservation Society«. Diese Gesellschaft setzte alle ihre Mittel und Kräfte ein, um die Erdöl-Multis an der Suche nach weiteren Quellen und der Zerstörung der Umwelt zu hindern. Die Firma ihres Vaters, »Anchorage Tool and Engineering«, war der Hauptlieferant der Bohranlagen- und Pipelineunternehmer. Sie hatte ihre Entscheidung wohlbedacht und vorsätzlich getroffen. Nun wartete sie in einem fremden Land ergeben darauf, daß er ein schönes wildes Tier abschlachten würde. Ihr schizophrenes Verhalten machte sie ganz krank. Diese Expedition wurde »Safari« genannt! Sie hätte nie im Traum daran gedacht, sich bei einem so abscheulichen Unternehmen mitschuldig zu machen, so wie sie auch in früheren Jahren ähnliche Einladungen von seiner Seite empört abgelehnt hatte, wäre sie nicht ein paar Tage vorher in ein Geheimnis eingeweiht worden. Es konnte das letzte, das allerletzte Mal sein, daß sie mit ihm zusammen etwas unternahm. Dieser Gedanke entsetzte sie noch mehr als das üble Geschäft, in das sie verwickelt war.
Mein Gott, dachte sie, was mache ich nur ohne ihn? Wie wird mein Leben ohne ihn aussehen?
Während sie sich das fragte, wandte sie den Kopf- die erste Bewegung seit zwei Stunden – und sah über die Schulter zurück. Dicht hinter ihr saß noch ein anderer Mann in diesem Versteck aus Binsen: der professionelle Jäger. Auf Dutzenden von Safaris hatte ihr Vater schon mit diesem Mann gejagt, aber Claudia war ihm vor vier Tagen zum ersten Mal begegnet, als sie in Harare, der Hauptstadt von Simbabwe, aus dem Flugzeug der South African Airways gestiegen waren. In seiner zweimotorigen Beechcraft Baron hatte der Jäger sie in dieses weite, abgelegene Jagdreservat nahe der Grenze von Mozambique geflogen. Für dieses Revier hatte er eine Konzession der Regierung von Simbabwe.
Sein Name war Sean Courtney. Sie kannte ihn erst seit vier Tagen, aber sie verabscheute ihn schon, als hätte sie ihn ein Leben lang gekannt. Es war nicht verwunderlich, daß der Gedanke an ihren Vater sie instinktiv dazu veranlaßt hatte, sich nach ihm umzudrehen. Auch er war ein gefährlicher Mann: hart, unbarmherzig und teuflisch gutaussehend, so daß ihre innere Stimme sie eindringlich warnte.
Stirnrunzelnd sah er sie scharf an mit seinen klaren hellgrünen Augen, und die Krähenfüße an den Schläfen zogen sich zusammen; es irritierte ihn, daß sie sich bewegt hatte. Mit einem Finger berührte er ihre Hüfte – und ermahnte sie so, sich still zu verhalten. Es war eine ganz leichte Berührung, aber sie spürte die beunruhigende männliche Kraft in diesem einen Finger. Seine schön geformten Hände waren ihr schon zuvor aufgefallen, wenngleich sie sich nicht davon beeindrucken lassen wollte. Die Hände eines Künstlers, eines Chirurgen oder eines Killers, hatte sie gedacht, aber jetzt verletzte sie diese gebieterische Berührung, sie fühlte sich wie vergewaltigt. Sie starrte wieder gebannt geradeaus durch den Spalt und bebte vor Empörung. Was nahm er sich heraus? Die Stelle, wo er sie an der Hüfte berührte hatte, schmerzte wie ein frisches Brandmal.
Bevor sie an diesem Nachmittag vom Lager aufgebrochen waren, hatte Sean darauf bestanden, daß jeder sich mit einer eigens dafür mitgebrachten unparfümierten Seife wusch. Er hatte Claudia ermahnt, kein Parfüm zu benutzen, und einer der Arbeiter im Camp hatte ein Khakihemd und eine Hose, beides frischgewaschen und gebügelt, auf ihr Feldbett im Zelt gelegt.
»Diese großen Katzen wittern Sie zwei Meilen gegen den Wind«, hatte Sean gesagt. Doch nach zwei Stunden in der Hitze des Sambesi-Tals, während er so nah hinter ihr saß, daß er sie fast berührte, nahm sie seinen Geruch wahr, frischen, männlichen Schweiß, und der Drang, sich auf ihrem Segeltuchstuhl zu bewegen, wurde unwiderstehlich. Unruhe erfüllte sie in seiner Gegenwart, aber sie zwang sich, regungslos sitzen zu bleiben. Sie atmete tief und versuchte unbewußt, den schwachen Dufthauch, der von ihm herüberwehte, aufzufangen, rief sich aber sofort ärgerlich zur Ordnung, als ihr das bewußt wurde.
Eine Handbreit vor dem Sehschlitz hing ein einzelnes grünes Blatt, das nun begann, sich langsam um sich selbst zu drehen, wie ein Wetterhahn, und unmittelbar darauf spürte sie, wie die leichte Abendbrise umsprang.
Sean hatte die Blende mit dem Sehschlitz in der vorherrschenden Windrichtung angebracht, und da nun die Brise auf sie zuwehte, trieb sie einen neuen Geruch vor sich her: Aasgestank. Als Köder diente eine alte Büffelkuh. Sean hatte sie aus einer Herde von zweihundert großen schwarzen Tieren ausgesucht.
»Das alte Mädchen hat mit Nachkommen nichts mehr im Sinn«, erklärte er ihr, und ihrem Vater hatte er zugerufen: »Tief an der Schulter ansetzen, direkt ins Herz!«
Es war das erste Mal, daß Claudia gesehen hatte, wie ein Tier vorsätzlich getötet wurde. Der heftige Knall hatte sie erschreckt und mit Abscheu erfüllt, viel mehr noch aber das strudelnde purpurrote Blut im hellen Licht der afrikanischen Sonne und das unendlich traurige Todesweinen der alten Kuh. Claudia war zum offenen Wagen zurückgekehrt und hatte auf dem Vordersitz gewartet, von Übelkeit gepackt, kalten Schweiß auf der Stirn, während Sean und seine Fährtensucher den Kadaver ausnahmen.
Diesen hatten sie mit Hilfe der Seilwinde vorn am Jagdwagen in die unteren Äste eines wilden Feigenbaums gehievt und nach langem Palaver zwischen Sean und seinen Leuten in der richtigen Höhe festgemacht, so daß nicht ein ganzes Löwenrudel auf einen Sitz alles verschlingen konnte, sondern ein ausgewachsener Löwe auf den Hinterbeinen stehend gerade in der Lage war, hinaufzulangen und sich zu sättigen, um sich dann anderenorts nach einem weiteren Mahl umzusehen.
Schon vor vier Tagen hatte der frische Blutgeruch Schwärme grüner, metallisch glänzender Schmeißfliegen angelockt. Nun hatten die Hitze und die Fliegen dem Kadaver den Rest gegeben. Claudia rümpfte die Nase und verzog das Gesicht bei dem Gestank, den die Brise ihr zutrieb. Es schien ihr, als ob der Geruch Zunge und Gaumen mit Schleim überzog, und während sie auf den Kadaver dort im Baum starrte und sich vorstellte, wie sich die Maden zu Tausenden in das faule Fleisch gruben, schien das schwarze Fell wellenartig leicht hin und her zu schwingen.
»Köstlich.« Sean hatte den Geruch eingesogen, bevor sie in ihr Versteck gingen. »Wie reifer Camembert. Keine Katze im Umkreis von zehn Meilen kann dem widerstehen.« Während sie warteten, senkte sich die Sonne am Himmel, und im weichen Licht leuchteten die Farben des Dickichts intensiver als in der grellen Mittagsglut.
Die kühle Abendbrise schien die Wildvögel aus ihrer Hitzestarre zu lösen. Aus dem Unterholz am Flußufer rief ein Lori: »Kok! Kok! Kok!«, krächzend wie ein Papagei, und in den Zweigen über ihnen huschte ein Paar metallisch glitzernder Honigsauger mit flatternden Flügeln geschäftig hin und her und hing sich mit dem Kopf nach unten in die flaumbedeckten Blüten, um eifrig den Nektar aufzusaugen. Ganz langsam hob Claudia den Kopf, um ihnen fasziniert zuzusehen. Und obwohl sie so nah war, daß sie sogar die dünnen Röhrenzungen wahrnehmen konnte, mit denen die Vögel tief in die gelben Blumen tauchten, bemerkten die winzigen Geschöpfe Claudia nicht, sondern hielten sie wohl für einen Teil des Baums.
Während sie die Vögel beobachtete, spürte sie plötzlich eine Spannung im Versteck aufkommen. Ihr Vater saß bewegungslos da, seine Hand umfaßte den Gewehrschaft etwas fester. Seine Erregung war fast körperlich spürbar. Er starrte durch den Sehschlitz, aber so sehr sie sich auch bemühte, sie konnte den Grund seiner Anspannung nicht erkennen. Aus den Augenwinkeln bemerkte sie, wie Sean Courtney seine Hand unendlich langsam zwischen ihnen hob und den Ellenbogen ihres Vaters warnend umfaßte. Dann hörte sie Sean leise flüstern: »Warten Sie!«
Also saßen sie totenstill und warteten, zehn Minuten, zwanzig Minuten.
»Links!« sagte Sean schließlich, und dies kam so unerwartet, daß sie bei dem kaum hörbaren Murmeln zusammenfuhr. Ihr Blick wanderte nach links. Sie sah nichts. Nur Gras, Buschwerk und Schatten. Sie starrte weiter dorthin, ohne mit der Wimper zu zucken, bis ihre Augen schmerzten und zu tränen anfingen und sie heftig blinzeln mußte. Da schaute sie abermals auf, und diesmal sah sie etwas, das sich bewegte, etwas Braunes, das durch das hohe verbrannte Gras strich.
Dann trat ganz plötzlich, unerwartet, ein Tier in das offene Schußfeld und näherte sich dem stinkenden Kadaver.
Unwillkürlich schnappte Claudia nach Luft. Es war das schönste Tier, das sie je gesehen hatte, eine große Raubkatze, viel größer, als sie erwartet hatte, geschmeidig, mit golden glänzendem Fell. Das Tier wandte den Kopf und schaute zu ihr. Die Kehle war weich und cremefarben, die langen weißen Schnurrhaare schimmerten in der Sonne. Die Ohren waren rund, schwarz an den Spitzen, hochgestellt, lauschend. Die Augen, abweisend und glänzend wie Mondstein, waren gelb, die Pupillen schwarze Pfeilspitzen. Das Tier sah durch die freie Schneise genau auf sie.
Es verschlug ihr den Atem. Erst als das Tier den Kopf abwandte und zu dem Kadaver emporschaute, atmete sie langsam wieder aus.
»Nicht schießen! Bitte nicht schießen!« Fast hätte sie es herausgeschrien. Erleichtert sah sie, daß ihr Vater keinen Muskel bewegt hatte und Seans Hand immer noch seinen Ellenbogen warnend umfaßt hielt.
Erst da wurde ihr klar, daß dies ein Weibchen war, eine Löwin, und sie erinnerte sich an all die Gespräche an den Lagerfeuern, wo sie gehört hatte, daß nur die Mähnenlöwen gejagt werden durften und daß auf das Abschießen eines Weibchens hohe Geldstrafen und sogar Gefängnis standen. Also entspannte sie sich, um sich ganz der Freude zu überlassen, die der Anblick dieses von überwältigender Schönheit gezeichneten Tieres in ihr hervorrief. Ihre Freude wuchs noch, denn die Löwin, die sich umherschauend vergewissert hatte, daß keine Gefahr drohte, gab einen leisen miauenden Laut von sich. Augenblicklich kamen ihre Jungen unbeholfen dahergelaufen. Die drei stolperten über ihre Pranken, die für die kleinen Leiber viel zu groß waren, und nach kurzem Zögern stürzten sie sich in einen ungestümen Scheinkampf, den die Löwin durchaus billigte, und fielen mit wildem Babygebrüll knurrend übereinander her.
Die Löwin ließ sie gewähren. Auf den Hinterbeinen erhob sie sich zu dem herabhängenden Kadaver, steckte den Kopf in den von Innereien befreiten offenen Bauch und fing an zu fressen. Die Reihe schwarzer Zitzen auf ihrem Leib ragte deutlich hervor, und das Fell um sie herum war durch den Speichel ihrer saugenden Sprößlinge verfilzt worden. Sie hatte sie noch nicht entwöhnt, und daher interessierte die Jungen die Mahlzeit ihrer Mutter nicht, sie balgten sich lieber.
Nun betrat eine zweite Löwin die Lichtung, der zwei halberwachsene Junge nachliefen. Diese Löwin war viel dunkler, am Rückgrat entlang fast blau, und ihr Pelz war kreuz und quer von alten Narben gezeichnet, Merkmale eines lebenslangen gefährlichen Jagens, die Siegel von Huf, Horn und Klaue. Die Hälfte eines Ohrs war abgerissen, und ihre Rippen traten unter dem vernarbten Fell hervor. Sie war offensichtlich alt. Die beiden Jungen waren vermutlich ihr letzter Wurf gewesen. Diese würden sie im nächsten Jahr sicher verlassen; sie selbst würde dann auch für das Leben im Rudel zu schwach sein und sterben.
Aber im Augenblick lebte sie noch dank ihrer Geschicklichkeit und ihrer reichen Erfahrung. Sie hatte der jungen Löwin den Vortritt gelassen, denn in genau solch einer Situation hatte sie gesehen, wie zwei Gefährten getötet wurden, auch unter einem aufgehängten saftigen Kadaver, und sie mißtraute dem Köder. Sie ging nicht zum Fressen, sondern schlich am Rande der Lichtung umher, während ihr Schwanz unruhig hin und her peitschte. Immer wieder blieb sie stehen und starrte gespannt auf das mit Gras verkleidete Versteck am Ende der Schneise.
Ihre beiden Jungen saßen auf der Hinterhand und spähten zum Kadaver hinauf. Sie hatten Hunger und knurrten verärgert, denn das Fleisch war eindeutig jenseits ihrer Reichweite. Schließlich ging das ältere ein Stück zurück und sprang mit Anlauf hinauf. Es hing nun mit den vorderen Krallen im Fleisch, die Hinterbeine über dem Boden schwingend, und versuchte, hastig einen Happen zu erwischen, aber die jüngere Löwin scheuchte es fauchend mit Prankenhieben zurück, bis es auf den Rücken fiel, sich aufrappelte und schuldbewußt davonschlich.
Die ältere machte keinen Versuch, ihr Junges zu schützen. So war eben das Gesetz des Rudels: Erwachsene Jäger, die ranghöchsten Mitglieder des Rudels, kamen beim Fressen als erste dran; nur durch deren Stärke konnte ein Rudel überleben. Erst wenn sie sich vollgefressen hatten, durften die Jungen ihren Hunger stillen. In mageren Zeiten, wenn es nur wenig Wild gab oder offenes Gelände die Jagd erschwerte, kam es auch vor, daß die Jungen verhungerten und die Weibchen so lange nicht paarungsbereit waren, bis es wieder Wild in Hülle und Fülle gab. Auf diese Weise war der Fortbestand des Rudels gesichert.
Das Junge kroch zu seinem Geschwister unter dem Kadaver und schnappte mit ihm um die Wette nach den Fleischfetzen, die die Löwin aus der Bauchhöhlung der Büffelkuh riß und versehentlich fallen ließ.
Einmal fiel die jüngere Löwin offensichtlich mißvergnügt auf alle viere zurück, und Claudia sah entsetzt, daß ihr Kopf übersät war von weißen Maden. Die Löwin schüttelte den Kopf und die Maden fielen wie Reiskörner von ihr ab. Sie hieb sich mit den Pranken heftig auf den Schädel, um sich von den fetten Würmern zu befreien, die in den pelzigen Öffnungen ihrer Ohren Unterschlupf suchten. Dann streckte sie den Kopf vor, nieste kräftig und schnäuzte dabei lebende Maden aus den Nüstern.
Ihre kleinen Jungen faßten das als Einladung zum Spielen oder zur Nahrungsaufnahme auf. Zwei sprangen ihr auf den Kopf und versuchten, sich an ihren Ohren festzuhalten, während das dritte schnell unter ihren Bauch tappte und sich wie ein dicker Blutegel an eine Zitze hing. Die Löwin kümmerte sich nicht um sie und stellte sich erneut auf die Hinterbeine, um weiterzufressen. Das Junge an der Zitze brachte es trotzdem fertig, sich noch etwas festzuhalten, fiel aber dann zwischen ihre Hinterbeine, und während sie sich hochreckte und an dem Köder zerrte und zog, wurde es buchstäblich mit Füßen getreten. Zerzaust und staubig und etwas geknickt kroch es unter ihren Beinen hervor.
Claudia kicherte unwillkürlich, schlug jedoch sofort beide Hände vor den Mund. Gleichzeitig stieß Sean sie unsanft an.
Nur die ältere Löwin reagierte auf ihr Gekicher, die anderen waren zu beschäftigt; sie aber preßte sich flach auf den Boden, legte die Ohren an und blickte gebannt in die Schußschneise. Derart von ihr fixiert, verging Claudia das Lachen; stattdessen hielt sie den Atem an.
Sie kann mich nicht sehen, versuchte sie sich zu beruhigen, sie kann mich doch bestimmt nicht sehen. Aber der bohrende Blick der Löwin hielt sie noch sekundenlang in Bann.
Dann stand die ältere Löwin abrupt auf und schlüpfte in das Dickicht hinter dem Baum. Ihr brauner Körper bewegte sich wie eine Schlange: glatt, geschmeidig und lautlos. Langsam ließ Claudia den Atem entweichen und schluckte erleichtert.
Während nun die Kleinen herumtollten, sich balgten und unter dem Köderbaum die Reste fraßen, sank die Sonne unter die Baumwipfel, und die lange Zeitspanne afrikanischen Zwielichts setzte ein.
»Wenn da ein Kerl ist, dann kommt er jetzt«, flüsterte Sean. Die Nacht gehörte den Katzen, im Dunkel wurden sie kühn und besonders wild. Man konnte zusehen, wie es nun dunkel wurde.
Claudia hörte etwas jenseits der Grasabdeckung neben sich, als ob ein Tier verstohlen durch das hohe Gras streift, aber im Busch gab es solche kleinen Geräusche überall, und so drehte sie nicht einmal den Kopf. Doch dann hörte sie einen Laut, ganz deutlich. Da waren die Schritte eines gewaltigen Tieres, sanft und verstohlen, jedoch sehr nahe, und die Angst überlief sie, kroch ihr den Nacken bis zu den Haarwurzeln hinauf. Schnell wandte sie den Kopf zur Seite.
Ihre linke Schulter drückte gegen die schützende Binsenwand, aber darin war ein Spalt, etwa einen Zoll breit. Das Loch war in Augenhöhe, und so sah sie eine Bewegung. Einen Augenblick konnte sie nichts erkennen, doch dann entdeckte sie, was es war: ein kleines Stück glatten gelbbraunen Fells, vielleicht zwei Handbreit von ihr entfernt. Zu Tode erschrocken starrte sie es an. Da glitt das gelbbraune Fell an ihr vorbei, und nun hörte sie etwas anderes, ein atmendes Tier, das an der Strohabdeckung schnupperte.
Instinktiv fuhr sie mit der freien Hand hinter sich, ohne den Blick eine Sekunde von dem Spalt abzuwenden. Eine harte, kühle Hand ergriff die ihre. Die Berührung, die sie noch vor wenigen Minuten zutiefst verletzt hatte, vermittelte ihr jetzt mehr Mut und Sicherheit, als sie je für möglich gehalten hätte, und sie wunderte sich nicht einmal darüber, daß sie nach Seans Hand und nicht nach der ihres Vaters getastet hatte.
Sie starrte durch den Spalt, plötzlich war da ein anderes Auge, ein riesiges, rundes Auge, schimmernd wie gelber Achat; ein furchtbares unmenschliches Auge, das sich nur eine Handbreit vor ihr mit starrem Blick aus dumpfer, schwarzer Pupille in ihre Augen brannte.
Sie wollte schreien, aber die Kehle war ihr wie zugeschnürt. Sie wollte aufspringen, aber ihre Beine waren wie tot. Die angeschwollene Blase lag ihr wie ein Stein im Unterleib, und bevor sie es verhindern konnte, fühlte sie ein paar warme Tropfen fließen. Das brachte sie wieder zu sich, diese Peinlichkeit überwog noch ihr Entsetzen, sie schloß Schenkel und Gesäß fest zusammen, und die Hand Seans hart umklammernd blickte sie immer noch in dieses schreckliche gelbe Auge.
Die Löwin schnüffelte abermals, laut, und wieder erschrak Claudia. Aber sie behielt ihre Fassung. Ich werde nicht schreien.
Die Löwin schnupperte erneut auf der anderen Seite der Abdeckung. Sie witterte Menschengeruch und ließ ein so lautes Knurren hören, daß die Graswand zu schwanken schien. Claudia erstickte den Schrei, bevor er ihrem Mund entwich. Dann war das gelbe Auge vor dem Spalt verschwunden, und sie hörte das Tappen großer Pranken hinten um den Anstand herum.
Dem Geräusch folgend, drehte Claudia den Kopf und sah Sean genau ins Gesicht. Er grinste, und nach allem, was sie gerade durchgemacht hatte, empörte sie dieses sorglose, rücksichtslose Grinsen und der Spott in seinen grünen Augen. Es war offensichtlich: Er lachte sie aus. Die Panik wich von ihr, und ihr Ärger machte sich Luft.
Dieses Schwein, dachte sie, dieses arrogante, dreckige Schwein. Sie wußte, daß sie bleich war im Gesicht, ihre Augen dunkel und vor Schreck noch weit aufgerissen, und sie haßte sich deswegen, und haßte zugleich ihn, weil er es sah.
Sie wollte ihre Hand aus der seinen reißen, konnte aber draußen immer noch die Raubkatze hören, die nach wie vor noch ganz nahe war und umherschlich. Obwohl sie ihn also verabscheute, wußte sie, daß sie sich ohne diese Hand sicher nicht beherrschen könnte. Also ließ sie ihm die Hand, wandte aber ihr Gesicht ab, den verstohlenen Geräuschen der Löwin folgend.
Die Löwin ging an der Blende vorbei. Durch den Sehschlitz sah sie undeutlich den goldschimmernden Körper, der schnell verschwand, und sie sah auch, daß die junge Löwin sich, alarmiert durch das warnende Knurren, samt Familie ins Dickicht zurückgezogen hatte. Der Jagdgrund unter dem Köderbaum lag verlassen da.
Das Licht wurde schwächer. Jetzt würde es binnen Minuten dunkel sein, und der Gedanke an die umherschleichende Bestie in der Finsternis war nahezu unerträglich. Sean griff über ihre Schulter und preßte einen kleinen, harten Gegenstand gegen ihre Lippen. Eine Sekunde lang widerstand sie, machte aber dann den Mund auf und ließ es ihn hineinstecken. Es war ein Kaugummi.
Der ist verrückt geworden, dachte sie verwirrt, wozu jetzt Kaugummi?
Als sie dann aber drauf herumkaute, merkte sie, daß sie keinerlei Speichel mehr gehabt hatte und ihr ausgedörrter Mund sich so zusammengezogen hatte, als hätte sie in eine grüne Dattelpflaume gebissen. Der Minzgeschmack ließ wieder Speichel fließen. Da sie aber wütend auf ihn war, empfand sie kein Gefühl von Dankbarkeit. Er hatte gewußt, daß die Angst ihren Mund ausgetrocknet hatte, und das ärgerte sie zutiefst.
Draußen war jetzt Dämmerlicht. Die Löwin knurrte hinter dem Versteck, und Claudia dachte sehnsüchtig an den Jagdwagen, der eine Meile von hier geparkt stand. Als hätte ihr Vater auch gerade daran gedacht, fragte er leise: »Wann sollen die Gewehrträger mit dem Wagen kommen?«
»Wenn wir kein Büchsenlicht mehr haben«, antwortete Sean ruhig. »In etwa einer Viertelstunde.«
Die Löwin hörte sie sprechen und fauchte drohend.
»Freches Biest«, sagte Sean gutgelaunt. »Die Bissige Berta persönlich.«
»Seien Sie still!« zischte Claudia. »Sie wird uns noch finden.«
»Ach, die weiß jetzt, daß wir hier sind«, entgegnete Sean und rief dann mit lauter Stimme: »Hau ab, du dämliches altes Luder, hau ab zu deinen Babys.«
Claudia riß ihre Hand aus seiner. »Sie verdammter Idiot! Sie bringen uns noch um!«
Die laute Menschenstimme hatte die Raubkatze alarmiert, und hinter der Graswand herrschte minutenlang Ruhe. Sean nahm die kurze, häßliche, doppelläufige Büchse, die neben ihm an der Wand lehnte, und legte sie sich quer über den Schoß. Er öffnete den Verschluß seiner Nitro Expreß, ließ die dicken Messingpatronen herausgleiten und setzte dafür zwei andere ein, die er aus den Schlaufen der linken Brusttasche nahm. Er war etwas abergläubisch, dieses Ritual des Patronentauschens vollzog er immer zu Beginn einer Jagd.
»Hören Sie zu, Capo«, sagte er zu Riccardo. »Wenn wir diese alte Hure ohne zwingenden Grund abschießen, bin ich meine Lizenz los. Zwingender Grund ist, wenn sie einem gerade den Arm zerfleischt. Sonst nicht. Haben Sie verstanden?«
»Verstanden«, bestätigte Riccardo.
»Also gut, Sie schießen erst, wenn ich’s Ihnen sage. Sonst, so leid es mir tut, muß ich Sie erschießen.«
Sie grinsten sich im Dämmerlicht an, und Claudia stellte fassungslos fest, daß sich die beiden tatsächlich amüsierten.
»Wenn Job mit dem Wagen ankommt, wird’s pechschwarze Nacht sein, und Job kann nicht bis rauf zum Anstand fahren. Wir müssen runtergehen zum Flußbett. Sie gehen als erster, Capo, und dann Claudia zwischen uns beiden. Dicht beieinander bleiben, und egal was passiert: Nicht laufen! Auf keinen Fall rennen!«
Jetzt hörten sie die Löwin wieder, die mit weichen Tritten umherschlich. Sie knurrte abermals, sofort kam das Echo von der anderen Seite des Verstecks. Dort hielt sich die junge Löwin auf.
»Da ist die ganze Bande versammelt«, erklärte Sean. Der Klang der Stimmen und ihr Knurren hatten die Sippe aufmerksam gemacht; aus den Jägern waren Gejagte geworden.
Sie waren in ihrem Versteck gefangen. Es war jetzt fast vollständig dunkel; am westlichen Horizont zeigte sich nur noch ein stumpfes dunkles Rot.
»Wo ist der Wagen?« flüsterte Claudia.
»Ist unterwegs«, sagte Sean und befahl gleich darauf mit scharfer Stimme: »Runter! Auf den Boden!« Claudia hatte nichts gehört, ließ sich aber sofort aus dem Segeltuchstuhl auf die Erde fallen.
Die Löwin war zur Blende geschlichen, fast lautlos, warf sich nun mit wildem Brüllen dagegen und schlug ihre Pranken in das dünne Grasgewebe. Mit Entsetzen sah Claudia, daß die Binsenwand auf sie fiel.
»Kopf runter!« schrie Sean, als die Wand aufbrach, und hob die doppelläufige Büchse.
Er feuerte, und ein ungeheurer Knall hallte durch das Versteck, das zugleich wie durch einen Blitz erleuchtet wurde. Er hat die Bestie getötet, dachte Claudia und war ungeachtet ihres Abscheus vor der blutigen Jagd erleichtert, wenn auch etwas schuldbewußt. Der Schuß hatte die Raubkatze aber nur erschreckt und für den Augenblick verscheucht: Claudia hörte, wie die Löwin grimmig fauchend in das Dickicht galoppierte.
»Daneben geschossen«, tadelte sie ihn atemlos, den Gestank verbrannten Pulvers noch in der Nase.
»Wollte sie nicht treffen.« Sean lud neue Patronen nach. »War nur ein Warnschuß vor den Bug.«
»Da kommt der Wagen«, sagte Riccardo plötzlich völlig gleichmütig. In Claudias Ohren dröhnte immer noch der Schuß, aber jetzt hörte auch sie den Dieselmotor.
»Job hat den Schuß gehört.« Sean stand auf. »Er kommt früh. Sehr schön. Dann wollen wir mal los.«
Claudia stand auf. Dann schaute sie über die niedrige Graswand des dachlosen Anstands in das drohende Dunkel des Waldes rings herum und dachte an den Pfad zum Flußbett, der als Straße diente. Bis zum Jagdwagen war es sicher noch eine Viertelmeile durch die Nacht. Bei dieser Aussicht sank ihr der Mut.
Hinter den Bäumen, einen Steinwurf entfernt, brüllte die Löwin wieder.
»Alte Nervensäge«, sagte Sean leise lachend und führte Claudia am Ellenbogen zur Tür. Diesmal wich sie nicht zurück, sondern hielt seinen Arm sogar fest umklammert.
»Halten Sie sich an Capos Gürtel fest.« Sanft löste er ihre Hand und führte sie zum Gürtel ihres Vaters.
»Halten Sie sich fest«, mahnte er. »Und denken Sie dran: Was auch passiert – nicht rennen! Das zieht sie erst recht an. Sie können dem Katz-und-Maus-Spiel nicht widerstehen.«
Er knipste die Stablampe an, aber selbst der kraftvolle Strahl dieser starken Lampe, mit der er einmal im Kreis leuchtete, wirkte in diesem finsteren Riesenwald nur schwach gelblich. Ein paar Mal glühten in dem Strahl Augen auf, funkelnd wie unheilvolle Sterne; da waren viele Augen im dunklen Busch, unmöglich, zwischen ausgewachsenen Löwinnen und Löwenjungen zu unterscheiden.
»Vorwärts«, sagte Sean ruhig, und Riccardo ging den unebenen engen Pfad hinab, Claudia im Schlepptau.
Sie gingen langsam, dicht zusammen. Riccardo sicherte mit dem leichteren Gewehr nach vorn, und Sean bildete mit der schweren Büchse und der Stablampe die Nachhut.
Immer wenn das Auge einer Katze im Lichtstrahl aufblitzte, schien sie näher herangekommen zu sein, bis Claudia endlich das ganze Tier hinter dem glühenden Auge ausmachen konnte. Bleich wie Nachtfalter erschienen die beiden Löwinnen in diesem Licht, behende und ruhelos umkreisten sie ihre Beute, durchstreiften geschwind das Unterholz. Sie beobachteten höchst aufmerksam, drehten jedoch den Kopf weg, wenn der starke Lichtstrahl ihre Augen traf.
Der Pfad war steil und uneben und nahm kein Ende. Jeder Meter, den sie hinter ihrem Vater herstolperte, steigerte Claudias quälende Ungeduld. Sie achtete nicht auf ihre Schritte, sah nur die bleichen katzenhaften Gestalten, die im Kreis um sie herumliefen.
»Da kommt die Bissige Berta! « sagte Sean wütend, als die alte Löwin ihren Mut zusammennahm und aus dem Dunkel heraus auf sie zukam, fauchend wie eine Dampflokomotive; ein ohrenbetäubender Schwall von Urlauten kam aus ihrer Kehle durch das weit offene Maul. Der lange Schwanz schnellte hin und her wie eine Nilpferdpeitsche. Sie blieben eng zusammen stehen, und Sean richtete den Lichtstrahl und die Büchse auf das angreifende Tier.
»Verschwinde!« brüllte er sie an. »Los! Hau ab!«
Die Löwin kam näher, die Ohren am Schädel angelegt, in ihrem aufgerissenen Maul waren lange gelbe Fangzähne und eine hellrote Zunge sichtbar.
»Ja! Bissige Berta!« schrie er. »Ich blas’ dir deinen dämlichen Schädel weg!«
Im letztmöglichen Moment kam sie zum Stehen, indem sie mit steifen Vorderbeinen den Angriff abbremste; sie stand drei Meter vor ihnen, der Staub wirbelte im Lichtstrahl hoch.
»Verpiß dich!« befahl Sean ihr streng, und ihre Ohren richteten sich auf, sie drehte sich um und trottete gehorsam in den Wald zurück.
»Sie wollte mal sehen, wer von uns mehr Angst hat, und hat’s einfach mal versucht.« Sean lachte in sich hinein.
»Aber wie konnten Sie das wissen?« Claudias schrille Stimme überschlug sich fast.
»Ich seh’s am Schwanz. Solange sie damit wedelt, ist alles nur Spaß. Wenn sie ihn allerdings steif hält, dann mach dich auf etwas gefaßt!«
»Hier kommt der Wagen«, sagte Riccardo. Der Wagen holperte unten durchs trockene Flußbett; sie konnten die Scheinwerfer durch die Bäume sehen.
»Gott sei’s gedankt«, flüsterte Claudia.
»Es ist noch nicht vorbei«, sagte Sean warnend, während sie auf dem Pfad weitergingen. »Da ist immer noch die Wilde Wilma.«
Claudia hatte gar nicht mehr an die jüngere Löwin gedacht. Nun, während sie ihrem Vater hinterherstolperte, blickte sie sich um.
Endlich waren sie am Flußufer angelangt, das vom Licht der Scheinwerfer beleuchtet wurde. Der Jagdwagen stand mit laufendem Motor etwa dreißig Meter vor ihnen. Hinter dem blendenden Strahl konnte Claudia bereits die Köpfe der Fährtensucher auf dem Vordersitz erkennen. So nahe, so sehr nahe war das Ziel, daß sie sich nicht mehr beherrschen konnte: Sie ließ einfach den Gürtel los und rannte zum Wagen, stürmte wie wild durch den Sand.
»Sind Sie wahnsinnig?« brüllte Sean.
Und fast gleichzeitig vernahm man das grollende Brüllen einer Löwin im Angriff. Im Laufen blickte Claudia seitwärts. Die Löwin hatte sie fast erreicht. Im Scheinwerferlicht schien sie riesig, bleich, schlangenschnell. Bei ihrem Gebrüll zog sich Claudias Magen heftig zusammen, und ihre Füße kämpften mit dem Sand. Claudia sah nun auch, daß die Löwin ihren Schwanz hochhielt. Er war so steif wie ein Ladestock, und sie erinnerte sich trotz ihrer Panik an die Worte Seans und war sich vollkommen darüber klar: Diesmal wird sie nicht anhalten, diesmal wird sie mich töten.
Einen entscheidenden Augenblick lang hatte Sean ihr Wegrennen gar nicht bemerkt. Er war gerade dabei, vorsichtig den steilen Pfad zum Flußbett hinunterzugehen, die Stablampe in der linken, die Büchse in der rechten Hand; er hielt das Gewehr am Kolbenhals, die Läufe über der Schulter, der Daumen auf dem Sicherungsbügel. Er behielt die alte Löwin am Rande des Schilfs im Auge; sie kroch auf dem Bauch auf sie zu, aber er war sicher, daß sie jetzt nur einen Überfall markierte, da er sie durch seine Entschlossenheit in die Schranken verwiesen hatte. Zwei ihrer Jungen folgten ihr in großem Abstand, sie saßen im Gras und beobachteten das Schauspiel hingerissen mit großen Augen, waren aber zu scheu, um schon teilzunehmen. Die jüngere Löwin hatte er aus den Augen verloren, obgleich er überzeugt war, daß sie jetzt die größere Gefahr darstellte, aber das Schilf stand dicht und hoch.
Er hatte gespürt, wie Claudia gegen seine Hüfte stieß, dachte aber, sie sei gestolpert, und merkte nicht, daß sie ihn gestoßen hatte, als sie sich umdrehte, um wegzurennen. Er spähte immer noch nach der jüngeren Löwin, tastete das Schilf mit dem Lichtstrahl ab, als er Claudias Füße im Sand knirschen hörte; er wirbelte herum und sah sie dort allein im Flußbett.
»Sind Sie wahnsinnig?« brüllte er, fassungslos vor Wut. Seit ihrer Ankunft vor vier Tagen hatte dieses Mädchen pausenlos für Ärger und Mißstimmung gesorgt. Nun hatte sie auch noch in ihrer Verblendung seinen strikten Befehl mißachtet. Er dachte sofort, noch bevor die Löwin zum Sprung ansetzte, daß ein getöteter oder schwer verwundeter Jagdgast für einen Berufsjäger die größte Schande war. Das konnte das Ende seiner Laufbahn, das beschämende Ende von zwanzig Jahren Mühe und harter Arbeit sein.
»Sind Sie wahnsinnig?« Sein ganzer Zorn entlud sich in diesem Schrei, den er der laufenden Gestalt hinterherschickte. Er stürzte an Riccardo vorbei, der immer noch starr vor Schreck im Weg stand. In genau diesem Augenblick brach die Löwin aus dem Schilf, wo sie gelauert hatte.
Das Flußbett war gottseidank durch die Scheinwerfer hell erleuchtet; daher ließ Sean die Stablampe fallen und riß das Gewehr mit beiden Händen hoch. Aber er konnte nicht feuern, denn das Mädchen befand sich genau zwischen ihm und der Löwin. Claudia rannte unbeholfen durch den klebrigen Sand, hob den Kopf nach vorn, um den Angriff zu sehen, und ruderte heftig mit den Armen.
»Runter!« brüllte Sean. »Auf den Boden!« Aber sie rannte weiter und hinderte ihn so am Schießen. Jetzt stürmte die Löwin heran, fortschnellender Sand unter ihren Pranken, die gelben Krallen bereits ausgestreckt, bei jedem Satz fauchend und brüllend und den Schwanz steil in die Höhe gereckt.
Im Scheinwerferlicht wirkten die Schatten des Mädchens und der Löwin auf dem weißen Sand unwirklich. Sean mußte tatsächlich hilflos durch das Visier zusehen, wie sich die Löwin zum Sprung niederkauerte, denn er konnte sie nicht auseinanderhalten: Es war unmöglich zu schießen, ohne das Mädchen zu treffen.
Im letzten Augenblick stolperte Claudia, die kraftlosen Beine gaben unter ihr nach, und mit einem verzweifelten Schrei fiel sie kopfüber in den Sand.
Sofort zielte Sean auf die creme-farbene Brust der Löwin. Mit diesem Gewehr traf er zwei gleichzeitig in die Luft geworfene Münzen auf dreißig Schritt, nacheinander, bevor sie zu Boden fielen. Mit diesem Gewehr hatte er Leoparden, Löwen, Nashörner, Büffel und Elefanten zu Hunderten getötet – und Männer, viele Männer während des rhodesischen Buschkriegs. Ein zweiter Schuß war niemals nötig gewesen. Nun war das Ziel frei, nun konnte er schießen. Das wäre das Ende dieser Raubkatze, das Ende der Safari und vermutlich auch das Ende seiner Lizenz. Zumindest würde es monatelange Untersuchungen und wahrscheinlich auch einen Prozeß geben. Eine getötete Löwin! Damit konnte er den ganzen Zorn der Regierung und des Wild-Departments auf sich ziehen.
Die Löwin war fast bei dem Mädchen, zwischen ihnen nur noch anderthalb Meter. Es war sehr riskant, was Sean nun vorhatte. Das Leben des Mädchens hing zwar davon ab, aber sie hatte ihn so wild gemacht, daß sie ruhig einen Teil des Risikos tragen sollte.
Er feuerte einen halben Meter vor dem aufgerissenen Maul der Löwin in den Sand. Das schwere Geschoß schlug ein und warf eine Sandwolke auf, eine Fontäne emporschießender weißer Körner, die das Tier einen Augenblick lang völlig einhüllte. Sand füllte das Maul und die Lungen, drang in seine Nüstern und verstopfte sie. Sand schoß ihm in die offenen gelben Augen. Die Löwin war wie blind und brach den Angriff ab.
Sean schnellte nach vorn, der zweite Gewehrlauf war feuerbereit. Aber es war nicht mehr nötig zu schießen. Die Löwin wich bereits zurück, schlug sich wie wild mit den Pranken auf die sandverklebten Augen, fiel auf die Seite, sprang wieder auf und raste auf das Schilf zu. Sie schoß blindlings in den Uferhang, überschlug sich und rappelte sich wieder auf. Dann allmählich verklang das Getöse ihres wilden Galopps und ihr Schmerzgebrüll.
Sean erreichte Claudia, schob einen Arm unter sie und riß sie hoch. Ihre Beine versagten, und er schleifte sie zum Jagdwagen halb tragend, halb ziehend; dann packte er sie auf den Vordersitz.
Gleichzeitig kletterte Riccardo auf den Rücksitz, Sean sprang auf das Trittbrett, in der freien Hand das Gewehr schußbereit wie eine Pistole ins Dunkel gerichtet.
»Los!« brüllte er Job an, und der Matabele-Fahrer ging von der Kupplung, und sie brausten über das steinige Flußbett.
Eine Minute lang schwiegen alle, bis sie aus dem Flußbett heraus auf einen besseren Weg kamen. Dann sagte Claudia mit unterdrückter Stimme: »Wenn ich jetzt nicht sofort pinkle, platze ich.«
»Wir könnten Sie eigentlich wie einen Feuerlöscher gegen die Bissige Berta halten und die einfach wegspülen«, meinte Sean kühl. Riccardo auf dem Hintersitz lachte schallend. Obwohl Claudia aus seinem Gelächter die Erleichterung und die nervöse Spannung heraushörte, nahm sie es ihm doch übel. Die ohnehin erlittene Demütigung wurde dadurch für sie noch verschärft.
Die Fahrt zum Camp dauerte eine Stunde. Als sie ankamen, hatte Moses, Claudias Lagerdiener, bereits heißes Wasser vorbereitet. Die Dusche war ein altes Ölfaß, in den Zweigen eines Mopan-Baums aufgehängt, hinter einem Binsenvorhang.
Unter dem heißen Wasserstrahl fühlte Claudia, wie die Erniedrigung und die Übelkeit nach dem Adrenalinschock allmählich schwanden und dem erhebenden Gefühl Platz machten, einer außerordentlichen Gefahr entronnen zu sein.
Während sie sich genüßlich einseifte, hörte sie Sean zu. Er war zwar fünfzig Meter weiter in seinem Zelt, aber sein regelmäßiges Keuchen beim Hantelnheben war deutlich zu hören. In den vier Tagen, seit sie hier war, hatte er diese Übung nicht einmal ausgelassen, gleichgültig, wie lang oder wie anstrengend die Jagd gewesen war.
Dieser Rambo! Sie lächelte spöttisch über seine männliche Eitelkeit, und doch hatte sie sich in den letzten Tagen mehrmals dabei ertappt, wie sie verstohlen seine muskulösen Arme oder seinen flachen Windhundbauch betrachtete, ihr Blick zuweilen sogar seinem festen Hintern folgte.
Moses lief mit der Laterne vor ihr her, als sie aus der Dusche kam; sie trug ihren seidenen Morgenrock, ein Handtuch war wie ein Turban um ihr Haar geschlungen. Es war alles für das Abendessen herausgelegt: Khakihosen, ein feines Sporthemd, Moskito-Stiefel aus weichem Straußenleder. Die Hosen knisterten sanft, als sie sie anzog, auch das trug zu ihrem Wohlgefühl bei.
Sie ließ sich Zeit, trocknete und bürstete ihr Haar, legte einen Hauch von Make-up auf, zog die Lippen nach, und als sie sich in ihrem kleinen Spiegel besah, fühlte sie sich noch besser.
»Wer ist nun eitel?« fragte sie sich, lächelte und ging zum Lagerfeuer, wo die Männer schon saßen. Sie genoß es, daß die Männer aufhörten zu reden und ihren Auftritt beobachteten. Sean erhob sich von seinem Stuhl, um sie zu begrüßen, was sie irritierte. Diese blöden britischen Manieren brachten sie immer aus der Fassung.
»Bleiben Sie doch sitzen.« Sie versuchte, barsch zu klingen. »Sie brauchen doch nicht dauernd auf und nieder zu springen.«
Sean lächelte freundlich. Laß sie bloß nicht merken, wie gut sie’s fertigbringt, dich wild zu machen, sagte er sich warnend. Er hielt ihr den Stuhl hin, und sie setzte sich.
»Gib der Dame einen Drink«, befahl Sean dem Diener. »Du weißt ja, wie sie ihn haben will.«
Der Diener servierte den Drink auf einem silbernen Tablett. Perfekt: ein Schuß Whisky, gerade genug, um das Sodawasser leicht braun zu färben, und Eis bis zum Rand. Der Boy trug ein knielanges schneeweißes Kanza-Gewand, eine purpurrote Schärpe über der Schulter, zum Zeichen, daß er der Chef war, und auf dem Kopf einen purpurroten Fez. Seine zwei Helfer standen weiter hinten; auch sie in weißen Gewändern und mit Fez. Claudia war etwas verlegen: Zwanzig Diener für drei Personen, das war Kolonialstil! Man schrieb 1987, um alles in der Welt, und das Empire war doch längst passé – aber immerhin, der Whisky war köstlich.
»Sie erwarten sicher jetzt, daß ich mich für meine Lebensrettung bedanke«, sagte sie, als sie am Glas nippte.
»Nicht doch, Schätzchen.« Sean hatte schon gleich gemerkt, daß sie diese Anrede haßte. »Ich erwarte nicht einmal, daß Sie sich für Ihre ungeheure Dummheit entschuldigen. Offen gestanden, ich habe mir eigentlich mehr Sorgen darüber gemacht, daß ich beinahe die Löwin hätte erschießen müssen. Das wäre wirklich eine Katastrophe gewesen.«
Sie fochten mit leichtem Florett, und Claudia bemerkte, daß es begann, ihr Vergnügen zu machen. Jeder Ausfall, der seine Deckung durchbrach, erfüllte sie mit inniger Genugtuung, und bedauernd hörte sie den Boy verkünden: »Koch sagen, die Dinner fertig, Mambo.« Sean führte sie zum Essenszelt, das von einem vielarmigen Leuchter aus Meissner Porzellan erhellt wurde. Das Besteck war aus echtem Silber, und auf der Spitzendecke aus Madeira funkelten kristallene Waterford-Weingläser. Hinter jedem der klappbaren Segeltuchstühle stand ein Boy in weißer Robe.
»Was darf’s denn heute abend sein, Capo?« fragte Sean.
»Vielleicht eine Spur Wolfgang Amadeus«, meinte Riccardo. Sean drückte den Knopf des Cassetten-Decks, und die hellen Klänge von Mozarts Klavierkonzert Nr. 17 breiteten sich aus.
Die Suppe aus Erbsen, Perlgraupen und Büffelmarkknochen war mit einer schauerlichen Chili-Sauce gewürzt, die Sean Peli Peli Ho Ho nannte.
Von ihrem Vater hatte Claudia eine Vorliebe für Chili, Knoblauch und Rotwein geerbt, aber vor dem zweiten Gang scheute sie zurück: Büffelkutteln in weißer Sauce. Die beiden Männer liebten die Kutteln »grün«, eine schönende Umschreibung dafür, daß der ursprüngliche Inhalt der Kutteln nicht sauber ausgewaschen worden war.
»Ist doch nur gekautes Gras«, erklärte ihr Vater, und sie kam sich etwas zimperlich vor. Doch als sie sich umwandte und einen Dufthauch des Mahles mitbekam, das der Koch nur für sie zubereitet hatte, war sie erfreut. Unter einer goldenen Pastetenkruste dampften geschmorte Antilopenfilets und Nierchen.
Der Koch hatte sein Haupt mit der hohen weißen Mütze geschüttelt, als sie ihm vorschlug, noch zehn Knoblauchzehen hinzuzufügen. »Kochbuch sagen, kein Knoblauch, Donna.«
»Ich möchte gerne Knoblauch, genau gesagt zehn Zehen Knoblauch, okay, Chef? « Und der Koch hatte grinsend kapituliert. Claudia hatte gleich von Anfang an das ganze Lagerpersonal durch ihre unbekümmerte Art für sich eingenommen.
Man trank einen gehaltvollen, kräftigen südafrikanischen Cabernet, mindestens so gut wie Chianti. Die Anstrengungen des Tages, die Hitze und die frische Luft hatten ihr Appetit gemacht. Wie ihr Vater konnte sie essen und trinken, soviel sie wollte, ohne ein Gramm zuzunehmen. Die Unterhaltung war allerdings eine Enttäuschung. Wie an jedem Abend sprachen die Männer über Gewehre und Großwildjagd. Das Gerede über Waffen war für sie ohnehin nur unverständliches Kauderwelsch.
Ihr Vater sagte dann so etwas wie: »Die .300er Weatherby treibt so ein Ding von 11,7 Gramm über 1000 Meter in der Sekunde, bei einer Auftreffenergie von über 5000 Joule, das gibt einen ungeheuren Druckwellenschock.«
Dann erwiderte Sean so etwas wie: »Ihr Yankees, ihr seid so auf Geschwindigkeit versessen. Roy Weatherby hat auf afrikanisches Wild mehr Kugeln verschossen, als Sie Spaghetti gegessen haben, Capo. Da halte ich mich an hohen Gasdruck, an Nosler-Geschosse und eine mittlere Geschwindigkeit ...«
Kein normaler Mensch hält das aus, Stunde für Stunde, sagte sie sich, war deshalb auch bisher jeden Abend zu Bett gegangen und hatte die beiden am Lagerfeuer ihren Gesprächen bei Cognac und Zigarren überlassen.
Wenn allerdings von Tieren gesprochen wurde, erwachte ihr Interesse, dann nahm sie sogar am Gespräch teil, in der Regel, um ihr Mißfallen kundzutun. Die Männer sprachen meistens von bestimmten legendären alten Einzeltieren, denen Sean Namen gegeben hatte, was Claudia genauso verärgerte, wie daß er ihren Vater »Capo« nannte, als wäre der ein angesehener Mafioso.
Eines dieser Tiere nannte er »Friedrich den Großen« oder einfach »Fritz«. Das war der Löwe, den sie jetzt jagten, für den sie auch den Büffelköder aufgehängt hatten.
»Ich habe ihn in dieser Saison bisher zweimal gesehen, ein Klient hat sogar einmal versucht, auf ihn zu schießen. Der Kerl hat so gezittert, daß er meilenweit danebenschoß.«
»Erzählen Sie mir mehr von ihm.« Riccardo beugte sich erwartungsvoll vor.
»Papa, er hat dir schon gestern abend von ihm erzählt«, sagte Claudia sanft, »und vorgestern und vorvorgestern ...«
»Kleine Mädchen sollte man sehen und nicht hören.« Riccardo lachte leise. »Hab’ ich dir denn gar nichts beigebracht? Erzählen Sie mir noch etwas von Fritz.«
»Er ist mehr als dreieinhalb Meter groß, und das betrifft nicht nur die Körperlänge. Er hat einen Kopf wie ein Flußpferd und eine Mähne wie ein schwarzer Heuhaufen. Wenn er geht, dann ist das ein Wogen und Tosen wie der Wind in einem Msasa-Baum.« Sean geriet ins Schwärmen. »Listig und verschlagen? Was glauben Sie. Fritz kennt alle Tricks. Ich weiß allein von drei Gelegenheiten, bei denen auf ihn geschossen wurde. Vor drei Jahren hat ihn einmal ein spanischer Jäger in Ian Piercys Konzession angeschossen und verwundet, aber davon hat er sich erholt. So groß wie der wird man nicht, wenn man blöd ist.«
»Wie kommen wir an ihn ran?« fragte Riccardo.
»Ihr zwei, ihr seid abscheulich«, warf Claudia ein, bevor Sean antworten konnte. »Diese großartigen Geschöpfe, die ihr heute gesehen habt, diese wunderschönen kleinen Löwenbabys, wie könnt ihr es nur fertigbringen, sie zu töten?«
»Ich hab’ heute kein getötetes Löwenbaby gesehen«, entgegnete Riccardo und nickte dem Boy zu, der ihm nochmals Kutteln anbot. »Tatsache ist, wir haben weder Mühe noch Risiken gescheut, damit sie am Leben bleiben.«
»Du opferst fünfundvierzig Tage deines Lebens, nur um Löwen und Elefanten abzuschießen«, erwiderte Claudia heftig, »also spiel hier nicht den aufrechten Mann, Riccardo Monterro.«
»Ich bin immer wieder fasziniert von den verworrenen Gedankengängen von euch laut protestierenden Liberalen«, warf Sean ein, und Claudia wandte sich sofort voller Eifer und Kampfeslust an ihn.
»Meine Gedankengänge sind nicht verworren. Sie sind doch hier, um Tiere zu töten.«
»Richtig. So wie ein Farmer Tiere tötet«, antwortete Sean. »Um sicherzustellen, daß seine Herde wächst und gedeiht und genügend Raum zum Leben hat.«
»Sie sind kein Farmer.«
»Doch«, widersprach Sean. »Der Unterschied ist nur, daß ich die Tiere im Jagdgebiet schlachte und nicht im Schlachthof, aber meine Hauptsorge galt dem Überleben des ›Zuchtviehbestandes‹.«
»Aber das sind keine Haustiere hier«, wandte Claudia ein. »Das sind wunderschöne wilde Tiere.«
»Wunderschöne wilde Tiere? Was zum Teufel hat das damit zu tun? Wie alles in unserer modernen Welt hat auch das Wild in Afrika für sein Überleben einen Preis zu zahlen. Der Capo hier zahlt Zehntausende von Dollars, um einen Löwen und einen Elefanten jagen zu können. Er gesteht diesen Tieren einen Geldwert zu, der viel höher ist als der von Ziegen und Rindern, und infolgedessen ist die seit kurzem unabhängige Regierung von Simbabwe bereit, Konzessionen von Millionen von Quadratmeilen nur für Wild zu reservieren. Ich pachte eine solche Konzession, und ich habe das größte Interesse der Welt, dieses Wild vor Verletzungen und vor Wilderern zu schützen, damit ich meinen Jagdgästen immer genügend davon anzubieten habe. Nein, mein Schätzchen, legale Jagdsafaris bieten immer noch einen wirksamen Schutz der Natur und der Tiere in Afrika.«
»Also Sie wollen die Tiere retten, indem Sie sie mit Hochleistungsgewehren abknallen?« fragte Claudia voller Verachtung.
»Hochleistungsgewehre?« Sean lachte leise. »Auch so ein sentimentaler Ruf der Liberalen. Würden Sie uns stattdessen lieber Luftgewehre an die Hand geben? Da könnten Sie genauso gut von einem Metzger verlangen, daß er dem Tier die Kehle mit einem stumpfen Messer durchschneidet. Sie sind doch eine intelligente Frau, denken Sie mit dem Kopf, nicht mit dem Herzen. Das einzelne Tier ist unwichtig. Seine Lebensspanne ist auf wenige Jahre beschränkt. Bei diesem Löwen, den wir jagen, zum Beispiel, beträgt sie höchstens zwölf Jahre. Wichtiger allerdings und nicht mit Gold aufzuwiegen ist der Fortbestand der Art als solcher. Nicht des einzelnen Tieres, sondern der Art! Unser Löwe ist jetzt ein alter Kerl, kurz vor dem Ende seines Lebens, er hat seine Weibchen und seine Jungen beschützt und seine Gene in den Fonds seiner Rasse eingebracht. Er wird im nächsten oder im übernächsten Jahr sowieso an Altersschwäche sterben. Es ist viel besser, sein Tod bringt zehntausend Dollar in bar ein, die seinen Jungen einen geschützten Lebensraum sichern helfen, als daß schwarze Menschenmassen mit ihren Herden ausgehungerter Ziegen hier einschwärmen und seine Wildnis verwüsten.«
»Hör’ sich das einer an. Du lieber Gott!« Claudia schüttelte bestürzt den Kopf. »Einschwärmende schwarze Menschenmassen, so spricht doch ein Rassist oder Fanatiker. Das ist ihr Land, warum sollten sie nicht frei entscheiden dürfen, wo sie leben wollen?«
»Das ist die Logik wirrköpfiger Liberaler.« Sean lachte. »Sie müssen sich mal entscheiden, wo Sie stehen, auf der Seite der wunderschönen wilden Tiere oder auf der Seite der wunderschönen wilden Schwarzen. Sie können nicht beides haben. Wenn sich diese beiden um Lebensraum streiten, sind die wilden Tiere immer die Verlierer, wenn wir Jäger nicht die Rechnung für sie bezahlen.«
Es war nicht leicht, mit ihm zu argumentieren, das mußte sie zugeben. Sie war erleichtert, als ihr Vater eingriff und ihr eine kleine Ruhepause verschaffte, in der sie sich sammeln konnte.
»Es gibt gar keinen Zweifel, auf welcher Seite meine liebe Tochter steht. Mein lieber Sean, Sie sprechen schließlich mit einem führenden Mitglied der Kommission zur Wiedereinsetzung der Inuit in ihr Recht auf ihr angestammtes Land.«
Sie lächelte lieb. »Nicht Inuit, Papa. Die Leute werden denken, du läßt nach. Nicht mal Eskimos. Du nennst sie doch normalerweise Kanaken, oder?«
Riccardo strich sich die dichten Silberwellen an den Schläfen zurück. »Soll ich Ihnen erzählen, wie meine Tochter und ihre Kommission vorgehen, um festzustellen, wieviel von Alaska den Inuit gehört?« fragte er.
»Er wird’s Ihnen auf jeden Fall erzählen.« Claudia lehnte sich vor, um die Hand ihres Vaters zu streicheln. »Es ist eine Nummer, die er auf Partys gern abzieht. Sehr komisch. Sie werden sich totlachen.«
Riccardo sprach weiter, als hätte sie nichts gesagt. »Sie gehen also die Vierte Straße in Anchorage runter, das ist die Straße mit all den Bars, und dann schnappen sie sich ein paar Eskimos, die noch stehen können. Die packen sie in ein Flugzeug und fliegen über die ganze Halbinsel, und dann sagen sie: ›Also jetzt erzählt uns mal, wo eure Leute früher gelebt haben. Wie wär’s denn zum Beispiel mit dem See da drüben, haben eure Leute da nicht vor langer Zeit gefischt?‹« Mit verstellter Stimme und überzeugender Mimik fuhr Riccardo fort. »›Klar‹, ruft da ein Eskimo, der hinten sitzt und mit whiskyunterlaufenen Augen durchs Fenster schielt, ›klar, genau da hat mein Opa gefischte«
Jetzt machte er Claudia nach: »›Und wie ist es mit diesem Berg da drüben, den wir gottlosen Weißen euch geraubt haben und jetzt Brooks Range nennen, hat dein Opa da nicht vor langer Zeit gejagt?‹« Dann imitierte er wieder die Eskimo-Stimme. »›Aber klar, Mann! Riesenhaufen Bären hat er da geschossen. Weiß noch, wie meine Oma mir davon erzählt hat.‹«
»Mach weiter, Papa. Heute abend hast du ein dankbares Publikum, Mr. Courtney ist von deinem Humor entzückt«, sagte Claudia aufmunternd.
»Und wissen Sie was?« fragte Riccardo. »Claudia hat noch nie einen Eskimo gefunden, der den angebotenen See oder Berg ausgeschlagen hat. Das ist doch auch etwas, oder? Mein kleines Mädchen hat eine einwandfreie Trefferliste. Keine einzige Ablehnung.«
»Sie sind ein Glückskind, Capo«, meinte Sean. »Zumindest lassen sie Ihnen vielleicht noch etwas übrig. Hier nehmen sie immer alles.«
Kapitel 2
Claudia erwachte durch das Geschirrklappern vor dem Zelt und das höfliche Hüsteln Moses. Niemand hatte ihr jemals Tee ans Bett gebracht. Es war ein Luxus, bei dem sie sich herrlich dekadent vorkam. Noch war es ganz dunkel und eiskalt im Zelt. Als Moses die Klappe aufmachte, hörte sie den Rauhreif auf der Zeltleinwand leise knistern. Sie hätte nie gedacht, daß es in Afrika so kalt sein könnte.
Sie setzte sich in ihrem Feldbett auf, die Steppdecke über den Schultern, hielt den Teebecher mit beiden Händen und sah zu, wie Moses sich im Zelt zu schaffen machte. Er goß einen Eimer heißen Wassers in ihr Waschbecken und legte ein sauberes weißes Handtuch daneben. Er füllte den Zahnbecher mit abgekochtem Wasser und drückte etwas Zahnpasta auf ihre Zahnbürste. Dann stellte er eine Kohlenpfanne mit glühender Holzkohle in der Mitte des Zeltes ab. »Heute zu kalt, Donna.«
»Und früh, verdammt«, stimmte Claudia schläfrig zu.
»Sie hören Löwen brüllen in Nacht, Donna?«
»Keinen Ton gehört.« Sie gähnte. Ein Blasorchester hätte neben ihr die Nationalhymne spielen können, und sie wäre nicht aufgewacht.
Zum Schluß legte Moses die Kleidung auf das Ersatzbett. Ihre Stiefel waren vollkommen blank geputzt.
»Sie wollen was, Donna, Sie rufen«, sagte er, als er rückwärts durch die Zeltklappe ging.
Sie stieg aus dem warmen Bett und stellte sich zitternd über die Kohlepfanne, während sie ihren Slip zum Anwärmen darüber hielt.
Die Sterne leuchteten noch, als sie aus dem Zelt kam. Sie blieb einen Moment stehen, um aufzublicken, erstaunt über die unermeßlich weit ausgebreiteten Juwelen am südlichen Himmel. Sie fand, sich selber lobend, das Kreuz des Südens und ging dann zum Lagerfeuer, wo die Männer saßen, und hielt die Hände dankbar über die Flammen.
»Du bist noch genauso wie früher, als du klein warst.« Ihr Vater lächelte sie an. »Weißt du noch, was das jeden Morgen für ein Theater war, bis ich dich aus dem Bett hatte, damit du pünktlich zur Schule kamst?« Ein Boy brachte ihr eine zweite Tasse Tee.
Sean pfiff. Sie hörte, wie Job den Jagdwagen anließ und um die Umzäunung herum zum Vordertor fuhr. Sie zogen jetzt ihre warmen Sachen an, Jerseywesten, Anoraks, Mützen und Wollschals. Dann marschierten sie zum Jagdwagen. Die Gewehre waren schon in den Gestellen, und im Hintergrund standen Job und Shadrach, die beiden Matabele; sie hatten den kleinen Ndorobo-Fährtensucher in die Mitte genommen. Der Fährtensucher ging Claudia nur bis zur Achselhöhle; das grinsende Runzelgesicht und seine strahlenden schalkhaften Augen machten ihn sofort sympathisch. Claudia hatte sich von vornherein vorgenommen, das ganze schwarze Lagerpersonal gern zu haben, aber Matatu war gleich ihr Liebling. Die drei Schwarzen hatten sich zum Schutz gegen die Kälte dicke Überzieher aus Army-Beständen angezogen und trugen Wollmützen, die auch die Ohren bedeckten. Ein dreifaches weißes Grinsen in der Dunkelheit war die Antwort auf Claudias Morgengruß. Alle hatte sie in ihren Bann geschlagen.
Sean setzte sich ans Steuer, und Claudia saß auf dem Vordersitz zwischen ihm und ihrem Vater. Sie kauerte hinter der Windschutzscheibe und kuschelte sich wärmesuchend an ihren Vater. In der kurzen Zeit hatte sie schon gelernt, am Abenteuer eines neuen Tages Gefallen zu finden.
Langsam fuhren sie über den gewundenen holprigen Weg, und als die Nacht allmählich der Dämmerung wich, schaltete Sean die Scheinwerfer aus.
Claudia schaute in den Wald und über die grasbestandenen Schneisen, welche die sumpfigen Niederungen, die »Vleis«, wie Sean sie nannte, durchzogen, um möglichst als erste ein scheues und schönes Wild zu erspähen, aber Sean oder ihr Vater murmelten schon vor ihr »Kudu links« oder »Da drüben ein Riedbock«, oder Matatu lehnte sich von hinten vor und berührte ihre Schulter, um ihr mit seiner kleinen ausgestreckten Hand mit den rosaroten Handflächen etwas Seltenes zu zeigen.
Der staubige Pfad war gezeichnet von den Spuren der Tiere, die in der Nacht hinübergewechselt waren. Einmal stießen sie auf frischen Elefantendung, der in der Morgenkühle noch dampfte, und alle stiegen aus, um den kniehohen Haufen ausgiebig zu prüfen. Anfangs hatte Claudia dieses eifrige Interesse an Dung außer Fassung gebracht, aber nun hatte sie sich daran gewöhnt.
»Alter Kerl«, sagte Sean, »trägt die letzten Zähne.«
»Woran sehen Sie das?« fragte sie.