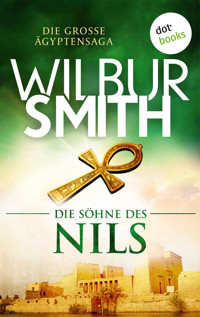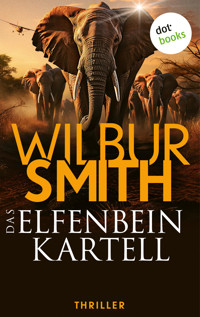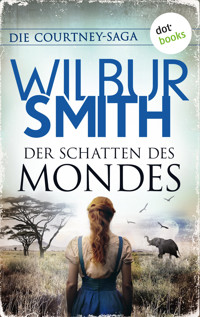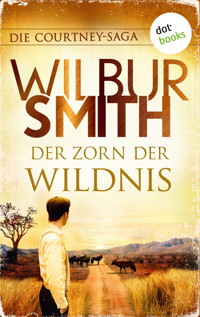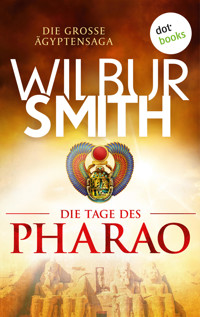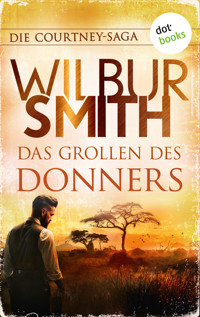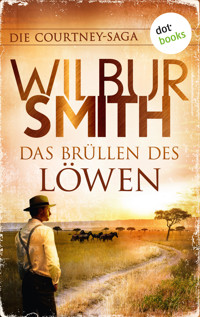9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Action, Romantik und Abenteuer aus der Feder des Bestsellerautors: »Keiner kann Abenteuer so gut wie Wilbur Smith«, urteilt der Daily Mirror. Ein uraltes Rätsel– ein tödlicher Wettlauf mit der Zeit … Ägypten, 1500 vor Christus. Nach dem Tod seiner Herrin Lostris entscheidet sich Taita, hoher Gelehrter und rechte Hand des Pharaos, ihr Vermächtnis für die Nachwelt zu bewahren: Über 70 Tage und Nächte schreibt er die Geschichte ihres Lebens und eines vom Krieg zerrissenen Königreichs auf. Doch sein letztes Geschenk an seine Herrin verbirgt ein großes Geheimnis … Ende des 20. Jahrhunderts: Seit Jahren forschen die Ägyptologin Royan Al Simmu und ihr Mann fieberhaft nach dem Grab der Königin Lostris. Doch als sie es endlich finden, ist die Kammer leer – bis auf zehn unscheinbare Schriftrollen. Erst beim Entziffern wird den beiden Forschern klar, dass sie den Schlüssel zum verschollenen Grabmal des großen Pharao Mamose in der Hand halten. Ein Fund, der ihnen bald zum Verhängnis werden soll, denn die Gier der Menschen nach den Schätzen der alten Könige ist unersättlich … Der zweite Band der großen Ägyptensaga von Bestseller-Autor Wilbur Smith verbindet geschickt die farbenprächtige Welt der Pharaonen mit dem Nervenkitzel einer dramatischen Abenteuerjagd. Der Roman kann unabhängig gelesen werden. • »Indiana Jones« trifft auf »Exodus: Götter und Könige« • Fesselnder Abenteuerroman für die Fans von Clive Cussler und Christian Jacq • Weltauflage des Autors: über 140 Millionen Exemplare
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1077
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über dieses Buch:
Ägypten, 1500 vor Christus. Nach dem Tod seiner Herrin Lostris entscheidet sich Taita, hoher Gelehrter und rechte Hand des Pharaos, ihr Vermächtnis für die Nachwelt zu bewahren: Über 70 Tage und Nächte schreibt er die Geschichte ihres Lebens und eines vom Krieg zerrissenen Königreichs auf. Doch sein letztes Geschenk an seine Herrin verbirgt ein großes Geheimnis …
Ende des 20. Jahrhunderts: Seit Jahren forschen die Ägyptologin Royan Al Simmu und ihr Mann fieberhaft nach dem Grab der Königin Lostris. Doch als sie es endlich finden, ist die Kammer leer – bis auf zehn unscheinbare Schriftrollen. Erst beim Entziffern wird den beiden Forschern klar, dass sie den Schlüssel zum verschollenen Grabmal des großen Pharao Mamose in der Hand halten. Ein Fund, der ihnen bald zum Verhängnis werden soll, denn die Gier der Menschen nach den Schätzen der alten Könige ist unersättlich …
Über den Autor:
Wilbur Smith (1933–2021) wurde in Zentralafrika geboren und gehört zu den erfolgreichsten Schriftstellern der Gegenwart. Der Debütroman seiner Jahrhunderte umspannenden Südafrika-Saga um die Familie Courtney, begründete seinen Welterfolg als Schriftsteller. Seitdem hat er über 50 Romane geschrieben, die allesamt Bestseller wurden, und in denen er seine Erfahrungen aus verschiedenen Expeditionen in die ganze Welt verarbeitete. Seine Bücher wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt und mehrfach verfilmt. Wilbur Smith starb 2021 in Kapstadt im Kreise seiner Familie.
Die Website des Autors: www.wilbursmithbooks.com/
Der Autor bei Facebook: www.facebook.com/WilburSmith/
Der Autor auf Instagram: www.instagram.com/thewilbursmith/
Die große Südafrika-Saga des Autors um die Familie Courtney erscheint bei dotbooks im eBook. Der Reihenauftakt »Das Brüllen des Löwen« ist auch als Hörbuch bei SAGA Egmont erhältlich.
Die große Ägypten-Saga über den Eunuchen Taita ist bei dotbooks als eBook erhältlich. Der Reihenauftakt »Die Tage des Pharao« ist auch als Hörbuch bei SAGA Egmont erhältlich.
Außerdem bei dotbooks erschienen der Abenteuerroman »Der Sonnenvogel« sowie die Action-Thriller »Greed – Der Ruf des Goldes«, »Blood Diamond – Tödliche Jagd«, »Black Sun – Die Kongo-Operation«, »Das Elfenbein-Kartell« und »Atlas – Die Stunde der Entscheidung«. Weitere Bände in Vorbereitung.
***
eBook-Ausgabe November 2024
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1995 unter dem Originaltitel »The Seventh Scroll« bei Macmillan Ltd., London.
First published in 1995 by Macmillan Publishers Ltd
Copyright © Wilbur Smith 1995
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1997 by Blanvalet Verlag in der Verlagsgruppe Bertelsmann GmbH, München
Copyright © der eBook-Ausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/Prachaya Roekdeethaweesab und AdobeStock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (fb)
ISBN 978-3-98952-474-3
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. In diesem eBook begegnen Sie daher möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Diese Fiktion spiegelt nicht automatisch die Überzeugungen des Verlags wider oder die heutige Überzeugung der Autorinnen und Autoren, da sich diese seit der Erstveröffentlichung verändert haben können. Es ist außerdem möglich, dass dieses eBook Themenschilderungen enthält, die als belastend oder triggernd empfunden werden können. Bei genaueren Fragen zum Inhalt wenden Sie sich bitte an [email protected].
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Wilbur Smith
Die Schwingen des Horus
Die große Ägyptensaga
Aus dem Englischen von Hans-Jürgen Baron Koskull
dotbooks.
Widmung
Auch dieses Buch widme ich meiner Frau Danielle.
Nach all den von gegenseitiger Liebe
erfüllten Jahren hoffe ich, daß uns noch eine lange Zeit
gemeinsamen Wirkens beschieden sein wird.
Kapitel 1
Die purpurfarbenen Schatten der Abenddämmerung, die aus der Wüste heranzog, legten sich über die Dünen. Mit ihnen erstarben alle Geräusche, und der Abend versank in Schweigen.
Sie standen auf dem Kamm der Düne und schauten hinunter auf die Oase und die sie umgebenden kleinen Dörfer. Die weißgetünchten Gebäude hatten flache Dächer und wurden nur von den Dattelpalmen überragt. Allein die Moschee und die koptische christliche Kirche überragten sie. Diese Bastionen des Glaubens standen einander an beiden Seeufern gegenüber.
Über der dunklen Oberfläche des Sees näherte sich eine Schar Enten, die bei der Landung vor dem Schilfgürtel das Wasser weiß aufspritzen ließen.
Der Mann und die Frau waren ein ungleiches Paar. Er war hochgewachsen, aber schon ein wenig gebeugt. Sein silberfarbenes Haar leuchtete in den letzten Sonnenstrahlen. Sie war jung, Anfang Dreißig, wachsam und lebendig. Sie hatte dichtes, krauses Haar, das im Nacken von einem Lederriemen zusammengehalten wurde.
»Es wird Zeit, hinunterzugehen. Alia wird schon auf uns warten.« Er blickte sie mit freundlichem Lächeln an. Sie war seine zweite Frau. Beim Tode der ersten hatte er gedacht, mit ihr sei auch die Sonne für immer hinter dem Horizont versunken. Er hatte nicht geglaubt, noch einmal ein solches Glück erleben zu dürfen. Jetzt waren diese junge Frau und seine Arbeit der Inhalt seines Lebens. Er war glücklich und zufrieden.
Plötzlich sprang sie davon, löste den Riemen, der das Haar zusammengehalten hatte, ließ sich die dichte, dunkle Mähne um den Kopf wehen und lachte. Es war ein fröhliches Lachen. Dann lief sie den steilen Hang der Düne hinunter, und ihr langer Rock flatterte um die wohlgeformten braunen Schenkel. Auf der Mitte des Hangs stolperte sie und rutschte aus.
Er war stehengeblieben und lächelte wohlwollend. Manchmal war sie noch ein richtiges Kind. Aber sie konnte auch ernst und würdevoll wirken. Er war sich nicht sicher, wie sie ihm besser gefiel, aber seine Liebe zu ihr war immer die gleiche. Am unteren Rand der Düne angekommen, setzte sie sich auf, lachte und schüttelte sich den Sand aus dem Haar.
»Jetzt bist du an der Reihe!« rief sie zu ihm hinauf. Mit vorsichtigen Schritten und seinem Alter entsprechend etwas steif, folgte er ihr und wahrte das Gleichgewicht, bis er unten angekommen war. Er half ihr beim Aufstehen, küßte sie aber nicht, obwohl er es gern getan hätte. Für einen Araber schickt es sich nicht, seine Zuneigung offen zu zeigen, nicht einmal seiner geliebten Frau.
Bevor sie sich auf den Weg zum Dorf machten, zog sie sich Rock und Bluse zurecht und band den Haarschopf wieder im Nacken zusammen. Der Weg führte sie vorbei an den dichten Schilfbeständen und auf wackeligen Brücken über die Bewässerungskanäle. Die Bauern, die ihnen auf dem Heimweg von den Feldern begegneten, grüßten sie ehrerbietig.
»Salaamaleikum, Doktari! Friede sei mit dir, Doktor.« Sie begegneten allen Gebildeten mit großem Respekt, besonders aber diesem Mann, der sie und ihre Familien im Verlauf vieler Jahre stets besonders freundlich behandelt hatte. Viele von ihnen hatten schon für seinen Vater gearbeitet. Dabei hatte es keine besondere Bedeutung, daß sie Muslime waren und er sich zum christlichen Glauben bekannte.
In ihrer Villa begrüßte sie die alte Haushälterin Alia mit vorwurfsvoller Miene und murmelte: »Sie kommen zu spät. Ständig verspäten Sie sich. Warum können Sie nicht pünktlich sein wie jeder anständige Mensch? Schließlich sind wir doch jemand.«
»Mein altes Mütterchen, du hast immer recht«, neckte er sie. »Was würden wir tun, wenn du nicht für uns sorgtest?« Damit schickte er sie fort, und während sie zur Tür ging, sah sie sich noch einmal mit enttäuschtem Gesicht nach ihm um und versuchte, dahinter die Liebe und Fürsorge zu verbergen, die sie für ihn empfand.
Auf der Terrasse nahmen die beiden das einfache Abendessen ein, Datteln und Oliven, ungesäuertes Brot und Ziegenkäse. Inzwischen war es dunkel geworden, nur die Sterne über der nächtlichen Wüste leuchteten wie Kerzen.
»Royan, Blüte meines Lebens.« Er beugte sich über den Tisch und berührte zart ihre Hand. »Es wird Zeit, die Arbeit ruft.« Er stand auf und ging durch die offene Terrassentür ins Arbeitszimmer.
Royan Al Simma folgte ihm, ging zum großen stählernen Tresor an der Rückwand des Zimmers und stellte die richtige Zahlenkombination ein. Der Tresor paßte eigentlich nicht in diesen Raum mit den alten Büchern und Schriftrollen, den Statuen, Artefakten und Grabbeigaben, die er in einem langen Leben zusammengetragen hatte.
Als sich die schwere Stahltür öffnete, blieb Royan einen Augenblick stehen und schaute hinein. Jedesmal, wenn sie dieses ehrwürdige Zeugnis aus längst vergangener Zeit vor sich liegen sah, verspürte sie, auch wenn seit dem letzten Mal nur wenige Stunden vergangen waren, diesen eigenartigen Schauer der Ehrfurcht.
»Die siebente Schriftrolle«, flüsterte sie und wagte kaum, sie zu berühren. Sie war fast viertausend Jahre alt. Ihr Verfasser war ein Genie gewesen, wie es die Menschheitsgeschichte nur selten hervorbringt, ein Mann, dessen Körper in diesen Jahrtausenden zu Staub zerfallen war, den sie jedoch inzwischen so gut kannte und achtete wie ihren eigenen Ehemann. Seine Worte waren Ausdruck ewiger Wahrheit, und sie sprachen zu ihr aus einem paradiesischen Bereich jenseits des Grabes über die Gegenwart der großen Trinität Osiris, Isis und Horus, an die er mit der gleichen tiefen Frömmigkeit geglaubt hatte, mit der auch sie an eine andere göttliche Dreifaltigkeit aus einer späteren Periode glaubte. Sie trug die Schriftrolle zu dem langen Tisch, an dem ihr Mann Duraid bereits arbeitete. Er blickte auf, als sie die Rolle vor ihn auf den Tisch legte, und einen Augenblick lang sah sie in seinen Augen die gleiche geheimnisvolle Ergriffenheit, die sie selbst spürte. Er wollte die Schriftrolle stets vor sich liegen sehen, obwohl es eigentlich nicht notwendig gewesen wäre, er könnte ebensogut mit den Fotos und dem Mikrofilm arbeiten. Es war so, als brauche er die unsichtbare Gegenwart des Verfassers, wenn er sich mit den Texten beschäftigte.
Doch schon nach wenigen Augenblicken war er wieder der leidenschaftslose Wissenschaftler und sagte: »Deine Augen sind besser als meine, mein Schatz. Was hältst du von diesem Schriftzeichen?«
Sie lehnte sich über seine Schulter und betrachtete die Hieroglyphe auf dem Foto der Schriftrolle, die er ihr zeigte. Sie überlegte kurz, nahm Duraid das Vergrößerungsglas aus der Hand und sah sie sich noch einmal genauer an.
»Es sieht so aus, als habe Taita ein eigenes Kryptogramm erfunden, um uns auf die Folter zu spannen.« Sie sprach von dem alten Verfasser so, als sei er ein lieber und auch heute noch lebender Freund, der manchmal versuchte, sie ein wenig zu verwirren und hinters Licht zu führen.
»Nun, wir werden trotzdem versuchen festzustellen, was er damit gemeint hat«, erklärte Duraid mit sichtlichem Vergnügen. Der Umgang mit den alten Texten war sein Lebensinhalt.
Die beiden arbeiteten weiter in der Kühle des Abends. Das war die Zeit, in der sie am besten vorankamen. Manchmal sprachen sie arabisch und manchmal englisch. Sie beherrschten beide Sprachen, als wäre es eine. Ihre dritte gemeinsame Sprache, das Französische, verwendeten sie weniger oft. Beide hatten sie Universitäten in England und den Vereinigten Staaten besucht, weit entfernt von diesem ihnen vertrauten, wahren Ägypten. Royan liebte den Ausdruck »dieses wahre Ägypten«, den auch Taita so oft in seinen Schriftrollen verwendete.
Sie fühlte sich in mancherlei Beziehung besonders eng mit diesem alten Ägypten verbunden. Schließlich stammte sie in direkter Linie von den alten Ägyptern ab. Sie gehörte der koptischen christlichen Kirche an, und ihre Vorfahren waren keine Araber, denn diese hatten Ägypten erst vor eintausendvierhundert Jahren erobert. In ihrem wahren Ägypten waren die Araber Fremde, während sie selbst ihre Herkunft bis in die Zeit der Pharaonen und der großen Pyramiden zurückverfolgen konnte.
Um zehn Uhr brühte Royan den Kaffee auf dem Holzkohlenofen auf, den Alia angeheizt hatte, bevor sie für die Nacht zu ihrer Familie im Dorf zurückgegangen war. Sie tranken den süßen, starken Kaffee aus kleinen Mokkatassen, die zur Hälfte mit dem dunklen Kaffesud gefüllt waren. Dabei unterhielten sie sich wie alte Freunde.
Es waren auch die freundschaftlichen Beziehungen, durch die sich Royan mit Duraid verbunden fühlte. Sie kannte ihn aus der Zeit, in der sie nach ihrer Promotion in Archäologie aus England zurückgekommen war und eine Anstellung bei der Staatlichen Behörde für Altertümer fand, deren Direktor er war.
Sie war seine Assistentin gewesen, als er im Tal der Könige das Grabmal der Königin Lostris aus der Zeit um 1780 v. Chr. geöffnet hatte.
Sie waren beide enttäuscht gewesen, als sie feststellen mußten, daß Grabräuber schon vor langer Zeit das Grabgewölbe ausgeplündert hatten und nichts übriggeblieben war als die wunderbaren Wand- und Deckengemälde im Inneren der Grabkammer.
Es war Royan selbst gewesen, die an der Wand hinter dem Sockel, auf dem der Sarkophag gestanden hatte, arbeitete und die Wandgemälde fotografierte, als ein Teil des Verputzes sich löste und in der Nische dahinter zehn Alabastervasen sichtbar wurden. Jede dieser Vasen enthielt eine Papyrusrolle mit schriftlichen Aufzeichnungen des Sklaven der Königin, Taita, der die Vasen offensichtlich dort hingestellt hatte.
Seither betrachteten Duraid und sie die Entzifferung dieser Schriftrollen als ihre Lebensaufgabe. Obwohl die Schriftrollen geringfügige Schäden aufwiesen, befanden sie sich nach viertausend Jahren immer noch in einem erstaunlich guten Zustand.
Der faszinierende Bericht, den sie enthielten, erzählte von einer Nation, die von einem überlegenen Gegner angegriffen wurde, der über Pferde und Streitwagen verfügte, wie sie den Ägyptern jener Zeit noch unbekannt waren. Vor dem Ansturm der Hyksos-Horden hatte das am Nil beheimatete Volk fliehen müssen. Unter der Führung ihrer Königin Lostris, die später in diesem Grabgewölbe beigesetzt worden war, folgten die Ägypter dem großen Fluß nach Süden fast bis zu einer Quelle im rauhen Hochland Äthiopiens. Hier hatte Lostris den mumifizierten Leichnam ihres Gatten, des Pharao Mamose, beisetzen lassen, der im Kampf gegen die Hyksos gefallen war.
Sehr viel später hatte die Königin Lostris ihr Volk wieder in nördlicher Richtung in das wahre Ägypten zurückgeführt. Jetzt hatte auch sie ihre in der afrikanischen Wildnis abgehärteten Krieger mit Pferden und Streitwagen ausgerüstet und stürmte mit ihnen über die Katarakte des großen Flusses hinunter, um sich noch einmal den Hyksos-Eindringlingen zu stellen, schließlich über sie zu triumphieren und ihnen die doppelte Krone von Ober- und Unterägypten zu entreißen.
Diese Geschichte beeindruckte Royan zutiefst, während sie und Duraid sich darum bemühten, die Hieroglyphen zu entziffern, mit denen der alte Sklave die Papyrusrollen bedeckt hatte.
In den vergangenen Jahren hatten sie allabendlich in ihrer Villa in der Oase daran gearbeitet, wenn sie von ihrem normalen Arbeitsplatz im Museum von Kairo nach Hause zurückgekehrt waren. Schließlich war es ihnen gelungen, die zehn Schriftrollen zu entziffern – bis auf die siebente. Der Inhalt der siebenten Schriftrolle blieb ihnen lange Zeit ein Rätsel, denn der Verfasser hatte sich einer esoterischen Kurzschrift bedient, die zu entschlüsseln nach so langer Zeit fast unmöglich erschien. Einige der von ihm verwendeten Symbole waren ihnen in den Tausenden von Texten, an denen sie gemeinsam gearbeitet hatten, bisher noch nie begegnet. Nach ihrer Überzeugung hatte Taita vermeiden wollen, daß, außer ihm und seiner geliebten Königin, irgend jemand die Schriftrollen zu Gesicht bekam. Sie waren sein letztes Geschenk, das er ihr ins Grab mitgegeben hatte.
Es hatte sie ihr ganzes Können, all ihre Phantasie und Vorstellungskraft gekostet, aber schließlich näherten sie sich der Vollendung ihrer Aufgabe. Immer noch gab es Lücken in der Übersetzung, und an manchen Stellen konnten sie nicht genau sagen, ob sie die wirkliche Bedeutung der Worte erfaßt hatten, aber doch lag nun das Gerippe des Manuskripts so geordnet vor ihnen, daß sie die Kontur des Wesens, das es darstellte, erkennen konnten.
Duraid trank einen kleinen Schluck Kaffee, schüttelte den Kopf, wie er es schon so oft getan hatte, und sagte: »Ich fürchte die Verantwortung. Was sollen wir mit dem Wissen anfangen, das wir hier zusammengetragen haben? Wenn es in die falschen Hände gerät ...« Er trank noch einen Schluck und seufzte, bevor er weitersprach. »Selbst wenn wir mit den richtigen Leuten darüber sprechen, werden sie an dieses fast viertausend Jahre alte Material glauben?«
»Warum müssen wir es anderen mitteilen?« fragte Royan etwas gereizt. »Warum können wir nicht nur das tun, was getan werden muß?« Bei solchen Gelegenheiten zeigten sich die Unterschiede zwischen den beiden sehr deutlich: bei Duraid die Zurückhaltung des Alters und bei Royan die Ungeduld der Jugend.
»Du verstehst das nicht«, sagte er. Es ärgerte sie jedesmal, wenn er das sagte und sie so behandelte, wie die Araber in ihrer Männerwelt die Frauen behandeln. Sie hatte auch jene andere Welt kennengelernt, wo die Frauen sich mit ihrer Forderung nach Gleichberechtigung durchsetzten. Sie führte ein Leben zwischen diesen beiden Welten, der westlichen und der arabischen.
Royans Mutter war Engländerin und arbeitete in den unruhigen Zeiten nach dem Zweiten Weltkrieg an der Britischen Botschaft in Kairo. Dort lernte sie Royans Vater, einen jungen ägyptischen Offizier im Stab von Oberst Nasser, kennen und heiratete ihn. Diese etwas ungewöhnliche Ehe scheiterte, als Royan noch ein Kind war.
Ihre Mutter hatte verlangt, zu Royans Geburt nach England in ihre Heimatstadt York zurückzukehren. Das Kind sollte die britische Staatsangehörigkeit haben. Nach der Scheidung ihrer Eltern wurde Royan, wieder auf Verlangen ihrer Mutter, nach England geschickt, um dort zur Schule zu gehen, aber ihre Ferien verbrachte sie in Kairo bei ihrem Vater. Ihr Vater war beruflich außerordentlich erfolgreich und gehörte schließlich als Minister der Regierung Mubarak an. Die engen Beziehungen zu ihrem Vater hatten zur Folge, daß Royan sich eher für eine Ägypterin als für eine Engländerin hielt.
Ihr Vater arrangierte auch die Ehe mit Duraid Al Simma. Das geschah kurz vor seinem Tod. Sie wußte, daß er bald sterben würde, und brachte es nicht übers Herz, sich ihm zu widersetzen. Sie war in unserer modernen Welt aufgewachsen und lehnte deshalb instinktiv die alte koptische Tradition der arrangierten Heirat ab, aber ihre Herkunft, ihre Familie und ihre Kirche hatten sie dazu gezwungen, und sie hatte sich dem Unvermeidlichen gefügt.
Es zeigte sich, daß die Ehe mit Duraid nicht so unerträglich war, wie sie gefürchtet hatte. Sie wäre vielleicht sogar durchaus harmonisch und befriedigend gewesen, wenn sie nicht schon erlebt hätte, was eine romantische Liebesbeziehung bedeuten kann. Doch sie erinnerte sich noch sehr gut an ihre Studienzeit und die Verbindung mit David. Damals hatte er sie in seiner ungestümen Art in einen rauschhaften Zustand versetzt, dem ein fast unerträglicher Liebeskummer folgte, als er sie verließ, um eine blonde englische Schönheit zu heiraten, die seine Eltern für die richtige Schwiegertochter hielten.
Sie achtete und mochte Duraid, aber manchmal hatte sie nachts die glühende Sehnsucht danach, einen männlichen Körper in den Armen zu halten, der ebenso kräftig und jung war wie ihr eigener.
Duraid redete immer noch, aber sie hatte nicht darauf geachtet, was er sagte. Nun hörte sie ihm wieder zu. »Ich habe noch einmal mit dem Minister gesprochen, aber ich nehme nicht an, daß er mir glaubt. Vielleicht hatte Nahoot ihn davon überzeugt, daß ich ein wenig verrückt bin.« Er lächelte betrübt. Nahoot Guddabi war sein ehrgeiziger Stellvertreter, der gute Beziehungen zu einflußreichen Leuten unterhielt. »Jedenfalls sagt der Minister, der Regierung stünden dafür keine Geldmittel zur Verfügung, und ich müßte versuchen, die Sache anders zu finanzieren. Deshalb habe ich mich nach möglichen Sponsoren umgesehen, und das sind wahrscheinlich nur vier. Der eine ist natürlich das Getty Museum, aber wie du weißt, arbeite ich nicht gerne für eine große unpersönliche Institution. Die Zusammenarbeit mit einer Einzelperson ist mir lieber, denn dabei kommt man leichter zu einer Entscheidung.« Das war ihr alles nicht neu, aber trotzdem hörte sie pflichtschuldigst zu.
»Ich habe auch an Herrn von Schiller gedacht. Er hat das notwendige Geld und interessiert sich für dieses Thema, ich kenne ihn aber nicht gut genug, um ihm restlos zu vertrauen.« Er machte eine Pause, und Royan kannte seine Überlegungen so gut, daß sie schon im voraus wußte, was er sagen würde.
»Wie wäre es mit dem Amerikaner? Er ist ein berühmter Sammler«, warf sie ein.
»Die Zusammenarbeit mit Peter Walsh wird schwierig sein. In seiner Sammelleidenschaft ist er mir zu skrupellos. Deshalb habe ich gewisse Bedenken.«
»Und wer bleibt dann übrig?« fragte sie.
Er antwortete nicht, denn sie kannten beide die Antwort auf diese Frage. Er konzentrierte sich wieder auf das Material auf seinem Arbeitstisch.
»Es sieht so unschuldig, so alltäglich aus. Eine alte Papyrus-Schriftrolle, einige Fotos und Notizbücher, ein Computerausdruck. Man kann sich nur schwer vorstellen, wie gefährlich das alles sein könnte, wenn es in die falschen Hände geriete.« Er seufzte. »Man könnte fast sagen, hier besteht eine tödliche Gefahr.«
Dann lachte er. »Offenbar geht die Phantasie mit mir durch. Vielleicht ist es die späte Stunde. Sollen wir weiterarbeiten? Um alles andere können wir uns kümmern, sobald wir die Rätsel gelöst haben, die dieser alte Schelm Taita uns aufgibt, und die Übersetzung fertig ist.«
Er nahm das oberste der vor ihm liegenden Fotos in die Hand. Es war eine Aufnahme vom mittleren Teil der Schriftrolle. »Zu schade, daß der Papyrus gerade an dieser Stelle beschädigt ist.« Er setzte seine Lesebrille auf und las die Übersetzung laut vor: »ManmußvieleStufenaufderTreppehinaufsteigen, diezurWohnungdesHapiführt. MitgroßerMüheerreichtenwirdiezweiteStufeundkamennichtweitervoran, denneswarhier, woderPrinzdiegöttlicheOffenbarungerfuhr. IneinemTraumerschienihmseinVater, derverstorbenegöttlichePharao, undverkündeteihm, ›ichhabeeineweiteReisehintermirundbinerschöpft. HierwerdeichruhenfüralleEwigkeit‹.« Duraid nahm die Brille ab und sah Royan an. »›DiezweiteStufe.‹ Das ist zunächst einmal eine sehr präzise Beschreibung. Hier versucht Taita nicht, uns wie schon so oft hinters Licht zu führen.«
»Laß uns noch einmal die Satellitenfotos anschauen«, sagte Royan und legte das auf Glanzpapier abgezogene Foto vor sich auf den Tisch. Duraid kam zu ihr und stellte sich hinter sie.
»Es erscheint mir logisch, daß das natürliche Hindernis, auf das sie in der Schlucht gestoßen waren, eine Stromschnelle oder ein Wasserfall gewesen ist. Wenn es der zweite Wasserfall war, dann müßte es hier gewesen sein –« Royan legte den Finger auf eine Stelle auf dem Satellitenfoto, wo sich der Fluß in engen Kurven durch das dunkle Bergmassiv wand.
In diesem Augenblick wurde sie abgelenkt und hob den Kopf. »Hörst du das?« Ihre Stimme klang besorgt.
Auch Duraid blickte auf. »Was ist das?«
»Der Hund«, antwortete sie.
»Dieser verdammte Köter«, schimpfte er. »Er stört uns jede Nacht mit seinem gräßlichen Gebell. Ich habe mir schon vorgenommen, ihn loszuwerden.«
In diesem Augenblick ging das elektrische Licht aus.
Die plötzlich eingetretene Dunkelheit beunruhigte sie. Das dumpfe Motorengeräusch des alten Dieselgenerators im Schuppen hinter dem Palmenhain war verstummt. Sie hatten sich so sehr daran gewöhnt, daß es ihnen erst bewußt wurde, als es aufhörte.
Allmählich paßten sich ihre Augen dem schwachen Sternenlicht an, das durch die Terrassentür drang. Duraid ging durch das Zimmer und nahm die Öllampe von dem Regal neben der Tür, wo sie für solche Fälle bereitstand. Er zündete sie an, blickte zu Royan hinüber und sagte mit resigniertem Lächeln: »Ich werde hinuntergehen müssen –«
»Duraid«, unterbrach sie ihn, »der Hund!«
Er lauschte einen Augenblick in die Nacht und bekam ein besorgtes Gesicht, denn der Hund hatte aufgehört zu bellen.
»Ich bin sicher, wir haben keinen Grund zur Besorgnis.« Er ging zur Tür, und unvermittelt rief sie ihm nach: »Duraid, sei vorsichtig!« Er zuckte die Schultern und trat hinaus auf die Terrasse.
Zunächst glaubte sie, es sei der Schatten einer Ranke am Spalier, die sich in einem nächtlichen Luftzug bewegte, aber es war eine windstille Nacht. Dann erkannte sie die menschliche Silhouette, die Duraid geräuschlos und schnell über die Fliesen folgte, als er am Rand des Fischteichs über die gepflasterte Terrasse weiterging.
»Duraid!« schrie sie laut, er drehte sich um und hielt die Lampe in die Höhe.
»Wer sind Sie?« rief er. »Was wollen Sie hier?«
Der Eindringling hatte ihn lautlos eingeholt. Das traditionelle lange Gewand, die dishdasha, wirbelte um seine Beine, und die weiße ghutrah bedeckte seinen Kopf. Im Licht der Taschenlampe sah Duraid, daß er das Kopftuch über das Gesicht heruntergezogen hatte, um es vor ihm zu verbergen.
Der Eindringling hatte ihr den Rücken zugekehrt, so daß Royan das Messer in seiner rechten Hand nicht sehen konnte, sie sah aber sehr deutlich, wie er Duraid mit einer scharfen Aufwärtsbewegung in den Magen stieß. Duraid stöhnte vor Schmerzen, krümmte sich, der Angreifer zog die Klinge heraus und stieß ein zweites Mal zu, aber diesmal ließ Duraid die Taschenlampe fallen und ergriff den Arm des Mannes.
Die Flamme der zu Boden gefallenen Öllampe flackerte. Die beiden Männer rangen miteinander, und Royan sah, wie sich ein dunkler Fleck auf dem weißen Hemd ihres Mannes ausbreitete.
»Lauf schnell!« rief er ihr zu. »Hol Hilfe! Ich kann ihn nicht länger festhalten!« Sie wußte, daß Duraid – ein freundlicher, sanfter Gelehrter – seinem Angreifer körperlich unterlegen war.
»Bitte geh! Bring dich in Sicherheit, mein Schatz!« Seine Stimme wurde schwächer, aber er bemühte sich immer noch verzweifelt, den Arm des Mannes festzuhalten.
In den ersten, wichtigen Sekunden war sie von dem Schock wie gelähmt und konnte sich nicht entscheiden, aber jetzt entschloß sie sich und lief zur Tür. Sie hatte den ersten Schreck überwunden und dachte nur noch daran, daß sie Duraid helfen mußte. So lief sie geschickt wie eine Katze über die Terrasse, während er den Eindringling daran hinderte, sich ihr in den Weg zu stellen.
Über die niedrige Steinmauer sprang sie in das Gebüsch und geriet dabei fast in die Arme des zweiten Mannes. Sie schrie auf und wich ihm aus, während seine ausgestreckten Finger ihr über das Gesicht fuhren. Fast wäre es ihr gelungen, ihm zu entkommen, aber er hielt sie an ihrer dünnen Baumwollbluse fest.
Nun sah sie auch das Messer in seiner Hand. Im schwachen Licht der Sterne blitzte es silbrig auf, und sie versuchte sich loszureißen. Die Bluse zerriß, und sie war frei, aber nicht schnell genug, um der Klinge zu entgehen. Sie spürte den Stich im Oberarm und stieß in ihrer Angst und mit der ganzen Kraft ihres starken jungen Körpers mit dem Fuß nach ihm und traf ihn im Unterleib. Er schrie auf und fiel auf die Knie.
Endlich war sie frei und rannte durch den Palmenhain. Zunächst wußte sie nicht, in welche Richtung sie laufen sollte. Es kam nur darauf an, so schnell und so weit zu laufen, wie ihre Füße sie tragen konnten. Doch allmählich gelang es ihr, ihre Angst zu überwinden. Sie blieb stehen und blickte zurück. Niemand schien ihr zu folgen. Am Seeufer angekommen, verlangsamte sie ihre Schritte, um Kräfte zu sparen, und sie bemerkte, daß Blut an ihrem Arm hinunterlief und von den Fingerspitzen zu Boden tropfte.
Sie blieb stehen und lehnte sich mit dem Rücken an den rauhen Stamm einer Palme. Dann riß sie einen Stoffstreifen von der Bluse ab und verband in aller Eile den verletzten Arm. Der Schock und die Anstrengung ließen sie so stark zittern, daß sie kaum die verletzte rechte Hand gebrauchen konnte. Nachdem sie den Notverband mit der linken Hand und ihren Zähnen verknotet hatte, hörte die Blutung allmählich auf.
Sie wußte nicht so recht, in welche Richtung sie sich wenden sollte, als sie jenseits des nächsten Entwässerungsgrabens das schwache Licht im Fenster von Alias Hütte erkannte. Sie lief in diese Richtung, aber sie war noch keine hundert Schritt gegangen, als sie hinter sich im Palmenhain eine Stimme hörte, die auf arabisch rief: »Yusuf, ist dir die Frau begegnet?«
Unmittelbar darauf leuchtete in der Dunkelheit vor ihr eine elektrische Taschenlampe auf, und eine zweite Stimme antwortete: »Nein, ich habe sie nicht gesehen.«
In den nächsten Sekunden wäre Royan diesem Mann in die Arme gelaufen. Sie duckte sich und blickte sich verzweifelt um. Hinter ihr im Palmenhain leuchtete eine zweite Taschenlampe auf und näherte sich auf dem Weg, den sie gekommen war. Es mußte der Mann sein, dem sie den Stoß versetzt hatte, doch daran, wie sich die Taschenlampe bewegte, erkannte sie, daß er sich erholt hatte und sich rasch näherte.
Die Gefahr kam jetzt von beiden Seiten, also kehrte sie um und schlich am Seeufer entlang zurück in Richtung auf die Straße. Vielleicht würde ihr dort ein Fahrzeug begegnen. Sie stolperte auf dem unebenen Boden, fiel hin, verletzte sich dabei das Knie, stand wieder auf und eilte weiter. Als sie zum zweiten Mal stolperte, stützte sie sich mit der linken Hand auf dem Boden ab und landete dabei auf einem runden, glatten Stein, der etwa so groß war wie eine Orange. Beim Weitergehen behielt sie den Stein in der Hand, um ihn notfalls als Waffe benutzen zu können.
Der verletzte Arm fing an zu schmerzen, aber ihre Sorge um Duraid trieb sie weiter. Sie wußte, daß er schwer verletzt war, denn sie hatte gesehen, in welche Richtung und mit welcher Kraft der Angreifer zugestoßen hatte. Sie mußte jemanden finden, der ihm helfen konnte. Die beiden Männer, die ihr mit den Taschenlampen folgten, kamen rasch näher und würden sie bald eingeholt haben. Sie hörte sie miteinander sprechen.
Endlich erreichte sie die Straße, und mit einem leisen Seufzer der Erleichterung kletterte sie aus dem Bewässerungsgraben auf den hellen Kiesweg. Sie konnte sich kaum noch auf den Beinen halten, ging aber mutig in Richtung auf das Dorf weiter.
Noch vor der ersten Kurve sah sie zwischen den Palmen zwei Autoscheinwerfer langsam auf sich zukommen. Auf der Mitte der Straße lief sie dem Wagen entgegen.
»Helfen Sie mir!« rief sie auf arabisch. »Bitte helfen Sie mir!«
Als der Wagen durch die Kurve fuhr und bevor die Scheinwerfer sie blenden konnten, sah sie, daß es ein kleiner, dunkelfarbiger Fiat war. Im Licht der Scheinwerfer stand sie nun da wie auf einer Theaterbühne und winkte dem Fahrer mit beiden Armen zu, in der Hoffnung, mitgenommen zu werden.
Der Fiat hielt vor ihr, sie lief um den Wagen herum zur Tür neben dem Fahrer und zog am Türgriff. »Bitte, Sie müssen mir helfen –«
Die Tür wurde von innen geöffnet und dann mit solcher Kraft wieder zugeschlagen, daß sie taumelte. Der Fahrer sprang heraus auf die Straße, packte sie am Handgelenk des verletzten Armes, zerrte sie zum Fiat und öffnete die hintere Wagentür.
»Yusuf, Bacheet«, rief er, »ich habe sie.« Sie hörte die Antwort der beiden und sah, wie sie ihre Taschenlampen auf das Fahrzeug richteten. Der Fahrer drückte Royan den Kopf nach unten und versuchte sie auf den Rücksitz zu drängen, aber sie hatte immer noch den Stein in ihrer unverletzten Hand. Sie drehte sich ein wenig zur Seite, nahm alle Kraft zusammen und schlug ihm mit dem Stein gegen die Stirn. Ohne einen Laut von sich zu geben, fiel er auf den Kiesweg und blieb bewegungslos liegen.
Royan warf den Stein fort und lief im grellen Licht der Scheinwerfer die Straße hinunter. Die beiden Männer im Palmenwald riefen dem Fahrer etwas zu und verfolgten sie, fast Schulter an Schulter.
Als sie zurückblickte stellte sie fest, daß ihre Verfolger schneller waren als sie. Ihr blieb nur noch die Möglichkeit, die Straße zu verlassen und in der Dunkelheit zu verschwinden. Sie sprang das Steilufer hinunter in das hüfttiefe Wasser des Sees.
Sie war so verwirrt, daß sie sich in der Dunkelheit nicht mehr zurechtfand. Sie hatte nicht daran gedacht, daß die Straße an dieser Stelle unmittelbar oberhalb des Steilufers verlief. Royan hatte keine Zeit mehr, den Hang hinaufzusteigen und die Straße zu erreichen, sie hoffte, daß sie sich vielleicht in dem vor ihr liegenden, dichten Schilf und Papyrus verstecken konnte.
Sie watete in den See hinein, bis der Boden unter ihren Füßen steil abfiel und sie zu schwimmen gezwungen war. Ihr Rock und der verletzte Arm behinderten sie, aber sie schwamm so ruhig, daß sich ihre Bewegungen nicht auf die Wasseroberfläche übertrugen. Und bevor die Männer auf der Straße die Stelle erreicht hatten, an der sie über das Steilufer in den See gerutscht war, verschwand sie im Schilf.
Wo es am dichtesten war, ließ sie sich tief ins Wasser sinken, und spürte den weichen Schlamm am Boden des Sees unter den Füßen. Mit vom Ufer abgewendetem Gesicht blieb sie stehen, so daß über der Wasserfläche nur ihr Hinterkopf sichtbar war. Sie wußte, ihr dunkles Haar würde den Lichtstrahl der Taschenlampe nicht reflektieren.
Obwohl ihr das Wasser bis über die Ohren reichte, hörte sie die erregten Stimmen der Männer auf der Straße, die mit den Taschenlampen in das Schilf leuchteten und sie suchten. Einen Augenblick streifte das Licht ihren Kopf, und sie atmete tief, um notfalls untertauchen zu können, aber der Lichtstrahl bewegte sich weiter, und erleichtert stellte sie fest, daß die Männer sie nicht gesehen hatten.
Das ermutigte sie, den Kopf leicht zu heben, bis sie mit einem freien Ohr die Männer hören konnte.
Sie sprachen arabisch, und Royan erkannte die Stimme des Mannes mit dem Namen Bacheet. Er war offensichtlich der Anführer, denn er gab die Befehle.
»Geh hinein, Yusuf, und hol die Hure heraus.«
Sie hörte, wie Yusuf das Steilufer herunterglitt und ins Wasser platschte.
»Weiter draußen«, rief ihm Bacheet zu. »Dort im Schilf, wo ich mit der Taschenlampe hinleuchte.«
»Es ist zu tief. Du weißt doch, ich kann nicht schwimmen. Da geht mir das Wasser über den Kopf.«
»Dort! Direkt vor dir. Dort im Schilf. Ich kann ihren Kopf sehen«, ermutigte ihn Bacheet. Royan fürchtete, die Kerle hätten sie entdeckt, und duckte sich, so tief sie konnte.
Yusuf platschte im Wasser herum und kam ihr immer näher, als plötzlich im Schilf eine starke Bewegung entstand, die Yusuf so erschreckte, daß er laut schrie: »Djinns! Gott schütze mich!« Ein Schwarm Wildenten hatte den Rand des Schilfgürtels erreicht und erhob sich nun mit pfeifenden Flügelschlägen in die Dunkelheit.
Yusuf kehrte um, und Bacheet konnte ihn nicht dazu bewegen, die Suche fortzusetzen.
»Die Frau ist nicht so wichtig wie die Schriftrolle«, protestierte er und kletterte den Hang zur Straße hinauf. »Ohne die Schriftrolle gibt es kein Geld. Später werden wir sie sicher noch finden.«
Royan wendete vorsichtig den Kopf und sah, wie sich das Licht der Taschenlampen die Straße hinunter zum geparkten Fiat bewegte, dessen Scheinwerfer noch brannten. Sie hörte das Zuschlagen der Wagentüren und den Anlasser und sah, wie der Fiat sich in Richtung auf die Villa in Bewegung setzte.
Sie wagte es nicht, ihr Versteck schon jetzt zu verlassen, denn sie fürchtete, einer der drei Männer könnte auf der Straße noch auf sie warten. Sie stellte sich auf die Zehenspitzen, und nun reichte ihr das Wasser noch bis zum Mund. Sie zitterte vor Erregung und war entschlossen, den Sonnenaufgang abzuwarten und erst bei Tageslicht ihr Versteck zu verlassen. Es war sehr viel später, als sie den Widerschein des Feuers und das Züngeln der Flammen zwischen den Palmen bemerkte. Ohne an ihre eigene Sicherheit zu denken, kletterte sie den Steilhang hinauf auf die Straße. Völlig erschöpft und außer Atem, geschwächt durch den Blutverlust und vor Angst zitternd, kniete sie im Schlamm am Seeufer und blickte durch den Schleier ihrer nassen Haare hinüber zu den Flammen.
»Die Villa!« flüsterte sie. »Duraid! Lieber Gott, nein! Nein!«
Mit Mühe zwang sie sich auf die Füße und torkelte auf das brennende Haus zu.
Bacheet schaltete die Scheinwerfer und den Motor des Fiat aus, bevor sie an die Einfahrt zum Villengrundstück kamen. Von hier aus ließ er den Wagen geräuschlos weiterrollen und hielt unterhalb der Terrasse an.
Die drei Männer stiegen aus und gingen die Steintreppe zur Terrasse hinauf. Duraid lag noch immer neben dem Fischteich, wo Bacheet ihn zurückgelassen hatte. Ohne ihn eines Blickes zu würdigen, gingen sie weiter in das dunkle Arbeitszimmer. Bacheet hatte einen billigen Plastikbeutel mitgebracht, den er jetzt auf den Tisch legte.
»Wir haben schon zu viel Zeit verschwendet. Jetzt müssen wir uns beeilen.«
»Daran ist Yusuf schuld«, brummte der Fahrer des Fiat. »Er hat die Frau entkommen lassen.«
»Und du hättest sie auf der Straße abfangen können«, knurrte Yusuf, »und hast es auch nicht getan.«
»Genug!« fuhr sie Bacheet an. »Wenn ihr bezahlt werden wollt, macht keine Fehler mehr.«
Im Schein seiner Stablampe sah Bacheet die Schriftrolle auf dem Tisch liegen. »Das ist sie.« Er war sich seiner Sache sicher, denn man hatte ihm ein Foto von der Schriftrolle gezeigt, um jeden Irrtum auszuschließen. »Unsere Auftraggeber brauchen alles – die Karten und die Fotos. Ebenso die Bücher und Papiere, alles, was auf dem Tisch liegt und die beiden bei ihrer Arbeit benutzt haben. Laßt nichts davon liegen.«
In aller Eile steckten sie die Unterlagen in den Beutel, und Bacheet verschnürte ihn.
»Jetzt ist der Doktari an der Reihe. Bringt ihn her.«
Yusuf und der Fahrer gingen hinaus auf die Terrasse und beugten sich über Duraid. Sie packten ihn an den Füßen und zerrten ihn über die Terrasse in das Arbeitszimmer. Dabei schlug Duraid mit dem Hinterkopf auf der Türschwelle auf und hinterließ eine lange Blutspur auf der Terrasse, die im Licht der Stablampe schimmerte.
»Hol die Lampe!« sagte Bacheet, und Yusuf ging zurück auf die Terrasse. Die Lampe lag noch dort, wo Duraid sie fallengelassen hatte. Sie brannte nicht mehr, und Bacheet hielt sie sich ans Ohr und schüttelte sie.
»Voll«, sagte er befriedigt und schraubte den Verschluß am Einfüllstutzen ab. »Alles in Ordnung«, sagte er zu den anderen, »bringt den Beutel zum Wagen.«
Sie gingen hinaus, und Bacheet bespritzte Duraids Hemd und Hosen mit dem Lampenöl. Dann ging er an die Regale und verteilte den Rest des Öls über die Bücher und Manuskripte.
Er stellte die leere Lampe auf den Boden und holte eine Schachtel Streichhölzer aus der Innentasche seines Gewands. Dann hielt er ein brennendes Streichholz an die vom Bücherregal heruntertropfende Ölspur. Sie fing sofort Feuer, das sich nach oben ausbreitete und die Manuskripte erfaßte. Ein zweites brennendes Streichholz warf er auf das blut- und ölgetränkte Hemd von Duraid.
Blaue Flämmchen hüllten Duraids Brust ein. Doch als die Flammen die Baumwolle und Duraids Fleisch erfaßten, veränderte sich ihre Farbe. Sie wurden orangefarben, und über ihnen kräuselte sich schwarzer Rauch.
Bacheet lief zur Tür, überquerte die Terrasse und sprang die Stufen hinunter. Er setzte sich auf den Rücksitz des Fiat, der Fahrer startete den Motor, und sie fuhren hinaus auf die Straße.
Kapitel 2
Die Schmerzen weckten Duraid aus seiner Ohnmacht, die so tief gewesen waren, daß sie ihn aus jenem fernen Land am Rande des Todes in die irdische Wirklichkeit zurückholten.
Er stöhnte. Seine erste Wahrnehmung war der Geruch verbrannten Fleisches, was ihm seine verzweifelte Lage bewußt machte. Er bebte am ganzen Körper, öffnete die Augen und sah an sich hinunter.
Seine Kleider schwelten und verkohlten, in seinem ganzen Leben hatte er noch nie solche Schmerzen verspürt. Nun wurde ihm auch bewußt, daß sich das Feuer im Zimmer ausbreitete. Der Rauch und die Hitze strömten in Wellen über ihn hinweg, so daß er kaum die offene Terrassentür erkennen konnte.
Die entsetzlichen Schmerzen quälten ihn so sehr, daß er sterben wollte. Doch dann dachte er an Royan. Er versuchte, mit seinen verbrannten Lippen ihren Namen zu sagen, brachte aber keinen Ton heraus. Nur der Gedanke an sie gab ihm die Kraft, sich zu bewegen. Er wälzte sich auf die andere Seite und spürte die Hitze jetzt auch im Rücken. Er stöhnte laut und kroch auf die Terrassentür zu.
Jede Bewegung erforderte eine gewaltige Anstrengung und erhöhte die Schmerzen, und als er wieder auf dem Rücken lag, stellte er fest, daß durch die offene Tür die frische Luft von der Hitze angesogen wurde und das Feuer anfachte. Mit einem tiefen Atemzug saugte er die frische Wüstenluft in seine Lungen, und das gab ihm Kraft genug, über die Türschwelle auf die kühlen Steine der Terrasse zu rutschen.
Seine Kleider und sein Körper brannten immer noch. Mit den vom Feuer geschwärzten Händen versuchte er, die Flammen auf seiner Brust zu löschen.
Dann erinnerte er sich an den Fischteich. Der Gedanke, seinen gemarterten Körper im Wasser abkühlen zu können, trieb ihn zu einer letzten verzweifelten Anstrengung. Wie eine Schlange mit gebrochenem Rückgrat wand er sich über die Steinplatten der Terrasse, an denen Fetzen seiner verbrannten Haut kleben blieben, und ließ sich dann ins Wasser gleiten, das hörbar zischte. Bei der Berührung mit dem kalten Wasser verstärkten sich die Schmerzen der Brandwunden so sehr, daß er erneut bewußtlos wurde.
Als er wieder zu sich kam und die dunklen Wolken vor seinen Augen sich auflösten, hob er den Kopf und sah eine menschliche Gestalt, die die Terrassenstufen hinaufwankte.
Zuerst hielt er sie für eine Wahnvorstellung, doch im Licht des Feuers in der brennenden Villa erkannte er Royan. Das nasse Haar hing ihr wirr ins Gesicht, und an ihrem zerrissenen und mit Schlamm bespritzten Kleid klebten grüne Algen. Ihr rechter Arm war mit schmutzigen Stoffstreifen verbunden, durch die hellrotes Blut drang.
Sie hatte ihn noch nicht gesehen. Sie war mitten auf der Terrasse stehengeblieben und starrte auf das brennende Haus. War Duraid noch darin? Sie ging ein paar Schritte auf die Flammen zu, aber die Hitze verwehrte ihr den Zugang. In diesem Augenblick stürzte das Dach ein, und eine gewaltige, aus Funken und Flammen bestehende Feuersäule erhob sich hoch in den Nachthimmel. Sie trat zurück und legte schützend einen Arm vor das Gesicht.
Duraid versuchte sie zu rufen, aber aus seiner von der Hitze ausgedörrten Kehle drang kein Laut. Royan wandte sich ab und ging zur Treppe. Es war ihm klar, daß sie Hilfe holen wollte. Unter großen Anstrengungen gelang es ihm endlich, zwischen seinen verbrannten und geschwollenen Lippen einen krächzenden Laut auszustoßen.
Royan fuhr herum, starrte ihn an und schrie vor Schreck auf. Was sie sah, war nicht mehr der Kopf eines Menschen. Der haarlose Schädel war rauchgeschwärzt, und an Kinn und Wangen hing die Haut in Fetzen herab. Das Gesicht war eine schwarzverkrustete Maske, auf der sich an einigen Stellen das rohe Fleisch zeigte. Sie wich vor ihm zurück wie vor einem ekelerregenden Ungeheuer.
»Royan«, krächzte er mit kaum hörbarer Stimme. Dann hob er eine Hand, um sie heranzuwinken, und sie lief zum Teich und ergriff die ausgestreckte Hand.
»Im Namen der Jungfrau, was haben sie dir angetan?« schluchzte sie, aber als sie versuchte, ihn aus dem Teich herauszuziehen, löste sich die Haut von seiner Hand und gab eine blutige, nackte Klaue frei.
Royan fiel am Rand des Teichs auf die Knie und beugte sich über ihn, um ihn in die Arme zu nehmen. Sie wußte, daß sie nicht die Kraft hatte, ihn herauszuziehen, ohne ihm weitere Schmerzen zuzufügen. Es war ihr klar, daß er sterben würde – kein Mensch konnte so fürchterliche Verletzungen überleben.
»Bald wird jemand kommen und uns helfen«, flüsterte sie auf arabisch. »Irgend jemand muß das Feuer gesehen haben. Sei tapfer, mein geliebter Mann, sehr bald wird die Hilfe da sein.«
In seiner Qual und in seinem Bemühen, sich verständlich zu machen, wand er sich in ihren Armen.
»Die Schriftrolle?« Seine Worte waren kaum zu verstehen. Sie blickte zurück auf das brennende Haus und schüttelte den Kopf.
»Sie ist fort«, sagte sie. »Verbrannt oder gestohlen.«
»Nicht aufgeben«, flüsterte er. »Unsere ganze Arbeit –«
»Sie ist fort«, wiederholte sie. »Niemand wird uns glauben ohne –«
»Nein!« Seine Stimme war schwach, aber entschieden. »Für mich, meine letzte –«
»Das darfst du nicht sagen«, flehte sie ihn an. »Du wirst wieder gesund werden.«
»Versprich es mir«, verlangte er. »Versprich es mir jetzt!«
»Wir haben keinen Sponsor. Ich bin allein, und allein schaffe ich es nicht.«
»Harper!« sagte er. Royan beugte sich zu ihm hinunter. »Harper«, wiederholte er. »Ein starker, harter, intelligenter Mann –« Sie wußte, was er meinte. Natürlich Harper. Er war der vierte und letzte auf ihrer Liste möglicher Sponsoren. Trotzdem wußte sie, daß Nicholas Quenton-Harper der Mann war, dem Duraid am meisten vertraute. Er hatte oft mit Achtung und Wärme von ihm gesprochen, manchmal sogar mit Ehrfurcht.
»Aber was soll ich ihm sagen? Er kennt mich nicht. Wie kann ich ihn überzeugen? Die siebente Schriftrolle ist fort.«
»Vertraue ihm«, flüsterte er. »Ein guter Mann. Vertraue ihm –« Er wollte sie unbedingt überzeugen: »Versprich es mir!«
Sie erinnerte sich an das Notizbuch in ihrer Wohnung in Gizeh, einem Vorort von Kairo, und an den Bericht von Taita über den strapaziösen Marsch nach Süden, den sie in ihrem Computer gespeichert hatte. Alles Material war also nicht verloren. »Ja«, stimmte sie ihm zu, »ich verspreche es dir, mein geliebter Mann, ich verspreche es dir.«
Zwar konnte sein verstümmeltes Gesicht keinen menschlichen Ausdruck mehr zeigen, aber sie glaubte dem Ton seiner Stimme eine gewisse Befriedigung entnehmen zu können, als er flüsterte: »Meine geliebte Blume!« Sein Kopf sank zurück, und er starb in ihren Armen.
Als die Bauern aus dem Dorf erschienen, kniete Royan noch immer neben dem Teich und flüsterte ihrem Mann tröstende Worte ins Ohr. Inzwischen war das Feuer in sich zusammengesunken, und das erste Licht der Morgendämmerung war stärker als das der allmählich verlöschenden Glut.
Alle höheren Beamten des Museums und des Ministeriums für Altertümer nahmen an der Totenfeier in der Kirche der Oase teil. Sogar Duraids Vorgesetzter, der Minister für Kultur und Tourismus Atalan Abou Sin, war in seinem Dienstwagen, einem schwarzen Mercedes mit Klimaanlage, aus Kairo gekommen.
Er stand hinter Royan, und obwohl er Moslem war, stimmte er in den Gesang der christlichen Liturgie ein. Nahoot Guddabi stand neben seinem Onkel. Nahoots Mutter war die jüngste Schwester des Ministers, und das war, wie Duraid einmal sarkastisch gesagt hatte, ein Ausgleich für die völlige Ahnungslosigkeit des Neffen auf dem Gebiet der Archäologie und seine Unfähigkeit als Verwaltungsbeamter.
Es war ein glühendheißer Tag. Die Außentemperatur lag bei über dreißig Grad Celsius, und selbst in der koptischen Kirche war es schwül. Die dichten Weihrauchwolken und die eintönige Stimme des schwarzgekleideten Priesters, der die altehrwürdige Trauerliturgie intonierte, wirkten bedrückend auf Royan und nahmen ihr den Atem. Die Wundnaht an ihrem rechten Arm schmerzte, und jedesmal, wenn sie auf den schwarzen Sarg vor dem vergoldeten Altar blickte, sah sie vor ihrem geistigen Auge Duraids kahlen und versengten Schädel, und es wurde ihr so schwindlig, daß sie sich festhalten mußte, um nicht umzufallen.
Endlich war die Feier vorüber, und sie konnte draußen in der frischen Luft aufatmen. Ihre Pflichten waren damit aber noch nicht zu Ende. Als Witwe des Verstorbenen war ihr Platz auf dem Wege zum Friedhof, wo Duraids Verwandte am Familiengrab auf ihn warteten, unmittelbar hinter dem Sarg.
Bevor er nach Kairo zurückkehrte, schüttelte Atalan Abou Sin ihr die Hand und sprach ihr mit wenigen Worten sein Beileid aus. »Wie fürchterlich das alles ist, Royan. Ich habe persönlich mit dem Innenminister gesprochen. Glauben Sie mir, man wird die Bestien finden, die Ihnen das angetan haben. Lassen Sie sich bitte so viel Zeit, wie Sie brauchen, bevor Sie in das Museum zurückkehren«, sagte er.
»Ich werde am Montag wieder in meinem Büro sein«, antwortete sie. Er zog ein Notizbuch aus der Brusttasche seines dunklen zweireihigen Anzugs, schlug es auf, machte sich eine Notiz und sah sie dann wieder an.
»Dann kommen Sie bitte am Nachmittag um vier Uhr zu mir ins Ministerium.« Damit ging er zu dem wartenden Mercedes, während Nahoot Guddabi ihr die Hand schüttelte. Mit seinem blassen Gesicht und den kaffeefarbenen Ringen unter den dunklen Augen wirkte dieser hochgewachsene Mann mit dem dichten welligen Haar und strahlendweißen Zähnen durchaus elegant. Er trug einen gutsitzenden Maßanzug und roch nach einem teuren Herrenparfüm. Er sah sie mit einem, dem Anlaß entsprechenden, ernsten Gesicht an.
»Er war ein guter Mann. Ich habe Duraid hoch geschätzt«, sagte er, und Royan nickte, ohne etwas auf diese offensichtliche Unwahrheit zu antworten. Duraid hatte seinen Stellvertreter nicht besonders geschätzt, und er hatte Nahoot nicht an der Arbeit mit den Taita-Schriftrollen beteiligt. Insbesondere hatte er ihm nie erlaubt, die siebente Schriftrolle anzusehen, und aus diesem Grund war es zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen den beiden Männern gekommen.
»Ich hoffe, Sie werden sich um den Direktorenposten bemühen, Royan«, sagte er. »Sie sind bestens dafür geeignet.«
»Vielen Dank, Nahoot, Sie sind sehr freundlich. Ich habe bisher noch keine Zeit gehabt, an die Zukunft zu denken, aber werden Sie sich nicht darum bewerben?«
»Natürlich«, nickte er. »Das heißt aber nicht, daß ich der einzige Bewerber sein muß. Vielleicht werden Sie mir die Stelle vor der Nase wegschnappen.« Er lächelte selbstzufrieden. Sie war eine Frau in einer arabischen Welt, und er war der Neffe des Ministers, und Nahoot wußte genau, daß er die besseren Chancen hatte. »Freundschaftliche Rivalität?« fragte er.
Royan lächelte betrübt. »Wenigstens sollten wir Freunde bleiben. Ich werde künftig jeden Freund brauchen, den ich finden kann.«
»Sie wissen, Sie haben viele Freunde. Alle Angehörigen des Ministeriums haben Sie gern, Royan.« Soweit sie wußte, hatte er damit wahrscheinlich recht. Mit sanfter Stimme fuhr er fort: »Darf ich Sie in meinem Wagen nach Kairo mitnehmen? Mein Onkel wird sicher nichts dagegen haben.«
»Vielen Dank, Nahoot, aber draußen steht mein eigener Wagen, und ich muß über Nacht in der Oase bleiben, um noch einiges für Duraid zu erledigen.« Das stimmte nicht. Royan hatte vor, noch am gleichen Abend zu ihrer Wohnung in Gizeh zurückzufahren, doch ohne genau zu wissen, weshalb, wollte sie Nahoot nicht in ihre Pläne einweihen.
»Dann sehen wir uns also am Montag im Museum.«
Royan verließ die Oase, sobald sie sich von den Verwandten, Freunden und Bauern verabschiedet hatte, von denen so viele den größten Teil ihres Lebens für Duraids Familie gearbeitet hatten. Sie fühlte sich alleingelassen und völlig auf sich selbst gestellt, und alle diese Beileidsbezeugungen und das fromme Zureden waren bedeutungslos und konnten sie nicht trösten.
Selbst zu dieser späten Stunde herrschte auf der Teerstraße durch die Wüste starker Verkehr in beiden Richtungen, denn morgen war Freitag, ein moslemischer Feiertag. Sie zog den rechten Arm aus der Schlinge, da er sie nicht beim Fahren behinderte. Sie kam verhältnismäßig rasch vorwärts, doch es war bereits nach siebzehn Uhr, als sich jenseits der braungelben Einöde der Wüste der schmale, grüne Streifen bewässerten und kultivierten Bodens am Nil zeigte, der großen Lebensader Ägyptens.
Wie immer wurde der Verkehr dichter, je mehr sie sich der Hauptstadt näherte, und es war schon fast ganz dunkel, als sie den Wohnblock in Gizeh erreichte, von dem aus man den Fluß und jene großen, steinernen Monumente überblicken konnte, die sich hoch und massiv vor dem Abendhimmel abhoben und die für Royan die Seele und die Geschichte ihres Landes verkörperten.
Sie ließ Duraids alten grünen Renault in der Tiefgarage des Gebäudes stehen und fuhr mit dem Aufzug hinauf in den obersten Stock.
Als sie die Wohnungstür öffnete, blieb sie starr vor Schrecken stehen. Einbrecher hatten das ganze Wohnzimmer verwüstet. Sogar der Teppichboden war aufgerissen, und die Bilder, die an den Wänden gehangen hatten, lagen zertrümmert im Zimmer herum. Völlig verstört ging sie ins Schlafzimmer, und auch hier zeigte sich ihr ein Bild der Verwüstung. Die Schranktüren standen offen, und ihre und Duraids Kleider lagen am Boden. Eine Schranktür war aus den Angeln gerissen. Das Bett war umgeworfen, und Laken und Kissen herausgezerrt.
Es roch nach Kosmetika und Parfüm aus den zerschlagenen Gefäßen und Flaschen im Badezimmer, aber sie scheute sich, hineinzugehen, denn sie konnte sich vorstellen, wie es dort aussah. Statt dessen lief sie den Gang hinunter in das geräumige Arbeitszimmer.
In dem dort herrschenden Chaos fiel ihr als erstes das antike Schachspiel auf, das Duraid ihr zur Hochzeit geschenkt hatte. Das aus schwarzem Marmor und Elfenbein zusammengesetzte Schachbrett war zerbrochen, und die Figuren waren in sinnloser, zerstörerischer Wut im Zimmer herumgeworfen worden. Sie bückte sich und hob die weiße Königin auf, deren Kopf abgebrochen war.
Mit der Königin in der Hand ging sie wie eine Schlafwandlerin zu ihrem Schreibtisch vor dem Fenster. Ihr Computer war zerschlagen. Man hatte den Bildschirm und das ganze Gerät offenbar mit einer Axt zertrümmert . Schon auf den ersten Blick sah sie, daß die gespeicherten Daten ein für allemal verloren waren.
Am Boden lag die Schublade, in der sie ihre Disketten aufbewahrt hatte. Diese und alle anderen Schubladen waren herausgezogen und auf den Boden geworfen worden. Sie waren leer, und alle Disketten, Notizbücher und Fotos fehlten. Von dem Material über die siebente Schriftrolle war nichts mehr übrig. Nach drei Jahren Arbeit ließ sich nicht mehr nachweisen, daß diese Schriftrolle überhaupt existiert hatte.
Vollkommen erschöpft setzte sie sich auf den Fußboden. Ihr Arm fing wieder an zu schmerzen, und sie fühlte sich so einsam und verwundbar wie noch nie in ihrem Leben. Sie hätte nie geglaubt, daß Duraid ihr jemals so fehlen würde. Ihre Schultern zuckten, und sie fühlte, wie aus ihrem Inneren die Tränen aufstiegen. Sie versuchte, sie zurückzuhalten, aber es gelang ihr nicht. So saß sie da, inmitten der Trümmer ihres bisherigen Lebens, und weinte, bis alles im Meer ihrer Tränen versank. Dann rollte sie sich auf dem Teppich zusammen und versank in einen Schlaf der Erschöpfung und Verzweiflung.
Am Montag morgen hatte sie ihr Leben wieder einigermaßen im Griff. Die Polizei war gekommen und hatte ihre Aussage protokolliert. Dann hatte sie die Wohnung weitgehend aufgeräumt und sogar den Kopf der weißen Königin angeklebt. Als sie die Treppe hinunterging und in der Tiefgarage in den grünen Renault stieg, hatten die Schmerzen im Arm schon nachgelassen. Zwar war sie nicht gerade bester Stimmung, sah aber doch schon sehr viel optimistischer in die Zukunft und wußte genau, was sie zu tun hatte.
Im Museum ging sie zuerst in Duraids Büro und ärgerte sich darüber, daß Nahoot schon vor ihr gekommen war und nun zwei Leute vom Sicherheitsdienst beaufsichtigte, die Duraids persönliche Sachen zusammenräumten.
»Sie hätten darauf Rücksicht nehmen sollen, daß dies meine Aufgabe gewesen wäre«, sagte sie kühl, aber er reagierte nur mit einem besonders freundlichen Lächeln.
»Es tut mir leid, Royan. Ich habe Ihnen helfen wollen.« Er rauchte eine seiner dicken, türkischen Zigaretten, deren schweren, süßlichen Moschusgeruch sie nicht ausstehen konnte.
Sie ging hinüber zu Duraids Schreibtisch und öffnete die rechte obere Schublade. »Hier lag immer das Tagebuch meines Mannes. Es ist nicht mehr da. Haben Sie es gesehen?«
»Nein, die Schublade war leer.« Nahoot sah zu den beiden Männern hinüber und wartete auf ihre Bestätigung, aber sie schüttelten nur die Köpfe. Royan hielt die Angelegenheit allerdings nicht für besonders wichtig, denn das Tagebuch enthielt nichts Wesentliches. Duraid hatte sich stets darauf verlassen, daß sie alle wichtigen Daten aufzeichnete und sie in ihrem Computer speicherte.
»Vielen Dank, Nahoot«, sagte sie. »Jetzt werde ich alles erledigen, was noch geschehen muß. Ich möchte Sie nicht länger von Ihrer Arbeit abhalten.«
»Wenn Sie Hilfe brauchen, Royan, bitte lassen Sie es mich wissen.« Mit einer leichten Verbeugung verabschiedete er sich von ihr.
Im Büro von Duraid gab es nicht mehr viel zu tun. Sie bat die beiden Männer vom Sicherheitsdienst, die Kartons mit den Privatsachen von Duraid in ihr Büro am anderen Ende des Korridors zu bringen und dort an die Wand zu stellen. In der Mittagspause erledigte sie einige liegengebliebene Arbeiten, und als sie fertig war, blieb ihr bis zu ihrer Verabredung mit Atalan Abou Sin noch eine Stunde Zeit.
Wenn sie alles tun wollte, was sie Duraid versprochen hatte, würde sie in den nächsten Tagen nicht zurückkommen können. Sie wollte sich von ihren liebsten Ausstellungsstücken im Museum verabschieden und ging hinunter in den öffentlich zugänglichen Teil des großen Gebäudes.
Am Montag war hier viel Betrieb, und in den Ausstellungssälen drängten sich Touristen, die den Fremdenführern wie Schafe ihrem Schäfer folgten. Vor den bekanntesten Ausstellungsstücken standen Gruppen von Besuchern, und geduldig lauschten sie den in allen nur denkbaren Sprachen auswendig gelernten, hohlen Phrasen.
In den Räumen im ersten Stock, wo die Schätze des Tut-ench-Amun ausgestellt waren, drängten sich so viele Menschen, daß sich Royan nur kurze Zeit dort aufhielt. Mit einiger Mühe gelang es ihr, bis vor die Vitrine mit der großartigen goldenen Totenmaske des kindlichen Pharao zu kommen. Wie jedes Mal, wenn sie vor diesem Kunstwerk stand, wurde sie von seiner Pracht und Schönheit ergriffen, und ihr Atem und Herzschlag beschleunigten sich. Und doch kam ihr, als sie nun eingezwängt zwischen zwei vollbusigen, schwitzenden älteren Frauen davorstand, der gleiche Gedanke wie schon so oft: Wenn ein so unbedeutender, schwacher König mit einer so kostbaren goldenen Maske über seinem Gesicht beigesetzt worden war, wie mußten dann die großen Pharaonen mit dem Namen Ramses in ihren Mausoleen zur Ruhe gebettet sein? Ramses II., der bedeutendste von ihnen, hatte siebenundsechzig Jahre regiert und in den Jahrzehnten seiner Regierungszeit die Möglichkeit gehabt, die Schätze, die man ihm ins Grab mitgeben sollte, aus den von ihm eroberten Gebieten zusammenzutragen.
Anschließend machte Royan auch diesem alten Monarchen ihre Aufwartung. Nach dreißig Jahrhunderten ruhte Ramses II. mit einem entrückten und heiteren Ausdruck auf dem hageren Gesicht im Grabe. Seine Haut hatte eine helle, marmorne Tönung. Die spärlichen Haare waren blond und mit Henna gefärbt. Seine ebenso gefärbten Hände waren lang, schmal und elegant. Er war jedoch nur in ein altes Leinentuch eingehüllt. Die Grabräuber hatten sogar die Bandagen entfernt, in welche die Mumie eingewickelt war, um an die darunterliegenden Amulette und Skarabäen zu kommen, und ihn dann fast nackt zurückgelassen. Als man seine sterblichen Überreste 1881 im Versteck der königlichen Mumien in der Felsenhöhle von Deir El Bahari gefunden hatte, lag auf seiner Brust nur noch ein Papyrus mit dem Nachweis seiner Abstammung.
Das hatte, wie sie meinte, seine moralische Berechtigung, aber als sie vor diesem sie tief beeindruckenden Zeugen der Vergangenheit stand, fragte sie sich erneut, wie sie und Duraid es schon so oft getan hatten, ob der Schreiber Taita die Wahrheit gesagt hatte und ob irgendwo in den fernen wilden afrikanischen Bergen noch ein anderer großer Pharao in einem bis jetzt noch nicht entdeckten Grab mit all seinen Schätzen ungestört ruhte. Der bloße Gedanke daran ließ sie erschauern, und die feinen dunklen Härchen in ihrem Nacken sträubten sich.
»Ich habe es dir versprochen, mein geliebter Mann«, flüsterte sie auf arabisch. »Ich werde es für dich und zu deinem Andenken tun, denn du hast mir den Weg gewiesen.«
Sie ging die Haupttreppe hinunter und schaute auf ihre Armbanduhr. Sie hatte noch fünfzehn Minuten Zeit bis zur Verabredung mit dem Minister, und sie wußte genau, was sie bis dahin tun mußte. Sie wollte noch einen, nur selten geöffneten Ausstellungsraum besuchen. Die Fremdenführer brachten die Touristen nur manchmal dorthin, um ihnen kurz die Statue von Amenhotep zu zeigen.
Royan blieb vor der vom Boden bis zur Decke reichenden, hohen Glasvitrine stehen. Hier waren zahlreiche kleinere Gebrauchsgegenstände, Werkzeuge und Waffen, Amulette und Gefäße ausgestellt. Die jüngsten stammten aus der Zeit der zwanzigsten Dynastie des Neuen Königreichs um 1100 v. Chr., während sich die ältesten auf die graue Vorzeit des Alten Königreichs vor fast fünftausend Jahren datieren ließen. Es gab noch kein vollständiges Verzeichnis dieser Gegenstände, und einzelne von ihnen waren noch nirgends beschrieben.
Auf dem untersten Regal lagen verschiedene Juwelen, Fingerringe und Siegel, und neben jedem Siegel lag ein damit hergestellter Wachsabdruck.
Royan kniete sich hin, um sich eines dieser Siegel genauer anzusehen – ein wunderschön geschnittenes Siegel aus blauem Lapislazuli. Für die alten Ägypter war der Lapis ein seltenes und kostbares Material, für das es im ganzen ägyptischen Reich keine natürlichen Fundstätten gab. Der Wachsabdruck zeigte einen Falken mit gebrochenem Flügel, und die Inschrift darunter war für Royan leicht zu lesen: »TAITA DER SCHREIBER DER GROSSEN KÖNIGIN«. Sie wußte, daß es derselbe Mann war, denn er hatte auch die Schriftrollen mit dem Symbol des verletzten Falkens gekennzeichnet. Sie fragte sich nur, von wem und wo dieses Siegel gefunden worden war. Vielleicht hatte irgendein Bauer das heute nicht mehr auffindbare Grab des alten Sklaven und Schreibers ausgeplündert, aber das ließ sich jetzt nicht mehr feststellen.