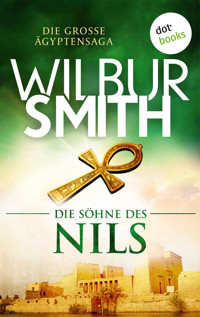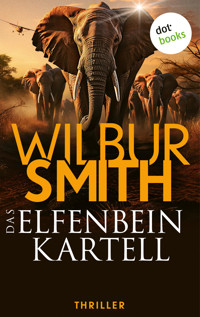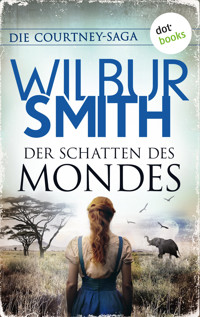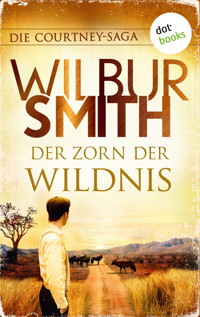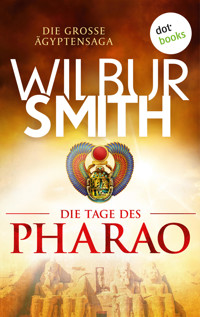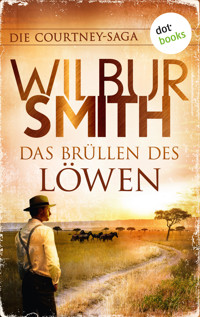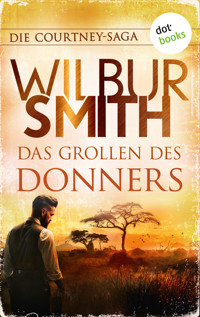
9,99 €
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Courtney-Saga
- Sprache: Deutsch
Das internationale Phänomen, das den Weltruhm des Autors begründet hat: »Keiner schreibt so gute Abenteuerromane wie Wilbur Smith«, urteilt der Daily Mirror. Brüder durch Geburt – Feinde durch Blut … Südafrika im Jahr 1899. Kurz vor der Jahrhundertwende wird das Land von dem Konflikt zwischen dem britischen Empire und den ansässigen Burenrepubliken erschüttert. Der Abenteurer und Unternehmer Sean Courtney folgt dem Ruf der Krone zu den Waffen – und muss schon bald erkennen, dass Feinde nicht nur auf dem Schlachtfeld geboren werden: Sein eigener Bruder Garrick, verbittert und rachsüchtig, ist fest entschlossen, Seans Ruf zu zerstören. Und nicht nur das: Auch ihre Söhne wiederholen in ihrer Rivalität die Sünden der Väter. Mit der Welt gegen sich, muss Sean um alles kämpfen, was er sich aufgebaut hat. Aber wenn der Feind die eigene Familie ist, gibt es Kriege, in denen es keine Sieger gibt ... Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der abenteuerliche Afrika-Roman »Das Grollen des Donners« von Bestseller-Autor Wilbur Smith ist der zweite Band seiner epochalen historischen Familiensaga um die Familie Courtney – Fans von Ken Follett und James Clavell werden begeistert sein! Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 724
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über dieses Buch:
Südafrika im Jahr 1899. Kurz vor der Jahrhundertwende wird das Land von dem Konflikt zwischen dem britischen Empire und den ansässigen Burenrepubliken erschüttert. Der Abenteurer und Unternehmer Sean Courtney folgt dem Ruf der Krone zu den Waffen – und muss schon bald erkennen, dass Feinde nicht nur auf dem Schlachtfeld geboren werden: Sein eigener Bruder Garrick, verbittert und rachsüchtig, ist fest entschlossen, Seans Ruf zu zerstören. Und nicht nur das: Auch ihre Söhne wiederholen in ihrer Rivalität die Sünden der Väter. Mit der Welt gegen sich, muss Sean um alles kämpfen, was er sich aufgebaut hat. Aber wenn der Feind die eigene Familie ist, gibt es Kriege, in denen es keine Sieger gibt...
»Das Grollen des Donners« erscheint außerdem als Printausgabe bei SAGA Egmont, www.sagaegmont.com/germany.
Über den Autor:
Wilbur Smith (1933–2021) wurde in Zentralafrika geboren und gehört zu den erfolgreichsten Schriftstellern der Gegenwart. Der Debütroman seiner Jahrhunderte umspannenden Südafrika-Saga um die Familie Courtney, begründete seinen Welterfolg als Schriftsteller. Seitdem hat er über 50 Romane geschrieben, die allesamt Bestseller wurden, und in denen er seine Erfahrungen aus verschiedenen Expeditionen in die ganze Welt verarbeitete. Seine Bücher wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt und mehrfach verfilmt. Wilbur Smith starb 2021 in Kapstadt im Kreise seiner Familie.
Die Website des Autors: www.wilbursmithbooks.com/
Die Autorin/der Autor bei Facebook: www.facebook.com/WilburSmith/
Die Autorin/der Autor auf Instagram: www.instagram.com/thewilbursmith/
Die große Südafrika-Saga des Autors um die Familie Courtney erscheint bei dotbooks im eBook und bei SAGA Egmont im Print:
»Das Brüllen des Löwen« (auch als Hörbuch bei SAGA Egmont erhältlich)
»Das Grollen des Donners«
»Der Sturz des Sperlings«
»Das Erbe der Steppe«
»Der Zorn der Wildnis«
»Das Vermächtnis der Savanne«
»Der Schatten des Mondes«
»Das Zeichen des Fuchses«
»Flug des Seeadlers«
»Tage des Monsuns«
»König der Wüste«
»Der Triumph der Sonne«
Weitere Bände sind in Vorbereitung.
Die große Ägypten-Saga über den Eunuchen Taita ist bei dotbooks als eBook erhältlich und bei SAGA Egmont als Printausgabe:
»Die Tage des Pharao« (auch als Hörbuch bei SAGA Egmont erhältlich)
»Die Schwingen des Horus«
»Die Söhne des Nils«
»Das Erbe des Magus«
Weitere Bände sind in Vorbereitung.
***
eBook-Ausgabe Mai 2024
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1966 unter dem Originaltitel »The Sound of Thunder« bei Heinemann. Die deutsche Erstausgabe erschien 1987 unter dem Titel »Im Schatten seines Bruders« im Paul Zsolnay Verlag.
First published in 1966 by William Heinemann Ltd.
Copyright © Wilbur Smith 1966
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1987 by Paul Zsolnay Verlag GmbH, Wien/Hamburg
Copyright © der eBook-Ausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Kristof Kovacs und AdobeStock/cherezoff
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (fb)
ISBN 978-3-98952-310-4
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. In diesem eBook begegnen Sie daher möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Diese Fiktion spiegelt nicht automatisch die Überzeugungen des Verlags wider oder die heutige Überzeugung der Autorinnen und Autoren, da sich diese seit der Erstveröffentlichung verändert haben können. Es ist außerdem möglich, dass dieses eBook Themenschilderungen enthält, die als belastend oder triggernd empfunden werden können. Bei genaueren Fragen zum Inhalt wenden Sie sich bitte an [email protected].
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Courtney 2« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Wilbur Smith
Das Grollen des Donners
Die Courtney-Saga 2
Aus dem Englischen von Helga Künzel
dotbooks.
Für meine Kinder
Shaun, Lawrence und Christian Laurie
Kapitel 1
Die vierjährige Reise in unwegsamer Wildnis hatte die Wagen arg mitgenommen. Viele der Radspeichen und Disselbooms waren durch grünes heimisches Holz ersetzt worden; bei den Planen sah man vor lauter Flicken kaum mehr etwas von der ursprünglichen Leinwand; und die Gespanne waren von je achtzehn Ochsen auf je zehn geschrumpft, denn Raubtiere und Krankheit hatten ihre Reihen gelichtet. Dennoch beförderte die erschöpfte kleine Karawane die Stoßzähne von fünfhundert Elefanten; zehn Tonnen Elfenbein; die »Ernte« von Sean Courtneys Gewehr; Elfenbein, das er in fast fünfzehntausend Goldsovereigns verwandeln würde, sobald er in Pretoria eintraf.
Wieder einmal war Sean ein reicher Mann. Er trug verschmutzte, ausgebeulte, grob geflickte Kleider; seine Stiefel waren fast durchgelaufen und mit ungegerbtem Büffelleder notdürftig besohlt; ein gewaltiger, ungepflegter Bart verdeckte seine halbe Brust, und eine dichte Mähne schwarzen Haars ringelte sich am Hals, war knapp über dem Kragen mit einer stumpfen Schere abgeschnipselt worden. Übrigens war Sean nicht nur reich an Elfenbein, er war es auch an Gold; letzteres wartete auf ihn in den Tresoren der Volkskaas Bank von Pretoria.
Auf einer Erhebung neben der Straße zügelte er sein Pferd und blickte zu seinen schwerfällig heranzockelnden Wagen zurück. Es ist jetzt Zeit für die Farm, dachte er voll Befriedigung. Er war siebenunddreißig, kein junger Mann mehr; wirklich Zeit, die Farm zu kaufen. Sean wußte genau, welche er haben wollte, und er wußte genau, wo er das Wohnhaus errichten würde – am Rand der Landstufe, so daß er abends auf der breiten Veranda sitzen und über die Ebene zum Tugela River schauen konnte, in die blaue Ferne.
»Morgen früh werden wir in Pretoria ankommen.«
Die Stimme riß Sean aus seinem Traum; er drehte sich halb im Sattel um und schaute zu dem Zulu hinab, der neben dem Pferd hockte. »Es war eine gute Jagd, Mbejane.«
»Nkosi, wir haben viele Elefanten erlegt.« Mbejane nickte, und Sean bemerkte zum ersten Mal die Silbersträhnen in der wolligen Haarkappe des Schwarzen. Auch kein junger Mann mehr.
»Wir haben viele lange Märsche gemacht«, fuhr Sean fort, als denke er laut. »Der Mensch kriegt den Treck satt. Es kommt eine Zeit, wo er sich danach sehnt, zwei Nächte hintereinander am selben Ort zu schlafen.«
»Und seine Frauen singen zu hören, wenn sie auf den Feldern arbeiten.« Mbejane spann den Faden weiter: »Und zuzuschauen, wie seine Rinder bei Einbruch der Dämmerung in den Kral kommen, von seinen Söhnen getrieben.«
»Diese Zeit ist für uns beide da, mein Freund. Wir kehren heim nach Ladyburg.«
Als Mbejane aufstand, rasselten die Speere an seinem Schild aus ungegerbtem Fell; Muskeln spielten unter dem samtigen Schwarz seiner Haut, er hob den Kopf zu Sean und lächelte. Es war ein Strahlen, dieses Lächeln, ein Blitzen der weißen Zähne. Sean mußte es einfach erwidern. Die beiden grinsten einander an wie zwei kleine Jungen nach einem gelungenen Streich.
»Wenn wir die Ochsen an diesem letzten Tag tüchtig treiben, können wir Pretoria noch heute erreichen, Nkosi.«
»Machen wir den Versuch.« Sean winkte ihm aufmunternd zu und lenkte sein Pferd im Schritt den Abhang hinunter, auf kürzestem Weg zur Wagenkolonne.
Die Gefährte bewegten sich im weißen, blendenden Licht des afrikanischen Morgens langsam auf Sean und Mbejane zu. Plötzlich entstand am hinteren Ende der Kolonne ein Tumult, der sich rasch nach vorn fortsetzte; die Hunde kläfften, und die Diener feuerten den jungen Reiter an, der an ihnen vorbei zur Spitze jagte. Er hatte sich im Sattel vorgebeugt, spornte sein Pony mit Faust und Fersen an, der Hut hing ihm am Lederband im Nacken, und sein schwarzes Haar wehte von dem raschen Ritt.
»Dieses Junge brüllt lauter als der Löwe, der es gezeugt hat«, brummte Mbejane, aber sein Gesicht verriet große Zuneigung, als er beobachtete, wie der Reiter beim führenden Wagen sein Pony aus vollem Lauf zum Stehen brachte.
»Und er verdirbt das Maul eines jeden Tieres, das er reitet.« Seans Stimme klang ebenfalls brummig, doch seine Augen glänzten, als er sah, wie sein Sohn einen toten braunen Springbock vom Sattelknopf schnitt und neben dem Wagen auf die Straße fallen ließ. Zwei der Ochsentreiber beeilten sich, das Tier aufzuheben. Dirk Courtney gab seinem Pony die Fersen und galoppierte zu Sean und Mbejane, die am Straßenrand warteten.
»Nur einer?« fragte Sean, als Dirk vor ihm sein Pony zügelte und hielt.
»O nein. Ich habe drei erwischt – drei mit drei Schüssen. Die Gewehrboys bringen die anderen.« Lässig, als sei es ganz natürlich, daß er mit neun Jahren das Fleisch für die ganze Gesellschaft herbeischaffte, lehnte sich Dirk im Sattel zurück; die Zügel hielt er mit der Linken, die Rechte hatte er, in getreuer Imitation des Vaters, leger auf die Hüfte gelegt.
Mit strengem Blick, um Stolz und Liebe zu verbergen, musterte Sean seinen Sohn. Die Schönheit des Jungengesichts war fast unanständig; diese unschuldigen Augen und diese makellose Haut hätten einem Mädchen gehören sollen. Die Sonne warf rötliche Lichter auf die dichten dunklen Locken, lange schwarze Wimpern säumten die auseinanderstehenden Augen, und die Brauen bildeten eine feine Linie. Dirks Augen waren Smaragde, seine Haut war Gold, und er hatte Rubine im Haar – ein von einem Goldschmied geschaffenes Gesicht. Der Mund allerdings – Sean empfand leises Unbehagen – war zu groß, hatte zu breite, weiche Lippen. Allzuoft sah es aus, als wollte der Junge gleich schmollen oder quengeln.
»Wir trecken heute den ganzen Tag durch, Dirk. Kein Outspan, bis wir in Pretoria sind. Reite zurück und sage es den Treibern.«
»Schick doch Mbejane. Er tut nichts.«
»Ich habe dich beauftragt.«
»Zum Teufel, Dad! Ich habe heute schon genug getan.«
»Reite, verdammt noch mal!« brüllte Sean mit unnötiger Heftigkeit.
»Ich bin gerade erst zurückgekommen, es ist nicht fair, daß...«, hob Dirk an.
Sean jedoch schnitt ihm das Wort ab. »Wenn ich dich auffordere, etwas zu tun, kommst du mir jedesmal mit einer ganzen Reihe von Argumenten. Tu jetzt, was ich dir sage.« Die beiden maßen einander mit Blicken; Sean schaute durchdringend, Dirk unmutig, schmollend. Der Ausdruck auf dem Gesicht des Jungen erfüllte Sean mit Entsetzen. Es würde also wieder zu einer jener Willensproben kommen, die zwischen ihnen immer häufiger stattfanden. Würde diese genauso enden wie die anderen? Würde er, Sean, von neuem unterliegen und den Sjambok benützen müssen? Wann hatte er es das letzte Mal getan? Vor zwei Wochen, als er Dirk wegen einer Lappalie im Zusammenhang mit der Versorgung des Ponys getadelt hatte. Dirk hatte schmollend dagestanden, bis Sean mit seiner Predigt fertig gewesen war, und sich dann zu den Wagen getrollt. Sean hatte die Sache als erledigt betrachtet und mit Mbejane geplaudert. Plötzlich war in der Wagenburg lautes Schmerzensgewinsel ertönt, und Sean war rasch hingelaufen.
Mitten im Geviert der Wagen hatte Dirk gestanden, das Gesicht noch dunkel vor Wut, und zu seinen Füßen hatte der winzige Körper eines Welpen gelegen, ein wimmerndes Bündel, dessen Brustkorb von Dirks Tritt eingedrückt war.
Vor Zorn hatte Sean den Jungen geschlagen. Immerhin hatte er trotz des elenden Zorns ein Tauende benutzt und nicht den grausamen Sjambok aus Flußpferdhaut, der sich nach vorn verjüngte. Dann hatte er Dirk in den Wohnwagen geschickt.
Mittags hatte er Dirk holen lassen und eine Entschuldigung verlangt – und Dirk, die Lippen zusammengepreßt, das Kinn vorgeschoben, die Augen trocken, hatte die Entschuldigung verweigert.
Sean hatte ihn wieder geschlagen, mit dem Tau, diesmal nicht im Affekt, sondern kaltblütig. Dirk war nicht zusammengebrochen.
In seiner Verzweiflung hatte Sean dann zum Sjambok gegriffen. Zehn zischende Schläge lang, die mit einem bösen Schnalzen auf Dirks Kehrseite klatschten, war der Junge stumm geblieben. Sein Körper hatte sich bei jedem Hieb leicht aufgebäumt, doch kein Wort war über seine Lippen gekommen. Sean war übel gewesen vor Scham und Schuldgefühl; Schweiß war ihm in die Augen geronnen, als er mechanisch den Sjambok geschwungen hatte, die Finger um den Griff geklammert, im Mund den schleimigen Speichel des Selbsthasses.
Als Dirk endlich schrie, hatte Sean den Sjambok fallen lassen, sich keuchend an die Wagenwand gelehnt und mühsam gegen die Übelkeit angekämpft, die ihm sauer in die Kehle hochstieg.
Dirk hatte geschrien und geschrien. Sean hatte ihn aufgehoben und an die Brust gepreßt.
»Es tut mir leid, Pa! Es tut mir leid. Ich werde es nie wieder tun, das verspreche ich dir. Ich liebe dich, ich liebe dich am meisten von allen – und ich werde es nie mehr tun«, hatte Dirk geschluchzt, während sie einander umschlungen hielten.
Danach hatte tagelang keiner der Diener Sean angelächelt oder auch nur mit ihm gesprochen, es sei denn, um einen Befehl zu bestätigen. Jeder der Diener, Mbejane eingerechnet, hätte bedenkenlos gestohlen, betrogen und gelogen, um Dirk Courtney zu verschaffen, was er haben wollte, und zwar genau in dem Moment, in dem er es haben wollte. Sie haßten jeden, auch Sean, der Dirk etwas verweigerte.
Die Auseinandersetzung lag zwei Wochen zurück. Und jetzt, fragte sich Sean, als er den unschönen Mund betrachtete; müssen wir jetzt alles noch einmal durchexerzieren?
Plötzlich lächelte Dirk. Es war einer dieser Stimmungswechsel, die Sean stets verwirrten, denn wenn Dirk lächelte, stimmte sein Mund. Dann war er unwiderstehlich.
»Ich reite zurück, Dad.« Fröhlich, als gehe er freiwillig, trieb Dirk sein Pony an und trabte zu den Wagen zurück.
»Frecher kleiner Lauser!« knurrte Sean, Mbejanes wegen, doch im stillen überlegte er, wie weit er selbst zu tadeln sei. Er hatte den Jungen mit einem Wagen als Heim großgezogen, mit dem Veld als Schulzimmer und mit erwachsenen Männern als Gefährten, über die Dirk aus unangefochtenem Geburtsrecht Autorität ausübte.
Seit dem Tod der Mutter vor fünf Jahren entbehrte Dirk den besänftigenden Einfluß einer Frau. Kein Wunder, daß er wild war.
Sean scheute die Erinnerung an Dirks Mutter. Auch ihr gegenüber empfand er Schuld, eine Schuld, mit der er sich lange herumgeschlagen hatte. Doch es hatte keinen Sinn, sich zu quälen. Dirks Mutter war tot. Sean schüttelte die Düsternis ab, die sich über seine eben noch so glückliche Stimmung gelegt hatte; er schlug seinem Pferd das lockere Zügelende leicht an den Hals und lenkte es auf die Straße – nach Süden, zur flachen Linie der Berge am Horizont, auf Pretoria zu.
Dirk ist wild, aber wenn wir in Ladyburg sind, wird mit ihm alles in Ordnung kommen, versicherte sich Sean. In der Schule werden sie ihm allen Unsinn austreiben, und zu Hause werden sie ihm Manieren einbleuen. Ja, es kommt bestimmt alles in Ordnung mit ihm.
Am Abend jenes Tages, des 3. Dezember 1899, führte Sean Courtney seine Wagen aus den Hügeln hinunter zum Apies River und schlug dort ein Lager auf. Nachdem alle gegessen hatten, schickte Sean Dirk in seine Koje im Wohnwagen. Dann stieg er allein wieder auf den Hügelkamm und blickte zurück auf das Land im Norden. Es schimmerte silbergrau im Mondlicht, dehnte sich endlos in der Ferne, von tiefer Stille erfüllt. Es verkörperte das alte Leben. Sean kehrte ihm jäh den Rücken und ging hinab, auf die Lichter der Stadt zu, die ihm aus dem Tal winkten.
Kapitel 2
Am nächsten Morgen gab es ein paar unangenehme Augenblicke, als Sean seinem Sohn befahl, bei den Wagen zu bleiben. Darum war Sean schlechter Laune, als er auf der Brücke über den Apies in die Stadt einritt. Mbejane neben ihm trabte, um mit dem Pferd Schritt zu halten.
Tief in Gedanken versunken, bog Sean in die Church Street ein. Erst hier bemerkte er, daß auf der Straße ungewöhnliche Aktivität herrschte. Eine Reiterkolonne zwang ihn, sein Pferd zu zügeln und an den Straßenrand auszuweichen. Voll Interesse musterte Sean die vorbeiziehende Kolonne.
Burgher in kunterbunter Kleidung, teils zu Hause gesponnen, teils gekauften Gewändern, ritten in einer Formation, die man mit viel Phantasie als Viererkolonne bezeichnen konnte. Seans Neugierde wurde jedoch vor allem durch ihre Zahl erregt. Gott! Es mußten mindestens zweitausend Mann sein, angefangen von jungen Burschen bis zu Graubärten. Alle trugen Patronengurte, und neben jedem Knie ragte der Kolben eines Mausergewehrs mit Schlagbolzenzündung aus der Sattelscheide. Zusammengerollte Decken waren an die Sättel geschnallt, Feldflaschen und Kochtöpfe klapperten. Kein Zweifel, das war ein Kriegskommando.
Von den Gehsteigen riefen ihnen Frauen und ein paar Männer zu: »Geluk hoor! Trefft gut!«, und: »Spoedige terugkoms.«
Die Leute des Kommandos lachten und riefen zurück. Sean beugte sich zu einem hübschen Mädchen hinab. Es hatte die ganze Zeit mit seinem roten Schal gewinkt. Sean gewahrte, daß – obwohl es lächelte – an ihren Wimpern Tränen hingen wie Tau an einem Grashalm.
»Wohin ziehen sie?« fragte Sean laut, um den Lärm zu übertönen.
Das Mädchen hob den Kopf. Dabei löste sich eine Träne, tropfte auf die Wange, lief zum Kinn und wurde zu einem feuchten Fleck auf der Bluse. »Zum Zug natürlich.«
»Zum Zug? Zu welchem Zug?«
»Schauen Sie, hier kommen die Kanonen.«
Konsterniert blickte Sean auf. Zwei Kanonen ratterten heran. Die Kanoniere in blauen Uniformen mit Goldlametta saßen in steifer Habachthaltung auf den Lafetten. Die Pferde stemmten sich ins Geschirr, kämpften mit dem ungeheuren Gewicht der Geschütze. Sean sah große, eisenbeschlagene Räder, leuchtende Bronze auf den Verschlüssen, Rohre in dunklem Grau.
»Mein Gott!« stieß er leise hervor. Er wandte sich wieder dem Mädchen zu, faßte es an der Schulter und schüttelte es erregt. »Wohin ziehen sie? Sagen Sie es mir, rasch – wohin?«
»Menheer!« Das Mädchen, das unter seinem Griff zusammengefahren war, entwand sich ihm.
»Bitte! Entschuldigen Sie – aber Sie müssen es mir sagen«, rief Sean, doch das Mädchen tauchte bereits in der Menge unter.
Eine Minute lang saß er verblüfft im Sattel, dann begann sein Gehirn wieder zu arbeiten.
Es war also Krieg. Aber wo und gegen wen?
Eine Stammeserhebung hätte bestimmt kein solches Aufgebot zur Folge gehabt. Die beiden Kanonen waren die modernsten Waffen, die Sean sich vorstellen konnte. Nein, es mußte ein Krieg der Weißen sein.
Gegen den Oranjefreistaat? Unmöglich, mit dem waren sie verbrüdert.
Also gegen die Briten? Der Gedanke entsetzte Sean. Und dennoch – bereits vor fünf Jahren waren diesbezügliche Gerüchte kursiert. Und es war schon zu Auseinandersetzungen mit den Briten gekommen. Sean dachte an 1895 und den Jameson-Raid, Sir Jamesons Einfall in Transvaal. In den Jahren, in denen Sean von der Zivilisation abgeschnitten gewesen war, konnte soviel geschehen sein. Nun war er in aller Unschuld mitten in das Geschehen getappt.
Rasch überdachte er seine Lage. Er war Brite, unterm Union Jack geboren, wenngleich im afrikanischen Natal. Er sah wie ein Burgher aus, sprach wie einer, ritt wie einer, hatte Afrika nie verlassen. Nichtsdestoweniger war er ebensogut Engländer wie einer, der das Licht der Welt unterm Geläut der Londoner Glocken erblickt hatte.
War jetzt wirklich Krieg zwischen dem Freistaat und Großbritannien – was würden die Buren mit ihm anfangen, wenn sie ihn erwischten?
Bestimmt seine Wagen und sein Elfenbein konfiszieren, ihn selbst vielleicht ins Gefängnis werfen und möglicherweise als Spion erschießen!
»Ich muß hier raus, verdammt noch mal!« murmelte er und sagte zu Mbejane: »Los, komm! Zurück zu den Wagen. Rasch!« Doch noch bevor sie die, Brücke erreichten, änderte Sean seine Meinung. Er wollte erst einmal in Erfahrung bringen, was tatsächlich los war. Es gab in der Stadt einen Menschen, zu dem er gehen konnte, und er mußte das damit verbundene Risiko auf sich nehmen.
»Mbejane, kehre ins Lager zurück. Suche Nkosizana Dirk und sorge dafür, daß er dort bleibt – und wenn du ihn fesseln mußt. Sprich mit niemandem, wenn dir dein Leben lieb ist, und laß Dirk mit niemandem sprechen. Hast du verstanden?«
»Ich habe verstanden, Nkosi.«
Sean, dem Aussehen nach ein Burgher unter Tausenden, kämpfte sich langsam durch die Menschenmenge und das Wagengedränge zum Laden eines Gemischtwarenhändlers am oberen Ende der Stadt, unweit des Bahnhofs.
Seit Sean das Ladenschild zuletzt gesehen hatte, war es neu gemalt worden, in Rot und Gold. »I. Goldberg. Import & Export, Handel in Grubenmaschinen, Einzel- und Großhandel, Einkäufer für: Gold, Edelsteine, Häute und Felle, Elfenbein und Naturprodukte.«
Trotz des Krieges, oder wegen des Krieges, machte Herrn Goldbergs »Warenhaus« gute Geschäfte. Es war voll. Sean schlenderte unbemerkt zwischen den Kunden, suchte ruhig nach dem Inhaber. Als er ihn fand, war Goldberg gerade damit beschäftigt, einen Sack Kaffeebohnen an einen Herrn zu verkaufen, der Bedenken hinsichtlich der Qualität hatte. Die Diskussion über die Vorzüge von Herrn Goldbergs Kaffeebohnen gegenüber jenen seines Konkurrenten auf der anderen Straßenseite war kompliziert und höchst technisch.
Sean lehnte sich an ein Warenregal, stopfte seine Pfeife und zündete sie an. Während er wartete, beobachtete er den agierenden Herrn Goldberg. Der Mann hätte Rechtsanwalt sein können; seine Argumente waren so gewichtig, daß er erst Sean und bald danach auch den Kunden überzeugte. Der letztere bezahlte, legte sich den Sack über die Schulter und verließ brummig den Laden. Herr Goldberg glühte und schwitzte vor Freude über den Erfolg.
»Sie sind nicht dünner geworden, Izzy«, begrüßte ihn Sean.
Goldberg blickte unsicher über seine goldgefaßte Brille, lächelte verbindlich – und erkannte Sean plötzlich. Er blinzelte erschrocken, machte mit dem Kopf eine auffordernde Bewegung, bei der sein Doppelkinn wabbelte, und verschwand im Büro hinter dem Laden. Sean folgte ihm.
»Sind Sie wahnsinnig, Mr. Courtney?« Goldberg zitterte vor Erregung. »Wenn man Sie erwischt ...«
»Hören Sie zu, lzzy. Ich bin gestern abend angekommen. Ich habe seit vier Jahren mit keinem Weißen gesprochen. Was geht hier vor?«
»Haben Sie es nicht gehört?«
»Nein, verdammt noch mal.«
»Es ist Krieg, Mr. Courtney.«
»Das sehe ich. Aber wo? Gegen wen?«
»An allen Grenzen – Natal, der Kapprovinz.«
»Gegen wen?«
»Gegen das Britische Reich.« Goldberg schüttelte den Kopf, als könne er seine eigenen Worte nicht glauben. »Wir nehmen es mit dem ganzen Britischen Reich auf.«
»Wir?« fragte Sean scharf.
»Die Freistaaten Transvaal und Oranje. Wir haben bereits große Siege errungen – Ladysmith ist belagert, Kimberley, Mafeking ...
»Sie? Sie persönlich?«
»Ich bin hier in Pretoria geboren. Ich bin ein Burgher.«
»Werden Sie mich anzeigen?«
»Nein, natürlich nicht. Sie sind seit Jahren ein guter Kunde von mir.«
»Danke, Izzy. Ich muß natürlich so rasch wie möglich hier weg.«
»Das wäre nur klug.«
»Was ist mit meinem Geld in der Volkskaas – kann ich es irgendwie kriegen?«
Izzy schüttelte bekümmert den Kopf. »Man hat alle Feindkonten eingefroren.«
»Verdammt, Herrgott noch mal«, fluchte Sean voll Bitterkeit, dann sagte er: »Izzy, ich habe zwanzig Wagen mit zehn Tonnen Elfenbein am Stadtrand draußen stehen – sind Sie interessiert?«
»Wieviel?«
»Zehntausend für alles; Ochsen, Wagen, Elfenbein – alles Sack und Pack.«
»Es wäre nicht patriotisch, Mr. Courtney«, entgegnete Goldberg zögernd. »Mit dem Feind handeln – außerdem habe ich nur Ihr Wort, daß es wirklich zehn Tonnen sind.«
»Zum Teufel, Izzy, ich bin nicht die britische Armee – das Ganze ist zwanzigtausend Pfund wert.«
»Sie wollen, daß ich die Sachen unbesehen kaufe – ohne Fragen zu stellen? Nun gut. Ich werde Ihnen viertausend geben – in Gold.«
»Sieben.«
»Viereinhalb«, entgegnete Izzy.
»Sie Halsabschneider.«
»Viereinhalb.«
»Nein, verdammt. Fünf!« knurrte Sean.
»Fünf?«
»Fünf!«
»In Ordnung, fünf.«
»Danke, Izzy.«
»Gern geschehen, Mr. Courtney.«
Sean beschrieb ihm eilends den Standort des Lagers. »Sie können jemanden hinschicken und alles holen lassen. Ich breche zur Grenze auf, sobald es dunkel ist.«
»Halten Sie sich von den Straßen und vor allem von der Eisenbahn fern. Joubert hat dreißigtausend Mann in Nordnatal stehen, sie sind um Ladysmith und entlang der Anhöhen am Tugela massiert.« Goldberg trat zum Safe und entnahm ihm fünf kleine Leinensäckchen. »Wollen Sie nachzählen?«
»Ich werde Ihnen genauso trauen wie Sie mir. Auf Wiedersehen, Izzy.« Sean ließ die schweren Säckchen in den Ausschnitt seines Hemdes gleiten und schob sie unter den Gürtel.
»Viel Glück, Mr. Courtney.«
Kapitel 3
Zwei Stunden Tageslicht blieben noch, dachte Sean, während er seinen letzten Diener ausbezahlte. Er schob das kleine Häufchen Sovereigns über die Ladeklappe zu dem Mann hin und vollzog mit ihm das komplizierte Ritual der Verabschiedung, bestehend aus Händeklatschen, Händedrücken, Wiederholung offizieller Sätze. Dann stand er von seinem Stuhl auf und warf einen Blick in die Runde. Seine Leute hockten geduldig da und beobachteten ihn; ihre schwarzen Gesichter waren steinern – dennoch spiegelte sich darin seine eigene Trauer über den Abschied wider. Sean hatte mit diesen Männern gelebt und gearbeitet, hatte hundert Mühen mit ihnen geteilt. Es war nicht leicht, sich jetzt von ihnen zu trennen.
»Es ist zu Ende«, sagte er.
»Yebbo, es ist zu Ende«, pflichteten sie ihm im Chor bei, doch keiner rührte sich von der Stelle.
»Geht, verdammt noch mal.«
Langsam stand einer auf, ergriff das Bündel mit seiner Habe, einem Kaross (Felldecke), zwei Speeren, einem abgelegten Hemd, das Sean ihm gegeben hatte. Er balancierte das Bündel auf dem Kopf und schaute Sean an.
»Nkosi!« sagte er und hob grüßend die geballte Faust.
»Nonga«, antwortete Sean. Der Mann drehte sich um und verließ schleppenden Schrittes das Lager.
»Nkosi!«
»Hlubi.«
»Nkosi!«
»Zama.«
Ein Namensaufruf als nochmaliger Dank für Treue – Sean sprach die Namen seiner Leute zum letzten Mal, und sie verließen nacheinander das Lager. Er stand da und schaute ihnen nach, wie sie in die Dämmerung zogen. Keiner schaute zurück, und keine zwei gingen miteinander.
Müde drehte sich Sean um. Das Lager war klein geworden. Fünf Pferde standen bereit. Drei mit Sätteln und zwei Packtiere.
»Wir essen erst noch, Mbejane.«
»Das Essen ist fertig, Nkosi. Hlubi hat es gekocht, bevor er gegangen ist.«
»Komm, Dirk. Abendessen.«
Dirk war der einzige, der während des Mahls sprach. Er plauderte fröhlich, schien erregt von der Erwartung eines neuen Abenteuers. Sean und Mbejane schaufelten das Stew des dicken Hlubi in sich hinein, ohne viel davon zu schmecken.
In der zunehmenden Dunkelheit bellte ein Schakal; ein einsamer Ton im Abendwind, zur Stimmung eines Mannes passend, der seine Freunde und sein Vermögen verloren hatte.
»Es ist Zeit.« Sean schlüpfte rasch in seine Schaffelljacke und knöpfte sie zu, während er aufstand, um das Feuer auszutreten. Plötzlich erstarrte er und horchte mit geneigtem Kopf. Der Wind trug ein neues Geräusch heran.
»Pferde!« Mbejanes leiser Ausruf bestätigte Seans Wahrnehmung.
»Schnell, Mbejane, mein Gewehr.« Der Zulu sprang auf, lief zu den Pferden und zog Seans Gewehr aus der Sattelscheide.
»Verschwinde aus dem Licht, Dirk, und halt den Mund«, befahl Sean seinem Sohn und schob ihn in den Schatten zwischen den Wagen. Er nahm Mbejane das Gewehr aus der Hand und steckte eine Patrone in den Lauf. Dann duckten sich alle drei und warteten.
Steine rollten unter Hufen, das Laub eines beiseite geschobenen Astes raschelte.
»Nur einer«, flüsterte Mbejane. Ein Packpferd wieherte leise, und sofort kam aus dem Dunkel ein Antwortwiehern. Dann Stille, lange Stille, die schließlich vom Knarren des Zaumzeugs unterbrochen wurde, als der Reiter absaß.
Sean sah ihn nun, eine schlanke Gestalt, die langsam aus der Nacht herankam. Er brachte sein Gewehr in Anschlag. Der Fremde bewegte sich irgendwie ungewöhnlich, graziös, mit einem Schwung aus den Hüften und auf langen Beinen wie ein Fohlen. Sean erkannte, daß er jung war; sehr jung, nach der Größe zu schließen.
Erleichtert richtete sich Sean aus seiner geduckten Stellung auf und musterte den Fremden, der unsicher neben dem Feuer stehengeblieben war und in den Schatten blickte. Der Junge trug eine spitz zulaufende Tuchkappe, die er über die Ohren gezogen hatte, und eine Jacke aus teurem, honigfarbenem Wildleder. Seine Reitbreeches waren hervorragend geschneidert und schmiegten sich eng um sein Gesäß. Sean sagte sich, dieses Gesäß sei zu groß und nicht in Proportionen mit den kleinen, in polierten englischen Jagdstiefeln steckenden Füßen. Ein richtiger Dandy. Aus Seans Stimme klang Verachtung, als er rief: »Bleiben Sie, wo Sie sind, mein Freund, und nennen Sie Ihr Begehren!«
Seans Anruf hatte eine unerwartete Wirkung. Der Junge sprang in die Höhe, die Sohlen seiner glänzenden Stiefel lösten sich ein gutes Stück vom Boden, und als er wieder landete, blickte er in Seans Richtung.
»Reden Sie. Ich habe nicht die ganze Nacht Zeit.«
Der Junge öffnete den Mund, schloß ihn wieder, fuhr sich mit der Zunge über die Lippen und sprach dann:
»Man hat mir gesagt, daß Sie nach Natal reiten.« Die Stimme war leise und rauh.
»Wer hat Ihnen das gesagt?« fragte Sean.
»Mein Onkel.«
»Wer ist Ihr Onkel?«
»Isaac Goldberg.«
Sean überdachte diese Mitteilung und betrachtete dabei das Gesicht des Jungen. Glattrasiert, blaß, große dunkle Augen und ein Mund, der gern lachte, jetzt aber vor Angst verzogen war.
»Und wenn ich wirklich nach Natal reite?« fragte Sean.
»Dann möchte ich mit Ihnen reiten.«
»Vergessen Sie’s. Steigen Sie auf Ihr Pferd und reiten Sie nach Hause.«
»Ich werde Sie bezahlen – gut bezahlen.«
Ist es die Stimme oder die Haltung, überlegte Sean. Irgend etwas an dem Jungen mutete seltsam an. Der Junge stand da, hielt eine flache Ledertasche mit beiden Händen vor die Hüften – in einer Verteidigungshaltung. Als schütze er – schütze er was? Plötzlich wußte Sean Bescheid.
»Nehmen Sie Ihre Kappe ab«, befahl er.
»Nein.«
»Nehmen Sie sie ab.«
Der Junge zögerte noch eine Sekunde, riß dann mit einer fast verächtlichen Geste die Kappe herunter, und zwei dicke schwarze Zöpfe, die im Feuerschein glänzten, entrollten sich, fast bis zur Hüfte, und verwandelten den geckenhaften jungen Mann unversehens in ein Mädchen von atemberaubender Weiblichkeit.
Trotz seiner Ahnung war Sean auf eine solche Enthüllung nicht vorbereitet. Nicht die Schönheit, sondern die Aufmachung der jungen Dame versetzte ihm einen Schock. Sean hatte noch nie eine Frau in Breeches gesehen, er sog tief die Luft ein. Breeches, bei Gott, sie hätte genausogut von der Taille abwärts nackt sein können – sogar das wäre weniger unanständig gewesen.
»Zweihundert Pfund...« Sie kam auf ihn zu, streckte ihm die Tasche hin. Bei jedem Schritt spannte sich das Tuch der Breeches um die Hüften. Sean wandte schuldbewußt den Blick ab und schaute ihr wieder ins Gesicht.
»Behalten Sie Ihr Geld, meine Dame.« Ihre Augen waren grau, rauchgrau.
»Zweihundert als Akontozahlung und noch einmal genausoviel, wenn wir in Natal anlangen.«
»Kein Interesse.« Doch das stimmte nicht. Die weichen Lippen begannen zu zittern.
»Wieviel dann? Nennen Sie Ihren Preis.«
»Schauen Sie, meine Dame, ich führe hier keine Prozession an. Wir sind bereits drei – darunter ein Kind. Uns steht ein harter Ritt bevor, ein langer Ritt, und eine Burenarmee befindet sich zwischen hier und unserem Ziel. Unsere Chancen sind ohnehin schon gering genug. Einer mehr, noch dazu eine Frau, würde sie auf Null reduzieren. Ich will Ihr Geld nicht, ich will nur eines, nämlich meinen Sohn in Sicherheit bringen. Reiten Sie nach Hause und warten Sie das Ende des Krieges ab – er wird nicht lange dauern.«
»Ich reite nach Natal.«
»Gut. Dann reiten Sie – aber nicht mit uns.« Seans Widerstand gegen das Flehen der grauen Augen schmolz bedenklich, darum drehte er sich zu Mbejane um. »Die Pferde«, befahl er knapp und ging von der jungen Dame weg. Sie sah ruhig zu, wie die drei aufsaßen, erhob keine Einwände. Sie wirkte sehr klein und allein, als Sean aus dem Sattel auf sie hinunterschaute.
»Es tut mir leid«, brummte er. »Kehren Sie nach Hause zurück, seien Sie ein gutes Mädchen.« Rasch wendete er sein Pferd und trabte los.
Sie ritten die ganze Nacht, ritten ostwärts durch offenes, im Mondschein liegendes Gelände. Einmal passierten sie ein dunkles Gehöft, und ein Hund schlug an. Da beschrieben sie einen Bogen und wandten sich später wieder nach Osten; sie achteten darauf, daß das große Kreuz des Südens zu ihrer Rechten stand. Als Dirk im Sattel einschlief und zur Seite rutschte, zog Sean ihn auf seinen Schoß und hielt ihn die restliche Nacht in den Armen.
Vor Tagesanbruch gelangten sie zu einem Buschdickicht am Ufer eines Flusses; sie hobbelten die Pferde an und schlugen das Lager auf. Mbejane hatte den Feldkessel über einem kleinen, gut abgeschirmten Feuer zum Kochen gebracht, und Sean hatte den fest schlafenden Dirk in seine Decken gewickelt, als das Mädchen ins Lager ritt und vom Pferd sprang.
»Zweimal hätte ich Sie beinahe verloren.« Sie lachte und zog die Kappe vom Kopf. »Hat mir entsetzliche Angst eingejagt.« Sie schüttelte die glänzenden Zöpfe. »Kaffee! Oh, gut. Ich bin am Verschmachten.«
Sean rappelte sich drohend auf die Beine und starrte sie mit geballten Fäusten an, aber sie hobbelte gelassen ihr Pferd an und ließ es laufen, bevor sie sich wieder ihm zuwandte.
»Stehen Sie doch nicht so förmlich, bitte setzen Sie sich.« Das Mädchen grinste ihn mit solchem Schalk in den grauen Augen an und ahmte, die Hände auf den unanständigen Hüften, so getreu seine Pose nach, daß Sean lächeln mußte. Er versuchte das Lächeln zu unterdrücken, denn er wußte, es war ein Eingeständnis seiner Kapitulation. Doch seine Bemühungen scheiterten so kläglich, daß das Mädchen in entzücktes Lachen ausbrach.
»Wie steht es mit Ihren Kochkenntnissen?« fragte er.
»Sosolala.«
»Dann polieren Sie sie lieber auf, denn ab sofort werden Sie die Reise abverdienen.«
Später, als er das erste von ihr bereitete Essen gekostet hatte, gab er knurrend zu:
»Nicht schlecht – unter den gegebenen Umständen.« Er wischte den Teller mit einem Kanten Brot aus.
»Zu gütig, der Herr«, dankte sie, trug ihre Deckenrolle in den Schatten, schlug sie auseinander, zog die Stiefel aus, bewegte genüßlich die Zehen und legte sich mit einem Seufzer hin.
Sean platzierte seine Decken so, daß er, wenn er die Augen öffnete, das Mädchen unter dem Hut hervor beobachten konnte, ohne den Kopf drehen zu müssen.
Er erwachte mittags und sah, daß das Mädchen mit der Wange in der offenen Hand schlief; ihre Wimpern waren dicht zusammengepreßt, und ein paar Strähnen des dunklen Haars hatten sich übers Gesicht gelegt, das von der drückenden Hitze feucht und gerötet war. Als er zum Fluß hinabging, hatte er seine flache leinene Toilettentasche unterm Arm, das letzte Paar Breeches, das weder geflickt noch verschmutzt war, und sein sauberes Seidenhemd in der Hand.
Auf einem Stein am Wasser hockend, nackt und frisch geschrubbt, betrachtete er sein Gesicht in einem Spiegel aus poliertem Stahl.
»Ein gewaltiges Unternehmen«, seufzte er und begann an dem struppigen Bart zu schnipseln, der seit drei Jahren keine Schere mehr gesehen hatte.
Bei Einbruch der Dämmerung kehrte Sean ins Lager zurück, verlegen wie ein Mädchen im ersten Ballkleid. Alle waren nun wach. Dirk und die junge Dame saßen nebeneinander auf ihrer Decke und waren in ein so ernstes Gespräch vertieft, daß keiner sein Eintreffen bemerkte. Mbejane werkelte am Feuer; er hockte sich auf die Fersen zurück und musterte Sean, ohne eine Miene zu verziehen.
»Wir sollten lieber essen und uns auf die Beine machen.«
Dirk und die junge Dame schauten auf. Die Augen des Mädchens zogen sich zusammen und weiteten sich dann nachdenklich.
Dirk starrte ihn mit offenem Mund an und stellte dann fest: »Dein Bart ist so komisch...« Das Mädchen kämpfte verzweifelt gegen das Lachen.
»Roll deine Decken zusammen, los, Junge.«
Sean versuchte Dirk vom Thema abzulenken, doch Dirk hielt daran fest wie eine Bulldogge an ihrer Beute. »Und warum trägst du deine besten Kleider, Dad?«
Kapitel 4
Sie ritten zu dritt nebeneinander, Dirk in der Mitte, und Mbejane folgte mit den Packpferden. Das Land stieg an und senkte sich wie die Dünungswogen eines endlosen Meeres; und die Art, wie sich das Gras im Nachtwind bewegte, steigerte noch die Illusion, durch Wellen zu reiten. Die dunklen Massen der Kopjes, an denen sie vorbeikamen, waren Inseln im Meer, und das Bellen eines Schakals war der Schrei eines Seevogels.
»Halten wir uns nicht zu weit nach Osten?« Mit dieser Frage zerbrach das Mädchen die Stille, der Ton ihrer Stimme verklang im leisen Rauschen des Windes.
»Das ist Absicht«, antwortete Sean. »Ich will die Ausläufer der Drakensberge in sicherem Abstand von den Burenkonzentrationen um Ladysmith und von der Eisenbahnlinie überqueren.« Er sah sie über Dirks Kopf an. Sie hatte das Gesicht zum Himmel gehoben.
»Kennen Sie die Sterne?« fragte er.
»Ein wenig.«
»Ich auch. Ich kenne alle.« Dirk fühlte sich herausgefordert und drehte den Kopf nach Süden. »Das ist das Kreuz mit den Zeigern, und das ist der Orion mit dem Schwert um den Leib, und das da ist die Milchstraße.«
»Nenne mir noch einige andere«, forderte das Mädchen ihn auf.
»Die anderen sind nur so gewöhnliche – die zählen nicht. Sie haben nicht mal Namen.«
»O doch, sie haben Namen, und mit den meisten ist eine Geschichte verbunden.«
Dirk schwieg. Er befand sich in der Zwickmühle: Entweder mußte er seine Unwissenheit zugeben, und das fiel ihm bei seinem Stolz nicht leicht, oder er mußte auf die Geschichten verzichten, auf eine ganze Reihe, wie es schien. Sein Stolz war groß, aber noch größer war sein Appetit auf Geschichten. Er gab sich geschlagen: »Erzählen Sie mir ein paar.«
»Siehst du die kleine Ansammlung dort unter dem großen hellen? Diese Sterne heißen Siebengestirn. Hm, es war einmal...«
Nach wenigen Minuten war Dirk völlig gefangen. Die Geschichten übertrafen sogar jene Mbejanes – vermutlich weil er sie zum ersten Mal hörte, während er Mbejanes ganzes Repertoire längst auswendig kannte. Unnachsichtig wie ein Staatsanwalt, stürzte er sich auf jeden schwachen Punkt der Handlung.
»Aber warum haben sie die alte Hexe nicht einfach erschossen?«
»Damals gab es noch keine Gewehre.«
»Sie hätten Pfeil und Bogen nehmen können.«
»Mit Pfeil und Bogen kann man eine Hexe nicht töten. Der Pfeil geht einfach so – ssst – durch sie hindurch, ohne sie zu verletzen.«
»Hol’s der Henker!« Das war wirklich beeindruckend, aber bevor Dirk es akzeptierte, mußte er sich bei einem Experten Gewißheit holen. Er fragte Mbejane, übersetzte dem Zulu das Problem. Als Mbejane dem Mädchen recht gab, war Dirk überzeugt, denn Mbejane galt als unangefochtene Autorität für das Übernatürliche.
In dieser Nacht schlief Dirk nicht im Sattel ein, und als sie beim ersten Morgengrauen lagerten, war das Mädchen heiser vor Überanstrengung, aber sie hatte Dirk vollständig und Sean weitgehend erobert.
Die ganze Nacht, während Sean ihrer Stimme und dem immer wieder aufklingenden leisen Lachen gelauscht hatte, war ihm gewesen, als treibe das Samenkorn, das die erste Begegnung mit dem Mädchen in ihn gesenkt hatte, Wurzeln in seinen Leib und seine Lenden und Schößlinge durch seine Brust. Er begehrte diese Frau so heftig, daß ihn in ihrer Gegenwart schier der Verstand verließ. Immer wieder hatte er in der Nacht versucht, sich am Gespräch zu beteiligen, doch jedesmal hatte Dirk ihn mit einer ungeduldigen Geste ausgeschaltet und sich wieder begierig dem Mädchen zugewandt. Am Morgen dann hatte Sean die beunruhigende Feststellung gemacht, daß er auf seinen Sohn eifersüchtig war – eifersüchtig auf die Aufmerksamkeit, die Dirk erhielt und nach der er selbst so hungerte.
Beim Kaffee nach der Morgenmahlzeit, den sie unter einer Gruppe Pfeifensträucher tranken, gemütlich auf ihre Decken ausgestreckt, sagte Sean: »Sie haben uns Ihren Namen noch nicht genannt.«
Natürlich antwortete Dirk: »Mir hat sie ihn genannt. Ruth heißen Sie – nicht wahr?«
»Richtig, Dirk.«
Mit einiger Mühe bezwang Sean den sinnlosen Zorn, der in ihm aufstieg: doch als er sprach, klang ein Rest davon in seiner Stimme nach: »Wir haben für diese Nacht genug von dir gehört, mein Junge. Leg dich jetzt hin, mach die Augen und den Mund zu und laß sie zu.«
»Ich bin nicht müde, Dad.«
»Tu, was ich dir sage.« Sean sprang auf und ging mit langen Schritten aus dem Lager. Er bestieg den kleinen Kopje neben dem Gebüsch. Mittlerweile war es ganz hell; Sean suchte das Veld rundum bis zum Horizont ab. Keine Spur von einer Behausung oder von Menschen. Er stieg wieder hinab und prüfte die Fesseln der Pferde, bevor er zu den Pfeifensträuchern zurückkehrte.
Trotz seines Protestes schlief Dirk, zusammengerollt wie ein kleiner Welpe; und vom Feuer, aus einem großen Deckenbündel, drang das unverkennbare Schnarchen Mbejanes. Ruth lag ein Stückchen abseits, eine Decke über den Beinen, die Augen geschlossen. Ihr Hemd hob und senkte sich und gab Sean zwei gute Gründe, nicht zu schlafen. Er stützte sich auf den Ellbogen, weidete seine Augen an dem Mädchen und ließ seine Phantasie spielen.
In den letzten vier Jahren hatte er keine weiße Frau gesehen, vier Jahre ohne den Klang einer Frauenstimme oder den Trost eines Frauenkörpers. Anfangs hatte es ihm zu schaffen gemacht – die Rastlosigkeit, die grundlosen Anfälle von Depression und die plötzlichen Wutausbrüche. Doch in den langen Tagen des Jagens und Reitens, in dem endlosen Kampf gegen Dürre und Sturm, wilde Tiere und die Elemente hatte er seinen Körper nach und nach unter Kontrolle gebracht. Die Frauen waren zu etwas Unwirklichem geworden, zu undeutlichen Phantomen, die ihn nur nachts quälten, so daß er sich herumwälzte, schwitzte und im Schlaf schrie, bis die Natur ihm Erleichterung verschaffte und die Phantome sich für eine Weile verzogen, um Kraft zur nächsten Heimsuchung zu sammeln.
Doch was jetzt da neben ihm lag, das war kein Phantom. Wenn er die Hand ausstreckte, konnte er den zarten Flaum auf Ruths Wange streicheln und die blutwarme, seidige Haut spüren.
Ruth öffnete die Augen, sie waren milchig grau vom Schlaf; ihr Blick konzentrierte sich langsam, bis er seinen traf, und sie musterte ihn genauso prüfend wie er sie.
Was sie in seinen Augen las, bewog sie, die linke Hand von der Decke zu heben und ihm hinzustrecken. Sie hatte die Reithandschuhe ausgezogen. Zum ersten Mal bemerkte Sean den schmalen Goldring an ihrem Mittelfinger.
»Verstehe«, murmelte er düster, dann fügte er protestierend hinzu: »Aber Sie sind zu jung – zu jung, um verheiratet zu sein.«
»Ich bin zweiundzwanzig«, erklärte sie leise.
»Ihr Mann – wo ist er?« Vielleicht war der Kerl tot. Seine einzige, letzte Hoffnung.
»Ich bin zu ihm unterwegs. Als der Krieg unvermeidlich schien, ist er nach Natal gereist, nach Durban, um dort Arbeit und ein Haus für uns zu suchen. Ich wollte nachkommen – aber der Krieg brach früher aus, als wir erwartet hatten. Ich saß fest.«
»Verstehe.« Ich bringe sie einem anderen Mann, dachte Sean voll Bitterkeit, sprach es jedoch nicht aus, sondern sagte: »Ihr Mann sitzt also seelenruhig in Durban und wartet darauf, daß Sie sich allein durch die Linien schlagen.«
»Er ist bei der Natal-Armee. Vor einer Woche hat er eine Nachricht an mich durchbekommen. Er wollte, daß ich in Johannesburg bleibe und warte, bis die Briten die Stadt eingenommen haben. Er meint, bei einer so großen Streitmacht seien sie in drei Monaten in Johannesburg.«
»Warum haben Sie dann nicht gewartet?«
Ruth zuckte die Achseln. »Geduld gehört nicht zu meinen Tugenden.« Wieder blitzte der Schalk in ihren Augen. »Außerdem dachte ich, es wurde Spaß machen, davonzulaufen – in Johannesburg war es so schrecklich langweilig.«
»Lieben Sie ihn?« fragte er unvermittelt. Die Frage überraschte sie, und das Lächeln erstarb auf ihren Lippen.
»Er ist mein Mann.«
»Das beantwortet meine Frage nicht.«
»Sie haben kein Recht zu dieser Frage.« Ruth war jetzt zornig.
»Sie müssen es mir sagen.«
»Lieben Sie Ihre Frau?« fauchte sie.
»Ich habe sie geliebt, sie ist seit fünf Jahren tot.«
Ruths Zorn erlosch genauso schnell, wie er aufgelodert war. »Oh, verzeihen Sie. Das habe ich nicht gewußt.«
»Vergessen Sie es. Vergessen Sie, daß ich die Frage gestellt habe.«
»Ja, das ist das beste. Wir geraten sonst in schreckliche Verwicklungen.« Ihre Hand mit dem Ring lag zwischen ihnen auf dem weichen Teppich abgefallenen Laubs. Sean ergriff sie. Es war eine kleine Hand.
»Mr. Courtney – Sean, es ist das beste, wenn ... Wir dürfen nicht... Ich denke, wir sollten jetzt lieber schlafen.« Ruth entzog ihm ihre Hand und drehte ihm den Rücken zu.
Der Wind weckte die vier Menschen mitten am Nachmittag: er wehte tosend aus Osten, legte das Gras auf den Hügeln flach und peitschte die Zweige über ihren Köpfen.
Sean war aufgestanden und blickte zum Himmel, der Wind ließ sein Hemd flattern und riß an seinem Bart. Er stemmte sich dagegen an, beugte sich dabei halb über Ruth, und ihr kam plötzlich zu Bewußtsein, wie groß er war. Er sah aus wie ein Gewittergott, hatte die langen, kräftigen Beine gespreizt, und die starken Muskeln seiner Brust und seiner Arme zeichneten sich durch die weiße Seide des Hemdes ab.
»Wolken bilden sich«, rief Sean durch das Tosen, »Kein Mond heute nacht.«
Ruth erhob sich rasch, eine plötzliche Bö erfaßte sie und brachte sie aus dem Gleichgewicht. Sie taumelte gegen Sean, und seine Arme schlossen sich um sie. Einen Moment lang drückte er sie an sich, sie spürte den schlanken, elastischen Körper und nahm dessen männlichen Geruch wahr. Der enge Kontakt war für beide ein Schock, und als Ruth sich von Sean löste, waren ihre Augen groß und grau aus Angst vor dem, was sich in ihr regte. »Es tut mir leid«, sagte sie leise. »War ein Versehen.« Der Wind erfaßte ihr Haar, wehte es ihr in einem tanzenden, schlängelnden Gewirr ums Gesicht.
»Wir werden satteln und reiten, solange es noch hell ist«, entschied Sean. »Heute nacht können wir uns bestimmt nicht von der Stelle bewegen.«
Der Wind trieb die Wolken heran, sie dehnten sich aus, veränderten die Form und sanken näher zur Erde. Es waren Wolken mit der Farbe von Rauch und von Blutergüssen, schwer vom Regen, den sie trugen.
Der Abend brach früh an, doch der Wind toste unvermindert, hieb in dem Zwielicht auf die vier Reiter ein.
»In etwa einer Stunde wird er abflauen, dann wird der Regen einsetzen. Wir müssen versuchen, einen Unterschlupf zu finden, solange es noch hell genug ist.«
Auf der windabgelegenen Seite eines Kopjes fanden sie einen Felsenüberhang; sie luden die Packpferde ab und verstauten die Sachen in der Nische darunter. Während Sean die Pferde an langen Seilen anpflockte, damit sie im Sturm nicht davonliefen, schnitt Mbejane Gras und stapelte es auf dem Felsboden unter dem Überhang zu einer Matratze. In ihr Ölzeug gehüllt, aßen sie Biltongue, bukaniertes Fleisch, und kaltes Maisbrot, dann zog sich Mbejane zum anderen Ende des Unterschlupfs zurück und verschwand unter seinen Decken. Er hatte die Fähigkeit, wie ein Tier sofort einzuschlafen, sogar unter den widrigsten Umständen.
»Los, mein Junge. Kriech in deine Decken.«
»Kann ich nicht...«, begann Dirk wie vor jedem Schlafengehen zu protestieren.
»Nein, du kannst nicht.«
»Ich werde dir etwas vorsingen«, erbot sich Ruth.
»Wozu?« fragte Dirk erstaunt.
»Ein Schlaflied – hast du noch nie eines gehört?«
»Nein.« Dirk war neugierig. »Was werden Sie singen?«
»Erst in die Decken mit dir.«
Neben Sean in der Dunkelheit sitzend und sich der Berührung seiner Schulter nur allzu bewußt, sang Ruth, das gedämpfte Tosen des Windes als Begleitung.
Zuerst sang sie die alten holländischen Volkslieder »Nooi, Nooi« und »Jannie met die Hoepel been«, dann andere alte, beliebte Lieder wie »Frère Jacques«. Ihre Stimme bedeutete jedem ihrer drei Gefährten etwas.
Mbejane wachte von dem Singen auf und mußte an den Wind auf den Hügeln des Zululandes denken und an die jungen Mädchen, die bei der Ernte auf den Feldern sangen. Freude stieg in ihm auf, daß es nach Hause ging.
Für Dirk war es die Stimme der Mutter, die er kaum gekannt hatte. Eine Stimme, die Sicherheit bedeutete – und ihn bald einschläferte.
»Nicht aufhören«, flüsterte Sean.
Also sang Ruth für ihn allein. Ein zweitausend Jahre altes Liebeslied, aus dem die ganzen Leiden ihres Volkes klangen, aber auch die Freuden. Der Wind flaute ab, während sie sang, und ihre Stimme klang in die endlose Stille der Nacht hinaus.
Plötzlich brach das Gewitter los. Der erste Donner krachte, Blitze zuckten blau durch die Wolken. Dirk wimmerte ein wenig, schlief aber weiter.
In dem grellen blauen Licht sah Sean, daß Ruths Wangen naß von Tränen waren; und als die Dunkelheit sich wieder über die Nische legte, spürte er, daß Ruth neben ihm zu zittern begann. Er streckte den Arm aus, und sie klammerte sich an ihn, lag klein und warm an seiner Brust, und er schmeckte das Salz ihrer Tränen auf seinen Lippen.
»Sean, wir dürfen das nicht.«
Doch er hob sie auf und ging hinaus in die Nacht. Wieder zuckte ein Blitz und tauchte das Land in verblüffende Helle; Sean konnte die Pferde sehen, die sich mit gesenkten Köpfen zusammendrängten, und er gewahrte über sich die scharfe Gratlinie des Kopjes.
Die ersten Regentropfen klatschten ihm auf die Schultern und ins Gesicht. Der Regen war warm, und er schritt weiter, Ruth auf den Armen. Dann war die Luft vom Regen erfüllt, von perlfarbenem Dunst, der beim nächsten Blitz alles verhüllte. Der Geruch nach Regen auf trockener Erde erfüllte die Nacht – ein sauberer, warmer Geruch.
Kapitel 5
In dem stillen Morgen, der vom Regen so saubergewaschen war, daß man am südlichen Horizont die Berge blau und scharf sah, standen Ruth und Sean auf dem Kamm des Kopjes.
»Das sind die Ausläufer der Drakensberge, wir sind gut zwanzig Meilen davon entfernt. Kaum wahrscheinlich, daß eine Burenpatrouille so weit herauskommt. Wir können jetzt am Tage reiten. Bald werden wir unseren Bogen vollendet haben und können uns hinter den Kampflinien wieder der Eisenbahn nähern.«
Die Schönheit des Morgens und des Landes, das sanft in die große Grassenke Natals abfiel, und die Frau an seiner Seite stimmten Sean heiter.
Die Aussicht auf das Ende einer Reise und den Beginn einer neuen mit dieser Frau als Gefährtin stimmte ihn zufrieden.
Als er sprach, wandte Ruth langsam den Kopf und schaute zu ihm auf, sie hob das Kinn, denn er war viel größer als sie. Erst jetzt bemerkte Sean, daß sich seine Stimmung nicht in ihren Augen spiegelte.
»Du bist so schön«, sagte er. Sie blieb stumm, und nun erkannte er, daß die Schatten in ihren Augen Trauer oder etwas noch Stärkeres waren.
»Ruth, du bleibst doch bei mir?«
»Nein.« Sie schüttelte langsam, betrübt den Kopf. Die dicke schwarze Zopfschlange rollte über ihre Schulter, legte sich auf ihre honigfarbene Wildlederjacke.
»Du mußt.«
»Ich kann nicht.«
»Aber heute nacht...«
»Das heute nacht war Wahnsinn – das Gewitter.«
»Es war richtig. Das weißt du.«
»Nein. Es war das Gewitter.« Sie schaute von ihm weg zum Himmel. »Und jetzt ist das Gewitter vorbei.«
»Es war nicht nur das Gewitter. Das weißt du. Es war vom ersten Augenblick unseres Zusammentreffens da.«
»Es war ein Wahnsinn, der auf Betrug basiert. Etwas, das ich mit Lügen werde zudecken müssen – wie wir es heute nacht mit Dunkelheit zudecken mußten.«
»Ruth. Mein Gott, sprich nicht so darüber.«
»Gut, dann nicht. Ich werde nicht mehr darüber sprechen, nie mehr.«
»Wir können das nicht aufgeben. Du weißt, daß wir es nicht können.«
Als Antwort hielt sie ihm die linke Hand hin, und das Gold blitzte in der Sonne. »Wir werden einander hier Lebewohl sagen, auf einem Hügel im Sonnenschein. Obwohl wir noch ein Stück zusammen reiten – werden wir uns hier Lebewohl sagen.«
»Ruth...«, begann er, aber sie legte ihm die Hand auf den Mund; er spürte das Metall des Ringes auf den Lippen, und es dünkte ihn so kalt wie seine Angst vor dem Verlust, den Ruth ihm zufügen wollte.
»Nein«, flüsterte sie. »Küß mich noch einmal, und dann laß mich los.«
Kapitel 6
Mbejane gewahrte es als erster und machte Sean leise darauf aufmerksam. Vielleicht zwei Meilen entfernt stieg an ihrer Flanke über einem Einschnitt im nächstgelegenen Hügel brauner Dunst empor wie Rauch. Man sah ihn kaum, so daß Sean einen Moment suchen mußte, bevor er ihn entdeckte. Dann riß er sein Pferd herum und galoppierte wie ein Wilder auf die erstbeste Deckung zu, einen Felsbrocken aus rotem Stein. Er war rund eine halbe Meile entfernt, viel zu weit.
»Was ist los, Sean?« Ruth wollte den Grund seiner Erregung wissen.
»Staub«, erklärte er ihr. »Reiter. Sie kommen hierher.«
»Buren?«
»Vermutlich.«
»Und was machen wir?«
»Nichts.«
»Nichts?«
»Wenn sie über den Hügelkamm kommen, reite ich ihnen entgegen. Will versuchen, uns durch einen Bluff vorbeizukriegen.« Er sagte auf Zulu zu Mbejane: »Ich reite zu ihnen. Beobachte mich genau, aber bewegt euch weiter weg. Wenn ich den Arm hebe, laß die Packpferde laufen und reitet, was das Zeug hält. Ich werde sie aufhalten, so lange ich kann, aber wenn ich den Arm hebe, ist es aus.« Rasch schnallte er die Satteltasche los, die das Gold enthielt, und reichte sie dem Zulu. »Bei einem guten Vorsprung sollte es euch gelingen, sie euch bis zum Einbruch der Nacht vom Hals zu halten. Bring die Nkosikazi hin, wohin sie will, und kehre dann mit Dirk zu meiner Mutter nach Ladyburg zurück.«
Sean schaute wieder zu der Anhöhe, gerade rechtzeitig, um zwei Reiter auftauchen zu sehen. Er hob den Feldstecher, den er um den Hals trug, an die Augen; in der runden Glasscheibe standen die beiden Reiter mit der Breitseite zu ihm da, die Gesichter ihm zugekehrt, so daß er die Form ihrer Helme auszumachen vermochte. Er sah die blankpolierte Ausrüstung, die Größe der Pferde und das charakteristische Sattelzeug, und schrie vor Erleichterung auf.
»Soldaten!«
Wie zur Bestätigung erschien eine Kavallerieschwadron in zwei ordentlichen Reihen über dem Kamm, die Fähnchen flatterten fröhlich auf dem Wald ihrer Lanzen.
Neben sich den vor Erregung johlenden Dirk und die lachende Ruth, hinter sich Mbejane mit den Packpferden, jagte Sean los. In den Steigbügeln stehend, galoppierte er auf die Soldaten zu und schwenkte den Hut überm Kopf.
Ungerührt von der begeisterten Begrüßung, blickten die Kavalleristen auf ihren Pferden den Ankömmlingen entgegen, und der Subalternoffizier an der Kolonnenspitze grüßte Sean mißtrauisch, als dieser bei ihm anlangte: »Wer sind Sie, Sir?«
Doch an Seans Antwort schien er viel weniger interessiert als an Ruths Breeches und deren Inhalt. Während Sean die nötigen Erklärungen gab, empfand er zunehmende Abneigung gegenüber dem Mann. Die glatte, von der Sonne gerötete Haut und der flaumige, gelbliche Schnurrbart berührten Sean unangenehm, doch der Hauptgrund für seine Abneigung waren die blaßblauen Augen. Vielleicht standen sie immer so vor, aber Sean bezweifelte es. Sie richteten sich nur kurz auf Sean, als er berichtete, daß er keine Berührung mit Buren gehabt habe, dann kehrten sie sofort zu Ruth zurück.
»Wir wollen Sie nicht länger aufhalten, Herr Oberleutnant«, brummte Sean und zog die Zügel an.
»Sie sind noch zehn Meilen vom Tugela River entfernt, Mr. Courtney, und theoretisch ist dieses Gebiet in der Hand der Buren. Wir befinden uns zwar weit außerhalb der Flanke ihres Hauptheeres, aber es wäre sicherer, wenn Sie unter unserem Schutz zu den britischen Linien ritten.«
»Haben Sie vielen Dank. Nein. Ich möchte beiden Heeren ausweichen und so schnell wie möglich nach Pietermaritzburg.«
Der Oberleutnant zuckte die Achseln. »Wie Sie wollen. Aber wenn das meine Frau und mein Kind wären...« Er vollendete den Satz nicht, sondern drehte sich im Sattel nach hinten, um der Kolonne das Zeichen zum Weiterreiten zu geben.
»Komm, Ruth.« Sean suchte ihren Blick, aber sie rührte sich nicht.
»Ich reite nicht mit dir.« Ihre Stimme war fast tonlos, und sie schaute von ihm weg.
»Sei nicht dumm.« Der Schock über ihre Worte ließen seine Antwort schroff klingen, und in Ruths Augen loderte Zorn auf.
»Kann ich mit Ihnen reiten?« fragte sie den Oberleutnant.
»Hm, Madam.« Er zögerte, warf einen raschen Blick auf Sean, bevor er fortfuhr: »Wenn Ihr Mann...«
»Er ist nicht mein Mann. Ich kenne ihn kaum«, unterbrach sie den Oberleutnant. Sie ignorierte Seans Protestruf. »Mein Mann ist in Ihrer Armee. Ich möchte, daß Sie mich mitnehmen, bitte.«
»Ja, dann...! Das ist natürlich etwas anderes«, sagte der Oberleutnant schleppend, doch die träge Arroganz seines Tonfalls verbarg kaum seine Freude über die Aussicht, Ruths Gesellschaft genießen zu können. »Ich wäre entzückt, Sie geleiten zu dürfen, Madam.«
Mit den Knien dirigierte Ruth ihr Pferd neben jenes des Oberleutnants. Dieses kleine Manöver brachte sie Sean gegenüber – als befinde sie sich auf der anderen Seite einer Barriere.
»Ruth, bitte. Laß uns darüber sprechen. Nur ein paar Minuten.«
»Nein.« Ihre Stimme und ihr Gesicht waren ausdruckslos.
»Nur, um uns Lebewohl zu sagen«, flehte er.
»Wir haben uns schon Lebewohl gesagt.« Sie blickte von Sean zu Dirk und dann in die Ferne.
Der Oberleutnant reckte die geballte Faust und hob die Stimme: »Kolonne vorwärts, marsch!« Als sein großes, glänzendes Jagdpferd sich in Bewegung setzte, grinste er Sean boshaft an und tippte in einem ironischen Gruß an den Rand seines Helms.
»Ruth!«
Doch Ruth sah Sean nicht an. Ihr Blick war nach vorn gerichtet, und sie ritt an der Spitze der Kolonne davon, das Kinn gereckt und den Mund, der so gern lachte, zu einem schmalen Strich zusammengepreßt. Der dicke schwarze Zopf sprang bei jedem Schritt des Pferdes von ihrem Rücken.
»Pech gehabt, Kamerad«, rief ein Reiter aus der hinteren Reihe, dann war die Kolonne vorbei.
Im Sattel zusammengesunken, starrte Sean hinterher.
»Kommt sie wieder, Pa?« fragte Dirk.
»Nein, sie kommt nicht wieder.«
»Warum nicht?«
Sean hörte die Frage nicht. Er wartete darauf, daß Ruth zu ihm zurückschaue. Aber er wartete vergebens. Plötzlich verschwand Ruth in der nächsten Senke, und wenige Sekunden später war die ganze Kolonne weg. Nichts war mehr da als die weite Leere des Landes und des Himmels oben – eine endlose Leere wie in Seans Innerem.
Kapitel 7
Sean ritt voraus, zehn Meter dahinter folgten Mbejane und Dirk. Der Zulu hielt den Jungen zurück, denn er wußte, daß man Sean jetzt in Ruhe lassen mußte. In den Jahren ihres Beisammenseins waren die beiden Männer oft in dieser Formation geritten – Sean voraus, erfüllt von seinem Leid oder seiner Scham, und Mbejane geduldig hinterher, darauf wartend, daß Seans Schultern sich strafften und sein Kinn sich von der Brust hob.
Seans Gedanken hatten keinen Zusammenhang, einzig das wechselweise Auf und Ab von Wut und Verzweiflung erfolgte nach einer Art Schema.
Wut auf die Frau, Wut, die fast zum Haß wurde, bevor die Verzweiflung Sean überfiel, wenn er daran dachte, daß Ruth fort war. Dann wuchs wieder langsam die Wut bis zum Wahnsinn, Wut auf sich selbst, weil er Ruth hatte gehen lassen. Und erneut der schmerzliche Sturz in die Verzweiflung, als er erkannte, daß es kein Mittel gegeben hätte, Ruth zu halten. Was hätte er ihr schon bieten können? Sich selbst? Knapp hundert Kilo Muskeln, Knochen und Narben, dazu ein Gesicht wie eine Granitklippe? Nicht viel wert! Seine weltlichen Güter? Ein Säckchen voll Sovereigns und das Kind einer anderen Frau – bei Gott, das war alles, was er besaß. Nach siebenunddreißig Lebensjahren war das alles, was er vorzuweisen hatte! Wieder loderte die Wut auf. Vor einer Woche war er noch reich gewesen – seine Wut fand ein neues Ziel. Nun gab es wenigstens etwas, woran er sich rächen konnte, einen greifbaren Feind, den er schlagen, töten konnte. Die Buren. Die Buren hatten ihm seine Wagen und sein Gold geraubt und ihn zur Flucht gezwungen; wegen der Buren war Ruth in sein Leben getreten, und ihretwegen hatte man sie ihm weggenommen.
Das also sind die Zukunftsaussichten, dachte er wütend. Krieg!
Er richtete sich im Sattel auf, seine Schultern schienen sich zu füllen, wurden breit und gerade. Er hob den Kopf und sah in dem Tal vor sich die glänzende Schlangenlinie eines Flusses. Sie hatten den Tugela erreicht. Ohne ihnen eine Rast zu gönnen, trieb Sean sein Pferd über den Rand der Landstufe. Halb auf den Hinterbacken rutschend, begannen die Pferde den Abstieg. Unter ihren Hufen rollten lockere Steine.
Ungeduldig ritt Sean flußabwärts und suchte eine Furt. Doch das Wasser floß überall rasch und tief zwischen den steilen Ufern, der Fluß war zwanzig Meter breit und noch schmutzverfärbt von dem Gewitter.
Als das jenseitige Ufer so flach wurde, daß das Verlassen des Flusses keine Schwierigkeiten aufwarf, verhielt Sean sein Pferd und sagte brüsk: »Wir schwimmen.«
Statt einer Antwort warf Mbejane einen vielsagenden Blick auf Dirk.
»Er hat das schon gemacht«, erklärte Sean, während er absaß und seine Kleider abzustreifen begann. »Los, Dirk, zieh dich aus«, forderte er den Jungen auf.
Sie trieben die Packpferde ins Wasser, zwangen sie, von dem steilen Ufer zu springen, und warteten besorgt, bis die Köpfe der Tiere wieder auftauchten und dem jenseitigen Ufer zustrebten. Dann saßen alle drei auf, nackt, ihre Kleider im Ölzeug an die Sättel gebunden.
»Du zuerst, Mbejane.«
Wasser spritzte übers Ufer hoch.
»Ab mit dir, Dirk. Und denk daran, dich am Sattel festzuhalten.«
Wieder schossen Spritzer hoch. Dann trieb Sean sein Pferd an, das scheute und seitlich am Ufer entlangtänzelte. Ein Satz vorwärts und langes Fallen, bevor sich das Wasser über Tier und Reiter schloß.
Schnaubend und prustend tauchten beide auf. Sean sah mit Erleichterung Dirks Kopf dicht neben dem seines Pferdes und hörte den Jungen vor Erregung schreien.
Ein paar Augenblicke später standen sie am anderen Ufer, Wasser rann von ihren nackten Körpern, und sie lachten, weil die Sache solchen Spaß gemacht hatte.