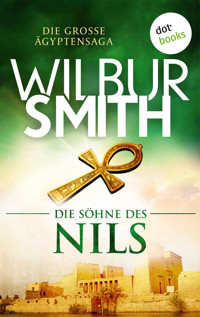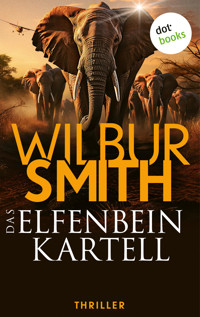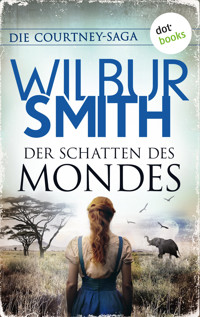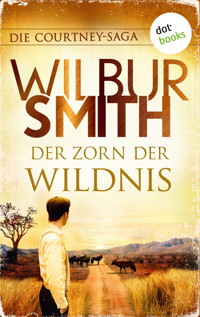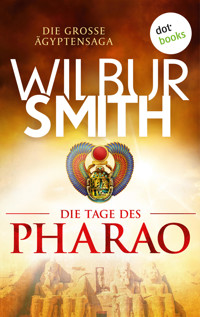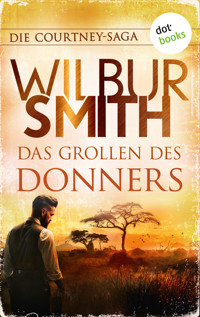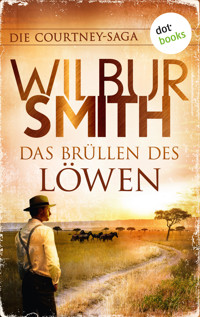4,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der perfekte Einstieg in das internationale Phänomen, das den Weltruhm des Autors begründet hat: »Wilbur Smith ist der beste historische Romanautor«, urteilt Stephen King. Die Zukunft eines Landes – das Ende einer Familie … Südafrika im Jahr 1952. Das Familienimperium der Courtneys, das von Shasa und Centaine Courtney mit eiserner Hand geführt wird, hat entscheidenden Einfluss auf das Leben der weißen und schwarzen Bevölkerung Südafrikas. Während Shasa davon träumt, sein geliebtes Land zu vereinen, droht die Apartheid, alles zu zerstören, was ihm lieb und teuer ist. Ohne einen anderen Ausweg schließt er sich der nationalistischen Partei an, mit dem Ziel, sie von innen heraus zu sabotieren. Dabei ahnt er noch nicht, dass sein Ringen um die Macht einen schrecklichen Tribut von ihm fordern wird. Nun, da das Feuer der Revolution am Horizont lodert, zeichnet sich immer deutlicher ab: Wenn der Kampf um die Zukunft Südafrikas endlich vorbei ist, wird die Familie Courtney nie wieder dieselbe sein … Der dramatische Afrika-Roman »Das Vermächtnis der Savanne« von Bestseller-Autor Wilbur Smith ist der sechste Band seiner epochalen historischen Familiensaga um die Familie Courtney – Fans von Jeffrey Archer und Ken Follett werden begeistert sein!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1059
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über dieses Buch:
Südafrika im Jahr 1952. Das Familienimperium der Courtneys, das von Shasa und Centaine Courtney mit eiserner Hand geführt wird, hat entscheidenden Einfluss auf das Leben der weißen und schwarzen Bevölkerung Südafrikas. Während Shasa davon träumt, sein geliebtes Land zu vereinen, droht die Apartheid, alles zu zerstören, was ihm lieb und teuer ist. Ohne einen anderen Ausweg schließt er sich der nationalistischen Partei an, mit dem Ziel, sie von innen heraus zu sabotieren. Dabei ahnt er noch nicht, dass sein Ringen um die Macht einen schrecklichen Tribut von ihm fordern wird. Nun, da das Feuer der Revolution am Horizont lodert, zeichnet sich immer deutlicher ab: Wenn der Kampf um die Zukunft Südafrikas endlich vorbei ist, wird die Familie Courtney nie wieder dieselbe sein …
Über den Autor:
Wilbur Smith (1933–2021) wurde in Zentralafrika geboren und gehört zu den erfolgreichsten Schriftstellern der Gegenwart. Der Debütroman seiner Jahrhunderte umspannenden Südafrika-Saga um die Familie Courtney, begründete seinen Welterfolg als Schriftsteller. Seitdem hat er über 50 Romane geschrieben, die allesamt Bestseller wurden, und in denen er seine Erfahrungen aus verschiedenen Expeditionen in die ganze Welt verarbeitete. Seine Bücher wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt und mehrfach verfilmt. Wilbur Smith starb 2021 in Kapstadt im Kreise seiner Familie.
Die Website des Autors: wilbursmithbooks.com/
Der Autor bei Facebook: facebook.com/WilburSmith/
Der Autor auf Instagram: instagram.com/thewilbursmith/
Die große Südafrika-Saga des Autors um die Familie Courtney erscheint bei dotbooks im eBook. Der Reihenauftakt »Das Brüllen des Löwen« ist auch als Hörbuch bei SAGA Egmont erhältlich.
Die große Ägypten-Saga über den Eunuchen Taita ist bei dotbooks als eBook erhältlich. Der Reihenauftakt »Die Tage des Pharao« ist auch als Hörbuch bei SAGA Egmont erhältlich.
Außerdem bei dotbooks erschienen der Abenteuerroman »Der Sonnenvogel« sowie die Action-Thriller »Greed – Der Ruf des Goldes«, »Blood Diamond – Tödliche Jagd«, »Black Sun – Die Kongo-Operation«, »Das Elfenbein-Kartell« und »Atlas – Die Stunde der Entscheidung«. Weitere Bände in Vorbereitung.
***
eBook-Ausgabe März 2025
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1987 unter dem Originaltitel »Rage« bei William Heinemann Ltd., London. Die deutsche Erstausgabe erschien 1990 unter dem Titel »Tara« bei Paul Zsolnay.
First published in 1987 by William Heinemann Limited
Copyright © Wilbur Smith 1987
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1990 bei Paul Zsolnay Verlag Gesellschaft mbH, Wien und Rastatt
Copyright © der eBook-Ausgabe 2025 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/Nik Makulov, Belikova Oksana, Simon Dannhauser und AdobeStock/ana
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (vh)
ISBN 978-3-98952-476-7
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. In diesem eBook begegnen Sie daher möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Diese Fiktion spiegelt nicht automatisch die Überzeugungen des Verlags wider oder die heutige Überzeugung der Autorinnen und Autoren, da sich diese seit der Erstveröffentlichung verändert haben können. Es ist außerdem möglich, dass dieses eBook Themenschilderungen enthält, die als belastend oder triggernd empfunden werden können. Bei genaueren Fragen zum Inhalt wenden Sie sich bitte an [email protected].
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Wilbur Smith
Das Vermächtnis der Savanne
Die Courtney-Saga 6
Aus dem Englischen von Grit Zoller
dotbooks.
Vorbemerkung des Autors
Was die historische Zeitskala in meiner Geschichte anlangt, so habe ich mir bezüglich der Datierungen wieder einige Freiheiten erlaubt. Das betrifft im Besonderen den Beginn der Widerstandsbewegungen »Umkhonto we Sizwe« und des »Poqo«, den Freispruch Nelson Mandelas in seinem ersten Hochverratsprozeß und die berühmte Rede Harold Macmillans im Südafrikanischen Parlament.
Ich hoffe, der Leser wird mir das, dem Roman zuliebe, verzeihen.
Wilbur Smith
Widmung
Ich widme dieses Buch meiner Frau, Danielle.
Hand in Hand haben wir Kontinente durchquert; doch keiner war so groß wie meine Liebe.
Gemeinsam sind wir auf allen Ozeanen gefahren; doch keiner war so tief wie meine Liebe.
Kapitel 1
Tara Courtney hatte seit ihrem Hochzeitstag nicht mehr Weiß getragen. Ihre Lieblingsfarbe war Grün, weil das am besten zu ihrem dichten haselnußbraunen Haar paßte.
Aber in dem weißen Kleid, das sie an diesem Tag trug, fühlte sie sich wieder wie eine Braut – nervös und ein wenig ängstlich, aber voll eines tiefen Gefühls der Freude und Hingabe. Sie hatte ihr Haar gebürstet, es leuchtete rubinrot in der hellen Kapsonne, und ihre Wangen waren vor Aufregung gerötet. Obwohl sie vier Kinder zur Welt gebracht hatte, war ihre Taille mädchenhaft schlank. Daher stellte die düstere schwarze Schärpe, die sie über der Schulter trug, einen umso stärkeren Kontrast dar: Jugend und Schönheit, geschmückt mit den Symbolen der Trauer. Trotz des Aufruhrs ihrer Gefühle stand sie, die Hände gefaltet und den Kopf gebeugt, völlig unbewegt und schweigend da.
Sie war nur eine von etwa fünfzig Frauen, die, alle weiß gekleidet und mit schwarzen Schärpen, in derselben Trauerhaltung in genau bemessenen Abständen den Gehsteig gegenüber dem Haupteingang des Parlamentsgebäudes der Union von Südafrika säumten.
Fast alle waren sie junge Damen aus Taras Gesellschaftsschicht – wohlhabend, privilegiert und gelangweilt vom unbefriedigenden Verlauf ihres unausgefüllten Lebens. Viele von ihnen hatten sich der Demonstration nur deshalb angeschlossen, weil sie es aufregend fanden, der etablierten Autorität zu trotzen und ihresgleichen zu schockieren. Manche versuchten damit auch die Aufmerksamkeit ihrer Ehemänner zurückzugewinnen, die sich im Trott der ersten Ehejahre von ihnen abgewendet hatte und nun mehr auf das Geschäft, das Golfspiel und andere außereheliche Aktivitäten gerichtet war. Es gab jedoch einen harten Kern in der Bewegung, der hauptsächlich aus älteren Frauen bestand, zu dem aber auch ein paar jüngere wie Tara und Molly Broadhurst gehörten. Bei diesen waren einzige Abscheu und Unrecht Triebfedern ihres Handelns. Tara hatte versucht, ihren Gefühlen auf der Pressekonferenz an diesem Morgen Ausdruck zu geben, als eine Reporterin vom »Cape Argus« von ihr wissen wollte: »Warum tun Sie das, Mrs. Courtney?« Sie hatte erwidert: »Weil ich Tyrannen hasse und Betrüger hasse.« Damit sah sie ihre Haltung gerechtfertigt.
»Da kommt der große böse Wolf«, flüsterte die Frau, die fünf Schritte rechts von Tara stand. »Haltung, meine Damen!« Molly Broadhurst war eine der Gründerinnen der »Schwarzen Schärpe«, eine kleine, entschlossene Person Anfang der Dreißig. Tara bewunderte sie sehr und suchte ihr nachzueifern.
Ein schwarzer Chevrolet mit den Kennzeichentafeln der Regierung hielt an der Ecke des Parliament Square. Vier Männer stiegen aus. Einer von ihnen war ein Polizeifotograf, der sich sofort an die Arbeit machte und jede einzelne der weißgekleideten, schwarz dekorierten Frauen fotografierte. Ihm folgten zwei Herren mit gezückten Notizbüchern. Wenngleich sie dunkle, schlechtsitzende Zivilanzüge trugen, stammten ihre klobigen schwarzen Schuhe ohne Zweifel aus den Polizeibeständen, und ihr Verhalten war barsch und geschäftsmäßig, als sie nacheinander die Namen und Adressen der Demonstrantinnen notierten. Tara, die nun schon fast so etwas wie eine Expertin war, vermutete, daß sie Polizeisergeanten der Sonderabteilung waren. Nur den vierten Mann kannte sie, wie die meisten ihrer Genossinnen, namentlich.
Er trug einen hellgrauen Sommeranzug, braune Schuhe, eine dezente braune Krawatte und einen grauen Filzhut. Er verzog den Mund zu einem Lächeln, als er vor Molly den Hut lüftete.
»Guten Morgen, Mrs. Broadhurst. Sie sind früh dran. Der Konvoi wird erst in einer Stunde eintreffen.«
»Werden Sie uns heute wieder alle festnehmen, Inspektor?« fragte Molly scharf.
»Ich denke gar nicht daran.« Der Inspektor zog eine Augenbraue hoch. »Wir leben in einem freien Land, wie Sie wissen.«
»Was Sie nicht sagen!«
»Aber, aber, Mrs. Broadhurst!« Er schüttelte den Kopf. »Sie versuchen, mich zu provozieren.« Sein Englisch war ausgezeichnet, er sprach es nur mit einer Spur Afrikaanderakzent.
»Nein, Inspektor. Wir protestieren gegen die himmelschreiende Willkür der Wahlbezirkseinteilung von Seiten dieser verderbten Regierung, gegen die Unterwanderung der gesetzlichen Ordnung und dagegen, daß man der Mehrheit unserer südafrikanischen Mitbürger einzig aus Gründen der Hautfarbe die Grundrechte vorenthält.«
»Ich glaube, Mrs. Broadhurst, Sie wiederholen sich. Das alles haben Sie mir bereits bei unserem letzten Zusammentreffen erklärt.« Der Inspektor grinste. »Als nächstes verlangen Sie womöglich, daß ich Sie wieder festnehme. Wir wollen dieses große Ereignis doch nicht stören –«
»Die Eröffnung dieses Parlaments, das dem Unrecht und der Unterdrückung seine Hände leiht, ist ein Anlaß zur Trauer, nicht zum Feiern.«
Der Inspektor tippte kurz an die Hutkrempe, aber hinter seiner lockeren Haltung verbarg sich ehrlicher Respekt und vielleicht sogar ein wenig Bewunderung. »Machen Sie ruhig weiter, Mrs. Broadhurst«, murmelte er. »Ich bin sicher, wir sehen uns bald wieder.« Er schlenderte weiter, bis er vor Tara stand.
»Einen schönen guten Morgen, Mrs. Courtney.« Er hielt inne, und diesmal trat seine Bewunderung offen zutage. »Was hält Ihr berühmter Gatte von Ihrem verräterischen Verhalten?«
»Ist es Verrat, sich gegen die Übertretungen der National Party und ihre auf Rasse und Hautfarbe basierende Gesetzgebung aufzulehnen, Inspektor?«
Sein Blick senkte sich für einen Augenblick auf ihre Brüste, die sich füllig und fest unter der weißen Spitze abzeichneten, und kehrte dann zu ihrem Gesicht zurück. »Sie sind viel zu hübsch für diesen Unsinn«, sagte er. »Überlassen Sie das doch den grauhaarigen alten Schachteln. Gehen Sie nach Hause, wo Sie hingehören, und kümmern Sie sich um Ihre Kinder.«
»Ihr männlicher Chauvinismus ist unerträglich, Inspektor.« Sie wurde rot vor Ärger, nicht ahnend, daß dies sie nur noch reizvoller machte.
»Ich wünschte, alle Verräterinnen wären so hübsch wie Sie. Das würde meine Arbeit um einiges erträglicher machen. Danke, Mrs. Courtney.« Er lächelte aufreizend und ging weiter.
»Laß dich nicht nervös machen von ihm, meine Liebe«, sagte Molly leise. »Darin ist er Experte. Wir protestieren passiv. Denk an Mahatma Gandhi.«
Mühsam beherrschte Tara ihren Zorn und nahm wieder die Trauerhaltung ein. Auf dem Gehsteig hinter ihr wuchs allmählich die Zahl der Schaulustigen. Die Reihe der weißgekleideten Frauen war Objekt von Neugier und Gelächter; es gab Beifall, aber auch einige Ablehnung.
Tara biß sich auf die Lippen und zwang sich, trotz vermehrter spöttischer Bemerkungen, auch von Seiten einiger Schwarzer, ruhig und mit gesenktem Kopf stehenzubleiben.
Langsam wurde es heiß. Obwohl sich über dem großen, abgeflachten Bollwerk des Tafelberges Wolkenbänke türmten, die das Aufkommen des Südostwindes ankündigten, regte sich in der Stadt darunter noch kein Lüftchen. Inzwischen war die Zuschauermenge weiter angewachsen, und Tara wurde – vermutlich absichtlich – immer wieder angerempelt. Sie blieb gelassen und konzentrierte ihre Aufmerksamkeit auf die Vorgänge vor dem Gebäude gegenüber.
Das erwartungsvolle Gemurmel der Menge um sie herum riß sie schließlich aus ihren Gedanken.
»Da kommen sie«, rief Molly, und die wogende, drängende Menge brach in Beifall aus. Das Klappern von Pferdehufen auf Asphalt kam näher, und dann trabte die berittene Polizeieskorte mit fröhlich flatternden Fähnchen an den Spitzen ihrer Lanzen heran.
Dahinter kamen die offenen Kutschen gefahren. In der ersten saßen der Generalgouverneur und der Premierminister. Daniel Malan, der Führer der Afrikaander, mit seinen häßlichen, fast froschähnlichen Gesichtszügen, hatte nur ein erklärtes Ziel: sein »Volk« in Afrika ein Jahrtausend an der Macht zu halten. Dafür war ihm kein Preis zu hoch.
Tara starrte ihn mit augenfälligem Haß an, er verkörperte für sie all das, was sie an dieser Regierung, die nun in ihrem heißgeliebten Land das Sagen hatte, verabscheute. Als die Kutsche an ihr vorbeiratterte, trafen sich für einen flüchtigen Moment ihre Blicke, und Tara versuchte, die Kraft ihrer Gefühle in ihren Blick zu legen, aber er sah sie an, ohne sie zu erkennen und ohne daß sich auch nur eine Spur von Ärger in seinem nachdenklichen Gesicht gezeigt hätte. Er hatte sie angesehen und sie nicht einmal wahrgenommen. Und plötzlich mischte sich Verzweiflung in ihre Wut.
Was muß geschehen, um diese Leute dazu zu bringen, daß sie einem zuhören? fragte sie sich. Inzwischen waren die Würdenträger aus den Kutschen gestiegen und lauschten in strammer Haltung den Klängen der Nationalhymne. Tara ahnte noch nichts davon, aber dies war das letzte Mal, daß »The King« bei der Eröffnung eines südafrikanischen Parlaments gespielt wurde.
Die Musikkapelle schloß mit einer Trompetenfanfare, und die Kabinettsminister traten hinter dem Generalgouverneur und dem Premierminister durch das große wuchtige Eingangsportal. Dann folgten nacheinander die führenden Politiker der Opposition. Das war der Augenblick, vor dem Tara Angst hatte, denn in diesem Teil der Prozession befanden sich auch Angehörige ihrer Familie. Unmittelbar hinter dem Oppositionsführer schritt Taras Vater mit ihrer Stiefmutter. Sie waren das auffälligste Paar in der langen Reihe – ihr Vater, groß, würdevoll, patriarchalisch wie ein Löwe, Centaine de Thiry CourtneyMalcomess an seinem Arm, schlank und anmutig in ihrem gelben Seidenkleid. Sie trug einen flotten Hut ohne Krempe und schien um keinen Tag älter zu sein als Tara, obwohl jedermann wußte, daß sie deshalb Centaine hieß, weil sie am ersten Tag des zwanzigsten Jahrhunderts geboren worden war.
Tara dachte schon, sie wäre unbemerkt geblieben. Niemand von ihnen hatte gewußt, daß sie an der Demonstration teilzunehmen beabsichtigte. Aber auf dem Absatz der breiten Freitreppe kam die Prozession für einen Augenblick zum Stehen, und jetzt drehte Centaine sich langsam um und schaute zurück. Von dort oben konnte sie über die Köpfe der Eskorte und der anderen Würdenträger hinweg auf den Platz hinuntersehen. Ihr Blick fiel auf Tara und blieb für einen Augenblick auf ihr ruhen. Obwohl sich ihr Gesichtsausdruck nicht änderte, war ihr Mißfallen selbst aus dieser Entfernung wie ein Schlag in Taras Gesicht. Für Centaine waren die Ehre und der gute Ruf der Familie von allergrößter Bedeutung. Sie hatte Tara wiederholt davor gewarnt, in der Öffentlichkeit aufzutreten, und Centaines Absichten und Wünsche zu verhöhnen war gefährlich, denn sie war nicht nur Taras Stiefmutter, sondern auch ihre Schwiegermutter und die Rangälteste des Courtney-Imperiums.
Shasa Courtney, der ein paar Schritte dahinter etwas tiefer als seine Mutter stand, bemerkte Richtung und Intensität ihres Blickes und drehte sich rasch um. Er entdeckte Tara, seine Frau, in der Reihe der schwarz dekorierten Demonstrantinnen. Als sie ihm an diesem Morgen beim Frühstück erklärt hatte, sie werde ihn nicht zur Eröffnungszeremonie begleiten, hatte Shasa kaum von der Wirtschaftsseite der Morgenzeitung aufgeblickt. »Tu, was dir beliebt, meine Liebe. Es wird ohnehin recht langweilig«, hatte er gemurmelt. »Aber ich hätte noch gern eine Tasse Kaffee, wenn du so nett wärst.«
Als er sie nun entdeckte, lächelte er fast unmerklich und schüttelte in gespielter Verzweiflung den Kopf, so als wäre sie ein Kind, das er bei einem dummen Zank ertappt hatte. Dann wandte er sich ab, da sich der Zug wieder in Bewegung setzte.
Er sah unglaublich gut aus, die schwarze Augenklappe gab ihm einen leicht piratenhaften Anstrich, was die meisten Frauen reizvoll und faszinierend fanden. Die beiden waren das hübscheste junge Paar in der guten Gesellschaft von Kapstadt. Doch hatten seltsamerweise die paar kurzen Ehejahre die Flammen ihrer Liebe zu einem Häufchen grauer Asche verglühen lassen.
Die letzten Abgeordneten verschwanden im Gebäude, die berittene Eskorte und die leeren Kutschen entfernten sich, und die Zuschauermenge begann sich zu zerstreuen. Die Demonstration war vorüber.
»Kommst du mit, Tara?« fragte Molly, aber Tara schüttelte den Kopf.
»Ich muß mich mit Shasa treffen«, erklärte sie. »Wir sehen uns Freitag nachmittag.« Tara nahm die breite schwarze Schärpe ab, faltete sie zusammen und steckte sie in ihre Handtasche, während sie sich einen Weg durch die Menge bahnte. Sie überquerte die Straße.
Tara fand nichts dabei, dem Portier am Besuchereingang ihren Parlamentsausweis zu zeigen und dann die Institution zu betreten, gegen deren Tätigkeit sie eben noch so energisch protestiert hatte.
Als sie um die Korridorecke bog, wäre sie beinahe mit einem Mann zusammengestoßen, der aus der anderen Richtung kam. Sie hielt gerade noch rechtzeitig an und sah, daß er ein großgewachsener Schwarzer war, der die Uniform eines Parlamentsdieners trug. Sie wollte eben mit einem freundlichen Nicken weitergehen, als ihr zu Bewußtsein kam, daß ein Diener während einer Parlamentssitzung nichts in diesem Gebäudetrakt zu suchen hatte, denn am Ende des Korridors befanden sich die Büros des Premierministers und der Oppositionsführer. Außerdem fiel ihr auf, daß der Diener, obwohl er Scheuerlappen und Eimer trug, weder etwas Unterwürfiges noch Lakaienhaftes an sich hatte. Sie blickte ihm scharf ins Gesicht.
Tara spürte ein Prickeln, als sie ihn wiedererkannte. Es war viele Jahre her, aber dieses Gesicht würde sie nie vergessen – die Gesichtszüge eines ägyptischen Pharaos, ebenmäßig und ausgeprägt, mit dunklen, wachen Augen. Er war noch immer einer der schönsten Männer, die sie je gesehen hatte, sie erinnerte sich an seine tiefe, erregende Stimme, und unwillkürlich überlief sie ein leichter Schauer. Auch seine Worte hatte sie noch im Ohr: »Es gibt eine Generation, deren Zähne wie Schwerter sind ... um die Anmut von dieser Erde zu tilgen.«
Es war dieser Mann gewesen, der ihr den ersten Schimmer von Verständnis dafür vermittelt hatte, was es hieß, in Südafrika als Schwarzer geboren zu sein. Ihre echte Hingabe für die Bewegung ging auf dieses erste, weit zurückliegende Zusammentreffen zurück. Dieser Mann hatte mit ein paar Worten ihr Leben verändert.
Sie blieb stehen, verstellte ihm den Weg und versuchte Worte zu finden, um ihre Gefühle auszudrücken, aber ihre Kehle war wie zugeschnürt, und sie merkte, daß sie vor Erregung zitterte. Als ihm bewußt wurde, daß er erkannt worden war, veränderte er sich wie ein Leopard, der in Abwehrstellung geht, sobald er die Jäger bemerkt. Tara spürte, daß sie in Gefahr war. Aber sie hatte keine Angst.
»Ich bin ein Freund«, sagte sie leise und trat beiseite, um ihn vorbeizulassen. »Wir kämpfen für die gleiche Sache.«
Er blieb einen Augenblick regungslos stehen und starrte sie an. Sie wußte, daß er sich ihr Gesicht für alle Zeiten einprägte, sein forschender Blick schien sich in ihre Haut zu brennen. Dann nickte er. »Ich kenne Sie«, bestätigte er, und abermals ließ seine Stimme sie erbeben – sie war tief und melodiös, erfüllt vom Rhythmus und vom Pulsschlag Afrikas. »Wir werden uns wiedersehen«.
Dann ging er weiter und verschwand, ohne sich noch einmal umzudrehen, um die Ecke des getäfelten Korridors. Tara stand da und starrte ihm nach. Ihr Herz pochte, ihr Atem ging rasch.
»Moses Gama«, flüsterte sie. »Der Messias von Afrika –« Dann hielt sie inne und schüttelte den Kopf. Was tat er hier, ausgerechnet hier?
Die vielen möglichen Antworten auf diese Frage nahmen sie gefangen, ließen ihr keine Ruhe, sie ahnte, daß etwas im Gange war, sehnte sich danach, daran teilzunehmen. Sie wollte mehr tun, als bloß mit einer schwarzen Schärpe über der Schulter an einer Straßenecke zu stehen. Sie wußte, Moses Gama brauchte nur zu winken, und sie würde ihm folgen – sie und mit ihr zehn Millionen andere.
»Wir sehen uns wieder«, hatte er versprochen, und sie glaubte es.
Beschwingt eilte sie den Gang hinunter. Sie besaß einen Schlüssel zum Büro ihres Vaters, und als sie ihn in das Schloß steckte, fiel ihr Blick auf das Messingschild in Augenhöhe:
OBERST BLAINE MALCOMESS
STELLVERTRETENDER OPPOSITIONSFÜHRER
Überrascht stellte Tara fest, daß das Büro nicht versperrt war. Sie stieß die Tür auf und trat ein.
Centaine Courtney-Malcomess wandte sich vom Fenster hinter dem Schreibtisch ab, um ihr entgegenzublicken.
»Ich habe hier auf dich gewartet, junge Dame.«
Tara hob trotzig das Kinn.
»Du brauchst gar nicht deine Nase so hoch zu tragen, Tara chéri«, fuhr Centaine fort. »Wenn du dich wie ein Kind benimmst, mußt du auch darauf gefaßt sein, daß man dich wie ein Kind behandelt.«
»Nein, Mutter, du bist im Irrtum. Ich nehme es nicht hin, von dir wie ein Kind behandelt zu werden, nicht jetzt und künftighin auch nicht. Ich bin eine verheiratete Frau von dreiunddreißig Jahren, Mutter von vier Kindern und führe meinen eigenen Haushalt.«
Centaine seufzte. »Schon gut« lenkte sie ein. »Meine Sorge ließ mich die Höflichkeit vergessen, und ich entschuldige mich. Wir wollen dieses Gespräch nicht noch schwieriger machen, als es ohnehin schon ist.«
»Ich wüßte nicht, was wir zu besprechen hätten.«
»Setz dich, Tara«, befahl Centaine, und Tara gehorchte unwillkürlich, worüber sie sich augenblicklich ärgerte. Centaine nahm auf dem Stuhl ihres Mannes hinter dem Schreibtisch Platz, was Tara ihr ebenfalls verübelte – der Stuhl gehörte ihrem Vater, und diese Frau hatte kein Recht, darauf zu sitzen.
»Du hast mir gerade erklärt, daß du Mutter von vier Kindern bist«, sagte Centaine ruhig. »Findest du nicht auch, daß du Pflichten hast –«
»Ich sorge sehr gut für meine Kinder«, fauchte Tara. »In diesem Punkt kannst du mir nichts vorwerfen.«
»Und wie steht’s mit deinem Mann und deiner Ehe?«
»Was ist mit Shasa?« Tara wurde augenblicklich abweisend.
»Das sollst ja du mir sagen«, forderte Centaine sie auf.
»Das geht dich nichts an.«
»O doch«, widersprach ihr Centaine. »Ich habe mein ganzes Leben Shasa gewidmet. Und er soll einmal ein Führer dieser Nation werden.«
»Das ist unmöglich, und das weißt du auch.«
Centaine funkelte Tara an. »Nichts ist unmöglich – nicht für mich. Nicht für uns.«
»O doch«, erwiderte Tara hämisch. »Du weißt ebensogut wie ich, daß sich die Nationalisten die Wahlbezirke selbst zurechtgestutzt haben und sogar den Senat mit ihren eigenen Leuten besetzt halten. Sie sind ein für allemal an der Macht. Nie wird einer, der nicht Nationalist und Afrikaander ist, je wieder Führer dieses Landes sein. Jedenfalls nicht bis zur Revolution – und wenn die vorbei ist, wird ein Schwarzer der Führer sein.« Tara brach ab und dachte einen Augenblick an Moses Gama.
»Du bist sehr naiv«, sagte Centaine. »Du hast nicht die leiseste Ahnung! Dein Gerede über Revolution ist kindisch und unverantwortlich.«
»Nenn es, wie du willst, Mutter. Aber tief in deinem Inneren weißt du, daß es so ist. Dein Liebling wird deinen Traum nie erfüllen. Sogar er empfindet bereits, wie sinnlos es ist, ewig auf der Oppositionsbank zu sitzen. Er verliert allmählich das Interesse am Unmöglichen. Es würde mich nicht überraschen, wenn er beschließen würde, zur nächsten Wahl nicht mehr anzutreten, die politische Laufbahn, die du ihm auferlegt hast, einfach aufzugeben und sich daranzumachen, eine weitere Milliarde zu verdienen.«
»Nein«, wehrte Centaine kopfschüttelnd ab. »Er gibt nicht auf. Er ist ein Kämpfer wie ich.«
»Nicht einmal Kabinettsminister wird er je werden, geschweige denn Premierminister«, meinte Tara entschieden.
»Wenn du so denkst, dann bist du keine Frau für meinen Sohn«, erwiderte Centaine.
»Das hast du gesagt«, sagte Tara leise.
»Oh, Tara, Liebste, es tut mir leid.« Centaine streckte die Hand aus, aber der Schreibtisch war zu breit, um Taras Hand erreichen zu können. »Verzeih mir. Ich war unbeherrscht. All das ist so ungeheuer wichtig für mich. Ich glaube so fest daran, aber ich wollte mich nicht gegen dich stellen. Ich will dir nur helfen – ich mache mir solche Sorgen um dich und Shasa. Ich möchte helfen, Tara. Willst du mich nicht helfen lassen?«
»Ich glaube nicht, daß wir Hilfe brauchen«, ging es Tara glatt über die Zunge. »Shasa und ich sind vollkommen glücklich. Wir haben vier wundervolle Kinder –«
Centaine machte eine ungeduldige Geste. »Tara, wir beide waren nicht immer einer Meinung. Aber ich bin deine Freundin, wirklich. Ich will für dich und Shasa und die Kleinen nur das Beste. Willst du mich nicht doch helfen lassen?«
»Wie denn, Mutter? Indem du uns Geld gibst – du hast uns schon zehn oder zwanzig Millionen Pfund gegeben – oder sind es bereits dreißig? Manchmal verliere ich die Übersicht.«
»Ich möchte, daß du an meiner Erfahrung teilhast. Möchtest du dir meinen Rat nicht wenigstens anhören?«
»Doch, Mutter, anhören kann ich ihn mir. Ich verspreche nicht, ihn zu befolgen, aber ich höre zu.«
»Zum ersten, liebe Tara, mußt du diese verrückten linken Umtriebe aufgeben. Du bringst damit die ganze Familie in Mißkredit. Du machst dich und damit auch uns zum Narren, wenn du dich in diesem Aufzug auf die Straße stellst. Abgesehen davon, ist es ausgesprochen gefährlich. Die Resolution über das Verbot des Kommunismus ist nun in Kraft. Du könntest zur Kommunistin erklärt und geächtet werden. Überleg dir das, du würdest zu einer Unperson werden, aller gesellschaftlichen Rechte und jeder Ehre beraubt. Und nicht zuletzt geht es um Shasas politische Laufbahn. Was du tust, wirft auch auf ihn ein schlechtes Licht.«
»Mutter, ich habe versprochen zuzuhören«, sagte Tara frostig, »aber nun ziehe ich dieses Versprechen zurück. Ich weiß, was ich tue.« Sie stand auf und ging zur Tür, wo sie stehenblieb und sich noch einmal umdrehte. »Hast du je daran gedacht, Centaine Courtney-Malcomess, daß meine Mutter an gebrochenem Herzen gestorben ist und daß es dein fatales Verhältnis mit meinem Vater war, das ihr das Herz brach? Und du sitzt selbstgefällig da und sagst mir, wie ich mein Leben zu führen habe, um dir und deinem Herzblatt keine Schande zu machen.« Sie verließ das Zimmer und machte leise die schwere Teaktür hinter sich zu.
Kapitel 2
Shasa Courtney saß, die Hände in den Taschen, die Beine ausgestreckt und gekreuzt, lässig in der vordersten Bankreihe der Opposition und lauschte aufmerksam dem Polizeiminister, der den Gesetzesvorschlag umriß, den er während der nun laufenden Gesetzgebungsperiode einzubringen gedachte.
Der Polizeiminister war das jüngste Mitglied des Kabinetts, etwa im selben Alter wie Shasa, was äußerst ungewöhnlich war. Die Afrikaander ehrten das Alter und mißtrauten der Unerfahrenheit und Leidenschaft der Jugend. Das Durchschnittsalter der anderen Mitglieder des nationalistischen Kabinetts lag bei etwa 65 Jahren, überlegte Shasa. Und da stand dieser Manfred De La Rey, ein Grünschnabel von knapp vierzig Jahren, vor ihnen und erläuterte in groben Zügen seine Ideen zur Änderung des Strafrechts, das er durch alle Instanzen bringen wollte.
»Er will tatsächlich ermächtigt werden, den Notstand auszurufen, der die Polizei über das Gesetz stellt und die Einflußnahme des Gerichts ausschaltet«, brummte Blaine Malcomess neben ihm, und Shasa nickte, ohne seinen Schwiegervater anzusehen. Stattdessen beobachtete er den Mann am Rednerpult.
»Der Kerl ist wirklich unverschämt«, murmelte Blaine Malcomess kopfschüttelnd. »Er fordert das Recht, die gesetzliche Ordnung aufzuheben und einen Polizeistaat einzuführen, der von der regierenden Partei gelenkt wird. Dagegen werden wir mit allen Mitteln ankämpfen müssen.«
»Ganz recht!« pflichtete Shasa bei, aber er stellte fest, daß er den Mann am Rednerpult beneidete und gleichzeitig auf seltsame Weise von ihm fasziniert war. Es war eigenartig, wie untrennbar ihrer beider Schicksale miteinander verwoben zu sein schienen.
Vor mehr als zwanzig Jahren war er Manfred De La Rey zum ersten Mal begegnet, und ohne jeden ersichtlichen Grund waren sie auf der Stelle wie zwei junge Kampfhähne aufeinander losgegangen und hatten sich eine blutige Prügelei geliefert. In der Erinnerung an deren Ausgang schnitt Shasa eine Grimasse – die Niederlage, die er hatte hinnehmen müssen, schmerzte ihn nach all den Jahren noch immer. Seither hatten sich ihre Wege immer und immer wieder gekreuzt.
1936 hatten sie beide der Olympiamannschaft angehört, die zu Adolf Hitlers Olympischen Spielen nach Berlin gefahren war, aber Manfred De La Rey war es gewesen, der im Boxring die einzige Goldmedaille für Südafrika erobert hatte, während Shasa mit leeren Händen zurückkehrte. Während der Wahlen von 1948 hatten sie heiß und erbittert um denselben Wahlkreis gekämpft, und wieder war es Manfred De La Rey gewesen, der siegreich aus den Wahlen hervorging und seinen Parlamentssitz erhielt, während Shasa eine Nachwahl in einem sicheren Wahlkreis der United Party abwarten mußte, um sich seinen Platz auf der Oppositionsbank zu sichern. Nun war Manfred Minister, eine Stellung, nach der Shasa mit ganzem Herzen trachtete. Bei Manfred De La Reys unbezweifelbarer Intelligenz und Redegewandtheit, seinem wachsenden politischen Spürsinn und der soliden Machtbasis innerhalb der Partei, auf die er sich stützen konnte, mußte seine Zukunft gesichert sein.
Neid, Bewunderung und ein tiefer Zwiespalt – das waren die Gefühle, die Shasa Courtney bewegten, als er dem Mann am Rednerpult zuhörte und ihn aufmerksam beobachtete.
Manfred De La Rey hatte noch immer eine Boxerfigur, breite Schultern und einen kräftigen Hals, aber seine Taille setzte langsam Fett an, und an seinem Kinn zeigte sich der Ansatz von Fleischwülsten. Er hielt sich nicht in Form, und seine einstmals harten Muskeln wurden allmählich schlaff. Shasa warf flüchtig einen selbstzufriedenen Blick auf seine eigenen schmalen Hüften und seinen flachen Bauch und konzentrierte sich dann wieder auf seinen Gegner.
Manfred De La Reys Nase war leicht verkrümmt, und durch eine seiner dunklen Augenbrauen zog sich eine weißschimmernde Narbe – Verletzungen, die er sich im Boxring zugezogen hatte. Doch seine Augen hatten die ungewöhnlich helle Farbe von gelbem Topas, waren undurchdringlich wie die Augen einer Katze, und doch loderte in ihnen das Feuer seines brillanten Verstandes. Wie alle nationalistischen Kabinettsminister, ausgenommen den Premierminister, war er ein äußerst gebildeter und begabter Mann, fromm und fanatisch und völlig überzeugt vom heiligen Recht seiner Partei und seines Volkes.
Er und seinesgleichen glauben wirklich, sie wären Gottes auserwähltes Volk auf Erden, und das ist es, was sie so verdammt gefährlich macht! Shasa lächelte grimmig, als Manfred seine Rede beendete und sich unter dem Beifallssturm seiner Partei setzte. Der Premierminister beugte sich seitwärts und klopfte Manfred auf die Schulter, während von den hinteren Bankreihen Dutzende Glückwunschzettel vorgereicht wurden.
Shasa benutzte diese Unterbrechung, um seinem Schwiegervater eine Entschuldigung zuzuraunen: »Ihr werdet mich heute nicht mehr brauchen, falls doch, weißt du, wo ich zu finden bin.« Dann stand er auf, verbeugte sich vor dem Vorsitzenden und begab sich so unauffällig wie möglich zum Ausgang. Shasa war jedoch über einen Meter achtzig groß, und mit seiner schwarzen Augenklappe, seinem welligen dunklen Haar und seinem guten Aussehen zog er mehr als nur ein paar prüfende Blicke von den jungen Frauen auf der Besuchergalerie auf sich.
Manfred De La Rey blickte von seinem Notizblock auf, als Shasa an ihm vorbeiging, und der Blick, den sie wechselten, war wachsam-gespannt, jedoch nicht deutlich. Dann war Shasa aus dem Saal und zog sein Sakko aus, während er den Gruß des Pförtners erwiderte und in den Sonnenschein hinaustrat.
Shasa hatte kein eigenes Büro im Parlamentsgebäude, denn das siebenstöckige »Centaine-Haus«, Hauptsitz der Courtney Bergwerks- und Finanzierungsgesellschaft, befand sich nur zwei Minuten entfernt. Als er unter den Eichen des Parks entlangschritt, wechselte er im Geist bereits die Hüte, tauschte den Zylinder des Politikers gegen den Homburg des Geschäftsmannes. Shasa hatte sein Leben zweigeteilt und gelernt, sich jeweils auf den einen Teil zu konzentrieren und nie zuzulassen, daß seine Energien, weil zu schwach eingesetzt, verpufften.
Als er die Straße vor der St.-George’s-Kathedrale überquerte und durch die gläserne Drehtür das »Centaine-Haus« betrat, dachte er bereits an Finanzierungen und Bergwerke, jonglierte mit Zahlen und Waren, wog Tatsachenberichte gegen seine eigenen Gefühle ab und genoß das Spiel mit Macht und Geld ebenso stark wie die Rituale und Konfrontationen im Plenarsaal des Parlaments.
Die beiden hübschen Mädchen hinter dem Empfangspult in der marmornen Eingangshalle setzten jede ein strahlendes Lächeln auf.
»Guten Tag, Mr. Courtney«, begrüßten sie ihn im Chor, und er schenkte ihnen ein Lächeln, während er zu den Liften trat. Diese Reaktion erfolgte automatisch; er umgab sich gern mit schönen Mädchen, obgleich er niemals eine seiner Angestellten angetastet haben würde. Das erschien ihm irgendwie blutschänderisch und unfair, etwa wie der Schuß auf einen sitzenden Vogel, denn sie hätten keine Möglichkeit gehabt, sich ihm zu verweigern.
Janet, seine Sekretärin, hatte den Lift gehört und erwartete ihn bereits. Sie war in der Art Shasa ähnlich – reif und ausgeglichen, gepflegt und tüchtig –, und obwohl sie keinen Versuch machte, ihre Bewunderung für ihn zu verbergen, fanden Shasas selbstgewählte Grundsätze auch auf sie Anwendung.
»Was gibt es Neues, Janet?« fragte er, und während sie ihm durch das Vorzimmer in sein Büro folgte, las sie ihm seine Termine für den Nachmittag vor.
Er trat als erstes zum Börsentelegraph in der Ecke und überflog rasch den Papierstreifen. Anglos war um zwei Shilling gefallen, es wurde allmählich Zeit, wieder zu kaufen.
»Rufen Sie Allen an und vertrösten Sie ihn. Ich bin noch nicht soweit«, befahl er und ging zu seinem Schreibtisch. »Lassen Sie mir fünfzehn Minuten Zeit, und dann verbinden Sie mich mit David Abrahams.«
Als sie draußen war, arbeitete sich Shasa durch die Fernschreiben und Eilbriefe hindurch, die sie ihm auf den Schreibtisch gelegt hatte. Als schließlich eines seiner Telefone klingelte, war er für das Gespräch mit David bereit.
»Hallo, Davie, wie läuft’s in Johannesburg?« Das war eine rein rhetorische Frage, denn er wußte, wie es lief und was zu tun war. Die täglichen Berichte und Schätzungen befanden sich unter den Papieren auf seinem Schreibtisch, dennoch lauschte er aufmerksam Davids zusammenfassendem Bericht.
David war geschäftsführender Direktor. Sie kannten sich seit der Universität, und er stand Shasa näher als jede andere Person mit Ausnahme von Centaine.
Obwohl die H´ani Diamantenmine nördlich von Windhuk noch immer, wie in den zweiunddreißig Jahren, seit Centaine Courtney sie entdeckt hatte, Hauptquelle des Gesellschaftsvermögens war, hatte sich die Gesellschaft unter Shasas Führung ausgeweitet, so daß er gezwungen gewesen war, den Verwaltungssitz von Windhuk nach Johannesburg zu verlegen. Johannesburg war das Wirtschaftszentrum des Landes und der Umzug daher unvermeidlich, obgleich sich die Stadt kahl, öde und unattraktiv zeigte und Centaine Courtney-Malcomess es ablehnte, das schöne Kap zu verlassen und dorthin zu übersiedeln. Also blieb der eigentliche Hauptsitz der Gesellschaft Kapstadt. Es war ein kostspieliger und plumper Kompromiß, aber Centaine setzte immer ihren Willen durch. Zudem erwies sich die Nähe zum Parlament für Shasa als sehr günstig, und er liebte das Kap ebenso sehr wie seine Mutter. Daher hatte er nicht versucht, sie umzustimmen.
Shasa und David unterhielten sich zehn Minuten lang, dann sagte Shasa: »Nun, das können wir nicht am Telefon entscheiden. Ich komme zu dir.«
»Wann?«
»Morgen nachmittag. Sean hat um zehn Uhr vormittags ein RugbyMatch. Das darf ich nicht versäumen. Ich hab’s ihm versprochen.«
»Ruf mich vor dem Abflug an«, meinte David ergeben. »Ich hole dich selbst vom Flughafen ab.«
Shasa legte auf und schaute auf seine Armbanduhr. Er wollte rechtzeitig in Weltevreden sein, um vor dem Abendessen noch eine Stunde mit den Kindern verbringen zu können. Die Arbeit konnte bis nach dem Abendessen warten. Er schob die restlichen Papiere in seinen schwarzen Hermés-Aktenkoffer, als Janet an die Innentür klopfte und eintrat.
»Verzeihung, Sir. Das ist gerade für Sie abgegeben worden. Ein Bote aus dem Parlament. Er sagte, es wäre sehr dringend.«
Shasa nahm den schweren Umschlag entgegen. »Danke, Janet.« Er riß das Kuvert mit dem Daumen auf und nahm den Brief heraus. Der Briefkopf lautete: »Büro des Polizeiministers«, die Nachricht war handgeschrieben und in Afrikaans.
»Lieber Mr. Courtney,
Eine hochgestellte Persönlichkeit, die von Ihrer Vorliebe für die Jagd weiß, hat mich gebeten, Sie für das kommende Wochenende zur Springbockjagd auf seine Ranch einzuladen. Auf dem Grundstück befindet sich ein Behelfsflugplatz, dessen Koordinaten wie folgt lauten: 28°32’ Süd 26T6’ Ost.
Ich kann Ihnen eine gute Jagd und eine interessante Gesellschaft versprechen. Bitte lassen Sie mich wissen, ob Sie daran teilnehmen können.
Mit freundlichen Grüßen
Manfred De La Rey.«
Shasa grinste und pfiff leise durch die Zähne, als er an die Wandkarte trat und die Koordinaten überprüfte. Die Einladung glich eher einem Befehl, und Shasa konnte sich denken, wer die hochgestellte Persönlichkeit war. Er sah, daß die Ranch südlich der Goldfelder von Welkom im Oranjefreistaat lag, und das bedeutete nur einen kleinen Umweg auf seinem Rückflug von Johannesburg. Was die nun wieder vorhaben – überlegte er und spürte kribbelnde Erwartung. Das war genau die Art von Spannung, die er liebte. Rasch schrieb er eine Antwort auf ein Blatt seines persönlichen Briefpapiers:
»Danke für Ihre freundliche Einladung zur Jagd an diesem Wochenende. Bitte überbringen Sie unserem Gastgeber meine Zusage und daß ich der Jagd mit Vergnügen entgegensehe.«
Als er den Umschlag versiegelte, murmelte er: »Ihr müßtet mich schon mit beiden Füßen am Boden festnageln, um mich von dort fernzuhalten.«
Shasa fuhr in seinem grünen Jaguar durch das hohe, weißgestrichene Tor von Weltevreden. Seit Centaine ihm das Gut übergeben hatte, um sich mit Blaine Malcomess auf der anderen Seite des Constantiaberges niederzulassen, hatte Shasa ebensoviel Liebe und Sorgfalt in Weltevreden investiert wie sie. Der Name bedeutete übersetzt »Wohl zufrieden«, und genauso empfand Shasa, als er die Geschwindigkeit drosselte, um der Weinreben wegen, die entlang der Zufahrtsstraße wuchsen, keinen Staub aufzuwirbeln.
Die Weinernte war in vollem Gange. Die Kopftücher der Frauen, die zwischen den langen Reihen schulterhoher Reben arbeiteten, waren helle, bewegte Farbtupfen inmitten des roten und goldgelben Laubes. Sie richteten sich auf, um Shasa im Vorbeifahren lächelnd zuzuwinken, und die Männer, die gebückt unter den von roten Trauben überquellenden Körben zu den Erntewagen marschierten, grinsten ihm ebenfalls zu.
Sean saß auf einem der Wagen in der Mitte der Rebenreihe und ließ die stämmigen Pferde im Schritt gehen, um mit den Erntearbeitern Schritt zu halten. Der Wagen war hoch mit reifen Trauben beladen, die wie Rubine in der Sonne glänzten.
Als Sean seinen Vater erblickte, warf er dem Kutscher die Zügel zu und sprang vom Wagen, um zwischen den Weinreben hindurch auf den grünen Jaguar zuzurennen. Er war erst elf, aber groß für sein Alter. Er hatte die helle Haut seiner Mutter und Shasas feine Gesichtszüge geerbt, und obwohl seine Glieder recht kräftig waren, lief er leichtfüßig und flink wie eine Antilope. Während Shasa ihn beobachtete, hatte er das Gefühl, sein Herz müßte vor Stolz zerspringen.
Sean riß die Beifahrertür des Jaguars auf und ließ sich auf den Sitz plumpsen, wo er augenblicklich seine übliche würdige Haltung wieder einnahm.
»Guten Abend, Papa«, sagte er, und Shasa legte den Arm um seine Schultern und drückte ihn an sich.
»Hallo, Sportsmann. Hattest du einen schönen Tag?«
Sie fuhren am Weingarten und an den Ställen vorbei, und Shasa stellte den Jaguar in dem überdachten Schuppen ab, wo auch die Erntewagen standen.
Die anderen Kinder hatten seine Ankunft durch das Fenster des Kinderzimmers beobachtet und kamen ihm über dem Rasen entgegengestürmt. Michael, der jüngste, war vorne, und Garrick, der mittlere, folgte gut fünf Meter dahinter. Die Jungen waren knapp ein Jahr auseinander. Michael war der Träumer der Familie, ein sensibles Kind von neun Jahren, das sich stundenlang, alles andere um sich herum vergessend, in »Die Schatzinsel« vertiefen oder einen ganzen Nachmittag mit Zeichenblock und Wasserfarben verbringen konnte. Shasa umarmte ihn genauso liebevoll wie seinen Ältesten. Dann kam Garrick herangekeucht, blaß, dünn und asthmatisch, mit strähnigem Haar, das borstig von seinem Kopf abstand.
»Guten Abend, Papa«, stotterte er. Er ist wirklich ein häßlicher kleiner Kerl, dachte Shasa, und woher, zum Teufel, hat er nur das Asthma und das Stottern?
»Hallo, Garrick.« Shasa nannte ihn nie »Sohn«, »mein Junge« oder »Sportsmann« wie die beiden anderen. Dieser hier war immer nur »Garrick«, und er tätschelte ihm lediglich leicht den Kopf. Es wäre ihm nie in den Sinn gekommen, das Kind zu umarmen – der arme kleine Kerl machte mit seinen zehn Jahren noch immer ins Bett.
Shasa wandte sich ab, um seine Tochter zu begrüßen.
»Komm, mein Engel, komm zu deinem Daddy!« Und sie flog in seine Arme und kreischte vor Entzücken, als er sie hochschwang. Dann schlang sie beide Arme um seinen Hals und bedeckte sein Gesicht mit warmen, feuchten Küssen.
»Was möchte mein Engel jetzt am liebsten tun?« fragte Shasa, ohne sie loszulassen.
»Ich möchte reiten«, erklärte Isabella. Sie trug bereits ihre neuen Reithosen.
»Dann werden wir reiten«, stimmte Shasa zu. Immer wenn Tara ihm vorwarf, er würde Isabellas Lispeln noch fördern, wandte er ein: »Sie ist doch noch ein Baby.«
»Sie ist eine gerissene kleine Hexe, die genau weiß, wie sie dich um den kleinen Finger wickeln kann – und du läßt es zu.«
»Also vorwärts«, befahl Shasa. »Machen wir vor dem Abendessen einen Ausritt.«
Sean war zu groß und erwachsen, um an der Hand zu gehen, aber er hielt sich eifersüchtig dicht an Shasas rechter Seite, Michael ging zu seiner Linken und klammerte sich ohne Scham an Shasas Hand, während Garrick fünf Schritte hinter ihnen trottete und bewundernd zu seinem Vater aufblickte.
»Ich war heute der Beste in Mathematik, Daddy«, sagte Garrick leise, aber das ging im allgemeinen Gelächter und Gebrüll unter.
Als sie nach dem Ritt zusammen das Haus betraten, fanden sie Tara in der Küche, wo sie die letzten Vorbereitungen für das Abendessen überwachte. Sie blickte auf und begrüßte Shasa gleichgültig.
»Guten Tag gehabt?« Sie trug diese schrecklichen Hosen aus verwaschenem blauem Drillich, die Shasa so haßte. Er bevorzugte feminine Kleidung.
»Ganz gut«, antwortete er und versuchte sich von Isabella zu befreien, die noch immer an seinem Hals hing. Er löste sich von ihr und übergab sie der Kinderfrau.
»Wir sind zwölf zum Abendessen.« Tara wandte sich wieder dem malaiischen Küchenchef zu, der respektvoll wartend neben ihr stand.
»Zwölf?« fragte Shasa scharf.
»Ich habe die Broadhursts noch im letzten Augenblick eingeladen.«
»O Gott«, stöhnte Shasa.
»Ich möchte zur Abwechslung einmal bei Tisch ein anregendes Gespräch führen, bei dem es nicht nur um Pferde, Jagd und Geschäfte geht.«
»Das letzte Mal, als sie zum Essen da war, ließ deine und Mollys anregende Unterhaltung die Gesellschaft noch vor neun Uhr aufbrechen.« Shasa warf einen Blick auf seine Uhr. »Ich werde mich umziehen.«
Shasa rasierte sich, während sein farbiger Diener im Ankleidezimmer sein Dinnerjacket zurechtlegte und die Manschettenknöpfe an seinem Hemd befestigte. Trotz Taras heftiger Proteste bestand er darauf, bei Tisch immer eine schwarze Krawatte zu tragen.
»Es ist so altmodisch und steif und versnobt.«
»Es ist zivilisiert«, widersprach er ihr.
Als er angezogen war, überquerte er den breiten mit Perserteppichen belegten Korridor, an dessen Wänden eine Reihe von Aquarellen von Thomas Baines hing, und klopfte an Taras Tür.
Tara war in diese Suite umgezogen, als sie Isabella erwartete, und dabei war es geblieben. Im letzten Jahr hatte sie die Suite neu eingerichtet. Die Samtvorhänge waren entfernt worden, ebenso die Möbel im Stil von George II. und Louis Quatorze, die Seidenteppiche und die herrlichen Ölbilder von De Jong und Naudé. Sie hatte die Samttapete herunterreißen, den Gelbholzboden abschleifen lassen, so daß die rohen Dielenbretter zum Vorschein kamen.
Die Wände wurden schneeweiß gestrichen, das spärliche Mobiliar, das Tara für ihren Salon wählte, war aus rostfreiem Stahl und aus Glas. Das niedrige Bett lag fast auf den bloßen Dielenbrettern des Bodens auf.
»Das ist der schwedische Wohnstil«, hatte sie erklärt.
»Schick es nach Schweden zurück«, hatte er ihr geraten.
Nun setzte er sich auf einen der Stahlsessel und zündete sich eine Zigarette an. Sie warf ihm im Spiegel einen mißbilligenden Blick zu.
»Entschuldige.« Er stand auf und schnippte die Zigarette aus dem Fenster. »Ich werde nach dem Abendessen noch arbeiten müssen«, erklärte er. »Und bevor ich es vergesse, möchte ich dir noch sagen, daß ich morgen nachmittag nach Johannesburg fliege und fünf oder sechs Tage ausbleiben werde.«
»Gut.« Sie spitzte die Lippen, um das blasse, malvenfarbene Lippenrot aufzutragen, das er so abstoßend fand.
»Noch etwas, Tara. Lord Littleton ist bereit, die Aktienausgabe für unsere mögliche Investition in die Goldfelder des Oranjefreistaates zu unterzeichnen. Du könntest mir einen persönlichen Gefallen tun, wenn du und Molly davon absehen würdet, ihm eure schwarzen Schärpen vors Gesicht zu halten und ihm eure Märchen von der weißen Ungerechtigkeit und der blutigen schwarzen Revolution aufzutischen.«
»Für Molly kann ich nicht sprechen, aber was mich betrifft, verspreche ich, brav zu sein.«
»Warum trägst du heute abend nicht deine Diamanten?« wechselte er das Thema. »Sie stehen dir so gut.«
Sie hatte den gelben Diamantenschmuck aus der H´ani Mine nicht mehr getragen, seit sie der Schärpenbewegung beigetreten war. Mit den Diamanten kam sie sich vor wie Marie Antoinette.
»Nicht heute abend«, erwiderte sie. »Der Schmuck ist recht auffällig, und das wird heute ein eher familiäres Abendessen.« Sie puderte sich die Nase und blickte Shasa im Spiegel an. »Warum gehst du nicht schon hinunter, Lieber. Dein teuerster Lord Littleton muß jeden Augenblick eintreffen.«
»Ich möchte Bella erst noch ins Bett bringen.« Er blieb hinter ihr stehen. Sie starrten einander ernst im Spiegel an.
»Was ist bloß aus uns geworden, Tara?« fragte er leise.
»Ich weiß nicht, was du meinst, Lieber«, erwiderte sie, senkte aber unwillkürlich den Blick und ordnete die Falten ihres Kleides.
»Wir sehen uns unten«, sagte er. »Komm aber bald und kümmere dich um Littleton. Er ist wichtig, und er ist ein Damenfreund.«
Nachdem er die Tür hinter sich geschlossen hatte, starrte Tara diese für einen Augenblick an, wiederholte seine Frage laut und gab auch gleich die Antwort: »Was aus uns geworden ist, Shasa? Das ist wirklich ganz einfach. Ich bin erwachsen geworden und kann die Trivialitäten, mit denen du dein Leben ausfüllst, nicht mehr ausstehen.«
Auf dem Weg nach unten schaute sie kurz nach den Kindern. Isabella schlief mit dem Teddy auf dem Gesicht. Tara bewahrte ihre Tochter vor dem Ersticken und ging ins Zimmer der Jungen. Nur Michael war noch wach. Er las.
»Licht aus!« befahl sie.
»Ach, Mutter, nur noch bis zum Ende dieses Kapitels.«
»Aus!«
»Nur noch diese Seite.«
»Aus, habe ich gesagt!« Sie küßte ihn liebevoll.
An der Treppe holte sie tief Atem wie ein Taucher vor dem Sprung ins Wasser, lächelte strahlend und stieg hinunter in den blauen Salon, wo die ersten Gäste bereits an ihren Sherrys nippten.
Lord Littleton war weit besseres Kaliber, als sie erwartet hatte – groß, weißhaarig und gütig.
»Jagen Sie?« fragte Tara bei erster Gelegenheit.
»Ich kann den Anblick von Blut nicht ertragen, meine Liebe.«
»Reiten Sie?«
»Pferde?« schnaubte er. »Verdammt dumme Tiere.«
»Ich glaube, Sie und ich werden gute Freunde werden«, sagte sie.
In Weltevreden gab es viele Räume, die Tara nicht mochte; das Eßzimmer mit all den Köpfen längst verendeter Tiere, die Shasa niedergemetzelt hatte und die nun mit ihren Glasaugen von den Wänden starrten, haßte sie richtiggehend. An diesem Abend ließ sie es darauf ankommen und platzierte Molly links neben Lord Littleton. Molly schaffte es innerhalb weniger Minuten, daß er sich vor Lachen krümmte.
Als sie die Männer bei Portwein und Zigarren zurückließen und sich in den Waschraum begaben, zog Molly Tara nah zu sich heran und sprudelte aufgeregt hervor: »Ich habe den ganzen Abend versucht, dich einmal allein zu sprechen«, flüsterte sie. »Du wirst nie erraten, wer in diesem Augenblick in Kapstadt ist.«
»Sag es mir.«
»Der Generalsekretär des Afrikanischen Nationalkongresses. Moses Gama höchstpersönlich.«
Tara wurde sehr still und blaß und starrte bloß.
»Er kommt zu uns nach Hause und will zu einer kleinen Gruppe von uns sprechen, Tara. Ich habe ihn dazu eingeladen, und er hat ausdrücklich darum gebeten, daß du dabei bist. Ich habe nicht gewußt, daß du ihn kennst.«
»Ich habe ihn nur einmal getroffen –« Sie verbesserte sich, »- zweimal.«
»Kannst du kommen?« drängte Molly. »Es ist besser, wenn Shasa nichts davon erfährt, du verstehst.«
»Wann?«
»Samstag abend, acht Uhr.«
»Shasa ist nicht da, ich werde kommen«, sagte Tara. »Das würde ich mir um nichts in der Welt entgehen lassen.«
Kapitel 3
Sean Courtney war eine Säule der Western Province Preparatory School oder »Wet Pups«, wie die Schule auch genannt wurde. Bärenstark und schnell lief er vier Runs gegen die Rondebosch Juniors und verwandelte selbst, während sein Vater und seine zwei jüngeren Brüder an der Touchline standen und ihn anfeuerten.
Nach dem Schlußpfiff blieb Shasa gerade noch so lange, um seinem Sohn gratulieren zu können.
»Gut gespielt, Sportsmann. Ich bin stolz auf dich«, sagte er. »Tut mir leid, daß ich dieses Wochenende nicht hier bin, aber ich werde es gutmachen.« Und obwohl sein Bedauern ernst gemeint war, verspürte Shasa doch einen Anflug von Übermut, als er zum Flugplatz bei Youngsfield fuhr. Dicky, sein Flugzeugmechaniker, hatte das Flugzeug aus dem Hangar gebracht und abflugbereit auf die Betonrampe gerollt.
»Wie geht’s der linken Magnetzündung?« fragte Shasa, als Dicky im öligen Overall heraneilte. Der kleine Mann warf sich in die Brust.
»Läuft wie eine Nähmaschine«, erwiderte er. Er liebte die Maschine, eine DH 98 Mosquito, fast noch mehr als Shasa, und jeder Defekt, war er auch noch so klein, verletzte ihn tief. Wenn Shasa von einem Defekt berichtete, nahm er das sehr ernst. Er half Shasa, Aktenkoffer, Reisetasche und Gewehrfutteral im Flugzeugbauch zu verstauen.
»Alle Tanks sind voll«, sagte er und setzte eine überhebliche Miene auf, als Shasa darauf bestand, sich selbst davon zu überzeugen, und einen letzten Inspektionsgang um die Maschine machte.
»Sie wird’s wohl überstehen«, gab Shasa schließlich zu und konnte nicht widerstehen, zärtlich über die Tragfläche zu streichen, als wäre es das Bein einer schönen Frau.
In elftausend Fuß Höhe schaltete Shasa die Sauerstoffzufuhr an, in zwanzigtausend Fuß Höhe brachte er die Mosquito auf Kurs, schaltete auf den Autopiloten um, überprüfte sorgsam Abgastemperatur und Drehzahl und lehnte sich dann zurück, um den Flug zu genießen.
Vielleicht war es der reine Sauerstoff, den er atmete, dazu die Verzückung des Fliegens, jedenfalls schienen seine Sinne und sein Verstand hier oben klarer zu arbeiten. Fragen, die unklar gewesen, wurden deutlich, Unsicherheiten lösten sich, und die Stunden jagten ebenso dahin wie die schöne Maschine, die durch das Blau des Himmels raste. Als er auf dem Flughafen von Johannesburg landete, wußte er mit Sicherheit, was zu tun war. David Abrahams erwartete ihn bereits. Er war lang und dünn wie eh und je, aber sein Haar lichtete sich bereits ein wenig, und er trug seit kurzem eine goldumrandete Brille, mit der er aussah, als würde ihn ständig etwas unangenehm berühren. Shasa sprang von der Tragfläche der Mosquito, und sie umarmten sich. Ihr Verhältnis war inniger als das zwischen Brüdern.
David klopfte auf die Tragfläche des Flugzeuges. »Wann werde ich sie wohl wieder einmal fliegen?« fragte er wehmütig. David hatte in der westafrikanischen Wüste das Fliegerkreuz erhalten und einen weiteren Orden in Italien. Er hatte es auf neun Abschüsse gebracht und den Krieg als Oberstleutnant beendet, während Shasa nur ein einfacher Major gewesen war, als er in Abessinien sein Auge verloren hatte und wegen Invalidität in die Heimat zurückgekehrt war.
»Die Maschine ist viel zu gut für dich«, erklärte Shasa und warf sein Gepäck auf den Rücksitz von Davids Cadillac.
Während David den Wagen aus dem Flughafengelände steuerte, tauschten sie Familienneuigkeiten aus. David war mit Tara Courtneys jüngerer Schwester, Mathilda Janine, verheiratet, daher waren sie verschwägert. Shasa erzählte von Sean und Isabella, ohne seine beiden anderen Söhne zu erwähnen, und dann wandten sie sich jenen Themen zu, die den eigentlichen Grund für ihr Zusammentreffen bildeten.
Hierbei ging es einmal um die Entscheidung, ob sie das Optionsrecht auf die neue Silver River Goldmine im Oranjefreistaat ausüben sollten oder nicht. Weiters gab es Schwierigkeiten mit der chemischen Fabrik an der Natalküste. Ein lokaler Interessenverband hatte wegen einer angeblichen Verseuchung des Meeresbodens und der Klippen in dem Gebiet, wo die Fabrik ihre Abwässer ins Meer abließ, Krawall geschlagen. Und schließlich ging es noch um Davids verrückte Idee, mehr als eine Viertelmillion Pfund in einen dieser neuen, riesigen elektronischen Rechner zu investieren, eine Sache, von der er nur schwer abzubringen war.
»Die Yankees haben alle Berechnungen für die Atombombe mit einem dieser Rechner durchgeführt«, führte David an. »Und sie nennen die Geräte nicht Rechner, sondern Computer«, korrigierte er Shasa.
»Na hör mal, Davie, was sollen denn wir damit anfangen?« protestierte Shasa. »Ich habe nicht vor, eine Atombombe zu bauen.«
»Anglo-American haben einen. Dem Computer gehört die Zukunft, Shasa, von dem Zug sollten wir nicht abspringen.«
»Du sprichst von einer Zukunft, die eine Viertelmillion Pfund kostet, alter Freund«, meinte Shasa. »Ausgerechnet jetzt, wo wir jeden Penny für Silver River brauchen!«
»Wenn wir einen solchen Computer gehabt hätten, um die geologischen Analysen auszuwerten, hätten wir jetzt schon fast so viel gespart, wie das ganze Ding kostet, außerdem fiele uns die Entscheidung um vieles leichter, als es nun der Fall ist.«
»Wie kann eine Maschine besser sein als ein menschliches Gehirn?«
»Komm mit und sieh’s dir selber an«, bat David. »Die Universität hat erst kürzlich einen IBM 701 aufstellen lassen. Ich habe für heute nachmittag eine Vorführung arrangiert.«
»Also gut, Davie«, kapitulierte Shasa, »ich schau’ ihn mir an, was aber noch lange nicht heißt, daß ich auch kaufen werde.«
Die IBM-Beauftragte, die die Computeranlage im Kellergeschoß der technischen Fakultät betreute, war knapp sechsundzwanzig Jahre alt.
»Lauter junge Leute«, erklärte David. »Eine Wissenschaft für die junge Generation.«
Die IBM-Beauftragte reichte Shasa die Hand und nahm ihre Hornbrille ab. Plötzlich wuchs Shasas Interesse an elektronischen Computern bedeutend. Ihre Augen waren hellgrün und ihr Haar hatte die Farbe von wildem Honig. Sie trug einen grünen Pullover aus eng anliegender Angorawolle und einen Schottenrock, der ihre gebräunten Waden freiließ. Es stand außer Zweifel, daß sie eine Expertin war, und sie beantwortete alle Fragen von Shasa ohne Zögern in gedehntem Südstaatendialekt.
»Marylee hat den Magistergrad in Elektrotechnik am Massachusetts Institute of Technology erworben«, murmelte David, und zu Shasas anfänglicher Faszination gesellte sich Respekt hinzu.
»Das Ding ist verdammt groß. Es füllt das gesamte Kellergeschoß aus. Der verflixte Apparat hat die Größe eines zweistöckigen Hauses.«
»Das ist die Kühlung«, erklärte Marylee. »Die Hitzeentwicklung ist gewaltig. Den Großteil des Gerätes machen die Kühlwände aus.«
»Was bearbeiten Sie im Augenblick?«
»Professor Darts archäologisches Material aus den Sterkfontein-Höhlen. Wir vergleichen rund zweihunderttausend Beobachtungen von ihm mit über einer Million von den Ausgrabungsstätten in Ostafrika.«
»Wie lange werden Sie dazu brauchen?«
»Wir haben den Lauf vor zwanzig Minuten begonnen und werden kurz vor Feierabend um fünf Uhr fertig sein.«
»Das ist in fünfzehn Minuten«, lächelte Shasa. »Sie wollen mich auf den Arm nehmen!«
»Hätte nichts dagegen«, murmelte sie prüfend, und als sie lächelte, waren ihre Lippen leicht geöffnet, feucht und einfach zum Küssen.
»Sie machen also um fünf Uhr Feierabend?« fragte er. »Wann fangen Sie wieder an?«
»Morgen früh um acht.«
»Und die Maschine steht über Nacht still?«
Marylee warf einen flüchtigen Blick durch den Raum. David stand am anderen Ende vor dem Drucker, und das Summen des Computers übertönte ihre Stimmen.
»Ganz recht, die Maschine wird die ganze Nacht stillstehen. Genauso wie ich.« Offensichtlich war sie eine junge Dame, die genau wußte, was sie wollte und wie sie es bekam. Sie schaute ihn herausfordernd an.
»Das können wir nicht zulassen«, meinte Shasa und schüttelte ernst den Kopf. »Eines hat mir meine Mama beigebracht: ›Spare in der Zeit, so hast du in der Not.‹ Ich kenne ein Lokal namens ›Stardust‹. Die Band dort spielt ausgezeichnet. Ich wette ein Pfund gegen ein Wochenende in Paris, daß ich so lange mit Ihnen tanzen kann, bis Sie um Gnade flehen.«
»Die Wette gilt«, erwiderte sie ernst. »Schwindeln Sie?«
»Natürlich«, antwortete er. Dann kam David zurück, und Shasa fuhr glatt und geschäftsmäßig fort: »Wie hoch sind die Betriebskosten?«
»Einschließlich Versicherung und Wertverlust insgesamt nicht ganz viertausend Pfund im Monat«, erklärte sie mit der passenden sachlichen Miene.
Als sie sich zum Abschied die Hand gaben, steckte sie Shasa eine Visitenkarte zu. »Meine Adresse«, murmelte sie.
»Acht Uhr?« fragte er.
»In Ordnung«, stimmte sie zu.
Als sie wieder im Cadillac saßen, zündete sich Shasa eine Zigarette an und blies einen perfekten Rauchring, der lautlos an der Windschutzscheibe zerschellte.
»Also, Davie, du setzt dich morgen als erstes mit dem Dekan der Technischen Fakultät in Verbindung. Biete ihm an, dieses Monstrum während seiner Stehzeit zwischen fünf Uhr nachmittags und acht Uhr morgens sowie an den Wochenenden zu mieten. Biete ihm viertausend Pfund Monatsmiete und weise darauf hin, daß er dadurch die Betriebskosten spart, weil wir die gesamten Kosten tragen.«
David starrte ihn erstaunt an und wäre dadurch beinahe von der Straße abgekommen.
»Warum ist das mir nicht eingefallen?« fragte er, als er den Cadillac wieder unter Kontrolle hatte.
»Du mußt eben früher aufstehen«, erwiderte Shasa grinsend und fuhr dann fort: »Sobald wir wissen, wie lange wir mit dem Ding arbeiten, werden wir die restliche Zeit an ein paar andere, nicht mit uns konkurrierende Firmen untervermieten, die ebenfalls an einem Computer interessiert sind. Auf diese Weise können wir das Ding gratis benützen, und sobald IBM das Design verbessert und den verdammten Apparat verkleinert hat, kaufen wir uns einen eigenen.«
»Himmeldonnerwetter.« David schüttelte ehrfürchtig den Kopf. »Du Hundesohn.« Und einem plötzlichen Einfall folgend: »Ich werde die kleine Marylee auf unsere Lohnliste setzen –«
»Nein«, sagte Shasa scharf. »Nimm jemand anders.«
David starrte ihn erneut verdutzt an, und seine Begeisterung verflog. Er kannte seinen Schwager nur zu gut.
»Dann wirst du Mattys Einladung zum Dinner heute abend wohl nicht annehmen?« fragte er düster.
»Heute abend nicht«, gab Shasa zu. »Grüße sie von mir und entschuldige mich bei ihr.«
»Sei bloß vorsichtig. Johannesburg ist ein Dorf, und dich kennt man«, meinte David, als er Shasa vor dem Carlton Hotel absetzte, wo das Unternehmen ständig eine Suite gemietet hatte. »Glaubst du, daß du morgen arbeitsfähig sein wirst?«
»Um acht Uhr«, erwiderte Shasa. »Pünktlich.«
Einmütig erklärten Marylee und Shasa das Wetttanzen im »Stardust« für unentschieden und kehrten kurz nach Mitternacht in seine Suite im Carlton Hotel zurück.
Marylees Körper war jung, glatt und fest, und kurz bevor sie, ihren Kopf mit dem honigfarbenen dichten Haar an seine Brust geschmiegt, einschlief, flüsterte sie schläfrig: »Na, ich glaube, das ist so ungefähr das einzige, was mein IBM 701 nicht für mich tun kann.«
Am nächsten Morgen war Shasa bereits fünfzehn Minuten vor David in den Büros der Courtney-Gesellschaft. Er liebte es, den anderen immer einen Schritt voraus zu sein.
Ihre Büros nahmen die gesamte dritte Etage des Standard Bank-Gebäudes in der Commissioner Street ein. Obwohl Shasa ein großes Grundstück gegenüber der Börse und in unmittelbarer Nähe des Hauptsitzes der Anglo-American an der Ecke der Diagonal Street besaß, war er bisher nicht dazu gekommen, dort zu bauen; alle Geldmittel des Unternehmens schienen immer für Bergwerksoptionen oder Erweiterungen oder andere gewinnmaximierende Unternehmungen bestimmt zu sein.
Die jugendliche Zusammensetzung des Verwaltungsrates der Courtney-Gesellschaft war aus guten Gründen mit ein paar grauen Köpfen durchsetzt. So gehörte etwa Dr. Twentyman-Jones noch immer dem Verwaltungsrat an. Er erschien in einem altmodischen schwarzen Alpakasakko mit schmaler Krawatte und verbarg seine Zuneigung für Shasa hinter einer traurigen Miene. Er hatte Anfang der zwanziger Jahre die allererste Schürfstelle der H´ani Diamantenmine für Centaine geführt und war einer der drei erfahrensten und besten Minenfachleute von Südafrika, was soviel hieß wie: der ganzen Welt.
Davids Vater, Abraham Abrahams, war nach wie vor Leiter der Rechtsabteilung. Er saß, lebhaft und heiter wie ein kleiner silberner Spatz, neben seinem Sohn. Seine Akten lagen hoch aufgestapelt vor ihm auf dem Tisch, aber er brauchte sie nur selten zu Hilfe zu nehmen. Mit dem halben Dutzend Neulingen, die Centaine und Shasa selbst ausgewählt hatten, war der Verwaltungsrat ein ausgewogenes und gutfunktionierendes Team.
»Lassen Sie uns zuerst über die Courtney Chemiefabrik in Chakas Bay reden«, eröffnete Shasa die Sitzung. »Wieviel von den Anschuldigungen, die gegen uns erhoben werden, ist wahr, Abe?«
»Wir lassen täglich zwischen elf und sechzehn Tonnen heiße Schwefelsäure in einer Konzentration von eins zu zehntausend ins Meer ab«, erklärte Abe Abrahams sachlich. »Ich habe einen unabhängigen Meeresbiologen damit beauftragt, einen Bericht für uns auszuarbeiten.« Er tippte auf eine Aktenmappe. »Es sieht nicht gut aus. Wir haben auf fünf Meilen entlang der Küste die Wasserstoffkonzentration völlig verändert.«
»Sie haben diesen Bericht doch nicht etwa veröffentlicht?« fragte Shasa scharf.
»Wo denken Sie hin?« Abe schüttelte den Kopf.
»Nun, David, was würde es uns kosten, die Düngemittelherstellung so umzustellen, daß die abfallende Säure auf andere Weise entsorgt wird?«
»Da gibt es zwei Möglichkeiten«, erklärte David. »Die einfachste und billigste Alternative wäre der Abtransport durch Tanker, aber dann müßten wir ein anderes Endlager finden. Die Ideallösung wäre die Wiederaufbereitung der Schwefelsäure.«
»Und die Kosten?«
»Jährlich hunderttausend Pfund für die Tanker – Die Wiederaufbereitungsanlage würde das Dreifache kosten.«
»Der Gewinn eines ganzen Jahres ginge in die Binsen«, bemerkte Shasa. »Das ist unakzeptabel. Wer ist diese Mrs. Pearson, die die Protestbewegung anführt? Läßt sie mit sich reden?«
Abe schüttelte den Kopf. »Das haben wir versucht. Sie hält die ganze Bewegung zusammen. Ohne sie werden die Knie weich.«
»Welche Stellung hat sie dort?«
»Ihrem Mann gehört die Bäckerei des Ortes.«