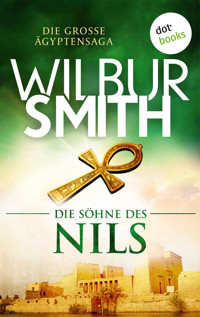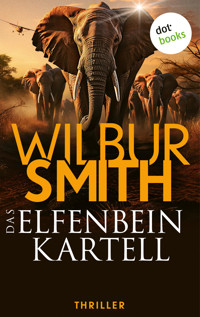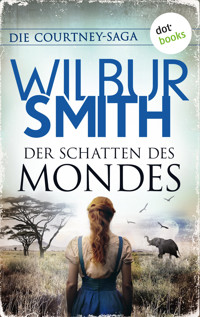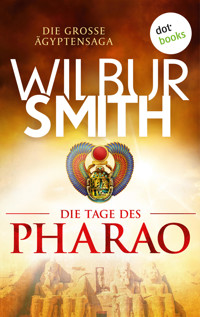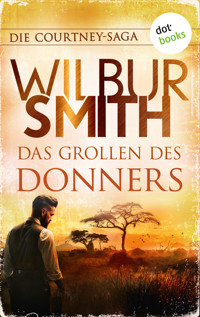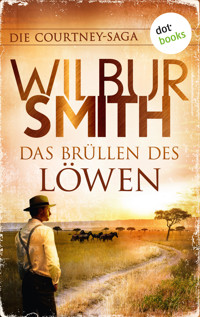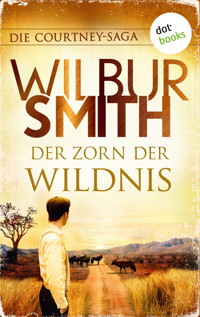
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Das internationale Phänomen, das den Weltruhm des Autors begründet hat: »Die einzigartige Mischung aus Action, Abenteuer und exotischen Schauplätzen macht Wilbur Smith zu einem faszinierenden Leseerlebnis«, urteilt The Mirror. Eine mächtige Familie – eine Zeit des Krieges … Südafrika in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Seit eine Fehde ihre beiden Eltern entzweite, leben die Halbbrüder Sasha Courtney und Manfred De La Rey in unterschiedlichen Welten: Während Sasha mit Kalkül und Durchblick den Wohlstand der eigenen Minengesellschaft sichern muss, verdient Manfred seinen Lebensunterhalt als Großwildjäger in der sonnengebleichten Savanne. Doch ihre gemeinsame Bestimmung führt die beiden Brüder unaufhaltsam aufeinander zu – mit fatalen Folgen: Als die Schatten des zweiten Weltkriegs auch Afrika erreichen, müssen die Rivalen eine Seite wählen. Ihre Entscheidung wird das Schicksal ihres Heimatlandes für immer verändern … Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der abenteuerliche Afrika-Roman »Der Zorn der Wildnis« von Bestseller-Autor Wilbur Smith ist der fünfte Band seiner epochalen historischen Familiensaga um die Familie Courtney – Fans von Robert Harris und James Clavell werden begeistert sein! Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 936
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über dieses Buch:
Südafrika in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Seit eine Fehde ihre beiden Eltern entzweite, leben die Halbbrüder Sasha Courtney und Manfred De La Rey in unterschiedlichen Welten: Während Sasha mit Kalkül und Durchblick den Wohlstand der eigenen Minengesellschaft sichern muss, verdient Manfred seinen Lebensunterhalt als Großwildjäger in der sonnengebleichten Savanne. Doch ihre gemeinsame Bestimmung führt die beiden Brüder unaufhaltsam aufeinander zu – mit fatalen Folgen: Als die Schatten des zweiten Weltkriegs auch Afrika erreichen, müssen die Rivalen eine Seite wählen. Ihre Entscheidung wird das Schicksal ihres Heimatlandes für immer verändern …
Über den Autor:
Wilbur Smith (1933–2021) wurde in Zentralafrika geboren und gehört zu den erfolgreichsten Schriftstellern der Gegenwart. Der Debütroman seiner Jahrhunderte umspannenden Südafrika-Saga um die Familie Courtney, begründete seinen Welterfolg als Schriftsteller. Seitdem hat er über 50 Romane geschrieben, die allesamt Bestseller wurden, und in denen er seine Erfahrungen aus verschiedenen Expeditionen in die ganze Welt verarbeitete. Seine Bücher wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt und mehrfach verfilmt. Wilbur Smith starb 2021 in Kapstadt im Kreise seiner Familie.
Die Website des Autors: wilbursmithbooks.com/
Der Autor bei Facebook: facebook.com/WilburSmith/
Der Autor auf Instagram: instagram.com/thewilbursmith/
Die große Südafrika-Saga des Autors um die Familie Courtney erscheint bei dotbooks im eBook. Der Reihenauftakt »Das Brüllen des Löwen« ist auch als Hörbuch bei SAGA Egmont erhältlich.
Die große Ägypten-Saga über den Eunuchen Taita ist bei dotbooks als eBook erhältlich. Der Reihenauftakt »Die Tage des Pharao« ist auch als Hörbuch bei SAGA Egmont erhältlich.
Außerdem bei dotbooks erschienen der Abenteuerroman »Der Sonnenvogel« sowie die Action-Thriller »Greed – Der Ruf des Goldes«, »Blood Diamond – Tödliche Jagd«, »Black Sun – Die Kongo-Operation«, »Das Elfenbein-Kartell« und »Atlas – Die Stunde der Entscheidung«. Weitere Bände in Vorbereitung.
***
eBook-Ausgabe November 2024
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1986 unter dem Originaltitel »Power of the Sword« bei William Heinemann Ltd., London. Die deutsche Erstausgabe erschien 1988 unter dem Titel »Wer aber Gewalt sät« im Paul Zsolnay Verlag.
First published in 1986 by William Heinemann Ltd.
Copyright © Wilbur Smith 1986
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1988 by Paul Zsolnay Verlag Gesellschaft mbH, Wien und Rastatt
Copyright © der eBook-Ausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/Vladislav T. Jirousek, Nik Merkulov, Eugen Haag, Nord_KM, Lucian Coman, Vaclav Sebek, Blue Snap
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (fb)
ISBN 978-3-98952-473-6
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. In diesem eBook begegnen Sie daher möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Diese Fiktion spiegelt nicht automatisch die Überzeugungen des Verlags wider oder die heutige Überzeugung der Autorinnen und Autoren, da sich diese seit der Erstveröffentlichung verändert haben können. Es ist außerdem möglich, dass dieses eBook Themenschilderungen enthält, die als belastend oder triggernd empfunden werden können. Bei genaueren Fragen zum Inhalt wenden Sie sich bitte an [email protected].
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Wilbur Smith
Der Zorn der Wildnis
Die Courtney-Saga 5
Aus dem Englischen von Grit Zoller
dotbooks.
Widmung
Für Danielle
mit all meiner Liebe
Motto
»Hätte ich der Willkür nachgegeben und,
der Saat der Gewalt weichend,
die Gesetze beugen lassen,
ich stünde nicht hier.«
König Karl I. von England
auf dem Schafott, 30. Januar 1649.
Kapitel 1
Dichter Nebel lag über dem Wasser und dämpfte jeden Laut, jede Farbe. Es wogte und wallte mit den ersten Böen des Morgenwindes, die auf das Land zustrichen. Der Trawler lag drei Meilen vor der Küste am Rand der Benguela-Meeresströmung – dort, wo die gewaltigen, planktonreichen, aus den Tiefen des Ozeans aufsteigenden Fluten sich längs einer dunkelgrünen Linie mit dem sanften Küstengewässer vereinigten.
Lothar De La Rey stand im Ruderhaus an das hölzerne Ruderrad gelehnt und starrte in den Nebel hinaus. Er spürte, wie sich allmählich prickelnde Spannung in ihm ausbreitete.
Er hatte Hunderte solcher Morgendämmerungen erlebt, als er noch Jagd auf großes Wild machte – auf rauhmähnige Kalaharilöwen, räudige alte Büffel mit gewaltigem Gehörn, weise Grauelefanten mit runzeliger Haut und kostbarem, langem Gezähn aus Elfenbein –, aber jetzt war das Wild kleiner und doch in seiner großen Zahl ebenso gewaltig wie der Ozean, aus dem es stammte.
Sein Gedankengang wurde unterbrochen, denn sein Sohn kam von der Kombüse über das offene Deck heran. Er hatte lange, braungebrannte kräftige Beine und ging barfuß. Er war fast so groß wie ein erwachsener Mann und mußte sich bücken, als er, in jeder Hand einen dampfenden Becher Kaffee balancierend, ins Ruderhaus trat.
»Gezuckert?« fragte Lothar.
»Vier Löffel, Pa«, sagte der Junge grinsend.
Sein blonder Schopf war von der Sonne platinfarben gebleicht, aber seine dichten Wimpern und Augenbrauen waren schwarz und seine Augen bernsteinfarben.
»Wahnsinnsfang heute.« Lothar kreuzte abergläubisch die Finger seiner rechten Hand. »Wir brauchen ihn«, dachte er. »Um zu überleben, brauchen wir ihn unbedingt.«
Vor fünf Jahren war er noch einmal dem Ruf des Jagdhorns, den Lockungen der Jagd und der Wildnis erlegen. Er hatte die gutgehende Straßen- und Eisenbahnbaugesellschaft, die er unter Mühen aufgebaut hatte, verkauft, Kredite genommen, wo er sie kriegte, und alles aufs Spiel gesetzt.
Er wußte von den unermeßlichen Schätzen, die das kalte grüne Wasser des Benguelastroms barg. Zum ersten Mal zu sehen bekommen hatte er sie in jenen chaotischen letzten Tagen des Ersten Weltkrieges, als er ein letztes Kommandounternehmen gegen die verhaßten Engländer und deren verräterische Marionette Jan Smuts, der an der Spitze der südafrikanischen Truppen stand, führte
Aus einem geheimen Vorratslager zwischen den hohen Dünen längs der südatlantischen Küste hatte er die deutschen U-Boote mit Treibstoff und Munition versorgt, und während er an diesem Küstenstrich tagelang auf die U-Boote wartete, sah er, wie die riesigen Fischschwärme den Ozean aufwühlten. In den Jahren, die dem unwürdigen Frieden von Versailles folgten und in denen er sich in Staub und Hitze mit Dynamit und schweren Maschinen durch die Berge fraß oder Straßen durch flimmernde Wüsten legte, war der Plan in ihm gereift. Er hatte gespart und Pläne geschmiedet.
Die Boote, klapprige alte Sardinentrawler, hatte er in Portugal aufgetrieben. Dort war er auch auf Da Silva gestoßen, einen alten und erfahrenen Seebären. Gemeinsam hatten sie die vier Trawler repariert und neu ausgerüstet und waren dann mit wenig Besatzung den afrikanischen Kontinent entlang nach Süden geschippert.
Die Konservenfabrik hatte er in Kalifornien entdeckt, wo sie zur Thunfischverwertung errichtet worden war, allerdings von einer Gesellschaft, die die Thunfischvorkommen über- und die Fangkosten dieses unzuverlässigen, unberechenbaren »Hühnchen des Meeres« unterschätzte. Lothar kaufte die Fabrik um einen Bruchteil der Gestehungskosten und verschiffte sie komplett nach Afrika. Hier ließ er sie auf dem gewalzten Sandboden neben der aufgelassenen und verfallenen Walfangstation, der diese trostlose Bucht den Namen Walvis Bay verdankte, wieder aufbauen.
In den ersten drei Fangjahren hatten Lothar und der alte Da Silva gute Ausbeute gemacht und die riesigen Fischschwärme abgeerntet, bis die Darlehen, die Lothar bedrückten, abbezahlt waren. Um die altersschwachen portugiesischen Trawler zu ersetzen, hatte er umgehend neue Boote bestellt und sich auf diese Weise tiefer in Schulden gestürzt als zu Beginn des riskanten Unternehmens.
Und dann gab’s keine Fische mehr. Aus unerklärlichen Gründen waren die riesigen Pilchardschwärme bis auf kleine Pulks da und dort verschwunden. Sie suchten vergeblich nach ihnen, liefen hundert Meilen und mehr auf die offene See hinaus, entfernten sich weit über die wirtschaftlich vertretbare Grenze von der Konservenfabrik, durchstöberten die lange öde Küste, und dabei vergingen unaufhaltsam die Monate. An jedem Monatsersten traf eine Mitteilung über die abgelaufenen Zinsen ein, die Lothar nicht begleichen konnte, außerdem sammelten sich die Betriebskosten für die Fabrik und die Fischerboote an, so daß er schließlich um weitere Kredite betteln mußte.
Zwei Jahre vergingen ohne ergiebigen Fang. Doch dann, gerade als Lothar sich geschlagen geben wollte, kam es zu einer unmerklichen Veränderung der Meeresströmung oder der herrschenden Windverhältnisse, und die Schwärme waren wieder da, riesig, unübersehbar, in der Morgendämmerung nach oben strebend wie frisches Gras.
»Laß es so bleiben«, betete Lothar im stillen. »Bitte, Herr, laß es so bleiben.« Noch drei Monate, nur noch drei kurze Monate, und er würde alles abzahlen können und wieder schuldenfrei sein.
»Es klart auf«, sagte der Junge, und Lothar schüttelte leicht den Kopf, um seine Gedanken zu verscheuchen.
Der Nebel hob sich wie ein Bühnenvorhang, und die Szenerie, die dahinter zum Vorschein kam, wirkte theatralisch und unwirklich. Der Dunst glühte und kochte wie der Widerschein eines Feuerwerks, und das orange-goldene Licht färbte die wabernden Nebelschwaden blutrot und rosa.
Dann brach mit einem Strahl hellen goldenen Lichts die Sonne durch die Nebelbank. Das Licht spielte auf der Wasseroberfläche, so daß die Strömungslinie deutlich sichtbar wurde. Das Küstenwasser war wolkig blau und ruhig und glatt wie Öl, die Linie, wo es auf die Tiefenströmung traf, scharf wie die Schneide einer Messerklinge.
»Daar spring hy!“ schrie Da Silva am Vorderdeck und deutete auf die dunkle Linie im Wasser. »Da springt er!“
Als der erste Sonnenstrahl auf das Wasser auftraf, sprang ein einzelner Fisch. Er war kaum länger als eine Männerhand – ein kleiner Span aus poliertem Silber.
»Motor anlassen!« Lothars Stimme war heiser vor Erregung. Der Junge stellte seinen Becher so heftig auf den Kartentisch, daß die letzten Tropfen Kaffee herausspritzten, und verschwand im Niedergang zum Maschinenraum.
Lothar drehte mit fliegender Hast an den Schaltern und packte den Gashebel, als sich der Junge unter ihm zum Griff der Anlaßkurbel bückte.
»Los!« brüllte Lothar. Der Junge nahm seine ganze Kraft zusammen und stemmte sich gegen den Druck der vier Zylinder.
»Jetzt!« Lothar schloß die Vordrossel, und die Maschine, noch warm von der Fahrt aus dem Hafen, sprang augenblicklich an. Öligschwarzer Rauch brach aus dem Auspuffkanal an der Seite des Schiffsrumpfes, dann lief die Maschine rund und gleichmäßig.
Der Junge kletterte die Leiter herauf und stürmte hinaus aufs Vordeck zu Da Silva.
Lothar wendete und steuerte das Boot an die Strömungslinie heran. Der Nebel zog ab, und sie sahen die anderen Boote. Diese hatten ebenfalls still in der Nebelbank gelegen und auf die ersten Sonnenstrahlen gewartet und hielten jetzt ungeduldig auf die Strömungslinie zu. Die Mannschaften drängten sich an die Relings und reckten die Hälse.
Vom verglasten Ruderhaus aus kontrollierte Lothar ein letztes Mal die Vorbereitungen. Das lange Netz war entlang der Steuerbordreling ausgelegt, die Obersimm fein säuberlich schneckenförmig aufgerollt. Trocken wog das Netz siebeneinhalb Tonnen, naß um ein Vielfaches mehr. Es war hundertfünfzig Meter lang und reichte im Wasser, wie ein Gazevorhang an den Korkschwimmern hängend, einundzwanzig Meter in die Tiefe. Das Netz hatte Lothar über fünftausend Pfund gekostet, mehr Geld, als ein gewöhnlicher Fischer in zwanzig Jahren unermüdlicher Arbeit verdienen konnte. Und die anderen drei Boote waren genauso ausgerüstet. Jeder Trawler hatte sein »Bucky« im Schlepptau, ein fünf Meter langes Dingi in Klinkerbauart, das mit einer schweren Fangleine am Heck befestigt war.
Gerade als Lothar wieder nach vorne blickte, sprang der nächste Fisch, diesmal so nahe, daß er die dunkle Linienzeichnung an seiner glänzenden Flanke erkennen konnte. Dann plumpste der Fisch zurück und hinterließ dunkle Wellenringe auf der Wasseroberfläche.
Wie auf ein Signal wurde das Meer plötzlich lebendig, verdunkelte sich wie im Schatten einer mächtigen Wolke, aber diese Wolke kam von unten, stieg aus den Tiefen empor, und das Wasser begann zu brodeln, als würde es von einem Ungeheuer aufgewühlt.
Vor ihnen lag ein einziger dunkler Fischschwarm, eine Meile breit und so lang, daß sein anderes Ende in der zurückweichenden Nebelbank verschwand. Lothar hatte in all den Jahren als Jäger noch nie eine solche Anhäufung von Lebewesen, eine so große Menge von Exemplaren einer einzelnen Spezies gesehen. Neben diesen Massen waren die Wanderheuschrecken, die die afrikanische Mittagssonne verhüllen und verdunkeln konnten, und die Scharen winziger Queleavögel, unter deren Gewicht die Äste großer Bäume abbrachen, vergleichsweise unbedeutend.
Der erste, der aktiv wurde, war Da Silva. Er drehte sich um und lief, beweglich und flink wie ein Jüngling, über das Deck nach achtern. Nur an der Tür zum Ruderhaus blieb er kurz stehen. »Gäbe die Jungfrau Maria, daß wir das Netz noch haben, wenn dieser Tag zu Ende ist.«
Nach dieser unmißverständlichen Warnung rannte der alte Mann zum Heck und kletterte über das Schandeck in das Beiboot, während die anderen Männer ebenfalls lebendig wurden und rasch ihre Posten einnahmen.
»Manfred!« rief Lothar, und sein Sohn, der wie hypnotisiert am Bug gestanden hatte, hob den Kopf und kam gehorsam angerannt.
»Übernimm das Ruder.« Für ein Kind war das eine ungeheure Verantwortung, aber Manfred hatte sich schon so oft bewährt, daß Lothar bedenkenlos das Ruderhaus verlassen konnte. Ohne zurückzublicken, gab er vom Bug aus seine Signale und fühlte, wie sich das Deck unter seinen Füßen neigte, als Manfred das Ruder herumwarf und, dem Befehl seines Vaters folgend, den Schwarm in einem großen Bogen zu umfahren begann.
»So viel Fisch«, flüsterte Lothar. Als er Entfernung, Windgeschwindigkeit und Strömung abschätzte, stand die Warnung des alten Da Silva an erster Stelle seiner Überlegungen: Hundertfünfzig Tonnen Fisch konnten der Trawler und das Netz bewältigen. Mit etwas Glück und Geschick vielleicht zweihundert.
Vor ihm lag ein Schwarm von einigen Millionen Tonnen. Brachte man das Netz im falschen Augenblick aus, würde es sich mit zehn- oder zwanzigtausend Tonnen füllen, und dann konnte es geschehen, daß Gewicht und Kraft der Fischmasse das Maschenwerk zerfetzten oder gar das Netz losrissen, daß die Obersimm brach oder die Poller vom Deck in die Tiefe gezerrt wurden. Schlimmer noch, wenn Leinen und Poller hielten, denn dann bestand die Gefahr, daß der Trawler durch das Gewicht krängte und kenterte.
Manfred grinste ihm durch das Fenster des Ruderhauses zu. Mit seinen strahlenden bernsteinfarbenen Augen und den blitzenden weißen Zähnen war er seiner Mutter ähnlich. Lothar wurde es schmerzlich bewußt, und er wandte sich rasch wieder seiner Arbeit zu.
Die wenigen Augenblicke der Unaufmerksamkeit wären Lothar beinahe zum Verhängnis geworden. Der Trawler fuhr direkt auf den Schwarm zu, würde innerhalb von Sekunden über ihm sein, und die Fische würden wegtauchen. Der ganze Schwarm, der sich so harmonisch bewegte, als wäre er ein einziger riesiger Organismus, würde wieder in den Tiefen des Ozeans verschwinden. Rasch gab Lothar das Zeichen zum Abdrehen, und der Junge reagierte sofort. Der Trawler machte eine Drehung um sein Heck, und sie liefen in einer Entfernung von fünfzehn Metern am Rand des Schwarmes entlang und warteten auf eine günstige Gelegenheit.
Ein rascher Blick in die Runde zeigte Lothar, daß seine Kapitäne auf den anderen Booten ebenfalls vorsichtig Abstand hielten. Swart Hendrick, ein riesiger Bulle von Mann, dessen Kahlkopf wie eine Kanonenkugel in der Morgensonne glänzte, starrte zu ihm herüber. Wie Lothar selbst hatte sein langjähriger Kampfgefährte und Begleiter ohne Mühe den Wechsel vom Land zum Wasser geschafft und war als Fischer ebenso geschickt wie einst als Elfenbein- und Menschenjäger.
Der Fischschwarm behielt seine geschlossene Formation bei, und Lothar begann allmählich zu verzagen. Die Fische waren nun schon über eine Stunde an der Oberfläche, viel länger als gewöhnlich. Jeden Augenblick konnten sie wegtauchen oder verschwinden, und keines seiner Boote hatte das Netz ausgebracht. Durch den Überfluß waren ihnen die Hände gebunden, und Lothar spürte, wie ihn eine wilde Verwegenheit überkam. Er hatte schon zu lange gewartet.
»Zum Teufel damit, wirf das Netz aus!« dachte er und bedeutete Manfred, näher an den Schwarm zu steuern.
Bevor er sich zu dieser Wahnsinnstat entschließen konnte, hörte er Da Silva pfeifen und blickte zurück. Der Portugiese stand auf der Ruderbank des Beibootes und gestikulierte wild. Der Fischschwarm begann sich hinter ihnen auszubauchen. Die feste runde Masse veränderte ihre Form. Ein Fühler wuchs aus ihr hervor, nein, es sah eher aus wie ein Kopf an einem dünnen Hals, als ein Teil des Schwarmes sich von der Hauptmasse löste. Das war es, worauf sie gewartet hatten.
»Manfred!« brüllte Lothar und bewegte seinen rechten Arm wie eine Windmühle. Der Junge riß das Ruder herum, das Boot drehte sich, sie fuhren mit voller Geschwindigkeit zurück, und der Bug des Trawlers zielte wie das Blatt eines Henkerbeiles auf den Hals des Schwarmes.
»Geschwindigkeit drosseln!« Lothar gab das entsprechende Handzeichen, und der Trawler wurde langsamer.
Mit viel Gefühl manövrierten Lothar und Manfred den Bug des Trawlers in die lebendige Masse. Sie fuhren mit kleinster Kraft, damit die Fische nicht unruhig wurden und wegtauchten. Der schmale Hals teilte sich vor dem Bug, und der kleinere Schwarm löste sich von der Hauptmasse.
»Noch immer zuviel!« murmelte Lothar. Es waren nach Lothars Schätzung noch immer weit über tausend Tonnen.
Es war riskant, äußerst riskant. Aus dem Augenwinkel sah Lothar, daß Da Silva mit heftigen Gesten zur Vorsicht mahnte. Dann pfiff er auch noch, schrill vor Aufregung. Dem alten Mann machte diese Menge Fisch Angst, und Lothar mußte grinsen, als er dem alten Mann demonstrativ den Rücken zukehrte und Manfred das Zeichen zum Beschleunigen gab.
Er ließ Manfred die Geschwindigkeit bei fünf Knoten halten und in engem Bogen beidrehen, so daß der Fischschwarm in der Mitte des Kreises zusammengetrieben wurde. Als der Trawler die zweite Runde gemacht hatte und im Wind an dem Schwarm vorbeitrieb, drehte sich Lothar zum Heck herum und legte die Hände trichterförmig an den Mund.
»Los!« brüllte er. »Beiboot losmachen!«
Der schwarze Herero am Heck löste mit einem Griff den Knoten, mit dem die Fangleine des Beibootes befestigt war, und warf die Leine über Bord. Das kleine hölzerne Dingi mit Da Silva an Bord fiel rasch vom Trawler ab und zog das Ende des schweren braunen Netzes mit sich.
Der Trawler umkreiste den Fischschwarm, und das grobe braune Maschengeflecht lief kratzend und knirschend über die hölzerne Reling. Die Obersimm, Nabelschnur zwischen Trawler und Dingi, wickelte sich los und glitt wie ein Python über Bord. Als der Trawler vor dem Wind zurückstampfte, bildeten die Korkschwimmer der Obersimm, gleichmäßig aufgereiht wie die Perlen einer Kette, einen Kreis um den geschlossenen dunklen Fischschwarm, und das Dingi, in dem Da Silva mit hängenden Schultern saß, lag direkt vor ihnen.
Manfred glich mit dem Ruder den Widerstand des großen Netzes aus und brachte den Trawler längsseits an das schaukelnde Dingi. Als sich die beiden Boote berührten, hielt er die Maschine an. Nun war das Netz geschlossen und der Schwarm gefangen. Da Silva kletterte, die Enden der schweren dreizölligen Hanftaue über der Schulter, an Bord.
»Du wirst das Netz verlieren«, rief er Lothar zu. »Nur ein Verrückter macht das Netz um diesen Schwarm zu – sie werden mitsamt dem Netz abhauen. Der heilige Antonius und der heilige Markus sind meine Zeugen –« Aber die Mannschaft machte sich bereits davon, unter Lothars knappen Anweisungen das Netz einzuholen. Zwei der Hereromänner hoben das Haupttau von Da Silvas Schultern und zurrten es fest, während ein anderer mit Lothar die Sacknetzleine zur Hauptwinde zog.
»Es ist mein Netz, und mein Fang«, brummte Lothar, als er die Winde in Gang setzte. »Häng das Bucky fest!«
Das Netz hing zwanzig Meter tief ins klare grüne Wasser, aber es war unten offen. Die erste und vordringlichste Arbeit bestand darin, das Netz zu schließen, bevor der Schwarm diesen Fluchtweg entdeckte. Lothar beugte sich über die Winde und zog mit rhythmischen Bewegungen der Arme und Schultern die Sacknetzleine ein, so daß sie sich um die rotierende Seiltrommel legte. Die Sacknetzleine lief durch Stahlringe am unteren Ende des Netzes und schloß wie das Zugband eines riesigen Tabaksbeutels die Öffnung.
Manfred hatte im Ruderhaus alle Hände voll zu tun, das Heck des Trawlers vom Netz fernzuhalten und zu verhindern, daß dieses sich um die Schraube wickelte. Inzwischen hatte Da Silva das Ding ans andere Ende der Obersimm gerudert und es dort eingehakt, um für den kritischen Augenblick, wenn der übergroße Schwarm bemerkte, daß er gefangen war, und zu rasen begann, zusätzlichen Auftrieb zu schaffen. Lothar holte die schwere Sacknetzleine ein, bis schließlich das Bündel Stahlringe an der Reling auftauchte. Das Netz war geschlossen, sie hatten den Schwarm im Sack.
Schweißnaß und so außer Atem, daß er nicht sprechen konnte, lehnte sich Lothar gegen das Schandeck.
Die Korkschwimmer der Obersimm lagen säuberlich auf dem sanft bewegten Wasser. Doch während Lothar noch nach Luft rang, veränderte der Kranz von Korkschwimmern plötzlich seine Form und zog sich in die Länge. Der Schwarm hatte das Netz bemerkt und drückte in plötzlicher Vorwärtsbewegung dagegen. Dann drehte der Schwarm um, und der Ansturm erfolgte in entgegengesetzter Richtung. Das Dingi wurde wie eine Nußschale hin und her geworfen. Der Schwarm besaß eine ungeheure Kraft.
»Himmel, das ist ja noch mehr, als ich gedacht habe«, keuchte Lothar. Dann raffte er sich auf, warf mit einem Ruck die nassen blonden Strähnen zurück und stürzte zum Ruderhaus.
»Da Silva hatte recht. Sie spielen verrückt«, flüsterte er und langte nach dem Griff des Nebelhorns. Er ließ drei kurze schrille Signale ertönen – die Bitte um Unterstützung. Als er wieder an Deck stürmte, sah er, daß die anderen drei Trawler wendeten und mit Höchstgeschwindigkeit herankamen. Auf keinem von ihnen hatte man bisher den Mut aufgebracht, das Netz auszubringen.
»Schnell, verdammt noch mal! Schnell!« rief Lothar ihnen zu. Und an seine eigene Mannschaft gewandt: »Alle Mann zum Hieven!«
Die Mannschaft zögerte, wollte nicht so recht, wagte sich nur ungern an dieses Netz.
»Bewegt euch, ihr schwarzen Bastarde!« schrie Lothar sie an und sprang zum Schandeck, um mit gutem Beispiel voranzugehen. Sie mußten den Schwarm zusammendrücken, die kleinen Fische so fest gegeneinanderdrängen, daß sie keine Kraft mehr hatten.
Das Netz war rauh und scharf wie Stacheldraht, aber sie stellten sich in einer Reihe auf und bückten sich, um das Netz im Rhythmus der sanften Dünung mit der Hand einzuholen. Mit jedem gemeinsamen Zug schafften sie ein paar Zentimeter.
Dann wurde der Schwarm wieder wild, und das Stück Netz, das sie gewonnen hatten, wurde ihnen aus den Händen gerissen. Einer der Hereromänner ließ nicht schnell genug los, und die Finger seiner rechten Hand verfingen sich im groben Geflecht. Wie einen Handschuh riß es ihm die Haut von den Fingern, so daß die blanken weißen Knochen und das rohe Fleisch zum Vorschein kamen. Er schrie und preßte die verstümmelte Hand gegen seine Brust. Das Blut spritzte ihm ins Gesicht, lief über die schweißglänzende schwarze Haut seines Oberkörpers und durchtränkte seine Hose.
»Manfred!« rief Lothar. »Kümmere dich um ihn!« Dann wandte er seine ganze Aufmerksamkeit wieder dem Netz zu. Der Schwarm versuchte wegzutauchen, zog ein Ende der Obersimm unter die Wasseroberfläche. Ein kleiner Teil des Schwarmes entwischte an dieser Stelle.
»Gott sei Dank sind wir euch los«, murmelte Lothar. Aber der Großteil des Schwarmes war noch gefangen, und die Korkschwimmer kamen wieder an die Oberfläche. Der Schwarm drängte abermals nach unten, und diesmal krängte der schwere, fünfzehn Meter lange Trawler so gefährlich, daß die Männer mit aschgrauen Gesichtern nach einem Halt suchten.
Das Dingi auf der anderen Seite des Korkschwimmerkranzes wurde mitgezogen. Es hatte nicht genug Tragvermögen, dem standzuhalten. Wasser strömte über das Schandeck ins Innere und brachte das Boot zum Sinken.
»Spring!« brüllte Lothar dem alten Mann zu. »Weg vom Netz!« Sie wußten beide um die Gefahr.
In der vorangegangenen Saison war einer aus ihrer Mannschaft in das Netz gefallen. Die Fische waren sofort auf ihn eingedrungen, hatten ihn unter die Oberfläche gedrückt und in dem Versuch zu entkommen gegen den Widerstand seines Körpers angekämpft.
Als sie die Leiche schließlich nach Stunden vom Netzboden bergen konnten, sahen sie, daß die Fische durch den ungeheuren Druck, der in Tiefe des gefangenen Schwarmes herrschte, durch Mund, Augenhöhlen und Anus in den Körper des Mannes eingedrungen waren. Der Leichnam war vollgestopft mit Fischen, zum Ballon gebläht – ein Anblick, den keiner von ihnen je vergessen würde.
»Weg vom Netz!« brüllte Lothar noch einmal, und Da Silva warf sich auf der anderen Seite aus dem sinkenden Dingi, unmittelbar bevor es unter Wasser gezogen wurde.
Swart Hendrick war schon zur Stelle, um ihn herauszuholen. Er schob seinen Trawler längsseits an die Obersimm heran, und zwei seiner Männer halfen Da Silva an Bord, während die anderen sich über die Reling beugten und unter Swart Hendricks Anleitung das Netz einhakten.
»Wenn bloß das Netz hält«, brummte Lothar, als sich die anderen beiden Trawler an der Obersimm einhakten. Nun bildeten die vier großen Boote einen Kreis um den gefangenen Schwarm, und die Männer begannen das Netz einzuholen.
Sie standen an der Reling und holten das Netz Zug um Zug ein – zwölf Mann auf jedem Trawler, selbst Manfred arbeitete an der Seite seines Vaters. Sie keuchten und schwitzten, das Blut lief ihnen über die zerschundenen Hände, der Schmerz brannte ihnen in Rücken und Schultern, aber sie hoben den riesigen Schwarm langsam, Zentimeter für Zentimeter aus dem Wasser, bis er schließlich »trocken hing«.
»Ausschöpfen!« brüllte Lothar, und auf allen Booten nahmen die drei Schöpfmänner die langstieligen Schöpfnetze von den Halterungen über dem Ruderhaus und schleppten sie zur Reling.
Die Schöpfnetze hatten die selbe Form wie Schmetterlingsnetze oder die kleinen Handkescher, mit denen Kinder am Strand Garnelen und Krabben fangen. Allerdings waren die Stiele dieser übergroßen Kescher fast zehn Meter lang, und die Netzsäcke faßten über eine Tonne Fisch. Von drei Punkten des Stahlringes, der die Öffnung des Netzes bildete, gingen Hanftaue ab, die in der Mitte über dem Netz zu dem schweren Windentau zusammengesplißt waren, mit dem das Schöpfnetz gehoben und gesenkt wurde. Der Boden des Netzes konnte ebenso wie das große Hauptnetz mit einer Sacknetzleine, die durch eine Reihe kleiner Stahlringe lief, geöffnet und geschlossen werden.
Während das Schöpfnetz in Position gebracht wurde, öffneten Lothar und Manfred die Lukendeckel zum Laderaum unter Deck. Dann nahmen sie eilig ihre Posten ein – Lothar an der Winde, Manfred am Ende der Sacknetzleine des Schöpfnetzes. Ratternd und quietschend kurbelte Lothar das Schöpfnetz am Ladebaum über ihren Köpfen hoch, während die drei Schöpfmänner das Netz am Stiel hinausschwenkten. Manfred zog an der Sacknetzleine, so daß sich der Boden des Schöpfnetzes schloß.
Lothar warf den Hebel der Winde herum, und das schwere Schöpfnetz bohrte sich unter neuerlichem schrillen Quietschen des Rollkolbens in die silbrige Fischmasse. Die drei Schöpfmänner verlagerten ihr ganzes Gewicht auf den Stiel und trieben das Netz tief in den lebenden Brei von Pilchards.
»Hieven!« brüllte Lothar und setzte die Winde wieder in Bewegung. Das Netz wurde durch den Schwarm hochgezogen und kam mit einer Tonne zappelnder, zuckender Pilchards zum Vorschein. Das volle Netz wurde bordeinwärts über die Laderaumluke geschwenkt. Manfred hing mit seinem ganzen Gewicht an der Sacknetzleine.
»Aufmachen!« rief Lothar seinem Sohn zu, und Manfred ließ die Sacknetzleine los. Der Netzboden öffnete sich, und eine Tonne Pilchards prasselte durch die offene Luke unter Deck.
Sobald das Netz leer war, zog Manfred die Sacknetzleine zu, und die Schöpfmänner schwenkten den Stiel außenbords, quietschend rastete die Winde ein, das Netz fiel in den Schwarm, und die ganze Prozedur begann von vorn. Auf den anderen Trawlern wurde in derselben Art und Weise gearbeitet, und alle paar Sekunden ergoß sich eine Tonnenladung Fisch in die Laderäume.
Es war eine mühsame, eintönige Arbeit, und sooft das Netz über die Köpfe der Männer hinwegschwang, ergoß sich eine Flut von eisigem Salzwasser und Fischschuppen über sie. Wenn die Männer an den Netzstielen vor Erschöpfung zusammenzubrechen drohten, wurden sie, ohne daß der Arbeitsrhythmus gestört wurde, von den Bootsführern gegen die Männer am Hauptnetz ausgetauscht. Lothar hielt die Stellung an der Winde, unerschütterlich, wachsam, unermüdlich.
Silberne Dreipencestücke, dachte er schmunzelnd, als auf allen seinen Booten die Pilchards in die Laderäume prasselten. Glänzende Dreipencestücke, keine Fische. Heute laden wir Bargeld.
»Volle Deckladung!« rief er Swart Hendricks über den kleiner werdenden Ring des Hauptnetzes zu.
»Volle Deckladung!« bestätigte dieser laut, genüßlich seine ungeheuren Kräfte vor den Augen der Mannschaft einsetzend. Die Laderäume der Trawler, von denen jeder über hundertfünfzig Tonnen Fisch aufnehmen konnte, waren bereits randvoll, also würden sie auf Deck weiterladen
Das war riskant. Einmal voll beladen, wurden die Boote erst wieder leichter, wenn sie im Hafen lagen und der Fisch in die Fabrik gepumpt wurde. Bei voller Deckladung kam ein Gewicht von hundert Tonnen hinzu, wodurch das Sicherheitslimit weit überschritten war. Falls das Wetter umschlug und der Wind nach Nordwest drehte, würde die rasch hochgehende See die überladenen Trawler in die kalten grünen Tiefen hineinhämmern.
»Das Wetter muß halten«, dachte Lothar, während er an der Winde schuftete. Er saß auf dem Kamm der Woge, und nichts konnte ihn mehr aufhalten. Er hatte ein hohes Risiko in Kauf genommen und dadurch einen Fang von nahezu tausend Tonnen Fisch gemacht, der ihm einen Gewinn von fünfzig Pfund je Tonne einbringen würde. Fünfzigtausend Pfund mit einer einzigen Fangfahrt. Die dickste Glückssträhne seines Lebens. Er hätte sein Netz, sein Boot und auch sein Leben verlieren können – statt dessen zahlte er mit einem einzigen Fang seine gesamten Schulden ab.
Sie leerten den Inhalt der Schöpfnetze auf die Laufplanken der Trawler, füllten die Boote bis an die Kanten der Schandecks mit der silbrigen Fischmasse, in der die Mannschaft hüfttief versank.
Die Rümpfe der Trawler sanken immer tiefer ins Wasser, bis kurz nach Mittag auch Lothar einsehen mußte, daß es genug war.
Lothar stellte die Winde ab. Im Hauptnetz trieben noch ungefähr hundert Tonnen Fisch. »Entleert das Netz«, befahl er. »Laßt sie raus und holt das Netz ein.«
Dann machten sich die vier Trawler mit Lothars Boot an der Spitze auf den Heimweg in Richtung Küste. Die Boote lagen so tief im Wasser, daß bei jeder Welle Seewasser durch die Speigatts flutete.
Eine Fläche von fast einer halben Quadratmeile, bedeckt mit toten Fischen, die, dick wie Herbstlaub auf dem Waldboden, mit dem Bauch nach oben auf dem Wasser trieben, blieb hinter ihnen zurück. Darüber kreisten tausende übersatter Seemöven, darunter wimmelte es von schlemmenden Haien.
Die erschöpften Männer arbeiteten sich durch die Berge zappelnder Fische an Deck zum Niedergang am Vorderdeck. Unter Deck warfen sie sich, durchnäßt und von Fischschleim überzogen, in ihre engen Kojen.
Lothar stand im Ruderhaus und trank zwei Becher heißen Kaffee. Dann blickte er auf den Chronometer über der Instrumententafel.
»Vier Stunden Fahrt zur Fabrik«, sagte er. »Zeit genug für unseren Unterricht.«
»Oh, Pa!« protestierte der Junge. »Nicht heute, heute ist ein besonderer Tag. Müssen wir heute unbedingt lernen?«
In Walvis Bay gab es keine Schule. Die nächste befand sich in Swakopmund, dreißig Kilometer entfernt. Lothar war für den Jungen von Anfang an Vater und Mutter zugleich gewesen. Er hatte ihn noch naß und blutig aus dem Kindbett fortgenommen. Seine Mutter hätte ihn nicht einmal sehen wollen. Das war Teil ihrer abnormen Abmachung gewesen. Mit Ausnahme der Ammen, die den Jungen in den ersten Monaten stillten, hatte er ihn allein und ohne fremde Hilfe aufgezogen. Dadurch standen sie einander so nahe, daß Lothar es nicht ertragen hätte, auch nur einen Tag von ihm getrennt zu sein. Um ihn nicht fortschicken zu müssen, hatte er sogar seine Erziehung und Ausbildung selbst übernommen.
»So besonders kann gar kein Tag sein«, erklärte er Manfred. Er tippte ihm an die Stirn. »Das hier ist es, was einen Mann stark macht. Hol die Bücher!«
Manfred warf Da Silva einen mitleidheischenden Blick zu, aber er wußte sehr wohl, daß jeder weitere Widerspruch zwecklos war.
»Übernimm das Ruder.« Lothar übergab an den alten Seemann und setzte sich neben seinen Sohn an den Kartentisch. »Nicht Rechnen.« Er schüttelte den Kopf. »Heute ist Englisch an der Reihe.«
»Ich hasse Englisch!« begehrte Manfred auf. »Ich hasse Englisch und ich hasse die Engländer.«
Lothar nickte. »Ja«, stimmte er zu. »Die Engländer sind unsere Feinde. Sie waren immer unsere Feinde und werden es bleiben. Deshalb müssen wir uns ihre Waffen aneignen. Deshalb lernen wir ihre Sprache.«
Er sprach das erste Mal an diesem Tag Englisch. Manfred antwortete ihm in Afrikaans, der südafrikanischen Mundart des Holländischen, die erst im Jahre 1918, ein Jahr vor Manfreds Geburt, als eigene Sprache anerkannt und als offizielle Sprache der Südafrikanischen Union eingeführt worden war. Lothar unterbrach ihn.
»Englisch«, ermahnte er ihn. »Jetzt wird nur Englisch gesprochen.«
Eine Stunde lang arbeiteten sie. Lothar ließ seinen Sohn laut aus der Bibel und aus einer zwei Monate alten Ausgabe der »Cape Times« vorlesen und diktierte ihm einen englischen Text. Der Umgang mit der ungewohnten Sprache kostete Manfred einige Mühe. Schließlich konnte er nicht länger an sich halten.
»Erzähl mir doch von Großpapa und dem Schwur!«
Lothar grinste. Du bist ein gerissener kleiner Schlingel, mein Junge.«
»Bitte, Pa –«
»Die Geschichte habe ich dir schon hunderte Male erzählt.«
»Erzähl sie mir noch einmal. Heute ist ein besonderer Tag.«
Lothar warf einen flüchtigen Blick auf die kostbare silberne Fracht an Deck. Der Junge hatte recht, es war ein ganz besonderer Tag.
»Also gut.« Er nickte. »Ich erzähle sie dir noch einmal, aber in englisch.« Manfred klappte erfreut sein Übungsbuch zu und stützte die Ellbogen auf den Tisch. Er hatte die Geschichte vom großen Aufstand schon so oft gehört, daß er sie auswendig konnte und jede Abweichung vom Original korrigierte.
»Also«, begann Lothar. »Als der verräterische englische König Georg V. dem deutschen Kaiser Wilhelm 1914 den Krieg erklärte, wußten dein Großpapa und ich, was wir zu tun hatten. Wir nahmen Abschied von deiner Großmutter und ritten aus, um uns am Ufer des Oranje dem alten General Maritz und seinen sechshundert Kriegern anzuschließen, die gegen den alten ›Slim‹ Jannie Smuts ins Feld ziehen wollten.« ›Slim‹ war im Afrikaans das Wort für verschlagen oder verräterisch.
»Weiter, Pa, weiter!«
Als Lothar zur Schilderung der ersten Schlacht kam, in der Jannie Smuts’ Truppen den Aufstand mit Maschinengewehren und Artillerie niederwarfen, wurde der Blick des Jungen bekümmert.
»Aber ihr habt gekämpft wie die Teufel, nicht wahr?«
»Wir kämpften wie besessen, aber sie waren uns zahlenmäßig überlegen und außerdem mit schwerer Artillerie und Maschinengewehren ausgerüstet. Dann bekam dein Großpapa einen Bauchschuß, und ich trug ihn vom Schlachtfeld.«
In den Augen des Jungen glänzten dicke Tränen, als Lothar zum Ende kam.
»Als es mit deinem Großvater schließlich zu Ende ging, nahm er die alte schwarze Bibel aus der Satteltasche, auf die sein Kopf gebettet war, und ließ mich einen Eid schwören.«
»Ich kann den Schwur auswendig«, unterbrach ihn Manfred. »Laß mich ihn aufsagen!«
»Nun, wie ging der Schwur?« ermutigte ihn Lothar.
»Großpapa sagte: ›Schwöre mir, mein Sohn, schwöre mir auf die Bibel, daß der Krieg gegen die Engländer niemals enden wird.‹«
Der alte Da Silva unterbrach die feierliche Stimmung, hustete, räusperte sich und spuckte durch das offene Fenster des Ruderhauses. »Du solltest dich schämen – dem Jungen Haß und Gewalt einzutrichtern«, sagte er, und Lothar stand hastig auf.
»Hüte deine Zunge, alter Mann«, warnte er ihn. »Das ist nicht deine Sache.«
»Gott behüte«, brummte Da Silva, »das ist eher Sache des Teufels.«
Lothar runzelte die Stirn und wandte sich von ihm ab. »Für heute ist’s genug, Manfred. Räum die Bücher weg.«
Er schwang sich aus dem Ruderhaus und kletterte auf das Dach. Nachdem er es sich an der Lukenkimming bequem gemacht hatte, nahm er eine lange schwarze Zigarre aus der Brusttasche, biß die Spitze ab und suchte in seinen Taschen nach Streichhölzern. Manfred streckte schüchtern den Kopf über den Rand der Kimming, und als ihn sein Vater nicht fortscheuchte, kletterte der Junge hinauf und setzte sich neben ihn.
Lothar zündete sich die Zigarre an, sog den Rauch tief in die Lunge, schnippte das Zündholz über Bord und legte seinen Arm wie zufällig um die Schultern seines Sohnes.
Die kleine Flottille lief auf die Küste zu und umrundete das schroffe Horn im Norden der Bucht. Die tiefstehende Sonne überzog die hohen bronzefarbenen Dünen, die wie eine Gebirgskette hinter der kleinen Ansammlung von Gebäuden in der Bucht emporragten, mit einem goldenen Schimmer.
»Ich hoffe, Willem war so klug, die Siedekessel anzuheizen«, murmelte Lothar. »Mit dieser Menge Fisch hat die Fabrik die ganze Nacht und morgen den ganzen Tag zu tun.«
»Wir schaffen es nie, den ganzen Fisch einzudosen«, flüsterte der Junge.
»Nein, den Großteil werden wir zu Fischmehl und Fischleim verarbeiten müssen –« Lothar brach ab und starrte über die Bucht. Manfred spürte, wie sein Körper steif wurde. Dann nahm Lothar den Arm von den Schultern seines Sohnes und beschattete seine Augen.
»Dieser verdammte Idiot«, knurrte er. Mit dem scharfen Blick des Jägers hatte er bereits den fernen Schornstein des Siedehauses ausgemacht. Er rauchte nicht. »Was, zum Teufel, treibt der Kerl bloß?« Lothar sprang auf. »Er hat die Siedekessel kalt werden lassen. Es dauert fünf oder sechs Stunden, sie wieder anzuheizen. Inzwischen verdirbt unser Fisch. Zum Teufel mit dem Kerl!« tobte er und ließ sich auf Deck hinunter. Er zog am Nebelhorn, um die Fabrik zu alarmieren. »Was, zum Teufel, geht da vor!« Er riß das Fernglas aus der Halterung neben dem Instrumentenbrett und stellte es ein. Sie waren nun nahe genug, um die Menschengruppe vor den Haupttoren der Fabrik erkennen zu können. Es waren die Schneider und Verpacker in ihren grünen Gummischürzen und Stiefeln. Sie hätten eigentlich an ihren Arbeitsplätzen in der Fabrik sein sollen.
»Dort ist Willem.« Der Fabriksleiter stand am Ende des langen hölzernen Entladestegs, der auf schweren Pfählen in das ruhige Wasser der Bucht hinausragte. Willem war nicht allein, zwei Fremde standen neben ihm. Sie trugen dunkle Straßenanzüge und hatten das selbstgefällige, arrogante Auftreten kleiner Beamter, etwas, das Lothar kannte und fürchtete.
Sein Ärger verrauchte und machte einem plötzlichen Unbehagen Platz. Staatsdiener hatten ihm noch nie Gutes gebracht. »Schwierigkeiten«, dachte er. »Gerade jetzt, wo ich tausend Tonnen Fisch zu konservieren habe –«
Dann sah er die Autos. Das Fabrikgebäude hatte sie verdeckt, bis Da Silva in den Hauptkanal einfuhr, der zum Entladesteg führte. Lothar konnte zwei Autos erkennen. Eines davon war ein alter, verbeulter Ford, das andere jedoch ein größerer Wagen – Lothar spürte einen Stich in der Herzgegend und begann schneller zu atmen.
Diesen Wagen konnte es nicht zweimal in Afrika geben. Es war ein riesengroßer, narzissengelber Daimler. Als er ihn das letzte Mal gesehen hatte, stand er vor dem Büro der Courtney Bergwerks- und Finanzierungsgesellschaft in der Main Street in Windhuk.
Damals war er gerade im Begriff gewesen, mit der Gesellschaft eine Verlängerung seiner Kredite zu verhandeln. Er hatte von der anderen Seite der breiten staubigen Straße mit angesehen, wie sie, flankiert von zwei unterwürfigen Angestellten in dunklen Anzügen und gestärkten weißen Kragen, die breiten Marmorstufen heruntergeschritten kam; einer der beiden hielt ihr die Tür des auffälligen gelben Wagens auf und half ihr mit einer tiefen Verbeugung beim Einsteigen, während der andere um den Wagen herumeilte, um die Anlasserkurbel zu bedienen. Sie war abgefahren, ohne Lothar auch nur bemerkt zu haben. Blaß und zitternd, mit den widersprüchlichen Gefühlen, die ihr bloßer Anblick in ihm erweckte, war er zurückgeblieben. Fast ein Jahr war seither vergangen.
Er schreckte auf, als Da Silva mit dem schwerbeladenen Trawler anlegte. Sie hatten solchen Tiefgang, daß Manfred einem der Männer auf dem Entladesteg über ihnen das Bugtau hinaufwerfen mußte.
»Lothar, diese Herren – sie wollen dich sprechen«, rief Willem nervös und deutete mit dem Daumen auf den Mann an seiner Seite.
»Sind Sie Mr. Lothar De La Rey?« fragte der kleinere der beiden Fremden, indem er seinen staubigen Filzhut in den Nacken schob und sich über die Stirn wischte.
»Ganz recht.« Lothar hatte seine Arme in die Hüften gestemmt und starrte zu ihm hinauf. »Und wer sind Sie?«
»Sind Sie der Besitzer der Südwestafrikanischen Konservenfabrik und Fischfanggesellschaft?«
»Ja! Ich bin der Besitzer. Und was weiter?«
»Ich bin der Sheriff des Gerichts in Windhuk und habe hier eine Verfügung über die Beschlagnahme aller Vermögenswerte der Gesellschaft.« Der Sheriff schwenkte das Dokument, das er in der Hand hielt.
»Sie haben die Fabrik geschlossen«, erklärte Willem unglücklich. »Ich mußte das Feuer unter den Siedekesseln löschen.«
»Das können Sie nicht machen!« fauchte Lothar, und seine Augen verengten sich zu gelben Schlitzen. »Ich hab’ hier tausend Tonnen Fisch, die verarbeitet werden müssen.«
»Sind das die vier Trawler, die unter dem Namen der Gesellschaft eingetragen sind?« fuhr der Sheriff ungerührt fort, knöpfte aber sein Jackett auf und stemmte die Arme in die Hüften. Dabei kam ein schwerer Webley-Dienstrevolver zum Vorschein, der in einem Gürtelhalfter steckte. Er sah zu, wie die anderen Trawler zu beiden Seiten des Entladestegs festmachten, dann redete er, ohne Lothars Antwort abzuwarten, seelenruhig weiter. »Mein Gehilfe wird die Gerichtssiegel an den Booten und der Fracht anbringen. Ich muß Sie darauf hinweisen, daß das Entfernen der Boote oder der Fracht eine strafbare Handlung wäre.«
»Das können Sie mir nicht antun!« Lothar kletterte die Leiter zum Entladesteg hoch. Sein Tonfall klang nicht mehr herausfordernd. »Ich muß meinen Fisch verarbeiten. Verstehen Sie denn nicht? Spätestens morgen früh stinkt er zum Himmel –«
»Das ist nicht Ihr Fisch.« Der Sheriff schüttelte den Kopf. »Der gehört jetzt der Courtney Bergwerks- und Finanzierungsgesellschaft.« Er gab seinem Gehilfen ungeduldig einen Wink. »Na los, Mann.« Und dann begann er sich abzuwenden.
»Sie ist hier«, rief Lothar ihm nach, und der Sheriff drehte sich wieder um.
»Sie ist hier«, wiederholte Lothar. »Das dort drüben ist ihr Wagen. Sie ist selbst hergekommen, stimmt’s?«
Der Sheriff wich seinem Blick aus und zuckte die Achseln, aber Willem platzte heraus: »Ja, sie ist hier – sie wartet in meinem Büro.«
Lothar wandte sich von der Gruppe ab und eilte mit großen Schritten und geballten Fäusten, wie zu einem Kampf bereit, den Steg hinunter.
Am Ende des Stegs erwarteten ihn die aufgeregten Arbeiter aus der Fabrik.
»Was ist los, Baas?« bestürmten sie ihn. »Die wollten uns nicht arbeiten lassen. Was sollen wir tun, Ou Baas?«
»Warten!« befahl Lothar schroff. »Ich bringe das in Ordnung.«
»Bekommen wir unseren Lohn, Baas? Wir haben Kinder –«
»Ihr bekommt euer Geld«, fauchte Lothar, »das verspreche ich euch.« Das war ein Versprechen, das er nicht halten konnte, nicht bevor er seinen Fisch verkauft hatte. Er bahnte sich einen Weg durch die Menge und eilte auf das Verwaltungsbüro zu.
Der Daimler stand direkt vor der Tür, und am vorderen Kotflügel des großen gelben Wagens lehnte ein Junge. Er war augenscheinlich schlecht gelaunt und gelangweilt. Er mußte ein Jahr älter sein als Manfred, war aber ein paar Zentimeter kleiner und hatte einen schlankeren, feingliedrigeren Körper. Er trug ein weißes Hemd, das in der Hitze ein wenig gelitten hatte, und eine elegante Oxfordhose aus grauem Flanell, die staubig war und zu modisch für einen Jungen seines Alters, aber er besaß eine natürliche Anmut und war schön wie ein Mädchen mit seiner makellosen Haut und seinen dunkelblauen Augen.
Lothar stutzte bei seinem Anblick, und es entfuhr ihm: »Shasa!«
Der Junge richtete sich auf und warf das dunkle Haar zurück.
»Woher wissen Sie meinen Namen?« fragte er, und seine dunkelblauen Augen leuchteten interessiert auf.
Es gab vieles, was Lothar ihm darauf hätte antworten können, und es drängte sich ihm auf die Zunge: Vor vielen Jahren habe ich dir und deiner Mutter im Busch das Leben gerettet ... Ich habe geholfen, dich von der Muttermilch abzusetzen, und nahm dich als Baby zu mir aufs Pferd ... Ich liebte dich fast so sehr, wie ich einst deine Mutter liebte ... Du bist Manfreds Bruder .. der Halbbruder meines Sohnes.
Statt dessen sagte er: »Shasa ist das Buschmannwort für ›gutes Wasser‹, das kostbarste Gut im Leben eines Buschmannes.«
»Das ist richtig.« Shasa Courtney nickte. »Sie haben recht. Es ist ein Buschmanname, aber mein Taufname ist Michel. Das kommt aus dem Französischen. Meine Mutter ist Französin.«
»Wo ist sie?« fragte Lothar, und Shasa warf einen flüchtigen Blick auf die Bürotür.
»Sie möchte nicht gestört werden«, warnte er, aber Lothar De La Rey kümmerte sich nicht darum. Er ging so nahe an Shasa vorbei, daß dieser den Fischgeruch wahrnehmen und die winzigen weißen Fischschuppen auf seiner gebräunten Haut sehen konnte.
»Besser, Sie klopfen vorher an –« riet Shasa mit gesenkter Stimme, aber Lothar ignorierte das und stieß die Bürotür auf. Er blieb in der geöffneten Tür stehen, und Shasa konnte an ihm vorbeisehen. Seine Mutter erhob sich von dem unbequemen Stuhl am Fenster und drehte sich um.
Sie war schlank wie ein junges Mädchen, und der gelbe Crépe de Chine ihres Kleides fiel in dekorativen Falten über ihre kleinen, modisch flachen Brüste und wurde um die Hüften von einem schmalen Gürtel zusammengehalten. Der schmalkrempige Glockenhut war tief in die Stirn gezogen und bedeckte ihren schwarzen Haarschopf. Sie hatte große, fast schwarze Augen.
Sie sah sehr jung aus, nicht viel älter als ihr Sohn. Erst als sie den Kopf hob, zeigte sich die harte, entschlossene Linie ihres Kinns.
Sie starrten einander an, suchten nach Veränderungen, die die langen Jahre seit ihrer letzter Begegnung bewirkt haben mochten.
»Wie alt sie jetzt sein mag?« fragte sich Lothar, und dann fiel es ihm wieder ein: »Sie ist eine Stunde nach Mitternacht am ersten Tag des Jahrhunderts geboren. Sie ist gleich alt wie das zwanzigste Jahrhundert – deshalb wurde sie Centaine getauft. Also ist sie einunddreißig Jahre alt und sieht noch immer aus wie neunzehn, so jung wie an dem Tag, als ich sie blutend und sterbend im Busch fand, mit den tiefen Wunden von Löwenklauen in ihrem süßen jungen Fleisch.«
»Er ist gealtert«, dachte Centaine. »Er muß jetzt über vierzig sein, und er hat gelitten – aber nicht genug. Ich bin froh, daß ich ihn nicht umgebracht habe, ich bin froh, daß meine Kugel sein Herz verfehlte. Jetzt ist er in meiner Gewalt und wird allmählich begreifen, was wahre –«
Plötzlich erinnerte sie sich ganz gegen ihren Willen an seinen nackten, glatten, harten Körper, und eine heiße Welle durchfuhr ihre Lenden, ebenso heiß wie das Blut, das ihr in die Wangen stieg, und ebenso heiß wie die Wut gegen sich selbst und ihre Unfähigkeit, ihre animalischen Gefühle zu beherrschen. In allen anderen Dingen war sie durchtrainiert wie ein Athlet, aber diese zügellose Anwandlung von Sinnlichkeit hatte sie noch immer nicht unter Kontrolle.
Sie blickte an dem Mann vorbei und sah Shasa draußen im Sonnenlicht stehen. »Machen Sie die Tür zu«, befahl sie mit heiserer, tonloser Stimme. »Kommen Sie herein und machen Sie die Tür zu.« Sie wandte sich ab und schaute aus dem Fenster, um ihre Fassung wiederzufinden.
Kapitel 2
Die Tür schloß sich, und Shasa war enttäuscht. Er spürte, daß da etwas Bedeutsames vor sich ging. Dieser blonde Fremde mit den katzengelben Augen, der seinen Namen und dessen Herkunft kannte. Und diese Reaktion seiner Mutter, dieses plötzliche Erröten und der Ausdruck in ihren Augen – und dann diese Unsicherheit, etwas für sie völlig Untypisches. Shasa hätte nur zu gern gewußt, was sich hinter der geschlossenen Tür abspielte.
»Wenn du etwas wissen willst, dann geh und finde es heraus.« Das war einer der Aussprüche seiner Mutter. »Das Fenster«, dachte er und setzte den Gedanken sofort in die Tat um. Als er, in der Absicht, am offenen Fenster zu lauschen, um die Ecke bog, war er plötzlich Gegenstand der Aufmerksamkeit von fünfzig Augenpaaren. Der Fabriksleiter und die Arbeiter waren noch immer vor dem Haupttor versammelt, und als er um die Ecke des Verwaltungstraktes kam, verstummten sie und musterten ihn genau.
Shasa warf den Kopf zurück und änderte seine Marschrichtung. Da sie ihn noch immer beobachteten, steckte er die Hände in die Hosentaschen und schlenderte mit vollendet gespielter Gleichgültigkeit auf den langen hölzernen Entladesteg zu, so als wäre das von Anfang an seine Absicht gewesen. Nun würde er nicht mehr erfahren, was in dem Büro vor sich ging, außer er konnte es später seiner Mutter entlocken, aber das war sehr unwahrscheinlich. Plötzlich entdeckte er die vier flachen hölzernen Trawler, die am Steg lagen, und seine Enttäuschung ließ ein wenig nach. Boote hatten ihn immer Schon fasziniert.
Als er den ersten Trawler erreichte, blieb er stehen. Das Boot war verwahrlost und häßlich, und es stank nach brackigem Wasser, Treibstoff und ungewaschenen Männern, die dort auf engstem Raum zusammenlebten. Nicht einmal einen Namen hatte es, nur die Lizenz- und die Zulassungsnummern waren am Bug aufgemalt. Seine eigene Sechs-Meter-Jacht, die ihm seine Mutter zum dreizehnten Geburtstag geschenkt hatte, hieß The Midas Touch, ein Name, den seine Mutter vorgeschlagen hatte.
Shasa rümpfte, angeekelt von dem Gestank des Trawlers und traurig über dessen schändlich verwahrlosten Zustand, die Nase. »Wenn Mutter deshalb die lange Fahrt von Windhuk hierher gemacht hat –« Er dachte den Gedanken nicht zu Ende, denn ein Junge bog in diesem Augenblick um die Ecke des Ruderhauses.
Er trug eine geflickte kurze Segeltuchhose, hatte braune, muskulöse Beine und balancierte auf bloßen Füßen die Lukenkimming entlang.
Als die Jungen einander erblickten, warfen beide den Kopf zurück und erstarrten wie zwei Hunde, die sich unerwartet gegenüberstehen. Schweigend musterten sie einander.
»Ein Luxusbübchen«, dachte Manfred. Er hatte schon einige von dieser Sorte bei ihren seltenen Besuchen in Swakopmund gesehen. Kinder reicher Eltern, die lächerlich steife Kleidung trugen und mit diesem schrecklich hochmütigen Gesichtsausdruck gehorsam hinter ihren Eltern herliefen. »Sieh dir nur sein Haar an, es glänzt von Pomade, und er stinkt wie ein Blumenstrauß.«
»Einer von den armen weißen Afrikanern«, beurteilte Shasa sein Gegenüber. »Ein Bywoner, ein Arbeiterkind.« Seine Mutter hatte ihm immer verboten, mit ihnen zu spielen, aber er hatte festgestellt, daß einige unter ihnen recht unterhaltsam waren. Das Verbot seiner Mutter steigerte ihre Anziehungskraft natürlich noch. Einer von den Söhnen des Obermaschinisten in der Mine imitierte so täuschend ähnlich Vogelstimmen, daß die Vögel auf seinen Ruf von den Bäumen herunterflogen. Und die ältere Schwester dieses Jungen, sie war ein Jahr älter als Shasa, hatte ihm, als sie einmal verbotenerweise ein paar Minuten allein hinter dem Pumpenhaus waren, etwas noch Bemerkenswerteres gezeigt. Sie hatte ihm sogar erlaubt, es zu berühren, dieses warme, pelzige Ding, das sich wie ein neugeborenes Kätzchen unter ihrem kurzen Baumwollrock verbarg – ein höchst aufregendes Erlebnis, das er bei nächster Gelegenheit zu wiederholen gedachte.
Dieser Junge hier sah auch recht interessant aus, vielleicht konnte er Shasa den Maschinenraum des Trawlers zeigen. Er warf einen flüchtigen Blick zur Fabrik zurück. Seine Mutter konnte ihn nicht sehen, und er war bereit, Großmut zu zeigen.
»Hallo.« Er machte eine großzügige Geste und lächelte vorsichtig. Sein Großvater, Sir Garrick Courtney, das wichtigste männliche Wesen in seinem Leben, hatte ihn immer ermahnt: »Du nimmst von Geburt eine besonders hohe Stellung in der Gesellschaft ein. Damit hast du nicht nur Vorrechte und Privilegien, sondern auch Verpflichtungen. Ein richtiger Gentleman behandelt die, die unter ihm stehen, ob schwarz oder weiß, alt oder jung, Mann oder Frau, mit Höflichkeit und Respekt.«
»Mein Name ist Courtney«, erklärte Shasa. »Shasa Courtney. Mein Onkel ist Sir Garrick Courtney und meine Mutter ist Mrs. Centaine de Thiry Courtney.« Er wartete auf die Unterwürfigkeit, die dieser Name gewöhnlich hervorrief, und als nichts dergleichen sich zeigte, fuhr er eher verlegen fort: »Und wie heißt du?«
»Ich heiße Manfred«, erwiderte der andere Junge in afrikaans und hob die dichten schwarzen Augenbrauen, die viel dunkler waren als sein strähniges blondes Haar. »Manfred De La Rey. Und mein Großvater, mein Großonkel und mein Vater waren ebenfalls De La Rey und schossen den Engländern das Gehirn aus dem Schädel, wann immer sie einem von ihnen begegneten.«
Dieser unerwartete Angriff ließ Shasa erröten, und er wollte sich schon abwenden, als er sah, daß im Fenster des Ruderhauses ein alter Mann lehnte, der sie beobachtete, und daß vom Vorderdeck zwei farbige Seeleute nähergekommen waren. Jetzt konnte er nicht den Rückzug antreten.
»Wir Engländer haben den Krieg gewonnen und den Rebellen 1914 die Hölle heiß gemacht«, brauste er auf.
»Wir!« widerholte Manfred und wandte sich an sein Publikum. »Dieser kleine Gentleman mit dem Parfüm im Haar hat den Krieg gewonnen.« Die Schwarzen lachten ermutigend. »Dem Geruch nach sollte er eigentlich Lily heißen – Lily, der parfümierte Soldat.« Manfred drehte sich wieder zu ihm um, und Shasa bemerkte, daß er mindestens einen halben Kopf größer war und beängstigend muskulöse braune Arme hatte. »Du bist also Engländer, was, Lily? Dann lebst du wohl in London, süße Lily?«
Shasa war es nicht gewohnt, daß sich ein armer weißer Junge so gewählt ausdrückte oder den Verstand hatte, so ätzende Bemerkungen zu machen. Gewöhnlich war er es, der das große Wort führte.
»Natürlich bin ich Engländer«, entgegnete er wütend und suchte nach einer scharfen Erwiderung, um dieses Gespräch beenden und sich ehrenhaft zurückziehen zu können.
»Dann lebst du also in London«, meinte Manfred hartnäckig.
»Ich lebe in Kapstadt.«
»Aha!« Manfred wandte sich an sein größer werdendes Publikum. Auch Swart Hendrick war von seinem Trawler herübergekommen. »Deshalb nennt man sie Soutpiel!« verkündete Manfred. Dieser derbe Ausdruck rief schallendes Gelächter hervor. Manfred hätte es nie gewagt, diesen Ausdruck in Gegenwart seines Vaters zu gebrauchen. Übersetzt hieß das Wort »Salzschwanz«. Shasa errötete und ballte bei dieser Beleidigung unwillkürlich die Fäuste.
»Ein Salzschwanz steht mit einem Fuß in London und mit dem anderen in Kapstadt«, erklärte Manfred genüßlich, »und sein Schwanz baumelt in der Mitte über dem salzigen Atlantik.«
»Das wirst du zurücknehmen!« Mehr wußte Shasa vor Wut nicht zu sagen. Kein Tieferstehender hatte jemals so mit ihm geredet.
»Zurücknehmen – du meinst, so wie du deine salzige Vorhaut zurückziehst? Wenn du damit spielst? Meinst du das?« fragte Manfred. Der Applaus hatte ihn leichtsinnig gemacht, er war näher gekommen und befand sich nun direkt unterhalb der Stelle, wo der Junge auf dem Entladesteg stand.
Shasa ließ sich ohne Vorwarnung auf Manfred fallen, der das nicht so bald erwartet hatte. Er hatte gedacht, sie würden noch ein paar Beleidigungen austauschen, bevor sie wütend genug waren, um einander anzugreifen.
Shasa sprang aus einer Höhe von fast zwei Metern und traf ihn mit der vollen Wucht seines Körpers und seiner Wut. Pfeifend entwich die Luft aus Manfreds Lungen, dann landeten sie eng umschlungen in dem Haufen toter Fische.
Sie wälzten sich herum, und Shasa erschrak über die Kraft, die sein Gegner besaß. Seine Arme waren hart wie Holzbalken, und seine Finger fühlten sich an wie eiserne Fleischerhaken. Nur das Überraschungsmoment und Manfreds augenblickliche Atemnot bewahrten ihn vor einer sofortigen Niederlage. Fast ein wenig zu spät erinnerte er sich an die Ermahnungen von Jock Murphy, seinem Boxlehrer: »Laß dich mit einem stärkeren Mann auf keinen Nahkampf ein. Halt ihn auf Distanz.«
Manfred griff nach seinem Gesicht, versuchte mit einem Arm seinen Hals zu umklammern, und sie wühlten sich in den kalten, glitschigen Fischhaufen. Shasa zog sein rechtes Knie an und stieß es Manfred in die Brust, als dieser sich über ihm aufrichtete. Manfred rang nach Luft und wich zurück, aber als Shasa versuchte, sich wegzurollen, warf er sich auf ihn, um seinen Kopf in die Zange zu nehmen. Shasa zog den Kopf ein und befreite sich aus Manfreds Griff. Der Fischschleim, der seinen Hals und Manfreds Arme bedeckte, kam ihm dabei zugute. Und kaum war er frei, schlug er mit der linken Faust zu.
Diese kurze Linke hatte Jock ihn endlos üben lassen. »Diesen Schlag mußt du unbedingt beherrschen.«
Es war zwar nicht einer von Shasas besten Schlägen, aber er traf den anderen Jungen kräftig genug am Auge, daß sein Kopf zurückschnellte und er so weit abgelenkt war, daß Shasa auf die Beine kam und zurückweichen konnte.
Inzwischen wimmelte es auf dem Steg über ihnen von schwarzen Arbeitern in blauen Monturen und Gummistiefeln. Sie brüllten vor Vergnügen und Aufregung und feuerten die beiden Jungen an, als wären sie Kampfhähne.
Manfred ging auf Shasa los, aber die schlüpfrige Masse unter seinen Füßen hinderte ihn, und die linke Gerade traf abermals. Sie kam ohne Vorwarnung, hart und treffsicher, und sie brannte auf seinem geschwollenen Auge, so daß er vor Wut laut aufbrüllte und seinen Widersacher zu packen versuchte.
Shasa duckte sich unter Manfreds Arm weg und schlug noch einmal zu, so wie Jock es ihm beigebracht hatte.
Der Schlag traf Manfreds Mund voll, so daß die Lippen aufplatzten und zu bluten begannen. Der Anblick des Blutes ermutigte Shasa, und das vielstimmige Gebrüll der Menge rief tief in seinem Inneren einen urzeitlichen Instinkt wach. Er gebrauchte abermals seine Linke und knallte sie in das rotgeschwollene Auge.
»Es funktioniert«, dachte Shasa triumphierend. Doch in diesem Augenblick stieß er rückwärts gegen das Ruderhaus, und Manfred, der seinen Gegner in die Enge getrieben sah, warf sich auf ihn. Verzweifelt duckte Shasa sich, stemmte für einen Augenblick die Beine gegen das Ruderhaus und schnellte nach vorn, seinen Kopf in Manfreds Magen bohrend.
Manfred ging abermals die Luft aus, und für ein paar Sekunden wälzten sie sich im Fischhaufen. Dann konnte Shasa sich herauswinden und erreichte halb robbend, halb kriechend das untere Ende der hölzernen Leiter zum Entladesteg. Er zog sich hinauf.
Die Menge lachte verächtlich und pfiff, als er floh, und Manfred hechtete heftig keuchend und spuckend hinter ihm her.
Shasa war die Leiter halb hinaufgeklettert, als Manfred seine Knöchel zu fassen bekam und ihm beide Füße von den Leitersprossen riß. Manfred hing, ausgestreckt wie ein Opfer auf der Folterbank, an der Leiter und klammerte sich mit aller Kraft an die oberste Sprosse, um nicht von dem beachtlichen Gewicht seines Gegners losgerissen zu werden.
Shasa trat mit dem freien Fuß nach unten und traf mit der Ferse Manfreds geschwollenes Auge. Manfred schrie auf und ließ los, und Shasa zog sich auf den Steg.
Der Fluchtweg den Steg hinunter war offen, und er wäre gern davongelaufen. Aber die Männer um ihn herum lachten und höhnten, und sein Stolz ließ eine Flucht nicht zu. Er schaute sich um und sah entsetzt, daß Manfred das obere Ende der Leiter erreicht hatte.
Shasa wußte nicht recht, warum er sich auf diesen Kampf eingelassen hatte oder was der eigentliche Streitpunkt war, er wünschte nur sehnlichst, er könnte sich herauswinden. Aber das war unmöglich. Seine Herkunft, seine Erziehung verboten es. Er versuchte das Zittern zu unterdrücken und drehte sich zu Manfred um.
»Mach ihn kalt, Kleinbasie«, brüllten die Schwarzen. »Bring ihn um, kleiner Master.« Ihr Spott rüttelte Shasa auf. Er holte tief Atem, hob seine Fäuste und nahm die klassische Boxerhaltung ein.
»Dauernd in Bewegung bleiben«, hatte Jock ihm eingeschärft, und er verlagerte sein Gewicht auf die Zehenspitzen und begann Manfred zu umtänzeln.
»Seht ihn euch an!« höhnten die Männer. »Er glaubt, er ist Jack Dempsey. Er will mit dir tanzen, Manie. Zeig ihm den Walvis-Bay-Walzer!«
Doch Manfred hatte nun gehörigen Respekt vor der verzweifelten Entschlossenheit in den dunkelblauen Augen und vor den weiß hervortretenden Knöcheln an Shasas linker Hand. Er begann ihn zu umkreisen und stieß dabei leise Drohungen aus.
»Ich reiß dir den Arm aus und stopf dir damit das Maul. Ich schlag’ dir die Zähne ein, daß sie hinten wie Soldaten in Reih’ und Glied wieder rausmarschieren.«
Shasa kniff die Augen zusammen, behielt aber seine Verteidigungsstellung bei. Manfred täuschte mit der Linken, machte einen Ausfallschritt und griff von der Seite an. Trotz seiner Größe und der Wuchtigkeit seiner Beine und Schultern war er sehr schnell. Shasa wirkte im Vergleich zu ihm fast mädchenhaft zart. Seine Arme waren dünn und blaß und seine Beine lang und dürr, aber er bewegte sich geschickt auf ihnen. Er blockte Manfreds Angriff ab, und während er auswich, schnellte abermals sein linker Arm nach vorn. Manfreds Zähne stießen unter dem Schlag hörbar gegeneinander, sein Kopf wurde nach hinten geschleudert.
»Vat hom, Manie, gib’s ihm!« brüllte die Menge, und Manfred griff neuerlich an und holte weit auf Shasas blasses, glattes Gesicht aus.
Shasa duckte sich nach unten weg und stieß seine linke Faust unerwartet und schmerzhaft nach oben auf das dunkelrot verfärbte geschwollene Auge, gerade als Manfred durch seinen eigenen Schwung ein wenig aus dem Gleichgewicht kam. Er legte die Hand über das verletzte Auge und fauchte Shasa an: „Kämpfe, wie es sich gehört, du verdammter Soutpiel.«