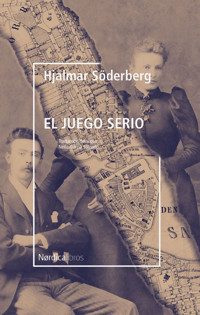9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Schweden an der Schwelle zum 20sten Jahrhundert. Arvid, ein gebildeter und ehrgeiziger junger Mann trifft Lydia, die Tochter eines Landschaftsmalers, während eines Sommerurlaubs und verliebt sich in sie. Arvid hat Angst vor einer engen Bindung und seinen eigenen Gefühlen und so entscheidet sich Lydia gegen ihn und für einen Mann, der in eine sichere Zukunft bieten kann. Zehn Jahre später, gefangen in lieblosen Ehen begegnen sich die beiden wieder und eine verhängsvolle Entwicklung nimmt ihren Lauf. »Das ernsthafte Spiel« - jetzt erstmals im ebook bei Piper Edition erhältlich »Ein zeitloser Liebesroman« Deutschlandradio Kultur
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
I
»Ich ertrage den Gedanken nicht, dass jemand herumgeht und auf mich wartet …«
Lydia badete gern allein.
Es war ihr am liebsten so, und davon abgesehen hatte sie in diesem Sommer niemanden, mit dem sie hätte baden können. Und sie hatte nichts zu befürchten: Ihr Vater saß ein Stück entfernt oben auf dem Felsen, malte an seinem »Motiv vom offenen Meer« und hielt ein Auge darauf, dass kein Unbefugter sich näherte.
Sie ging ins Wasser hinaus, bis es ihr bis knapp über die Taille reichte. Dort blieb sie mit erhobenen Armen stehen, die Hände im Nacken verschränkt, bis sich die Ringe im Wasser geglättet hatten, und spiegelte ihre achtzehn Jahre in den Wellen.
Dann beugte sie sich vor und schwamm hinaus – über die smaragdklare Tiefe hinweg. Sie genoss das Gefühl, vom Wasser getragen zu werden, sie fühlte sich so leicht. Sie schwamm ruhig und still. Heute sah sie keine Barsche; sonst spielte sie manchmal ein wenig mit ihnen. Einmal war sie so nahe daran gewesen, einen mit der Hand zu fangen, dass sie sich an seiner Rückenflosse gestochen hatte.
Glücklich wieder an Land, fuhr sie sich rasch mit dem Badetuch über den Körper und ließ sich dann von der Sonne und der leichten Sommerbrise trocknen. Dann streckte sie sich auf einem flachen Felsen am Strand aus, den die Wellen blank geschliffen hatten. Erst legte sie sich auf den Bauch und ließ sich die Sonne auf den Rücken brennen. Sie war schon am ganzen Körper braun – genauso braun wie im Gesicht.
Und sie ließ ihren Gedanken freien Lauf. Sie dachte daran, dass bald Essenszeit war. Es würde gebratenen Schinken mit Spinat geben. Doch obwohl ihr das schmeckte – es half alles nichts, das Essen war trotzdem die langweiligste Zeit des Tages. Der Vater war nicht sehr gesprächig, und ihr Bruder Otto saß meist stumm und mürrisch da. Otto hatte ja auch seine Sorgen. Unter den Ingenieuren herrschte hierzulande großes Gedränge, und im Herbst würde er nach Amerika fahren. Der Einzige, der gewöhnlich bei Tisch sprach, war Filip. Aber er sagte nie etwas, dem sie gern zugehört hätte – es ging meist um Präzedenzfälle und Juristenkniffe und Beförderung und solchen Unsinn, für den sich kein Mensch interessieren konnte. Es war, als redete er nur, damit etwas gesagt würde, während er mit seinen kurzsichtigen Augen nach den besten Bissen auf der Platte suchte.
Dennoch hatte sie ihren Vater ebenso wie ihre Brüder sehr gern. Es war nur seltsam, dass es so langweilig sein konnte, mit seinen nächsten Angehörigen, die man doch so gern hatte, an einem gedeckten Tisch zu sitzen …
Sie drehte sich auf den Rücken, verschränkte die Hände im Nacken und starrte hinauf ins Blaue.
Und sie dachte: blauer Himmel, weiße Wolken. Blau und weiß – blau und weiß … Ich habe ein blaues Kleid mit weißen Spitzen. Es ist mein bestes Kleid, aber ich mag es nicht deswegen so gern. Es hat einen anderen Grund. Denn es war das Kleid, das ich damals trug.
Damals.
Und sie dachte weiter: Liebt er mich? Ja, ja. Bestimmt tut er das.
Aber liebt er mich wirklich – wirklich?
Sie erinnerte sich an eine Gelegenheit vor nicht allzu langer Zeit, als sie eines Abends allein in der Fliederlaube gesessen hatten. Er hatte plötzlich eine kühne Liebkosung gewagt, die ihr Angst machte. Aber er hatte anscheinend selbst gleich gemerkt, dass er einen falschen Weg eingeschlagen hatte, denn er hatte ihre Hand genommen, die Hand, mit der sie sich gewehrt hatte, und sie geküsst, als wollte er sagen: Verzeih.
Ja, dachte sie, bestimmt liebt er mich wirklich. Und sie dachte weiter: Ich liebe ihn. Ich liebe ihn.
Und sie dachte es so stark, dass ihre Lippen sich mit ihren Gedanken bewegten und der Gedanke zu einem Flüstern wurde: Ich liebe ihn.
Blau und weiß – blau und weiß … Und Wassergeplätscher – Geplätscher – Geplätscher …
Plötzlich kam ihr in den Sinn, dass sie erst in diesem Sommer entdeckt hatte, wie schön es war, allein zu baden. Sie fragte sich, woher es kommen mochte. Aber schön war es. Wenn Mädchen sonst zusammen badeten, mussten sie ja immer schreien und lachen und lärmen. Dabei war es viel schöner, ganz allein und ganz still zu sein und nur dem Geplätscher des Wassers an den Klippen lauschen.
Während sie sich anzog, summte sie ein Lied:
Stehen wir einst Seit an Seit
vor dem Traualtar bereit,
willst du dann der Meine sein,
der Meine ganz allein?
Doch sie sang nicht die Worte dazu, sondern summte nur die Melodie.
Der Maler Stille mietete seit jeher jeden Sommer dasselbe rot gestrichene Fischerhäuschen weit draußen in den Schären. Er malte Kiefern. Seinerzeit hatte es geheißen, er habe die Schärenkiefer entdeckt, so wie Edvard Bergh den nordschwedischen Birkenhain. Am liebsten nahm er sich seine Kiefern im Sonnenschein nach dem Regen vor, wenn die Stämme vor Feuchtigkeit schimmerten. Doch er brauchte weder Regenwetter noch Sonnenschein, um sie so zu malen: Das konnte er schon auswendig. Er ließ die Abendsonne in roten Reflexen auf der dünnen, hellroten Rinde am Baumwipfel und im knorrigen, verkrümmten Astwerk brennen. In den Sechzigerjahren hatte er in Paris eine Medaille bekommen. Seine berühmteste Kiefer hing in der Luxembourggalerie, und es gab auch welche im Nationalmuseum. Jetzt – gegen Ende der Neunzigerjahre – war er ein gutes Stück über sechzig und mit den Jahren bei der wachsenden Konkurrenz ein wenig ins Hintertreffen geraten. Doch er arbeitete zäh und fleißig, wie er es sein ganzes mühseliges Leben lang getan hatte, und er verstand sich auch darauf, seine Kiefern zu verkaufen.
Malen, das ist keine Kunst, pflegte er zu sagen, das konnte ich vor vierzig Jahren ebenso gut wie heute. Aber verkaufen, das ist eine Kunst, die zu erlernen man lange braucht.
Das Geheimnis war einfach: Er verkaufte billig. Und so hatte er sich mit Frau und drei Kindern wacker durchgeschlagen und es Gott und jedermann recht gemacht. Nun war er seit ein paar Jahren Witwer. Klein, sehnig und knorrig und mit Flecken von frischer, rötlicher Haut, die hier und da durch den verfilzten Bart schimmerten, glich er selbst einer alten Schärenkiefer.
Die Malerei war sein Beruf, doch seine Liebe galt der Musik. Eine Zeit lang hatte er sich damit vergnügt, Geigen zu bauen, und davon geträumt, den vergessenen Geheimnissen des Geigenbaus auf die Spur zu kommen. Das war lange her. Mittlerweile spielte er gern samstagabends, die Stummelpfeife im Mundwinkel, den Schärenbewohnern zum Tanz auf.
Und er war begeistert, wenn er beim Quartettsingen den zweiten Bass übernehmen durfte. Deshalb war er an diesem Tag am Esstisch guter Laune.
»Heute Abend gibt es Gesang«, sagte er. »Der Baron hat angerufen, er will mit Stjärnblom und Lovén herüberkommen.«
Der Baron hatte jenseits der Bucht einen kleinen Landsitz und war, wenn man nur die Angehörigen der Oberschicht rechnete, der nächste Nachbar. Kandidat Stjärnblom und Assessor Lovén waren seine Gäste.
Lydia stand hastig auf und machte sich draußen in der Küche zu schaffen. Sie spürte, dass ihre Wangen ganz heiß geworden waren.
»Ich singe nicht mit«, maulte Filip.
»Dann lass es eben bleiben«, knurrte der Vater.
Nun verhielt es sich so, dass das Quartett einen kleinen Makel hatte: Es besaß zwei erste Tenöre. Der alte Stille war immer noch ein prächtiger zweiter Bass. Der Baron behauptete, jede Stimme »genauso brillant miserabel« singen zu können, war aber beim ersten Bass geblieben. Stjärnblom sang den zweiten Tenor. Doch die Ehre und Verantwortung als erste Tenöre teilten sich Filip und Lovén. Filips Tenor war klein und zart und rein; ausgesprochen lyrisch. Lovén wiederum besaß einen kolossalen Tenor, in dessen Tonschwall Filip hilflos ertrank. Es hieß, er habe ein Engagement an der Oper angeboten bekommen. Trotzdem spürte Filip mit Stolz seine Unersetzlichkeit, was subtilere Partien betraf, denn sein Rivale hatte nur zwei Saiten auf seiner Lyra: forte und fortissimo. Eine Schwachstelle von Assessor Lovén war außerdem sein leidenschaftliches Sängertemperament: Wenn die Leidenschaft ihn überwältigte, sang er falsch, oder die Stimme machte einen Kiekser.
Otto durchbrach das Schweigen am Tisch.
»Ach was«, sagte er, »du singst auf jeden Fall mit. Ein Tenor, der den Mund halten kann, wenn er andere singen hört, das gibt es nicht.«
»Du kannst ja das singen, was zu deiner Stimme passt«, meinte der Vater vermittelnd.
Filip saß noch immer etwas beleidigt da und stocherte in seinem Spinat. Womöglich würde er sich dazu bewegen lassen, bei »Warum bist du so ferne« mitzusingen, vielleicht auch bei »Kornmodsglansen«. Er erinnerte sich an das letzte Mal, als sie »Warum« sangen. Lovén hatte losgeschmettert, aber auf einmal hatte der Baron mit der Stimmgabel an das Punschtablett geklopft und gesagt: Halt’s Maul, Lovén, und lass Filip das singen, denn das kann er! Und er erinnerte sich daran, wie schmelzend fein und schön er damals gesungen hatte.
Lydia nahm ihren Platz am Tisch wieder ein.
»Ich musste mich erkundigen, was wir heute Abend anzubieten haben«, sagte sie. »Es gibt wieder Schinken und dann Hering mit Kartoffeln und Ottos Barsche. Das ist alles.«
»Und Schnaps und Bier und Punsch und Kognak«, ergänzte Otto.
»Ja, was braucht man mehr«, sagte der alte Stille. »Das sind doch alles herrliche Gottesgaben.«
Die Augustsonne neigte sich schon ihrem Untergang entgegen, als der kleine Segelkutter des Barons hinter der Landzunge erschien. Der Wind war abgeflaut. Die Segel hingen schlaff herab, und man hatte zu den Rudern gegriffen. Als das Boot sich dem Anlegesteg näherte, wurden die Segel gerefft, der Ruderer hielt inne, der Baron gab mit der Stimmgabel den Ton an, und während der Kutter von der Dünung sachte aus der weiten Bucht herangeschaukelt wurde, stimmten die drei Männer im Boot ein Trio von Bellman an:
Stiller die Welle schlägt,
Äol bläst leise,
wenn er vom Ufer hört
unsere Weise.
Hell ist des Mondes Strahl,
es glitzert der See,
Fliederduft überall,
Jasmin süß wie je.
Der Falter in Grün und Gold
glänzt auf der Blüte hold,
aus der Erde kriecht bald der Wurm,
aus der Erde kriecht bald der Wurm.
Der Gesang klang rein und schön übers Wasser. Zwei alte Fischer, die mit einem Fischkasten dasaßen und die Langleine auslegten, ließen ihre Arbeit ruhen und lauschten.
»Bravo!«, rief der alte Stille vom Steg aus.
»O ja, das machst du nicht schlecht, Lovén, mit Ausnahme von diesem ›krie-ie-iecht‹. Das ist eher etwas für Filip. Aber guten Tag, alle miteinander! Guten Tag, alter Gauner, hast du Kognak da? Whisky haben wir mitgebracht. Guten Tag, liebes feines, süßes, schönes …« Der Baron begleitete jedes Kompliment mit einem ritterlichen Handkuss. »… Fräulein Lydia! Grüßt euch, Jungs!«
Baron Freutiger war ein braun gebrannter und wettergegerbter Haudegen mit einem schwarzen Nebukadnezarbart. Er war an die fünfzig, hatte sich aber seine Jugend bewahrt, indem er das Leben von der leichten Seite nahm. Sorgen und Kümmernisse perlten an ihm ab. Dabei hatte er allerhand durchgemacht, und er selbst pflegte zu sagen, eines seiner unangenehmsten Erlebnisse sei gewesen, als man ihn wegen Pferdediebstahls in Arizona gehängt habe. In der Tat war er in seiner Jugend der Pechvogel der Familie gewesen und hatte die Wechselfälle des Glücks in vielen Gegenden der Welt erprobt. Er beherrschte viele Künste. So hatte er eine Sammlung von Reisebeschreibungen herausgegeben, deren frische und liebenswürdige Lügenhaftigkeit ihm einen Namen unter den Literaten verschafft hatte, und er komponierte Walzer, nach denen auf den Hofbällen getanzt wurde. Nachdem er vor einigen Jahren geerbt hatte, hatte er sich in den Schären einen kleinen Landsitz gekauft, wo er sich unter dem Deckmäntelchen der Landwirtschaft die Zeit mit der Jagd auf Seevögel und Mädchen vertrieb. Doch er hatte auch politische Ambitionen gehabt. Bei der letzten Reichtagswahl hatte er für die Liberalen kandidiert und wäre vielleicht gewählt worden, wenn er nur erkannt hätte, wie wichtig es war, in der Abstinenzfrage einen etwas klareren Standpunkt zu vertreten.
In einem blendend weißen Flanellanzug und mit einem schmutzigen alten Strohhut von unbestimmter Form auf dem Kopf sprang er auf den Steg und versammelte das Quartett um sich. Zollassessor Lovén, ein stattlicher Mann, blond und rosig, dicklich und mit einem puppenhaft schönen Gesicht, stellte sich in Positur und schmetterte probeweise ein paar hohe Töne hinaus. Kandidat Stjärnblom, ein breitschultriger junger Värmländer mit scheuen, tiefen Augen, hielt sich mehr im Hintergrund. Der alte Stille und Filip schlossen sich an, der Baron gab den Ton an, und unter den Klängen von »Die Sängerfahne wird gehisst« zog man hinauf zu dem roten Haus, wo zwischen den Hopfenranken der kleinen Veranda die Flaschen und Gläser glitzerten.
Es dämmerte mehr und mehr, und am bleichen Nordhimmel glitzerte bereits der helle Stern der Augustabende, die Capella.
Lydia stand am Geländer der Veranda. Sie war fast den ganzen Abend zwischen Küche und Veranda hin und her gelaufen und hatte sich mit dem »Küchenkram« zu schaffen gemacht – das war ihr Oberbegriff für Flaschen und Gläser und alles, was zum Haushalt gehörte. Das Servieren musste sie allein übernehmen – Augusta, ihr altes Dienstmädchen, das sie seit zwölf Jahren hatten, zischte immer wie ein heißes Bügeleisen, wenn Besuch kam, und zeigte sich aus Prinzip nicht.
Und jetzt war Lydia ein wenig müde.
Lied um Lied war an dem stillen Abend erklungen, unterbrochen von kleinen Meinungsverschiedenheiten zwischen den Tenören, die unter dem Klang von Gläsern beigelegt wurden, welche mit dreierlei erfrischenden Spirituosen gefüllt waren. Jetzt saßen die Sänger in stillem Frieden auf der Veranda beieinander. Lydia stand da und schaute in die dichter werdende Dämmerung hinaus, sie hörte das Gespräch der Männer und hörte es dennoch kaum, ihre Augen waren von Tränen groß geworden, und ihr war auf einmal so schwer ums Herz. Ihr Liebster schien ihr stets so weit weg, wenn sie ihn zusammen mit anderen Männern sah. Und dabei saß er knapp drei Schritte von ihr entfernt.
Sie hörte die Stimme ihres Vaters: »Bist du in der Ausstellung gewesen, Freutiger?«
Es war der Sommer der großen Weltausstellung 1897.
»Ja, ich habe gestern kurz vorbeigeschaut, als ich ohnehin in der Stadt war. Und nach alter Gewohnheit – ich habe ja mindestens hundert kolossale Weltausstellungen gesehen – habe ich mich gleich gefragt, als ich hineinkam: Wo ist der Bauchtanz? Doch es gab keinen Bauchtanz! Ich war kurz vor einer Ohnmacht. Dann bin ich in die Kunstausstellung hineingestolpert. Apropos, ist etwas von dir dabei?«
»Den Teufel werd ich. Ich stelle nie aus. Ich verkaufe trotzdem. Aber vorige Woche war ich da und hab’s mir angeschaut. Und da gab’s schon was zu sehen. Da war ein Däne, der hatte eine Sonne gemalt, die man tatsächlich nicht betrachten konnte, ohne dass einem die Augen brannten. Gut gemacht! Aber es kann ja kein Mensch mithalten und all die modernen Gaunerkniffe lernen. Ich bin alt. Prost, Lovén! Du trinkst nichts, Stjärnblom, prost! Irgendwann in den Achtzigerjahren begann ich mich so verdammt unmodern zu fühlen und bekam Lust, mit der Zeit zu gehen. Sonnenschein war nicht mehr in Mode, und von meinen Kiefern hatte man allmählich genug bekommen. Da habe ich dann eine ›Scheune im Regenwetter‹ zusammengeschmiert. Mir lag daran, sie an Fürstenberg oder das Museum in Göteborg zu verkaufen. Aber wie’s der Teufel will, es landete im Nationalmuseum, und da hängt es immer noch. Da war ich zufrieden und kehrte zu meinem Gewohnten zurück. Tja!«
»Prost, alter Gauner«, sagte Freutinger. »Du und ich, wir haben bis auf den Grund des Weltschwindels geschaut. Lovén kann nur in die Höhe blicken, da er Tenor ist. Und Stjärnblom ist zu jung. Junge Leute sehen nur sich selbst und betrachten uns Ältere als Staffage auf dem Gemälde. Nicht wahr, Arvid?«
Lydia fuhr bei dem Namen zusammen. Arvid … Wie konnte jemand anders ihn so nennen dürfen?
»Prost!«, erwiderte Stjärnblom.
»Raff dich auf, Junge«, fuhr der Baron fort. »Sitzt du da und sehnst dich nach Hause zu deinen Bergen in Värmland?«
»Da gibt es keine nennenswerten Berge«, sagte Stjärnblom.
»Woher soll ich das wissen?«, meinte Freutiger. »Ich bin überall gewesen außer in Schweden. Und mit Värmland hat mich nie etwas anderes verbunden als meine Großmutter, die in ihrer Jugend in Geijer verliebt war. Aber er hat sich den Teufel um sie geschert. Die Sache war die, dass Geijer mit meiner Großmutter auf einem See in Värmland Schlittschuh fuhr – gibt es nicht einen See, der Fryken heißt? Gut, dann war es also auf dem Fryken – irgendwann am Anfang des Jahrhunderts. Sagen wir 1813, da es in diesem Jahr einen besonders kalten Winter gab. Und dann fiel meine Großmutter auf den Hintern, sodass Geijer ihre Beine zu sehen bekam. Und sie waren viel dicker und stämmiger, als er sie sich vorgestellt hatte. So erlosch diese Flamme! Aber mein Großvater, der Hüttenwerksbesitzer und ein praktischer Kerl war und kein alberner Ästhet, nahm sie stattdessen. Und das ist der Grund dafür, dass ich Freutiger heiße und überhaupt da bin und die Schönheit der Natur genieße. Tja!«
Assessor Lovén hatte eine Weile lang sichtbare Zeichen der Unruhe gezeigt. Er hustete und räusperte sich. Plötzlich stand er auf und stimmte eine Arie aus »Mignon« an. Seine schöne Stimme klang volltönend und sanfter als sonst: »Wie ihre Unschuld auch sich das Gefühl verhehlte – das schon so lange tief in ihrem Herzen schlief – dass ein geliebtes Bild ihr ganzes Sein beseelte …«
Lydia war auf den mit Sand bestreuten Platz unterhalb der Veranda gegangen und zupfte Blätter von einem Berberitzenstrauch, die sie zwischen den Fingern zerknitterte. Kandidat Stjärnblom hatte sich erhoben und stand jetzt am Geländer der Veranda, wo sie eben noch gestanden hatte. Lydia ging langsam den Gartenweg entlang. Es war schon dunkel zwischen den Hecken. Sie blieb am Eingang der Fliederlaube stehen. Herrn Lovéns Stimme war zu hören: »Dann, holder Lenz, dann magst du den Tropfen Tau ihr spenden – Herz, mein He-erz …«
Natürlich gab es einen Kiekser beim hohen B. Sie hörte Schritte im Sand. Sie kannte diese Schritte. Sie wusste sehr wohl, wer das war. Und sie versteckte sich in der Laube.
Eine leise Stimme: »Lydia …?«
»Miau!«, ertönte es aus der Laube.
Noch im selben Moment reute es sie, und es erschien ihr so albern, wie eine Katze zu maunzen, und sie verstand überhaupt nicht, warum sie das getan hatte. Sie streckte ihm ihre Arme entgegen: Arvid – Arvid …
Sie begegneten sich in einem langen Kuss.
Und als der Kuss nicht ausreichte, sagte er leise: »Hast du mich ein bisschen lieb?«
Sie barg ihren Kopf an seiner Brust und schwieg.
Nach einer Weile sagte sie: »Siehst du den Stern dort?«
»Ja.«
»Ist es der Abendstern?«
»Nein, das kann er nicht sein«, antwortete er. »Der Abendstern geht um diese Zeit zusammen mit der Sonne zu Bett. Es ist bestimmt die Capella.«
»Capella. Was für ein schöner Name.«
»Ja, er ist schön. Aber er bedeutet nur Ziege. Und warum dieser Stern Ziege heißt, weiß ich nicht. Ich weiß eigentlich überhaupt nichts.«
Sie standen still da. In der Ferne hörte man den Wiesenknarrer.
Er sagte: »Wie kommt es, dass du mich lieb hast?«
Wieder barg sie den Kopf an seiner Brust und schwieg.
»Findest du nicht, dass Lovén vorhin schön gesungen hat?«, fragte er.
»Doch«, antwortete sie. »Er hat eine schöne Stimme.«
»Und war Freutiger nicht komisch?«
»Ja, es war lustig, ihm zuzuhören. Und es ist bestimmt nichts Böses an ihm.«
»Nein, im Gegenteil …«
Sie standen dicht beieinander und wiegten sich und sahen zu den Sternen hinauf.
Dann sagte er: »Aber deinetwegen macht Lovén seine Kiekser, wenn das Gefühl ihn überwältigt, und für dich lügt sich Freutiger seine Geschichten zusammen. Sie sind alle beide in dich verliebt. Nun weißt du das. Damit du wählen kannst.«
Er lachte auf. Und da küsste sie ihn auf die Stirn. Und nach einer Weile flüsterte sie, halb zu sich selbst: »Wenn man nur wüsste, was sich da drinnen befindet …«
»Da gibt es bestimmt nichts Besonderes«, antwortete er. »Und im Übrigen tut es einem nicht immer gut zu wissen …«
Sie antwortete, die Augen tief in den seinen: »Ich glaube an dich. Und das ist mir genug. Und nur die Tatsache, dass du in diesem Winter in Stockholm sein wirst, sodass wir uns ab und zu sehen und treffen können, allein das ist mir genug. Machst du dein Referendarjahr am Norra Latin?«
»Ja«, antwortete er, »das werde ich wohl tun. Lehrer will ich natürlich nicht werden. Das ist zu trostlos. Aber da ich nun meinen cand. phil. habe, kann ich ja ebenso gut das Referendarjahr machen. Und dann werde ich wohl bis auf Weiteres Aushilfslehrer – während ich warte.«
»Während du wartest – worauf?«
»Ich weiß nicht. Vielleicht auf gar nichts. Darauf, etwas tun zu können, was taugt – was immer es ist … Nein, Lehrer will ich nicht werden. Das kann ich mir als Zukunft nicht vorstellen – als meine Zukunft.«
»Ja«, sagte sie, »die Zukunft – was weiß man schon darüber …«
Lange standen sie schweigend unter den schweigenden Sternen.
Plötzlich fiel ihr etwas ein, was er bei den anderen auf der Veranda gesagt hatte, und sie fragte: »Gibt es keine höheren Berge in deinem Värmland? Das hatte ich gedacht.«
»O nein«, sagte er, »es gibt dort zwar höhere Berge als hier, aber richtig hohe Berge gibt es da nicht. Und ich mag sie nicht – doch, ich gehe gern in die Berge, aber ich möchte nicht zwischen ihnen eingeklemmt leben. Man spricht von Berglandschaften – dabei sollte es besser Tallandschaften heißen. Man wohnt und lebt unten im Tal, nicht auf den Berggipfeln. Und die Sonne wird von den Bergen verdeckt wie von hohen Häusern in einer Gasse, sodass in meiner Heimat fast den ganzen Nachmittag eine eiskalte blaue Dämmerung herrscht. Es ist dort nur für kurze Zeit mitten am Tag richtig schön: wenn nämlich die Sonne im Süden steht oder etwas früher und mitten ins Flusstal des Klarälven scheint. Dann fällt ein schönes Licht auf all das Schöne, dann sieht man gen Süden, hinaus in die Sonne und ins Licht in der offenen Weite des Flusstals, und denkt: Da drüben ist die Welt.«
Lydia hörte halb zerstreut auf seine Worte. Sie hörte »Sonnenschein« und »da drüben ist die Welt«. Und sie hörte den Wiesenknarrer auf dem Acker.
»Ja, die Welt«, sagte sie, »die Welt … Glaubst du, Arvid, dass du und ich uns eine kleine Welt für uns allein erschaffen könnten?«
Er antwortete, seinerseits halb abwesend und zerstreut: »Wir können es ja versuchen.«
Jetzt ertönte plötzlich die Stimme des Barons von der Veranda: »Sänger! Sä-änger! Brüderlein trink! Brüderlein trink!«
Sie schlang ihre Arme um seinen Hals und flüsterte dicht an seinem Ohr: »Ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Und ich kann warten.«
Und wieder hörte man Freutiger: »Sä-änger!«
Auf getrennten Gartenwegen eilten sie hinauf zur Veranda, sodass sie aus entgegengesetzten Richtungen dort ankamen.
Lydia stand am offenen Fenster und schaute mit tränenfeuchten Augen hinaus in die Sommernacht. Draußen in der Bucht sah sie im Mondschein das Boot mit den fortziehenden Sängern. Sie ließen die Ruder ruhen und sangen ihr zu Ehren eine Serenade.
Sie sangen »Warum bist du so ferne«. Assessor Lovéns Tenor klang schön in der stillen Nacht. Baron Freutiger sang den ersten und den zweiten Bass gleichzeitig, zumindest glaubte er das selbst. Und in der mittleren Lage konnte sie der Stimme ihres Liebsten folgen.
Warum bist du so ferne,
o, mein Lieb!
Es leuchten mild die Sterne,
o, mein Lieb!
Der Mond will sich schon neigen
in seinem stillen Reigen.
Gute Nacht, mein süßes Lieb.
Gute Nacht, mein Lieb.
Lydia ließ sich auf einen Stuhl sinken und weinte vor Glück und Müdigkeit. Plötzlich nahm sie einen kleinen altmodischen Buketthalter aus vergoldetem Silber mit türkisblauem Griff vom Haken unter dem kleinen Spiegel und benetzte ihn mit Küssen und Tränen. Er hatte ihrer Mutter gehört – diese hatte ihren Brautstrauß darin getragen.
Der Gesang war verstummt, und das Boot glitt mit gleichmäßigen Ruderschlägen davon. Lovén und Stjärnblom ruderten mit je einem Ruder, und Freutiger steuerte. Und ob es nun daran lag, dass alle drei in dasselbe Mädchen verliebt waren, oder an etwas anderem: keiner sagte ein Wort.
Der Baron wirkte düster, wie er da am Ruder saß. Er überlegte, was er gesagt oder nicht gesagt hatte. Hatte er ihr einen Antrag gemacht oder nicht? Was das Mädchen selbst betraf, hatte er ihr nicht direkt einen Antrag gemacht, sie nur dunkel ahnen lassen, flüchtig, dass sie seine erste richtige Liebe war. Aber später, beim Grog nach dem Essen, hatte er allein mit dem alten Stille zusammengesessen, und bei dieser Gelegenheit musste er etwas Klareres und Entschiedeneres gesagt haben, denn er erinnerte sich deutlich, wie der alte Stille geantwortet hatte: Du und Lydia? Heiraten? Dass du dich nicht schämst, du altes Schwein!
Assessor Lovén bediente sein rechtes Ruder und blickte zu den Sternen auf. Im Gedächtnis ging er alle Lieder durch, die er im Lauf des Abends gesungen hatte. Und er wusste, dass er so gesungen hatte, dass jedes Herz schmelzen musste. Zwar war ihm ein paarmal ein Kiekser unterlaufen. Aber immerhin – immerhin! Er meinte, das Beste hoffen zu dürfen.
Kandidat Stjärnblom saß mit geschlossenen Augen da und bediente sein linkes Ruder. Er dachte an etwas, was Lydia ihm in der Laube gesagt hatte. Sie hatte gesagt: Ich glaube an dich! Sehr erfreulich und gut – wenn es dabei geblieben wäre … Aber dann hatte sie gesagt: Ich kann warten. Und das war nicht gut – das war gar nicht gut! Ich ertrage den Gedanken nicht, dass jemand herumgeht und auf mich wartet, dachte Arvid. Dass jemand etwas von mir erwartet. Wenn ich diesen Gedanken ständig über mir habe, dann wird nie etwas aus mir …
Und im Übrigen, dachte er, bin ich zweiundzwanzig Jahre alt, das ganze Leben liegt ja noch vor mir. Sich jetzt zu binden – fürs ganze Leben! Nein, man muss sich davor hüten, stecken zu bleiben. Man muss doch vorher wenigstens ein bisschen leben.
Aber zugleich durchströmte eine warme Welle sein ganzes Wesen, als er sich an ihre Küsse erinnerte. Und er fragte sich, ob sie wirklich eine Unschuld war.
In solchen Gedanken saß Kandidat Stjärnblom, während er mit geschlossenen Augen und zusammengebissenen Zähnen sein linkes Ruder in dem stillen, nächtlichen Wasser bediente, in dem sich Tannenwipfel und Sterne spiegelten.
Ein verhangener, gedämpfter Tag Anfang Oktober.
Arvid Stjärnblom ging einen Weg auf Djurgården entlang – den, der von Ulmen mit geneigten, schwarzen Stämmen gesäumt wird und am Ufer der stillen Djurgårdsbrunnsbucht verläuft, unterhalb von Skansens zerklüfteten Felsen. Das Ausstellungsgelände hatte er hinter sich gelassen.
Die Ausstellung war seit einigen Tagen geschlossen. Er blieb für einen Augenblick stehen und sah zurück. Die Kulissenmauern von »Alt-Stockholm« waren schon von Regen und Wind zerfleddert, und jeden Tag nahm die Zerstörung der bunten Marktstadt des vergangenen schönen Sommers weiter ihren Lauf. Aber über allem erhob sich noch die farbig schimmernde Kuppel der Industriehalle mit den vier Minaretten. Ganz im Westen brach die Sonne gerade durch eine Bresche in der Wolkendecke, sie stand ganz niedrig, am Rand der Dunstglocke über der Stadt, und leuchtete mit einem Licht wie von altem verblichenen Silber mit halb abgegriffener Vergoldung.
Arvid Stjärnblom schenkte der Sonne und der Stadt und der Ausstellung einen langen Blick zum »Lebewohl, wir sehen uns wieder« und setzte seinen Weg fort.
Er hatte kürzlich sein Referendarjahr am Norra Latin begonnen, mit »Muttersprache« und »Geschichte und Geografie« als Hauptfächern, und fast gleichzeitig hatte er durch einen entfernten Verwandten, Markel, eine Stelle als Korrekturleser und Volontär bei einer großen Tageszeitung bekommen. Aber er dachte jetzt an nichts, was seinen Beruf betraf. Er dachte an Lydia.
Es vergingen keine vierundzwanzig Stunden und kaum eine Stunde der wachen Zeit, ohne dass sie hin und wieder in seinen Gedanken auftauchte. Und oft dachte er: Das muss wohl Liebe sein; ich fürchte, mit weniger ist es nicht getan. Aber er hatte beschlossen, sie in Stockholm nicht aufzusuchen, sondern ihre Begegnung dem Zufall zu überlassen. Sie hatten ja auch keinerlei Verabredung getroffen, als sie sich an dem letzten Abend da draußen auf Runmarö sahen – wobei sie damals nicht gewusst hatten, dass es das letzte Mal für diesen Sommer sein würde … Aber er fand nicht, dass er ihr in ihrem Elternhaus einen Besuch abstatten konnte. Bestimmt betrachteten ihn der alte Stille und die Brüder lediglich als einen gewöhnlichen Sommerbekannten und würden vielleicht ein wenig erstaunt aussehen, wenn er plötzlich in der kleinen Atelierwohnung in Söder auftauchte. Damit würde er ihnen ganz einfach offenbaren, dass zwischen Lydia und ihm »etwas war«. Denn weder Filip noch Otto oder der Alte würden sich auch nur für einen Augenblick einbilden, dass er ihretwegen kam …
Nein …
Ein Eichhörnchen mit einem schon etwas herbststruppigen und grau gesprenkelten Fell kam plötzlich in kleinen Sprüngen den Weg entlanggetanzt, hielt inne, setzte sich aufs Hinterteil und betrachtete ihn – neugierig, spöttisch und mit einer Scheu, die ihm ein wenig berechnend kokett vorkam. Er blieb stehen und sah dem kleinen Tier in die schwarzen Perlenaugen. Doch das musste das Eichhörnchen irgendwie irritiert haben. Es verschwand im Nu einen Baum hinauf, in einer blitzschnellen Spirale um den Stamm …
Arvid war dem Weg an Sirishov vorbei nach Rosendal gefolgt und war nach rechts abgebogen. Dort verzweigte sich der Weg, und er wählte einen beliebigen Pfad.
Nein, er konnte ihr keinen Besuch abstatten. Sollte er ihr schreiben und irgendwo um ein Treffen bitten, beispielsweise hier auf Djurgården? Das konnte sie doch wohl nicht als Beleidigung auffassen – nach all der Küsserei im Sommer … Aber …
Aber es widerstrebte ihm, ihr zu schreiben und sie um etwas zu bitten, da er ihr nichts zu bieten hatte. Noch war er ja nichts – überhaupt nichts.
Arvid Stjärnblom war nicht ohne Selbstbewusstsein, aber es fehlte ihm an Selbstvertrauen. Er sah sich nicht als gescheiterte und wertlose Gestalt, doch er misstraute seiner Fähigkeit, innerhalb einer überschaubaren Zukunft den Wert, den er möglicherweise besaß, ans Tageslicht zu bringen. Und das Schlimmste war, dass er nicht wirklich den Mut hatte, seinen eigenen Gefühlen zu vertrauen. Er war schon einige Male verliebt gewesen, und es war jedes Mal vorübergegangen …
Nein, besser abwarten. Es dem Zufall überlassen.
Er blieb stehen und zeichnete mit dem Stock im Staub des Weges herum.
Und was sollte überhaupt daraus werden – was konnte es werden? An Heirat war ja nicht zu denken. Und … sie »verführen«?
Er wagte nicht einmal an einen Versuch zu denken. Wenn es gelänge, würde er ja alle Achtung vor ihr verlieren. Und wenn es nicht gelänge, würde er sein letztes bisschen Selbstachtung verlieren.
Aber … aber mein Gott, wie ich mich nach ihr sehne! Danach, sie nur irgendwann zu treffen – sie irgendwann zu sehen …
Gesehen hatte er sie tatsächlich einmal im Herbst. Es war an jenem Abend gewesen, beim Regierungsjubiläum des Königs, mit Festbeleuchtung und Feuerwerk und einem Gedränge, dass man sich kaum bewegen konnte. Er hatte eingeklemmt in der Menschenmenge an der Ecke von Nybroplan und Birger Jarlsgatan gestanden, als die Kortege mit dem schönsten König Europas – einem fast siebzigjährigen Mann – vorbeifuhr, der wie ein römischer Triumphator in seinem Wagen stand … Ein alter, etwas schwachköpfiger Gastwirt, der bei diesem Anblick verrückt vor Anarchistenangst geworden war, hatte geschrien: »Man ermordet den König, man ermordet den König!« … Wenig später hatte er Lydias Gesicht nur ein paar Schritte von der Stelle entfernt erblickt, an der er selber stand. Er war so eingeklemmt gewesen, dass er den Arm nicht hatte heben können, um sie zu grüßen. Er musste sich damit begnügen, den Kopf zum Gruß zu neigen – mit Hut! Er errötete immer noch, wenn er sich daran erinnerte. Aber sie hatte ihn gesehen und ihrerseits den Kopf geneigt.
Dann waren sie im Gewühl in verschiedene Richtungen gedrängt worden.
Und den ganzen Abend, stundenlang, hatte er sich aufs Geratewohl treiben lassen, in der Hoffnung, sie wiederzusehen … Vom Kai an der Strömgatan aus hatte er kleine schwarze Schattenfiguren gesehen, die sich auf dem Dach eines der Schlossflügel in Richtung Strömmen bewegten. Es waren der König und die fürstlichen Gäste von auswärts, die sich das Feuerwerk ansehen wollten. In der Menschenmenge um Arvid herum entstand eine plötzliche Bewegung, und er hörte jemanden sagen, dass der König singe. »Es ist eine Arie aus ›Robert‹«, warf ein anderer ein. Und Arvid meinte wirklich, so etwas wie Harfen in der Luft zu hören.
Aber Lydia sah er nicht …
Es ist seltsam, dass ich sie nie sehe, dachte er. Die ganze Zeit, die ich freihabe, treibe ich mich ja auf all den Straßen und Gassen herum, wo ich mir vorstellen kann, ihr zu begegnen.
Er ging tatsächlich beinahe täglich ein paarmal die Västerlånggatan hin und zurück. Sie wohnte in Söder und musste doch manchmal Richtung Norden gehen. Und dann würde sie wahrscheinlich die Västerlånggatan entlangkommen. Manchmal versuchte er es auch mit der Stora Nygatan oder Skeppsbron. Aber vermutlich ging sie gerade dann die Västerlånggatan entlang.
Und es war sehr ungewöhnlich, dass er wie jetzt auf Djurgården herumschlenderte.
Er hatte sich auf eine Bank gesetzt.
Es war noch hell, wo er saß. Es gab keine großen Bäume in der Nähe, man hatte genug Licht zum Lesen, wenn man wollte.
Arvid Stjärnblom fiel plötzlich ein, dass er ein paar kleine Bücher in der Manteltasche hatte. Ein paar kleine Bücher, die er sich für einen bestimmten Zweck besorgt hatte und die er also lesen musste. Eines Abends hatte er mit ein paar Kommilitonen zusammengesessen – jungen Aushilfslehrern und Referendaren –, und sie waren auf den Religionsunterricht zu sprechen gekommen. Sie waren sich ziemlich einig über das Bedenkliche daran, dass sich der gesamte Unterricht zum Thema Moral auf die christliche Religion stützte, also auf eine Grundlage, die für viele, vielleicht für die allermeisten, schon vor dem Ende der Schulzeit ins Wanken geriet und zerbrach. Sie hätten das gern geändert, konnten sich aber nur schwerlich darüber einigen, wie die Frage am besten zu lösen wäre. Jemand hatte etwas von religiös neutralen Lehrbüchern der Moral erwähnt, die bereits jetzt im Unterricht an französischen Staatsschulen benutzt wurden. Arvid hatte eine plötzliche Neugier überkommen, diese Lehrbücher zu sehen, er hatte sofort beschlossen, sie sich zu besorgen, und heute waren sie von der Buchhandlung geschickt worden; ebendiese trug er in der Tasche.
Was hatte er eigentlich mit ihnen vor? Er wusste es selbst nicht so genau. Natürlich fühlte er sich nicht speziell dazu berufen, ein »Lehrbuch der Moral« zu schreiben. Bereits ein solcher Titel würde ja ein Buch der Lächerlichkeit preisgeben. Aber dennoch … Dennoch … Ihm schwebte vor, dass es hier doch eine Aufgabe zu lösen gäbe … vielleicht eine Lücke zu schließen … Wie sie zu lösen wäre, die Aufgabe, das wusste er noch nicht, und noch weniger wusste er, ob ausgerechnet er dazu berufen war, sie zu lösen.
Der Himmel hatte im letzten Moment aufgeklart, und eine bleiche Herbstsonne fiel auf eine leere Bank zwischen ein paar schwarzen Kiefern. Er setzte sich auf die Bank und las.
Es waren zwei Bücher gekommen, das eine für die Volksschule (das war gleich an der äußeren Aufmachung zu erkennen), das zweite für eine etwas höhere Unterrichtsstufe.
Er nahm sich zuerst das Volksschulbuch vor. »Manuel d’éducation morale, par A. Burdeau, Président de la Chambre des députés.«
Arvid stutzte. Der Vorsitzende der Deputiertenkammer! Die Person von dritthöchstem Rang in Frankreich! Höher als der Ministerpräsident! Und der setzt sich hin und schreibt ein kleines Buch für die armen kleinen Schulkinder in seinem großen Land! Das war mehr als imponierend; es war rührend.
Und er begann zu lesen.
Meine Kinder, der moralische Unterricht lehrt uns, wie wir uns jetzt und in Zukunft zu benehmen haben, um ehrbare Menschenund gute Franzosen zu sein, genau wie die, welche vor uns gelebt haben.
Nun ja. Hm. Genau wie die, welche vor uns gelebt haben … Hm …?
Er blätterte weiter.
Worin besteht das größte Unglück des Unwissenden? – Das größte Unglück des Unwissenden besteht darin, dass er nicht versteht, in welch hohem Grad seine Lage bedauernswert ist.
Hm!
Warum ist Wissen wertvoll? – Wissen ist wertvoll, weil es uns erleichtert, ehrlich zu sein.
Hm …? Hm …?
Gibt es etwas, das für den Menschen ebenso nützlich ist wie Nahrung und Kleidung? – Es gibt etwas, das für den Menschen ebenso notwendig ist wie Nahrung und Kleidung: nämlich eine moralische Erziehung.
In Arvids Kopf begann sich alles zu drehen. Das war ja der reinste Witz! Sollte Herr A. Burdeau, Vorsitzender der Deputiertenkammer und eine der drei höchstgestellten Personen Frankreichs, in Wahrheit ein alter Witzbold sein? Oder war es wirklich möglich, dass französische Schuljungen so etwas schluckten? Bei schwedischen Schuljungen würde so etwas nie im Leben gut gehen … Nein, es war bestimmt vergeudete Zeit, sich weiter mit Herrn A. Burdeau zu befassen. Er erfüllte vermutlich mit Würde seine Aufgabe als Vorsitzender der Kammer, aber offenbar hatte er keine Ahnung, wie diese Sache anzugehen war … Und das habe ich im Übrigen auch nicht …
Zerstreut blätterte er weiter, fand Erläuterungen wie die, dass der Lehrer ein Beamter sei (fett gedruckt) und den Staat repräsentiere, Ermahnungen zur Reinlichkeit, etwas Geschimpfe auf Napoleon III. und andere im Kaiserreich und so weiter …
Schließlich gelangte er zur letzten Seite: