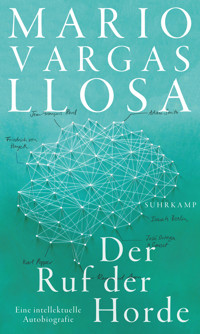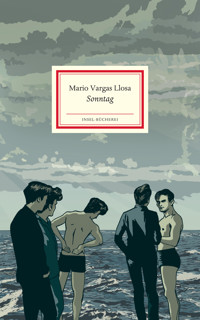15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Urania Cabral nach langen New Yorker Exiljahren nach Santo Domingo zurückkehrt, auf die Insel, die sie nie wieder betreten wollte, findet sie ihren Vater stumm und im Rollstuhl vor. Der einstige Senatspräsident und Günstling des Diktators blickt sie auf ihre schweren Vorwürfe nur starr an, und Urania bleibt allein mit ihren Erinnerungen an die Zeit der Willkür – und an ein ungeheuerliches Geschehen.
Mit ihr kehren wir zurück ins Jahr 1961, als die dominikanische Hauptstadt noch Ciudad Trujillo heißt. Dort herrscht der »Große Wohltäter«, er hat fast das ganze Land in seinen persönlichen Besitz gebracht. Militär, Kirche, amerikanische Botschaft hält er vermeintlich in Schach, aber seine Attentäter sind längst unterwegs – ohne ihrerseits zu ahnen, dass in ihrem Rücken ein machiavellistischer Machtwechsel im Gange ist.
Im eisigen Zentrum von Vargas Llosas Roman steht die nur allzu reale Gestalt des General Leónidas Trujillo, genannt »Der Ziegenbock«. Doch der Blick des Schriftstellers dringt unter die historische Haut, macht uns zu Zeitgenossen, zu Mitwissern. Den Verschwörern mit ihrer brennenden Begierde, ihren Demütiger zu beseitigen, den intelligenten Politschranzen und den Opfern gibt der Erzähler seine eindringliche Stimme. Ein Roman über die Psychographie der Macht und ihrer Verheerungen, der sich wie ein Thriller liest.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 807
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Als Urania nach langen Exiljahren in die Dominikanische Republik zurückkehrt, findet sie ihren Vater, den einstigen Günstling des Diktators Trujillo – genannt »Der Ziegenbock« –, stumm und im Rollstuhl vor. Nun muß sie versuchen, allein fertig zu werden mit ihren Erinnerungen an die Zeit der Willkür – und an ein ungeheuerliches Geschehen. Mario Vargas Llosa beschreibt in diesem spannenden Politthriller eine Alleinherrschaft, die gleichermaßen nackte Gewalt und charismatische Verführungskraft birgt.
Mario Vargas Llosa, geboren 1936 in Arequipa/Peru, lebt heute in Madrid und Lima. Neben zahlreichen anderen Auszeichnungen erhielt er 1996 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels und 2010 den Nobelpreis für Literatur. Sein schriftstellerisches Werk erscheint auf deutsch im Suhrkamp Verlag.
MARIO VARGAS LLOSA
Das Fest des Ziegenbocks
Roman
~
Aus dem Spanischenvon Elke Wehr
Suhrkamp
Die Originalausgabe erschien 2000 unter dem Titel
La Fiesta del Chivo
bei Alfaguara, Madrid.
© Mario Vargas Llosa, 2000
Umschlagabbildung:
Ambrogio Lorenzetti, Allegorie der Schlechten Regierung (Detail)
Palazzo Pubblico, Siena. Foto: Scala, Florenz
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2012
© der deutschen Ausgabe Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 2001
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlag: Göllner, Michels
eISBN 978-3-518-73575-6
www.suhrkamp.de
Inhalt
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
Für Lourdes und José Israel Cuello
und so viele andere
dominikanische Freunde
Das Volk, es feiert
Mit großem Geschrei
Das Fest des Ziegenbocks
Am dreißigsten Mai.
Sie haben den Ziegenbock umgebracht
Dominikanischer Merengue
I
Urania. Ihre Eltern hatten ihr keinen großen Gefallen getan; ihr Name ließ an einen Planeten denken, an ein Mineral, an alles mögliche, nur nicht an die schlanke Frau mit feinen Gesichtszügen, glatter Haut und großen dunklen, ein wenig traurigen Augen, die ihr aus dem Spiegel entgegenblickte. Urania! Was für ein Einfall. Zum Glück nannte sie niemand mehr so, sondern Uri, Miss Cabral, Mrs. Cabral oder Dr. Cabral. Soweit sie sich erinnern konnte, hatte seit ihrem Fortgang aus Santo Domingo (»besser gesagt, aus Ciudad Trujillo«, damals hatte man der Hauptstadt noch nicht ihren Namen zurückgegeben) niemand, weder in Adrian noch in Boston, noch in Washington D.C. oder in New York, sie jemals wieder Urania genannt wie früher zu Hause und in der Santo-Domingo-Schule, wo die Sisters und ihre Klassenkameradinnen den absurden Namen, den man ihr bei der Geburt auferlegt hatte, ganz korrekt aussprachen. War es seine oder ihre Idee gewesen? Zu spät, um das herauszufinden, Mädchen; deine Mutter ist im Himmel und dein Vater ein lebender Leichnam. Du wirst es nie erfahren. Urania! Genauso abwegig, wie das alte Santo Domingo de Guzmán zu beleidigen, indem man es Ciudad Trujillo nannte. Ob das wohl auch eine Idee ihres Vaters gewesen war?
Sie wartet darauf, daß im Fenster ihres Zimmers im neunten Stock des Hotels Jaragua das Meer erscheint, und endlich sieht sie es. Die Dunkelheit weicht in wenigen Sekunden, und mit dem rasch heraufziehenden bläulichen Schein am Horizont beginnt das Schauspiel, auf das sie wartet, seit sie um vier Uhr aufgewacht ist, obwohl sie trotz ihrer Aversion gegen Schlafmittel eine Tablette genommen hat. Die dunkelblaue Oberfläche des Meeres, aufgerauht durch Schaumflecken, wird an der fernen Linie des Horizonts auf einen bleifarbenen Himmel treffen und bricht sich geräuschvoll in schaumigen Wellen an der Uferpromenade, deren Bürgersteig sie durch die Palmen und Mandelbäume, die ihn säumen, hier und da erkennen kann. Damals ging das Hotel Jaragua mit der Vorderseite auf die Promenade hinaus. Jetzt mit der Schmalseite. In ihrer Erinnerung steigt das Bild des kleinen Mädchens auf – an jenem Tag? –, das an der Hand seines Vaters das Restaurant des Hotels betritt, wo sie beide ganz allein essen wollen. Man gab ihnen einen Tisch am Fenster, und Urania konnte durch die Vorhänge hindurch den weiträumigen Garten und den Swimmingpool mit Sprungbrettern und Badegästen sehen. Ein Orchester spielte Merengues im Spanischen Hof, den Kacheln und Nelken in Blumentöpfen schmückten. War es an jenem Tag gewesen? »Nein«, sagt sie mit lauter Stimme. Das damalige Hotel Jaragua hatte man abgerissen und durch dieses große pinkfarbene Gebäude ersetzt, das sie bei ihrer Ankunft in Santo Domingo drei Tage zuvor so überrascht hatte.
Hast du gut daran getan, zurückzukommen? Du wirst es bereuen, Urania. Eine Ferienwoche zu vergeuden, wo du nie Zeit hattest, all die Städte, Regionen, Länder kennenzulernen, die du gern gesehen hättest – die beschneiten Bergketten und Seen Alaskas zum Beispiel –, und auf die kleine Insel zurückzukehren, die nie wieder zu betreten du dir geschworen hattest. Zeichen des Niedergangs? Herbstliche Sentimentalität? Neugier, nichts weiter. Dir beweisen, daß du durch die Straßen dieser Stadt laufen kannst, die nicht mehr deine ist, dieses fremde Land bereisen kannst, ohne Traurigkeit, Wehmut, Haß, Bitterkeit, Wut zu empfinden. Oder bist du gekommen, um dich mit dem menschlichen Wrack deines Vaters zu konfrontieren? Um herauszufinden, welche Wirkung sein Anblick nach so vielen Jahren auf dich hat? Ein Schauer läuft ihr den Rücken hinunter. Urania, Urania! Vielleicht entdeckst du ja noch nach so vielen Jahren, daß unter deinem willensstarken, wohlgeordneten, gegen Mutlosigkeit gefeiten Kopf, hinter dieser Festung, die man an dir bewundert und um die man dich beneidet, ein ängstliches, verletztes, sentimentales kleines Herz schlägt. Sie lacht auf. Schluß mit den Albernheiten, Mädchen.
Sie zieht die Turnschuhe, die Sportkombination an, faßt ihr Haar mit einem Haarnetz zusammen. Sie trinkt ein Glas kaltes Wasser und schickt sich an, den Fernseher einzuschalten, um CNN zu sehen, aber sie überlegt es sich anders. Sie bleibt am Fenster stehen und betrachtet das Meer, die Uferpromenade und nach einem leichten Drehen des Kopfes den Wald aus Dächern, Türmen, Kuppeln, Glockentürmen und Baumwipfeln der Stadt. Wie sie gewachsen ist! Als du sie 1961 verlassen hast, beherbergte sie dreihunderttausend Seelen. Jetzt mehr als eine Million. Sie hat sich um ganze Viertel, breite Straßen, Parks und Hotels vermehrt. Am Vortag hatte sie sich wie eine Fremde gefühlt, als sie in einem Mietwagen durch die eleganten Wohnkomplexe von Bella Vista und den riesigen Park El Mirador gefahren war, wo es genauso viele Jogger gab wie im Central Park. In ihrer Kindheit endete die Stadt am Hotel El Embajador; dort begannen die Plantagen und Saatfelder. Der Country Club, in den ihr Vater sie an den Sonntagen zum Swimmingpool mitnahm, war von freien Feldern umgeben, und nicht von Asphalt, Häusern und Lichtmasten wie jetzt.
Aber der koloniale Stadtteil wurde nicht erneuert, auch nicht Gazcue, ihr Viertel. Und sie ist sich ganz sicher, daß ihr Haus sich kaum verändert hat. Es wird das alte sein mit seinem kleinen Garten, dem alten Mangobaum und dem rotblühenden Flamboyant, der sich über die Terrasse neigte, auf der sie am Wochenende im Freien zu essen pflegten; mit seinem Satteldach und dem kleinen Balkon ihres Schlafzimmers, auf den sie hinaustrat, um ihre Cousinen Lucinda und Manolita zu erwarten und, in jenem letzten Jahr, 1961, um diesen Jungen abzupassen, der auf dem Fahrrad vorbeifuhr und sie verstohlen anschaute, ohne zu wagen, das Wort an sie zu richten. Ob es drinnen auch unverändert war? Die Kuckucksuhr, die die Stunden schlug, war mit gotischen Ziffern und einer Jagdszene bemalt. Ob dein Vater unverändert war? Nein. Du hast seinen Verfall auf den Photos verfolgt, die Tante Adelina und andere ferne Verwandte, die dir weiter schrieben, obwohl du ihre Briefe nie beantwortet hast, alle paar Monate oder Jahre schickten.
Sie läßt sich in einen Sessel fallen. Die Strahlen der aufgehenden Sonne treffen das Zentrum der Stadt; die Kuppel des Regierungspalastes und seine blaß ockerfarbenen Mauern leuchten sanft unter dem blauen Gewölbe. Geh endlich hinaus, bald wird die Hitze unerträglich sein. Sie schließt die Augen, von einer Trägheit erfaßt, die sie selten befällt, sie, die gewohnt ist, immer aktiv zu sein, keine Zeit mit dem zu verlieren, was sie, seit sie ihren Fuß wieder auf dominikanischen Boden gesetzt hat, Tag und Nacht tut: sich erinnern. »Diese Tochter, immer am Arbeiten, noch im Schlaf wiederholt sie die Aufgaben.« Das sagte der Senator Agustín Cabral über dich, der Minister Cabral, Cerebrito – Köpfchen – Cabral, wenn er vor seinen Freunden mit dem kleinen Mädchen prahlte, das alle Preise gewann, mit der Schülerin, die von den Sisters immer als Vorbild hingestellt wurde. Ob er wohl vor dem Chef mit Uranitas schulischen Leistungen prahlte? »Es würde mich sehr freuen, wenn Sie sie kennenlernen, sie hat seit ihrem Eintritt in die Santo-Domingo-Schule jedes Jahr den Klassenpreis bekommen. Es wäre das höchste Glück für sie, Sie kennenzulernen, Ihnen die Hand zu geben. Uranita betet jeden Abend, damit der liebe Gott Ihnen Ihre eiserne Gesundheit erhält. Und auch für Doña Julia und Doña María. Gewähren Sie uns diese Ehre. Darum bittet, darum fleht, darum winselt der treueste Ihrer Hunde. Sie können mir das nicht abschlagen: empfangen Sie sie. Exzellenz! Chef!«
Verabscheust du ihn? Haßt du ihn? Noch immer? »Nicht mehr«, sagt sie mit lauter Stimme. Du wärst nicht zurückgekehrt, wenn das Ressentiment noch schwelen, die Wunde bluten, die Enttäuschung dich erdrücken, dich vergiften würde, wie in deiner Jugend, als Lernen und Arbeiten zum obsessiven Mittel wurden, dich nicht zu erinnern. Damals hast du ihn tatsächlich gehaßt. Mit allen Fasern deines Wesens, mit allen Gedanken und Gefühlen, die in deinem Körper Platz fanden. Du hast ihm Mißgeschicke, Krankheiten, Unfälle an den Hals gewünscht. Gott hat dir den Gefallen getan, Urania. Oder eher der Teufel. Ist es nicht genug, daß der Gehirnschlag ihn zu Lebzeiten getötet hat? Eine süße Rache, daß er seit zehn Jahren im Rollstuhl sitzt, ohne gehen, sprechen zu können, daß er abhängig von einer Krankenschwester ist, um zu essen, ins Bett zu gehen, sich anzukleiden, sich auszukleiden, sich die Nägel zu schneiden, sich zu rasieren, seine Blase und seinen Darm zu entleeren? Fühlst du Genugtuung? »Nein.«
Sie trinkt ein zweites Glas Wasser und geht hinaus. Es ist sieben Uhr morgens. Im Erdgeschoß des Hotels Jaragua überfällt sie der Lärm, dieses schon vertraute Ambiente aus Stimmen, Motorgeräuschen, voll aufgedrehten Radios, Merengues, Salsas, Danzones und Boleros oder Rock und Rap, die sich vermischen, sich gegenseitig attackieren, sie attackieren mit ihrem schrillen Getöse. Belebtes Chaos, tiefes Bedürfnis deines einstigen Volkes, Uranita, sich zu betäuben, um nicht zu denken und vielleicht nicht einmal zu fühlen. Aber auch Explosion wilden Lebens, das den Wellen der Modernisierung widersteht. Etwas in den Dominikanern klammert sich an diese vorrationale, magische Form: dieses Verlangen nach Lärm. (»Nach Lärm, nicht nach Musik.«)
Sie kann sich nicht erinnern, daß ein derartiger Lärm auf der Straße herrschte, als sie ein kleines Mädchen war und Santo Domingo noch Ciudad Trujillo hieß. Vielleicht gab es ihn nicht; vielleicht war die Stadt vor fünfunddreißig Jahren stiller und weniger hektisch, als sie nur ein Drittel oder ein Viertel so groß war, als sie provinziell, isoliert, von Angst und Servilität betäubt war und ihre Seele darniederlag in panischer Ehrfurcht vor dem Chef, dem Generalissimus, dem Wohltäter, dem Vater des Neuen Vaterlandes, vor seiner Exzellenz Dr. Rafael Leónidas Trujillo Molina. Heute kommen sämtliche Geräusche des Lebens, Automotoren, Kassetten, CDs, Radios, Hupen, bellende, knurrende Hunde, menschliche Stimmen in voller Lautstärke daher, auf der höchsten Stufe des stimmlichen, mechanischen, digitalen oder tierischen Lärmpegels (die Hunde bellen lauter, und die Vögel piepsen heftiger). Und New York hat den Ruf, laut zu sein! Nie in ihren zehn Jahren in Manhattan haben ihre Ohren etwas gehört, das sich mit dieser brutalen, mißtönenden Symphonie vergleichen ließe, in die sie seit drei Tagen eingetaucht ist.
Die Sonne erleuchtet die alten Palmen mit ihren hohen Wipfeln, den kaputten Bürgersteig, der wie bombardiert wirkt mit seinen zahllosen Löchern und Abfallhaufen, die einige kopftuchtragende Frauen zusammenfegen und in zu kleinen Plastiksäcken sammeln. »Haitianerinnen.« Jetzt sind sie stumm, aber gestern tuschelten sie auf kreolisch miteinander. Ein wenig weiter vorne sieht sie die beiden barfüßigen, halbnackten Haitianer, die auf ein paar Kisten hocken, hinter sich Dutzende von Bildern in lebhaftesten Farben, die auf einer Wand verteilt sind. Es stimmt, die Stadt hat sich mit Haitianern gefüllt, womöglich das ganze Land. Das gab es damals nicht. Wie sagte der Senator Cabral? »Vom Chef mag man einmal sagen, was man will. Aber die Geschichte wird ihm zumindest das Verdienst zusprechen, daß er ein modernes Land geschaffen und die Haitianer an ihren Platz verwiesen hat. Große Übel verlangen große Lösungen!« Der Chef hatte ein kleines Land vorgefunden, das von den bewaffneten Auseinandersetzungen der Caudillos ruiniert war, ohne Gesetz noch Ordnung, verarmt, überschwemmt von seinen hungrigen, wilden Nachbarn und im Begriff, seine Identität zu verlieren. Sie durchwateten den Masacre-Fluß und kamen, um Eigentum, Tiere, Häuser zu rauben, nahmen unseren Landarbeitern die Arbeit, verdarben unsere katholische Religion mit ihren teuflischen Hexereien, vergewaltigten unsere Frauen, zerstörten unsere Kultur, unsere Sprache und unsere westlichen, spanischen Sitten, indem sie uns ihre barbarischen afrikanischen aufzwangen. Der Chef durchschlug den gordischen Knoten: »Schluß!« Große Übel verlangen große Lösungen! Nicht nur, daß er das Massaker an den Haitianern im Jahr siebenunddreißig rechtfertigte; er betrachtete es als eine Großtat des Regimes. Rettete es die Republik nicht davor, ein zweites Mal in der Geschichte von diesem raubgierigen Nachbarn entehrt zu werden? Was bedeuten fünf-, zehn-, zwanzigtausend Haitianer, wenn es gilt, ein Volk zu retten?
Sie läuft rasch, erkennt die markanten Punkte: das Kasino von Güibia, jetzt ein Klub, und die Badeanstalt, heute vom Pestgestank der Kloaken erfüllt; gleich wird sie an die Ecke Uferpromenade und Avenida Máximo Gómez kommen, Parcours des Chefs bei seinen abendlichen Spaziergängen. Seitdem die Ärzte ihm gesagt hatten, dies sei gut für sein Herz, ging er von der Villa Radhamés bis zur Máximo Gómez, mit einem Zwischenstop im Haus von Doña Julia, der Erhabenen Matrone – das Uranita einmal betreten hatte, um eine Rede zu halten, die sie kaum über die Lippen brachte –, dann hinunter bis zum Malecón George Washington, bog an dieser Ecke ab und setzte seinen Weg fort bis zum Obelisken, der eine Imitation des in Washington stehenden war, mit flottem Schritt, umgeben von Ministern, Beratern, Generälen, Helfern, Höflingen, die in respektvoller Entfernung, mit aufmerksamem Blick und hoffnungsvollem Herzen auf eine Geste, eine Gebärde warteten, die ihnen erlauben würde, sich dem Chef zu nähern, ihm zuzuhören, einiger Worte würdig zu sein, und wäre es auch eine Rüge. Alles, nur nicht in die Ferne verbannt sein, in die Hölle der Vergessenen. Wie oft bist du mitgegangen, Papa? Wie oft warst du seiner Worte würdig? Und wie oft kehrtest du traurig zurück, weil er dich nicht rief, mit der Furcht, nicht mehr dem Kreis der Erwählten anzugehören, unter die Ausgestoßenen gefallen zu sein. Ständig lebtest du in der Angst, dir könnte das gleiche widerfahren wie Anselmo Paulino. Und es widerfuhr dir, Papa.
Urania lacht auf, und ein entgegenkommendes Paar in Bermudashorts glaubt, daß es gemeint sei. »Guten Tag.« Aber sie lacht nicht über die beiden, sondern über das Bild des Senators Agustín Cabral, der jeden Abend zwischen den Luxusbediensteten über diese Uferpromenade trabt, voller Aufmerksamkeit, nicht für die warme Brise, das Rauschen des Meeres, die Akrobatik der Möwen oder die leuchtenden Sterne der Karibik, sondern für die Hände, die Augen, die Bewegungen des Chefs, die ihn vielleicht rufen, ihm vor den anderen den Vorzug geben würden. Sie ist zur Landwirtschaftsbank gelangt. Danach wird die Villa Ramfis kommen, in der noch immer das Außenministerium untergebracht ist, und das Hotel Hispaniola. Und dann kehrt.
›Calle César Nicolás Penson, Ecke Galván‹, denkt sie. Würde sie hingehen oder nach New York zurückkehren, ohne einen Blick auf ihr Haus geworfen zu haben? Du wirst eintreten und die Krankenschwester nach dem Invaliden fragen und zum Schlafzimmer und zur Terrasse hinaufgehen, auf die man ihn schiebt, damit er dort seinen Mittagsschlaf hält, auf diese Terrasse, die rot war vor lauter Flamboyantblüten. »Hallo, Papa. Wie geht es dir, Papa. Erkennst du mich nicht? Ich bin Urania. Natürlich, wie sollst du mich erkennen. Das letzte Mal war ich vierzehn, und jetzt bin ich neunundvierzig. Eine Menge Jahre, Papa. Warst du nicht genauso alt, als ich nach Adrian ging? Ja, achtundvierzig oder neunundvierzig. Ein Mann in den besten Jahren. Jetzt wirst du bald vierundachtzig. Du bist uralt geworden, Papa.« Wenn er in der Lage ist, zu denken, wird er in diesen Jahren viel Zeit gehabt haben, eine Bilanz seines langen Lebens zu ziehen. Du wirst an deine undankbare Tochter gedacht haben, die fünfunddreißig Jahre lang keinen Brief beantwortete, kein Photo und keine Geburtstags-, Weihnachts- oder Neujahrsgrüße schickte, die nicht einmal, als du deinen Gehirnschlag hattest und Tanten, Onkel, Cousins und Cousinen glaubten, du würdest sterben, kam oder sich nach deiner Gesundheit erkundigte. Was für eine böse Tochter, Papa.
Das kleine Haus in der César Nicolás Penson, Ecke Galván, wird keine Besucher mehr empfangen im Vestibül, wo man gewöhnlich das Bild der Jungfrau von Altagracia zusammen mit der prahlerischen Bronzeplakette aufhängte: »In diesem Haus ist Trujillo der Chef.« Oder hast du sie aufbewahrt, als Zeichen der Ergebenheit? Du wirst sie ins Meer geworfen haben, wie Tausende von Dominikanern, die sie gekauft und am sichtbarsten Ort des Hauses aufgehängt hatten, damit niemand an ihrer Treue zum Chef zweifelte, und, als der Bann gebrochen war, die Spuren verwischen wollten, voll Scham über das, was sie symbolisierte: ihre Feigheit. Bestimmt hast auch du sie verschwinden lassen, Papa.
Sie ist zum Hotel Hispaniola gelangt. Sie schwitzt, ihr Herz schlägt schnell. Ein zweifacher Strom von Autos, Lieferwagen und Lastwagen wälzt sich über die Avenida George Washington, und ihr scheint, als hätten alle das Radio laufen und als müßte der Lärm ihr gleich das Trommelfell zerreißen. Ab und zu schiebt sich ein männlicher Kopf aus einem Fahrzeug, und einen Augenblick lang treffen sich ihre Augen mit denen des Fahrers, die ihre Brüste, ihre Beine oder den Hintern taxieren. Diese Blicke. Sie wartet auf eine Lücke, um die Straße zu überqueren, und sagt sich einmal mehr, wie gestern, wie vorgestern, daß sie auf dominikanischem Boden ist. In New York schaut niemand mehr die Frauen mit dieser Dreistheit an. Maßnehmend, abwägend, abschätzend, wieviel Fleisch jede ihrer Brüste, jeder ihrer Schenkel enthält, wieviel Haar ihr Schamhügel, wie die Kurve ihrer Hinterbacken verläuft. Sie schließt die Augen, von leichtem Schwindel erfaßt. So schauen in New York nicht einmal mehr die Latinos, die Dominikaner, Kolumbianer, Guatemalteken. Sie haben gelernt, sich zurückzunehmen, begriffen, daß sie die Frauen nicht anschauen dürfen wie Hunde die Hündinnen, Hengste die Stuten, Eber die Sauen.
Als sich eine Lücke im Verkehr auftut, überquert sie die Straße im Laufschritt. Aber sie kehrt nicht um, geht nicht zurück zum Hotel Jaragua; statt dessen führen ihre Schritte, nicht ihr Wille, sie um das Hispaniola herum auf die Independencia, eine breite Straße, die, wenn ihre Erinnerung sie nicht trügt, mit ihrer doppelten Reihe dicht belaubter Lorbeerbäume, deren Wipfel sich über dem Fahrdamm treffen und ihm Kühle spenden, von hier aus bis zu einer Gabelung weiterführt und sich dann im Kolonialviertel verliert. Wie oft bist du an der Hand deines Vaters im rauschenden Schatten der Lorbeerbäume der Independencia gegangen. Sie spazierten von der César Nicolás Penson bis zu dieser Avenida hinunter, bis zum Independencia-Park. In der italienischen Eisdiele, rechts, am Anfang von El Conde, aßen sie ein Kokus-, Mango- oder Guyabaeis. Mit welchem Stolz gingst du an der Hand dieses Herrn – des Senators Cabral, des Ministers Cabral. Alle kannten ihn. Sie traten heran, gaben ihm die Hand, nahmen den Hut ab, verbeugten sich vor ihm, und Polizisten und Militärs schlugen die Hacken zusammen, wenn sie ihn vorbeigehen sahen. Wie sehr mußt du dich nach diesen Jahren zurückgesehnt haben, in denen du so wichtig warst, Papa, als du dich in einen ganz gewöhnlichen armen Teufel verwandeltest. Man begnügte sich damit, dich im Öffentlichen Forum zu beschimpfen, und steckte dich nicht ins Gefängnis wie Anselmo Paulino. Davor hast du dich am meisten gefürchtet, nicht? Daß der Chef eines Tages befehlen könnte: Cerebrito ins Gefängnis! Du hast Glück gehabt, Papa.
Sie ist seit einer Dreiviertelstunde unterwegs, und es fehlt noch ein gutes Stück bis zum Hotel. Wenn sie Geld dabei hätte, würde sie sich in irgendein Café setzen, frühstücken und sich ausruhen. Der Schweiß zwingt sie, sich alle Augenblicke das Gesicht abzuwischen. Die Jahre, Urania. Mit neunundvierzig ist man nicht mehr jung. Auch wenn du dich besser gehalten hast als andere. Aber du bist noch nicht soweit, zum alten Eisen geworfen zu werden, nach den Blicken zu urteilen, die von rechts und links ihr Gesicht und ihren Körper treffen, verführerische, begehrliche, freche, unverschämte Blicke von Männern, die es gewohnt sind, jede Frau auf der Straße mit Augen und Gedanken auszuziehen. »Neunundvierzig Jahre, die dir wunderbar zu Gesicht stehen, Uri«, hatte Dick Litney, ihr Kollege und Freund im New Yorker Anwaltsbüro, am Tag ihres Geburtstages zu ihr gesagt, eine Kühnheit, die kein Mann der Kanzlei sich erlaubt hätte, es sei denn, er hätte, wie Dick an jenem Abend, zwei oder drei Whiskys intus. Armer Dick. Er wurde rot und geriet in Verwirrung, als Urania ihn mit einem dieser langen, eisigen Blicke bedachte, mit denen sie seit fünfunddreißig Jahren auf Komplimente, anzügliche Witze, Scherze, Anspielungen oder dumme Reden der Männer und bisweilen der Frauen reagiert.
Sie bleibt stehen, um Atem zu holen. Sie spürt ihr außer Kontrolle geratenes Herz, ihre Brust, die sich hebt und senkt. Sie steht an der Ecke Independencia und Máximo Gómez und wartet inmitten einer Traube von Männern und Frauen darauf, die Straße überqueren zu können. Ihre Nase registriert eine Vielfalt von Gerüchen, die genauso groß ist wie die endlose Zahl von Geräuschen, die in ihren Ohren hämmern: das Öl, das die Motoren der Autobusse verbrennen und die Auspuffrohre ausstoßen, züngelnde Rauchwölkchen, die sich auflösen oder über den Fußgängern in der Luft schweben; Gerüche nach Fett und Gebratenem von einem Verkaufsposten, wo zwei Pfannen brutzeln und Essen und Getränke angeboten werden, und dieses dichte, undefinierbare, tropische Aroma von Harz und verfaulenden Pflanzen, von schwitzenden Leibern, eine Luft, getränkt mit tierischen, pflanzlichen und menschlichen Ausdünstungen, aufgeheizt von der Sonne, die ihre Auflösung und Verflüchtigung hinauszögert. Es ist ein warmer Geruch, der irgend etwas tief in ihrer Erinnerung anrührt und sie in ihre Kindheit zurückversetzt, zu den Bougainvilleen, die in allen Farben von Dächern und Balkonen herabwuchsen, auf diese Avenida Máximo Gómez. Der Muttertag! Natürlich. Der Mai mit strahlender Sonne, sintflutartigen Regenfällen, Hitze. Die Mädchen der Santo-Domingo-Schule, auserwählt, um Mama Julia, der Erhabenen Matrone, Mutter des Wohltäters, Spiegel und Symbol der dominikanischen Mutter, Blumen zu bringen. Sie kamen in einem Bus von der Schule, in ihren makellosen weißen Uniformen, begleitet von der Oberin und von Sister Mary. Du branntest vor Ungeduld, Stolz, Liebe und Respekt. Du würdest als Abgesandte der Schule das Haus von Mama Julia betreten. Du würdest vor ihr das Gedicht »Mutter und Lehrerin, Erhabene Matrone« aufsagen, das du geschrieben, auswendig gelernt und Dutzende Male vor dem Spiegel, vor deinen Klassenkameradinnen, vor Lucinda und Manolita, vor Papa, vor den Sisters aufgesagt und stumm für dich wiederholt hattest, um sicher zu sein, nicht eine Silbe zu vergessen. Als der glorreiche Augenblick gekommen war, im großen, rosafarbenen Haus von Mama Julia, und sie, verwirrt von den Militärs, den Damen, den Adjutanten, den Delegationen, die sich in Gärten, Zimmern, Fluren drängten, von Aufregung und Rührung überwältigt, einen Schritt nach vorne tat, kaum einen Meter von der alten Frau entfernt, die ihr aus ihrem Schaukelstuhl wohlwollend zulächelte, den Strauß Rosen im Arm, den die Oberin ihr gerade überreicht hatte, bekam sie einen Knoten im Hals, und ihr Kopf war völlig leer. Du brachst in Tränen aus. Du hörtest Lachen, aufmunternde Worte von den Damen und Herren, die Mama Julia umringten. Die Erhabene Matrone hieß dich lächelnd näher treten. Daraufhin faßte sich Uranita, wischte sich die Tränen ab, richtete sich auf und sagte rasch und entschlossen, wenn auch ohne die richtige Betonung, »Mutter und Lehrerin, Erhabene Matrone« auf, ohne abzusetzen. Man applaudierte ihr. Mama Julia strich ihr über das Haar, und ihr von tausend Falten zerfurchtes Mündchen gab ihr einen Kuß.
Endlich ändert sich das Licht. Urania setzt ihren Weg fort, vor der Sonne geschützt durch den Schatten der Bäume auf der Máximo Gómez. Seit einer Stunde läuft sie schon. Es ist angenehm, unter den Lorbeerbäumen zu gehen, die Sträucher voll kleiner roter Blüten mit goldenem Stempel zu entdecken, Pfefferstrauch oder Christusblut genannt, während sie in ihre Gedanken vertieft ist, eingelullt von der Anarchie der Stimmen und der Musik und doch auf der Hut vor den Unebenheiten, Schlaglöchern, Vertiefungen, Verwerfungen der Bürgersteige, über die sie ständig zu stolpern droht, oder vor den Abfallhaufen, an dem Straßenhunde schnüffeln. Warst du damals glücklich? Als du mit dieser Gruppe von Schülerinnen der Santo-Domingo-Schule am Muttertag zur Erhabenen Matrone gingst, um ihr Blumen zu bringen und das Gedicht aufzusagen, warst du es. Obwohl seit dem Augenblick, da die wunderschöne Gestalt, die ihre Kindheit beschützt hatte, aus dem Haus in der César Nicolás Penson verschwunden war, vielleicht auch die Idee des Glücks sich aus Uranias Leben verf lüchtigt hatte. Aber dein Vater und deine Onkel und Tanten – vor allem Tante Adelina und Onkel Aníbal und die Cousinen Lucindita und Manolita – und die alten Freunde taten alles Menschenmögliche, um das Fehlen deiner Mutter durch liebevolle Fürsorge auszugleichen, damit du dich nicht allein, zurückgesetzt fühltest. Dein Vater war dir in jenen Jahren Vater und Mutter gewesen. Deshalb hattest du ihn so geliebt. Deshalb hatte es dir so weh getan, Urania.
Als sie zum Hintereingang des Hotels Jaragua kommt, einem breiten Gittertor, durch das die Autos, die Hoteldiener, die Köche, die Zimmermädchen, das Reinigungspersonal in das Gebäude gelangen, bleibt sie nicht stehen. Wohin gehst du? Sie hat keine Entscheidung getroffen. Keinen Moment lang denkt ihr Kopf, der auf ihre Kindheit, auf ihre Schule, auf die Sonntage konzentriert ist, an denen sie mit ihrer Tante Adelina und ihren Cousinen zur Kindervorstellung des Elite-Kinos ging, daran, am Hotel vorbeizugehen, nicht zu duschen und zu frühstücken. Ihre Füße haben beschlossen weiterzugehen. Sie läuft ohne zu zögern, mit sicherer Orientierung, zwischen Fußgängern und Autos, die ungeduldig an den Ampeln warten. Willst du wirklich dorthin, wo du hingehst, Urania? Jetzt weißt du, daß du es tust, auch wenn du es zu bereuen haben wirst.
An der Calle Cervantes biegt sie nach links ab und geht weiter bis zur Bolívar, während sie wie im Traum die ein- oder zweistöckigen Einfamilienhäuser wiedererkennt, mit Mauern und Gärten, unbedeckten Terrassen und Garagen, die ein Gefühl von Vertrautheit in ihr wecken, gut erhaltene, beschädigte, leicht verblaßte, abgeblätterte Bilder, durch Anbauten und Zusätze entstellt, auf die Terrassendächer gesetzte, an die Seiten gefügte, inmitten der Gärten errichtete Bauten, um die Sprößlinge unterzubringen, die heiraten und nicht allein leben können, die sich den Familien anschließen und mehr Raum verlangen. Sie geht an Wäschereien, Apotheken, Blumengeschäften, Cafés, Schildern von Zahnärzten, Ärzten, Rechnungsprüfern und Anwälten vorbei. Auf der Avenida Bolívar beschleunigt sie, als versuchte sie, jemanden einzuholen, als würde sie gleich losrennen. Das Herz schlägt ihr bis zum Hals. Du wirst jeden Augenblick zusammenbrechen. Auf der Höhe von Rosa Duarte biegt sie nach links ab und rennt los. Aber die Anstrengung ist zu groß, und sie geht wieder im Schritt, jetzt langsamer, dicht an der weißlichen Mauer eines Hauses, für den Fall, daß der Schwindel wiederkommt und sie sich auf etwas stützen muß, um Atem zu holen. Außer einem lächerlichen, schmalen vierstöckigen Gebäude dort, wo das kleine stacheldrahtbewehrte Haus von Doktor Estanislas stand, der sie einst an den Mandeln operierte, hat sich nichts verändert; sie würde sogar schwören, daß die Dienstmädchen, die die Gartenwege und vor den Fassaden fegen, sie gleich grüßen werden: »Hallo, Uranita. Wie geht’s dir, Mädchen. Wie du gewachsen bist. Wohin denn nur so eilig, heilige Mutter Gottes.«
Das Haus hat sich auch nicht sehr verändert, obwohl sie sich erinnert, daß das Grau seiner Wände kräftig war; jetzt ist es verblaßt und voller Flecken und abgeblätterter Stellen. Der Garten hat sich in ein Dickicht aus Unkraut, welkem Laub und vertrocknetem Gras verwandelt. Seit Jahren wird ihn niemand begossen oder beschnitten haben. Da ist der Mangobaum. War das der Flamboyant? Er muß es gewesen sein, als er Blätter und Blüten hatte; jetzt ist er ein Stamm mit nackten, verdorrten Armen.
Sie lehnt sich gegen die durchbrochene Eisentür, die zum Garten führt. Der kleine Fliesenweg mit dem in den Fugen sprießenden Unkraut ist verfallen, und auf der Terrasse, unter dem Vordach, steht ein schiefer Stuhl mit einem kaputten Bein. Die Möbel mit ihren Bezügen aus gelber Kretonne sind verschwunden. Auch die kleine Mattglaslampe an der Ecke, die die Terrasse beleuchtete und am Tag die Schmetterlinge anzog und in der Nacht summende Insekten. Dem kleinen Balkon ihres Schlafzimmers fehlt die malvenfarbene Bougainvillea, die ihn überdeckte; er ist ein Vorsprung aus Zement, mit rostigen Flecken.
Im hinteren Teil der Terrasse öffnet sich mit anhaltendem Knarren eine Tür. Eine weibliche Gestalt in weißer Uniform betrachtet sie neugierig:
»Suchen Sie jemanden?«
Urania bringt kein Wort hervor; sie ist zu aufgeregt, bewegt, verschreckt. Sie steht stumm und schaut die Unbekannte an.
»Womit kann ich Ihnen dienen?« fragt die Frau.
»Ich bin Urania«, sagt sie schließlich. »Die Tochter von Agustín Cabral.«
II
Er wachte auf, gelähmt vom Gefühl einer Katastrophe. Reglos blinzelte er in der Dunkelheit, gefangen in einem Spinnennetz, kurz davor, von einem haarigen Tier voller Augen verschlungen zu werden. Endlich konnte er die Hand zum Nachttisch ausstrecken, auf dem er den Revolver und die Maschinenpistole mit dem eingelegten Magazin aufbewahrte. Aber statt nach der Waffe griff er nach dem Wecker: zehn Minuten vor vier. Er atmete auf. Jetzt war er völlig wach. Alpträume, schon wieder? Er hatte noch ein paar Minuten; als Pünktlichkeitsfanatiker sprang er nicht vor vier aus dem Bett. Keine Minute früher oder später.
›Der Disziplin verdanke ich alles, was ich bin‹, dachte er. Und diese Disziplin, Kompaß seines Lebens, verdankte er den marines. Er schloß die Augen. Die Zulassungsprüfungen in San Pedro de Macorís für die Dominikanische Polizei, die die Yankees im dritten Jahr der Besetzung zu schaffen beschlossen hatten, waren extrem hart. Er bestand sie ohne Schwierigkeiten. Im Zuge der Ausbildung schied die Hälfte der Anwärter aus. Er genoß jede Übung, bei der Beweglichkeit, Entschlossenheit, Risikobereitschaft oder Widerstandskraft gefragt waren, selbst die brutalen, bei denen es darum ging, Willensstärke und Gehorsam gegenüber dem Vorgesetzten unter Beweis zu stellen: sich mit voller Montur in den Morast werfen oder im Wald überleben, indem man den eigenen Urin trank und sich von Pflanzenstengeln, Gräsern und Heuschrecken ernährte. Seargent Gittleman hatte ihm die höchste Note gegeben: »Du wirst es weit bringen, Trujillo.« Er hatte es weit gebracht, ja, dank dieser erbarmungslosen, Helden und Mystikern abgeschauten Disziplin, die die marines ihm beigebracht hatten. Er dachte mit Dankbarkeit an den Unteroffizier Simon Gittleman. Ein loyaler, uneigennütziger Gringo in diesem Land von Raffzähnen, Blutsaugern und Idioten. Hatten die Vereinigten Staaten in den letzten einunddreißig Jahren einen aufrichtigeren Freund gehabt als ihn? Welche Regierung hatte sie in der UNO mehr unterstützt? Wer war der erste gewesen, der Deutschland und Japan den Krieg erklärt hatte? Wer schmierte die Repräsentanten, Senatoren, Gouverneure, Bürgermeister, Anwälte und Journalisten der Vereinigten Staaten mit mehr Dollar? Der Lohn: die Wirtschaftssanktionen der OAS, um dem Negerlein Rómulo Betancourt zu Gefallen zu sein und weiter an das venezolanische Erdöl zu kommen. Wenn Johnny Abbes seine Arbeit besser gemacht und die Bombe der Schwuchtel Rómulo den Kopf abgerissen hätte, gäbe es keine Sanktionen und die dämlichen Gringos würden ihm nicht mit staatlicher Souveränität, mit der Demokratie und den Menschenrechten auf die Nerven gehen. Aber dann hätte er nicht entdeckt, daß er in diesem Land von zweihundert Millionen Idioten einen Freund wie Simon Gittleman hatte. Imstande, von Phoenix, Arizona, aus, wo er seit seinem Abschied von den marines seinen Geschäften nachging, einen persönlichen Feldzug zur Verteidigung der Dominikanischen Republik zu führen. Ohne einen Centavo zu verlangen! Es gab noch solche Männer bei den marines. Ohne etwas zu verlangen oder die Hand aufzuhalten! Was für eine Lektion für die Blutsauger des Senats und des Abgeordnetenhauses, die er seit so vielen Jahren mästete, die immer mehr Schecks, mehr Konzessionen, mehr Dekrete, mehr steuerliche Befreiungen verlangten und sich jetzt, da er sie brauchte, taub stellten.
Er sah auf die Uhr: noch vier Minuten. Ein großartiger Gringo, dieser Simon Gittleman! Ein echter marine. Er gab seine Geschäfte in Arizona auf, empört über die vom Weißen Haus, von Venezuela und der OAS eingeleitete Offensive gegen Trujillo, und bombardierte die nordamerikanische Presse mit Briefen, in denen er daran erinnerte, daß die Dominikanische Republik während der Ära Trujillo ein Bollwerk des Antikommunismus gewesen war, der beste Verbündete der Vereinigten Staaten in der westlichen Welt. Damit nicht zufrieden, gründete er – und das mit Mitteln aus seiner eigenen Tasche! – Unterstützungskomitees, sorgte für Publikationen, organisierte Vorträge. Und kam, um ein Beispiel zu geben, mit seiner Familie nach Ciudad Trujillo und mietete ein Haus an der Uferpromenade. Heute mittag würden Simon und Dorothy mit ihm im Regierungspalast essen, und der ehemalige marine würde den Verdienstorden Juan Pablo Duarte erhalten, die höchste dominikanische Auszeichnung. Ein echter marine, jawohl!
Punkt vier Uhr, jetzt ja. Er knipste die Nachttischlampe an, schlüpfte in die Hausschuhe und stand auf, ohne die frühere Beweglichkeit. Die Knochen taten ihm weh, und er spürte schmerzhaft die Muskeln der Beine und des Rückens, wie vor kurzem im Mahagonihaus, in der verfluchten Nacht mit dem kleinen spröden Mädchen. Vor lauter Verdruß knirschte er mit den Zähnen. Er ging zum Stuhl, auf dem Sinforoso ihm seine Sportkombination und seine Turnschuhe hingelegt hatte, als ein Verdacht ihn innehalten ließ. Beklommen musterte er das Laken: der formlose kleine Fleck von gräulicher Farbe entstellte das weiße Leinen. Es war ihm wieder passiert. Die Empörung löschte die unangenehme Erinnerung an das Mahagonihaus aus. Scheiße! Verdammte Scheiße! Das war kein Feind, dem er den Garaus machen konnte wie den Hunderten, den Tausenden, denen er im Lauf der Jahre die Stirn geboten, die er besiegt hatte, indem er sie gekauft, eingeschüchtert oder umgebracht hatte. Er lebte in seinem Innern, Fleisch von seinem Fleisch, Blut von seinem Blut. Er zerstörte ihn gerade jetzt, da er mehr Kraft und Gesundheit brauchte denn je. Das Klappergestell von Mädchen hatte ihm Pech gebracht.
Er fand alles makellos gewaschen und gebügelt vor, die Hosenträger, die Shorts, das Hemd, die Sportschuhe. Er kleidete sich mit Mühe an. Nie hatte er viele Stunden Schlaf gebraucht; von Jugend an, in San Cristóbal oder als Aufseher in der Zuckermühle Boca Chica, hatten vier oder fünf ihm genügt, auch wenn er bis zum Morgengrauen getrunken und gevögelt hatte. Seine Fähigkeit, sich mit einem Minimum an Ruhe körperlich zu regenerieren, hatte seinen Nimbus als höheres Wesen befördert. Damit war es vorbei. Er erwachte müde, nach kaum vier Stunden Schlaf; meistens waren es nur zwei oder drei, und das durch Alpträume aufgeschreckt.
Die Nacht zuvor hatte er schlaflos im Dunkel gelegen. Durch die Fenster sah er die Kronen einiger Bäume und ein Stück sternenbesäten Himmel. In der hellen Nacht drangen bisweilen die Stimmen der alten Nachteulen zu ihm, die Gedichte von Juan de Dios Peza, von Amado Nervo, von Rubén Darío (was ihn vermuten ließ, daß der Lebende Dreck bei ihnen war, der Darío auswendig kannte), die Zwanzig Liebesgedichte von Pablo Neruda und die pikanten Stanzen von Juan Antonio Alix deklamierten. Und natürlich die Verse von Doña María, der dominikanischen Schriftstellerin und Moralistin. Er lachte, während er auf das Heimfahrrad stieg und in die Pedale zu treten begann. Seine Frau hatte die Sache schließlich ernst genommen und organisierte von Zeit zu Zeit im Rollschuhpavillon der Villa Radhamés literarische Abende, zu denen sie Vortragskünstlerinnen einlud, die idiotische Verse aufsagten. Der Senator Henry Chirinos, der sich als Dichter gebärdete, pflegte an diesen Soireen teilzunehmen, dank deren er seine Zirrhose auf Kosten der Staatskasse pflegte. Um sich bei María Martínez beliebt zu machen, hatten diese blöden Vetteln, wie Chirinos selbst, ganze Seiten der Moralischen Meditationen oder lange Tiraden des Theaterstückchens Falsche Freundschaft auswendig gelernt, rezitierten sie und ließen sich von den Schnattermäulern beklatschen. Und seine Frau – denn diese dicke, dämliche Alte, die Vortreffliche Dame, war schließlich und endlich seine Frau – hatte das mit der Schriftstellerei und dem Moralisieren ernst genommen. Warum nicht. Sagten es nicht die Zeitungen, die Rundfunksender, das Fernsehen? Waren sie nicht Pflichtlektüre in den Schulen, diese Moralischen Meditationen mit einem Vorwort des Mexikaners José Vasconcelos, die alle zwei Monate neu gedruckt wurden? War Falsche Freundschaft nicht der größte Theatererfolg der nun schon einunddreißig Jahre währenden Ära Trujillo gewesen? Hatten die Kritiker, die Journalisten, die Universitätsprofessoren, die Geistlichen, die Intellektuellen seine Frau nicht in den Himmel gehoben? Hatte man ihr im Instituto Trujilloniano nicht ein Seminar gewidmet? Hatten die Soutaneträger, die Bischöfe, diese verräterischen Pfaffen, diese Judasse, die erst aus seiner Tasche gelebt hatten und jetzt genau wie die Yankees von Menschenrechten zu faseln begannen, nicht ihre Gedanken gelobt? Die Vortreffliche Dame war Schriftstellerin und Moralistin. Das war nicht ihr Verdienst, sondern seines, wie alles, was in diesem Land seit drei Jahrzehnten geschah. Trujillo konnte bewirken, daß Wasser sich in Wein verwandelte und das Brot sich vermehrte, wenn es ihn in den Eiern juckte. Er hatte María beim letzten Streit daran erinnert: »Du vergißt, daß nicht du diesen Blödsinn verzapft hast, du kannst ja nicht mal deinen Namen fehlerfrei schreiben, sondern dieser Verräter, der Galicier José Almoina, den ich bezahlt habe. Weißt du nicht, was die Leute sagen? Daß das Stück eigentlich Falscher Fuffziger heißen müßte.« Wieder schüttelte ihn ein offenes, fröhliches Lachen. Seine Bitterkeit war verflogen. María brach in Tränen aus: »Wie du mich demütigst!« und drohte ihm damit, sich bei Mama Julia zu beschweren. Als hätte seine arme Mutter mit ihren sechsundneunzig Jahren Sinn für Familienzwiste. Genau wie seine Brüder benutzte seine Frau die Erhabene Matrone ständig als Tränentuch. Um Frieden zu schließen, mußte er die Dame wieder einmal schmieren. Denn es stimmte, was die Dominikaner hinter vorgehaltener Hand erzählten: Die Schriftstellerin und Moralistin war ein Raffzahn, eine Seele voller Schäbigkeit. Schon in ihrer ersten Zeit als Liebespaar. Noch als junges Mädchen kam sie auf die Idee mit der Wäscherei für die Uniformen der Dominikanischen Polizei, mit der sie ihre ersten Pesos verdiente. Das Radfahren hatte ihn erwärmt. Er fühlte sich in Form. Fünfzehn Minuten: genug. Weitere fünfzehn Rudern, bevor die Schlacht des Tages begann.
Das Rudergestell befand sich in einem angrenzenden kleinen Raum, der vollgestopft war mit Sportgeräten. Er begann zu rudern, als ein Wiehern in der Stille des Morgengrauens vibrierte, anhaltend, musikalisch, wie ein fröhliches Lob des Lebens. Wie lange war er nicht mehr geritten? Monate. Er hatte nie genug davon bekommen, nach fünfzig Jahren machte es ihm noch immer Freude, wie der erste Schluck aus einem Glas mit spanischem Brandy Carlos I. oder der erste Blick auf den nackten, weißen, üppigen Körper eines begehrten weiblichen Wesens. Aber dieser Gedanke wurde von der Erinnerung an das dürre Mädchen vergiftet, das dieser Scheißkerl ihm ins Bett gelegt hatte. Hatte er es im Wissen um die Demütigung getan, die er erleben würde? Dazu fehlte ihm der Schneid. Sie hatte es ihm bestimmt erzählt, und er hatte schallend gelacht. Sicher lief es schon von Klatschmaul zu Klatschmaul in den kleinen Cafés von El Conde. Er zitterte vor Scham und Wut, während er noch immer gleichmäßig ruderte. Er schwitzte schon. Wenn man ihn sehen würde! Ein weiterer Mythos, der kolportiert wurde: »Trujillo schwitzt nie. Er trägt im glühendsten Sommer diese Uniformen aus schwerem Tuch, dazu Dreispitz aus Samt und Handschuhe, und kein Schweiß glänzt auf seiner Stirn.« Er schwitzte nicht, wenn er nicht wollte. Aber in der Intimität, wenn er seine Übungen machte, gab er seinem Körper die Erlaubnis. In der letzten schwierigen, problemreichen Zeit hatte er auf die Pferde verzichtet. Vielleicht würde er diese Woche nach San Cristóbal fahren. Er würde allein unter den Bäumen, am Fluß entlang reiten, wie früher, und er würde sich verjüngt fühlen. ›Nicht einmal die Arme einer Frau sind so zärtlich wie der Rücken eines Fuchses.‹
Er hörte mit dem Rudern auf, als er einen Krampf im linken Arm spürte. Nachdem er sein Gesicht abgewischt hatte, sah er auf seine Hose, in Höhe des Hosenschlitzes. Nichts. Es war noch immer dunkel. Die Bäume und Büsche der Villa Radhamés waren dunkle Flecken unter einem reinen Himmel voller flimmernder kleiner Lichter. Wie lautete der Vers von Neruda, der den schwatzhaften Freundinnen der Moralistin so sehr gefiel? »Und blaugefroren zittern weit entfernte Gestirne.« Diese alten Vetteln träumten zitternd von irgendeinem Dichter, der sie kratzte, wo es sie juckte. Und sie hatten nur diesen Frankenstein Chirinos in greifbarer Nähe. Wieder kicherte er laut vor sich hin, was ihm in diesen Zeiten selten widerfuhr.
Er zog sich aus und ging in Hausschuhen und Morgenmantel ins Bad, um sich zu rasieren. Er stellte das Radio an. In der Stimme der dominikanischen Republik und in Radio Karibik lief gerade die Presseschau. Bis vor einigen Jahren begannen die Nachrichten um fünf. Aber als sein Bruder Petán, der Besitzer derStimme, erfuhr, daß er um vier Uhr aufwachte, zog er die Nachrichtensendung vor. Die anderen Sender taten es ihm nach. Sie wußten, daß er Radio hörte, während er sich rasierte, badete und ankleidete, und taten ihr Bestes.
Nach einem Werbespot des Hotel-Restaurants El Conde, worin ein Tanzabend mit den Giganten des Rhythmus unter der Leitung von Professor Gatón und mit dem Sänger Johnny Ventura angekündigt wurde, berichtete die Stimme über den Julia-Molina-verwitwete-Trujillo-Preis für die Kinderreichste Mutter. Die Gewinnerin, Doña Alejandrina Francisco, Mutter von einundzwanzig lebenden Kindern, hatte beim Erhalt der Medaille mit dem Abbild der Erhabenen Matrone erklärt: »Meine einundzwanzig Kinder werden ihr Leben für den Wohltäter geben, wenn er es von ihnen verlangt.« »Ich glaub dir kein Wort, dumme Ziege.«
Er hatte sich die Zähne geputzt, und jetzt rasierte er sich mit der Sorgfalt, mit der er es getan hatte, seit er ein kleiner Hungerleider in San Cristóbal gewesen war. Als er nicht einmal wußte, ob seine arme Mutter, der nun am Muttertag das ganze Land huldigte (»Quelle der Barmherzigkeit und Mutter des hehren Mannes, der uns regiert«, sagte der Sprecher), am Abend Bohnen und Reis für die acht Mäuler der Familie haben würde. Sauberkeit, Körperpflege und äußere Erscheinung waren für ihn die einzige Religion gewesen, die er bewußt praktizierte.
Nach einer weiteren langen Liste von Besuchern, die zu Mama Julia kamen, um sie zum Muttertag zu beglückwünschen (arme Alte, die unerschütterlich diese Karawane von Schulen, Verbänden, Instituten, Gewerkschaften empfing und sich mit ihrer schwachen kleinen Stimme für die Blumen und Glückwünsche bedankte), begannen die Attacken auf die Bischöfe Reilly und Panal, »die nicht unter unserer Sonne geboren wurden und nicht unter unserem Mond gelitten haben« (›Hübsch‹, dachte er), »sich in unser ziviles und politisches Leben einmischen und dabei den Boden der Strafbarkeit betreten«. Johnny Abbes wollte die Santo-Domingo-Schule stürmen und den Yankee-Bischof aus seiner Zuflucht holen. »Was kann schon passieren, Chef? Die Gringos werden natürlich protestieren. Protestieren sie denn nicht schon ewig wegen allem möglichen? Wegen Galíndez, wegen des Piloten Murphy, wegen der Schwestern Mirabal, wegen des Attentats auf Betancourt, wegen tausend anderer Sachen. Was macht es schon, wenn sie in Caracas, Puerto Rico, Washington, New York, Havanna bellen. Wichtig ist, was hier passiert. Nur wenn die Pfaffen einen Schrecken bekommen, werden sie aufhören zu konspirieren.« Nein. Der Augenblick war noch nicht gekommen, mit Reilly abzurechnen oder mit dem anderen Scheißkerl, dem Bischof Panal, diesem Spanierlein. Er würde kommen, sie würden bezahlen. Sein Instinkt trog ihn nicht. Den Bischöfen einstweilen kein Haar krümmen, auch wenn sie weiter nervten, wie sie es seit Sonntag, dem 25. Januar 1960, taten – fast eineinhalb Jahre schon! –, als der Hirtenbrief der Bischöfe von allen Kanzeln verlesen wurde und die Kampagne der katholischen Kirche gegen das Regime einleitete. Diese Schandmäuler! Diese Pfaffen! Diese Eunuchen! Das ihm, der im Vatikan von Pius XII. mit dem Großkreuz des päpstlichen Ordens des heiligen Georg ausgezeichnet worden war. In der Stimme erinnerte Paíno Pichardo in einer Rede, die er am Vorabend in seiner Eigenschaft als Innenund Kultusminister gehalten hatte, daß der Staat insgesamt sechzig Millionen Pesos für diese Kirche ausgegeben habe, deren »Bischöfe und Priester der Schar der dominikanischen Gläubigen jetzt einen so großen Schaden zufügen«. Er wechselte den Sender. In Radio Karibik verlasen sie einen Protestbrief mehrerer hundert Arbeiter: Man habe ihre Unterschriften nicht aufgenommen in das Große Nationale Manifest »gegen die störenden Machenschaften des Bischofs Reilly, Verräter an Gott und Trujillo und seiner Manneswürde, der, statt in seiner Diözese San Juan de la Maguana zu bleiben, wie eine verängstigte Ratte nach Ciudad Trujillo gelaufen war, um sich unter den Röcken der nordamerikanischen Nonnen der Santo-Domingo-Schule zu verstecken, einer Höhle des Terrorismus und der Konspiration«. Als er gehört hatte, daß das Unterrichtsministerium der Santo-Domingo-Schule wegen »Komplizenschaft der ausländischen Nonnen mit den staatsfeindlichen terroristischen Intrigen der Purpurträger aus San Juan de la Maguana und La Vega« die Staatlichkeit aberkannt hatte, kehrte er zur Stimme zurück, gerade rechtzeitig, um vom Sprecher die Bekanntgabe eines weiteren Sieges der dominikanischen Polomannschaft in Paris zu hören, wo sie »auf dem schönen Spielfeld von Bagatelle das sachverständige Publikum begeisterte und nach einem Fünf-zu-vier-Sieg gegen die Leopards den Aperture-Pokal erhielt«. Ramfis und Radhamés die gefeiertsten Spieler. Eine Lüge, um den Dominikanern zu schmeicheln. Und ihm. Er spürte ein Ziehen am Mageneingang, das ihn jedesmal befiel, wenn er an seine Söhne dachte, diese erfolgreichen Mißerfolge, diese Enttäuschungen. In Paris Polo zu spielen und Französinnen flachzulegen, während ihr Vater die härteste Schlacht seines Lebens schlug.
Er wischte sich das Gesicht ab. Sein Blut wurde sauer, wenn er an seine Söhne dachte. Mein Gott, er war es nicht, der versagt hatte. Seine Rasse war gesund, ein Zuchthengst mit großem Stockmaß. Da waren zum Beweis die Kinder, die sein Samen in anderen Leibern gezeugt hatte, dem von Lina Lovatón, um ein naheliegendes Beispiel zu nennen, kräftige, energische Burschen, die es tausendmal verdienten, den Platz dieser beiden Schmarotzer einzunehmen, dieser Nieten mit den Namen von Operngestalten. Warum hatte er zugelassen, daß die Vortreffliche Dame seinen Söhnen die Namen aus dieser Oper Aida gab, die sie unglücklicherweise in New York gesehen hatte? Sie hatten ihnen Pech gebracht, Operettenbuffos aus ihnen gemacht, statt Männer mit Haaren auf der Brust. Bohemiens, Müßiggänger ohne Charakter noch Ehrgeiz, die nur zum Amüsement taugten. Sie waren nach seinen Brüdern geraten, nicht nach ihm. Genauso unnütz wie Negro, Petán, Pipí, Aníbal, dieser Haufen von Spitzbuben, Schmarotzern, Taugenichtsen und armen Teufeln. Keiner besaß auch nur ein Millionstel seiner Tatkraft, seines Willens, seiner Vision. Was würde nach seinem Tod aus diesem Land werden? Bestimmt war Ramfis nicht einmal so gut im Bett, wie seine Schmeichler ihm nachsagten. Er hat Kim Novak flachgelegt! Er hat Zsa Zsa Gabor flachgelegt! Er hat Debra Paget und halb Hollywood über die Klinge springen lassen! Was für ein Verdienst. Mit Mercedessen, Cadillacs und Nerzmänteln als Geschenk hätte es sogar der verrückte Valeriano mit Miss Universum und mit Elizabeth Taylor getrieben. Armer Ramfis. Er hatte den Verdacht, daß ihm die Frauen gar nicht so sehr gefielen. Ihm gefiel der äußere Schein, daß man sagte, er sei der beste Bespringer dieses Landes, besser noch als Porfirio Rubirosa, der Dominikaner, der in der ganzen Welt durch die Größe seiner Rute und seine Heldentaten als internationaler Hurenbock bekannt war. Spielte er auch Polo mit seinen Söhnen, drüben in Bagatelle, der Große Schänder? Die Sympathie, die er für Porfirio empfand, seit dieser zum Korps seiner Militäradjutanten gehörte, ein Gefühl, das sich trotz dessen gescheiterter Ehe mit seiner ältesten Tochter Flor de Oro erhalten hatte, verbesserte seine Laune. Porfirio besaß Ehrgeiz und hatte große Frauen flachgelegt, von der Französin Danielle Darrieux bis zur Multimillionärin Barbara Hutton, ohne ihnen einen Blumenstrauß zu schenken, im Gegenteil, ausgepreßt hatte er sie und sich auf ihre Kosten bereichert.
Er füllte die Badewanne mit aufschäumenden Salzen und stieg mit der tiefen Zufriedenheit jedes Morgens hinein. Porfirio hatte immer ein gutes Leben geführt. Seine Ehe mit Barbara Hutton dauerte einen Monat, gerade so lange, um ihr eine Million Dollar in bar und eine weitere in Form von Immobilien abknöpfen zu können. Wenn Ramfis oder Radhamés wenigstens wie Porfirio wären! Dieser wandelnde Schwanz strotzte vor Ehrgeiz. Und hatte Feinde, wie jeder Sieger. Ständig lag man ihm mit Klatschgeschichten im Ohr, riet ihm, Rubirosa aus dem diplomatischen Dienst zu entfernen, da seine Skandale das Ansehen des Landes befleckten. Neidhammel. Was für eine bessere Reklame konnte es für die Dominikanische Republik geben als einen solchen Schwanz. Seitdem Porfirio mit Flor de Oro verheiratet war, wollte man, daß er dem herumhurenden Mulatten, der seine Tochter verführt und seine Bewunderung gewonnen hatte, den Kopf abriß. Er würde es nicht tun. Er kannte die Verräter, er roch sie, bevor sie wußten, daß sie Verrat begehen würden. Deshalb lebte er noch, und deshalb verfaulten so viele Judasse in La Cuarenta, La Victoria, auf der Beata-Insel, in den Bäuchen der Haie oder mästeten die Würmer der dominikanischen Erde. Armer Ramfis, armer Radhamés. Ein Glück, daß Angelita ein wenig Charakter besaß und bei ihm blieb.
Er stieg aus der Badewanne und nahm eine kurze Dusche. Der Gegensatz zwischen warmem und kaltem Wasser belebte ihn. Jetzt war er tatsächlich gut aufgelegt. Während er sich Deodorant und Talkum auflegte, verfolgte er Radio Karibik, Sprachrohr der Ideen und Losungen des »intelligenten Schurken«, wie er Johnny Abbes nannte, wenn er guter Laune war.
Der wetterte gegen »die Ratte von Miraflores«, »den venezolanischen Abschaum«, und der Sprecher, der sich stimmlich darauf einstellte, daß er von einem Schwulen sprach, erklärte, daß Präsident Rómulo Betancourt nicht nur das venezolanische Volk ausgehungert, sondern obendrein Unglück über Venezuela gebracht habe, denn war da nicht gerade ein weiteres Flugzeug der venezolanischen Luftpostlinie abgestürzt, mit der Folge von zweiundsechzig Todesopfern? Diese Schwuchtel würde ihren Willen nicht kriegen. Betancourt hatte es geschafft, daß die OAS ihm Sanktionen auferlegte, aber wer zuletzt lacht, lacht am besten. Weder die Ratte des Palasts von Miraflores noch Muñoz Marín von Puerto Rico mit seiner Drogenmanie, noch der costaricanische Pistolero Figueres machten ihm Sorgen. Die Kirche dagegen wohl. Perón hatte ihn gewarnt, als er Ciudad Trujillo in Richtung Spanien verließ: »Hüten Sie sich vor den Geistlichen, Generalissimus. Es waren nicht die aufrührerischen Oligarchen oder die Militärs, die mich zu Fall gebracht haben; es waren die Soutanen. Paktieren Sie mit ihnen oder machen Sie ihnen endgültig den Garaus.« Ihn würden sie nicht zu Fall bringen. Sie gingen ihm auf die Eier, das ja. Seit diesem schwarzen 25. Januar 1960, vor genau einem Jahr und vier Monaten, hatten sie nicht einen Tag aufgehört, ihm auf die Eier zu gehen. Briefe, Memoranden, Messen, Novenen, Predigten. Alles, was das soutanetragende Pack gegen ihn tat und sagte, fand Echo im Ausland, und in den Zeitungen, in Rundfunk und Fernsehen war die Rede vom unmittelbar bevorstehenden Sturz Trujillos, jetzt, da »die Kirche sich von ihm abgewandt hat«.
Er zog die Unterhose, das Hemd und die Strümpfe an, die Sinforoso am Vorabend vor dem Kleiderschrank zurechtgelegt hatte, neben dem Kleiderständer, auf dem der graue Anzug, das weiße Oberhemd und die blaue, weißgetupfte Krawatte prangten, die er heute morgen tragen würde. Womit verbrachte der Bischof Reilly seine Tage und Nächte in der Santo-Domingo-Schule? Damit, Nonnen flachzulegen? Sie waren schrecklich, einige hatten Haare im Gesicht. Er erinnerte sich, Angelita hatte diese Schule der Wohlsituierten besucht. Seine Enkelinnen ebenfalls. Wie hatten diese Nonnen ihm geschmeichelt, bis zu dem Hirtenbrief. Vielleicht hatte Johnny Abbes recht, und es war Zeit zu handeln. Da die Manifeste, Artikel, Proteste der Rundfunksender und des Fernsehens, der Institutionen, des Kongresses sie nicht abschreckten, galt es zuzuschlagen. Es war das Volk! Es überrannte die Polizisten, die man zum Schutz der ausländischen Bischöfe dort postiert hatte, drang in die Santo-Domingo-Schule und in den Bischofssitz von La Vega ein, zerrte den Gringo Reilly und den Spanier Panal an den Haaren heraus und lynchte sie. Es rächte die Beleidigung des Vaterlandes. Man würde Beileidsbezeigungen und Entschuldigungen an den Vatikan, an den Heiligen Vater Johannes Blödmann schicken – Balaguer war ein Meister im Abfassen solcher Schriften – und ein paar unter gewöhnlichen Kriminellen ausgewählte Schuldige exemplarisch bestrafen. Würden sich die anderen Pfaffen angesichts der vom Volkszorn gevierteilten Leichname der Bischöfe abschrecken lassen? Nein, es war nicht der richtige Augenblick. Nur keinen Vorwand liefern, damit Kennedy all diesen Betancourt, Muñoz Marín und Figueres zu Gefallen wäre und eine Truppenlandung anordnete. Einen kühlen Kopf bewahren und mit Vorsicht handeln, wie ein marine.
Aber was die Vernunft ihm diktierte, überzeugte seine Drüsen nicht. Er mußte das Ankleiden unterbrechen, blind vor Zorn. Die Wut stieg auf sämtlichen verschlungenen Pfaden seines Körpers in ihm hoch, ein Lavastrom, der sich bis zu seinem Gehirn hochwälzte, das zu knistern schien. Mit geschlossenen Augen zählte er bis zehn. Die Wut war schlecht für die Regierung und für sein Herz, sie brachte ihn dem Infarkt näher. In jener Nacht, im Mahagonihaus, hatte die Wut ihn an den Rand des Kollapses gebracht. Er beruhigte sich. Er hatte es immer verstanden, sie zu kontrollieren, wenn es erforderlich war: sich zu verstellen, sich notfalls freundlich, herzlich zu verhalten gegenüber dem schlimmsten menschlichen Auswurf, diesen Witwen, Kindern oder Brüdern der Verräter. Deshalb würde er das Gewicht seines Landes nun bald zweiunddreißig Jahre lang auf den Schultern tragen.
Er war mit der komplizierten Aufgabe beschäftigt, die Strümpfe an den Strumpfhaltern zu befestigen, damit sie keine Falten warfen. Wie angenehm war es doch, der Wut freien Lauf zu lassen, wenn keine Gefahr für den Staat darin lag, wenn man den Ratten, Kröten, Hyänen und Schlangen geben konnte, was sie verdienten. Die Bäuche der Haie waren Zeugen dafür, daß er sich dieses Vergnügen nicht versagt hatte. War da in Mexiko nicht der Leichnam des perfiden Galiciers José Almoina? Und der des Basken Jesús de Galíndez, eine weitere Schlange, die in die Hand biß, aus der sie fraß? Und der von Ramón Marrero Aristy, der geglaubt hatte, daß er als berühmter Schriftsteller die New York Times mit Informationen gegen die Regierung beliefern konnte, die ihm Besäufnisse, Buchausgaben und Nutten finanzierte? Und die der drei Schwestern Mirabal, die die Kommunistinnen und Heldinnen spielten, waren sie nicht da, um Zeugnis dafür abzulegen, daß nichts seiner Wut Einhalt gebieten konnte, wenn er ihr freien Laufließ? Sogar Valeriano und Barajita, die kleinen Verrückten von El Conde, konnten dies bezeugen.
Er verharrte mit dem Schuh in der Luft, während er sich an das berühmte Pärchen erinnerte. Eine richtige Institution im Kolonialviertel. Sie wohnten unter den Lorbeerbäumen des Kolumbus-Parks, zwischen den Bögen der Kathedrale, und postierten sich zur Hauptgeschäftszeit an den Eingängen der eleganten Schuh-und Schmuckgeschäfte von El Conde, wo sie ihre Verrückten-Nummer aufführten, damit die Leute ihnen eine Münze hinwarfen oder etwas zu essen. Er hatte Valeriano und Barajita mit ihren Lumpen und absurden Verkleidungen oft gesehen. Wenn Valeriano sich für Christus hielt, schleppte er ein Kreuz; wenn für Napoleon, reckte er seinen Besenstiel, brüllte Befehle und rückte gegen den Feind vor. Ein calié, ein Spitzel von Johnny Abbes, berichtete, daß der verrückte Valeriano den Cheflächerlich gemacht, ihn Gendarm genannt hatte. Das weckte seine Neugier. Er beobachtete ihn heimlich von einem Auto mit dunklen Fensterscheiben aus. Der Alte, die Brust mit kleinen Spiegeln und Kronenkorken bedeckt, stolzierte einher und führte seine Medaillen mit Clownsgebaren einer Gruppe erschreckter Zuschauer vor, die nicht wußten, ob sie lachen oder das Weite suchen sollten. »Applaudiert dem Gendarm, ihr Idioten«, rief Barajita, während er auf die schimmernde Brust des Verrückten zeigte. In diesem Augenblick spürte er, wie die Weißglut seinen ganzen Körper erfaßte, ihn blind machte, ihn drängte, den Tollkühnen zu bestrafen. Er gab den Befehl, auf der Stelle. Aber am nächsten Tag, als er dachte, daß Verrückte schließlich und endlich nicht wissen, was sie tun, und daß man, statt Valeriano zu bestrafen, die Witzbolde ergreifen sollte, die das Paar angestachelt hatten, befahl er Johnny Abbes in einem Morgengrauen, das so dunkel war wie diese frühe Stunde: »Verrückte sind verrückt. Laß sie laufen.« Der Chef des militärischen Geheimdienstes verzog das Gesicht: »Zu spät, Exzellenz. Wir haben sie noch gestern den Haien vorgeworfen. Lebendig, wie Sie befohlen haben.«
Er stand auf, jetzt mit den Schuhen an den Füßen. Ein Staatsmann bereut seine Entscheidungen nicht. Er hatte nie irgend etwas bereut. Dieses Paar Bischöfe würde er lebendig den Haien vorwerfen. Nun begann die eigentlich genußvolle Phase der allmorgendlichen Körperpflege, bei der er immer an einen Roman denken mußte, den er als junger Mann gelesen hatte und der ihm als einziger stets gegenwärtig war: Quo vadis? Eine Geschichte mit Römern und Christen, von der ihm das Bild des raffinierten, steinreichen Petronius im Gedächtnis geblieben war, des Schiedsrichters der Eleganz, der jeden Morgen dank der Massagen und Waschungen, Salböle, Essenzen, Parfüme und Liebkosungen seiner Sklavinnen zu neuem Leben erwachte. Wenn er Zeit hätte, wäre er dem Beispiel des Schiedsrichters gefolgt und hätte nach den Übungen, um die Muskeln zu wärmen und das Herz auf Trab zu bringen, den ganzen Morgen in den Händen von Masseusen, Pediküren, Maniküren, Friseuren, Bademeistern verbracht. Er ließ sich mittags, nach dem Essen, kurz massieren und mit mehr Muße an den Sonntagen, wenn er den fordernden Pflichten zwei oder drei Stunden stehlen konnte. Aber die Zeiten waren nicht danach, um sich mit Hilfe der sinnlichen Exerzitien des großen Petronius zu entspannen. Er mußte sich mit diesen zehn Minuten begnügen, in denen er das parfümierte Deodorant Yardley auftrug, das Manuel Alfonso ihm aus New York schickte – der arme Manuel, wie mochte es ihm gehen, nach der Operation –, die sanfte französische Feuchtigkeitscreme für das Gesicht, Bienfait du Matin, und das Kölnischwasser mit einem leichten Duft nach Maisfeldern, ebenfalls von Yardley, mit dem er sich die Brust abrieb. Als er gekämmt war und noch einmal über die Spitzen des kleinen Kinnbarts gestrichen hatte, den er seit zwanzig Jahren trug, bestäubte er sein Gesicht mit reichlich Talkum, bis die braune Farbe seiner mütterlichen Vorfahren, der haitianischen Neger, die er bei anderen und bei sich selbst immer verachtet hatte, unter einer zarten weißlichen Wolke verschwand.
Um sechs Minuten vor fünf war er angekleidet, mit Jackett und Krawatte. Er stellte es zufrieden fest; nie überschritt er die Zeit. Es gehörte zu seinen abergläubischen Überzeugungen: wenn er nicht Punkt fünf Uhr sein Büro betrat, würde etwas Ungutes an dem Tag geschehen.
Er tat ein paar Schritte zum Fenster. Es war noch immer dunkel, als wäre es Mitternacht. Aber er sah weniger Sterne als eine Stunde zuvor. Sie wirkten verzagt. Es war kurz davor, Tag zu werden, sie würden bald verlöschen. Er nahm einen Stock und ging zur Tür. Kaum hatte er sie geöffnet, hörte er die Absätze der beiden Militäradjutanten:
»Guten Morgen, Exzellenz.«
»Guten Morgen, Exzellenz.«
Er antwortete ihnen mit einem Neigen des Kopfes. Mit einem raschen Blick sah er, daß sie korrekt uniformiert waren. Er gestattete keine Nachlässigkeit, keine Unordnung, weder bei einem Offizier noch bei einem gemeinen Soldaten der Streitkräfte, aber bei den Adjutanten, dem Korps, dem seine Bewachung oblag, stellten ein fehlender Knopf, ein Fleck oder eine Falte an der Hose oder an der Uniformjacke, ein schlecht sitzendes Käppi schwerwiegende Verstöße dar, die mit mehreren Tagen Haft und bisweilen mit Ausschluß und Rücckehr zu den regulären Bataillonen geahndet wurden.
Eine leichte Brise bewegte die Bäume vor der Villa Radhamés, während er an ihnen vorbeiging und das Rauschen der Blätter vernahm und abermals das Wiehern eines Pferdes im Stall. Johnny Abbes, Rapport über den Verlauf der Kampagne, Besuch des Luftstützpunkts San Isidro, Rapport von Chirinos, Mittagessen mit dem marine, drei oder vier Audienzen, Beratung mit dem Innen- und Kultusminister, Beratung mit Balaguer, Beratung mit Cucho Álvarez Pina, dem Präsidenten der Dominikanischen Partei, und Spaziergang auf der Uferpromenade nach einem kurzen Besuch bei Mama Julia. Würde er zum Schlafen nach San Cristóbal fahren, um den schlechten Nachgeschmack jener Nacht loszuwerden?
Er betrat sein Büro im Regierungspalast, als seine Uhr fünf zeigte. Auf seinem Arbeitstisch erwartete ihn das Frühstück – Fruchtsaft, Toast mit Butter, frisch aufgebrühter Kaffee –, mit zwei Tassen. Und, sich erhebend, die weichliche Gestalt des Chefs des Geheimdienstes, Oberst Johnny Abbes García:
»Guten Morgen, Exzellenz.«
III
»Er kommt nicht«, rief Salvador plötzlich aus. »Noch ein verlorener Abend, ihr werdet schon sehen.«
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!