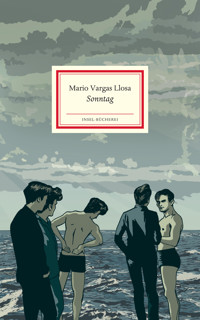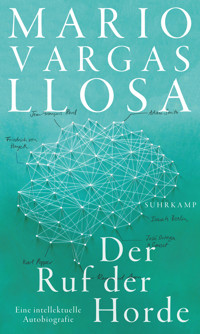
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Gegen den »Ruf der Horde« (Karl Popper), gegen den weltweit grassierenden, primitiven Populismus vergegenwärtigt Mario Vargas Llosa die Traditionen des Liberalismus, die ihn geprägt, bereichert und ein ganzes Leben lang geleitet haben – als politischen Schriftsteller wie als schreibenden Politiker.
Mit essayistischer Verve und analytischem Scharfsinn schreibt Mario Vargas Llosa über seine Heroen des historischen Liberalismus, über Adam Smith, José Ortega y Gasset, Friedrich Hayek, Karl Popper, Raymond Aron, Isaiah Berlin und Jean-François Revel. Sie haben ihn mit einer ganz anderen Denkungsart vertraut gemacht, mit einer Denkungsart, die das Individuum stets höher stellte als die »Horde«, die Nation, die Klasse oder die Partei und die die freie Meinungsäußerung immer schon als fundamentalen Wert für das Gedeihen von Demokratie zu verteidigen wusste.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 398
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Mario Vargas Llosa
Der Ruf der Horde
Eine intellektuelle Autobiografie
Aus dem Spanischen von Thomas Brovot
Suhrkamp
Für Gerardo Bongiovanni, den Förderer der liberalen Ideen und treuen Freund.
Inhalt
Der Ruf der Horde
Adam Smith . 1723-1790
Theorie der ethischen Gefühle (1759)
Die Arbeit an Der Wohlstand der Nationen
Der Wohlstand der Nationen
Adam Smiths letzte Jahre
José Ortega y Gasset . 1883-1955
Unabhängigkeitsstreben und Niedergang
Die Entmenschlichung der Kunst
Der Aufstand der Massen
Ortega y Gasset und die Republik
Die Höflichkeit des Philosophen
Ortega und der Bürgerkrieg
Friedrich August von Hayek . 1899-1992
Hayek und Keynes
Die verhängnisvolle Anmaßung
Der Weg zur Knechtschaft
Die Verfassung der Freiheit
»Warum ich kein Konservativer bin«
Karl Popper . 1902-1994
Ein Leben im Jahrhundert
Die offene Gesellschaft und ihre Feinde
Popper und Wittgenstein
Die verdächtige Wahrheit
Die geschlossene Gesellschaft und die Welt 3
Historizismus und Fiktion
Reformismus oder die Technik der kleinen Schritte
Die Tyrannei der Sprache
Die Stimme Gottes
Raymond Aron . 1905-1983
Das Opium der Intellektuellen
Die unauffindbare Revolution
Raymond Aron und Jean-Paul Sartre
Isaiah Berlin . 1909-1997
Der diskrete Philosoph
Der Mann, der zu viel wusste
Die widersprüchlichen Wahrheiten
Die Erfahrung in Washington
Die Nacht mit der Achmatowa
Die zwei Freiheiten
Im goldenen Käfig
Der Igel und der Fuchs
Helden unserer Zeit
Der Magus aus dem Norden
Weise, diskret und liberal
Jean-François Revel . 1924-2006
Wozu Philosophen?
Sozialist und Liberaler
Die totalitäre Versuchung
Kein Jesus und kein Marx
So enden die Demokratien
Die Herrschaft der Lüge
Terrorismus und Demokratie
Der Dieb im leeren Haus
Danksagung
Der Ruf der Horde
Nie wäre es mir in den Sinn gekommen, ein Buch wie das vorliegende zu schreiben, hätte ich nicht vor mehr als zwanzig Jahren Edmund Wilsons Auf dem Weg zum Finnischen Bahnhof gelesen. Dieses faszinierende Werk erzählt die Geschichte der Entstehung der sozialistischen Ideen von dem Moment an, als der französische Historiker Jules Michelet in einer Fußnote auf Giambattista Vico stieß und, neugierig geworden, Italienisch zu lernen begann, bis zu Lenins Ankunft am Finnischen Bahnhof in Sankt Petersburg am 16. April 1917, wo er sich an die Spitze der Russischen Revolution stellte. Die Lektüre brachte mich auf die Idee zu einem Buch, das für den Liberalismus sein sollte, was der amerikanische Literaturkritiker für den Sozialismus vorgelegt hatte; zu einem Buch, das, beginnend mit der Geburt von Adam Smith 1723 im schottischen Hafenstädtchen Kirkcaldy, die Entwicklung der liberalen Ideen nachzeichnet und ihre bedeutendsten Vertreter porträtiert, jeweils im Rahmen der historischen und gesellschaftlichen Ereignisse, die zur Verbreitung ihrer Ideen in der Welt führten. An mein Vorbild reiche ich bei weitem nicht heran, aber das ist der Ursprung von Der Ruf der Horde.
Es mag zunächst nicht so aussehen, aber es ist ein autobiografisches Buch. Es beschreibt meinen eigenen intellektuellen und politischen Werdegang, die Wegstrecke, die mich von meiner Jugend, geprägt vom Marxismus und von Sartres Existenzialismus, zum Liberalismus meiner späteren Jahre führte, wozu auch eine Neubewertung der Demokratie gehörte; die Lektüre von Schriftstellern wie Albert Camus, George Orwell und Arthur Koestler war mir dabei hilfreich. Auch über manche politischen Erfahrungen habe ich mich auf den Liberalismus zubewegt, vor allem aber waren es die Ideen der sieben Denker, um die es hier gehen soll: Adam Smith, José Ortega y Gasset, Friedrich von Hayek, Karl Popper, Isaiah Berlin, Raymond Aron und Jean-François Revel.
Die Politik entdeckte ich als Zwölfjähriger, im Oktober 1948, als in Peru General Manuel Apolinario Odría mit einem Militärputsch den Präsidenten José Luis Bustamante y Rivero stürzte, einen Verwandten meiner Familie mütterlicherseits. Während der acht Jahre unter Odría muss in mir der Hass auf Diktatoren jeder Couleur gewachsen sein, eine der wenigen ehernen Konstanten in meiner politischen Haltung. Die eigentliche gesellschaftliche Problematik jedoch – dass Peru nämlich ein Land voller Ungerechtigkeiten war, in dem eine privilegierte Minderheit die übergroße Mehrheit nach Belieben ausbeutete – kam mir erst 1952 zu Bewusstsein, als ich in meinem letzten Schuljahr die spanische Ausgabe von Jan Valtins Tagebuch der Hölle las. Deshalb wollte ich auch nicht auf die Universidad Católica gehen, wie es meine Familie gerne gesehen hätte – im damaligen Peru war sie die Hochschule für Kinder aus besserem Hause –, und ich bewarb mich an der San Marcos, einer öffentlichen, volksnahen und der Militärdiktatur fernstehenden Universität, wo ich, dessen war ich mir sicher, in die Kommunistische Partei eintreten konnte. Als ich 1953 dann mit dem Literatur- und Jurastudium an der San Marcos begann, hatte die Repression unter Odría fast vollständig mit den Kommunisten aufgeräumt, das Führungspersonal wurde eingesperrt, umgebracht oder ins Exil gejagt. Mit der Gruppe Cahuide, in der ich mich ein Jahr lang engagierte, versuchte die Partei sich neu zu formieren.
Dort erhielt ich auch meinen ersten Marxismus-Unterricht, in heimlichen Lesezirkeln, in denen wir José Carlos Mariátegui, Georges Politzer, Marx, Engels, Lenin lasen und heftig über den sozialistischen Realismus diskutierten, über den linken Radikalismus auch, die »Kinderkrankheit im Kommunismus«. Meine große Bewunderung für Sartre, den ich andächtig las, schützte mich vor allzu Dogmatischem – wir peruanischen Kommunisten dieser Jahre waren, wie Salvador Garmendia es nannte, »wenige, aber ausgesprochen sektiererisch« –, und so verfocht ich in meiner Zelle die These, wonach ich an den historischen Materialismus und den Klassenkampf glaubte, nicht aber an den dialektischen Materialismus. Anlass für meinen Genossen Félix Arias Schreiber, mich bei einer dieser Diskussionen als »Untermenschen« zu bezeichnen.
Ende 1954 verließ ich die Gruppe Cahuide, blieb aber, denke ich, weiter Sozialist, zumindest was meine Lektüren betraf, und mit dem Kampf Fidel Castros und seiner »Bärtigen« in der Sierra Maestra und dem Sieg der Kubanischen Revolution in den letzten Tagen des Jahres 1958 erhielt diese Einstellung neuen Schwung. Auf meine Generation – nicht nur in Lateinamerika – hatten die Ereignisse in Kuba entscheidenden Einfluss, es war eine ideologische Zäsur. Viele Menschen sahen, so wie ich, in dem castristischen Unternehmen nicht allein ein heroisches und edelmütiges Abenteuer idealistischer Kämpfer, die mit der korrupten Diktatur Batistas Schluss machen wollten, sondern auch eine Form des Sozialismus, in dem Kritik und Vielfalt erlaubt wären und selbst Andersdenkende ihren Platz hätten. Viele von uns glaubten das, weshalb die Kubanische Revolution in den ersten Jahren auch weltweit eine solche Unterstützung fand.
Als 1962 die Kubakrise ausbrach, war ich als Reporter für den französischen Sender RTF in Mexiko, um über eine von Frankreich organisierte Ausstellung im Chapultepec-Park zu berichten. Also schickte man mich nach Havanna, ich saß im letzten Flugzeug der Cubana, das vor der Blockade noch von Mexiko aus fliegen konnte. In Kuba befürchtete man eine Landung der Marines, und Castro hatte die allgemeine Mobilmachung ausgerufen. Es war ein beeindruckendes Schauspiel. Am Malecón wurden die kleinen, bocachicas genannten Flugabwehrkanonen bedient von Jugendlichen, fast noch Kinder, die, ohne einen Schuss abzugeben, unter den Tiefflügen der amerikanischen F-86 ausharrten; Radio und Fernsehen gaben Anweisungen, was die Bevölkerung zu tun hatte, sollte es mit den Bombardierungen losgehen. Das alles erinnerte mich an die aufgeladene, begeisterte Atmosphäre eines freien und hoffnungsvollen Volkes, wie Orwell es in Mein Katalonien beschrieb; zu Beginn des Spanischen Bürgerkriegs hatte er sich in Barcelona als Freiwilliger dem Kampf gegen die Putschisten angeschlossen. Ich war zutiefst ergriffen, das alles schien mir dem Ideal eines freiheitlichen Sozialismus zu entsprechen, und ich stellte mich in eine lange Schlange, um Blut zu spenden. Dank dem Kubaner Ambrosio Fornet, in Madrid mein Kommilitone, und der Peruanerin Hilda Gadea, die in Guatemala, als Jacobo Árbenz noch Präsident war, Che Guevara kennengelernt hatte – den sie dann in Mexiko heiratete, wo sie mit ihm eine Tochter bekam –, lernte ich zahlreiche kubanische Schriftsteller kennen, die mit der Casa de las Américas in Verbindung standen, auch mit der Leiterin Haydée Santamaría hatte ich eine kurze Begegnung. Als ich ein paar Wochen später wieder abreiste, sangen die jungen Leute auf den Straßen von Havanna »Nikita, mariquita, lo que se da no se quita« – »Nikita, du Schwuchtel, geschenkt ist geschenkt, wiederholen ist gestohlen« –, weil Chruschtschow, der sowjetische Parteichef, sich Kennedys Ultimatum gebeugt und die Raketen von der Insel abgezogen hatte. Erst später sollte bekannt werden, dass John F. Kennedy in Geheimverhandlungen offenbar Chruschtschow versprochen hatte, im Gegenzug auf einen Einmarsch in Kuba zu verzichten und die in der Türkei stationierten Jupiter-Raketen abzuziehen.
Meine Identifizierung mit der Kubanischen Revolution reichte bis weit in die Sechzigerjahre, eine Zeit, in der ich als Mitglied eines internationalen Redaktionsbeirats der Casa de las Américas fünfmal nach Kuba flog und die Revolution sowohl in Frankreich, wo ich lebte, als auch in Lateinamerika, wohin ich oft reiste, mit Manifesten, Artikeln und bei öffentlichen Auftritten verteidigte. In diesen Jahren nahm ich meine marxistischen Lektüren wieder auf, und ich las nicht nur die Klassiker, sondern auch Autoren, die sich mit der Kommunistischen Partei identifizierten oder ihr nahestanden, wie Georg Lukács, Antonio Gramsci, Lucien Goldmann, Frantz Fanon, Régis Debray oder Che Guevara, selbst den ideologischen Hardliner Louis Althusser, Professor an der École normale supérieure, der später verrückt werden sollte und seine Frau erdrosselte. Allerdings kaufte ich mir in meinen Pariser Jahren, daran erinnere ich mich noch gut, auch Woche für Woche heimlich die von der Linken meistgehasste Zeitung, den Figaro, um den Artikel von Raymond Aron zu lesen, dessen schneidende Analysen des Zeitgeschehens mich so verstörten wie faszinierten.
Ende der Sechzigerjahre brachten mich verschiedene Erfahrungen vom Marxismus ab. Dazu gehörte die Einrichtung der UMAP in Kuba, ein Euphemismus, denn hinter der Fassade der Militärischen Einheiten zur Unterstützung der Produktion verbarg sich nichts anderes als Konzentrationslager, in die man gleichermaßen Konterrevolutionäre, Homosexuelle und gewöhnliche Kriminelle sperrte. Auch meine Reise in die UdSSR1968 als Gast einer Puschkin-Veranstaltung hinterließ einen bitteren Beigeschmack. Dort wurde mir klar, dass ich als Russe in diesem Land ein Dissident gewesen wäre, ein Paria also, oder ich wäre im Gulag elend verreckt. Für mich war es eine traumatische Erfahrung. Denn Sartre, Simone de Beauvoir, Merleau-Ponty und Les Temps Modernes hatten mich davon überzeugt, dass die UdSSR bei allem, was dort schieflief, für den Fortschritt und die Zukunft stand, es war das Land, in dem es, wie Paul Éluard in einem Gedicht schrieb, das ich auswendig kannte, weder Nutten noch Diebe oder Pfaffen gab. Nur war die Armut nicht zu übersehen, die vielen Betrunkenen auf den Straßen, die Apathie allenthalben. Wo immer ich hinkam, war die kollektive Klaustrophobie mit Händen zu greifen, eben weil es keine Informationen gab über das, was im Land selbst und im Rest der Welt geschah. Beim Geld im Portemonnaie mochten die Klassenunterschiede verschwunden sein, aber man musste sich nur umschauen, und es war klar, wie groß die Ungleichheiten in der UdSSR waren, alles war eine Frage der Macht. Einmal fragte ich einen überraschend gesprächigen Russen: »Wer hat hier die meisten Privilegien?«, und er antwortete: »Die unterwürfigen Schriftsteller. Sie haben eine Datscha, da verbringen sie die Ferien, und sie können ins Ausland reisen, das stellt sie weit über das gemeine Volk. Was will man mehr!« Konnte ich ein solches Gesellschaftsmodell weiter verteidigen, wo ich nun wusste, dass ich selbst niemals so hätte leben können? Nicht weniger enttäuscht war ich von Sartre, dem Vordenker, als ich eines Tages in Le Monde ein Interview las, das Madeleine Chapsal mit ihm geführt hatte. Darin erklärte er, er verstehe gut, dass die afrikanischen Schriftsteller das Schreiben aufgäben, um zuerst die Revolution zu machen und ein Land aufzubauen, in dem Literatur möglich sei. So wie er auch sagte, angesichts eines verhungernden Kindes vermöge sein Roman Der Ekel nichts auszurichten (»La Nausée ne fait pas le poids«). Für mich war das ein Dolchstoß in den Rücken. Wie konnte er so etwas behaupten? Hatte er uns nicht eingeredet, Schreiben sei eine Form der Aktion, schreibend würde man Einfluss nehmen auf die Historie? Und auf einmal war die Literatur ein Luxus, den sich nur die Länder erlauben konnten, die den Sozialismus erreicht hatten. Damals las ich noch einmal Camus und musste ihm recht geben. Ich begriff, dass in der polemischen Auseinandersetzung mit Sartre zu den Konzentrationslagern in der UdSSR er, Camus, das Richtige gesagt hatte. Denn wo die Moral sich aus der Politik verabschiedet, beginnt das Morden und der Terror, diese Erkenntnis hätte wahrer nicht sein können. Die ganze Entwicklung findet sich widergespiegelt in einem kleinen Sammelband mit meinen Artikeln aus den Siebzigerjahren über die beiden Denker, erschienen 1981 in Puerto Rico (Entre Sartre y Camus).
Mein Bruch mit Kuba, in gewisser Weise auch mit dem Sozialismus, war die Folge des seinerzeit weithin beachteten (und heute kaum noch von jemandem erinnerten) Falls Padilla. Heberto Padilla, Dichter und Aktivist der Kubanischen Revolution – er brachte es bis zum Gesandten des Handelsministeriums –, kritisierte 1970 hier und da die Kulturpolitik des Regimes. Zunächst wurde er von der offiziellen Presse massiv attackiert, dann eingesperrt, die aberwitzige Anschuldigung lautete, er sei ein Agent des CIA. Empört verfassten wir, fünf Freunde, die ihn kannten – Juan und Luis Goytisolo, Hans Magnus Enzensberger, José María Castellet und ich –, in meiner Wohnung in Barcelona ein Schreiben, um gegen diese Ungeheuerlichkeit zu protestieren. Viele Schriftsteller in der ganzen Welt schlossen sich an, darunter Sartre, Simone de Beauvoir, Susan Sontag, Alberto Moravia und Carlos Fuentes. Fidel Castro antwortete persönlich. Er beschuldigte uns, dem Imperialismus zu dienen, und stellte klar, dass wir nie wieder Kuba betreten würden, »auf unbestimmte und unbegrenzte Zeit« (für alle Ewigkeit also).
Trotz der beleidigenden Kampagne, der ich mich mit meinem Protest ausgesetzt sah, fiel eine große Last von mir ab: Ich musste gegenüber dem, was in Kuba passierte, keine Zustimmung mehr heucheln. Doch brauchte ich noch ein paar Jahre, um mit dem Sozialismus ganz zu brechen und die Demokratie wirklich wertzuschätzen. Es war eine Zeit der Ungewissheit und der kritischen Überprüfung, in der ich nach und nach begriff, dass die »formalen Freiheiten« der sogenannten bürgerlichen Demokratie keine bloße Fassade waren, hinter der die Ausbeutung der Armen durch die Reichen fröhlich weiterging. Sie markierten vielmehr die Grenze zwischen dem, was Menschenrechte, Meinungsfreiheit, politische Vielfalt garantierte, und einem autoritären und repressiven System; einem System, das im Namen der einzigen, von der Kommunistischen Partei und ihren Hierarchen repräsentierten Wahrheit jede Form von Kritik zum Schweigen bringen konnte, dogmatische Parolen durchsetzte und Dissidenten in Lager sperrte, gar verschwinden ließ. Mit all ihren Unvollkommenheiten, und das waren viele, vermochte die Demokratie zumindest qua Gesetz die Willkür einzuhegen, sie erlaubte freie Wahlen und von der Macht unabhängige Parteien und Gewerkschaften.
Meine Entscheidung für den Liberalismus war ein jahrelanger, vor allem intellektueller Prozess. Geholfen hat mir dabei, dass ich seit Ende der Sechzigerjahre in London wohnte, wo ich an der Universität lehrte und auch die elf Regierungsjahre von Margaret Thatcher unmittelbar miterlebte. Sie gehörte der Konservativen Partei an, die Überzeugungen aber, die sie leiteten, waren zutiefst liberal, ihr Instinkt war es ohnehin, in beidem war sie Ronald Reagan recht ähnlich. Das England, in dem sie 1979 zur Premierministerin aufstieg, war ein Land im Niedergang, die Reformen der Labour Party (wie auch die der Tories) hatten ihm zunehmend die Luft abgeschnürt. Etatismus und Kollektivismus fraßen sich in den Alltag, auch wenn man die bürgerlichen Freiheiten wie Wahlen und das Recht auf freie Meinungsäußerung respektierte. Doch an allen Ecken und Enden wucherte der Staat, Industrien waren verstaatlicht worden, und auch die Wohnungspolitik bewirkte lediglich, dass die Bürger immer abhängiger wurden vom Wohlwollen des Staates. Diese Spielart des demokratischen Sozialismus hatte das Land der industriellen Revolution aller Kraft beraubt, und nun dümpelte es im Mittelmaß dahin.
Margaret Thatchers Regierungszeit (1979-1990) kam einer Revolution gleich, einer Revolution im Rahmen absoluter Rechtsstaatlichkeit. Staatsbetriebe wurden privatisiert, und die britischen Unternehmen erhielten keine finanziellen Unterstützungen mehr, womit sie, wenn sie auf einem freien Markt bestehen wollten, gezwungen waren, sich zu modernisieren. Auch die Sozialwohnungen, die die Regierungen bisher Menschen mit geringem Einkommen zur Verfügung stellten – um ihre Wählerschaft bei Laune zu halten –, wurden an ihre Bewohner verkauft, eine Politik, die Großbritannien zu einem Land der Eigentümer machen sollte. Die Grenzen öffneten sich für die internationale Konkurrenz, und die veralteten Industrien, der Kohlebergbau zum Beispiel, wurden zu Grabe getragen, damit sich das Land erneuern und modernisieren konnte.
All diese Wirtschaftsreformen führten natürlich zu Streiks und trieben die Menschen auf die Straße, der Streik der Bergarbeiter etwa dauerte ein ganzes Jahr. Dabei zeigte Margaret Thatcher einen Mut und eine Überzeugung, wie Großbritannien es seit den Zeiten Winston Churchills nicht erlebt hatte. Zu diesen Reformen, die das Land innerhalb weniger Jahre zum dynamischsten Europas machten, gehörte aber auch die Verteidigung der demokratischen Kultur und die Bekräftigung der moralischen und materiellen Überlegenheit der liberalen Demokratie über den autoritären, korrupten und wirtschaftlich ruinierten Sozialismus, was schließlich auf die ganze Welt ausstrahlte. Hinzu kam, dass Thatchers Politik zusammenfiel mit der Politik, die zur selben Zeit Ronald Reagan in den USA betrieb. Endlich erschienen an der Spitze der westlichen Demokratien Führungsfiguren ohne Minderwertigkeitskomplexe gegenüber dem Kommunismus, und wo immer sie sich zu Wort meldeten, erinnerten sie angesichts von Gewaltherrschaft und dem wirtschaftlichen Scheitern der kommunistischen Länder an die großen Errungenschaften bei den Menschenrechten, der Chancengleichheit, der Achtung des Individuums und seiner Ideen. Während Ronald Reagan, ein außergewöhnlicher Verbreiter der liberalen Theorien, diese wohl nur in groben Zügen kannte, war »Maggie« Thatcher hier präziser, ideologischer auch. Sie hatte keine Bedenken, sich mit Friedrich von Hayek zu beraten, und sie las Karl Popper, der für sie der größte zeitgenössische Denker der Freiheit war. Ich habe sie damals beide gelesen, und seither sind Poppers Die offene Gesellschaft und ihre Feinde und Hayeks Der Weg zur Knechtschaft meine Leib-und-Magen-Lektüre.
In ökonomischen und politischen Fragen waren Ronald Reagan und Margaret Thatcher eindeutig liberal eingestellt, in vielen gesellschaftlichen und moralischen Fragen aber vertraten sie konservative, gar reaktionäre Positionen – niemals hätten sie die gleichgeschlechtliche Ehe, die Abtreibung, die Legalisierung von Drogen oder die Sterbehilfe akzeptiert, für mich legitime Forderungen und Bereiche, die der Reform bedurften –, und in diesen Punkten war ich selbstverständlich anderer Meinung als sie. Aber unterm Strich bin ich fest davon überzeugt, dass beide der Kultur der Freiheit einen großen Dienst erwiesen haben. Mir jedenfalls halfen sie, zu einem Liberalen zu werden.
Dank dem Historiker Hugh Thomas, einem alten Freund, hatte ich das Glück, Frau Thatcher persönlich kennenzulernen. Thomas, Berater der britischen Regierung zu Spanien und Lateinamerika, hatte bei sich zu Hause an der Ladbroke Grove ein Abendessen mit Intellektuellen arrangiert, um die Premierministerin mit den Tigern zu konfrontieren (die Linke war natürlich die erbittertste Feindin von Thatchers Revolution). Man setzte sie neben Isaiah Berlin, dem sie sich den ganzen Abend mit größtem Respekt zuwandte. Am Tisch saßen die Schriftsteller V. S. Naipaul und Anthony Powell, die Dichter Al Alvarez, Stephen Spender und Philip Larkin, der Literaturkritiker und Erzähler V. S. Pritchett, der Dramatiker Tom Stoppard, der Historiker J. H. Plumb aus Cambridge, Anthony Quinton, Kanzler des Trinity College (Oxford), und noch jemand, an den ich mich nicht erinnere. Mich fragte sie, wo ich wohnte, und als ich sagte, am Montpelier Walk, betonte sie, dass ich ein Nachbar von Arthur Koestler sei, ihn hatte sie zweifellos gelesen. Das Tischgespräch war für sie eine harte Prüfung, und weder das Feingefühl noch die britische Höflichkeit der anwesenden Intellektuellen konnte deren Kampfeslust verbergen. Der Hausherr, Hugh Thomas, eröffnete das Feuer und fragte Frau Thatcher, ob die Meinung der Historiker sie interessiere und in Regierungsfragen zu etwas nützlich sei. Sie antwortete auf die Fragen in aller Klarheit, ohne sich je einschüchtern zu lassen und ohne jede Pose, meist mit großer Bestimmtheit, manchmal räumte sie aber auch ein, dass sie sich unsicher sei. Als sie nach dem Essen gegangen war, resümierte Isaiah Berlin sehr schön, was die meisten Gäste wohl genauso sahen: »Es gibt keinen Grund, sich zu schämen.« Sehr wohl aber, dachte ich, einen Grund, stolz zu sein auf eine Regierende von solch einem Charakter, hoch gebildet und mit festen Überzeugungen. In den nächsten Tag sollte Margaret Thatcher nach Berlin reisen und zum ersten Mal die Mauer der Schande besuchen. Sie hielt dort eine ihrer bedeutendsten Reden gegen die autoritären Regime und für die Demokratie.
Auch Ronald Reagan habe ich persönlich kennengelernt, bei einem Abendessen in größerer Gesellschaft im Weißen Haus, zu dem mich Selwa Roosevelt eingeladen hatte, damals die Protokollchefin. Sie stellte mich dem Präsidenten vor, und bei dem sehr kurzen Gespräch konnte ich ihn nur fragen, warum er, wo die USA Schriftsteller wie Faulkner, Hemingway oder Dos Passos hätten, als seinen Lieblingsautor immer Louis L’Amour nannte. »Na ja«, sagte er, »er hat sehr schön beschrieben, was so typisch für uns ist, das Leben der Cowboys im Wilden Westen.« In dem Punkt konnte ich ihm weniger folgen.
Beide, Thatcher und Reagan, waren große Politiker, die bedeutendsten ihrer Zeit, und beide trugen auf entscheidende Weise zum Zusammenbruch und Verschwinden der UdSSR bei, dem größten Feind, den die demokratische Kultur je gekannt hat. Dabei hatten sie nichts Charismatisches à la Hitler, Mussolini, Perón oder Fidel Castro, Führerfiguren, die in ihren Reden vor allem an das »Stammesdenken« appellieren. So nennt Karl Popper den Irrationalismus des primitiven Menschen, der in den tiefsten Tiefen aller zivilisierten Menschen nistet. Denn die Sehnsucht nach dieser traditionellen Welt – der Stammesgesellschaft – haben wir nie ganz überwunden, jener Welt, als der Mensch noch untrennbarer Teil der Gemeinschaft war, dem allmächtigen Hexer oder Häuptling untergeben, der für ihn alle Entscheidungen traf, einer Gemeinschaft, in der er sich sicher fühlen konnte und befreit war von Verantwortlichkeiten, aufgegangen in der Gruppe wie das Tier in der Herde oder der Mensch in der Clique, dem Haufen Fans, gewiegt inmitten derer, die dieselbe Sprache sprachen, dieselben Götter verehrten und dieselben Bräuche praktizierten, dabei den Anderen hassend, weil er nicht so war wie man selbst und man ihn verantwortlich machen konnte für alle Katastrophen, die über die Gemeinschaft kommen mochten. Der »Stammesgeist«, Quell des Nationalismus, hat neben dem religiösen Fanatismus die schlimmsten Gräuel in der Geschichte der Menschheit hervorgebracht. In zivilisierten Ländern wie Großbritannien war der Ruf der Stammesgesellschaft, der Horde, vor allem in den großen Spektakeln zu vernehmen, den Fußballspielen oder den Open-Air-Konzerten, wie sie in den Siebzigerjahren die Beatles und die Rolling Stones gaben und bei denen das Individuum von der Masse verschluckt wurde, es war eine vorübergehende Flucht aus der Fron des Alltags, so gesund wie kathartisch. In manchen Ländern, und das nicht nur in der Dritten Welt, war dieser »Ruf«, von der uns die demokratische und liberale Kultur – letztlich die Vernunft – befreit hatte, immer wieder von neuem ertönt, und dahinter standen ebenjene unsäglichen charismatischen Führer, die es immer wieder schaffen, dass die Bürger zur belehnten Masse eines Diktators werden. Genau das ist der Boden, auf dem der Nationalismus gedeiht, und schon in jungen Jahren habe ich ihn verabscheut. Und weil ich ahnte, dass er einhergeht mit der Negierung der Kultur, der Demokratie und jeder Rationalität, war ich in meinen Jugendjahren auch ein Linker und ein Kommunist. In den Jahren aber, von denen ich hier spreche, stand nichts so sehr für eine Rückkehr zur »Stammesgesellschaft« wie der Kommunismus, denn er negierte den Menschen als souveränes und verantwortliches Individuum und verwies ihn auf seine Rolle als Teil einer Masse, noch dazu unter dem Diktat eines Führers, eines religiösen Gurus mit heiligem Wort gewissermaßen, unwiderleglich wie ein Axiom, was den schlimmsten Formen von Demagogie und Chauvinismus neuen Auftrieb gab.
In diesen Jahren las ich wieder und wieder die Denker, um die es hier gehen soll. Viele andere natürlich auch, sie hätten genauso dabei sein können, Ludwig von Mises etwa oder Milton Friedman, der Argentinier Juan Bautista Alberdi und der Venezolaner Carlos Rangel, Letztere außergewöhnliche Beispiele für einen echten Liberalismus auf dem lateinamerikanischen Kontinent. Auch reiste ich damals nach Edinburgh, um am Grab von Adam Smith Blumen abzulegen, und nach Kirkcaldy, weil ich das Haus besuchen wollte, in dem er Der Wohlstand der Nationen geschrieben hatte und wo, wie ich feststellte, nichts geblieben war als eine Gedenktafel an einer schäbigen Wand.
Es waren die Jahre, in denen sich meine politischen Überzeugungen herausbildeten. Überzeugungen, die ich seither in Büchern und Artikeln verteidige und die 1987 dazu führten, dass ich in Peru gegen die Verstaatlichung des Bankenwesens protestierte, die Präsident Alan García in seiner ersten Regierungszeit (1985-1990) durchzusetzen versuchte; dass ich die Freiheitsbewegung Movimiento Libertad mitbegründete und mich 1990 für das Bündnis Frente Democrático (Demokratische Front) mit einem Programm um das Präsidentenamt bewarb, das sich vornahm, die peruanische Gesellschaft radikal zu reformieren und in eine liberale Demokratie zu überführen. Nebenbei gesagt: Meine Freunde und ich wurden zwar an den Urnen besiegt, doch viele der Ideen, für die wir in dieser fast drei Jahre andauernden Kampagne gekämpft hatten und von denen hier die Rede sein soll, sind keineswegs untergegangen. Sie haben sich ihren Weg gebahnt und sind heute in Peru Teil der politischen Agenda.
Konservatismus und Liberalismus sind zweierlei Dinge, wie Hayek in einer berühmten Schrift klarstellte. Was nicht heißen soll, dass es zwischen Liberalen und Konservativen keine Übereinstimmungen oder gemeinsamen Werte gäbe, nicht anders als zwischen Sozialdemokraten und Liberalen. Man erinnere sich nur an die große wirtschaftliche und gesellschaftliche Transformation Neuseelands in den Jahren 1984 bis 1993, begonnen von einer Labour-Regierung mit ihrem Finanzminister Roger Douglas und erfolgreich weitergeführt von Ruth Richardson, Finanzministerin in einem konservativen Kabinett. Deshalb ist unter Liberalismus auch nicht eine weitere Ideologie zu verstehen, einer dieser weltlichen Glaubensakte, die für Irrationales und dogmatische Wahrheiten ebenso anfällig sind wie die Religionen, sämtliche Religionen, die primitiven magisch-religiösen und auch die modernen. Unter Liberalen gibt es oft mehr Meinungsverschiedenheiten als Übereinstimmungen, ein anschauliches Beispiel dafür sind die in diesem Buch Porträtierten. Der Liberalismus ist eine Position, die keine Antworten auf alles hat, wie es der Marxismus für sich in Anspruch nimmt, er lässt Abweichung und Kritik zu, Grundlage ist ein kleines, aber unverkennbares Bündel an Überzeugungen. Etwa dass die Freiheit der höchste Wert ist und dass sie weder teilbar ist noch in Teilen zu haben; dass sie eine einzige ist und in einer wahrhaft demokratischen Gesellschaft in allen Bereichen zum Ausdruck kommt, dem wirtschaftlichen, politischen, sozialen, kulturellen. Weil sie genau das nicht verstanden haben, sind alle Regime gescheitert, die in den Sechziger- und Siebzigerjahren allein auf die wirtschaftliche Freiheit setzten, es waren despotische Regime, meist Militärdiktaturen. In ihrer Ignoranz glaubten sie, Marktpolitik könne unter einer repressiven, diktatorischen Regierung erfolgreich sein. Andererseits sind in Lateinamerika aber auch viele demokratische Versuche gescheitert, die die politischen Freiheiten achteten und an die ökonomische Freiheit – den freien Markt – nicht glaubten. Der aber bringt nun mal materielle Entwicklung und Fortschritt.
Liberale sind undogmatisch. Sie wissen, dass die Wirklichkeit komplex ist und dass politische Ideen und Programme sich, sollen sie Erfolg haben, anpassen müssen; dass man die Wirklichkeit nicht starren Konzepten unterordnen darf, sie wären sonst zum Scheitern verurteilt, politische Gewalt wäre die Folge. Natürlich wohnt auch dem Liberalismus eine »Kinderkrankheit« inne, es ist das Eifernde mancher Ökonomen, die wie verzaubert sind vom freien Markt als Allheilmittel für die Lösung sämtlicher gesellschaftlichen Probleme. Gerade ihnen sollte man das Beispiel von Adam Smith ins Gedächtnis rufen, diesem Klassiker des Liberalismus, der sich dafür aussprach, unter bestimmten Umständen Privilegien aufrechtzuerhalten, Unterstützungen und Kontrollen etwa, wenn ihre Abschaffung unmittelbar mehr Nachteile als Vorteile brächte. Diese Toleranz, die Smith gegenüber seinen Gegnern an den Tag legte, ist der vielleicht bewunderungswürdigste Zug der liberalen Lehre: anzuerkennen, dass man womöglich im Irrtum ist und andere recht haben. Eine liberale Regierung muss sich gegenüber der gesellschaftlichen und historischen Wirklichkeit flexibel zeigen und darf nicht glauben, alle Gesellschaften ließen sich in ein einziges theoretisches Schema pressen, es wäre nur kontraproduktiv, Misserfolg und Enttäuschung folgten auf dem Fuße.
Liberale sind keine Anarchisten. Wir wollen den Staat nicht abschaffen, im Gegenteil, wir wollen einen starken und effizienten Staat, was nicht gleichbedeutend ist mit einem sich breitmachenden Staat, der meint, Dinge tun zu müssen, die die Zivilgesellschaft in einem System des freien Wettbewerbs besser kann. Der Staat soll die Freiheit garantieren, öffentliche Ordnung, die Einhaltung des Gesetzes, Chancengleichheit.
Gleichheit vor dem Gesetz und Chancengleichheit bedeuten nicht Einkommensgleichheit, keinem Liberalen käme das je in den Sinn. Es ließe sich auch nur durchsetzen mit einer autoritären Regierung, in einem oppressiven System, das alle Bürger ökonomisch »gleichmacht«. Und schon wäre Schluss mit den verschiedenen individuellen Fähigkeiten, mit Fantasie und Kreativität, mit Konzentration, Sorgfalt, Ehrgeiz, mit Arbeitsmoral und Führungsqualität. Es käme dem Verschwinden des Individuums gleich, seinem Aufgehen in der Stammesgesellschaft.
Nimmt man ein bestimmtes, vergleichbares Level als Ausgangspunkt, ist nichts gerechter, als dass sich die Einkünfte je nach den Beiträgen des Einzelnen zum Nutzen des gesellschaftlichen Ganzen unterscheiden. Es wäre töricht zu ignorieren, dass es unter den Menschen nun mal intelligentere und dümmere gibt, fleißigere und faulere, eifrigere und trägere, solche, die erfinderisch sind oder bloß routiniert et cetera. Und schlicht ungerecht wäre es, wenn im Namen der »Gleichheit« alle denselben Lohn erhielten, ungeachtet ihrer unterschiedlichen Qualifikationen und Verdienste. Alle Gesellschaften, die das versucht haben, haben die individuelle Initiative und die Kreativität erstickt und den einzelnen Menschen in einer grauen Masse verschwinden lassen.
Natürlich steht außer Frage, dass in so ungleichen Gesellschaften wie in den Ländern der Dritten Welt die Kinder wohlhabender Familien unendlich größere Chancen auf Erfolg im Leben haben als die Kinder armer Familien. Gerade die »Chancengleichheit« aber ist ein zutiefst liberales Prinzip, auch wenn manche Cliquen dogmatischer, intoleranter und oftmals rassistischer Ökonomen, die die Bezeichnung liberal missbrauchen – in Peru gibt es sie zuhauf, sämtlich aus dem Dunstkreis Fujimoris –, nichts davon wissen möchten.
Daher liegt Liberalen auch so viel an einem erstklassigen Bildungssystem, das alle jungen Menschen erreicht und sicherstellt, dass jede Generation einen gemeinsamen Ausgangspunkt hat, der spätere Einkommensunterschiede legitimiert: je nach Talent und Anstrengung, je nach dem Dienst, den der Einzelne der Gemeinschaft erweist. Gerade im Bildungsbereich – Schule, Berufsausbildung, Studium – schaffen Privilegien die größte Ungerechtigkeit. Denn während die einen durch eine gute Ausbildung begünstigt werden, sind andere zu einer rudimentären, oberflächlichen verdammt, einer Ausbildung, die so eben zum Überleben reicht, ihnen aber kaum eine Zukunft ermöglicht. Utopisch ist ein solches System keineswegs. Frankreich etwa hat es in der Vergangenheit mit einem öffentlichen und kostenlosen, der ganzen Gesellschaft zugänglichen Erziehungswesen geschafft, das in der Regel auch noch ein höheres Niveau aufwies als die Privatschulen. Erst die Bildungskrise dort hat zu einem Rückschritt geführt, nicht aber in Skandinavien, in der Schweiz oder in asiatischen Demokratien wie in Japan oder Singapur, wo man eine solche Chancengleichheit erreicht hat, ohne dass es sich negativ auf die gelebte Demokratie oder den ökonomischen Wohlstand ausgewirkt hätte, ganz im Gegenteil.
Chancengleichheit in der Bildung heißt nicht, dass Privatschulen zugunsten der öffentlichen abgeschafft werden sollten. Für den Fortschritt ist es unerlässlich, dass es beide gibt und sie miteinander konkurrieren – das Bessere ist nun mal der Feind des Guten. Im Übrigen stammt der Gedanke des Wettbewerbs unter Bildungsstätten von einem liberalen Wirtschaftswissenschaftler, Milton Friedman. Die von ihm ins Spiel gebrachten »Bildungsgutscheine« haben in den Ländern, die sich der Idee annahmen, zu hervorragenden Ergebnissen geführt, in Schweden etwa, wo den Eltern der Schulkinder eine sehr aktive Rolle bei der Verbesserung des Schulsystems zugestanden wird. Die Bildungsgutscheine ermöglichen den Eltern eine Wahlfreiheit zwischen staatlichen und privaten Schulen, und so wird eine breitere staatliche Förderung in ebenjene Schulen gelenkt, die aufgrund ihrer Qualität am meisten nachgefragt werden.
Nicht vergessen darf man, dass ein Bildungswesen, das einen hohen Standard halten will, bei all den technologischen und wissenschaftlichen Neuerungen immer teurer wird; was auch bedeutet, dass die Zivilgesellschaft dafür ebenso viel Verantwortung trägt wie der Staat. Kinder vermögender Familien von den Kosten für ihre Ausbildung zu befreien ist genauso ungerecht, wie einem jungen Menschen, der das Talent und die Arbeitsmoral mitbringt, aus wirtschaftlichen Gründen den Zugang zu den besten Einrichtungen zu verwehren. Zur Herstellung von Chancengleichheit bedarf es in der Bildung also neben solchen Gutscheinen eines Systems von Stipendien und Beihilfen.
Ein schlanker Staat ist im Allgemeinen effizienter als ein großer – für Liberale eine der Überzeugungen, an denen sich am wenigsten rütteln lässt. Je größer der Staat wird, je mehr Befugnisse er sich anmaßt, desto geringer ist der Spielraum der Freiheit für seine Bürger. Dezentralisierung der Macht ist ein liberales Prinzip, nur so kann die Gesellschaft als Ganzes die verschiedenen gesellschaftlichen und politischen Institutionen wirksam kontrollieren. Verteidigung, Justiz und öffentliche Ordnung sind hier auszunehmen, denn dort gilt das Primat des Staates (nicht in jedem Fall das Monopol); bei allen übrigen wirtschaftlichen und sozialen Aktivitäten wird idealerweise, im Rahmen eines freien Wettbewerbs, die größtmögliche zivilgesellschaftliche Partizipation gefördert.
Im Laufe der Geschichte haben die politischen Gegner sich auf den Liberalismus eingeschossen wie auf keine andere Lehre, haben ihn verachtet und verunglimpft, zuerst die Konservativen – man erinnere sich an die entsprechenden päpstlichen Enzykliken und selbst jüngste Erklärungen der katholischen Kirche, trotz so vieler liberaler Gläubiger –, dann die Sozialisten und Kommunisten, die den »Neoliberalismus« als die Speerspitze des Imperialismus dargestellt haben, als die unbarmherzigste Form des Kolonialismus und des Kapitalismus. Die historische Wahrheit straft solche Diffamierungen Lügen. Denn seit ihren Anfängen steht die liberale Lehre für die am weitesten entwickelte Form der demokratischen Kultur, und in den freien Gesellschaften hat sie auch die größten Fortschritte gebracht: bei den Menschenrechten, der Meinungsfreiheit, den Rechten sexueller, religiöser und politischer Minderheiten, dem Umweltschutz und der Bürgerpartizipation im öffentlichen Leben. Sie ist es, mit anderen Worten, die uns wie keine andere geschützt hat vor dem ewigen »Ruf der Horde«. Es bleibt eine notwendige Aufgabe, und mit diesem Buch möchte ich mein Scherflein dazu beitragen.
Madrid, August 2017
Adam Smith
1723-1790
Über Adam Smiths Kindheit und Jugend wissen wir fast nichts, nur dass er irgendwann im Jahr 1723 in Kirkcaldy geboren wurde, einem schottischen Handelsstädtchen an der Küste zehn Meilen nördlich von Edinburgh. In seinem Leben zog es ihn immer wieder dorthin, und in Kirkcaldy auch sollte er mindestens sechs der zehn Jahre verbringen, in denen er an seinem Hauptwerk schrieb, erschienen 1776: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (Der Wohlstand der Nationen)[1]. Seinen Vater, einen Anwalt und Zollrevisor, hat er nicht kennengelernt, vor seiner Geburt war er gestorben; seine Mutter, Margaret Douglas, liebte er abgöttisch. Nicht verbürgt ist die Legende, wonach er mit drei Jahren von einer Zigeunerbande geraubt wurde, eine Entführung, die nur ein paar Stunden dauerte. Er war ein kränkliches Kind, alles andere als anmutig, und noch bevor er für seine Klugheit bekannt wurde, war er es für seine außerordentliche Zerstreutheit. Eines Tages entdeckte ein Kutscher, der mit seiner Postkutsche aus London kam, außerhalb von Kirkcaldy einen einsamen Wanderer mitten auf dem Feld; er hielt die Pferde an und fragte Smith, wohin der Weg ihn führe, und der musste verblüfft zur Kenntnis nehmen, dass er sich, ohne es zu merken und allein seinen Gedanken hingegeben, so weit von der Stadt entfernt hatte. Und eines Sonntags sah man ihn, noch im Morgenmantel und mit seinem seltsamen, staksenden Gang eines Kamels, durch Dunfermline ziehen, fünfzehn Meilen von Kirkcaldy entfernt; er schaute ins Nichts und sprach mit sich selbst. Jahre später sollten sich die Einwohner von Edinburgh an das Bild gewöhnen, wie dieser alte, leicht hypochondrische Einzelgänger, den alle Welt einen Gelehrten nannte, zu den unmöglichsten Uhrzeiten die Altstadt kreuz und quer durchmaß, verlorenen Blicks und still die Lippen bewegend. Dutzende solcher Anekdoten säumen seinen Lebensweg.
Zwischen 1731 und 1737 besuchte er eine Schule in der Hill Street, in der Nähe seines Zuhauses, und er muss in Latein und Griechisch ein guter Schüler gewesen sein, denn als er mit vierzehn in Glasgow auf die Universität ging, konnte er die beiden Vorbereitungsjahre, die dem Erwerb der klassischen Sprachen dienten, überspringen. Die drei Jahre, die er in Glasgow studierte, waren, gestand er in einem Brief, »die bei weitem sinnvollste, insofern auch glücklichste und achtbarste Zeit meines Lebens«[2]; in diesen Jahren entdeckte er Newtons Physik und Euklids Geometrie, und mit Francis Hutcheson, einem herausragenden Vertreter der schottischen Aufklärung, hatte er einen Professor in Moralphilosophie, der auf seine intellektuelle Bildung großen Einfluss haben sollte. Nach den Jahren in Glasgow erhielt er ein Stipendium, mit dem er von 1740 bis 1746 am Balliol College in Oxford studierte. Von dem Leben, das er in diesen sechs Jahren führte, wissen wir ebenfalls so gut wie nichts. Seine Biografen nehmen an, dass es ein recht einsames war, denn das politische und kulturelle Klima der Universität wurde bestimmt von einem Jakobitentum, wie es konservativer und reaktionärer nicht sein konnte, für Smith, geprägt vom Presbyterianismus und den (liberalen) Whigs, von keinerlei Wert. Immerhin lernte er auf eigene Faust Französisch und las leidenschaftlich die französische Literatur, seine Lieblingsautoren waren Racine und Marivaux. Das für ihn Bedeutsamste in seinen Oxforder Jahren aber war, dass er das Werk David Humes kennenlernte, vielleicht sogar ihn selbst, eine weitere der großen Gestalten der schottischen Aufklärung. Hume, zwölf Jahre älter als Smith, genoss in Intellektuellenkreisen großes Ansehen, nicht aber unter denen, die in der Universität das Sagen hatten, ihnen galt er als Atheist. Adam Smith erhielt – eines der wenigen Details, die wir aus seinem Leben in Oxford kennen – am Balliol College eine Rüge, als man ihn dabei ertappte, wie er heimlich den Treatise of Human Nature (1738) dieses einflussreichen Philosophen las, der später sein bester Freund werden sollte. Auf ihn und auf Hutcheson sang er ein Loblied in seiner Theorie der ethischen Gefühle (1759).
Bis heute kursiert die irrige Vorstellung, Adam Smith sei vor allem Ökonom gewesen – man nennt ihn »Vater der Nationalökonomie« –, was ihn mehr als verblüfft hätte. Er selbst betrachtete sich immer als einen Philosophen und Moralisten. Sein Interesse an ökonomischen Fragen wie auch an anderen Disziplinen – so schrieb er etwa einen Aufsatz zur Geschichte der Astronomie, der erst posthum veröffentlicht wurde – ergab sich aus seinem Bestreben, eine »Wissenschaft vom Menschen« zu entwickeln und sich das Funktionieren der Gesellschaft zu erklären.
Umfänglicher wird die Quellenlage, als er sein Studium in Oxford beendet und nach Edinburgh kommt, wo er zwischen 1748 und 1751 dank Lord Kames, auch er eine Persönlichkeit der schottischen Aufklärung, eine Reihe öffentlicher Vorträge hält, die großen Eindruck machen und zu seinem Ruf beitragen. Die Texte dieser Vorträge sind verloren gegangen, man kennt sie aber über die Aufzeichnungen von Studenten, die unter den Zuhörern waren. Der erste ist ein Vortrag über Rhetorik und wie die Sprache entstanden ist, die menschliche Verständigung, für Smith nicht nur eine überlebensnotwendige Tätigkeit, es geht dabei auch um Angemessenheit und Sympathie, um die Fähigkeit, mit Menschen umgehen zu können, um den Gemeinsinn, Pfeiler des gesellschaftlichen Lebens und zugleich sein Mörtel. Zur Demonstration nahm er Beispiele aus der Literatur. Seiner Meinung nach bringt eine klare, direkte und konzise Sprache am besten die Gefühle und Gedanken zum Ausdruck, anders als jener weitschweifige und überladene, für eine erlesene Minderheit charakteristische (und vom 3. Earl of Shaftesbury praktizierte) Stil, der den gewöhnlichen Menschen ausschließe.
In einem anderen seiner Vorträge, über die Jurisprudenz, skizzierte Smith einige der Ideen, die er später weiterentwickeln sollte, ausgehend von David Hume, für den die Einführung des Sondereigentums den Beginn der Zivilisation markiert. Es war ein Thema, für das sich die besten schottischen Intellektuellen jener Zeit begeisterten. Lord Kames zum Beispiel vertrat die Ansicht, der ausgeprägteste Trieb des Menschen sei der, etwas zu besitzen, daraus sei das Privateigentum erwachsen und in gewisser Weise die Gesellschaft selbst. In seinem Buch Historical Law-Tracts (1758) teilt er den Ablauf der Geschichte in vier Stufen ein: das Zeitalter der Jäger, das Zeitalter der Hirten, das Zeitalter der Ackerbauern und schließlich das Zeitalter der Händler. Der Austausch von Erzeugnissen innerhalb und außerhalb der eigenen Gruppe wäre demnach der wahre Motor der Zivilisation gewesen. Regierungen bildeten sich, als den Mitgliedern der Gemeinschaft die Bedeutung des Privateigentums bewusst wurde und sie begriffen, dass dieses geschützt werden musste, wozu es der Gesetze bedurfte und einer Obrigkeit, die für ihre Einhaltung sorgte. Auf Adam Smith hatten diese Gedanken großen Einfluss, er machte sie sich zu eigen und sollte sie später ausweiten und nuancieren. Vielleicht schon in seinen Jahren in Edinburgh gelangte er in Umrissen zu der Überzeugung – sein ganzes Leben sollte sie ihn begleiten –, dass der schlimmste Feind des Eigentums und der Regierung die adligen Großgrundbesitzer waren, jene Aristokraten, die von ihren Pachtgütern lebten und es oftmals schafften, Regierungen, die ihre Macht beschnitten, zu stürzen; für Smith waren sie deshalb schon immer eine Bedrohung für das Recht, für den sozialen Frieden und den Fortschritt. Dank seiner Edinburgher Vorträge sah man den jungen Mann nunmehr als Mitglied jener Bewegung – der schottischen Aufklärung –, die die Ideen, die Werte und die Kultur ihrer Zeit revolutionieren sollte.
Von Edinburgh ging Adam Smith nach Glasgow, wo er dreizehn Jahre blieb – bis 1764 –, zunächst als Professor für Logik und Metaphysik und dann für Moralphilosophie. Von da an wissen wir mehr über seine Person. In Glasgow lebte er zusammen mit seiner Mutter und einer Cousine, Janet Douglas, die sich in all seinen Jahren in Schottland um den Haushalt kümmerten. Sein Leben war geprägt von stoischer, presbyterianischer Genügsamkeit, ohne Alkohol und wahrscheinlich auch ohne Sex – nie hat er geheiratet, von einer Freundin ist auch nichts bekannt, und die Gerüchte, die über manche Romanze im Umlauf waren, haben alle etwas Unwirkliches –, gewidmet allein seinen Studien und der Lehre. Sein Ansehen als Professor war so groß, dass nicht nur James Boswell, der zukünftige Biograf von Samuel Johnson, sich an der Universität Glasgow einschrieb, um seine Vorlesungen zu hören. Nach dem Zeugnis seiner Schüler las er vom Blatt ab, auch wenn er sich oft von seinen Aufzeichnungen entfernte, um irgendein Thema zu entwickeln oder zu präzisieren, und er verabscheute es, dass seine Studenten mitschrieben, während er sprach (»I hate scribblers« – »Ich hasse Kritzler«). Auch in der Administration machte er eine gute Figur. Er war mit der Leitung der Bibliothek und der Anschaffung von Büchern betraut, zuständig für den Bau neuer Forschungseinrichtungen, und er arbeitete mit in der Verwaltung und der Buchhaltung einer Universität, an der er schließlich zum Dekan gewählt wurde und Prorektor war. Bei all diesen Tätigkeiten verdiente er sich ebenso viel Respekt und Lob wie für seine geistige Arbeit.
Glasgow erlebte in diesen Jahren – nach der Öffnung der Märkte durch den Unionsvertrag mit England – eine außerordentliche Blütezeit, besonders dank dem Handel mit Tabak, den die schottischen Schiffe aus Virginia in den Vereinigten Staaten brachten und dann im Königreich und im übrigen Europa vertrieben. Wie Arthur Herman in seinem Buch über die schottische Aufklärung schreibt, begann Adam Smith sich in dieser Zeit, eben aufgrund der bemerkenswerten Konjunktur Glasgows, für die Handelsgeschäfte der großen Unternehmen zu interessieren. Durch einen Freund, einen der Tabaklords der Stadt, lernte er sie von innen her kennen: »Zu Smiths engerem Bekanntenkreis zählte John Glassford, der ihn über die Geschehnisse in Amerika auf dem Laufenden hielt und seinerseits ein lebhaftes Interesse daran zeigte, wie es mit Der Wohlstand der Nationen voranging. Der Bürgermeister von Glasgow, Andrew Cochrane, organisierte einen Political Economy Club, zu dessen Mitgliedern Smith, Glassford und ein weiterer vermögender Tabakhändler gehörten, Richard Oswald. Cochrane leitete auch eine Sondersitzung des Glasgower Stadtrates am 3. Mai 1762, als Professor Smith zum Ehrenbürger der Stadt ernannt wurde.«[3]
Theorie der ethischen Gefühle (1759)
Das erste Werk, das Adam Smith veröffentlichte, The Theory of Moral Sentiments (1759)[4], ist das Ergebnis seiner Vorlesungen, die er im Laufe der Jahre hielt, und es zeigt, wie sehr der moralische Aspekt für ihn im Vordergrund stand. In den Thesen, die er darin entwickelt, sind die Ideen seines ehemaligen Lehrers Francis Hutcheson präsent, ebenso die von David Hume, von Rousseau über die Ungleichheit unter den Menschen und die von Bernard Mandeville über die Moral. Das Buch enthält aber auch bereits einen tragfähigen eigenen Gedanken, es ist eine erste Annäherung an diese »Wissenschaft vom Menschen«, von deren Ausarbeitung Smith schon als junger Mann träumte.
Manche Begriffe sind Schlüssel zum Verständnis des Buches – Sympathie (im Sinne von Empathie), Fantasie, Schicklichkeit, der unparteiische Zuschauer –, und die Frage, auf die diese umfangreiche Untersuchung eine Antwort geben will, ist: Wie kommt es, dass manche Gemeinschaften sich halten und mit der Zeit fortentwickeln, statt auseinandergetrieben zu werden von Rivalitäten, entgegengesetzten Interessen, Instinkten und egoistischen Affekten? Was ermöglicht die Soziabilität des Menschen, diesen Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält, so unterschiedlich die Einzelnen und ihre Charaktere auch sind?
Die Menschen machen sich in der Vorstellung einen Begriff voneinander, über ein natürliches Mitgefühl dem Nächsten gegenüber, es nähert die Individuen einander an, was nie passieren würde, wären ihre Handlungen ausschließlich von der Vernunft geleitet. Ein solches Empfinden von Sympathie und die Vorstellungskraft ziehen Fremde an, stellen eine Verbindung zwischen ihnen her, womit der Argwohn überwunden und Solidarität geschaffen wird. Das Bild vom Menschen und von der Gesellschaft, das diesem Buch zugrunde liegt, ist positiv und optimistisch, denn Adam Smith glaubt, dass trotz aller auf der Welt begangenen Gräuel das Gute über das Böse siegt, mit anderen Worten: die ethischen Gefühle. Ein schönes Beispiel für diesen natürlichen Anstand, der die allermeisten Menschen auszeichnet, erscheint auf den letzten Seiten des Buchs: »Einem Menschen zu sagen, daß er lügt, ist die tödlichste von allen Beschimpfungen […]. Ein Mann, der das Unglück hätte, sich vorstellen zu müssen, daß niemand auch nur ein Wort von dem glaubt, was er sagt, würde die Empfindung haben, daß er aus der menschlichen Gesellschaft ausgestoßen ist, würde vor dem bloßen Gedanken zurückschrecken, sich in die Gesellschaft zu begeben oder vor die Augen der Menschen zu treten, und könnte, wie ich glaube, kaum ein anderes Schicksal haben, als vor Verzweiflung zu sterben.« (S. 554) Vieles hat sich in den Jahrhunderten, seit Adam Smith diese Zeilen schrieb, beträchtlich verändert, und in moralischer Hinsicht haben sich die Menschen zum Nachteil entwickelt, denn es ist kaum vorstellbar, dass heute noch allzu viele in der Lage wären, allein bei der Vorstellung, Mitmenschen könnten sie als Lügner ansehen, so zu erschrecken, dass sie vor Verzweiflung sterben. Aber der das schrieb, war alles andere als naiv: Smiths Analysen des moralischen Verhaltens sind von großer Subtilität und Komplexität, gestützt auf die Überzeugung, dass sich selbst unter den schlimmsten Umständen die Schicklichkeit – propriety, im Sinne eines richtigen, gerechten und angemessenen Verhaltens in den zwischenmenschlichen Beziehungen – gegen die Unschicklichkeit durchsetzt: »Als die Natur den Menschen für die Gesellschaft bildete, da gab sie ihm zur Aussteuer ein ursprüngliches Verlangen mit, seinen Brüdern zu gefallen, und eine ebenso ursprüngliche Abneigung, ihnen wehe zu tun. Sie lehrte ihn Freude über deren freundliche Gesinnung, und Schmerz über ihre unfreundliche Gesinnung zu empfinden.« (S. 187)
Es ist ein etwas kurioses, schwankendes, schillerndes und feinsinniges Buch, das einem mal vorkommt wie eine Abhandlung über gute Manieren, mal wie eine psychologische Analyse der Gefühle des Menschen gegenüber seinen Mitmenschen, mal wie ein Handbuch der Soziologie. Tatsächlich ist es eine Studie über die menschlichen Beziehungen und wie sie eine Gesellschaft dazu bringen, dass sie funktioniert, dass in ihrer Mitte eine Grundsolidarität entsteht, die ein Auseinanderfallen verhindert. Ebenso über den moralischen Sinn, der es uns ermöglicht, das Gute vom Bösen zu unterscheiden, das Künstliche vom Echten, das Wahre vom Falschen. Es war Adam Smiths erster Band, in dem er diese »Wissenschaft vom Menschen« skizzierte, die ihn sein Leben lang beschäftigen sollte und die er doch niemals abschloss.
Bei der Beschreibung der Reaktionen und Verhaltensweisen berücksichtigt Smith Armut und Reichtum, gesellschaftliche Vorurteile und die Stellung des Einzelnen in der Gesellschaft, im Allgemeinen aber konzentriert er sich auf die ganz gewöhnlichen Bürger, die für den Normalfall stehen. Über Menschen, die sich der Normalität entziehen und ihr zuwiderhandeln (diese Monster, die Georges Bataille so faszinierten), geht er meist rasch hinweg. Deshalb erscheint die Gesellschaft, wie sie uns in seiner Theorie der ethischen Gefühle