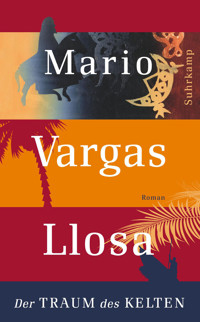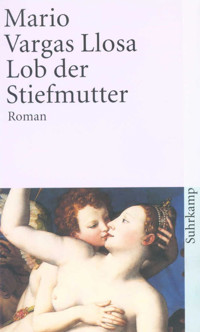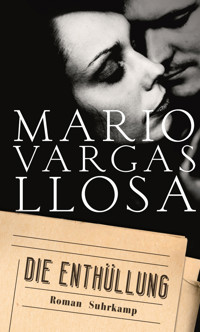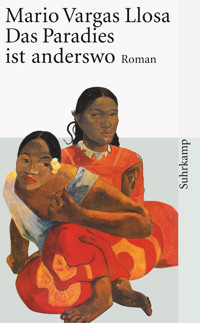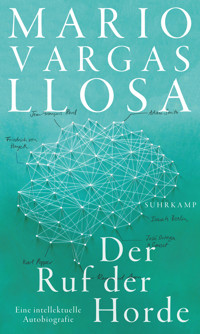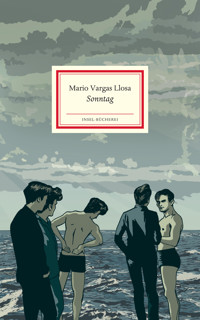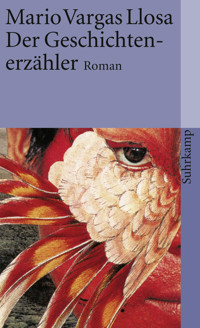
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mario Vargas Llosa erschließt in der spannend entfalteten Handlung dieses Romans, der von dem »Geschichtenerzähler« der Machiguengas und einem verschollenen Studienfreund erzählt, ein brennendes Thema Lateinamerikas: die Kultur der Indios im Amazonasgebiet. Welchen Platz lassen wir dem ganz anderen, wie es sich in der Welt der »Primitiven« zeigt und entzieht, in unserer »modernen« Gesellschaft? Welche Rolle kann der »aufgeklärte« Intellektuelle, der engagierte Schriftsteller in dieser Auseinandersetzung zwischen den Kulturen einnehmen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 384
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Seit seiner Studienzeit fühlt sich der Ich-Erzähler dieses Romans von der Welt der Urwaldindianer in Bann geschlagen. Besonders fasziniert ist er von der Institution des »Geschichtenerzählers« im Stamm der Machiguengas, und zusammen mit seinem Freund, der eine verheißungsvolle Karriere aufgegeben hat und bei den Indios lebt, versucht er, dessen Bedeutung zu erkunden. Zwei Jahrzehnte später findet er den Freund in dem entlegenen Gebiet nicht mehr vor, und die Machiguengas scheinen ihren »Geschichtenerzähler« vergessen zu haben. Hat der inzwischen von der Zivilisation eingeholte Stamm seine Tradition aufgegeben? Und was hat es mit dem abrupten Verschwinden seines Freundes auf sich? Eine spannende Spurensuche beginnt.
Mario Vargas Llosa, geboren 1936 in Arequipa/Peru, lebt heute in Madrid und Lima. Neben zahlreichen anderen Auszeichnungen erhielt er 1996 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels und 2010 den Nobelpreis für Literatur. Sein schriftstellerisches Werk erscheint auf deutsch im Suhrkamp Verlag.
Mario Vargas Llosa
Der Geschichtenerzähler
Roman
Aus dem Spanischenvon Elke Wehr
Suhrkamp
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2014
Hinweise zur Textgrundlage:
Die Originalausgabe erschien 1987 unter dem Titel El hablador bei Seix Barral, Barcelona.
Der vorliegende Text folgt der 11. Auflage 2011 der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 1982.
© Mario Vargas Llosa 1987
© der deutschen Ausgabe Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1990
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlagmotiv: Andrzej Klimowski
Umschlaggestaltung: Göllner, Michels, Zegarzewski
eISBN 978-3-518-73568-8
www.suhrkamp.de
Für Luis Llosa Ureta in seinem Schweigen
und für die Machiguenga-Kenkitsatatsirira
I
Ich war nach Florenz gekommen, um Peru und die Peruaner eine Zeitlang zu vergessen, und da begegnete mir dieses verflixte Land heute morgen auf denkbar unerwartete Weise. Ich hatte das wiederaufgebaute Haus Dantes besichtigt, die kleine Kirche San Martino del Vescovo und die Gasse, wo dieser der Legende nach Beatrice zum ersten Male erblickte, als ein Schaufenster in der Santa-Margherita-Passage mich plötzlich innehalten ließ: Bogen, Pfeile, ein geschnitztes Paddel, ein Krug mit geometrischen Zeichnungen und eine Schaufensterpuppe, die in einer Cushma, einem indianischen Hemd aus wilder Baumwolle, steckte. Aber vor allem drei oder vier Photographien ließen mich ganz plötzlich den Geschmack des peruanischen Urwalds wiederfinden. Breite Flüsse, dickstämmige Bäume, zerbrechliche Kanus, kümmerliche, auf Pfählen erbaute Hütten und Grüppchen halbnackter, farbig bemalter Männer und Frauen, die mich unverwandt aus ihrem glänzenden Fotokarton betrachteten.
Natürlich ging ich hinein. Mit einem seltsamen Kribbeln und der Vorahnung, daß ich eine Dummheit beging, daß ich mich aus trivialer Neugierde der Gefahr aussetzte, das bislang so gut geplante und ausgeführte Vorhaben zum Scheitern zu bringen – ein paar Monate lang in unerbittlicher Einsamkeit Dante und Machiavelli zu lesen und die Malerei der Renaissance anzuschauen – und eine jener unauffälligen Katastrophen auszulösen, die mein Leben von Zeit zu Zeit auf den Kopf stellen. Aber natürlich ging ich hinein.
Die Galerie war winzig klein. Ein einziger Raum mit niedriger Decke, in dem man, um sämtliche Photographien zeigen zu können, zwei zusätzliche Stellwände aufgebaut hatte, die ebenfalls auf beiden Seiten dicht mit Bildern bedeckt waren. Ein mageres Mädchen mit Brille, das hinter einem kleinen Tisch saß, schaute mich an. War die Ausstellung »I nativi della foresta amazonica« zu besichtigen?
»Certo. Avanti, avanti.«
Im Innern der Galerie gab es keine Gegenstände, nur Fotos, mindestens um die fünfzig und die meisten ziemlich groß. Sie trugen keine Bildunterschriften, aber irgend jemand, vielleicht Gabriele Malfatti persönlich, hatte auf zwei Blatt Papier vermerkt, daß die Photographien im Verlauf einer zweiwöchigen Reise durch die Amazonas-Region der Departements Cusco und Madre de Dios im Osten Perus entstanden waren. Der Künstler war dem Vorsatz gefolgt, »ohne Demagogie noch Ästhetizismus« das tägliche Leben eines Stammes zu beschreiben, der noch bis vor wenigen Jahren beinahe ohne jeden Kontakt zur Zivilisation, in Einheiten von einer oder zwei Familien verstreut, gelebt hatte. Erst in unseren Tagen begann er, sich an den von der Ausstellung dokumentierten Orten zusammenzufinden, aber viele seiner Mitglieder lebten nach wie vor in den Wäldern. Der Name des Stammes stand in fehlerlosem Spanisch da: Die Machiguengas.
Die Fotos wurden Malfattis Vorsatz durchaus gerecht. Da waren die Machiguengas, wie sie vom Flußufer aus die Harpune schleuderten oder, halb im Dickicht verborgen, den Bogen auf das Wasser- oder das Nabelschwein anlegten; man sah, wie sie Yuccas von den leinen Saatfeldern ernteten, die um ihre funkelnagelneuen Weiler verstreut lagen – vielleicht die ersten ihrer langen Geschichte –, wie sie den Wald mit Machetenhieben rodeten und Palmblätter flochten, um die Dächer ihrer Unterkünfte zu decken. Im Kreis sitzende Frauen flochten Strohmatten und Körbe, andere fertigten Kronen mit prachtvollen Papageien- und Arafedern, die auf hölzernen Reifen befestigt wurden. Man sah, wie sie ihre Gesichter und Körper sorgfältig mit Orleantinktur bemalten, Feuer anzündeten, Felle trockneten, die Yucca für den Masato in kanuförmigen Gefäßen fermentierten. Die Fotos zeigten anschaulich, wie wenige sie waren in der sie umgebenden unermeßlichen Weite aus Himmel, Wasser und Vegetation, zeigten ihr prekäres und kärgliches Leben, ihre Isolation, ihren Archaismus, ihre Schutzlosigkeit. Es stimmte: ohne Demagogie noch Ästhetizismus.
Was ich jetzt sagen werde, ist weder eine nachträgliche Erfindung noch eine falsche Erinnerung. Ich bin sicher, daß ich mit einer inneren Bewegtheit von Foto zu Foto wanderte, die sich in einem bestimmten Augenblick in Beklemmung wandelte. Was hast du? Was könntest du in diesen Bildern finden, das eine derartige Unruhe rechtfertigte?
Schon bei den ersten Bildern hatte ich die Lichtungen wiedererkannt, auf denen sich Nueva Luz und Nuevo Mundo befinden – vor nicht einmal drei Jahren war ich dort gewesen –, und als mir eine Luftaufnahme des zweiten Ortes vor Augen kam, erwachte in meiner Erinnerung sogar schlagartig das Katastrophengefühl, mit dem ich die akrobatische Landung erlebt hatte, die wir dort an jenem Morgen mit der Cessna des Instituts für Linguistik vollführten und bei der wir den Machiguenga-Kindern ausweichen mußten. Ich glaubte auch, einige Gesichter von Männern und Frauen wiederzuerkennen, mit denen ich dank der Hilfe von Mr. Schneil gesprochen hatte. Der Glaube wurde zur Gewißheit, als ich auf einer anderen Photographie das Kind erblickte, dessen Mund und Nase von der Uta-Krankheit zerfressen waren, mit demselben aufgeblähten Bäuchlein und denselben lebhaften Augen, wie ich sie in meiner Erinnerung bewahrte. Mit der gleichen natürlichen Unschuld wie uns damals zeigte es der Kamera jene Öffnung mit Eckzähnen, Gaumen und Mandeln, die ihm das Aussehen eines mysteriösen Raubtiers verlieh.
Die Photographie, auf die ich wartete, seit ich die Galerie betreten hatte, befand sich unter den letzten. Auf den ersten Blick war erkennbar, daß diese Gemeinschaft von Männern und Frauen, die auf amazonische Art im Kreis saßen – der orientalischen ähnlich: im Schneidersitz, mit sehr geradem Oberkörper – und in das abnehmende Licht der in Dunkelheit übergehenden Dämmerung getaucht waren, sich im Zustand einer an Hypnose grenzenden Konzentration befand. Ihre Reglosigkeit war vollkommen. Alle Gesichter richteten sich, wie die Radien eines Kreises, auf den Mittelpunkt, eine männliche Gestalt, die im Zentrum des Kreises der gebannt lauschenden Machiguengas stand und mit den Armen gestikulierend sprach. Ich spürte es kalt den Rücken hinunterlaufen. Ich dachte: ›Wie hat dieser Malfatti es fertiggebracht, daß sie ihm erlaubt haben, wie hat er es angestellt, um ...?‹ Ich bückte mich und näherte das Gesicht der Photographie so weit es ging. Ich betrachtete und beschnupperte sie, durchbohrte sie mit den Augen und der Vorstellungskraft, bis ich bemerkte, daß das Mädchen der Galerie sich von ihrem kleinen Tisch erhob und beunruhigt auf mich zukam.
Bemüht, meine Fassung wiederzugewinnen, fragte ich sie, ob die Photographien verkäuflich seien. Nein, das glaube sie nicht. Sie stammten vom Verlag Rizzoli. Er beabsichtigte anscheinend, ein Buch mit ihnen zu veröffentlichen. Ich bat sie, mich mit dem Photographen in Kontakt zu bringen. Das würde leider nicht möglich sein:
»Il signore Gabriele Malfatti è morto.«
Gestorben? Ja. An einem Fieber. Ein Virus, mit dem er sich in diesen Urwäldern angesteckt hatte, forse. Der Ärmste! Er war Modephotograph gewesen, hatte für Vogue, Uomo und ähnliche Zeitschriften gearbeitet, Modelle photographiert, Möbel, Schmuckstücke, Kleider. Er hatte sein ganzes Leben davon geträumt, etwas anderes zu machen, etwas Persönlicheres, wie diese Reise in die Amazonas-Region. Und als er es endlich geschafft hatte und man sich anschickte, seine Arbeit in einem Buch zu veröffentlichen, da starb er! Und jetzt, le dispiaceva, aber es sei Zeit für das pranzo und sie müsse schließen.
Ich bedankte mich bei ihr. Bevor ich hinausging, um mich abermals den Herrlichkeiten und Touristenhorden von Florenz auszuliefern, konnte ich noch einen letzten Blick auf die Photographie werfen. Ja. Es bestand nicht der geringste Zweifel. Ein Geschichtenerzähler.
II
Saúl Zuratas hatte einen dunkelvioletten, weinfarbenen Leberfleck, der die ganze rechte Seite seines Gesichts bedeckte, und rotes Haar, wirr wie die Borsten eines Schrubbers. Der Leberfleck verschonte weder das Ohr noch die Lippen, noch die Nase, die er ebenfalls mit rot geäderten Schwellungen überzog. Er war der häßlichste Junge der Welt; aber auch sympathisch und herzensgut. Ich habe niemanden gekannt, der gleich ihm auf Anhieb den Eindruck eines so offenen, geradlinigen, uneigennützigen und gutwilligen Menschen machte, niemanden, der in jeder erdenklichen Situation eine solche Einfachheit und Herzlichkeit an den Tag legte. Ich lernte ihn kennen, als wir die Aufnahmeprüfungen für die Universität ablegten, und wir wurden ziemlich gute Freunde – soweit man Freund eines Erzengels sein kann –, vor allem in den ersten zwei Jahren, in denen wir gemeinsam Vorlesungen an der Philosophischen Fakultät besuchten. An dem Tag, da ich ihn kennenlernte, erklärte er mir, während er auf seinen Leberfleck wies und dabei schon loslachte:
»Man nennt mich Mascarita, Kumpel. Wetten, du rätst nicht, warum.«
Auch wir auf der San-Marcos-Universität gaben ihm diesen Spitznamen.
Er stammte aus Talara und stand mit allen auf freundschaftlichem Fuß. Wörter und Ausdrücke des Straßenjargons tauchten in jedem Satz auf, der aus seinem Mund kam, und gaben selbst seinen vertraulichen Äußerungen einen scherzhaften Anflug. Sein Problem, so sagte er, bestand darin, daß sein Vater zuviel mit dem Laden in ihrem Kaff verdient hatte, so viel, daß er eines Tages beschloß, nach Lima überzusiedeln. Und seitdem sie in die Hauptstadt gekommen waren, hatte der Alte sich aufs Judentum verlegt. Er war nicht besonders religiös gewesen in der Hafenstadt dort oben im Departement Piura, soviel Saúl sich erinnern konnte. Gelegentlich hatte er gesehen, wie er in der Bibel las, das ja, aber nie hatte er Mascarita einzuschärfen gesucht, daß, er einer anderen Rasse und einer anderen Religion angehörte als die Jungen im Ort. Hier in Lima dagegen wohl. Was für ein Pech! Alter schützt vor Torheit nicht. Oder besser gesagt, vor der Religion Abrahams und Mosis. Du lieber Himmel! Was hatten wir anderen, die wir Katholiken waren, für ein Glück. Die katholische Religion erwies sich als Kinderspiel in ihrer Einfachheit, eine kleine halbstündige Messe jeden Sonntag und die Kommunion jeden ersten Freitag im Monat, die wie im Fluge verging. Er hingegen mußte an den Sonnabenden stundenlang in die Synagoge abtauchen, sich das Gähnen verkneifen und so tun, als interessiere er sich für die Predigten des Rabbiners – von denen er keinen Deut verstand –, um seinen Vater nicht zu enttäuschen, der schließlich und endlich sehr alt und ein herzensguter Mensch war. Hätte Mascarita ihm gesagt, daß er schon seit langem nicht mehr an Gott glaubte und daß es ihm letzten Endes schnuppe war, zum auserwählten Volk zu gehören, den armen Don Salomón hätte der Schlag getroffen. Ich lernte Don Salomón wenig später kennen, an einem Sonntag. Saúl hatte mich zum Mittagessen eingeladen. Die Wohnung lag im Breña-Viertel, hinter der La-Salle-Schule, in einer heruntergekommenen Seitenstraße der Avenida Arica. Es war eine Wohnung mit tiefen Zimmern voller alter Möbel und einem kleinen sprechenden Papagei, der einen Kafkaschen Namen trug und der die ganze Zeit Saúls Spitznamen wiederholte: »Mascarita! Mascarita!« Vater und Sohn lebten allein mit einem Dienstmädchen, das mit ihnen aus Talara gekommen war und ihnen nicht nur die Küche besorgte, sondern Don Salomón auch in dem Krämerladen zur Hand ging, den er in Lima aufgemacht hatte. »Der mit dem Rolladen mit dem sechszackigen Stern, Kumpel. Er heißt wegen des Davidssterns, stell dir das mal vor!«
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!