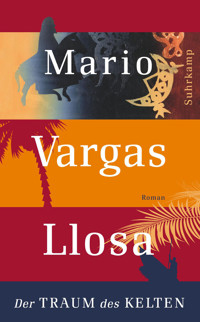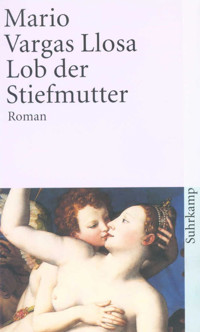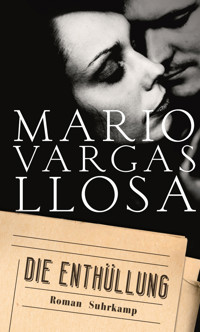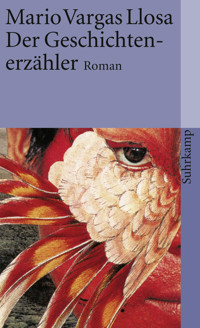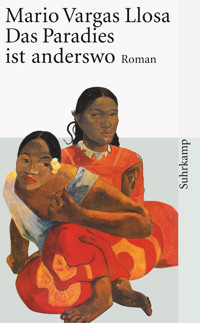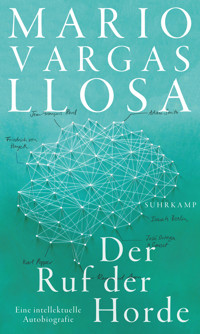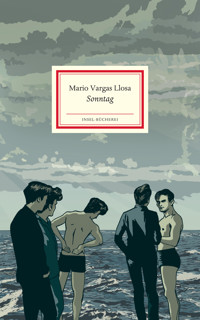21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Mario Vargas Llosa hat ein spätes Meisterwerk geschrieben, in dem er seine Lebensthemen virtuos zusammenführt. Von großen und noch größeren Versuchungen erzählt dieser sinnliche, kräftige, lebenspralle Roman, von der Verführungskraft der Musik, der grenzenlosen Leidenschaft für die Kunst und die Welt – und der Schwierigkeit, dabei Maß zu halten.
Toño Azpilcueta führt Familien- und Berufsleben mit sehr mäßiger Begeisterung. Seine Leidenschaft gilt der traditionellen Musik seines Landes, dem peruanischen Walzer, den er seit der Jugend akribisch erforscht. Eines Tages lernt er einen unbekannten, aber offensichtlich über alle Maßen talentierten Gitarristen namens Lalo Molfino kennen. Die Begegnung verändert Toños Leben – sehr zur Beunruhigung seiner Familie –, denn Molfino spielen zu hören, ist für ihn eine Offenbarung. Augenblicklich weiß Toño, was seine Mission ist: Er schreibt endlich das Buch, über Molfino, den peruanischen Walzer und vor allem die künstlerische Vision eines besseren Lebens. Es wird ein Erfolg und Toño berühmt. Was läge also näher, als das Buch zu erweitern, sein Land, dessen Geschichte, die ganze Welt darin unterzubringen? Immer mehr, geradezu manisch, schreibt Toño daran, taub gegen die lauter werdende Sorge seiner Familie …
»Das ist mein letztes Buch.« Mario Vargas Llosa
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 346
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Cover
Titel
Mario Vargas Llosa
Die große Versuchung
Aus dem Spanischen von Thomas Brovot
Suhrkamp Verlag
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
Die Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel Le dedico mi silencio bei Alfaguara, Madrid.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2024
Deutsche Erstausgabe 2024
Erste Auflage 2024Deutsche Erstausgabe© der deutschsprachigen Ausgabe Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2024© 2023, Mario Vargas Llosa
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg, unter Zuhilfenahme von Midjourney KI
eISBN 978-3-518-78052-7
www.suhrkamp.de
Widmung
Für Patricia
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Cover
Titel
Impressum
Widmung
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXVI
XXXVII
Informationen zum Buch
Die große Versuchung
I
Warum hatte José Durand Flores ihn wohl sprechen wollen, dieses Mitglied der intellektuellen Elite Perus? Man hatte es ihm in der Pulpería ausgerichtet, die sein Freund Collau betrieb, ein kleines Lokal und zugleich Kiosk für Zeitungen und Zeitschriften, und er rief zurück, aber niemand ging ran. Collau sagte, die Nachricht habe seine Tochter entgegengenommen, die kleine Mariquita, vielleicht habe sie die Nummer nicht richtig verstanden, bestimmt würden sie sich noch mal melden. Dann plagten Toño wieder diese schamlosen Viecher, die ihn, wie er sagte, seit frühester Kindheit verfolgten.
Warum wollte der Mann mit ihm sprechen? Er kannte ihn nicht persönlich, sehr wohl aber wusste Toño Azpilcueta, wer José Durand Flores war. Ein anerkannter Schriftsteller, jemand also, den Toño bewunderte und zugleich verabscheute, weil er es bis nach oben geschafft hatte und mit Attributen belegt wurde wie »Kundiger von Rang« und »gefeierter Kritiker«, das übliche Lob, das sich die Intellektuellen so leicht verdienten, Leute, die im Land zu dem gehörten, was Toño Azpilcueta »die Elite« nannte. Was hatte dieser Mensch bisher gemacht? Er hatte in Mexiko gelebt, klar, und kein Geringerer als Alfonso Reyes, Dichter, Essayist und Gelehrter, Diplomat und Leiter des Colegio de México, hatte ein Vorwort geschrieben zu seiner berühmten und ebendort herausgegebenen Anthologie Niedergang der Sirenen, Glanz der Seekühe. Es hieß, er sei Experte für den Inka Garcilaso de la Vega und es sei ihm gelungen, dessen Bibliothek bei sich zu Hause oder in einem Archiv der Universität zu rekonstruieren. Das konnte sich sehen lassen, war aber auch nicht viel, letztlich fast nichts. Er rief noch einmal an, und auch diesmal ging niemand ans Telefon. Jetzt waren sie wieder da, die Nagetiere, und krochen ihm über den ganzen Körper, so wie jedes Mal, wenn er aufgeregt war, nervös oder ungeduldig.
Toño Azpilcueta hatte in der Nationalbibliothek im Zentrum von Lima darum gebeten, die Bücher von José Durand Flores zu erwerben, und die junge Frau, die ihn bediente, sicherte es ihm zwar zu, aber dann passierte nichts, und so wusste Toño nur, dass er ein bedeutender Akademiker war, nicht aber, warum. Sein Name war ihm vertraut aufgrund eines Umstands, der seiner offensichtlichen Vorliebe für das Fremde zuwiderlief oder sie überspielte. Denn jeden Samstag brachte Durand Flores in der Zeitung La Prensa einen Artikel, worin er sich wohlwollend über die kreolische Musik äußerte, selbst über Sänger, Gitarristen und Cajónspieler wie Caitro Soto, Begleiter von Chabuca Granda, weshalb Toño eine gewisse Sympathie für ihn empfand. Dagegen empfand er für diese hochmütigen Intellektuellen, die die kreolischen Musiker verachteten und sie nicht einmal erwähnten, weder um sie zu loben noch um sie niederzumachen, eine tiefe Abneigung – zur Hölle mit ihnen.
Toño Azpilcueta war eine Kapazität auf dem Gebiet der kreolischen Musik, egal von woher, von der Küste, aus dem Hochland, vom Amazonas, ihr hatte er sein Leben gewidmet. Die einzige Anerkennung, die ihm zuteilgeworden war – Geld freilich nicht –, bestand darin, dass er, zumal nach dem Tod von Professor Morones, diesem großartigen Menschen aus Puno, als der beste Kenner der peruanischen Musik im Land galt. Seinen Lehrer hatte er kennengelernt, als er noch auf die La-Salle-Schule ging, kurz nachdem sein Vater, ein italienischer Einwanderer mit baskischem Nachnamen, ein kleines Haus in La Perla gemietet hatte, wo Toño aufgewachsen war. Nach dem Tod von Professor Morones wurde er zu dem »Intellektuellen«, der am meisten wusste (und schrieb) über die Musik und die Tänze, welche die Folklore des Landes prägten. Er hatte an der San Marcos studiert, und seinen Abschluss hatte er mit einer Arbeit über den Vals gemacht, den peruanischen Walzer, betreut von Hermógenes A. Morones persönlich – hinter dem A mit Punkt, hatte Toño herausgefunden, verbarg sich der Name Artajerjes –, und Toño war nicht nur sein Assistent und Lieblingsschüler gewesen, sondern in gewisser Weise auch derjenige, der seine Studien und Forschungen über die Musik und die Tänze in den verschiedenen Regionen fortführte.
Im dritten Jahr ließ Morones ihn den ein oder anderen Kurs abhalten, und alle an der San Marcos hofften, dass Toño Azpilcueta, wenn der Professor in den Ruhestand trat, seinen Lehrstuhl erben würde. Er selbst dachte das auch. Weshalb er nach Beendigung des fünfjährigen Studiums an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät weiterforschte, um eine Doktorarbeit zu schreiben mit dem Titel Die Pregones von Lima, die natürlich seinem Lehrmeister gewidmet wäre, Dr. Hermógenes A. Morones.
Bei der Lektüre der Chronisten aus der Zeit der Kolonie war Toño aufgefallen, dass die Ausrufer, die sogenannten pregoneros, die Nachrichten und städtischen Anordnungen gewöhnlich sangen und nicht verlasen, sodass sie die Bürger in Begleitung mündlicher Musik erreichten. Und dank Rosa Mercedes Ayarza, der großen Spezialistin für peruanische Musik, war er zu der Erkenntnis gelangt, dass die pregones die ältesten Geräusche der Stadt waren, denn so riefen auch die Straßenverkäufer ihre Ware aus, Backwaren wie die rosquetes, die bizcochos de Guatemala, die reyes frescos, Fisch wie den bonito, die cojinova und die pejerreyes. Es waren die ältesten Klänge in den Straßen von Lima. Ganz zu schweigen von denen der causera mit ihren Kartoffeltörtchen, dem frutero mit seinem Obst, der picaronera mit ihren Süßkartoffel-Kürbis-Ringen, der tamalera mit ihren Maispasteten oder der tisanera mit ihrem Kräutergetränk.
Daran musste er denken, und er war so ergriffen, dass ihm die Tränen kamen. Die tiefsten Schichten dessen, was Peru als Nation ausmachte, dieses Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft, zusammengehalten von ein und denselben Nachrichten und Verordnungen, sie waren durchdrungen von volkstümlicher Musik und volkstümlichen Gesängen. Das sollte der erhellende Grundton einer Dissertation sein, die in einer Vielzahl vollgeschriebener Karteikarten und Hefte vorangekommen war, alle akkurat aufbewahrt in einem kleinen Koffer; bis zu jenem Tag, als Professor Morones in den Ruhestand trat und ihm mit tiefbetrübter Miene mitteilte, dass die San Marcos entschieden habe, nicht ihn zu seinem Nachfolger zu berufen, sondern den Lehrstuhl für die peruanische Folklore zu schließen. Es war kein Pflichtfach, und aus unerklärlichen Gründen, wahrlich unerhört, schrieben sich jedes Jahr weniger Interessierte aus der Geisteswissenschaftlichen Fakultät ein. Der Mangel an Studenten bedeutete das traurige Aus.
Die Wut, die Toño Azpilcueta packte, als er erfuhr, dass er niemals Professor an der San Marcos würde, war so groß, dass er schon daran dachte, sämtliche in seinem Koffer verstauten Karteikarten und Hefte in tausend Stücke zu reißen. Zum Glück tat er es nicht, sehr wohl aber verabschiedete er sich von seinem Dissertationsvorhaben und seinem Traum von einer akademischen Karriere. Was ihm blieb, war allein der Trost, dass er zu einem echten Experten für Volksmusik und Volkstänze geworden war oder, wie er es nannte, zu einem »proletarischen Intellektuellen« der Folklore. Aber woher wusste Toño Azpilcueta so viel über peruanische Musik? Unter seinen Vorfahren war niemand, der Sänger oder Gitarrist gewesen wäre, und schon gar kein Tänzer. Sein Vater, ein Auswanderer aus einem kleinen italienischen Dorf, war Angestellter bei der Eisenbahn des zentralen Hochlands und sein Leben lang unterwegs gewesen, während seine Mutter in den Hospitälern ein und aus ging, um sich von allerlei Leiden zu kurieren. Sie starb eines unbestimmten Tages, als er noch ein Kind war, und seine Erinnerung beruhte mehr auf den Fotos, die sein Vater ihm gezeigt hatte, als auf eigenem Erleben. Nein, in der Familie gab es keine Vorgeschichte. Im Alter von fünfzehn Jahren begann er ganz allein, Artikel über die Folklore des Landes zu schreiben, denn er hatte begriffen, dass er die Gefühle, die die Akkorde eines Felipe Pinglo Alva und all die Sänger der kreolischen Musik in ihm weckten, in Worte fassen musste. Womit er im Übrigen recht erfolgreich war. Seinen ersten Artikel schickte er an eine der kurzlebigen Zeitschriften, die in den Fünfzigerjahren erschienen. Er versah ihn mit der Überschrift »Mein Peru«, schließlich ging es darin um das kleine Haus von Felipe Pinglo Alva in Cinco Esquinas, das er besucht hatte, Notizbuch und fleißige Feder in der Hand. Für den Text zahlte man ihm zehn Sol, was ihn schon zu der Annahme verleitete, er sei nun der beste Kenner der volkstümlichen peruanischen Musik und ihrer Tänze. Das Geld gab er, wie auch seine sonstigen Ersparnisse, auf der Stelle für Schallplatten aus. So machte er es mit jedem einzelnen Sol, der ihm in die Hände kam, er investierte ihn in Musik, und bald war seine Plattensammlung in ganz Lima bekannt. Radiosender und Zeitungen liehen sich Schallplatten bei ihm aus, aber da er sie nur selten zurückbekam, zeigte er sich zwangsläufig knausrig. Bald behelligten sie ihn nicht länger, ohnehin hatte er seine wertvolle Sammlung längst gegen Baumaterial für ein Häuschen in Villa El Salvador getauscht. Was ihn nicht bekümmerte, denn die Musik, sagte er sich, trug er weiter im Blut und im Gedächtnis, und das reichte aus, um seine Artikel zu verfassen und das geistige Erbe des berühmten Mannes aus Puno, Hermógenes A. Morones, Friede seiner Seele, auf immer zu bewahren.
Seine Leidenschaft war einzig und allein geistiger Natur. Toño selbst war weder Gitarrist noch Sänger, nicht einmal Tänzer. Dass er nicht tanzen konnte, brachte ihn als jungen Mann nicht selten in Verlegenheit. Denn gerade beim Besuch einer Peña oder einer Tertulia, in einem der Clubs oder bei diesen geselligen Zusammenkünften, zu denen er immer mit einem kleinen Notizbuch in der Anzugtasche erschien, kam es vor, dass ihn die eine oder andere Dame aufforderte, und dann machte er mehr schlecht als recht ein paar Schritte zu einem Vals, vorausgesetzt, es war ein eher einfacher, nie aber zu den Marineras, den Huainitos oder diesen Tänzen aus dem Norden, den Tonderos aus Piura, oder den Polkas. Er hatte seinen Körper nicht im Griff, stolperte über die eigenen Füße, fiel sogar einmal hin – was für eine Blamage –, weshalb er lieber den zweifelhaften Ruf pflegte, nicht tanzen zu können. Er blieb sitzen, vertieft in die Musik, und beobachtete, wie die unterschiedlichsten Männer und Frauen aus ganz Lima in einträchtiger Umarmung verschmolzen, in einem Miteinander, das bestätigte, was er in seinem tiefsten Inneren schon erfasste.
Mochten die peruanischen Intellektuellen, die Professuren bekleideten oder in angesehenen Verlagen veröffentlichten, ihn auch verachten oder erst gar nicht zur Kenntnis nehmen, Toño fühlte sich nicht kleiner als sie. Vielleicht wusste er nicht viel von der Weltgeschichte und war auch nicht im Bilde über die französischen philosophischen Moden, aber er kannte die Musik und die Texte aller Marineras, Pasillos und Huainitos. Er hatte zahlreiche Artikel geschrieben für Mein Peru, Die peruanische Musik, Heimische Folklore, für diesen bunten Strauß an Publikationen, die es nur bis zur zweiten oder dritten Ausgabe schafften und dann verschwanden, oft hatten sie ihm nicht einmal das bisschen gezahlt, das sie ihm schuldeten. Ein »proletarischer Intellektueller«, und wennschon. Vielleicht hatte er sich bei Intellektuellen wie José Durand Flores (warum der wohl nach ihm suchte?) nicht den nötigen Respekt erworben oder auch nur Interesse geweckt, sehr wohl aber bei den Sängern oder Gitarristen selbst, denen daran gelegen war, bekannt und gefördert zu werden, und genau das hatte Toño Azpilcueta jahrelang getan, bezeugt von den Hunderten von Zeitungsausschnitten, die er in ebenjenem Koffer lagerte, in dem seine Notizen für die Dissertation vor sich hin gammelten. Einige der Artikel bewahrten die Erinnerung an die Peñas mit ihrer kreolischen Musik, die nun verschwunden waren, La Palizada etwa oder La Tremenda Peña, zwei Lokale am Puente del Ejército. Zum Glück war Toño Zeuge dieser Abende gewesen. Schon als Jugendlicher besuchte er sie alle in Lima. Er begann mit fünfzehn, als er noch fast ein Kind war, und er erinnerte an sie, damit ihre einst bedeutende Rolle nicht in Vergessenheit geriet. Gelegentlich wandte sich ein Journalist an ihn, der etwas über Lima schreiben wollte, und dann verabredete er sich mit ihm im Bransa an der Plaza de Armas zum Frühstück. Es war sein einziges Laster, Frühstücken im Bransa, das Geld dafür musste er sich manchmal von seiner Frau Matilde leihen.
Seine eigentlichen Einkünfte verschaffte ihm der Zeichen- und Musikunterricht am Colegio del Pilar, einer Nonnenschule im Viertel Jesús María. Sie zahlten ihm nur wenig, aber dafür durften seine beiden Töchter, Azucena und María, zehn und zwölf Jahre alt, die Schule kostenlos besuchen. Er war dort schon mehrere Jahre tätig, und so ungern er Zeichnen unterrichtete, konnte er sich doch die meiste Zeit der Musik widmen, der kreolischen natürlich, womit er der grundlegenden pädagogischen Aufgabe gerecht wurde, die Liebe zu den peruanischen Traditionen zu vermitteln. Das einzige Problem waren die riesigen Entfernungen in Lima. Das Colegio del Pilar lag weit von seinem Wohnviertel entfernt, was hieß, dass er und seine beiden Töchter jeden Tag mehrere Sammeltaxis nehmen mussten, um hinzugelangen. Mehr als eine Stunde Fahrt, wenn nicht gerade Streik war.
Seine Frau hatte er kennengelernt, kurz bevor sie ihr Häuschen auf dem großen freien Feld bauten, das Villa El Salvador damals war. Wer hätte gedacht, dass in dem entlegenen Vorort einmal Gruppen des Sendero Luminoso auftauchen würden, Mitglieder dieses »Leuchtenden Pfads«, um jene, die dort das Heft in der Hand hatten, zu verdrängen und die Bewohner zu kontrollieren, selbst führende Persönlichkeiten der Linken wie María Elena Moyano, eine mutige Frau, die erst vor ein paar Monaten, nachdem sie die Willkür und den Fanatismus der Senderistas angeprangert hatte, bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung im Viertel auf brutalste Weise ermordet worden war. Matilde hatte sich, seit sie hergezogen waren, den Lebensunterhalt als Wäscherin und mit dem Flicken und Stopfen von Hemden, Hosen, Kleidern und sonstigen Wäschestücken verdient, ein Beruf, der ihr das nötige Kleingeld fürs Essen der Familie einbrachte. Ihre Ehe funktionierte leidlich und war Garant nicht unbedingt für ein erfülltes, aber doch immerhin ein Leben. Sie hatten ihre schönen Momente gehabt, vor allem am Anfang, als Toño noch dachte, er könnte seine Leidenschaft für die Musik mit ihr teilen. Er hatte ihr den Hof gemacht, hatte ihr Akrostichen geschickt, in denen er sich die feurigsten Verse seiner liebsten Valses zu eigen machte, und er dachte schon, mit diesen Worten aus den Tiefen der volkstümlichen Empfindsamkeit hätte er ihr Herz erobert. Doch bald merkte er, dass sie bei den Akkorden der Gitarre nicht so ergriffen war wie er, dass ihr der Atem nicht stockte, wenn Felipe Pinglo Alva mit seiner samtenen Stimme diese Strophen sang, in denen es um den bitteren Schmerz der unerwiderten Liebe ging. Als es ihm zur Gewissheit wurde, dass sie sich, statt bei der Musik zu erschauern und von einem besseren und einträchtigeren Leben zu träumen, nur langweilte, nahm er sie nicht mehr mit zu den Peñas und Tertulias, und mit der Zeit begann er, sein Leben allein zu leben, und erzählte ihr nicht einmal, was er machte oder wohin er an den Wochenenden ging. Es waren im Allgemeinen keusche Ausflüge, bei denen er sich nur hier und da mit jemandem unterhielt, kreolische Musik hörte, neue Stimmen und neue Gitarristen entdeckte – alles festgehalten in seinen Notizbüchern – und dabei auch die Tänzerinnen und Tänzer mit ihren verrückten Figuren bewunderte. Er trank nicht mehr so viel wie früher, zumal er inzwischen schon fünfzig war und der Alkohol seinem Magen zusetzte, nur noch ein Fläschchen Pisco oder – wenn er mal über die Stränge schlug – Zuckerrohrschnaps. In diesem Milieu konnte Toño seine Autorität ausspielen, denn meist wusste er mehr als die anderen, und wenn sie ihm Fragen stellten, wurde es ringsum still, als kämen seine Antworten aus dem Mund eines Universitätsprofessors. Zwar hatte er kein einziges Buch veröffentlicht, und seine gewissenhaften Artikel weckten allenfalls die Neugier einiger weniger, nie das Interesse der erlauchten Gelehrten, doch in diesen dunklen kolonialen Häusern, geschmückt mit Stichen der verschleierten Frauen von Lima und Nachbildungen der Balkons mit Gitterfenstern, worin das echte Peru noch zu spüren war, sein reinster und authentischster Duft, an diesen Orten genoss niemand ein größeres Ansehen als er.
Wenn sein Gemüt einer Aufmunterung bedurfte, sagte er sich, dass er das Buch über die Pregones von Lima fertigstellen und promovieren würde, und sicherlich würde er auch einen Verlag finden, der ihm die Publikation finanzierte. Dieser Gedanke – den er manchmal wie eine Art Mantra wiederholte – hob zuverlässig seine Stimmung. Er war jetzt durch die erdigen Straßen von Villa El Salvador gelaufen und sah schon in der Ferne sein Haus und gegenüber das Lokal mit Kiosk seines Kumpels Collau. Nach weiteren fünfzig Metern konnte er erkennen, wie Mariquita, die älteste Tochter der Collaus, ihm entgegenkam.
»Was gibt's, meine Kleine?«, sagte Toño und gab ihr einen Kuss auf die Wange.
»Wieder ein Anruf für Sie«, antwortete Mariquita. »Derselbe Mann, der gestern angerufen hat.«
»Doktor José Durand Flores?«, fragte er und rannte los, nicht dass aufgelegt wurde, bevor er Collaus Pulpería erreicht hatte.
»Es ist schwerer, Sie anzutreffen als den Präsidenten der Republik«, sagte eine allzu vertrauliche Stimme am Telefon. »Ich spreche mit dem Herrn Toño Azpilcueta, richtig?«
»Am Apparat«, sagte Toño. »Doktor Durand Flores, ja? Es tut mir leid, dass Sie mich gestern nicht erreicht haben. Ich habe versucht zurückzurufen, aber ich glaube, Mariquita, die kleine Tochter eines Freundes, hat sich die Nummer nicht richtig gemerkt. Was kann ich für Sie tun?«
»Ich wette, Sie haben noch nie von Lalo Molfino gehört«, antwortete die Stimme im Hörer. »Oder irre ich mich?«
»Nein, nicht … Lalo Molfino, sagten Sie?«
»Er ist der beste Gitarrist Perus und vielleicht der ganzen Welt«, sagte Dr. José Durand Flores mit großer Bestimmtheit. Er hatte eine feste, drängende Stimme. »Ich rufe an, weil ich Sie für heute Abend zu einer Tertulia einladen möchte, bei der Lalo Molfino spielen wird. Sie müssen unbedingt kommen. Haben Sie etwas, um die Adresse zu notieren? Es wird in Bajo el Puente stattfinden, in der Nähe der Arena. Können Sie es einrichten?«
»Jaja, natürlich«, antwortete Toño, er war neugierig, aber auch überrascht, dass ein Musiker, noch dazu ein angeblich so talentierter, seinem Radar entgangen war. »Lalo Molfino … Nein, nie gehört. Aber mit dem größten Vergnügen. Sagen Sie mir bitte die Adresse. Heute Abend also, so gegen neun?«
Toño Azpilcueta beschloss hinzugehen, mehr daran interessiert, Dr. Durand Flores kennenzulernen als diesen Lalo Molfino, dabei konnte er nicht ahnen, dass die Einladung ihm etwas offenbaren sollte, was für ihn bisher nur eine Intuition gewesen war.
II
Es sind recht alte Anlagen, die ältesten von vor hundert oder zweihundert Jahren. Die Architekten oder Baumeister wollten Wohnungen für die Armen bauen oder für Menschen mit nur wenig Geld, die Zimmer klein und ohne jede Sorgfalt im Akkord errichtet, gedeckt mit einem Wellblechdach und beiderseits eines langen Hofgangs, wo es immer einen Hahn gab, aus dem das Wasser kam (manchmal schmutziges) und vor dem die Bewohner Schlange standen, um sich das Gesicht oder den Körper zu waschen (wenn sie reinlich waren) und Flaschen oder Eimer mit frischem Wasser zu füllen, mit dem sie kochten und ihre Kleidung wuschen.
Versteht sich, dass Limas Hinterhofkolonien, die legendären callejones, auch ein einziges Gewimmel von Ratten waren, ein ernstes Problem für all jene, die von den widerlichen Viechern betroffen sind und unter ihnen leiden. Es gibt eine bekannte Beschreibung der Callejones von Lima aus dem Jahr 1907 von Abelardo Gamarra, dem großartigen »Schriftsteller des Volkes«, genannt El Tunante, worin er die geistigen und körperlichen Schäden vor Augen führt, die diese ruchlosen Exemplare anrichteten.
Die ältesten Callejones gab es wahrscheinlich schon zu Kolonialzeiten, in Malambo und Monserrate, doch im frühen 19. Jahrhundert, als General San Martín die Unabhängigkeit ausrief, strömten immer mehr Menschen ins Zentrum von Lima, ebenso in fast alle anderen Viertel, vor allem nach Rímac, Bajo el Puente und Barrios Altos. Perus Hauptstadt füllte sich mit mittellosen Menschen, die sich dort niederließen, weil es in der großen Stadt leichter war als in den Provinzen, Arbeit zu finden, sei es als Köchin, Pförtner, Leibwächter oder Dienstpersonal. Missgünstige Zeitgenossen sagten, die Callejones würden auch Kriminelle und zwielichtige Gestalten aus dem alten Lima anlocken, aber das war ein wenig übertrieben.
Fast alle Viertel im Zentrum der Hauptstadt, oder zumindest die ältesten, hatten Callejones mit ihren vielen kleinen Zimmern entlang einem schmalen Hof, von den Eigentümern verkauft oder vermietet an Familien, die dort mit mehreren Personen wohnten – Eltern und ihre Kinder, Fremde natürlich auch – und die manchmal auf Matratzen auf dem Boden schliefen oder, sofern das Einkommen es hergab, in Betten mit zwei oder auch drei Etagen, welche die Bewohner aus Brettern und Stangen und mit einer kleinen Leiter selbst zusammenbauten. Schwer begreiflich, wie in diese armseligen, wenn auch achtbaren Löcher so viele Menschen hineinpassten, von den Großeltern und Urgroßeltern bis hin zu den Jüngsten. Sie waren sowohl eine Nische, in der das volkstümliche Herz schlug, als auch ein Ort schrecklichen Gedränges, denn sie begünstigten die Ausbreitung von Seuchen und forderten unter den Bewohnern zahlreiche Opfer.
Niemand hätte sich vorstellen können, dass die Callejones einmal zu dem Ort schlechthin würden, an dem die volkstümliche peruanische Musik ihre Heimat fände, insbesondere der Vals, der auf natürliche Weise gespielt und gesungen wurde, ohne Mikrofon, klar, ohne Bühne für die Kapelle oder eine Tanzfläche. Denn dort feierte man die berühmten feuchtfröhlichen jaranas – das Wort entstand zweifellos mit dieser Musik –, und man tanzte die Zamacueca, später dann die Marinera und den Vals, bei diesen verrückten Festen, die, angeheizt durch Pisco pur, Zuckerrohrschnaps aus der Sierra und gar einem guten Wein aus den Keltereien von Ica, manchmal über zwei oder drei Tage gingen, Hauptsache, der Körper machte mit. Aber wie haben die Bewohner der Callejones das angesichts ihrer dürftigen wirtschaftlichen Verhältnisse geschafft? Rätsel und Wunder der peruanischen Armut.
Dort in den Callejones kamen die ersten großen Gitarristen und Cajónspieler Perus auf die Welt, ebenso die besten Tänzer der Valses, Huainitos, Marineras und Resbalosas. Während die jungen Damen aus gutem Hause Tanzunterricht nahmen – die Lehrer waren meist Schwarze –, brachten Interpreten-Duos wie die berühmten Montes und Manrique, Salerno und Gamarra oder Medina und Carreño die strengen Winternächte von Lima in Schwung und gönnten sich im Sommer eine Erfrischung, wenn nur die Kleidung variierte und die Menge an Alkohol, mit der sie anstießen. Männer und Frauen waren glücklich, aber sie starben jung, nicht selten an den obskuren Seuchen, welche die widerlichen Ratten, die in den Ritzen von Barrios Altos nisteten, an ihren ekelhaften Pfoten, ihren kranken Schnauzen und in ihrem schmierigen und stinkenden Fell herbeischleppten.
In den Callejones gedieh aber auch eine gute Nachbarschaft, die Menschen schlossen Freundschaft, halfen einander bei Krankheit und im Alltag, liehen sich Sachen aus, feierten die Geburt eines neuen Bewohners, luden sich gegenseitig ein, sodass eine Art Gemeinschaftssinn entstand, befördert nicht zuletzt durch das Prekäre eines Lebens ohne Zukunft. In Lima waren die Callejones bekannt dafür, mit welcher Leichtigkeit sich diese Bindungen ergaben, wozu es unter denen, die besser lebten als die Armen, im Allgemeinen nicht kam. Und so waren die Callejones und die kreolische Musik für die etwa siebzigtausend Limeños (nennen wir sie so), die in ihnen lebten, untrennbar miteinander verknüpft, auch wenn die meisten callejoneros, die Bewohner dieser Hinterhofgänge, von überall her im Landesinneren kamen.
Callejones gab es in ganz Lima, aber die Schwarzen (oder morenos, Dunkelhäutigen), viele von ihnen freie oder geflüchtete Sklaven, hatten ihre eigenen immer in Malambo, wo sich ihre Familien wieder versammelten. Die Jaranas, die an diesem Ort mit dem sinnenfrohen Namen gefeiert wurden, waren die bekanntesten, wegen des Zapateos, einer Art Stepptanz, der großartigen Stimmen, der hervorragenden Gitarristen und weil es dort die besten Musiker am Cajón gab, an dieser von den Armen erfundenen Kistentrommel, es war das verwegenste und genialste aller Instrumente, die sich die Peruaner zur Begleitung des Vals ausdachten; und weil der Eifer, mit dem die Menschen an den Jaranas teilnahmen, dazu führte, dass sie über viele Stunden gingen, manchmal Tage, ohne dass sich irgendwer zum Ausruhen verabschiedete. Felipe Pinglo Alva, der große kreolische Komponist, ging oft zu den Festen in den Callejones von Lima, aber er zog sich früh zurück – na ja, früh, wie man so sagt –, weil er am nächsten Tag zur Arbeit musste. Von ihm heißt es, er habe bis zu seinem Tod mehr als dreihundert Stücke komponiert.
Wer hätte gedacht, dass die Callejones von Lima einmal zur natürlichen Heimat des Vals würden, dass diese Musik dort erblühen und mit der Zeit hineinwachsen würde ins gesellschaftliche Leben, bis sie auch von der Mittelschicht akzeptiert wurde und später sogar Einzug hielt in die Salons des Adels, im Gefolge der jungen Leuten, für die die spanische Musik zunehmend etwas Altmodisches und Langweiliges hatte, zumal im Vergleich zur peruanischen und zu diesen Texten mit all ihren Bezügen zur eigenen Welt, zu den lokalen Sitten und Gebräuchen. Mit der Ausbreitung der kreolischen Musik verschwanden auch die Tanzlehrer, sie mussten ihren Beruf wechseln, wenn sie nicht verhungern wollten.
Die Callejones von Lima waren die Wiege einer Musik, die man, drei Jahrhunderte nach der Conquista, als echte peruanische bezeichnen konnte. Unnötig zu sagen, dass sie für den stolzen Verfasser dieser Zeilen das Erhabenste ist, was die Welt Peru verdankt. In den Vielfamilienhöfen gab es Ratten, aber eben auch Musik, und das eine entschädigte für das andere.
Bevor die Callejones entstanden, amüsierte sich Lima bereits beim Karneval, bei den carnestolendas, wenn quer durch die Stadt das Wasser spritzte und die Passanten klatschnass wurden, die oft ihrerseits anfingen, mit den Straßenjungen zu spielen und es ihnen heimzuzahlen. Aber neben dem Karneval gab es auch die retretas, Umzüge mit Musikkapellen oder Straßenkonzerte zur Feier von Geburtstagen der Verlobten, Eltern, Geschwister und Freunde, Feste, die die Abende von Lima mit Gitarrenklängen und Gesang erfüllten. Das heißt, bevor der Brauch aufkam, zur Pampa de Amancaes hinaufzuziehen, vergnügten sich die Einwohner Limas bereits auf vielfältige Weise, und der größte Quell der Freude war vielleicht der Baile de los Diablitos, der Tanz der Teufelchen, von dem keine Spur geblieben ist, auch wenn er, laut Schreibern und Chronisten, seinerzeit sehr beliebt war.
Was für eine Stadt war das damalige Lima? César Santa Cruz Gamarra, der bekannte Verseschmied, erinnert in seinem charmanten, 1977 erschienenen Buch El Waltz y el valse criollo (Der Walzer und der kreolische Vals) daran, dass 1908 in der Hauptstadt Perus eine Volkszählung durchgeführt wurde, die für Lima eine Einwohnerzahl von 140 000 ergab, verteilt, nach der damals üblichen Klassifizierung, wie folgt: weiße Bevölkerung 58 683, mestizische 48 133, indianische 21 473, schwarze 6763 und gelbe 5487. Es handelte sich also um eine noch kleine Gesellschaft, in der gemäß den Vorurteilen der Zeit Weiße und Indigene, Schwarze und die wenigen Menschen asiatischer Herkunft nebeneinanderher lebten und wo, wie Santa Cruz Gamarra schreibt, das beliebteste Musikinstrument die Mundharmonika war, abgesehen vom Pfeifen, das die Bewohner Limas lauthals praktizierten, wenn sie durch die Straßen liefen. Laufen war nämlich der populärste Sport, da allen zugänglich. Schon damals traten der Vals und die Marinera allmählich an die Stelle der Zamacueca als meistgehörte Musik, so auch bei den musikalischen Darbietungen der Militärkapellen auf den Plätzen der Stadt.
In diesen Jahren zu Beginn des 20. Jahrhunderts engagierte die Columbia Phonograph Company ein berühmtes Duo, Eduardo Montes und César Augusto Manrique, und holte die beiden nach New York, um dort Platten mit peruanischen Liedern aufzunehmen, darunter viele Tonderos und Resbalosas, wofür die örtliche Presse sie feierte.
Der Raum, den die Hauptstadt Perus damals einnahm, war ebenfalls recht klein. Eine Straße wie die Colmena gab es noch nicht, auch keine Plaza San Martín, keinen Parque Universitario. Mangels Verkehrsmitteln waren die Viertel am Stadtrand noch nicht gewuchert. Aber in dieser nach wie vor kleinen Stadt ereignete sich das vielleicht außergewöhnlichste soziale Phänomen: das Aufkommen des Vals, der sich innerhalb weniger Jahre durchsetzen sollte und zur repräsentativsten Musik der gesamten Gesellschaft wurde. Die Vals-Stücke traten an die Stelle aller anderen Musik, die um die Gunst der Menschen buhlte, und etablierten sich auf natürliche Weise, ohne dass irgendwer es beschlossen oder befördert hätte, es war allein die Begeisterung der großen Mehrheit unserer Landsleute, und darauf konnten sie stolz sein.
III
An diesem Abend ging Toño Azpilcueta, nachdem er sich das Gesicht gewaschen und seinen besten Anzug mit Kragenhemd und blauer Krawatte angezogen hatte – es war der einzige elegante Anzug, den er besaß, reserviert für wirklich wichtige Anlässe –, aus dem Haus und machte sich auf den Weg von Villa El Salvador nach Bajo el Puente, dem alten kolonialen Bezirk von Lima. Dort war er einmal überfallen worden, mindestens zehn Jahre war das her. Friedlich und in aller Ruhe hatte er seine Brieftasche ausgehändigt, doch die messerschwingenden Halunken fanden darin nicht mehr als einen Zehn-Sol-Schein. Sie waren enttäuscht, steckten ihn aber natürlich ein, und Toño musste mit einem Taxi nach Hause fahren und es mit dem bisschen Geld bezahlen, das er in einem blauen Täschchen aufbewahrte, versteckt unterm Bett.
Seit dem Überfall verspürte Toño eine gewisse Abneigung gegen Bajo el Puente, den Bezirk »unter der Brücke«, trotz seines kolonialen Charmes und des imposanten Paseo de Aguas. Aber von wegen »Aguas«. Allein schon den Rímac »Wasser« zu nennen, diesen schwindsüchtigen Fluss, der zwischen den Felsen und Sandhäufchen seine jämmerlichen Reste durchs Bett zog und nahe dem Kloster der Unbeschuhten und den halb verfallenen großen Häusern und Palästen verlief, schien ein Witz zu sein. Dann kam der Paseo de Amancaes, kamen die Bettler und die Plaza de Acho, über die in den Monaten Oktober und November mit dem alljährlichen Fest das Leben hereinbrach, mit den Stierkämpfen vor allem und den vielen Peñas, die in der Gegend florierten.
Er hatte keine Schwierigkeiten, das Haus zu finden, wo der Abend stattfand, und natürlich erkannte er auch viele der Anwesenden. Es war nicht irgendein Haus, sondern ein altes prachtvolles mit zwei Geschossen und vielen Räumen, eines der wenigen, die in dem kolonialen Viertel noch erhalten geblieben waren, wo man die meisten von ihnen geteilt und wieder geteilt hatte, bis sie Bienenstöcken glichen. Es waren viele Menschen da, Männer wie Frauen, mehr als die üblichen Peñas und Tertulias versammelten, und sie tranken die Schlückchen Pisco, die Dr. José Durand Flores, wie auf den Fotos in Hemdsärmeln und mit Brille, austeilte und zugleich mittrank. »Zum Wohlsein, mein Lieber, Prost, Prösterchen«, und schon kippte er das nächste Glas in sich hinein. Als er vor Toño stand, begrüßte er ihn so herzlich, als wären sie alte Freunde.
»Machen Sie sich gefasst auf das, was Sie gleich hören werden, mein Freund. Ich kann Ihnen sagen, dieser Junge, Lalo, ist ein wahres Ausnahmetalent auf den Saiten seiner Gitarre.«
Toño hätte gern ein paar Worte mit ihm gewechselt, aber Dr. Durand Flores schien sich mit seiner Anwesenheit zufriedenzugeben und fühlte sich nicht verpflichtet, ein Gespräch zu beginnen. Er schenkte ihm einen Pisco ein, ermunterte ihn, das Glas auf ex zu trinken, und begrüßte weitere Gäste. Toño Azpilcueta stand mit offenem Mund da und bereute schon, gekommen zu sein. Zuerst spielten ein paar kreolische Gruppen, Toño kannte die Musiker bestens, schließlich hatte er sich in seinen Artikeln für sie eingesetzt. Inzwischen saß er auf einer Bank, die sich um ein kleines Wasserbecken zog, Pflanzen und Blumen schwammen darin. Er war es leid, so vielen Leuten die Hände zu schütteln und sie zu umarmen, Menschen, die er kannte und die, vom Pisco schon besäuselt, auf ihn zutraten. Er wollte sich gerade ein wenig entfernen, um alkoholisierten Unterhaltungen aus dem Weg zu gehen, als er sah, wie Dr. Durand Flores in der Menge wieder auftauchte und in die Hände klatschte, Schweigen gebot, er habe etwas zu sagen. Und mit einer Stimme, die ein Zuviel an Alkohol verriet, sagte er, es sei ihm eine Freude, dem Publikum, dem »hochmögenden Publikum«, denn an diesem Abend erklinge das Beste der kreolischen Musik, einen jungen Gitarristen aus Chiclayo vorzustellen, der »ein wahres Ausnahmetalent« sei. Er sei eben erst nach Lima gekommen, daher kenne ihn noch niemand. Dann bat er um Applaus. Und erklärte, für das Ensemble Perú Negro beginne eine neue Etappe, um die Musik der Afroperuaner im Ausland bekannt zu machen, ihre erste Station werde Santiago de Chile sein. Lalo Molfino war offensichtlich das neue Mitglied der Truppe. Und dann hob er die Hand wie ein Priester, der den Segen spendet, und rief: »Ehrfurcht und Stille!« Und schwieg.
Die Lichter gingen aus, eine einzige Glühbirne blieb an und beleuchtete ein Fleckchen in diesem Innenhof. Darauf erschien die Person, die nach den Worten von Dr. Durand Flores zum Ruhm bestimmt war. Was Toño Azpilcueta als Erstes auffiel, ein Detail, das er nie vergessen würde, waren die Lackschuhe des jungen Mannes aus Chiclayo. Natürlich ohne Socken. Die Schuhe waren wie ein Markenzeichen, gleichsam seine Visitenkarte. Er trug einen Anzug, der ihm zu klein war, oder zumindest die Hose, sie ging ihm nur bis zu den Waden, dazu ein geblümtes Hemd mit sehr kurzen Ärmeln. Er hatte ein ernstes, recht dunkles Gesicht und krauses Haar, wie man es auf der Straße nicht mehr sah: lang, sehr schwarz und mit untergemengtem Grau. Wenn er den Mund aufmachte, zeigte er strahlend weiße Zähne. Er blickte finster und sagte keinen Ton, nicht einmal, um sich für den spärlichen Applaus, mit dem man ihn empfing, zu bedanken. Als er dann auf seinem Stuhl saß und die Gitarre stimmte, wanderten seine Augen immer wieder durch diesen Garten voller Gäste.
Kaum hörte Toño Azpilcueta die ersten Akkorde, schaute er nicht länger auf die Lackschuhe an den Füßen des Gitarristen. Und etwas Seltsames geschah. Der Ärger über die Gleichgültigkeit, mit der Dr. Durand Flores ihm begegnet war, verflog, und alles um ihn herum erlosch, bis es nur noch die Gitarre gab, die der Junge – denn der dort spielte, war noch sehr jung – zum Seufzen brachte, zum Weinen, zum Auf- und Abschwellen, und das auf eine Weise, wie Toño Azpilcueta es noch nie gehört hatte, er, der alle professionellen Gitarristen in Lima gehört hatte, die bekanntesten und die am wenigsten bekannten und natürlich auch »die erste Gitarre Perus«, Óscar Avilés, dieses Mannsbild mit dem gestutzten Bärtchen.
Die Stille legte sich über das Grün des Patios, über das ganze große Haus. Eine Stille der Stierkampftage, dachte Toño Azpilcueta, eine Stille, die nur durchbrochen wurde vom Klang der Saiten, wie die Stille an jenem Sonntagnachmittag in der Plaza de Acho – er vergaß ihn nie – während des Festes im Oktober jenes Jahres, 1956 oder 1957, als sein Vater, der Italiener, ihn zu einer Corrida mitgenommen hatte, der ersten seines Lebens, bei der er sah, dass Procuna, der mexikanische Torero, tatsächlich sehr ungleich in der Arena kämpfte, ein Mann der Extreme, denn an manchen Nachmittagen rannte er panisch und ohne jede Scham vor den Stieren davon und überließ das Geschäft seinen Gehilfen, an anderen flogen ihm der Mut und die Kunst nur so zu, und er näherte sich dem Tier auf eine Weise, dass den Zuschauern auf den Sperrsitzen schwindlig wurde.
Er war zwar fast jedes Jahr zu den Corridas in Lima gegangen – die Liebe zum Stierkampf war von klein auf in ihm gewachsen –, doch glaubte er nicht, jemals wieder eine solch tiefe, ekstatische Stille gehört zu haben, die Stille einer ganzen Arena, die, in Erwartung aufgelöst, verstummte, das Atmen einstellte, das Denken, die sich vergaß und reglos, gebannt, berauscht das Wunder sah, das dort unten geschah, wo Procuna, beseelt von Kunst, Mut und Weisheit, unendliche Male die Manöver mit der Muleta in seiner Linken ausführte und dann mit der Rechten wiederholte, jedes Mal näher an dem Stier, bis er mit ihm verschmolz. Jetzt fühlte er sich wieder wie an jenem Nachmittag, überwältigt von einem fast religiösen Gefühl, tief eingewurzelt, von ursprünglicher Art. Während der Junge aus Chiclayo die Saiten spielte und einer jeden außergewöhnliche, verblüffende, innige, schier verrückte Klänge entlockte, konnte Toño die Stille ringsum mit Händen greifen. Alle Anwesenden, Männer, Frauen, Alte, hatten das Gelächter hinter sich gelassen, die Zwiegespräche, Witze und Komplimente, waren verstummt und lauschten entrückt, wie hypnotisiert dem Schwingen der Saiten in diesem großartigen Schweigen, das den Abend dominierte.
Es war eine erhabene Stille, wie sie sich, hieß es, über die Arena von Sevilla oder Las Ventas in Madrid legte und die er als Kind fraglos in der Plaza de Acho vernommen hatte, und nun entsprang sie diesem jungen Zambo aus Chiclayo, den er dort vor sich sah, nur ein paar Schritte entfernt. Er spielte einen Vals, so viel war gewiss, aber Toño Azpilcueta erkannte ihn nicht, konnte ihn nicht identifizieren, denn unter Lalo Molfinos Wunderfingern ähnelten die Saiten nichts, was er je gehört hatte. Ihm war, als würde die Musik auf ihn übergreifen, in ihn eindringen und mit dem Blut durch die Adern strömen. Armer Óscar Avilés, die vermeintlich erste Gitarre Perus, mit einem Mal verdrängt.
Aber es war nicht nur die Fingerfertigkeit, mit der dieser Gitarrist Töne hervorbrachte, die neu zu sein schienen. Nein, es war mehr. Es war Weisheit, Konzentration, meisterliche Beherrschung, ein Wunder. Und es war nicht nur die tiefe Stille, es war auch die Reaktion des Publikums. Toños Gesicht war aufgelöst in Tränen, und seine Seele öffnete sich und wünschte sich nichts sehnlicher, als all diese Landsleute in einer großen Umarmung zu vereinen, Brüder und Schwestern, die das Mirakel bezeugten. Und nicht nur er war ergriffen. Mehrere andere holten ihre Taschentücher hervor, darunter auch Dr. Durand Flores. Er wollte auf ihn zugehen und ihn in die Arme schließen wie einen besten Freund, »mein Artgenosse!«, konnte er nur murmeln, ein Bruder, durch dessen Adern dasselbe Blut floss. Die Musik hatte die Seelen der Anwesenden so fest in ihren Bann gezogen, dass jeder soziale, ethnische, intellektuelle oder politische Unterschied in den Hintergrund trat. Der Innenhof des Hauses war wie elektrisiert von einer Welle des Miteinanders, es herrschte das Wohlwollen, die Liebe. Und dieses Empfinden, davon war er überzeugt, teilte er mit den anderen. Als Lalo Molfino sich von seinem Stuhl erhob, sehr aufrecht, sehr dünn, die Gitarre an sich gedrückt, um gleichgültig die Ovationen des Publikums entgegenzunehmen, glaubte er im Lächeln ringsum, in den leuchtenden Pupillen und geröteten Wangen deutliche Anzeichen einer geschwisterlichen Liebe zu erkennen, der Liebe zur Heimat.
Der junge Zambo aus Chiclayo verneigte sich und verschwand in einem der Flure des Hauses. Der Beifall hielt an, ein verzücktes Raunen mischte sich hinein. Toño Azpilcueta wollte diesem irdischen Wunder die Hand schütteln, ihm ein paar Fragen stellen. Er sah sich nach ihm um und fragte nach dem Jungen, aber niemand konnte ihm eine Antwort geben. Dr. José Durand Flores hatte sich wieder seinen Gästen zugewandt und schenkte ihnen, vor Glück strahlend, ein weiteres Schlückchen Pisco ein. Bei jedem Anstoßen verkündete er die Wiederauferstehung von Perú Negro und den baldigen Aufbruch der Gruppe nach Santiago de Chile. Toño Azpilcueta umarmte ihn und wünschte ihm alles Gute für die Reise. »So werden die Chilenen erfahren, was das echte Peru ist«, sagte er gerührt und verließ schweigend diesen Patio, das Haus in Bajo el Puente, das er bis ans Ende seines Lebens nicht vergessen würde. Jetzt konnte er zufrieden nach Hause zurückkehren und über den Artikel nachdenken, den er noch am Abend zu schreiben gedachte, vielleicht auch morgen früh, in der Nationalbibliothek im Zentrum der Stadt, direkt an der Avenida Abancay. Dorthin ging er oft, um seine Kritiken zu schreiben und die Zeitungen zu lesen. Den Titel hatte er schon: »Und es wurde still unter der Brücke.«
In der Nacht dachte er weder an Ratten noch an gespenstische Nagetiere, befürchtete nicht, dass sie sich, wie es manchmal passierte, in seine Träume schlichen und ihm den Schlaf raubten. Und im Bett liegend, die Augen an die Decke gerichtet, war er immer noch hingerissen von dem Erlebnis, Lalo Molfino zu hören. Neben ihm schlief Matilde mit offenem Mund und wälzte sich herum, so wie jede Nacht. Er schaute zu ihr hinüber, und für einen Moment kam sie ihm so schön vor wie Cecilia Barraza. Er beugte sich über sie, wollte sie wecken, ihr Küsschen geben, auf die Wange, den Hals, fest entschlossen, so schwungvoll wie früher mit ihr zu schlafen, aber Matilde ging nicht darauf ein. Im Halbschlaf fuchtelte sie mit der Hand, als wollte sie im Albtraum einen Zudringling verscheuchen, und drehte sich schimpfend auf die andere Seite. Toño Azpilcueta nahm es gelassen. Er hatte Lalo Molfino gehört. Er würde etwas Schönes träumen, und morgen würde er den besten Artikel seines Lebens schreiben.
IV
Kaum war der vals criollo