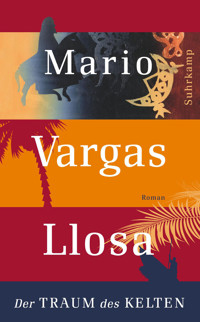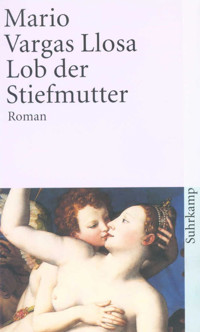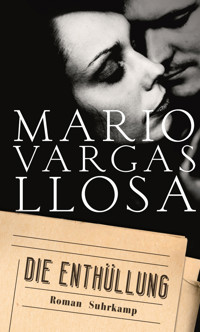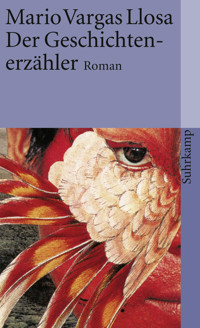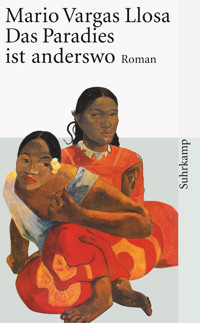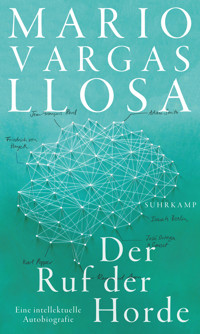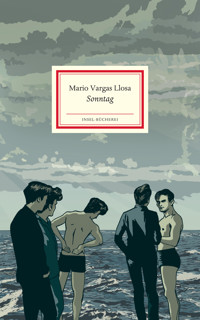11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Harte Jahre ist ein vielstimmiges Romanepos über Macht, Verschwörung und Verrat – über die Fallstricke der Geschichte und die dreisten Machenschaften imperialer Politik. Und ein virtuoser literarischer Hochseilakt.
Im Jahr 1954 bringt ein Militärputsch die Regierung Guatemalas zu Fall, mit freundlicher Unterstützung des CIA. Und zwar vermittels einer dreisten Lüge, die als Wahrheit durchgeht: US-Präsident Eisenhower hatte in Umlauf gebracht, Guatemalas Präsident Árbenz billige und unterstütze die Ausbreitung des sowjetischen Kommunismus auf dem Kontinent. Eine Lüge, die das Schicksal ganz Lateinamerikas verändern wird. Diese folgenreiche historische Episode – die uns schmerzlich an unsere Gegenwart erinnert – greift Mario Vargas Llosa auf und erzählt sie lebhaft und packend in ihrer ganzen Vielgestaltigkeit. Wer gründet welche Intrigen? Wer sind die Profiteure? Wer bleibt auf der Strecke?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 472
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Titel
Mario Vargas Llosa
Harte Jahre
Roman
Aus dem Spanischen von Thomas Brovot
Suhrkamp
Übersicht
Cover
Titel
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Inhalt
Cover
Titel
Inhalt
Harte Jahre
Vorher
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
Nachher
Danksagung
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Harte Jahre
Es waren schwere Zeiten!
Teresa von Ávila
Für drei Freunde:
Soledad ÁlvarezTony Raful undBernardo Vega
I’d never heard of this bloody place Guatemalauntil I was in my seventy-ninth year.
Winston Churchill
Vorher
Auch wenn sie einer breiteren Öffentlichkeit kaum bekannt sind und in den Geschichtsbüchern allenfalls einen Platz am Rande einnehmen, waren die beiden Personen, die im zwanzigsten Jahrhundert das Schicksal Guatemalas, ja ganz Mittelamerikas am meisten beeinflusst haben, wahrscheinlich Edward L. Bernays und Sam Zemurray, zwei Männer, die aufgrund ihrer Herkunft, ihres Temperaments und ihres Wirkens nicht unterschiedlicher hätten sein können.
Zemurray wurde 1877 unweit des Schwarzen Meeres geboren und wanderte, als Jude in einer Zeit, da im Russischen Reich die Pogrome wüteten, mit nicht einmal fünfzehn Jahren an der Hand einer Tante in die USA aus, wo sie in Selma, Alabama, im Haus von Verwandten unterkamen. Edward L. Bernays gehörte ebenfalls einer Familie jüdischer Emigranten an, allerdings aus besseren Kreisen, sowohl gesellschaftlich als auch ökonomisch, außerdem gab es in der Familie eine berühmte Persönlichkeit: seinen Onkel Sigmund Freud. Abgesehen davon, dass beide Juden waren – so wenig eifrig sie ihre Religion auch praktizierten –, hatten sie praktisch nichts gemein. Edward L. Bernays rühmte sich, so etwas wie der Vater der Public Relations zu sein, die er zwar nicht erfunden habe, jedoch (auf Kosten Guatemalas) in die luftigsten Höhen katapultieren würde, bis er sie zur wichtigsten politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Waffe des zwanzigsten Jahrhunderts gemacht hätte. Das zumindest sollte sich bewahrheiten, auch wenn seine Egozentrik ihn bisweilen zu maßlosen Übertreibungen anstachelte. Die erste Begegnung zwischen den beiden hatte 1944 stattgefunden, und in dem Jahr auch begann ihre Zusammenarbeit. Sam Zemurray hatte ihn um einen Termin gebeten, und Bernays empfing ihn in seinem damals noch kleinen Büro im Herzen Manhattans. Es ist anzunehmen, dass Zemurray, dieser große, schlecht gekleidete Kerl, unrasiert, ohne Krawatte, in einer verschossenen Jacke und rustikalen Halbstiefeln, Bernays mit seinen eleganten Anzügen, seiner gewählten Sprache, den Yardley-Parfums und aristokratischen Manieren auf den ersten Blick nicht sonderlich beeindruckte.
»Ich habe versucht, Ihr Buch Propaganda zu lesen, aber ich habe nicht viel verstanden«, stellte Zemurray sich dem Werbefachmann vor. Er sprach ein schleppendes Englisch, als wäre er sich bei jedem Wort unsicher.
»Dabei ist es in einer sehr einfachen Sprache geschrieben, jedem des Lesens Kundigen zugänglich«, kanzelte Bernays ihn ab.
»Dann wird es an mir liegen«, räumte sein Gegenüber ein, ohne sich im mindesten angegriffen zu fühlen. »Ehrlich gesagt, ich bin kein großer Leser. In meiner Kindheit drüben in Russland habe ich gerade mal die Schule hinter mich gebracht, und Englisch habe ich nie richtig gelernt, das wird Ihnen sicher aufgefallen sein. Wenn ich Briefe schreibe, ist es noch schlimmer, alles voller Rechtschreibfehler. Mich interessiert mehr die Tat als das Geistesleben.«
»Tja, wenn das so ist, dann weiß ich nicht, womit ich Ihnen behilflich sein könnte, Mister Zemurray«, sagte Bernays und tat schon, als wollte er aufstehen.
»Ich will Ihnen nicht die Zeit stehlen«, hielt Zemurray ihn zurück. »Ich leite ein Unternehmen, das Bananen aus Mittelamerika in die Vereinigten Staaten importiert.«
»Die United Fruit?«, fragte Bernays überrascht und musterte seinen unansehnlichen Besucher nun interessierter.
»Wie es aussieht, haben wir einen miserablen Ruf, sowohl in den USA als auch in ganz Mittelamerika, das heißt in den Ländern, in denen wir tätig sind«, fuhr Zemurray mit einem Achselzucken fort. »Und offenbar sind Sie der Mann, der das in Ordnung bringen könnte. Ich möchte Sie engagieren, als Leiter der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit im Unternehmen. Wie auch immer, wählen Sie die Bezeichnung, die Ihnen am besten gefällt. Und um Zeit zu sparen, bestimmen Sie auch gleich das Honorar.«
So hatte die Beziehung zwischen den beiden ungleichen Männern begonnen: zwischen dem feinsinnigen Werbefachmann, der sich für einen Wissenschaftler und Intellektuellen hielt, und dem ungeschliffenen Sam Zemurray, einem Selfmademan und draufgängerischen Unternehmer, der, angefangen mit einer Ersparnis von hundertfünfzig Dollar, eine Firma aufgebaut hatte, die ihn, auch wenn sein Äußeres dies nicht verriet, zum Millionär gemacht hatte. Natürlich hatte er die Banane nicht erfunden, aber dank ihm gehörte sie nun in den USA, wo zuvor nur sehr wenige diese exotische Frucht gegessen hatten, für Millionen von Menschen auf den Speiseplan und erfreute sich auch in Europa und anderen Regionen der Welt zunehmender Beliebtheit. Wie er es geschafft hatte? Niemand hätte das wirklich sagen können, denn Sam Zemurrays Leben verwob sich mit Mythen und Legenden. Dieser primitive Unternehmer schien mehr einem Abenteuerbuch entsprungen als der amerikanischen Welt der Wirtschaft. Und im Gegensatz zu Bernays sprach er, der alles war, nur nicht eitel, nie über sein Leben.
Auf seinen Reisen hatte Zemurray in den Urwäldern Mittelamerikas Bananen gesehen, und dank glücklicher Intuition zu dem kommerziellen Nutzen, der sich aus dieser Frucht ziehen ließ, begann er, sie auf dem Seeweg nach New Orleans und in andere nordamerikanische Städte zu spedieren. Der Zuspruch war von Anfang an groß. So groß, dass die zunehmende Nachfrage ihn von einem bloßen Händler zu einem internationalen Agrarunternehmer und Produzenten von Bananen machte. Es war der Durchbruch für die United Fruit gewesen, die zu Beginn der Fünfzigerjahre ihr Netz über Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica und Kolumbien sowie mehrere karibische Inseln spannte und mehr Dollars einbrachte, als die allermeisten anderen Unternehmen in den USA und selbst im Rest der Welt verdienten. Dieses Imperium war ohne Zweifel das Werk eines einzigen Mannes: Sam Zemurray. Unzählige Menschen waren nun von ihm abhängig.
Für seinen Erfolg hatte er Tag für Tag von früh bis spät geschuftet und war unter widrigsten Bedingungen durch ganz Mittelamerika und die Karibik gezogen, hatte sich heldenhaft, Messer und Pistole im Anschlag, mit Abenteurern so wie er um Anbauland geschlagen, hatte hunderte Male in der Wildnis übernachtet, aufgefressen von Moskitos und immer wieder geplagt vom Sumpffieber, hatte die Obrigkeit bestochen, ahnungslose Bauern und Ureinwohner übers Ohr gehauen und mit korrupten Diktatoren verhandelt, mit deren Hilfe er – ihre Habgier oder Dummheit ausnutzend – nach und nach einen Grundbesitz erwarb, der sich bald auf mehr Hektar belief, als ein europäisches Land von ansehnlichen Ausmaßen sein Eigen nannte, hatte Tausende von Arbeitsplätzen geschaffen, Schienenwege gelegt, Häfen eröffnet und die Barbarei mit der Zivilisation verbunden. Das zumindest sagte Sam Zemurray, wenn er sich gegen Angriffe wehren musste, denen sich die United Fruit – in ganz Mittelamerika La Frutera genannt und mit Spitznamen der Krake – nicht nur von neidischen Zeitgenossen ausgesetzt sah, sondern auch von der US-amerikanischen Konkurrenz. Tatsächlich hatte er nie zugelassen, dass andere mit seiner Firma in einen fairen Wettbewerb traten, vielmehr übte sie in dieser Region, was die Erzeugung und Vermarktung von Bananen anging, ein tyrannisches Monopol aus. In Guatemala zum Beispiel hatte er sich die vollständige Kontrolle über den einzigen Hafen des Landes an der Karibikküste gesichert – Puerto Barrios –, über die Stromversorgung und über die Eisenbahn, die die beiden Ozeane miteinander verband und ebenfalls seiner Company gehörte.
So grundverschieden Zemurray und Bernays auch waren, bildeten sie doch ein gutes Team. Ohne Zweifel verhalf Bernays der United Fruit in den USA zu einem besseren Image, machte sie in den Washingtoner politischen Kreisen salonfähig und brachte sie in Kontakt mit den Bostoner Millionären (die sich damit brüsteten, Aristokraten zu sein). Zur Werbung war er auf indirektem Weg gekommen, dank seiner guten Beziehungen auf allen Ebenen, vor allem aber zu Diplomaten, Politikern, Besitzern von Zeitungen, Rundfunk- und Fernsehsendern, zu erfolgreichen Unternehmern und Bankiers. Er war intelligent, sympathisch, überaus fleißig, und einen seiner ersten Erfolge konnte er verbuchen, als er für Caruso, den berühmten italienischen Tenor, eine Tournee durch die Vereinigten Staaten organisierte. Seine offene und kultivierte Art und seine umgänglichen Manieren gefielen den Menschen, so hatten sie das Gefühl, bedeutender und einflussreicher zu sein, als sie in Wirklichkeit waren. Werbung und Public Relations gab es natürlich schon, als er noch nicht auf der Welt war, doch Bernays hatte aus diesem Geschäft, das alle Firmen in Anspruch nahmen, aber als ein minderes betrachteten, eine echte Disziplin von intellektuellem Format gemacht, als Teil der Soziologie, der Ökonomie und der Politik. Er hielt Vorträge und unterrichtete an renommierten Universitäten, veröffentlichte Artikel und Bücher, und dabei präsentierte er seinen Beruf als einen, der wie kein anderer für das zwanzigste Jahrhundert stand, gleichbedeutend mit Modernität und Fortschritt. In seinem Buch Propaganda (1928) hatte er einen prophetischen Satz geschrieben, für den er in gewisser Weise in die Geschichte eingehen sollte: »In einer demokratischen Gesellschaft ist die bewusste und intelligente Manipulation der formierten Gewohnheiten und Meinungen der Massen ein wesentliches Element. Diejenigen, die diesen verborgenen Mechanismus steuern, bilden eine unsichtbare Regierung, sie ist die wahre Macht in unserem Land … Gerade die intelligenten Minderheiten müssen sich der Propaganda fortwährend und systematisch bedienen.« Im Fall von Guatemala hatte Bernays schließlich Gelegenheit, diese Theorie, von manchen Kritikern als Negierung der Demokratie gebrandmarkt, höchst wirksam anzuwenden, wenige Jahre nachdem er begonnen hatte, als PR-Berater für die United Fruit zu arbeiten.
Seine Beratungstätigkeit trug erheblich dazu bei, das Image des Konzerns aufzupolieren und ihm in der Politik Unterstützung und Einfluss zu sichern. Der Krake hatte es nie für nötig befunden, sein bemerkenswertes industrielles und kommerzielles Geschäft als etwas darzustellen, was der Gesellschaft im Allgemeinen zugutekam, schon gar nicht den »barbarischen Ländern«, in denen die United Fruit operierte und denen sie – nach Bernays’ Definition – nun half, über den Zustand der Wildheit hinauszukommen, denn sie schaffe Arbeitsplätze für Tausende von Bürgern, verhelfe ihnen zu einem höheren Lebensstandard und binde sie ein in die Moderne, den Fortschritt, ins zwanzigste Jahrhundert, in die Zivilisation. Auf Bernays’ Anraten ließ Zemurray auf den Ländereien der Company einige Schulen bauen, man holte katholische Priester und protestantische Geistliche auf die Plantagen, baute Erste-Hilfe-Stationen und ähnliche Einrichtungen, vergab Stipendien und Reisezuschüsse an Studenten und Professoren, alles Dinge, die sie in der Öffentlichkeit darstellte als glaubwürdigen Beweis für das modernisierende Werk, das sie vollbringe. Gleichzeitig bewarb sie, strategisch geplant und mithilfe von Wissenschaftlern und Fachleuten, den Konsum von Bananen zum Frühstück und zu jeder Tageszeit als unverzichtbar für die Gesundheit und die Heranbildung gesunder und sportlicher Bürger. Bernays war es, der die brasilianische Sängerin und Tänzerin Carmen Miranda (die Señorita Chiquita Banana aus den Shows und den Filmen) durch die USA schickte, wo sie mit ihren Bananenhüten ungeheuren Erfolg hatte und in ihren Liedern außerordentlich wirkungsvoll Reklame machte für diese Frucht, die dank der PR-Anstrengungen in den Haushalten der Amerikaner bereits ihren festen Platz hatte.
Bernays schaffte es auch, dass die United Fruit die Nähe der Bostoner Aristokratie und der politischen Macht suchte. Sam Zemurray wäre das nie in den Sinn gekommen, denn die Reichsten der Reichen von Boston waren nicht nur mächtig und vermögend, sie hatten auch Vorurteile und waren meist antisemitisch eingestellt. Für Bernays war es also nicht einfach gewesen, jemanden wie Henry Cabot Lodge dazu zu bewegen, in den Aufsichtsrat der United Fruit einzutreten, oder dass die Brüder John Foster und Allen Dulles, Partner der renommierten New Yorker Kanzlei Sullivan & Cromwell, das Mandat für die Company übernahmen. Bernays wusste, dass Geld alle Türen öffnet und nicht einmal Rassenvorurteile dem entgegenstehen, und so gelang es ihm, auch diese schwierige Verbindung herzustellen, nach der sogenannten Oktoberrevolution von 1944 in Guatemala, als die United Fruit sich in Gefahr sah. Bernays’ Ideen und Beziehungen sollten mehr als nützlich sein, um die »kommunistische Regierung« des Landes zu stürzen und sie durch eine demokratischere zu ersetzen, eine Regierung, mit anderen Worten, die sich ihren Interessen williger fügte.
Während der Amtszeit von Juan José Arévalo (1945-1951), der ersten Regierung in der Geschichte des Landes, die aus wirklich freien Wahlen hervorgegangen war, fingen die Alarmglocken an zu schrillen. Nicht weil Professor Arévalo, der einen wie auch immer gearteten idealistischen »geistigen Sozialismus« vertrat, sich gegen die United Fruit gestellt hätte. Aber er ließ ein Gesetz verabschieden, das den Arbeitern und Bauern gestattete, Gewerkschaften zu gründen oder sich einer anzuschließen, was es bisher auf den Ländereien der Company nicht gegeben hatte. Zemurray und die anderen Aufsichtsratsmitglieder ließ dies hellhörig werden, und in einer eilig einberufenen Sitzung, die in Boston stattfand, wurde vereinbart, dass Bernays nach Guatemala fliegen, die Situation einschätzen und berichten sollte, wie gefährlich für das Unternehmen die Geschehnisse dort unten waren.
Edward L. Bernays blieb zwei Wochen in Guatemala, untergebracht im Hotel Panamerican im Zentrum der Stadt, nur einen Steinwurf entfernt vom Regierungspalast. Mithilfe von Dolmetschern, da er kein Spanisch sprach, befragte er Plantagenbesitzer, Militärs, Bankiers, Parlamentarier, Polizisten und Ausländer, die seit Jahren in dem Land ansässig waren, dazu Gewerkschaftsführer, Journalisten und natürlich Mitarbeiter der Botschaft der Vereinigten Staaten sowie leitende Angestellte der United Fruit. Die Hitze und die Moskitos setzten ihm schwer zu, aber er machte seine Arbeit gut.
Bei einer erneuten Sitzung in Boston schilderte er den Aufsichtsratsmitgliedern seinen persönlichen Eindruck von dem, was seiner Meinung nach in Guatemala vor sich ging. Er trug seinen Bericht anhand von Notizen vor, mit der Gewandtheit eines Profis und ohne jede Spur von Zynismus:
»Die Gefahr, Guatemala könnte kommunistisch werden und der Sowjetunion als Brückenkopf dienen, um in Mittelamerika einzusickern und den Panamakanal zu bedrohen, ist unwahrscheinlich, ich würde sogar sagen, einstweilen nicht existent«, versicherte er ihnen. »Nur sehr wenige Menschen in Guatemala wissen überhaupt, was Marxismus oder Kommunismus ist, nicht mal die paar Versprengten, die sich Kommunisten nennen und die Escuela Claridad gegründet haben, eine Schule für Arbeiter, wo man revolutionäre Ideen verbreitet. Diese Gefahr ist irreal, auch wenn es uns zupasskommt, dass man denkt, es gäbe sie, vor allem in den Vereinigten Staaten. Die wahre Gefahr ist anderer Natur. Ich habe mit den engsten Mitarbeitern von Präsident Arévalo gesprochen, auch mit ihm persönlich. Er ist so antikommunistisch wie Sie und ich. Darum haben der Präsident und seine Anhänger auch darauf bestanden, dass die neue Verfassung Guatemalas politische Parteien mit internationalen Verbindungen verbietet, und bei verschiedenen Gelegenheiten haben sie erklärt, der Kommunismus sei ›die größte Gefahr, der sich die Demokratien gegenübersehen‹. Außerdem haben sie die Escuela Claridad geschlossen und die Gründer ausgewiesen. Doch so paradox es erscheinen mag, ihre grenzenlose Begeisterung für die Demokratie ist für die United Fruit eine ernsthafte Bedrohung. Das, meine Herren, sollten Sie wissen, aber nicht aussprechen.«
Bernays lächelte und warf einen theatralischen Blick in die Runde der Aufsichtsratsmitglieder, von denen einige höflich lächelten. Nach einer kurzen Pause fuhr er fort:
»Arévalo möchte aus Guatemala eine Demokratie machen wie in den USA, ein Land, das er bewundert und in dem er ein Modell sieht. Schwärmer können gefährlich sein, und in diesem Sinne ist Dr. Arévalo eine Gefahr. Sein Projekt hat nicht die geringste Chance auf Verwirklichung. Wie will ein Land zu einer modernen Demokratie werden, wenn von seinen drei Millionen Einwohnern siebzig Prozent analphabetische Indios sind, die kaum das Heidentum hinter sich gelassen haben oder noch heidnisch sind, und wo auf einen Arzt wahrscheinlich drei oder vier Schamanen kommen? Ein Land noch dazu, in dem die weiße Minderheit, bestehend aus rassistischen und ausbeuterischen Großgrundbesitzern, die Indios verachtet und wie Sklaven behandelt. Die Militärs, mit denen ich gesprochen habe, scheinen ebenfalls tief im neunzehnten Jahrhundert zu leben und könnten jeden Moment putschen. Präsident Arévalo hat schon mehrmals einen Militäraufstand niederschlagen müssen. Nun denn. Auch wenn ich seine Bemühungen, das Land in eine moderne Demokratie zu überführen, für vergeblich halte, wäre jeder Schritt in diese Richtung, machen wir uns nichts vor, für die Company von großem Nachteil.«
»Ich nehme an, das ist Ihnen klar«, fuhr er fort, nachdem er zu einem Glas Wasser gegriffen und einen Schluck getrunken hatte. »Ein paar Beispiele. Arévalo hat ein Arbeitsgesetz verabschieden lassen, das es erlaubt, in den Betrieben und auf den Haziendas Gewerkschaften zu gründen, Vereinigungen, denen alle Arbeiter und Bauern beitreten dürfen. Außerdem hat er ein Gesetz gegen Monopole erlassen, nach dem Muster des Antitrust-Gesetzes in den USA. Sie können sich vorstellen, was es für die United Fruit bedeuten würde, käme eine solche Maßnahme zum Schutz des freien Wettbewerbs zur Anwendung. Die Folge wäre vielleicht nicht ihr Ruin, aber doch ein erheblicher Rückgang der Gewinne. Und die resultieren ja nicht nur aus der Effizienz, mit der wir arbeiten, oder den Investitionen und Anstrengungen, mit denen wir Plagen bekämpfen und das Land kultivieren, das wir den Urwäldern für den Bananenanbau abtrotzen. Sie resultieren auch aus dem Monopol, das mögliche Konkurrenten aus unseren Gebieten fernhält, sowie den wahrlich privilegierten Bedingungen, unter denen wir tätig sind, befreit von Steuern, ohne Gewerkschaften und ohne die damit einhergehenden Risiken und Gefahren. Das Problem ist nicht nur Guatemala, ein kleiner Teil der Welt, in der wir agieren. Aber andere mittelamerikanische Länder und Kolumbien könnten angesteckt werden, wenn der Funke überspringt und die Vorstellung, zu einer ›modernen Demokratie‹ zu werden, auch dort um sich greift. Die United Fruit bekäme es mit Gewerkschaften und der internationalen Konkurrenz zu tun, müsste Steuern zahlen, den Arbeitern und ihren Familien gegenüber für eine Krankenversicherung und Rente geradestehen, und sie würde Hass und Neid auf sich ziehen, wovon florierende, leistungsstarke Unternehmen in armen Ländern niemals verschont bleiben, erst recht nicht, wenn es US-amerikanische Firmen sind. Die Gefahr, meine Herren, ist das schlechte Beispiel. Nicht unbedingt der Kommunismus, sehr wohl aber die Demokratisierung. Und auch wenn es wahrscheinlich nie dazu kommt, würden die Fortschritte, die das Land in dieser Richtung macht, für uns einen Rückschritt bedeuten, einen Verlust.«
Er schwieg und musterte die verblüfften oder nachfragenden Blicke der Mitglieder des Aufsichtsrats. Sam Zemurray, der Einzige, der keine Krawatte trug und mit seinem legeren Aufzug unter den eleganten Herren an dem langen Tisch aus dem Rahmen fiel, sagte:
»Schön, das ist der Befund. Und womit ließe sich die Krankheit bekämpfen?«
»Ich wollte Ihnen eine kurze Verschnaufpause gönnen«, scherzte Bernays und trank einen weiteren Schluck Wasser. »Dann also zu den Heilmitteln, Sam. Die Behandlung wird lang, kompliziert und teuer. Aber sie wird das Übel an der Wurzel packen. Und wenn sie gelingt, kann die United Fruit weitere fünfzig Jahre expandieren, macht Gewinn und hat ihre Ruhe.«
Edward L. Bernays wusste, wovon er sprach. Die Behandlung würde darin bestehen, auf die Regierung der Vereinigten Staaten und zugleich auf die Öffentlichkeit einzuwirken. Weder hier noch da hatte man die geringste Vorstellung von der Existenz Guatemalas, schon gar nicht wusste irgendwer, dass das Land ein Problem darstellte. Was zunächst einmal gut war. »Es ist an uns, die Regierung und die Öffentlichkeit über Guatemala aufzuklären, und zwar auf eine Weise, dass man vom Ernst der Lage überzeugt ist und die Gefahr für so groß hält, dass sie auf der Stelle gebannt werden muss. Wie uns das gelingen soll? Indem wir subtil und zielgerichtet vorgehen. Indem wir es so einrichten, dass die Öffentlichkeit, die in einer Demokratie nun mal entscheidend ist, auf die Regierung Druck ausübt, damit sie handelt und eine ernsthafte Bedrohung stoppt. Welche? Ebenjene, die Guatemala, wie ich Ihnen eben erklärt habe, nicht ist: das trojanische Pferd der Sowjetunion, eingeschleust in den Hinterhof der USA. Doch wie lässt sich der Öffentlichkeit einreden, Guatemala sei bereits jetzt auf dem Weg in den Kommunismus und könnte, sollte Washington nicht energisch eingreifen, zum ersten Satellitenstaat der Sowjetunion in der Neuen Welt werden? Über die Presse, den Rundfunk und das Fernsehen, für die Bürger die wichtigste Quelle der Information und der Orientierung, ob in einem freien Land oder einem Land unter der Knute eines anderen. Wir müssen den Journalisten die Augen öffnen über das, was sich keine zwei Flugstunden von den USA entfernt und in unmittelbarer Nähe des Panamakanals zusammenbraut.
Das Beste wäre, wenn alles auf natürliche Weise vonstattenginge, von niemandem geplant und gelenkt, am wenigsten von uns, die wir ein Interesse daran haben. Die Vorstellung, Guatemala sei kurz davor, in sowjetische Hände zu fallen, sollte nicht von der republikanischen oder der rechten Presse in den USA stammen, vielmehr von der progressiven, sie wird von den Demokraten gelesen und gehört, von der Mitte also und von den Linken. Sie hat die größte Reichweite. Um der Sache einen wahrscheinlicheren Anstrich zu geben, muss alles ein Werk der liberalen Presse sein.«
Sam Zemurray unterbrach ihn mit einer Frage:
»Und was sollen wir tun, um die liberale Presse davon zu überzeugen? Die ist doch der letzte Dreck.«
Bernays lächelte, machte erneut eine Pause. Und wie ein vollendeter Schauspieler ließ er den Blick feierlich von Gesicht zu Gesicht wandern:
»Dafür haben wir den König der Public Relations, das heißt: mich«, antwortete er ohne jede Bescheidenheit, als wollte er seine Zeit nicht damit verschwenden, diesem ehrenwerten Gremium in Erinnerung zu rufen, dass die Erde rund war. »Dafür, meine Herren, habe ich meine Freunde unter den Herausgebern und Eigentümern von Zeitungen, Rundfunk- und Fernsehsendern in den Vereinigten Staaten.«
Es sei unerlässlich, sagte er weiter, verschwiegen und mit großem Geschick vorzugehen, nicht dass die Medien sich benutzt fühlten. Alles müsse so spontan ablaufen, wie auch die Natur ihre wunderbaren Verwandlungen bewirke, müsse den Anschein erwecken, es seien »Exklusivmeldungen«, Fakten, die die freie und fortschrittliche Presse enthüllt habe und der Welt nun offenbare. Es gelte, liebevoll das Ego der Journalisten zu massieren, denn davon hätten sie zur Genüge.
Als Bernays zu Ende gesprochen hatte, bat Sam Zemurray erneut um das Wort:
»Sag jetzt bitte nicht, wie viel uns der Spaß kostet, den du da so schön ausmalst. Als Schock reicht es für heute.«
»Nein, dazu werde ich vorerst nichts sagen«, beruhigte ihn Bernays. »Wichtig ist, meine Herren, dass Sie eines nicht vergessen: Die Company wird sehr viel mehr verdienen als alles, was sie für diese Operation womöglich aufwenden muss – wenn es uns nur für ein weiteres halbes Jahrhundert gelingt, dass Guatemala nicht zu der modernen Demokratie wird, von der Präsident Arévalo träumt.«
Was Edward L. Bernays bei jener denkwürdigen Aufsichtsratssitzung der United Fruit in Boston vorschlug, ging aufs Wort in Erfüllung und bestätigte, nebenbei gesagt, seine These, das zwanzigste Jahrhundert sei, sowohl in den demokratischen wie auch in den autoritären Gesellschaften, das Jahrhundert der Werbung als elementares Werkzeug der Macht und der Manipulation der öffentlichen Meinung.
So wurde Guatemala, zunächst gegen Ende der Regierungszeit von Juan José Arévalo, sehr viel mehr aber noch in den Jahren, als Oberst Jacobo Árbenz Guzmán Präsident war, in der US-amerikanischen Presse zu einer Meldung. In Reportagen, die in der New York Times, der Washington Post oder im Nachrichtenmagazin Time erschienen, wies man auf die wachsende Gefahr für die freie Welt hin, die der Einfluss der Sowjetunion auf das Land bedeute, ein Einfluss, den sie über Regierungen ausübe, die, auch wenn sie sich nach außen hin demokratisch gäben, in Wahrheit durchsetzt seien von Kommunisten, nützlichen Idioten und Weggenossen; die Maßnahmen, die sie ergriffen, seien nicht nur unvereinbar mit Rechtsstaatlichkeit, Panamerikanismus, Privateigentum und freiem Markt, sie befeuerten auch den Klassenkampf, die Verachtung aller gesellschaftlichen Unterschiede und eine feindselige Einstellung gegenüber Privatunternehmen.
Dank Bernays’ Beziehungen und seiner Betreibungen hinter den Kulissen schickten nun US-amerikanische Zeitungen und Zeitschriften, die sich bisher noch nie für Guatemala, Mittelamerika oder überhaupt für Lateinamerika interessiert hatten, Korrespondenten nach Guatemala. Sie logierten im Hotel Panamerican, dessen Bar sich zu so etwas wie einem internationalen Pressezentrum entwickelte; dort erhielten sie Mappen mit ausführlichen Dokumentationen der Vorfälle, die die bisherigen Hinweise bestätigten – Bildung von Gewerkschaften als Waffe in der Auseinandersetzung und fortschreitende Zerstörung des privaten Unternehmertums –, und dort arrangierte man, von Bernays in die Wege geleitet oder empfohlen, Interviews mit Grundbesitzern, Unternehmern, Priestern (gar dem Erzbischof), mit Journalisten, Oppositionsführern, Pfarrern und Akademikern, die mit detaillierten Angaben den Befürchtungen Nahrung gaben, das Land sei auf dem Weg, zu einem sowjetischen Satellitenstaat zu werden, über den der internationale Kommunismus den Einfluss und die Interessen der USA in ganz Lateinamerika zu untergraben versuche.
Ab einem bestimmten Moment – genauer gesagt, als die Regierung Árbenz die Agrarreform im Land einleitete – musste Bernays nicht länger auf die Eigentümer und Herausgeber der Presseorgane in den USA einwirken, denn in Politik, Wirtschaft und Kultur machte man sich – es war die Zeit des Kalten Krieges – tatsächlich große Sorgen, und die Medien schickten von allein Korrespondenten, damit sie sich vor Ort ein Bild machten über die Lage in diesem kleinen, vom Kommunismus unterwanderten Land. Höhepunkt war die Veröffentlichung einer Meldung der United Press aus der Feder des britischen Journalisten Kenneth de Courcy, wonach die Sowjetunion die Absicht habe, in Guatemala eine U-Boot-Basis zu errichten. Das Life Magazine, die Herald Tribune, der Londoner Evening Standard, das Harper’s Magazine und die Chicago Tribune, ebenso die Zeitschrift Visión (spanischsprachig) und der Christian Science Monitor sowie weitere Publikationen brachten seitenlange Berichte, um mit konkreten Vorfällen und Zeugenaussagen die allmähliche Unterwerfung Guatemalas unter den Kommunismus und die Sowjetunion aufzuzeigen. Eine Verschwörung war das alles nicht, denn die Propaganda hatte eine aparte Fiktion über die Wirklichkeit gebreitet, und über die schrieben die unvorbereiteten nordamerikanischen Journalisten nun ihre Artikel, die meisten von ihnen merkten nicht einmal, dass sie Marionetten eines genialen Puppenspielers waren. So erklärt sich, dass eine bei den Linksliberalen so angesehene Korrespondentin wie Flora Lewis ein Loblied auf John Emil Peurifoy sang, den Botschafter der USA in Guatemala. Das alles trug dazu bei, dass aus der Fiktion Wirklichkeit wurde; am Ende zählten diese Jahre zu den schlimmsten der McCarthy-Ära und des Kalten Krieges zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion.
Als Sam Zemurray im November 1961 starb, war er fast fünfundachtzig. Er hatte sich von den Geschäften zurückgezogen und lebte mit seinen Millionen in Louisiana, doch noch immer wollte ihm nicht in den Kopf, dass das, was Edward L. Bernays damals bei dieser Sitzung der United Fruit in Boston skizziert hatte, Punkt für Punkt in Erfüllung gegangen war. Auch hätte er nie gedacht, dass die Frutera, die diesen Krieg schließlich gewonnen hatte, längst im Niedergang begriffen war, dass ein paar Jahre später ihr Präsident sich das Leben nehmen sollte, die Company verschwände und nur schlimme und schlimmste Erinnerungen an sie blieben.
I
Miss Guatemalas Mutter entstammte einer Familie italienischer Einwanderer namens Parravicini. Nach zwei Generationen hatte sich der Name abgeschliffen und war hispanisiert. Als der junge Juraprofessor und praktizierende Anwalt Arturo Borrero Lamas um die Hand der jungen Marta Parra anhielt, erhob sich in den besseren Kreisen ein Getuschel, denn die Tochter italienischstämmiger Krämer, Brot- und Kuchenbäcker war gesellschaftlich eindeutig nicht auf der Höhe dieses schmucken Herrn, nach dem sich aufgrund des Alters seiner Familie, seines beruflichen Ansehens und seines Vermögens die heiratsfähigen Mädchen aus der guatemaltekischen Oberschicht in ihren Träumen sehnten. Doch irgendwann verstummte das Gerede, und alle Welt strömte herbei, sei es als Gast oder als Zaungast, um die Hochzeit zu erleben, die in der Kathedrale gefeiert wurde, zelebriert vom Erzbischof der Stadt persönlich. Auch der ewige Präsident General Jorge Ubico Castañeda gab sich die Ehre, am Arm seiner anmutigen Gattin und in einer eleganten, von Medaillen starrenden Uniform, und unter dem Applaus der Menge ließen sich die beiden im Vorhof der Kirche mit dem Brautpaar fotografieren.
Die Ehe war, was die Nachkommenschaft betraf, keine glückliche. Denn Marta Parra wurde zwar jedes Jahr schwanger, doch sosehr sie auf sich achtgab, gebar sie nur klapperdürre Jungen, die halb tot zur Welt kamen und trotz aller Bemühungen von Hebammen, Gynäkologen und selbst Hexen und Wunderheilern der Stadt nach wenigen Tagen oder Wochen verstarben. Im fünften Jahr schließlich erblickte Martita Borrero Parra das Licht der Welt, und sie war so hübsch, so munter und lebhaft, dass die Eltern sie von der Wiege an Miss Guatemala nannten. Anders als ihre Brüder überlebte sie. Und wie!
Bei der Geburt war auch sie ein schmächtiges Kind, nur Haut und Knochen. Doch schon in den Tagen, in denen die Leute Messen lesen ließen, damit die Kleine nicht das Schicksal ihrer Brüder ereilte, fielen ihre feinen Gesichtszüge auf, die glatte Haut, ihre großen Augen und dieser ruhige, feste, durchdringende Blick, der sich auf Menschen wie auf Dinge legte, als müsste sie sich alles für immer einprägen. Ein Blick, der verwirrte und erschreckte. Símula, die Quiché-Maya, die ihre Kinderfrau werden sollte, prophezeite: »Das Mädchen wird Kräfte haben!«
Miss Guatemalas Mutter, Marta Parra de Borrero, konnte sich an ihrem einzigen überlebenden Kind nicht lange erfreuen. Nicht weil sie gestorben wäre – sie wurde neunzig Jahre alt und starb in einem Seniorenheim, ohne dass sie vom Geschehen ringsum noch viel mitbekommen hätte –, sondern weil sie nach der Geburt des Mädchens so erschöpft und deprimiert war, dass sie verstummte und (wie man es damals auf euphemistische Weise ausdrückte) wunderlich wurde. Ganze Tage blieb sie reglos im Haus, ohne ein Wort zu sprechen, gefüttert von Patrocinio und Juana, ihren Dienstmädchen, die ihr auch die Beine massierten, damit sie nicht verkümmerten, und wenn sie ihr seltsames Schweigen einmal brach, dann mit einem Heulkrampf, worauf sie in stumpfer Schläfrigkeit versank. Símula war die Einzige, mit der sie sich verstand; eine Geste genügte, wenn das Dienstmädchen ihre Wünsche mal nicht gleich erriet. Dr. Borrero Lamas vergaß mit der Zeit, dass er eine Frau hatte. Tage vergingen, dann Wochen, ohne dass er ins Schlafzimmer trat, um seiner Frau einen Kuss auf die Stirn zu geben, und jede Stunde, die er nicht in seiner Kanzlei arbeitete, bei Gericht vortrug oder in der Universität San Carlos unterrichtete, widmete er der kleinen Marta, die er seit dem Tag ihrer Geburt hätschelte und abgöttisch liebte. So wuchs das Mädchen an der Hand des Vaters heran, und wenn sich an den Wochenenden das koloniale Haus mit hohen Herren bevölkerte – Richter, Gutsbesitzer, Politiker, Diplomaten –, die kamen, um das anachronistische Rocambor zu spielen, erlaubte er Martita, zwischen den Besuchern umherzutollen. Den Vater amüsierte der Anblick, wie die Kleine seine Freunde mit ihren riesigen graugrünen Augen anschaute, als wollte sie ihnen ihre Geheimnisse entlocken. Sie ließ sich von allen streicheln, war selber aber, außer ihrem Vater gegenüber, sehr zurückhaltend, wenn es darum ging, anderen einen Kuss zu geben oder sie mit einer Zärtlichkeit zu bedenken.
Als Martita viele Jahre später an diese frühe Kindheit zurückdachte, sollte sie sich, wie Flammen, die auflodern und verlöschen, kaum erinnern an die politischen Sorgen, die auf einmal die Gespräche all dieser Freunde beherrschten, wenn sie an den Wochenenden kamen, um ein Kartenspiel aus vergangenen Zeiten zu spielen. Nur undeutlich hörte sie, wie sie um das Jahr 1944 herum einräumten, dass General Jorge Ubico Castañeda, dieser Herr mit den Medaillen und den Goldstickereien, auf einmal so unbeliebt war, dass es Bewegungen von Militärs und Zivilisten gab und Studentenstreiks mit dem Ziel, ihn zu stürzen. Tatsächlich gelang es ihnen, und 1944 musste er die Macht abgeben an eine Militärjunta mit General Federico Ponce Vaides an der Spitze, der bei der sogenannten Oktoberrevolution im selben Jahr ebenfalls gestürzt werden sollte. Schließlich gab es Wahlen. Die vornehmen Rocambor-Spieler hatten panische Angst, Professor Juan José Arévalo, der aus dem argentinischen Exil zurückgekehrt war, könnte sie gewinnen, denn wie sie sagten, hätte sein »geistiger Sozialismus« (was das wohl heißen mochte?) für Guatemala katastrophale Folgen, die Indios würden ihre Häupter erheben und ehrbare Bürger umbringen, die Kommunisten würden sich das Land der Großgrundbesitzer unter den Nagel reißen und die Kinder aus gutem Hause nach Russland schicken, wo man sie als Sklaven verkaufte. Wenn sie so etwas sagten, wartete Martita immer auf die Reaktion von Dr. Efrén García Ardiles, einem der Herren, die an diesen Wochenenden mit Rocambor und politischem Klatsch zugegen waren. Er war eine stattliche Erscheinung mit seinen hellen Augen und seiner langen Mähne, lachte viel und nannte die anderen Gäste paranoide Steinzeitler, denn seiner Meinung nach war Professor Arévalo antikommunistischer als sie alle zusammen, sein »geistiger Sozialismus« sei lediglich eine symbolische Art, um zu sagen, dass er Guatemala aus der Armut und dem primitiven Feudalismus herausholen und zu einem modernen und demokratischen Land machen wollte. Martita erinnerte sich an die heftigen Diskussionen, die sich daran anschlossen: Die Herren fuhren Dr. García Ardiles über den Mund, nannten ihn einen Roten, einen Anarchisten und Kommunisten. Und als sie ihren Vater fragte, warum der sich immer mit allen stritt, antwortete er: »Efrén ist ein guter Arzt und ein fabelhafter Freund. Schade, dass er so verrückt ist und so links!« Martita wurde neugierig. Irgendwann würde sie Dr. García Ardiles bitten, ihr zu erklären, was das heißen sollte, links und Kommunist.
Damals besuchte sie bereits die von flämischen Nonnen geführte Belgische Schule (Ordensgesellschaft der Heiligen Familie von Helmet), auf die in Guatemala alle Mädchen aus gutem Hause gingen, und auch Auszeichnungen hatte sie erhalten und in den Klassenarbeiten nur Bestnoten. Es kostete sie keine besondere Anstrengung, sie musste sich nur auf diese natürliche Intelligenz besinnen, die sie im Übermaß besaß, und sich sagen, dass sie ihrem Vater mit all den »sehr gut« im Notenheft eine große Freude bereitete. Wie glücklich Dr. Borrero Lamas am Schuljahresende immer war, wenn seine Tochter auf die Bühne stieg und das Zeugnis für Fleiß und untadeliges Betragen entgegennahm! Und dann der Beifall, den die ganze Aula und die Nonnen dem Mädchen spendeten.
Hatte Martita eine glückliche Kindheit? Das sollte sie sich in den kommenden Jahren noch oft fragen, und immer war die Antwort ein Ja, wenn man darunter ein ruhiges und geordnetes, unerschüttertes Leben verstand, das Leben eines vom Vater wohlbehüteten und verwöhnten Mädchens, umgeben von Dienstpersonal. Traurig dagegen machte sie, dass sie die Liebe einer Mutter nicht gekannt hatte. Nur einmal am Tag – es war immer der schwierigste Moment – trat sie ins Zimmer dieser Frau, die ewig im Bett lag und sie, auch wenn sie die Mutter war, nie beachtete. Símula brachte sie hin, damit sie ihr vor dem Schlafengehen einen Kuss gab. Sie mochte die Besuche nicht, denn die Frau schien mehr tot als lebendig zu sein; sie schaute Martita gleichgültig an, ließ sich küssen, erwiderte die Zärtlichkeit aber nicht, gähnte manchmal gar. Auch mit den vielen Freundinnen konnte sie nie richtig etwas anfangen, nicht mit den Geburtstagsfesten, zu denen Símula sie als Anstandsdame begleitete, und nicht mit den Tanzabenden, als sie schon auf die höhere Schule ging und die Jungs anfingen, die Mädchen zu umschmeicheln und ihnen Briefe zu schreiben, worauf sich die ersten Liebespärchen bildeten. Unterhaltsamer waren für Martita die langen Abende an den Wochenenden und die Rocambor-Herren. Vor allem aber die Gespräche am Rande mit Dr. Efrén García Ardiles, den sie mit Fragen zur Politik bestürmte. Er erklärte ihr, Juan José Arévalo mache, trotz der Klagen dieser Herren, seine Sache gut, denn er versuche dafür zu sorgen, dass es endlich etwas Gerechtigkeit im Land gebe, vor allem für die Indios, die große Mehrheit der drei Millionen Guatemalteken. Dank Präsident Arévalo, sagte er, werde aus Guatemala endlich eine Demokratie.
Der große Einschnitt in Martitas jungem Leben war der Tag, an dem sie fünfzehn wurde, Ende 1949. Das ganze alte Viertel San Sebastián, wo sie wohnten, nahm gleichsam teil an dieser quinceañera, die ihr Vater für sie ausrichtete und mit der die besseren Familien den fünfzehnten Geburtstag ihrer Töchter feierten, es war ihr Entree in die Gesellschaft. Das Haus mit seinem großen Eingangsbereich, den Gitterfenstern und dem üppigen Garten, im Herzen des kolonialen Viertels, prangte an diesem Tag im Blumen- und Girlandenschmuck und war erhellt von Lichtern. In der Kathedrale gab es eine Messe, gelesen vom Erzbischof, und Martita wohnte ihr in einem bauschigen weißen Tüllkleid und mit einem Zweig Orangenblüten in der Hand bei, begleitet von der ganzen Familie einschließlich Onkel und Tanten und Cousins und Cousinen, die sie zum ersten Mal sah. Auf der Straße wurde ein Feuerwerk abgebrannt und eine große Piñata aufgehängt, und glücklich schlugen die jungen Gäste auf die Pappmascheefigur voller Süßigkeiten und kandierter Früchte ein. Die Hausangestellten und das sonstige Dienstpersonal bewirteten in ihren typischen Trachten, die Frauen in Huipiles mit farbenfrohen geometrischen Mustern und dunklen Schärpen über langen Röcken, die Männer in weißen Hosen, bunten Hemden und Strohhüten. Mit dem Bankett wurde der Reitclub betraut, und man engagierte zwei Orchester, ein volkstümliches mit neun Marimbaspielern und ein modernes, bestehend aus zwölf Lehrern, die zu den modischen Tänzen aufspielten, La Bamba, Vals und Blues, Tangos, Corridos und Guarachas, Rumbas und Boleros. Martita, die Geehrte, tanzte gerade mit dem Sohn des Botschafters der Vereinigten Staaten, Richard Patterson Jr., als sie plötzlich in Ohnmacht fiel. Man trug sie ins Schlafzimmer, und Dr. Galván, der zugegen war, um auf seine Tochter Dolores aufzupassen, Schulkameradin von Martita, untersuchte sie, maß die Temperatur und den Blutdruck und rieb sie mit Alkohol ein. Bald war sie wieder bei Bewusstsein. Es sei nichts Schlimmes, erklärte der alte Arzt, nur ein kleiner Abfall des Blutdrucks aufgrund der Eindrücke des Tages. Martita erholte sich und kehrte zurück auf die Tanzfläche. Doch den ganzen weiteren Abend war sie traurig und wie abwesend.
Als die letzten Gäste gegangen waren, schon recht spät, trat Símula an Dr. Borrero heran und bat ihn mit leiser Stimme, allein mit ihm sprechen zu dürfen. Der führte sie in die Bibliothek. »Dr. Galván irrt sich«, sagte ihm die Kinderfrau. »Der Blutdruck, von wegen, das ist doch lächerlich. Tut mir leid, Doktor, aber am besten sage ich es Ihnen gleich: Das Mädchen ist guter Hoffnung.« Jetzt war es der Hausherr, dem die Sinne schwanden. Er musste sich in einen Sessel fallen lassen, und alles, die Bücherregale, die ganze Welt kreiste um ihn wie ein Karussell.
Er konnte seine Tochter noch so sehr bitten, sie anflehen, ihr mit den schlimmsten Strafen drohen, Martita – die so ihren unbändigen Charakter unter Beweis stellte und wie weit sie es damit einmal bringen würde – weigerte sich kategorisch, ihm zu verraten, wer der Vater des unter ihrem Busen heranwachsenden Kindes war. Dr. Borrero Lamas glaubte schon, er verlöre den Verstand. Er war sehr katholisch, erzkonservativ, trotzdem zog er, als Símula bei seinem Anblick sagte, sie könne das Mädchen zu einer Frau bringen, die darauf spezialisiert sei, »Ungeborene in den Limbus zu schicken«, vor lauter Verzweiflung eine Abtreibung in Betracht. Doch nachdem er es im Kopf hin und her gewendet hatte, vor allem aber nachdem er sich mit Pater Ulloa von den Jesuiten beraten hatte, seinem Beichtvater und Freund, beschloss er, die Tochter nicht einem solch riskanten Eingriff auszusetzen und auch nicht in die Hölle zu fahren, schließlich war das eine Todsünde.
Dass Martita ihr Leben ruiniert hatte, zerriss ihm das Herz. Er musste sie von der Belgischen Schule nehmen, denn immer wieder erbrach sie sich und bekam Schwindelanfälle, die Nonnen hätten den Grund bald erkannt, der Skandal hätte nicht auf sich warten lassen. Es schmerzte den Anwalt tief, dass seine Tochter wegen dieser Verrücktheit keine gute Partie mehr machen konnte. Welcher ernsthafte junge Mann aus guter Familie und mit gesicherter Zukunft gäbe seinen Namen schon einem Mädchen, das auf diese Weise vom Weg abgekommen war? Er ging kaum noch in die Kanzlei, vernachlässigte seine Seminare, verwandte in den Tagen und Nächten nach der Enthüllung der Schwangerschaft seines Augensterns alle Gedanken darauf, herauszufinden, wer der Vater sein könnte. Martita hatte keine Verehrer. Ihr schien nicht einmal danach zu sein, mit den jungen Burschen zu flirten, so wie es die anderen Mädchen ihres Alters taten, für die Schule zu lernen war für sie das Wichtigste. War das nicht mehr als seltsam? Martita hatte nie einen Freund gehabt. Außerhalb der Schulstunden überwachte er alle ihre Ausflüge. Wer hatte sie wie und wo geschwängert? Und was ihm am Anfang unmöglich erschien, bahnte sich in seinem Kopf einen Weg, und er beschloss, sosehr der Zweifel an ihm nagte, den Stier bei den Hörnern zu packen. Er nahm seine alte Smith & Wesson, die er kaum je benutzt hatte – allenfalls mal im Jagd-, Schieß- und Angelclub, wo er auf Scheiben schoss, oder wenn seine Jägerfreunde ihn auf eine dieser Jagden schleiften, bei denen er sich fürchterlich langweilte –, und steckte fünf Kugeln hinein.
Unversehens erschien er an der Tür des Hauses, in dem Dr. Efrén García Ardiles mit seiner betagten Mutter wohnte, im angrenzenden Viertel San Francisco. Sein alter Freund war gerade aus der Praxis gekommen, wo er nachmittags arbeitete – vormittags hatte er Dienst im Hospital General San Juan de Dios –, und bat ihn herein. Er führte ihn in einen kleinen Salon mit Bücherregalen und primitiven Objekten der Quiché-Mayas, Masken und Graburnen.
»Beantworte mir eine Frage, Efrén.« Dr. Borrero Lamas sprach sehr langsam, als müsste er sich die Wörter aus dem Mund ziehen. »Wir sind zusammen auf die Maristenschule gegangen, und trotz deiner abwegigen politischen Ideen halte ich dich für meinen besten Freund. Im Namen dieser langen Freundschaft hoffe ich, dass du mich nicht anlügst. Hast du meine Tochter geschwängert?«
Er sah, wie Dr. Efrén García Ardiles kreidebleich wurde und mehrmals nach Luft schnappte. Und mit zitternden Händen stammelte er:
»Ich wusste nicht, dass sie schwanger ist, Arturo. Ja, ich war es. Das ist das Schlimmste, was ich in meinem Leben getan habe. Ich werde es auf ewig bereuen, das kannst du mir glauben.«
»Ich bin gekommen, um dich zu töten, du Hurensohn, verfluchter, aber nicht mal das schaffe ich, so sehr widerst du mich an.«
Und er weinte, mit Schluchzern, die seine Brust zum Beben brachten und sein Gesicht in Tränen badeten. Sie blieben fast eine Stunde zusammen, und als sie sich an der Haustür verabschiedeten, gaben sie sich weder die Hand noch klopften sie sich wie üblich auf die Schulter.
Wieder zu Hause, ging Dr. Borrero Lamas direkt zum Schlafzimmer seiner Tochter, wo er sie noch am Tag ihrer Ohnmacht eingesperrt hatte.
Der Vater sprach mit ihr, ohne sich hinzusetzen, von der Tür aus und in einem Ton, der keine Widerworte duldete:
»Ich habe mit Efrén gesprochen, wir haben eine Abmachung getroffen. Er wird dich heiraten, damit das Kind einen Namen hat und nicht auf die Welt kommt wie diese Köter, die die Hündinnen auf der Straße werfen. Die Hochzeit findet auf der Finca in Chichicastenango statt. Ich spreche mit Pater Ulloa, er soll euch trauen. Gäste wird es keine geben. Die Hochzeit wird in der Zeitung bekanntgemacht, danach werden die Anzeigen verschickt. Bis dahin tun wir weiter so, als wären wir eine Familie. Nachdem du Efrén geheiratet hast, werde ich dich nicht wiedersehen und mich auch nicht um dich kümmern, sondern dich wie auch immer enterben. Bis dahin bleibst du weiter eingeschlossen in diesem Zimmer und setzt keinen Fuß auf die Straße.«
So wurde es gemacht. Die plötzliche Hochzeit von Dr. Efrén García Ardiles mit einem fünfzehnjährigen Mädchen, achtundzwanzig Jahre jünger als er, gab Anlass zu den wildesten Gerüchten und hielt die Stadt Guatemala in Atem. Allen war klar, dass Martita Borrero Parra auf diese Weise nur heiratete, weil der Doktor sie geschwängert hatte, kein Wunder bei einem Menschen mit solch revolutionären Ideen, und alle hatten Mitleid mit dem rechtschaffenen Dr. Borrero Lamas, den seither nie wieder jemand lächeln, auf Feste gehen oder Rocambor spielen sah.
Die Hochzeit fand auf der abgelegenen kleinen Finca des Vaters der Braut außerhalb von Chichicastenango statt, wo er Kaffee anbauen ließ, und er selbst war auch einer der Trauzeugen; die anderen waren ein paar seiner Landarbeiter, die, da Analphabeten, mit einem Kreuz und Hingekritzeltem unterschreiben mussten, ehe sie zum Dank ein paar Quetzals erhielten. Es gab nicht mal ein Glas Wein, um auf das Glück der Frischvermählten anzustoßen.
Die Eheleute kehrten nach Guatemala-Stadt zurück, direkt zum Haus von Efrén und seiner Mutter, und alle besseren Familien erfuhren, dass Dr. Borrero, weil er es so versprochen hatte, seine Tochter nie wiedersehen würde.
Mitte 1950 brachte Martita einen Jungen zur Welt, der, zumindest offiziell, ein Siebenmonatskind war.
II
»Man muss die Nerven in den Griff kriegen, egal wie«, sagte Enrique und rieb sich die Hände. »Vorher werde ich bei solchen Sachen immer nervös. Aber wenn es so weit ist, beruhigen sich die Nerven, und ich mache es einfach. Geht dir das auch so?«
»Bei mir ist es umgekehrt«, sagte der Dominikaner und schüttelte den Kopf. »Ob ich wach werde, einschlafe oder aufstehe, ich bin nervös. Und wahnsinnig nervös, wenn ich handeln muss. Die Nerven gespannt, das ist mein Normalzustand.«
Sie waren im Büro der Generaldirektion für Sicherheit, die eine Ecke des Regierungspalastes einnahm; hinter den Fenstern war der Parque Central zu sehen, der Hauptplatz mit seinen dicht belaubten Bäumen, auch die Fassade der Kathedrale von Guatemala-Stadt. Es war ein sonniger Tag, noch wolkenlos, aber später würde der Regen niedergehen und bis in die Nacht die Straßen unter Wasser setzen und in kleine Sturzbäche verwandeln, so war es schon die ganze Woche gewesen.
»Die Entscheidung ist getroffen, alles tausendmal durchgespielt, und die Leute, auf die es ankommt, machen mit. Du hast für dich und die Doña die Passierscheine und die Genehmigungen in der Tasche. Warum sollte etwas schiefgehen?«, sagte der andere, fast flüsternd jetzt. Und mit einem Lächeln, wenn auch ohne eine Spur von Humor, wechselte er das Thema: »Weißt du, womit man die Nerven am besten beruhigt?«
»Mit einem ordentlichen Schluck trockenem Rum«, sagte der Dominikaner und lächelte ebenfalls. »Aber man muss ihn in einem Bordell trinken, nicht in so einem tristen Büro und umgeben von Ohren, wie man hier bei euch die Spitzel nennt. Ohren! Klingt schön. Gehn wir lieber ins Viertel Gerona, zu dieser Gringa, die sich die Haare färbt.«
Enrique schaute auf die Uhr:
»Es ist erst vier«, sagte er betrübt. »Wird geschlossen sein, noch zu früh.«
»Dann treten wir eben die Tür ein«, meinte der Dominikaner und stand auf. »Wir können jetzt nichts mehr tun. Die Würfel sind gefallen. Bis es so weit ist, trinken wir einen Schluck. Du bist eingeladen.«
Sie gingen los, und auf ihrem Weg durch den Raum voller Schreibtische erhoben sich die Zivilisten und die Militärs, um Enrique zu grüßen. Der blieb nicht stehen, und da er in Zivil war, verabschiedete er sich nur mit einem Nicken. Draußen, vor einer Seitentür des Gebäudes, erwartete sie das Auto mit dem hässlichsten Fahrer der Welt am Steuer. Er brachte sie rasch zu ihrem Ziel, und tatsächlich war das Bordell der Gringa noch geschlossen. Ein einsamer, hinkender Straßenkehrer wies sie darauf hin, dass erst geöffnet werde, »wenn es dunkel wird und regnet«. Sie klopften trotzdem, immer wieder, trommelten, bis die Tür sich irgendwann, nach einem Geklirr von Schlüsseln und Ketten, einen Spalt öffnete.
»Um diese Uhrzeit, meine Herren?«, fragte die Frau mit dem platinblonden Haar verwundert, aufgeregt auch, als sie die beiden erkannte. Miriam Ritcher, so ihr Name, sprach mit Akzent, um sich als Ausländerin kenntlich zu machen. »Die Mädchen schlafen noch. Oder frühstücken.«
»Wir kommen nicht wegen der Mädchen, wir wollen was trinken, Miriam«, fuhr Enrique sie an. »Können wir jetzt rein, ja oder nein?«
»Für Sie immer Ja.« Mit einem Schulterzucken zog die Gringa die Tür auf, trat zur Seite, damit sie hindurchkonnten, und sagte mit einer höflichen Verbeugung: »Nur herein, die Herren.«
Um diese Uhrzeit, ohne Licht und ohne Gäste, machte der kleine Barraum einen noch ärmeren und tristeren Eindruck als mit schummriger Beleuchtung, lärmender Kundschaft und aufgedrehter Musik. Statt Bildern hingen Plakate an den Wänden, Reklame für Getränke und die Eisenbahnlinie an die Küste. Die beiden Freunde gingen an die Theke und setzten sich auf zwei hohe Barhocker. Sie zündeten sich Zigaretten an, rauchten.
»Dasselbe wie immer?«, fragte die Frau. Sie trug einen Morgenmantel und Pantoffel. In diesem Aufzug, noch ungeschminkt und nicht zurechtgemacht, sah sie aus wie eine Hundertjährige.
»Dasselbe wie immer«, sagte der Dominikaner und lachte. »Und wenn möglich auch eine saftige Fotze zum Lecken.«
»Sie wissen genau, dass ich keine vulgären Ausdrücke dulde«, brummte die Wirtin, während sie ihnen die Getränke hinschob.
»Ich auch nicht«, sagte Enrique zu seinem Freund. »Mehr Respekt also, wenn du den Mund aufmachst.«
Sie schwiegen einen Moment, und auf einmal fragte Enrique ihn:
»Und du willst Rosenkreuzer sein? Was ist das für eine Religion, die es dir erlaubt, in Anwesenheit einer Dame vulgäre Sachen zu sagen?«
»Das mit der Dame gefällt mir«, sagte die Frau, die schon ging, ohne sich noch einmal nach ihnen umzuschauen. Sie verschwand durch eine Tür.
Der Dominikaner dachte kurz nach und hob die Schultern:
»Ich bin nicht mal sicher, dass das eine Religion ist, vielleicht nur eine Philosophie. Ich habe einen weisen Mann kennengelernt, es hieß, er ist Rosenkreuzer. Oben in Mexiko, ich war gerade erst angekommen. Der Bruder Cristóbal. Er hat einen Frieden ausgestrahlt, wie ich es in meinem Leben nie wieder gespürt habe. Und er hat mit einer großen Ruhe gesprochen, ganz langsam. Von den Engeln inspiriert, könnte man meinen.«
»Wie bitte? Inspiriert?«, fragte Enrique. »Einer von diesen verrückten Heiligen, die durch die Straßen ziehen und mit sich selber sprechen, meinst du das?«
»Er war ein weiser Mann, nicht verrückt«, bekräftigte der Dominikaner. »Er hat nie Rosenkreuzer gesagt, sondern immer ›der Alte Mystische Orden vom Rosenkreuz‹. Das konnte einem Respekt einflößen. Der Orden hat seinen Ursprung im alten Ägypten, sagte er, zur Zeit der Pharaonen, als geheime Bruderschaft, und so hat er jahrhundertelang überlebt, vor der Öffentlichkeit verborgen. Im Orient und in Europa ist er offenbar sehr verbreitet. Hier weiß kein Mensch etwas davon. In der Dominikanischen Republik auch nicht.«
»Und wie kannst du dann ein Rosenkreuzer sein?«
»Ich weiß nicht mal, ob ich einer bin«, sagte der Dominikaner bekümmert. »Ich hatte keine Zeit, es zu lernen. Den Bruder Cristóbal habe ich nur ein paarmal getroffen. Aber er hat mich geprägt. Nach dem, was er mir erzählte, hatte ich den Eindruck, dass diese Religion oder Philosophie am besten zu mir passt. Sie hat mir großen Frieden geschenkt, und sie mischt sich überhaupt nicht ins Privatleben der Leute ein. Wenn er sprach, hat er mir genau das vermittelt: Ruhe.«
»Aber ein bisschen seltsam bist du schon, oder?«, befand Enrique. »Und das sage ich nicht nur wegen deiner komischen Vorlieben.«
»Zumindest was die Religion und die Seele angeht, das ja«, sagte der Dominikaner. »Jemand, der anders ist als die anderen. Das bin ich, und es ist mir eine Ehre.«
III
›Ich brauche jetzt einen Schluck‹, dachte er. Und während er sich aus den Umarmungen befreite, die Ohren gemartert von den Hochrufen und den Jubeltrupps, die seinen Namen skandierten, sagte er leise zu María Vilanova: »Ich muss mal«, und nur rempelnd schaffte er es, den Balkon zu verlassen und ins Palastinnere zu entwischen. Er lief zu dem Büro, das seins gewesen war, solange er unter Arévalo das Amt des Verteidigungsministers innehatte. Er trat hinein, verriegelte von innen und öffnete das kleine, immer unter Verschluss gehaltene Zimmer hinter seinem Schreibtisch. Dort stand die Flasche Whisky. Er hatte kaum die Kraft, sie zu öffnen, und schenkte sich ein halbes Glas ein. Sein ganzer Körper zitterte, vor allem die Hände. Er musste das Glas mit allen zehn Fingern halten, nicht dass es überschwappte und seine Hose besudelte. ›Ein Alkoholiker bist du geworden‹, dachte er erschrocken. ›Du bringst dich noch um, wirst enden wie dein Vater. Das kann nicht sein.‹
Für Jacobo Árbenz Guzmán war der Selbstmord seines Vaters, eines Schweizer Apothekers, der sich in Quetzaltenango niedergelassen hatte, im westlichen Hochland von Guatemala, ein unergründliches Rätsel. Warum hatte er das getan? Lief die Apotheke schlecht? Hatte er Schulden? War er bankrott? Der Vater, ein Einwanderer, hatte in dieser bergigen Region, wo Jacobo selbst am 14. September 1913 geboren wurde und die Spuren des Maya-Erbes allgegenwärtig waren, eine örtliche Lehrerin geheiratet, Doña Octavia Guzmán Caballeros, und die hatte ihrem Sohn den Grund für den Freitod des Vaters immer verschwiegen (vielleicht wusste sie ihn auch nicht); erst Jahre später fand Árbenz heraus, dass sein Vater, ein verschlossener Mensch, an einem Zwölffingerdarmgeschwür litt und sich Morphiumspritzen setzte, um die Schmerzen zu lindern.
Warum trank er jetzt nicht dieses Glas Whisky, nach dem er sich so gesehnt hatte und das er mit beiden Händen umklammerte? Ihn erschreckte, wie sehr ihn während der ganzen Kundgebung zur Feier seines Sieges der Gedanke umgetrieben hatte. ›Bin ich schon Alkoholiker?‹, fragte er sich erneut. Dabei hatte er eine gewaltige Aufgabe vor sich! So viele Guatemalteken erwarteten etwas von ihm! Würde er sie enttäuschen, bloß weil er diesen jämmerlichen Hang zum Suff hatte? Trotzdem konnte er sich nicht aufraffen, den Whisky, der da zwischen seinen Fingern schaukelte, wegzuschütten, aber auch nicht, ihn zu trinken.
Als Kind und als Jugendlicher hatte Jacobo im Hochland mit eigenen Augen gesehen, wie die Masse der Indios ein Leben in Armut führte und von den Grundbesitzern erbarmungslos ausgebeutet wurde, ihm war also schon früh bewusst gewesen, dass es in Guatemala ein ernstes gesellschaftliches Problem gab, Ungleichheit, Ausbeutung, Hunger und Not, auch wenn es später heißen sollte, er sei nur dank seiner Frau, der Salvadorianerin María Cristina Vilanova, zu einem Mann der Linken geworden.
Er war immer ein begeisterter Sportler gewesen, Leichtathletik, Schwimmen, Fußball, Reiten, was wohl der Grund war, weshalb er die Militärlaufbahn eingeschlagen hatte; wobei auch die schwierige finanzielle Situation der Familie nach dem tragischen Tod des Vaters eine Rolle gespielt haben dürfte.
Seit jeher hatte er sich durch sein gefälliges Äußeres, seine akademische Brillanz und seine sportlichen Erfolge ausgezeichnet. Aber auch, ein Erbe des Vaters, durch sein anhaltendes Schweigen und sein ungeselliges und sprödes Wesen. Als er Mitte 1932 als Jahrgangsbester auf die Escuela Politécnica kam, die Militärakademie der Streitkräfte Guatemalas, sprach man von ihm als einem jungen Mann mit großer Zukunft. Im Laufe ihrer Ausbildung erhielten die Kadetten Dienstgrade; Árbenz erreichte den höchsten in der Geschichte der Schule: Hauptfeldwebel. Und er war Fahnenträger der Kadettenkompanie und Boxchampion.
Rührte seine Neigung zum Alkohol von dorther? Er erinnerte sich, dass das Trinken der beliebteste Zeitvertreib der Kadetten wie auch der Unteroffiziere und Offiziere war. Das größte Ansehen bei seinen Kameraden und Vorgesetzten verschafften ihm nicht seine guten Noten oder seine makellose Personalakte, sondern dass er gehörig saufen konnte. ›Strohköpfe‹, dachte er.
Noch als Kadett lernte er die schöne und intelligente María Cristina Vilanova kennen. Sie war auf Besuch in Guatemala, und bei einem Volksfest, das am 11. November zu Ehren des regierenden Diktators gefeiert wurde, des Generals Jorge Ubico Castañeda, machte man sie miteinander bekannt. An diesem Tag war der junge Mann sehr blass, denn er hatte einen Motorradunfall gehabt und kam gerade aus dem Krankenhaus. Sie fanden Gefallen aneinander, und als die junge Frau nach San Salvador zurückkehrte, schrieben sie sich heiße Liebesbriefe. In ihrer kleinen Autobiografie erzählt sie, dass sie in der Zeit ihres Verlöbnisses nicht nur über romantische Dinge sprachen, Thema war bald auch Ernsthafteres »wie Chemie und Physik«. María Cristina, geboren 1915, entstammte einer der sogenannten »vierzehn Familien« El Salvadors; sie hatte in den USA das Notre Dame de Namur College in Belmont, Kalifornien, besucht, sprach Englisch und Französisch und hätte eine Hochschullaufbahn eingeschlagen, wenn es ihr denn erlaubt gewesen wäre, aber in der damaligen Zeit gehörte sich so etwas für ein anständiges Mädchen nicht. Also musste die Lektüre ein solches Studium ersetzen, ihre Leidenschaft für die Literatur, die Politik, die Kunst. Sie war eine ruhelose junge Frau und hatte fortschrittliche Ideen, besorgt um die wirtschaftliche und gesellschaftliche Situation in Mittelamerika, und in ihren freien Stunden malte sie. Trotz des Widerstands ihrer Familie beschlossen die beiden jungen Leute zu heiraten, und so machten sie es auch, kaum dass Jacobo Árbenz zum Leutnant befördert wurde. Die kirchliche Trauung fand im März 1939 statt, wofür er zur Beichte und zur Erstkommunion gehen musste, da seine bisherige Erziehung eine laizistische gewesen war. Von Marías Familie erhielt das Paar als Hochzeitsgeschenk eine Finca in Guatemala, El Cajón, gelegen in der Gemeinde Santa Lucía Cotzumalguapa im Bezirk Escuintla. Natürlich war María Vilanova auch die Erste, die bemerkte, dass das, was als eine einfache Neigung begonnen hatte, mit der Zeit zu einem Laster wurde. Wie oft hatte seine Frau ihm gesagt: »Es reicht, Jacobo, du lallst schon, hör auf zu trinken!« Und immer gehorchte er.
Es war eine glückliche Ehe, und der Einfluss, den María Cristina mit ihrer Bildung und Empfindsamkeit auf den jungen Offizier ausübte, war groß. Sie brachte ihn mit Intellektuellen zusammen, mit Schriftstellern, Journalisten und Künstlern aus Guatemala und dem übrigen Mittelamerika, Menschen, die er sonst nicht kennengelernt hätte; darunter waren nicht wenige, die sich Sozialisten und Radikale nannten, und sie schimpften auf die in den mittelamerikanischen Ländern um sich greifenden Militärdiktaturen (wie die des Generals Ubico) und wollten für Guatemala eine Demokratie mit freien Wahlen, Pressefreiheit, freien politischen Parteien, wollten Reformen und die Indios aus dem Joch der Knechtschaft befreien, unter dem sie seit Kolonialzeiten lebten. Das Problem mit diesen Künstlern und Intellektuellen war, dachte er, dass sie alle dem Alkohol genauso zusprachen wie er; die Zusammenkünfte, auf denen er so viel lernte, endeten fast immer in einem Besäufnis. Wie hypnotisiert schaute er weiter auf die gelbliche Flüssigkeit in seinen Händen.