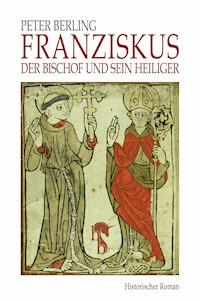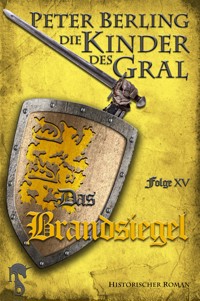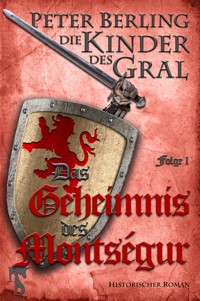
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Kinder des Gral
- Sprache: Deutsch
Der Gral-Zyklus: In der aufregendsten Zeit des Hohen Mittelalters erzählt Peter Berling in 17 Romanen das Schicksal jener Kinder, die aufgrund ihres Blutes als Träger der Krone auserwählt wurden. Die Gral-Serie besteht aus 17 Bänden: – Das Geheimnis des Montségur – Der Häscher des Kardinals – Im Lügengespinst von Byzanz – Die Piratin der Ägäis – Kreuzzug ins Verderben – Schicksal am Nil – Höhle der Muräne Christi – Im Banne der Assassinen – Geiseln des Großkhan – Die Rose im Feuer – Das Geheimnis der Templer – Ein blutig Hauen und Stechen – Die Braut von Palermo – Die Spur des Kelches – Das Brandsiegel – Das Haupt des Drachens – Ein Teppich in der Wüste 1244, Frankreich im Hochmittelalter: Schon seit einem Jahr belagern Ritter aus dem Norden Frankreichs die Trutzburg der Katharer, eine Kapitulation der Verteidiger erscheint unausweichlich. Doch die Kämpfer und Ritter in der Burg verlangen einen letzten Aufschub für die todgeweihte Feste. Während die Angreifer glauben sollen, dass die Templer ihr ketzerisches Fest »Consolamentum« feiern möchten, laufen in der Gralsburg die letzten Vorbereitungen für einen waghalsigen Plan. Denn Roç und Yeza, die Kinder des Grals, müssen in Sicherheit gebracht werden. Doch für Roç und Yeza ist die Flucht aus der Burg erst der Beginn einer abenteuerlichen Reise. Templer, Assassinen und Deutsche Ordensritter sollen die beiden um jeden Preis auf der Flucht nach Otranto in Apulien unterstützen. Dort wartet ein Schiff in die Freiheit. Doch die katholische Kirche veranstaltet eine Hetzjagd auf die Gralskinder, zu sehr fürchtet man in Rom ihre Macht … Ein spannender historischer Roman von Peter Berling, der gleichzeitig den Auftakt zum großen Epos »Die Kinder des Gral« aus der Zeit der Kreuzzüge bildet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 437
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
PETER BERLING
Das Geheimnis des Montségur
Folge I des 17-bändigen Kreuzzug-Epos Die Kinder des Gral[1]
Historischer Roman
WAS IST DER GRAL?
Einführung
Als im Hohen Mittelalter eine unheilige Allianz von Paris und Rom die letzte Zufluchtsburg der ›Reinen‹ ausgehoben hatte, (das griechische Wort ›Katharer‹ ist als ›Ketzer‹ seither in den Sprachgebrauch eingegangen), suchten die Eroberer vergeblich nach dem Schatz der Sekte, dem ›Gral‹.
Etwas ›Kostbares‹ war angeblich in der Nacht zuvor in Sicherheit gebracht worden. Gut Hundert Jahre Minnedichtung im Abendland hatte dafür gesorgt, dass der Gralsmythos den interessierten Eingeweihten bekannt war: ein einzigartiger Edelstein vom Himmel herabgestürzt? Ein köstlicher Kelch von Wert ohnegleichen? Das waren bis dahin die gängigen Vorstellungen. Dann verbreitete sich das Gerücht, es handele sich um zwei Kinder, Träger und einzige Erben des ›Heiligen, Königlichen Blutes‹. Nun ging es plötzlich um den Inhalt des Gefäßes, die Symbolik des Juwels, um das ›Heilige Blut‹, – zumindest bis zum Hause König Davids zurückreichend. Ihm allein soll die Herrschaft über die Welt zufallen.
Mit Einsetzen der Renaissance und in Folge der Aufklärung entschwand das Interesse am ›Gral‹. Verfremdet, auch missbraucht und in abgewandelter Form als ›Stein der Weisen‹ taucht er zur Hochzeit des Spiritismus und der Alchemie wieder auf, um dann Ende des 19. Jahrhunderts bis weit ins 20ste zu einer neuen Blüte anzusetzen.
Nach wie vor ist ungeklärt, bleibt auch wohl unerklärbar, ob es sich bei dem vielbenutzten Begriff (mit dem Zusatz ›Heilig‹ auch von der Kirche gern vereinnahmt), überhaupt um ein materielles Gut, um Materie im klassischen Sinne handelt. Oder ob ›Gral‹ nicht vielmehr ein Erinnern an das Geheimnis des Entstehens der Menschheit verbirgt, die Sehnsucht nach dem Ur-Wissen, seinen Gefahren und Gefährdungen, aber auch der nie versiegenden Hoffnung auf die Existenz eines Höheren Wesens …
ANMERKUNG DES VERFASSERS
Lange Zeit galten die in diesem Buch auszugsweise zitierten Aufzeichnungen des Franziskaners William von Roebruk (*1222) als in arabischen Bibliotheken verschollen. Niemand suchte nach ihnen, niemand bemühte sich um eine Übersetzung. Teile gingen, trotz vielfacher arabischer Abschriften, im Laufe der Jahrhunderte verloren. Aus ihren Resten – und anderen Quellen – hat der Autor die hier wiedergegebene Geschichte rekonstruiert. Ihre Einleitung ist ein Schreiben, das der Minorit wohl am Vorabend seiner Reise zu den Mongolen zu treuen Händen seines Ordensbruders Lorenz von Orta (Portugal) hinterließ, eine Mission, die ihn in den Jahren 1253–1255 als Gesandten Königs Ludwig IX. von Frankreich nach Karakorum, dem Sitz des Großkhans, führte. Das Dokument befand sich bei den ›Starkenberg-Rollen‹ und ist hier in gekürzter Form wiedergegeben.
Die ›Roebruksche Chronik‹ selbst setzt kurz vor 1244 ein, dem Jahr der Kapitulation der Gralsburg Montségur sowie auch des endgültigen Verlustes von Jerusalem. Sie ist überwiegend in latinesker Sprache verfasst, enthält jedoch zahlreiche Zitate und Verse in den damals geläufigen Idiomen des Mittelmeerraumes, der sogenannten ›lingua franca‹, einer Mischung aus Provenzalisch, Mittelhochdeutsch, Altgriechisch und Arabisch, deren Spuren sich heute noch als ›rätoromanisch‹ in abgelegenen Hochtälern der Alpen finden. Dieses ›ladin‹ wurde zum Teil original beibehalten. Übersetzungen befinden sich im Anhang.
Um dem interessierten Leser den Einstieg in die Geschichte zu erleichtern, hat der Autor vor jedem Unterkapitel Ort und Zeit notiert, wie auch mit dem Vermerk »Chronik« die Transkription des Originaltextes William von Roebruks gekennzeichnet. Dem Text angehängt ist ein ausführliches Personenverzeichnis, das zur besseren Übersicht parteilich gegliedert ist. Im Anhang befindet sich zudem ein ausführliches Glossarium, das chronologisch auf im Text erwähnte historische Fakten und Daten eingeht.
Die hier vorgenommene Aufteilung der Pentalogie von »Die Kinder des Gral« in 17 Bände folgt dem Wunsch zahlreicher Leser im In- und Ausland – insgesamt zum heutigen Tag über 1,4 Millionen –, handlicheres Lesematerial zur Mitnahme auf Reisen und Urlaub zur Verfügung zu haben. Es entspricht auch meiner Vorstellung vom Teilen eines Gesamtwerkes in leichter übersichtliche Blöcke, denen weitere vorangestellt werden oder nachfolgen können.
Rom, den 28. Mai 2012
Peter Berling
PROLOG
In memoriam infantium ex sanguine regali
Dem Andenken der Kinder aus königlichem Blut
(Aus der Chronik[2]des William von Roebruk[3])
Goldglühendes Licht einer für mich schon versunkenen Abendsonne lag noch auf der Ketzerfeste, als wolle Gott sie für unser Auge noch einmal emporheben in ihrer Verblendetheit, bevor sein Zorn sie zerschmettern würde als Strafe für ihre Sünden. Wir waren eben erst am Fuße des Pog eingetroffen, und bei uns unten im Tal herrschten schon die schwarzvioletten Schatten der schnell hereinbrechenden Nacht. So trat mir der Montségur[4] ein erstes Mal entgegen, und ich erschauerte ungewollt, ärgerlich über mich selbst. Noch hielt ich Gott für den Unsrigen, von der Rechtschaffenheit meiner katholischen vocatio[5] überzeugt, die mich ausgesandt hatte, am Ausbrennen dieser Eiterbeule ruchloser Häresie[6] teilzuhaben.
Ich, William von Roebruk, ein dralles Bauernschlitzohr aus dem Flämischen, in der ärmlichen Kutte meines Ordens der Minderen Brüder und dank eines gräflichen Stipendiums mit dem Hochmut eines studiosus parisiensis im Herzen, allwo ich die Universität besuchte, ich fühlte mich wie der Großinquisitor: »Zittere, katharische Schlangenbrut, dort oben im falschen Glanz einer heidnischen Sonne! Bald wird ein anderes Feuer euch leuchten, wenn erst aus den Scheiterhaufen eure gottlosen Seelen zur Hölle fahren!«
Heute, nach zehn Jahren – und über dreißig und bald kahlköpfig –, kann ich nur lächeln, wehmütig lächeln über den armen, ahnungslosen Franziskaner-Tölpel an der Schwelle zu einer nie geträumten Welt großer, geheimnisvoller, wilder und gemeiner, ja perfider Geister, wie er da stand am nicht erkannten Rand eines Hexenkessels voller Abenteuer, Nöte und Verderben – vor dem Eintritt, ach was, dem Hineinstürzen in ein Leben, gestößelt und gequirlt in Leidenschaft, Neid, Intrigen und Hass. Ein Leben, das in mir mehr einen Spielball sah, den es nach Lust und Laune herumwarf, auf dass mir noch Hören und Sehen vergehen sollte. Alles das vermochte ich nicht zu erahnen, doch ich erinnere mich eines Schauers im Angesicht der Gralsburg in jenem Licht. Munsalvätsch!
Begonnen hat es mit mir wohl an einem fernen anderen Ort. Das gräfliche Geschlecht derer vom Hennegau hatte aus Freude, einen der ihren zum Kaiser von Konstantinopel[7] gekürt zu sehen, auch die Pfarrei zu Roebruk mit einer Stiftung bedacht: ein letztgeborener, viel-, wenn nicht gar mehr versprechender Knabe des Dorfes durfte, den priesterlichen Konsens vorausgesetzt, zur höheren Ehre Gottes studieren. Ich war der Jüngste, leider! Und so und mit kirchlichem Segen, sprich obolus[8], hatte mein Vater mich ins nächste Franziskanerkloster geprügelt, ohne sich um mein Protestgeschrei zu kümmern. Die Tränen meiner Mutter galten auch weniger meiner Not als der Sorge, ich vermöchte ihren Ehrgeiz zu enttäuschen, einen ruhmreichen Missionar zu ihren Söhnen zu zählen. Auch ein von Heiden erschlagener Märtyrer wäre ihnen nur recht gewesen!
Ich überstand das Noviziat, dank heimlich zugesteckter Kuchen, ohne körperlichen Schaden zu nehmen, was mir schon den Glorienschein des Auserwählten verlieh. Alsbald erhob ich das Betteln aus dem niedrigen Stand einer Tugend zu einer sich stets verleugnenden, sich gleichwohl selbst vergoldenden Kunst, sodass es mir nicht schwerfiel, meine Ordensoberen, kaum, dass die Tonsur mich verunzierte, zu überzeugen, mir einen Platz an der Universität zu beschaffen. Mein Vater legte sich stolz eine Schweinemast zu, meine Mutter hoffte noch heftiger auf eine Art wundersame Kanonisierung, zumindest Seligsprechung. Mit nicht einmal neunzehn Lenzen verfrachtete man mich – viribus unitis[9] – nach Paris.
Ha, welche Stadt, doch welch teures Pflaster! Hier verfeinerte ich meine ordensmäßig anerzogene Gabe des Schnorrens zu hoher Blüte. Almosen? Welch demütigendes Konzept unwürdigen Daseins! Ich hielt die Gesellschaft derer aus, die mich aushielten: freien Austausch gegenseitiger Gunstbeweise möchte ich es genannt wissen!
Dem schwer vermeidbaren Studium der klassischen Theologie entzog ich mich weitgehend, mein ›Missionarsgewissen‹ immerhin beschwichtigend, indem ich das Arabische als Pflichtfach auf mich nahm, um mich für den unerbetenen Fall zu wappnen, meine Kustoden würden eines Tages auf die Idee kommen –meine Mutter ließ nicht locker! –, mich in die Wüsten der Terra Sancta[10] zu deportieren! Dort müsste ich die Heiden, wenn schon nicht um mein Leben, wenigstens um einen Schluck Wasser anflehen können. Die Macht des wohldozierten Wortes hatte mich schon immer beeindruckt, weshalb ich auch die Disziplinen der freien Predigt und der strengen Form der Liturgie nie vernachlässigte.
Dann suchte mein König jemanden, der ihm die Sprache der Muslime beibringen könnte. Ludwig der Heilige[11] spielte wohl schon seinerzeit mit dem erhebenden Gedanken, den Sultan persönlich zur Rede zu stellen, um ihn von seinem heidnischen Glauben abzubringen. Nicht weniger mag ihn bewogen haben, dass sein kaiserlicher Cousin Friedrich[12] diese Zunge glänzend beherrschte und darob viel Rühmens war. Für den hochfahrenden Herrn Studiosus, den ich damals spielte, ein erstaunliches Ansinnen, schien mir dieses Idiom doch ein gering geschätzter Behelf für von chronischer Schwindsucht Befallene, die Freude daran finden, sich gegenseitig anzuhusten und anzuspucken! Wenn ich heute dem Vortrag arabischer Dichter lausche, könnte ich vor Scham über meine jugendliche Ignoranz im Boden versinken, erhebt mich der Wohlklang ihrer Verse doch in lichte Höhen sonst nirgendwo erfahrener sprachlicher Schönheit.
Mein König hatte weit weniger im Sinn. Sich den ehrwürdigen Meister Ibn Ikhs Ibn-Sihlon, bei dem ich lernte, an den Hof kommen zu lassen traute er sich wohl nicht recht. So wurde ich als harmloser Mittler auserkoren, denn alle hielten mich für diesem Idiom besonders zugetan.
Zu einem geregelten Unterricht kam es nie. Wenn er mich kurz empfing, zog es mein Souverain vor, mit mir zu beten, oder ich musste ihm Geschichten von Saint-François[13] erzählen, den ich allerdings gar nicht mehr persönlich erlebt habe, was ich, um ihn nicht zu enttäuschen, stets geschickt überspielte. Wir waren's beide so zufrieden.
Es muss ein wüster Albtraum gewesen sein, der meinen Herrn und allergnädigsten Gebieter heimsuchte, oder es waren seine Gebresten, Blutarmut und Rotlauf, unter denen er litt, oder plagten ihn seine sonstigen geistlichen Berater – zu denen ich mich kaum zählen durfte? Seit Wochen lagen sie ihm in den Ohren, endlich den letzten Stachel der Ketzerei aus dem seit langem geschlagenen und geschundenen Fleisch des Südens zu reißen. Wahrscheinlich waren es die Einflüsterungen seines obskuren Beichtvaters Vitus von Viterbo[14], vom Papst[15] persönlich geschickt, die ihn drängten, die Madonna zu versöhnen und den frechen Inquisitorenmord von Avignonet[16] zu rächen. Jedenfalls schwor der fromme Mann der allerheiligsten Jungfrau, nunmehr dem Ketzernest auf dem Pog de Montségur den Garaus zu machen. Jenem Maulwurf Roms – ich bekam ihn nie zu Gesicht – mögen unsere gemeinsamen Gebete ein Dorn im Auge gewesen sein, sodass ich mich eines Tages von königlicher Güte überschüttet sah: Ich erhielt das Privileg, bei dem Unternehmen gegen die Katharerfeste mitzuwirken – als Feldkaplan eines Provinz-Seneschalls, der schon zwei hatte und eigentlich keinen mehr wollte.
Der Viterbese sorgte dafür, dass ich sofort meine Bestallungsurkunde in die Hand gedrückt kriegte und in Marsch gesetzt wurde. Ich sah einen eintönigen Aufenthalt auf dem Lande vor mir, packte ein paar Bücher ein, die hoffentlich der Bibliothek nicht zu sehr fehlen würden, um dem Stumpfsinn eines Feldlagers in der Provinz meine geistige Weiterbildung entgegensetzen zu können, verabschiedete mich auch nicht von meinen treu sorgenden Eltern, die mich und mein Ordenshaus in der Kapitale immerhin erfreulich regelmäßig mit Schweinswürsten und Speck versehen hatten, und begab mich lustlos auf die mir zugemutete Reise in den dumpfen Süden. Ich sollte weder Dorf noch Paris noch die lieblichen Gestade Flanderns je wiedersehen.
Einmal ins Mittelmeer getaucht, geriet ich in die Strudel von Skylla und Charybdis[17]; sie sogen mich in die Tiefe, rissen mich fort, warfen mich an Strände, von denen ich nie geträumt hatte – oder doch? Waren das nicht die endlosen Wüsten, die steinigen Gebirge, in denen der Versucher mich auf den Turm führte, jene Einöden, vor denen ich mich als Bub und noch als Novize geängstigt hatte, welche ich nun durchzog, durch die ich gezogen wurde, kleiner Bauer im gigantischen Schach der Großen dieser Welt. Bald Läufer, bald Springer – bedroht von finsteren Türmen, umschmeichelt von hohen Damen, Figur welchen Königs?
Anfangs diente ich noch Ludwig in bedingungsloser Loyalität. Er war mein guter Souverain; fehlte ich seiner, schämte ich mich, soweit mein Sinn für Scham entwickelt war. Doch in dem Maße, in dem ich ihn aus dem Auge verlor, schwand auch mein flämisch bodenständiges Selbstverständnis. Ich war entwurzelt. Andere Kräfte schoben mich bis an den Rand des Universums, warfen mich von dem übersichtlichen Brett, das mir so klar in Schwarz und Weiß aufgeteilt zu sein schien. Stellten mich zurück ins Spiel, wenn ich mich schon längst aufgegeben hatte, jagten mich, vergaßen mich. War Schwarz das Gute, für das es dem Mönch der Ecclesia catolica[18] zu kämpfen galt? War das rote Tatzenkreuz der Templer noch Signum Christi? Das grüne Tuch der Muslim, Versprechen oder Verdammnis? Die Feldzeichen der Mongolen, Brandeisen des Teufels? Oder die weißen, wehenden Gewänder der Katharer – verhießen sie doch das Paradies? Ich erfuhr Barmherzigkeit von den Assassinen[19], bedingungslose Treue von den Tataren[20], fand Freunde unter christlichen Rittern und Edelmut bei den arabischen Emiren. Ich erlebte Gift, Niedertracht und grässlichen Tod, ich sah Liebe und Opfer, doch kein Schicksal hat mich mehr bewegt als das der Kinder – der Infanten des Grals.
Ihrem Andenken fühle ich mich verpflichtet. Sie waren mir verwandt, als seien es die Meinen. Sie waren die zarten Figuren der Hoffnung, die von gnadenlosen Gewalten über das Spielbrett geschoben wurden, das kindliche Herrscherpaar im ›Großen Plan‹. Mein König und meine Königin! Mit ihrem Ende zerstob der Traum von Frieden und Glück für den Rest der Welt. Ich war nur eine kleine unwichtige Figur, die überleben durfte. Sie wurden geopfert, noch bevor die Partie zu Ende ging.
Von ihnen will ich berichten …
I MUNSALVAETSCH
Die Belagerung
Montségur, Herbst 1243
Als schroffer Felskegel ragt der Montségur aus der zerklüfteten Niederung – entrückt, wie nicht von dieser Welt und nur himmlischen Heerscharen sich öffnend, so sie denn aus ihrer Engelsperspektive eine Handbreit platten Grundes erspähen, um ihre Himmelsleiter aufzusetzen. Naht ein menschlicher Eindringling vom Norden her, scheint der Berg zum Greifen nah wie ein abgesetzter Helm, den eine Zauberhand steil in die Höhe hebt, je näher sein Fuß der Flanke rückt. Schleicht er sich, dem Trug des weich abfallenden Bergrückens erliegend, von Osten an, wirft ihn der gereckte Schild des Roc de la Tour zurück, wenn er ihn nicht in die gischtige Klamm des Lasset schleudert, der sich so tief in die Felsen geschnitten hat, dass von dort unten nicht einmal mehr die Kuppe des Berges, geschweige denn die Burg zu sehen ist. Nur im Südwesten lädt nach geschwungenem Hang ein bewaldeter Sattel ein. Doch kaum hat der keuchende Kletterer den Schutz des Unterholzes verlassen, zieht die nackte Geröllhalde steil nach oben. Und genau über ihm kragen die Mauern. Er kann das Tor erkennen, und er weiß, es wird sich ihm nicht öffnen. Sein Herz klopft wild, sein Atem geht stoßweise, die Luft ist dünn – blauviolett leuchten die Gipfel der nahen Pyrenäen herüber, auch in diesem Altweibersommer des Jahres 1243 schon mit Schnee bedeckt. Der Wind fährt raschelnd durch die Blätter des Buchsbaumes. Der Eindringling hört das Zwitschern des Armbrustbolzens nicht, der ihm die Kehle aufreißt, ihn an den Stamm des Bäumchens nagelt. Sein Blut quillt wie aus einem erquickenden Quell, nach dem er sich während des Aufstieges so gesehnt. Es sprudelt hervor in den Stößen seines ermattenden Herzschlags. Die grauen Felsen über ihm verwachsen mit den Mauern, werden hell, licht wie der Himmel dahinter, die Sinne haben ihn verlassen, bevor er rückwärts in das dunkle Grün des Waldes stürzt, den er nicht hätte verlassen sollen.
Das Feldlager hatte sich auf dem gegenüberliegenden Wiesenhang breitgemacht, in respektvoller Distanz zum Pog und in sicherer Entfernung vor der Reichweite der Steinschleudern. In seiner Mitte hatten die beiden Anführer ihre Zelte aufgeschlagen: Pierre Amiel, Erzbischof von Narbonne und Legat des Papstes, der sich die Vernichtung der »Synagoge Satans« eifernd aufs Panier geschrieben, und in gebührendem, wenn nicht gesuchtem Abstand zu diesem lagerte Hugues des Arcis, Seneschall von Carcassonne, den der König zum militärischen Führer der Unternehmung bestellt hatte.
Obgleich der Legat dem Heer wie jeden Morgen die Messe gelesen hatte – viel lieber wäre er wohl an dessen Spitze mit Leitern und Türmen gegen die Ketzerfestung gestürmt –, kniete der Seneschall auch zum abendlichen Angelus-Läuten vor seinem Zelt zum Gebet nieder, umgeben von seinen drei Feldkaplanen, als deren einer William von Roebruk amtierte.
Der Erzbischof, dem zuviel gebetet und zu wenig gekämpft wurde, wartete mühsam beherrscht das Amen ab: »Das Heil Eurer Seele solltet Ihr weniger im Frieden mit Gott als im Kampf gegen seine Feinde suchen!«
Der Seneschall genoss es, sich noch nicht erhoben zu haben, hielt die Augen geschlossen und die Hände gefaltet – weiß zeichneten sich die Knöchel seiner gepressten Fäuste ab –, aber er schwieg.
»Diese Art schonender Belagerung praktizierte der Graf von Toulouse[21] lange genug, und mein Herr Papst –«
»Ich diene dem König von Frankreich«, unterbrach ihn hier Hugues des Arcis; er hatte sein seelisches Gleichgewicht wiedergefunden und ließ in Ruhe seinen Ärger an seinem geistlichen Gegenspieler aus, »und werde – so Gott will – getreulich seinen Befehl ausführen: Einnahme des Montségur!«
Er stand auf und entließ seine Kaplane mit einer schroffen Handbewegung. »Die Ketzerverfolgung, die Euch so am Herzen liegt, muss sich diesem Primat beugen. Sie von einem Toulouse zu erwarten, zeugt von wenig politischem Fingerspitzengefühl: handelt es sich doch bei den Verteidigern um seine eigenen ehemaligen Vasallen, oft sogar um Blutsverwandte!«
»Faidits[22]!«, schnaubte der Erzbischof. »Treulose Verräter, Aufrührer! Und der hier zuständige Lehnsherr, der Vicomte von Foix[23], hält es nicht einmal für nötig, bei uns zu erscheinen!«
Der Seneschall wandte sich zum Gehen: »Sein Nachfolger ist längst bestimmt: Guy de Levis[24], Sohn des Kampfgefährten des großen Montfort! Soll er für ihn das Eisen aus dem Feuer holen!«
Pierre Amiel heftete sich geifernd an seine Fersen. »Feuer? Das solltet Ihr hinauftragen und in das Nest dieser Teufelsbrut werfen, auf dass sie alle in Rauch und Flammen zur Hölle fahren!«
Wortlos bückte sich der Seneschall und zog einen brennenden Ast aus einer der Feuerstellen. »Die Fackel der Inquisition!« höhnte er und streckte dem verdutzten Erzbischof das flammende Holz entgegen. »Tragt sie hinauf! Wenn Ihr unterwegs genug blast oder die heilige Jungfrau Euch ihren Odem leiht, wird sie schon nicht verlöschen!«
Da der Legat keine Anstalten machte, den schwelenden Ast entgegenzunehmen, warf ihn der Seneschall zurück in die Glut und schritt von dannen. Sein Gefolge, das solche Auftritte von ihm gewöhnt war, mochte sich ein Lachen nicht verkneifen.
Die Dämmerung brach herein; überall leuchteten jetzt die Lagerfeuer auf. Die Marketenderweiber füllten die Bottiche, und die Soldaten drehten die Spieße, weil die Jagd in den Wäldern des Corret und das Plündern der Bauern des Taulats heute etwas gebracht hatten. Sonst wären nur gesammelte Eicheln und Kastanien und das harte Brot geblieben, das die Fourageure[25] verteilten.
Die Mannschaften waren Söldner. Ihre Herren, die Kreuzritter, waren Noble aus dem Norden, die sich dem Wunsch ihres Souverain Ludwig nicht widersetzen mochten, Schmeichler, die seine Gunst zu erringen trachteten, oder einfach Abenteurer, die sich – die Lehen und Pfründe waren längst vergeben – wenigstens Beute und sonstigen Gewinn versprachen, zumal die Kirche jedem Teilnehmer vollkommenen Ablass und Vergebung aller Sünden zugesichert hatte.
Die Mauern des Montségur, dessen stärkste Flanke im stumpfen Winkel auf das Heerlager herabsah, waren in das Gold der untergehenden Sonne getaucht.
»Wie viele mögen es wohl sein?« Esclarmonde de Perelha[26], die junge Tochter des Kastellans, trat furchtlos an die zinnenlose Brüstung der Mauer und schaute hinab ins Tal. »Sechstausend, zehntausend?«
Der Vicomte Pierre-Roger de Mirepoix, Schwager Esclarmondes und Kommandant der Festung, lächelte. »Es sollte Euch nicht berühren«, sanft drängte er sie zurück, »solange sie nicht in der Lage sind, auch nur hundert unter die Wälle zu schicken.«
»Aber sie werden uns aushungern –«
»Bislang hat jeder der Herren da unten sein Zelt nach Gutdünken aufgeschlagen, sich landsmannschaftlich voneinander absetzend.« Der Mirepoix wies mit der Hand über Hang, Hügel und Täler. »Diese dümmliche Arroganz, unterstützt von der zerklüfteten, unübersichtlichen Umgebung und den dunklen Wäldern, vor denen sie sich fürchten, hat für uns zur angenehmen Folge, dass ihr Belagerungsring mehr Löcher aufweist als der Käse aus den Pyrenäen, den man uns wöchentlich frisch hier heraufbringt.«
Es war offensichtlich, dass er ihr Mut zusprechen wollte. Schon ihr Name verpflichtete Esclarmonde dem Vorbild der berühmtesten Katharerin, jener ›Schwester‹ Parsifals[27], die vor nun bald vierzig Jahren den Montségur hatte ausbauen lassen. Auch die junge Esclarmonde war eine parfaite, eine Reine. Ihr leibliches Leben war in höchster Gefahr, wenn der Berg des Heils nicht standhalten sollte. Doch solche Gefahr achtete sie gering.
»Der Gral –«, sagte sie leise, ihre einzige Sorge dem Vicomte mitteilend, »sie sollen ihn nicht erfahren, noch Hand an ihn legen können.«
Zwei kleine Kinder waren unbemerkt hinter sie getreten. Der Junge umklammerte furchtsam die Beine der jungen Frau, während das zierliche Mädchen keck an den Mauersims trat, einen Stein in die Tiefe warf und verzückt seinem Aufschlag lauschte, der erst den Kommandanten auf sie aufmerksam machte.
»Ihr sollt doch nicht hier oben –«, entfuhr es ihm, da sah er schon die Amme von der Treppe herbeistürzen, die vom Burghof steil hinaufführte. Er gab der Kleinen einen Klaps, griff sie am Schlafittchen und drückte sie der Dienerin in die Hand. Esclarmonde strich dem Jungen übers Haar, der artig der Frau folgte.
»Wie lange noch?« wandte sich Esclarmonde wieder an den Vicomte.
Der Festungskommandant schien in Gedanken versunken. »Friedrich kann uns nicht im Stich lassen …« Doch seiner Stimme gelang es nicht, den Zweifel zu verbergen.
»Der Staufer tritt das Heil mit den Füßen«, sagte sie ohne Bitternis, »sein eigenes – wie viel mehr erst das seines Blutes. Verlasst Euch nicht auf ihn – um ihretwillen!« Sie warf einen Blick auf die beiden Kinder, die alles daransetzten, der Amme den Abstieg auf der steilen Steintreppe zu erschweren.
»Es gibt eine höhere Macht. Ich schwöre Euch, Esclarmonde, sie werden gerettet werden. Seht her!« Er schritt hinüber zur Ostecke, wo sich das überdachte Observatorium befand. »Diese Seite, wo der Lasset aus den Tabor-Bergen durch die tief eingeschnittene Schlucht tost, ist völlig unbewacht geblieben.«
Esclarmonde grüßte mit zusammengelegten Handflächen die weiß gekleideten Greise, Parfaits wie sie, die von der Plattform den Lauf der aufblinkenden Gestirne beobachteten.
»Neben der mangelnden Disziplin unserer Feinde«, fuhr der Mirepoix fort, »hilft uns vor allem, dass viele der geworbenen Truppen mit uns sympathisieren. So die aus dem Camon, ehemalige Lehnsleute meines Vaters – sie lagern unterhalb des Roc de la Tour.« Er bemühte sich der jungen Frau Zuversicht einzuflößen. »Solange er in unserer Hand ist, reißt die Verbindung zur Außenwelt nicht ab – und so besteht durchaus Hoffnung …«
»Ach, Pierre-Roger«, sie legte ihre Hand auf seine Schulter, »hofft nicht auf die Außenwelt, versperrt sie doch nur den Blick auf die Tür zum Paradies. Das Paradies jedoch ist die Gewissheit, die uns keiner nehmen kann!«
Sie entließ ihn mit einem heiteren Lächeln.
Dunkelheit hatte inzwischen den Montségur umfangen, dafür leuchteten die Sterne um so heller. Unten im Tal glimmten die Feuer, doch die zotigen Gesänge, das Kreischen der Huren und das Fluchen der Soldateska beim Würfelspiel und beim Saufen drang nicht bis zur Spitze des Berges herauf.
Die Stimmung im Lager war schlecht. Es nahte der Herbst. Sie hockten hier nun schon ein gutes halbes Jahr. In den ersten Tagen hatten etliche Draufgänger Sturmangriffe auf eigene Faust versucht und sich dabei blutige Nasen geholt. Die strategische Lage und die Feuerkraft der Festung hatte nicht umsonst über zwei Generationen hinweg allen Attacken getrotzt.
Der Seneschall wusste darum und hielt sich zurück, obgleich der päpstliche Legat ihn ständig drängte. Doch auch Hugues des Arcis wurde ob der untätigen Warterei am Fuße des Pogs immer unleidlicher. Er ließ seine Feldkaplane mehrmals am Tage die Messe lesen, als ob Beten seine militärische Lage hätte verbessern können. So war auch in dieser Nacht der Franziskaner zum Beten angetreten, als dem Seneschall die Eingebung kam.
»Baskische Gebirgsjäger!« eröffnete er William, der gewohnheitsgemäß niedergekniet war. »Wir sollten sie sogleich anwerben, für teures Geld, auch wenn sie sich kaum aufmachen werden, bevor die Ernte eingebracht ist!«
»Gelobt sei der Herr und die heilige –«, begann William.
»Heb deinen flämischen Arsch«, schnaubte der Seneschall, »und reich mir lieber den Krug rüber! Darauf müssen wir trinken!«
Die Montagnards[28]
Montségur, Winter 1243/44 (Chronik)
Im Spätherbst traf das Korps der ›Montagnards‹ aus dem fernen Baskenland bei uns ein. Mein Herr, der Seneschall, ließ sie gar nicht erst im Feldlager kampieren, sondern führte sie persönlich um die Nordwestecke des Pogs herum, unter den Roc de la Portaille, hinter dem die Wand am steilsten aufragt, dass man den Donjon[29] des Montségur von unten kaum noch sehen kann. Hier ließ er sie rasten.
Zum Neid meiner Mitbrüder hatte er nur mich erwählt, ihn zu begleiten. Am Nachmittag brachen wir wieder auf und schlängelten uns unter der Nordwand, vor jedem Blick geschützt, durch die hohen Tannen des Waldes von Serralunga, dessen Ausläufer hier bis an den Fels heranreichen.
Ich ging hinter Jordi, einem der Hauptleute der Basken. Nur mit Mühe gelang es mir, mit ihm Schritt zu halten und ihn in ein Gespräch zu verwickeln, wobei wir uns mit einem Gemisch italienischer und latinesker Brocken behalfen. Ich hatte nicht die leiseste Ahnung, wohin unser geheimer Zug führen sollte.
»Roc de la Tour«, beschied er mich knapp.
Und ich keuchte stolpernd: »Warum?«
»Eine Wurst, die man schneiden will, muss man erst mal zubinden. Und das hat man dort vergessen«
Ich schwieg. Zum einen, weil mir bei seinen Worten sofort Hungergefühle aufstiegen, zum anderen weil mir beim Gedanken ans Essen der ›Gral‹ durch den Kopf schoss, von dem hier alle im Lager munkelten, aber worüber mir keiner auch nur eine im geringsten befriedigende Antwort geben konnte. Es musste mehr sein als ein Schatz, eine Labsal, die keinen Durst mehr verspüren ließ, ein himmlisches Manna, das einen armen Mönch wie mich über alle irdische Mühsal erhob.
»Suchen wir den Schatz, diesen Gral?« bohrte ich vorsichtig, weil ich mich schämte, es nicht besser zu wissen, und weil ich schon oft die wunderlichsten, schroffsten Reaktionen erlebt hatte, wenn unsereins auf den eigentlichen Grund unseres Kreuzzuges zu sprechen kam.
»Nein, William«, grinste Jordi, »es geht um einen Haufen wertloser Steine, um die sich keiner gekümmert hat, weswegen sie für die Verteidiger des Montségur zum bequemen Mauseloch geworden sind, durch das sie ihren Nachschub holen – doch jetzt kommt die Katze!«
Er lachte pfiffig, und ich wusste so viel wie zuvor, immerhin aber ungefähr, wo der Roc de la Tour lag: am äußersten Nordostpunkt des Pog, dort wo sich der Sattel des Berges senkte und den Lasset wieder freigab.
»Warum gehen wir nicht durch die Schlucht, die viel kürzer sein soll?«
»Ganz einfach, weil dort die Templer wachen und längst unser Kommen hinaufsignalisiert hätten!«
»Das sind doch christliche Ritter«, schnaubte ich empört, »wie könnt Ihr denken, sie hielten es mit den Ketzern?«
»Du hast nach dem Gral gefragt, Franziskaner? Da hast du die Antwort!« Er schritt jetzt schneller und gab mir so zu verstehen, dass er mir nichts weiter sagen wollte.
Bald waren wir am Fuße des Felsen angekommen, wo die Leute aus dem Camon lagerten. Der Empfang war frostig, wenn nicht feindselig. Sie begrüßten den Seneschall förmlich, die Basken hingegen gar nicht. »Verräter!« hörte ich sie zischeln.
Mittlerweile war es dunkel geworden. Der Seneschall verbot, was die Stimmung nicht gerade hob, jedes Feuer, um Lichtsignale zu verhindern.
Über uns, dem Auge halb verborgen hinter schnell ziehenden Wolkenfetzen, reckte sich das Vorwerk der Ketzerfeste in die mondlose Nacht. Die Montagnards hatten sich die braungegerbten Gesichter zusätzlich noch mit Ruß geschwärzt. Sie trugen keine Rüstungen, keine schweren Waffen – nur eng sitzende Lederwämse und zweiseitig geschliffene Dolche, deren Griffe über die Schulter und aus den Stiefeln ragten.
Auf Befehl des Seneschalls segnete ich sie, jeden einzelnen. Als die Reihe an Jordi kam, flüsterte ich nach dem Kreuzzeichen: »Die Muttergottes behüte …«
Doch er zog aus seinem Hosenschlitz eine schwarze Katzenpfote hervor. »Spuck drauf«, raunte er mir zu, »wenn du mir wohl willst.«
Ich täuschte einen Hustenanfall vor und tat ihm den Gefallen.
Die Montagnards bewegten sich wirklich wie Raubkatzen, sie verständigten sich durch Tierschreie; kaum dass sie in die Felswand eingestiegen waren, wurden sie alsbald unseren Blicken entzogen.
Ich verbrachte den Rest der Nacht trinkend, meinem Seneschall Gesellschaft leistend. Wir schwiegen und lauschten in die Höhe. Ob ich es mir nur einbildete oder dem Bericht Jordis erlegen war, jedenfalls sah ich das Geschehen deutlich vor mir, so als hätte ich es selbst miterlebt:
Die Montagnards erklommen zügig die Höhe des Roc de la Tour, doch eng ins schroffe Gestein gepresst warteten sie reglos, bis das Morgengrauen einsetzte.
Die Verteidiger des Vorwerks, katalanische Armbrustschützen, hatten die ganze Nacht ins Dunkel gestarrt, denn die Ankunft der Basken war ihnen nicht verborgen geblieben. Als der Morgen endlich dämmerte, schien die Gefahr für diese Nacht gebannt. Die Anspannung ihrer Augenlider ließ nach. Es verging noch in trügerischer Stille die Zeit eines Ave Maria – die Montagnards sprangen die übernächtigten Verteidiger an, im Sprung zogen sie ihre Dolche – Röcheln, Stöhnen, dumpfer Fall – ein paar Felsbrocken prasselten, dazwischen das Zwitschern der Bolzen – die Katalanen zogen sich über den bewaldeten Höhenrücken unter die schützenden Burgmauern zurück. Die Basken wagten nicht, ihnen zu folgen. Auf Distanz waren die Armbrustiers überlegen, doch es war noch zu dunkel, und so ließen diese davon ab, die Montagnards wieder vom Roc zu vertreiben.
Damit war die letzte, uns jedenfalls bekannte, Verbindung der Belagerten mit der Außenwelt abgeschnürt, der Ring um den Montségur geschlossen.
Den Rest erzählte mir Jordi, als ich ihn Tage später im Lager wiedertraf. Unten im Tal hatte der findige Monseigneur Durand, seines Zeichens eigentlich Bischof von Albi, seine berühmten Wurfmaschinen zerlegen lassen; diese zogen die Basken jetzt an Seilen herauf. Doch die Verteidiger konnten dank eines ebenso genialen catapulteurs, Bertrand de la Beccalaria, die Scharte wieder auswetzen. Der Ingenieur aus Capdenac hatte die von ihm geleitete Dombauhütte zu Montauban spontan im Stich gelassen, als er von der Not seiner Freunde erfuhr, und war in letzter Minute mit seinen Helfern noch in die Festung geschmuggelt worden. Seine transportablen Steinschleudern wurden auf dem Pas de Trébuchet in Stellung gebracht und erwiderten den Beschuss der Angreifer so wirkungsvoll, dass an weiteres Vordringen nicht zu denken war.
Der Höhenrücken, bewaldet und durchzogen von versteckten Passagen zwischen den Felsen, mal unter, mal über dem Grund, voller Höhlen und geheimen Ausfallpforten, blieb in der Hand der Katalanen. Die Montagnards beschränkten sich auf das Halten des eroberten Brückenkopfes. Doch von dort aus reichte die Wurfkraft ihrer Maschinen nicht weiter als bis zur Barbacane[30], dem wuchtigen Außenwerk des Montségur.
»An die Mauern der Burg selbst kommen wir nicht heran!«
»Und warum schickt man Euch keine Verstärkung?«, wollte ich schlauer Stratege wissen, »und rückt dem Teufelsnest mit seiner Schlangenbrut nicht endlich auf den Pelz?«
»Weil«, Jordi pfiff zwischen den Zähnen, »weder der Herr Seneschall noch der Herr Erzbischof besonders gute Kletterer sind – noch ihr lahmes Fußvolk!« Er lachte. »Außerdem erfüllen wir unseren Zweck!«
In der Tat: Tag und Nacht wuchteten und hämmerten jetzt die Wurfmaschinen des Monsignore Durand ihre mörderischen Brocken blind über den Wald in die Mauern der letzten Außenbastionen; sehr zum Vergnügen des päpstlichen Legaten. »In der Barbacane zermalmen wir jetzt die Ketzer, wie der Stößel in den Mörser fällt«, frohlockte Jordi.
»Sterbend erhalten sie das consolamentum[31], die Letzte Ölung dieser Irrgläubigen, auf dass sie in der Hölle besser schmurgeln«, wusste ich hohnvoll zu ergänzen.
»Doch auch die Verteidiger lassen ihre todbringenden Schleudern sprechen, knicken unsere Leiber, fegen die ungeschützt Anstürmenden vom steilen Geröllhang hinab in die Schründe, an deren Ende uns der Herr Erzbischof als himmlischer Türschließer schon erwartet!«
»Und Euch, Jordi, macht Euch nichts den Tod fürchten?«
»Ich verlass' mich auf besseren Zauber!« lachte er. »Mir ist geweissagt, ich würde nur zu meinen Ahnen kehren, wenn um mich versammelt sei die Trinität eines römischen Bischofs, eines häretischen Templers und eines franziskanischen Gralhüters! Da kann ich lange warten!«
»Weiß Gott! Zumal wir Minoriten höchstens Schafe hüten«, rief ich aus. »Und welchen heidnischen Hexenkünsten verdankt Ihr diesen Schutz?« Ich war neidisch auf ihn, dem solches prophezeit ward, hatte ich doch nur mit der Anrufung der Jungfrau und etlicher Heiliger aufzuwarten. Allerdings war mein Leben auch nicht in Gefahr, wenn mir nicht gerade ein verirrter Stein auf den Kopf fiel. »Verratet es mir!«
»Habt Ihr nie von der weisen Frau gehört, die …? Seltsam!« Jordi musterte mich mit einem Blick, der Argwohn und Belustigung zugleich ausdrücken konnte. »Sie kennt Euch!«
Jordi zog es vor, nichts weiter verlauten zu lassen, aber ich lief ihm nach. Er wurde unwillig: »›Haltet mir bloß diesen franziskanischen Unglücksraben, der da durch euer Lager streicht, vom Leibe!‹ hat sie gesagt, wenn du es genau wissen willst. ›Ich will ihn nicht zwischen den Füßen! ‹«
Ich verstand sehr wohl, dass dies auch Jordis Haltung mir gegenüber entsprach. Ich ärgerte und schämte mich. Wir gingen uns von da an aus dem Wege. Vor allem aber war ich sehr beunruhigt.
Kurz darauf hieß es für die Montagnards zurück auf den Pog. Diesmal wurde überhaupt nicht gesegnet, und wenn, wären meine Mitbrüder an der Reihe gewesen. So hatte ich keine Gelegenheit, Jordi noch einmal zu sprechen und danach zu fragen, was es mit mir und dieser Wahrsagerin auf sich habe.
Sie war unter dem Namen › Loba[32] die Wölfin‹ bekannt. Eine wahrscheinlich katharische Hexe, soviel hatte ich inzwischen im Lager in Erfahrung gebracht, die im Walde von Corret hauste und auf deren Sprüche gut Verlass sei.
Gewappnet mit der Schlichtheit meines Gemüts, neigte ich mehr und mehr dazu, sie zur Rede zu stellen über ihre Weisheiten bezüglich meiner Person. Ich würde sie schon verdauen; denn sagte nicht der Herr: »Alles, was da feil ist auf dem Fleischesmarkt, das esset und forschet nicht nach, auf dass ihr das Gewissen nicht beschweret.«
Die Stellen über das Essen hatte ich mir immer gemerkt. Und was der Herr so freundlich meinem Magen zugestand, das mochte erst recht für meinen Kopf gelten.
Die Barbacane
Montségur, Winter 1243/44
Unter schweigend erbrachtem Blutzoll – auch das hatte Loba die Wölfin dem Hauptmann der Montagnards vorausgesagt: »Der Mantel der Nacht bietet keinen Schutz gegen blinde Geschosse!« – erklommen die Basken den Pas de Trébuchet und erdolchten und erwürgten in erbitterten Handgemengen dessen Katapultbesatzung. Während die Verteidiger der Barbacane noch argwöhnisch ins Dunkle gelauscht und sich gewundert hatten, warum das vertraute Zischen und Scheppern der Schleudern so plötzlich verstummte, waren die Basken bereits über sie hergefallen. Zu spät ertönte die Alarmglocke. Die Schlaftrunkenen wurden niedergemacht, bevor aus der Burg Hilfe kommen konnte.
Als der Tag graute, starrten die Montagnards mit Grausen in die senkrecht abfallende Tiefe, die sie in der Finsternis durchstiegen hatten.
»Der Besitzwechsel der Barbacane richtet sich so schnell gegen uns Verteidiger des Montségur«, beschied oben auf der Burgmauer Bertrand de la Beccalaria seinen Gastgeber fast emotionslos, »wie die Miliz des Monsignore Durand braucht, um die adoratrix murorum[33], sein gigantisches Katapult, dort in Stellung zu bringen!«
»Wir können sie nicht hindern«, trotzte sich Ramon de Perelha, der Kastellan, Zuversicht ab, »aber wir werden auch diese Prüfung durchstehen.«
Bald donnerten hundert Pfund schwere, roh behauene Granitkugeln gegen die Burg. Die über vier Meter dicke Ostmauer hielt stand, aber das auf ihr errichtete Gebälk des Observatoriums wurde sofort zerfetzt, und die im Hof darunter liegenden Dächer wiesen immer mehr Löcher auf.
›In Abständen eines hastig heruntergebeteten Rosenkranzes‹ – so der Spott des Kastellans – fauchten die Geschosse heran. Gefolgt von krachenden Einschlägen, wenn sie ein hölzernes Ziel fanden, begleitet von dumpfem Aufprall, wenn sie sich in den Boden des Schlosshofes bohrten. Sie zermürbten die Gemüter der Frauen und Kinder, die verängstigt in den Kasematten hockten.
Nicht alle ließen sich von den großen Marmeln sonderlich beeindrucken. Der kleine schüchterne Junge und das Mädchen hatten sich vor ihrer Amme unter den Stufen der Steintreppe versteckt, die zum Observatorium hinaufführte. Sie hielten sich bei jedem Pfeifen, das sie über ihren Köpfen vernahmen, die Augen zu und wetteten blind auf das Ziel: ›Dach‹, oder ›Hof‹. Sodann verfolgten sie mit Enthusiasmus den Schaden in den Dachziegeln und das Kullern der Kugeln im Sand, den man auf das Pflaster aufgebracht hatte, um ein Springen der Geschosse zu verhindern.
Eine besonders große Marmel kam langsam auf das Versteck der Kinder zugerollt, was zur Entdeckung der beiden durch die aufgelöste Amme führte. Sie fuchtelte verzweifelt mit den Armen, dass die Kinder zu ihr kommen sollten, doch die betasteten interessiert den runden Stein, der vor ihnen zum Stillstand gekommen war. Soldaten nötigten sie mit freundlichem Zureden, ihre Höhle zu verlassen, und trugen sie – immer im Schatten der Mauer – hastig hinüber zum schützenden Donjon, bevor das nächste Geschoss heranschwirrte.
»Die Garnison gibt die Hoffnung keineswegs auf«, berichtete Ramon Perelha mit gewissem Stolz dem Kommandanten, dem Vicomte de Mirepoix. »Noch halten die katalanischen Armbrustschützen den Zugang zur Burg nach allen Seiten frei, noch halten sich die Verluste der Kämpfenden in Grenzen, noch können alle Wehren ausreichend bemannt werden …«
»Auch in Anbetracht der Tatsache, dass die parfaits selbst bei der größten Bedrohung niemals zu den Waffen greifen würden«, fügte der leitende Ingenieur sarkastisch hinzu.
»Wenn sie das täten«, entgegnete ihm der junge Kommandant, »dann würden sie sich selber aufgeben, und der Montségur wäre verraten, noch bevor er kapitulieren müsste!«
»Davon kann überhaupt nicht die Rede sein!«, unterbrach sie der Kastellan barsch. »Vorräte und Feuerholz sind reichlich vorhanden, die Zisternen wohl gefüllt!«
Die Kapitulation
Montségur, Frühjahr 1244 (Chronik)
Die täglichen Messen für das Seelenheil meines Herrn Seneschall lasen meine beiden Kollegen aus dem Nivernais, ohne dass mein Mitwirken erwünscht war. Sie sahen Hugues des Arcis sowieso selten genug, und dann drückte er neuerdings sporenklirrend auf das Tempo ihrer Litanei, während ich dumm herumstand.
Dabei hatte der Oberkommandierende gar keine Eile, denn das hatte er bald allen Beteiligten klarmachen können, den Erzbischof natürlich ausgenommen: Im Sturm war dieser Berg mit seiner stolzen Burg auch jetzt nicht zu nehmen – es sei denn unter wahnwitzigen Blutverlusten! Ich hatte also viel Zeit zum Beten, wobei ich neugierig durch die verschiedenen Feldlager schlenderte.
Überall fand ich Ritter, die missmutig ihre Schlachtrosse striegelten; denn hier bot sich, weiß Gott, keinerlei Gelegenheit, macte anime[34] in den Kampf zu galoppieren, um den Gegner mit schwerer Lanze aus dem Sattel zu werfen.
So traf ich auch Gavin, den Templer. Dieser hochedle Herr Montbard de Bethune[35] war der Präzeptor des nahe gelegenen Ordenshauses von Rennes-le-Château und hatte sich mit einer Abteilung seiner Ritter herbegeben, ohne eigentlich mit von der Partie zu sein: dem Seneschall konnte der Orden sich nicht unterstellen, und auch der Erzbischof hatte keine Befehlsgewalt über ihn. So nahm Gavin den Status eines Beobachters ein, hatte sein Zelt an der schönsten Stelle am Rande der Lasset-Schlucht aufgeschlagen und sein Gefolge im Umkreis lagern lassen. Mit ihm freundete ich mich an, und wir hatten in der Folge eine Reihe von sehr sonderbaren Gesprächen.
Gavin entstammte – wie der stolz angefügte Name seiner Mutter verriet – diesem Lande. Die Bethunes waren Lehnsleute und – durch mehrfache Blutsbande – auch Verwandte der Grafen von Toulouse. Gavin hatte den Trencavel noch in persona gekannt und war auch bei Carcassonne einst dabei gewesen. Ich ersparte mir, ihn zu fragen, auf wessen Seite. Carcassonne war ihm eine Erinnerung, an der er offensichtlich schwer trug, was mich wiederum sehr irritierte.
Gavin musste, dem Grau seines struppig melierten Bartes nach zu schließen, die Fünfzig bereits überschritten haben. In der Umgebung des Pog kannte er sich bestechend gut aus. So war er bestens informiert über dessen Besatzung, die er – bei über einem Dutzend ihm namentlich bekannter Ritter – samt Knappen, Sergeanten und angeworbenen Hilfstruppen auf über vierhundert wehrtüchtige Männer einschätzte. Die parfaits, wie er diese Ketzer ehrerbietig nannte, machten sicher mit ihren Familien weitere zweihundert Köpfe aus.
Gavin wusste zu gut Bescheid, er musste schon dort oben geweilt haben, in diesem Ketzernest! Bestanden etwa doch irgendwelche verborgenen Querverbindungen zwischen den Templern und Katharern? Schließlich munkelte man über eine gemeinsame Leiche in einer unbekannten Gruft. Einen versteckten, streng gehüteten Schatz – diesen Gral? Obskure Götzenriten? Die geheime Regel des Ordens – wer weiß, was sie an Ungeheuerlichkeiten enthielt?
»Ist es denn wahr«, fragte ich Gavin und bekreuzigte mich schnell, »dass diese von Gott und dem Heiligen Geist Verlassenen nicht nur unseren Herrn Papst verhöhnen, die jungfräuliche Geburt unseres Heilands anzweifeln, seine Gottessohnschaft verleugnen, sondern auch seinen Tod am Kreuze für uns?«
»Gott verlässt niemanden«, wies mich der Templer zurecht, mit einem Ernst, der mich zwang, über diesen Satz mit all seinen Konsequenzen nachzudenken. Doch sofort brach wieder sein Sarkasmus durch: »Quidquid pertinensvicarium[36], parthenogenesem, filium spiritumque sanctum – schon die Trinität ist ihnen zuviel.«
Verspottete er die Kirche? Wollte er mich verführen, meinen festen Glauben an die Sakramente zum Wanken bringen? War der Versucher in Gavin gefahren und des roten Kreuzes ungeachtet unter seinen weißen Mantel geschlüpft?
»Ihnen reicht das ›Eine Göttliche Wesen‹ – und sein Widerpart, das luziferische Element …«
Also doch! »Ergo glauben sie an den Bösen, verehren ihn womöglich insgeheim?«
»Glaubt Ihr nicht an den Teufel, Bruder William?« Gavin lachte dröhnend über mich erschrockenen Mönch, der ihn anstarrte, als sei ihm Der-heilige-Gott-sei-bei-Uns gerade mit Pech- und Schwefelgestank begegnet. »Armer Bruder William«, sagte er, »es gibt Dinge zwischen Himmel und Assisi, die sich ein Franziskaner nicht in seinen schlimmsten Hungervisionen vorstellen kann!«
Amüsiert betrachtete er meinen Bauch, über dem sich die braune Kutte beängstigend spannte, obgleich ich hier im Feldlager jeden Tag sicher etliche Pfunde – na ja, Unzen – verlor. Ich schämte mich, und Gavin weidete sich an meiner Verlegenheit.
»Der Tempel Salomonis zu Jerusalem liegt auf einem anderen Sephirot[37] als die Portiuncula[38], er ist ein magischer Ort – das gleiche gilt auch für den Montségur da oben!«
Ich schwieg; ich war zutiefst verwirrt. Welche Abgründe taten sich da auf?
Oder sollte ich mich fragen, zu welchen Höhenflügen ist der menschliche Geist fähig?
Unser zum Stillstand gekommenes Vordringen – ich fühlte mich durch meine Gebete mit den tapferen Basken da oben verbunden, als sei ich selbst – Gott bewahre! – in vorderster Linie dabei, ermutigte den Ketzerkommandanten und seinen Kastellan, einen Ausfall zu wagen, um die ›Maueranbeterin‹ auf der Barbacane zum Schweigen zu bringen.
In einer windig-trockenen Winternacht – günstig, um Pech und Feuer an die Maschine zu legen – schlich sich ein kleiner Trupp – ausgesuchte Teufel! – aus einem verborgenen Seitenauslass. Aber die Verteidiger verfügten leider auch über ein baskisches Hilfskontingent, das frech auf Rache an den ›verräterischen‹ Landsleuten brannte, unseren braven Montagnards, denen sie vorwarfen, ›im Judaslohn der französischen Unterdrücker zu stehen‹.
So verkehrte sich die Welt dieser Bergbauernlümmel: Kein Gedanke daran, dass sie mit ihren Untaten ihrer heiligen Mutter, der Kirche, in den Rücken fielen! Nein, selbst im Sold des Bösen – und solcherart verdorbenen Sinnes, dass sie geschworen hatten, die Unsrigen sollten ›mit durchschnittener Kehle an dem Blutgeld ersticken‹.
Fast hätte die vertraute Sprache den Überraschungsangriff gelingen lassen, doch schnell unterschied Mundart – Dank der heiligen Muttergottes! – zwischen Freund und Feind, und es kam zu einem wüsten Tumult.
Der Waffenlärm tönte bis hinab zu uns ins Tal, wo am Fuß des Pog Bischof Durand entsetzt die ersten Flammen am Gebälk seines kostbaren Katapults züngeln sah.
Ich war zu ihm getreten. »Maria voll der Gnaden!«, betete ich laut. Was konnte ich sonst zur Rettung der adoratrix murorum beitragen?
»Halt die Schnauze mit deinem Geflenne!«, brüllte er mich an. »Sorg lieber dafür, dass sich der Wind dreht!«
Ich ließ mich nicht verdrießen. »Laudato si' mi s signore[39] per il frate vento«, fiel mir die passende Zeile meines Heiligen Franziskus ein, »et per aere et nubilo et sereno –«
»Es ist nicht zu fassen!«, heulte der Bischof auf und schlug mit seinem Stab nach mir, während über uns in beizendem Pechrauch und flackerndem Feuerschatten Mann gegen Mann kämpfte. Losungsworte, Flüche, Todesschreie zerflatterten im eisigen Wind.
»Soll ich denn nicht beten?«, fragte ich kleinlaut.
»Nein, blasen!« Gavin lachte voller Sarkasmus. Er hatte sich im Dunkeln unbemerkt zu uns gesellt. Schweigend starrten wir in die Höhe, Körper stürzten über die Klippen und zerschellten Hunderte von Metern tiefer in den Felswänden. Schließlich behielt unsere Besatzung der Barbacane die Oberhand, konnte die Anstürmenden zurückjagen und die Brandherde löschen.
»Laudate e bendicite mi’ Signore[40] et rengratiate e serveateli cum grande humilitate!« Gavin hatte diesen Abschluss des cantico zitiert – ich hatte mich nicht mehr getraut, das Maul aufzumachen. Der Bischof warf ihm einen Blick zu, als wolle er sichergehen, ob der Templer noch ganz bei Trost sei. Ich war stolz auf ihn, hatte er doch damit die Ehre eines kleinen Minoriten wiederhergestellt.
»Die Anführer der Verteidiger sollten sich bewusst sein«, gab Monsignore Durand zu bedenken, »dass sie solche Ausfälle nicht beliebig wiederholen können, ohne die Zahl der Kampfeswilligen auf der Burg ernstlich zu schwächen.«
»Sie könnten noch lange aushalten«, sinnierte der Templer, ohne dabei seinen Blick vom Montségur zu wenden.
»Doch nicht ewig!« Der Bischof war kein Fanatiker des Glaubens, sondern ein pragmatischer Techniker.
»Ein einsamer Adlerhorst«, Gavin gab sich nicht die geringste Mühe, seine Sympathien zu kaschieren, »in einem Lande, wo längst keine Vögel mehr singen.«
Es hätte mir arg schwärmerisch geklungen, wenn da nicht so viel Trauer mitgeschwungen hätte – und seltsamerweise ging der Bischof auf diesen Ton ein, statt den Templer zu maßregeln. »Und keine Rettung«, konstatierte er leise, der mir noch eben so grob über den Mund gefahren, »weit und breit in Sicht!« Die beiden wechselten einen Blick, der mir verdächtigen Konsens offenbarte.
»Rettende Hilfe nicht, doch Trost: Sie werden sich mit ihrem Bischof beraten«, gab der Templer seine Vermutungen preis, mit einer Sicherheit, die mich verwirrte, nicht aber den katholischen Bischof von Albi.
»Bertrand en-Marti[41] wird nach langem meditativem Gebet für seine Brüder und Schwestern im Glauben ›Bereitschaft‹ erklären.«
Durand hatte den Gedanken ohne jede Häme fortgeführt und überließ es Gavin, ihn zu Ende zu bringen.
»Ja, sich einzurichten auf den letzten Opfergang!«
Welch ein Zusammenspiel mir verborgener und so unterschiedlicher Kräfte. Meine Anwesenheit störte sie auch gar nicht. Ich war Luft, ein Staubkorn. ›Liebe deine Feinde‹. Konnte man das Christuswort so ernst nehmen? William, sagte ich mir, wahrscheinlich hat es dir das Leben bisher zu einfach gemacht – oder du selbst hast es zu leicht genommen?
Da brachten sie die ersten Toten und Verletzten ins Tal. Ich wusste plötzlich, dass Jordi dabei sein würde. Aber dagegen stand die seltsame Todesprophezeiung, die der Baske mir anvertraut hatte. Oder war Gavin am Ende ein häretischer Templer? –Durant konnte man sicher als römischen Bischof bezeichnen, doch mich wohl kaum als einen Hüter des Gral. Trotzdem wollte ich mich lieber davonschleichen.
»He, Francescone!«, rief mich Monsignore Durand zurück, »hiergeblieben! Jetzt ist Salbung gefragt – oder fürchtest du dich, dem Tod ins brechende Auge zu schauen, bevor du es mit sanfter Hand verschließt?« Er winkte mich zu sich und wies auf den Körper, der gerade zu seinen Füßen achtlos abgesetzt worden war.
Jordis Brustkorb war zerschmettert, aber er atmete noch und sah mich mit großen Augen an. »Bist du es, William –?« Da trat der Templer zu uns. »Bist du der Hüter –?«
Ich legte ihm schnell die Hand auf die Lippen. »Sag mir, was hat sie wirklich über mich gesagt?«
»Ich muss sterben, Minorit!« röchelte er leise. »Über mir stehen schon ein Templer und ein Bischof.« Sein Atem ging stoßweise. »Et tu mi rompi le palle!«
Ich kam mir schlecht vor – mir war schlecht – aber ich wollte es wissen, bevor er Lobas Worte, die mich betrafen, mit ins Grab nahm.
»Du musst nicht sterben, Jordi«, versicherte ich mehr mir als ihm. »Ich bin nicht der Schatzmeister des Gral!«
»Doch!« keuchte er. »Du bist der Hüter des Schatzes, der Reisende ans Ende der Welt – von der Kirche gehetzt, von Königen geehrt – du, der dicke Mönch aus Flandern, dessen Schicksal sich erfüllen wird – wie das meine, bevor der Montségur gefallen –«
Hastig fiel ich aufs Knie und brachte mein Ohr an seine Lippen. »Sprich! … Sprich weiter!«
»Scher dich zum Teufel!« Blut quoll ihm jetzt aus dem Munde. »Templer, Bischof und ein fetter Minorit! Lass mich in Frieden …«
Er hatte aufgehört, die Lippen zu bewegen. Ich lauschte noch eine Weile, dann schloss ich seine Lider, machte das Kreuzzeichen über ihm. Eine Übelkeit stieg in mir auf, wie ich sie sonst nur nach Völlerei verspürt hatte. Es war nicht das Sterben von Jordi, das mich berührte, sondern dass sein Tod mir von dunklen Mächten kündeten, die auch nach meinen Leben griffen.
Am nächsten Sonntagmorgen, als ob der treuga dei[42] alle feindseligen Handlungen ruhten – was mich im Kampf gegen Ketzer eine die Kirche kränkende, unnötige Schonfrist dünkte –, ließ der Kommandant der Festung den Seneschall des Königs wissen, dass er bereit sei, die Konditionen einer Kapitulation zu erörtern.
Allein diese Formulierung zeugte von unglaublicher Arroganz: Nur bedingungslose Übergabe und Unterwerfung auf Gnade oder Ungnade erschien mir treuem und naivem Sohn der Kirche angebracht! Ich hütete mich gleichwohl, Gavin meine Einstellung zu offenbaren, als ich ihm – nicht ganz zufällig – in der Lasset-Schlucht über den Weg lief.
Es hatte fast so ausgesehen, dass mein Herr, der Seneschall, mich zu den Verhandlungen mitnehmen würde, aber dem hatten sich seine Kaplane erfolgreich widersetzt. So musste ich unten bleiben, während sie im Gefolge des Herrn von Arcis sich den Pog hinaufquälen durften. Das Treffen mit Pierre-Roger de Mirepoix, dem Kommandanten, sollte irgendwo auf halber Höhe stattfinden.
»Werden wir die Kapitulation annehmen?«, begann ich das Gespräch unverfänglich.
»Ihr Pfaffen«, bekam ich gleich einen Streich übergebraten, »würdet Euch wohl gern verweigern!« Der Templer machte sich über mich lustig. »Die Kriegsleute, die für Euch ihre Haut zu Markte tragen, sind es leid, noch länger zu warten. Das gilt vor allem für jene, die aus Lehnspflicht – nicht aus Überzeugung! – jetzt bereits den zehnten Monat in diesem unwirtlichen Gebirge hocken. Also werden sie darauf drängen, die Belagerung zu beenden –«
»Und was ist mit der Bestrafung?« rutschte es mir heraus.
Der Templer schenkte mir nur einen mitleidvollen Blick, der mich zutiefst beschämte, ging aber nicht darauf ein. »Hugues des Arcis braucht den Erfolg – braucht ihn mehr als einen Sieg! Sein Auftrag lautet – im Namen des Königs von Frankreich –, den Montségur zu besetzen, nicht Rache zu üben! Ich nehme an, er wird ihn zu erfüllen suchen, wie wenig auch immer der Kirche die Konditionen schmecken werden.«
Der Präzeptor begab sich zum Zelt des Seneschalls, der mittlerweile von seiner Bergtour zurück sein musste; ich folgte ihm. Ohne dass er mich dazu aufgefordert hätte, trottete ich hinter ihm her wie ein zugelaufener Hund.
Solcherhalb bereitete es ihm wohl Vergnügen, mir weitere Lektionen wie Hiebe zu erteilen.
»Zu überstimmen ist nur Pierre Amiel«, ließ er mich wissen, ohne sich nach mir umzudrehen. »Der Erzbischof giert wie Ihr, Bruder William, nach den Seelen der dort oben verborgenen Ketzer, nicht um sie zu bekehren, nein, um sie als schwarze Rauchfahnen aus den Flammen geradewegs zur Hölle fahren zu sehen!«
Das wollte ich nun nicht auf mir sitzen lassen. »Einem reuigen Sünder sollt’ allemal verziehen werden.«
»Und wer sich keiner Schuld bewusst ist, woher soll der das Gefühl der Reue beziehen?« peinigte mich der Templer, an dessen Lippen ich hing, der sich über mich lustig machte und den ich fürchtete. »Solch ein Widerruf, den Ihr verlangt, das wäre erst der Sündenfall eines ›Reinen‹! Da zieht er den Tod vor – und damit allein verdient er schon deine Achtung, William!«
Ich zog den Schwanz ein; er hatte ja recht – die Mauern meiner religiösen Erziehung bekamen Risse, das aufliegende Gebälk meiner theologischen Studien ächzte und knackte. Und so schwieg ich und ließ mich ein wenig hinter ihn zurückfallen; denn wir waren am Stander unseres Feldherren angelangt.
»… der Garnison freien Abzug«, hörte ich ihn zum Erzbischof sagen, der schon aufbrausen wollte, »aber alle anderen haben sich dem Inquisitionstribunal zu stellen!« Das entzückte Pierre Amiel sichtlich, während es mich plötzlich erschauern machte. »Die Übergabe wird nach eines halben Mondes Länge erfolgen!«, fügte der Seneschall wie nebensächlich noch hinzu.
»Wie das?«, begehrte der Erzbischof – eine Falle witternd und auf jeden Fall um sein alsbaldiges Vergnügen gebracht, empört auf.
»Conditio sine qua non[43]!« beschied ihn Hugues des Arcis abschließend. »Ich bin froh, mit dieser rein zeitlichen Konzession die Lösung gefunden zu haben, und Ihr, Eminenz, solltet mit dem Beispiel der Geduld vorangehen!«
Der Erzbischof verließ den Platz, sein Ärger hing ihm nach wie eine Furzwolke. Gavin folgte einem unauffälligen Zeichen des Seneschalls und betrat hinter ihm dessen Zelt. Ich setzte mich auf einen Stein.
Es war Abend geworden, eine plötzliche feiertägliche Ruhe umwehte den stoisch aufragenden Pog, eine unwirkliche Stille – nicht des Friedens, mehr des Abgehobenseins von Zeit und Raum. Ging sie von meinem Herzen aus? Oder von den Menschen, die sich dort oben hinter den schweren Mauern der Burg zusammengeschart hatten?