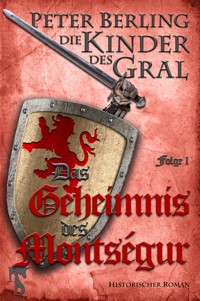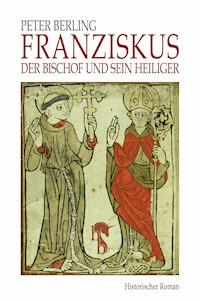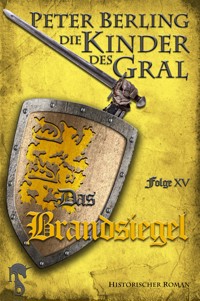3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Kinder des Gral
- Sprache: Deutsch
Nachdem Ludwig, der französische König, aus der Gefangenschaft der Mameluken entlassen wurde, entwickelt er trotz der Zurückweisung von Yeza eine seltsame Zuneigung zu dem Gralskind. Kurzerhand nimmt er sie mit sich nach Akkon, zum ersten Mal seit ihrer Flucht von der Gralsburg im fernen Frankreich werden die »Königlichen Kinder« getrennt. Roç schlägt sich unter dem Schutz des Roten Falken bis zu den Tempeln von Baalbek durch. Und beiden Gralskindern sind alte Widersacher dicht auf den Fersen, allen voran Vitus von Viterbo, ein Häscher Roms, sowie Yves, der Bretone, der sich von der Hinrichtung der Gralskinder ewigen Ruhm verspricht. Doch auch die Verbündeten der Königlichen Kinder bleiben nicht untätig. Templer, Deutschritter und nicht zuletzt der treue Freund William von Roebruk wachen über Roç und Yeza. Dank der Mithilfe der Assassinen gelingt es immer wieder, die Widersacher zurückzuschlagen. Endlich können sie Syrien verlassen, die Geschwister sind wieder vereint und reisen nach Alamut, der Hauptstadt der Assassinensekte im fernen Persien. Eine Stadt wie eine Rosenblüte, aus Eisen und Feuer geschmiedet … Ein spannender historischer Roman von Peter Berling, der gleichzeitig das große Epos »Die Kinder des Gral« aus der Zeit der Kreuzzüge als Teil VII fortführt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 424
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
PETER BERLING
Höhle der Muräne Christi
Folge VII des 17-bändigen Kreuzzug-Epos Die Kinder des Gral
Historischer Roman
WAS DAVOR GESCHAH IN FOLGE VI
Schicksal am Nil
Mit der Gefangennahme des christlichen Königs von Frankreich beginnt das lange Feilschen um Lösegeld und Freilassung. Sie kostet, als erstes Opfer, den Kopf des Sultans von Ägypten. Seine Leibgarde, die Mameluken, putschen sich an die Regierung, und Yeza und Roç mittendrin, die Kinder sind schnell gereift, werden immer begehrenswerter – und mehr und mehr verlangen sie, Herr ihrer eigenen Entscheidungen zu sein.
So wie der König innerhalb der Haft jede persönliche Freiheit genießt, bewegen sich auch die ›Königlichen Kinder‹ wie flinke Fische im trüben Wasser des Nils. Es kann gar nicht ausbleiben, dass unter der schwülen Hitze abstrusen Gedankenspielen nachgegeben wird, die von einer abenteuerlichen Aufwertung des minderen Königlichen Blutes von Frankreich durch Vereinigung mit der kostbaren Blutslinie des Gral träumen. Einladend als gewaltiger Altar für solch irrwitzige Zeremonie ist die große Pyramide. Mit knapper Not kann Prinzessin Yeza die Unversehrtheit ihres Leibes aus dem dunklen Stein retten, sich in die Arme Roçs flüchten …
I DIE GROSSMEISTER
Der Deutsche Orden zu Akkon
Durch wild zerklüftetes Gelände waren sie geritten.
Die tief eingeschnittenen Flussläufe lagen trocken, gesäumt von wildem Lorbeer und knorrigen Eichen.
Der wohl wenig benutzte Pfad schlängelte sich durch mannshohe Ginsterstauden, jeden Augenblick musste der kleine Trupp gewärtig sein, auf eine größere Anzahl nicht freundlich gesonnener Reiter oder schlicht auf eine Räuberbande zu stoßen.
Der Rote Falke, Madulain und Roç hatten das äußerste Grenzgebiet des Königreiches erreicht, die sogenannte »Syrische Pforte«[1]. Sie ließen die Treiber mit den Tieren vorausgehen, ihr Rufen und der Hufschlag der Pferde waren das einzige Geräusch in der Stille der Hügel. Dann – es war Roç, der es als erster vernahm und den Arm hob, Madulain zügelte ungläubig ihren Zelter, der Rote Falke schloss zu ihr auf.
»Allerêst lebe ich mir werde,
sit min sündic ouge siht …«
Deutlich war jetzt – vom Wind leicht verweht – der Gesang, ein Choral, zu vernehmen.
»daz here lant und ouch die erde,
der man vil der eren giht.«[2]
Roç bog vorwitzig um die Ecke. »Starkenberg[3]!«, rief er leise.
Gegenüber dem Hang, an den schroffen Felsen klebend wie ein Hornissennest, ragte die Burg des Deutschen Ritterordens auf. Sie näherten sich dem Rand der Schlucht, drüben erschien eine Wache auf der Mauer, im wehenden weißen Umhang, das schwarze Kreuz der Schwertbrüder zeichnete sich auf der Tunika ab, von der Brust bis zur Kniehöhe.
»Mirst geschehen des ich ie bat,
ich bin komen an die stat
da got mennischlichen trat.«[4]
Der Wächter beäugte die Ankömmlinge und wies ihnen dann stumm den Abstieg, den sie vorher nicht wahrgenommen. Sie mussten ihn zu Fuß antreten.
»Schoenui lant rieh unde here
swaz ich der noch hen gesehen,
so bist duz ir aller ere.
waz ist wunders hie geschehen!«[5]
Der mächtige Choral drang jetzt im Innern der Burg viel dumpfer durch die Mauern, als sein Ton draußen ins Land geweht war.
»Daz ein magt ein feint gebar
here übr aller engel schar,
was daz niht ein wunder gar?«[6]
Sigbert von Öxfeld, der Komtur, stand bei seinen Freunden im Sockelgeschoss des Donjons und hörte sich lächelnd ihren Plan an, die Mamelukenkinder aus Homs zu befreien.
»Ich bewundere Euren Mut«, raunzte er dann bärbeißig den Roten Falken an, »aber ich spreche Eurem Vorhaben jegliche Aussicht auf Erfolg ab. Ihr dürft unmöglich jetzt als Mamelukenemir dem An-Nasir[7] gegenübertreten!«
»Das gedachte ich sicher zu vermeiden«, entgegnete ihm der Rote Falke schnippisch, »Roç kennt einen geheimen –«
Das dröhnende Gelächter des Öxfeld unterbrach ihn. »Sicher den kürzesten Weg in den Kerker, und dort erwartet Euch nur einer: der Henker! Nein, so keinesfalls, mein Lieber!«
»Und wenn«, beendete Madulain das betretene Schweigen, »der Herr von seiner illustren Vergangenheit als ›Prinz Konstanz von Selinunt‹ nützlichen Gebrauch machen würde?«
»Höchst kluge Tochter der Saratz!« polterte Sigbert erfreut. »Das ist die Lösung: Ihr tretet als Gesandter des Kaisers auf, in geheimer Mission selbstredend und somit nur von seiner Dame und« – er schaute belustigt auf Roç herab – »einem sehr jungen Schildknappen begleitet –« »Ich ziehe es vor, nicht als solche zu erscheinen«, wandte Madulain ein, »vergesst nicht: Mich und Roç kennt man in Homs. Die Verkleidung müsste also umgekehrt geschehen, ich als Pferdeknecht und Roç als Tochter oder Schwester oder –«
»Ich bin Ritter und trage keine Weibersachen!« empörte sich Roç. Sigbert räusperte sich. »Wenn Ihr schon von Homs nicht lassen wollt, dann muss sich jeder in die Rolle fügen, die ihn nicht wiedererkennbar und glaubwürdig gegenüber dem An-Nasir macht. Du willst doch deine kleinen Freunde befreien – oder?«
Roç schluckte, Madulain warf den Kopf zurück, und sie stiegen hinter dem Deutschritter hinauf in die oberen Turmgemächer.
»Hier nächtigte schon mancher König nebst seiner Gemahlin«, erläuterte der Komtur den kargen Raum mit dem von einem Baldachin gekrönten Ehebett. Er öffnete einige der Schränke, ihr hervorquellender Inhalt an Samtwesten und feinem Beinkleid reichte, um eine ganze Pagenschar einzukleiden.
»Wir lassen die Dame jetzt allein«, schlug Sigbert wohlgemut vor, »und erwarten dann einen ranken Knappen.«
Er schob die beiden Männer aus der Tür in das Vorzimmer. Auch hier standen Schränke und Truhen.
»Darin, Roç, wirst du finden, was dir steht – oder soll dir Madulain zur Hand gehen?«
»Anziehen kann ich mich schon selbst! «, wies der Junge den altväterlichen Komtur zurecht.
»Deinen Stock!«, fügte der Rote Falke hinzu. »Den darfst du hierlassen. Kleine Mädchen führen keine Ebenholzknüppel mit verborgener Klinge bei sich.«
Roç war so wütend, dass er mit hochrotem Kopf tief in der Kiste wühlte.
»Könnt Ihr mich jetzt gefälligst allein lassen!« keuchte er, und die beiden Ritter gingen.
Von Sigbert ließ sich Roç ja alles sagen, aber nicht vom Roten Falken, der bloß hinter Madulain her war, auch wenn er's nicht zeigte. Und dann solche Fehler machte, als Mamelukenemir die Mamelukenkinder befreien zu wollen! Jetzt wurde es also ernst, er, Roç, würde, wenn auch als Zofe getarnt, seine erste Rittertat begehen. Dass Yeza ihn nicht sehen konnte!
Der Raum, in dem man ihn allein gelassen hatte, musste den Kriegermönchen als Skriptorium[8] gedient haben. In den anderen Kisten waren Pergamentrollen und Folianten aufbewahrt, wie Roç neugierig feststellte. Lesen konnte er es nicht. Es war wohl Deutsch. Aber er fand ein unbeschriebenes kleines Blatt, Feder und Tinte.
Es konnte ihm natürlich auch ein ruhmreicher Tod beschieden sein – als gefallener Held sollte man der Liebsten einen letzten Gruß zukommen lassen, damit sie was zum Weinen hatte. Er musste Yeza einen vorsorglichen Abschiedsgruß schreiben, den sollte man dann finden, wenn er nicht mehr war – oder auf einem Schild aufgebahrt zur Ritterburg zurückgetragen wurde, die Hände über dem Schwertknauf gefaltet. Der Knauf! Das wäre ein Versteck, von dem nur sie wüsste, Yeza, seine trauernde Wittib.
Roç setzte sich auf die Truhe und begann zu schreiben.
»Liebste Yeza, wenn Du diesen Brief in den Händen hältst –«
Nein, er musste mutiger beginnen, ihr Vertrauen in eine Zukunft ohne ihn einflößen – ohne ihn? Das war zu traurig, der Gedanke ließ ihm selbst die Tränen kommen. Noch war er ja nicht tot! Also:
»Meiner heiß und innig geliebten Yeza ein hurtig Grußwort von Starkenberg, der Festung unseres väterlichen Hüters Sigbert, dessen Gastfreundschaft ich gerade genieße. Morgen brechen wir auf gegen Homs, die Freunde zu befreien, denn es gilt den Schwur der Brüder und Schwestern des geheimen Schwertes einzulösen. Sollte mir etwas zustoßen wie der Tod oder so, nimm's leicht – nach angemessener Trauerzeit –, geh nicht ins Kloster, und vergiss mich nie!«
Jetzt musste er doch wieder weinen. Er raffte sich noch einmal mannhaft auf und setzte darunter: »Dein Dich ewig liebender Roç«.
Er schnäuzte sich, rollte das Pergament zusammen, zog die Klinge aus ihrer versteckten Scheide, wickelte die Botschaft sorgfältig um sie und versenkte sie bedächtig. Dann stellte er den unverdächtigen Stab in eine Ecke, sodass ihn jeder sehen musste, der nach einem Stück von ihm suchte. So würde Yeza als seine einzige Erbin die Nachricht erhalten, und das war dann auch sehr würdig.
Jetzt musste er sich aber schleunigst in das verlangte Frauenzimmer verwandeln. Er würde sich einfach so verkleiden, als wäre er Yeza. Ob Madulain schon mit dem Anprobieren fertig war? Roç lauschte. Er hörte, wie sie sich im Nebenraum bewegte.
Auf Zehenspitzen schlich er zur Tür und presste sein Auge gegen das Schlüsselloch. Ihm stockte der Atem. Madulain stand splitternackt vor dem Schrank und hielt sich ein Wams nach dem anderen vor den Körper, sie war ihm zugewandt, dass er ihre Schenkel und die dunkle Paradiespforte sehen durfte, die ihm allerdings wie ein Höllenschlund erschien, doch ehe er dies genauer ergründen konnte, stieg sie behände in ein Paar zweifarbige enge Hosen, zwängte ihren marmornen Bauch und ihren Hintern hinein und verbarg ihm so das Geheimnis.
Seit der Geschichte mit den Männern in Baalbek kam er von diesem Anblick nicht mehr los. Er verfolgte ihn sogar in den Schlaf, er träumte von diesem schwarz behaarten Schoß, der sich ihm entgegenwölbte, ihn lockte, ihn in sich hineinzog. Roç atmete schwer, und er spürte seinen Penis unter dem Rock steifer werden und wachsen, doch er traute sich nicht, die Tür zu öffnen und – ja, wie sollte er der schönen Saratz gegenübertreten, was sollte er ihr sagen, sie, die sogar schon verheiratet war, die selbst einen Ritter wie den Roten Falken verschmähte? – Sie einfach umarmen? Vor ihr niederknien?
»Or me laist Dieus en tel honor monter,
que cele ou j'ai mon cuer et mon penser,
tiegne une foiz entre mes braz nuete,
ainz que voise autre mer.«[9]
Sich sporenklirrend nähernde Schritte im Gang bewahrten ihn vor der Entscheidung. Mit einem Satz war Roç zurück bei der Kleidertruhe und wühlte, den roten Kopf tief hineingebeugt, in den Stoffen.
»Hast du nichts gefunden?«, fragte die Stimme Sigberts väterlich. »Ich werde dir helfen –«
Roç nickte dankbar und legte seine eigenen Sachen ab. Der Penis, das fühlte er mit Erleichterung, war schon wieder so weit abgeschlafft, dass er ihn nicht verraten würde. Warum bloß war Yeza nicht da; ihn einfach allein zu lassen in der Fremde!
»Probier das mal an!« Sigbert hielt ihm eine seidene Bluse hin, und Roç erkannte das Wappen der Staufer.
Stolz stieg in ihm auf.
Diarium des Jean de Joinville
Akkon, den 3. Juli A.D. 1250
Die Stadt Akkon, das alte Ptolemais, am nördlichen Ende der Bucht von Haifa gelegen, galt als das weitaus bestbefestigte Bollwerk dessen, was uns Christen noch vom »Königreich von Jerusalem« übrig geblieben war.
Seit dem Verlust von Hierosolyma, der glorreichen Namensgeberin, vor genau 63 Jahren durch den großen Saladin[10], diente Akkon Outremer als Hauptstadt, Sitz der Könige oder ihrer Regenten, des Patriarchen und aller drei Großmeister der Ritterorden.
Als unser Schiff mit Herrn Ludwig am »Turm der Fliegen«[11] vorbei in das gesicherte Hafenbecken einbog und beim Arsenal[12] anlandete, hatten sich die wenigsten der Genannten zum Empfang eingefunden.
Mich wunderte das wenig, denn auch auf dem genuesischen Schiff, das den König hierherbrachte, waren nicht einmal neue Kleider für ihn bereitgelegt worden.
Er war gezwungen, die Reise in denselben Gewändern hinter sich zu bringen, die er seit seiner Gefangennahme am Leibe trug, denn Geschenke der Mameluken hatte er – als einziger von uns – standhaft verschmäht.
Regent von Outremer war – seit dem Tod seiner Mutter Alice – König Heinrich von Zypern[13]. Der war auf seiner Insel geblieben.
Der Patriarch Robert schmachtete noch in Ägyptens Kerkern, ebenso wie der Großmeister der Johanniter Guillaume de Chateauneuf[14], der allerdings schon seit der unglücklichen Schlacht von Gazah A.D. 1244.
Das Hospital wurde repräsentiert durch seinen Profess[15] Henri de Ronay[16], doch der kam erst mit einem späteren Schiff, der Tempel durch seinen bisherigen Marschall Renaud de Vichiers, den sein Ordenskapital allerdings jetzt offiziell zum Großmeister gewählt hatte, was ihm wohl zu Kopfe gestiegen war, denn ich sah nur den Herrn Gavin Montbard de Béthune am Ufer.
Auch bei den Deutschen hatte es im vergangenen Jahr nach dem Tod von Heinrich II. von Hohenlohe[17] einen Wechsel gegeben.
Der neue Hochmeister ihres Ritterordens, Graf Günter von Schwarzburg[18], residierte jedoch im fernen Prussien[19] und hatte das Heilige Land noch nicht mit seinem Besuch beehrt. Und da auch nicht sein Herr und König Konrad[20] jetzt hier eintraf, sondern Herr Ludwig Capet, würde er ihm auch weiterhin fernbleiben. Er ließ sich durch den Komtur von Starkenberg, den alten Kämpen Sigbert von Öxfeld, vertreten, der seit den schweren Stunden von Damiette in höchster Huld der Königin Margarete[21] stand.
Die stand am Kai, das drei Monate alte Söhnlein im Arm, das sein Vater noch nicht zu Gesicht bekommen hatte, war es doch erst nach seiner Gefangennahme geboren worden.
Und hinter ihr, reuig sich ins zweite Glied drückend, musste Herr Ludwig seinen ungebärdigen Garde-du-Corps, Yves den Bretonen, erblicken.
Es war also ein recht spärliches Willkommen, das uns da geboten wurde, als Herr Ludwig, Yeza an der Hand, von Bord des Schiffes ging.
Die Königin schaute etwas befremdet auf das blonde Mädchen in Hosen, mit einem Dolch im Hüfttuch, das ihr unbefangen entgegentrat, während sie mit einem Hofknicks dem König seinen Sohn Jean-Tristan darbot.
Yeza zeigte für das Kindlein mehr Interesse als der Herr Ludwig selbst, der seinen Sohn nur flüchtig auf die Stirn küsste.
Nur das energische Dazwischengreifen der Damen verhinderte, dass Yeza es auf den Arm nahm. Sie grinste ihm zu und kniff ein Auge zusammen, und das Kind begann zu greinen.
Sigbert trat vor und befreite das Herrscherpaar von der erklärungsbedürftigen Inkonvenienz[22] einer derart selbstständigen unerwarteten Pflegetochter.
Doch Yeza fiel rechtzeitig ein, was sich gehörte, und knickste tief vor Frau Margarethe, bevor sie sich von dem Deutschritter zur Seite ziehen ließ.
Der König wandte sich an Yves: »Ach«, sagte er leichthin, »Herr Yves, ich wähnte Euch schon mit Eurem Grafen Peter Mauclerc in die Bretagne zurückgekehrt –«
»Ich wollt, Ihr wünscht mir nicht das gleiche Schicksal, Majestät«, sagte Yves und beugte sein Knie, »der Graf wird sein Land nicht wiedersehen. Er starb noch angesichts der Küste Ägyptens –«
»So will ich Euch seinen Beinamen ›Mauclerc‹[23] vermachen«, sagte der König bitter, »denn wenig Gutes habe ich von ihm erfahren und übler könnt auch Ihr mir nicht mitspielen, hoffe ich. Ein ›schlechter Priester‹ seid Ihr allemal«, fügte er hinzu.
»Aber ein Schutzschild, der sich für Euch in Stücke schlagen ließe, Majestät! Ein Arm, der jeden Stoß auffangen will, der gegen Euch –«
»So tretet hinter meinen Rücken, Yves Mauclerc, damit Ihr mir nicht den Anblick vergällt, und ich verbiete auch, dass Euer Arm je wieder zuschlägt, denn ich will lieber von drei Mameluken erschlagen als von einer Hand beschützt werden, die das Heil der Seele nicht achtet.«
Während der Bretone sich erhob und schnell wieder seinen angestammten Platz hinter dem König einnahm, richtete die Königin ein Wort an ihren Gemahl. »Sire«, sagte sie und wies auf Sigbert, »Verdienst um das Wohl Eurer Familie hat sich hingegen der Komtur von Starkenberg erworben.«
Dem König passte dieser Hinweis jetzt wenig, und er sagte mürrisch: »Komtur, Wir sind in Eurer Schuld und wüssten nicht, wie Wir sie je begleichen könnten – oder haben die Deutschritter ein dringliches Anliegen?«
»Es genügt uns, Majestät«, erwiderte Sigbert und legte seine breite Pranke auf Yezas Kopf, »dass Ihr dem Kaiser und seinem Blute in diesen Zeiten der Anfeindung so loyal die Freundschaft haltet. Dagegen verblasst mein Verdienst. Wir haben für Euren Schutz des Kindes zu danken.«
Er beugte sein Knie und wollte Yeza mit sich wegführen, doch der König winkte ihn zurück.
»Euch kann ich nicht halten«, sagte er und griff nach Yezas Arm, »doch sollt Ihr meines kaiserlichen Vetters Spross nicht in die Einöde von Starkenberg entführen. Yeza ist mir ans Herz gewachsen. Ich will sie der Liebe der Königin anvertrauen.«
Frau Margarethe war sprachlos, sie reichte Yeza die Hand, die diese jedoch nicht ergriff. Erst als Sigbert sie zu der Königin geleitete, gab sie ihren Widerstand auf.
Mich dauerte sie, und so gab ich William einen Stoß und sagte laut zu Herrn Ludwig und seiner Gemahlin: »Das Kind ist schwer zu hüten und soll Euch nicht zur Last fallen. Ich gebe Euch meinen Sekretarius dazu, der sich schon als Erzieher der Prinzessin bewährt hat.«
William trat vor, und ein dankbares Lächeln ging über Yezas Züge, doch die Königin sagte spitz: »So ungebärdig kann die Tochter Eures Friedrich doch wohl nicht sein, dass es eines Komturs, eines Sekretarius und der Fürsprache eines Seneschalls bedarf«, und sie winkte ihre Damen herbei, damit diese Yeza in Empfang nahmen.
Da sagte die schnell, zum König hingewandt: »Ich nehme den Herrn William von Roebruk gern in meine Dienste –«, und zu Sigbert: »Ich danke Euch für Eure Obhut.«
Sie stellte sich zwischen die beiden Männer, sodass die Hofdamen davon Abstand nahmen, sie zu behelligen.
Der König lachte und sagte zu seiner Frau: »Da habt Ihr einen Vorgeschmack, Madame«, und als er sah, dass die Königin diesen wenig goutierte, fügte er hinzu: »wenn schon der Deutsche Orden seinen treuesten Ritter und Ihr, lieber Joinville, die Blüte der Sippschaft des heiligen Franz abstellt, will ich nicht zurückstehen und meinerseits Herrn Yves beisteuern, der solch liebender Betreuung gar sehr bedarf.«
Mich deuchte, mir bleibt das Herz stehen! Wusste denn der Herr Ludwig nicht, dass er da den ärgsten Bock zum Gärtner machte – oder wollte er gerade dies, das versteinerte Herz des Bretonen durch den Umgang mit der liebreizenden Yeza umstimmen? Ein gewagtes Spiel! Frau Margarethe, wohl betroffen, dass dem fremden Kind so viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt wurde als ihrem eigenen, bat darum, sich zurückziehen zu dürfen.
Jetzt erst bemerkte der König ihre Verärgerung, nahm den Sohn auf den Arm und bot ihr seine Begleitung an.
»Folgt nur Eurem Herzen«, sagte sie darauf und schritt voran.
Die Verlockung scharfen Eisens
Ein seltsames Bild bot sich den Händlern des Basars von Akkon, der sich zwischen dem Patriarchat[24], Montjoie[25] und dem Arsenal ausbreitete: drei völlig verschiedenartige Männer wetteiferten um die Gunst eines kleinen Mädchens, das blond und zart zwischen ihnen ging, und da nur für zwei von ihnen Platz zur Rechten wie zur Linken war, eilte der dritte voraus oder – je nach Temperament –, er stapfte hinterdrein.
Dem mächtigen teutonischen Bären Sigbert vermochte keiner den festen Platz an der Seite Yezas streitig machen. Nur wenige Male gelang es dem dicken Minoriten mit dem lustigen rötlichen Lockenkranz, den gedrungenen Yves zu verdrängen, sodass dieser mit seinem bleichen Albengesicht, von langem schwarzen Haar düster umrahmt, gebeugt, fast buckelig, hinterherschleichen musste. Meist blieb dem Franziskaner nichts anderes übrig, als vorwegzuhüpfen und Yeza auf allerlei Köstlichkeiten des Marktes aufmerksam zu machen.
Yves spürte die widerwillige Wachsamkeit des deutschen Reckens und den nervösen Argwohn des Mönches, als habe ein verwirrter Hirte seine treuen Schäferhunde geheißen, einen Wolf in ihren Reihen zu dulden. Er war der Wolf, ein einsamer Wolf.
Doch auch der finstere Bretone achtete flinken Auges auf seltene Arbeiten, versteckte Raritäten und skurrile Gerätschaften und, da alle drei – wie auch Yeza selbst – des Arabischen mächtig waren, stöberten, entdeckten und feilschten sie um die Wette. Die Männer taten alles, um das Mädchen mit kleinen Aufmerksamkeiten zu überhäufen.
Längst folgte ihnen ein Lastenträger, dessen Korb sich zusehends füllte, mit silbernen Fußreifen, dicken Bernsteinketten, Flakons mit wohlriechenden Essenzen, intarsiengeschmückten Kästen voller Henna und Myrrhe, perlenbestickten Pantöffelchen, Schals, Bändern und Gürteln, doch Yeza hatte nur Augen für die Waffen, für die Säbel und Spieße, Keulen und Bögen und die dunklen Gewölbe der Waffenhändler. Sie bemerkte als einzige, dass Yves sich heimlich davonstahl. Neugierig folgte sie ihm.
Ihr war der unheimliche Geselle mit dem breiten Brustkorb und den langen Armen durchaus noch von der Grabkammer her in dumpfer Erinnerung, auch wenn ihr der Blick auf die erhobene Axt des Bretonen erspart geblieben war. Jetzt stand der Bretone vor dem offenen Schmiedefeuer, dessen glutroter Schein ihn beleuchtete, und sah einem Schmied aufmerksam bei seiner Arbeit zu.
Seit seinem Waffengang mit Angel von Karos war Yves die Idee von einer Kombination von dessen zwei Mordinstrumenten im Kopf herumgegangen, denn ein Morgenstern in der einen und eine Axt in der anderen Hand waren zwar fürchterlich anzuschauen, aber wie von ihm selbst schlagend und schneidend bewiesen, boten sie dem Träger keinen hinreichenden Schutz. Yves mochte auf den freien Arm für den Schild nicht verzichten. Er hatte dem Schmied umständlich erklärt, wie die stachelige Kugel auf dem Dorn der Axt zu sitzen habe und ihre Kette im hohlen Stiel zu verbergen sei, sodass die aufgesetzte Kugel hinter der Klinge des Beils dessen Schwere verstärkte und gar nicht als mobiles Element erkennbar war.
Yeza sah, wie der Schmied das gerade geschmiedete Eisen jetzt in einen Wasserbottich stieß, dass es zischte, und es dann dem Bretonen überreichte. Die gefährliche Waffe faszinierte sie ebenso wie das Verhalten von Yves, der den Mechanismus mit der Sanftheit eines Lammes bemängelte. Die Anwesenheit von Yeza hatte er immer noch nicht bemerkt. »Guter Mann«, sagte er zu dem Schmied, »Ihr habt die Kette einfach und sichtbar um den Schaft gewunden, statt sie darin zu verstecken.« Der Schmied betrachtete seinen seltsamen Auftraggeber voller Argwohn: »Hohl würde der Stiel an Stärke einbüßen, Euch in der Hand zerbrechen – und«, murmelte er aufsässig, »so kostet es Euch weniger.«
Yeza hatte sofort begriffen, was dem begriffsstutzigen Mann nicht einleuchten wollte, er war der Tradition seines Gewerbes zu verhaftet oder der verlangten Tücke abhold.
»Dann schmiedet mir ein Rohr aus Eisen«, schlug der Bretone geduldig vor, »kümmert Euch nicht um die Schwere für meinen Arm noch um die Belastung für meinen Beutel. Kugel und Beil könnt Ihr wiederverwenden. Sie sind gute Arbeit«, lobte er ihn und wollte ihm die Waffe zurückreichen, als er Yeza hinter sich entdeckte.
»Du tötest gern, Yves?«, fragte Yeza leise, als er mit dem Daumen prüfend über die Schneide fuhr.
Er zuckte zusammen.
Das Kind hatte ein so wissendes Lächeln und Augen, die man nicht belügen konnte. Er spürte, wie er zusehends dem Bann des seltsamen Geschöpfes verfiel, das er hatte töten sollen und das ihm jetzt nie gekannte Gefühle eines väterlichen Beschützers aufzwang.
»Ich tat es stets im Namen der Gerechtigkeit«, sagte er bedächtig, »im Interesse der Krone, für den rechten Glauben –«
»Das mag jeder Henker von sich sagen«, entgegnete Yeza, »aber für Euch trifft es nicht zu, Ihr seid ein Jäger.«
»Ich danke Euch für so viel gut gemeintes Verständnis, Prinzessin, aber ich bin auch der Wolf – und das viele Blut, das ich schon vergossen habe, im Namen welchen Gesetzes auch immer, es macht mich zum wilden Tier – und nicht zum besseren Menschen. Gerechtigkeit«, Yves lachte bitter, »ist immer das Gericht der Mächtigen über die Unterlegenen. Für die Armen gibt es sie nur als frommes Geschwätz oder huldvolle Geste, aber nie als Recht – und ich bin ein Armer, Prinzessin!«
»Nein«, sagte Yeza, »wer sich so selbst erkennt, ist schon reicher als alle, die in blöder Ignoranz verharren. Macht euch nicht geringer, Yves, sondern stärker!«
»Wollt Ihr das Arsenal hier aufkaufen?« polterte da Sigbert in die Höhle. »Der Bretone ist ein gar gefährlicher Umgang für eine junge Walküre.«
»Was soll ich bitte sein?« ging Yeza, verärgert über die Bevormundung, den nachdrängenden William an und verließ das Gewölbe.
Fast verlegen gab Yves die Axt mit dem Morgenstern dem Schmied zurück. »Versucht meine Wünsche zu erfüllen, Meister, ich will's Euch gut lohnen!« Dann folgte er schnell den anderen.
»Eine Art Ritterin«, beantwortete der Mönch die Frage des Mädchens, »sie trägt nach der Schlacht die gefallenen Helden.«
»Was habt Ihr von Roç gehört?«, fragte Yeza heftig. »Was verschweigt Ihr mir?«
»Eure Freunde haben«, mischte sich Sigbert ein, »Starkenberg bei bester Gesundheit verlassen und werden ihr Ziel sicher wohlbehalten erreichen.«
William verschwieg, dass die meisten Stimmen übler von dem Schicksal des Roten Falkens und seiner Gefährtin zu berichten wussten, von Tod bis Gefangenschaft – und Yeza ließ sich nicht anmerken, dass der neugierige Gang über den Basar von ihr nur vorgeschoben war, um etwas über die Verschollenen in Erfahrung zu bringen. Zu lange Zeit war es her, dass die drei nach Homs aufgebrochen waren, und immer noch fehlte jede Nachricht von ihnen.
Sigberts vertröstende Auskunft stürzte sie in eine tiefe Traurigkeit. Sie verspürte keine Lust mehr, in den Gassen und Läden herumzustöbern, und so sehr sich auch alle, selbst Yves, der den anderen wie ausgewechselt erschien, sich Mühe gaben, sie aufzuheitern, Yeza verfiel ins Grübeln.
Yves gab Geschichten vom Hof zum besten, in seiner knappen, sarkastischen Art, von der Würfelleidenschaft der Brüder des Königs, die dem Herrn Ludwig als äußerst verwerflich erschien. Mal hatte er dem Herrn Charles nicht nur die Würfel, sondern auch das bereits gewonnene Geld so vom Tisch gefegt, dass es seinen hoch verlierenden Mitspielern unerwartet in den Schoß flog, und der Herr Alphonse hatte die Angewohnheit, immer, wenn ein Bettler vorbeikam, nicht von seinem Haufen, sondern von dem der anderen reichlich zu nehmen und es den Armen zuzuwerfen.
William konnte darüber lachen, Yeza nicht. Gavin, der Templer, hatte von Weitem die Gruppe um Yeza beobachtet, und er runzelte missbilligend die Stirn. Yves, der Bretone, mochte sich über Nacht, die Nacht in der Pyramide, vom Saulus zum Paulus gewandelt haben und den König jetzt mit neuer Frömmigkeit und der Sanftheit eines Lammes erfreuen. Es gab immer noch eine unsichtbare Nabelschnur, die ihn mit Charles d'Anjou verband – das übersah der gute Herr Ludwig–, und solange diese Verbindung bestand, konnte jederzeit der böse Geist des Anjou den schlicht denkenden Yves wieder in den reißenden Wolf zurückverwandeln.
Gavin trat zu der Gruppe und begrüßte Yeza respektvoll, Sigbert freundschaftlich, William spöttisch und Yves kühl. »Der Herr König hat dem Gesuch des Herrn Komtur des Deutschen Ritterordens stattgegeben, sodass unser Freund Sigbert nach Norden eilen kann, um nach Eurem Roç zu forschen«, wandte er sich an Yeza, »und wie ich Herrn Sigbert kenne und schätze, wird er ihn finden.«
Das war die als Trost bemäntelte Ankündigung, dass Yeza dieses Schutzes entbehren müsse.
Doch das Mädchen fiel dem überraschten Sigbert um den Hals und dankte ihm für sein Vorhaben.
»Auch mich hat der König beiläufig darauf angesprochen«, setzte Gavin spöttisch hinzu, »ob die Templerburgen an den Grenzen nicht meines Armes bedürften, und vor allem meiner Erfahrung.«
»Und Ihr habt ihm stolz erwidert, im Orden des Tempels sei jeder ersetzbar, und keine Burg sei je ohne qualifizierte Führung gelassen worden«, ergänzte Sigbert die Schilderung vorsichtig, denn er wusste nicht, worauf der Templer hinauswollte.
»Ich erwiderte ihm«, sagte Gavin, »meine Aufgabe sei anderer Natur, und deswegen würde ich Akkon grad verlassen, ohne es jedoch aus den Augen zu verlieren.«
Sigbert hatte begriffen: »Das will ich auch so halten – und schließlich ist ja Akkon in zweier Tage scharfen Ritts von Starkenberg her zu erreichen!«
»Wenn Ihr Euch um mich Sorgen macht, lieber Sigbert«, sagte da Yeza, »so reitet immer weiter, viele scharfe Tagesritte, bis Ihr meinen Roç gefunden und ihn mir sicher zurückgebracht habt!«
Sie schenkte ihm das Strahlen ihrer Augensterne und wies dann, zu Gavin gewandt, auf William und Yves, den Bretonen. »Ich habe mit Eurem Fortgang zwar keinen richtigen Ritter mehr, aber zwei Herren, die, so verschieden sie in ihrer Art sein mögen, sich die undankbare Aufgabe haben aufbürden lassen, um mein Wohl besorgt zu sein, dazu die Fürsorglichkeit des Königs selbst. Um meinen Schutz ist es also nicht schlecht bestellt! Und nun lasst uns gehen, meine Herren, die Frau Königin fragt sich sonst mit Recht, was sich wohl ein junges Mädchen mit vier ausgewachsenen Männern und einem Lastenträger so lang auf dem Basar herumtreibt.«
»Mich entschuldigt«, Gavin verbeugte sich förmlich vor Yeza, »ich muss noch meine Abreise vorbereiten, denn ich will das Tor von Maupas[26] so schnell wie möglich hinter mich bringen. – Euch sehe ich noch«, wandte er sich vertraulich an Sigbert, grüßte William und Yves durch Hochziehen der Augenbrauen und verschwand.
Lehnstreue auf Vorbehalt
Diarium des Jean de Joinville
Akkon, den 4. Juli A.D. 1250
Heute Morgen hat uns mein Herr Ludwig zu sich gerufen. »Meine hohen Herren«, sagte der König, »ihre Königliche Hoheit, die Königinmutter, hat mir die dringliche Botschaft zukommen lassen, ich möge nach Frankreich zurückkehren, denn das Land sei in höchster Gefahr, da sich der Herr Henri[27], König von England, nicht an die vom Papst auferlegte Waffenruhe hält. Andererseits – die Bewohner von Outremer bitten mich flehentlich zu bleiben, denn wenn ich von dannen zöge, wäre der Traum von Jerusalem zunichte, es blieben nach dem durch mich zugefügten Aderlass nur wenige, um auch nur Akkon halten zu können. So erwarte ich von Euch, meine lieben Herren, dass Ihr reiflichen Ratschluss wägt. Dem Ernst der Lage Rechnung tragend, lasse ich Euch dazu eine angemessene Frist. Dann sollt Ihr mir Eure wohlweisliche Meinung kundtun.«
Kaum hatte uns der König vor die schwere Entscheidung gestellt, suchte mich der römische Legat in meinem Quartier auf, um mich wissen zu lassen, er sähe auch nicht die geringste Möglichkeit für Herrn Ludwig, im Heiligen Land zu verweilen, und lud mich ein, auf seinem Schiff die Rückreise nach Frankreich anzutreten.
Ich sagte ihm nicht, dass ich kein Geld mehr besaß, um meine Schulden hier zu zahlen, sondern dass ich mich von seinem Angebot hoch geehrt fühlte, doch die Mahnung meines alten Priesters Dean of Manrupt – Gott habe ihn selig! – im Ohr behalten hätte: »Auf Kreuzzug ausfahren ist ein gar löblich Unterfangen, aber achtet darauf, wie Ihr heimkehret! Denn jeder Rittersmann, ob arm oder reich, verlor' sein Ehr, bedeckte sich mit Schand, wenn er Gottes schlichte Knechte, mit denen er ausgezogen, in den Kerkern der Heiden schmachten ließe.« Der Herr Legat war sehr verschnupft ob dieser Zurückweisung.
Alsbald rief uns der König wieder zusammen, seine Brüder und die anderen Pairs[28] von Frankreich hatten den Grafen von Flandern beauftragt, ihren gemeinsamen Entschluss darzulegen.
»Majestät«, sagte der. »Wir haben Eure Lage gewissenhaft bedacht und sind zu der Auffassung gelangt, dass Ihr hier nicht bleiben könnt, ohne Schaden an Eurer Ehr und dem Wohlergehen des Königreiches von Frankreich zu nehmen. Von allen Rittern, die mit Euch ausgezogen sind – zweitausendachthundert brachtet Ihr nach Zypern – umringen Euch heute hier in Akkon grad' noch hundert! Deshalb lautet unser Rat: ›Kehrt heim nach Frankreich, verschafft Euch dort Mannen und Geld, und kommt mit solchen versehen schnellstens wieder, um Vergeltung zu üben an den Feindes Gottes, die Euch diese Schmach angetan.«
Der Herr Ludwig war wenig erbaut von diesem Vorschlag, er fragte seine Brüder Charles und Alphonse, ob sie diese Ansicht teilten, und sie nickten.
Der Legat, der sich als Mann der Kirche in der heiklen Frage bedeckt hielt, obgleich ich wusste, dass ihm jegliche Bemühungen um das Heilige Land zuwider sein mussten, stand doch sein Trachten darauf, im Abendland eine bewaffnete Koalition gegen den Staufer auf die Beine zu bringen, wandte sich törichterweise an den Philipp de Montfort, um eine weitere Stimme pro signo recipiendi[29] ins Feld zu führen, doch der bat, man möge ihm die Antwort ersparen, »denn meine Burgen liegen im Grenzland, und wenn ich den König aufforderte zu bleiben, so erweckte ich den Eindruck, ich täte es aus Eigennutz.«
Doch Herr Ludwig gebot ihm, seine Gründe darzulegen, und so erhob er sich und sagte: »Wenn Eure Majestät es ermöglichen könnte, seinen Feldzug noch um ein Jahr zu verlängern, dann würdet Ihr viel Ehre gewinnen und das Heilige Land retten.«
Der erboste Legat fragte jetzt – um die Schlappe abzuschwächen – jeden laut, und alle waren zu seiner sichtlichen Befriedigung für den Vorschlag des Grafen von Flandern.
Aber dann kam, und er konnte mich nicht übergehen, die Reihe an mich, und ich sagte laut: »Ich stimme mit dem Montfort überein!«
Der Legat war so wütend, dass er den Fehler beging, sich mit mir in einen Disput zu verwickeln, weil er nämlich sagte, wie ich mir denn einbilden tät, dass der Herr König mit so wenigen Leuten hier bestehen könnte.
Und weil er mich so schön gereizt hatte, stand ich auf und antwortete: »Das will ich Euch gerne sagen, werter Herr, weil Ihr es ja hören wollt. Bislang – so sagt man, und ich will auch gar nicht wissen, ob es wahr ist – wurde dieser Kreuzzug von den Abgaben bestritten, die von der Kirche eigens dafür eingetrieben wurden. Wie wär’s, wenn der König nun etwas aus dem eigenen Säckel spendieren tät, und zwar freigiebig und großzügig? Dann kämen genug Ritter aus aller Welt angelaufen, und es wäre ihm ein Leichtes, so Gott will, dieses Land – wenn schon nicht zu retten, so doch zumindest um ein weiteres Jahr zu halten. Und so, und nur so, wäre es ihm vergönnt, in dieser Frist die Gefangenen zu befreien, die für Gott und im Vertrauen auf ihn, den König, ausgezogen sind und die nie mehr freikommen würden, wenn er selbst das Feld räumen tät!«
Ich hatte eigentlich erwartet, jetzt ein empörtes Zischeln zu hören, weil ich es als einziger gewagt hatte, gegen den allgemeinen Konsens aufzutreten, aber es herrschte betroffene Stille, einige schnäuzten sich, denn es war wohl keiner, der nicht einen Freund in den Händen der Ungläubigen wusste.
Und der König sagte: »Ich habe nun gehört, meine Herren, was Ihr mir zu sagen hattet. Ich will's überschlafen und meine Absicht Euch dann wissen lassen.«
»Gloria in excelsis Deo.
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.«[30]
Der König zog sich zur Abendtafel in seine Gemächer zurück, und wie stets erging die Einladung an mich, ihm bei Tisch Gesellschaft zu leisten.
Er hieß mich an seiner Seite sitzen, aber er richtete während des Essens kein Wort an mich, was mich beunruhigte. Sicher war er höchst verärgert, weil ich so rundheraus ihm vorgehalten hatte, dass er bislang noch kein Livre[31] aus den eigenen Truhen ausgegeben, wo er solches doch wirklich vermöchte.
Ich war auch nicht gewillt, den Vorwurf, so er denn stimmte, zurückzunehmen.
»Crucifixus etiam pro nobis;
sub Pontio Pilato passus et sepultus est.
Et resurrexit tertia die secundum scripturas.«[32]
Während Herr Ludwig noch mit seinen Priestern die übliche Danksagung abhielt, war ich an das Fenster getreten, und es kam mir in den Sinn, wenn der König nach Frankreich zurückgehen würde, dann könnte ich beim Fürsten von Antioch Bleibe finden, der – ein entfernter Verwandter – schon angefragt hatte, ob ich zu ihm kommen wolle. So könnte ich meine Kasse wieder auffüllen und abwarten, bis ein neues Heer aufgestellt würde oder jedenfalls die Gefangenen wieder freikämen.
»Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.«[33]
Da legte sich eine Hand schwer auf meine Schulter. An dem königlichen Siegelring erkannte ich sie.
»War es der Widerspruchsgeist des jungen Mannes«, fragte der König, »oder seid Ihr tatsächlich der Meinung, ich täte schlecht daran, wenn ich dieses Land im Stich lassen würde?«
»Beides, mein Herr«, sagte ich.
»Würdet Ihr bleiben, wenn ich bleibe?«
»Gewisslich!«, antwortete ich. »Fragt sich nur, auf wessen Kosten, denn ich habe alles verloren.«
»Darüber macht Euch keine Sorgen, Seneschall«, sagte der König, »denn ich bin Euch zu großem Dank verbunden für die Haltung, die Ihr gezeigt – die Ihr mir gewiesen –«
Mit kräftigem Druck nahm er seine Hand von meiner Schulter.
»Sprecht mit niemandem darüber«, mahnte er mich, »bis ich meine Entscheidung verkündet habe!«
Der Komtur der Deutschen von Starkenberg wurde gemeldet, Herr Sigbert kam um seinen Abschied ein.
Gleichzeitig erschien auch die Königin mit einer sittsamen Yeza im Gefolge – sie trug zumindest ein hochgeschlossenes Kleid, das Blondhaar geflochten und gesteckt, und der geliebte Mongolendolch blieb unsichtbar.
Frau Margarethe, der die Amme ihr Söhnlein nachtrug, zog einen Reif vom Finger und sagte: »Lieber Öxfeld, Uns verbindet mehr als solcher Tand, er soll Euch auch nur zur Erinnerung dienen für Stunden, die ich Euch nie vergessen will –«
Der Komtur beugte sein Knie vor dem Königspaar und sagte: »Ich gehe davon aus, dass Eure Herrschaft dem Königreich von Jerusalem noch lange erhalten bleibt.«
Der König blickte erstaunt, die Königin betroffen, aber beide hielten an sich.
»Sonst hättet Ihr mir die Prinzessin mit nach Starkenberg gegeben«, löste er das Rätsel seiner zur Gewissheit erlangten Vermutung, »denn Ihr wisst, Majestäten, um meine Verpflichtung, sie zu schützen. Der Ring, den Ihr mir gabt«, wandte er sich jetzt an Frau Margarethe, »möge Euch vielmehr daran erinnern, dass nun Ihr in diese Verantwortung eintretet.«
»Wieso?« entfuhr es der Königin, den knienden Ritter übergehend. »Lieber Herr Gemahl, kehren wir nicht heim nach Paris?« Der König lächelte gequält.
»Der Komtur ist sicher nicht in der Absicht gekommen, Unserem Entschluss vorzugreifen. Ihm geht es lediglich darum, Unserer Fürsorge gewiss zu sein, und dies will ich ihm gern zum Abschied bestätigen.«
Er reichte Sigbert die Hand zum Kuss und ließ Yeza vortreten. Sigbert erhob sich.
»Wir haben uns alles gesagt«, sprach das Mädchen mit fester Stimme, »und sind uns unseres Vertrauens gewiss. Habt eine gute Reise, lieber Sigbert!«
Yeza deutete einen Knicks an, zwinkerte ihm zu und trat sittsam unter die Frauen der Königin zurück. Der Komtur neigte grüßend sein Haupt und schritt hinaus.
Akkon, den 5. Juli a.d. 1250
»Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem,
factorem coeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.«[34]
Am nächsten Morgen versammelte uns der König gleich nach der Morgenmesse. Als wir vollzählig waren und Schweigen eingetreten war, schlug unser frommer Herrscher das Kreuzeszeichen über seine Lippen, wohl um den Heiligen Geist anzurufen, bevor er das Wort an uns richtete.
»Ich danke, meine Herren, allen, die mir geraten, nach Frankreich heimzukehren, aber auch denen, die mir empfohlen hierzubleiben. Ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass die Kronlande nicht so gefährdet sind, zumal meine Frau Mutter über genügend wehrtüchtige Armeen gebietet, um Frankreich wirkungsvoll zu verteidigen! Andererseits wäre das Königreich von Jerusalem verloren, weil niemand bleiben würde, wenn ich ginge. Somit habe ich entschieden, dass ich das Heilige Land auf gar keinen Fall im Stich lassen werde, bin ich doch hergezogen, es zurückzuerobern. Nun erwarte ich von Euch, meine edlen Herren, dass Ihr offen mit mir sprecht. Ich will jedem, der bei mir bleibt, so großzügige Bedingung bieten, auf dass es nicht meine Schuld ist, sondern seine, wenn er nicht an meine Seite tritt.«
Da breitete sich große Befangenheit aus.
»Agnus Dei, quitollis peccata mundi,
miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem.«[35]
Um allen Widerworten die Spitze zu brechen, befahl Herr Ludwig seinen beiden Brüdern, nach Frankreich zur Königinmutter zurückzugehen. Und als sie nicht widersprachen, und auch sonst keiner spontan sein Bleiben erklärte, war der König sehr traurig und entließ uns mit plötzlicher Heftigkeit.
Der Graf von Anjou war schon im Packen seines Hofhalts begriffen, als Yves, der Bretone, zu ihm geführt wurde. »Ihr habt mich rufen lassen, Herr Charles –?« Der Graf scheuchte die Bediensteten aus dem Raum. »Früher«, sagte er leise, als der letzte die Tür hinter sich geschlossen, »ließet Ihr Euch nicht lange bitten, Bretone! Woher die Widersetzlichkeit? Wollt Ihr den Ast, auf dem Ihr gut sitzt, dem Strick vorbehalten, an dem Treulose baumeln?«
»Ich bin kein Verräter«, sagte Yves, »und das ist genau die Gabelung, an der sich unsere Wege trennen. Früher diente ich durch Euch dem Hause Capet und damit dem König, der – wie Ihr wohl wisst – mein einziger Herr ist. Ihr schlagt jetzt eine Richtung ein, die Euren Interessen frommen mag, aber denen meines Herren Ludwig gar bald in die Quere kommen wird. Ich will und kann nicht –«
»Ich bin gerührt«, sagte der Anjou, der ihn mit unbeweglicher Miene hatte bis dahin ausreden lassen, »ich bin zerknirscht wie zwei Mühlsteine, in die ein Kiesel geraten ist: Mein Bretone hat Skrupel.«
Yves sah ihm gradaus in die Augen, soweit das seine immer leicht vorgebeugte Statur zuließ. Er wollte den hochfahrenden Anjou nicht unnötig reizen, aber er wollte auch Klarheit.
»Mein Sinn für Recht und Unrecht ist mir, dafür danke ich meinem Schöpfer, nie abhanden gekommen. Wenn Ihr mir ein weites Gewissen unterstellen wollt, edler Herr, dann habt Ihr Euch von meinem bedingungslosen Einsatz für die Krone leiten lassen – und darauf mag ich stolz sein. Nun strebt Ihr nach einer eigenen Krone, und so bin ich Euer Mann nicht länger –«
»Das wird Euch leid tun«, sagte Anjou, ohne zu drohen, fast als bedauere er den Bretonen mehr als sich selbst, der diesen Diener verlor. »Ich biete Euch dennoch eine Abfindung an, die Euch vor Augen führt, was Ihr so leichtfertig »aus Gewissensgründen« aufgebt. – Wollt Ihr es hören?«
»Nein«, sagte Yves. »Ich will es nicht, aber das hat Euch ja noch nie geschert.«
»Die Grafschaft von Sarrebruck ist mir wieder zugefallen«, er beobachtete Yves aus den Augenwinkeln, »ich gebe sie Euch zum Lehen –«
Der Bretone starrte zu Boden. »Und was verlangt Ihr von mir dafür –?«
»Nichts Unehrenhaftes«, sagte der Anjou leichthin, »auch nichts Neues: nur die Köpfe –«
»Nein!«, sagte Yves. »Ich lege die Hand nicht an die Kinder, nicht mehr, nimmermehr – nicht weil mein Herr König die Seine schützend über sie hält, sondern weil ich diese Art von Henkersarbeit nicht mehr will, um meinetwillen!«
»Wollt Ihr Eure Seele retten?«, spottete der Anjou.
»Nein«, lachte Yves ihm ins Gesicht, »die hab' ich spätestens verloren, als ich Euch traf.«
Das gefiel dem Anjou. »Ihr könnt sie zurückkaufen, Ritterschlag und den reichen Besitz an der Sarre obendrein für einen einzigen blonden Kopf, nicht größer, nicht schwerer als ein Krautkopf – seid kein Narr!«
»Ich wär' ein Narr«, sagte der Bretone, »wenn ich mich weiterhin an Euch binden wollte. Das ist nicht der Weg zum Rittertum! Gehabt Euch wohl – ich werde für Euch beten, wann immer ich von Euch höre.«
»Geht nur, Yves«, lachte der Herr Charles. »Ihr werdet von mir hören! Bis dahin begreift, dass weder Gott noch ein Herrscher dieser Welt von Euch fromme Gebete erwartet, sondern den Zuspruch des Schwertes!«
Er entließ Yves mit einer ärgerlichen Handbewegung. »Bretonischer Dickschädel!«
Diarium des Jean de Joinville
Akkon, den 16. Juli A.D. 1250
König Ludwig zeigte seinen Unmut nur im kleinsten Kreise der ihm treu Ergebenen, für die es eine Selbstverständlichkeit darstellte, ihm Gefolgschaft zu leisten, wohin er auch ging oder schritt.
»Meine Herren«, sagte er, »bald sind es zwei Wochen, dass ich mein Verweilen hier kundgetan, und Ihr habt noch keinen einzigen Ritter in meine Dienste genommen?«
»Majestät«, antwortete der Konnetabel, »die wollen alle nach Haus, und so setzten sie den Preis für ihr Hierbleiben so unverschämt hoch an, dass weder Euer Marschall noch Euer Schatzmeister es für vertretbar hielten, sie festzuhalten.«
»Und bietet sich keiner billiger an?«, fragte der König bekümmert.
»Doch«, sagte der Konnetabel und wies auf mich, »der Herr Seneschall de Joinville, und selbst der verlangt so viel, dass wir es nicht wagen, ihn einzustellen.«
Da wandte sich Herr Ludwig an mich und sagte: »Ihr habt Euch immer meiner besonderen Gunst erfreut – und immer hatte ich auch das Gefühl, dass Ihr mich liebtet – wo liegen die Schwierigkeiten?«
Ich antwortete: »Ihr wisst, Majestät, dass ich alles verloren habe, und so brauche ich zweitausend Livres sofort auf die Hand: Jedes der drei Ritterbanner, die ich in den Dienst nehmen will, kostet mich vierhundert bis Ostern nächsten Jahres –«
Der König nahm seine Finger zur Hilfe. »So kosten Euch Eure Mannen zwölfhundert –?«
»Richtig«, entgegnete ich, »aber denkt dran, dass ich für Pferde, meine Rüstung und Knappen nochmals gut achthundert aufwenden muss – und dann soll ich noch alle Mann verköstigen, denn Ihr wollt sie ja wohl nicht täglich an Eurem Tisch sehen, schätze ich.«
Der König wandte sich an seine Berater: »Divine nutu gratiae solus comes campaniae![36] – Ich sehe nichts Übertriebenes in dieser Forderung«, und zu mir sagte er freundlich: »Ich nehme Euch in meine Dienste, mein lieber Joinville.«
Hochmut der Tempelherren
Kurz darauf begaben sich die Brüder des Königs und alle anderen Herren an Bord ihrer Schiffe. Gerade als sie in See stechen wollten, ging der Herr Alphonse de Poitiers noch einmal bei allen Abreisenden herum und lieh sich von ihnen, was sie ihm an Schmuck und Juwelen überlassen wollten. Die Stücke verteilte er freigiebig an uns, die wir in Akkon beim König zurückblieben.
Beide Brüder flehten mich voller Sorge an, ich möge ihren lieben Bruder gut behüten, denn ich sei der einzige von allen, zu dem sie dieses Vertrauen hätten.
Als Herr Charles die Segel setzen ließ, überkam ausgerechnet den kaltherzigen Grafen von Anjou eine so weinerliche Rührseligkeit, dass alle, die am Kai standen, peinlich berührt waren.
Wir winkten mit unseren Tüchern, bis die stattliche Flotte außer Sicht war. Dann fühlten wir uns erleichtert.
Jetzt wussten wir, auf wen wir uns verlassen konnten: Nur auf uns selbst.
Yves, der Bretone, hatte tagelang das Tor des Maupas nicht aus den Augen gelassen, um nur ja nicht das Wegreiten der Templer unter dem Präzeptor Gavin Montbard de Béthune zu versäumen.
Nach dem letzten Gespräch mit Charles d'Anjou sah er seinen Weg klar vor sich, denn solange er seinem Herrn, dem König Ludwig, diente und sich somit zwangsläufig im Dunstkreis der Capets aufhielt, würde ihn Charles, dieser Geier, immer wieder in die Krallen bekommen, ihn zu verführen, zu dingen, zu pressen versuchen. Zu Taten oder Untaten, die mit seinem neuen Selbstverständnis nichts zu tun hatten, und er würde irgendwann diesen perfiden Einflüsterungen, diesen Verheißungen weltlichen Standes erliegen.
Wessen er, Yves, der Bretone, bedurfte, das war die eherne Disziplin eines Mönchsordens, in dem der Sache Gottes, dem göttlichen Recht gedient wurde, und so er in solcher Zucht und Gehorsamkeit sein Schwert ziehen müsse, dann geschähe es für den Glauben – und nicht für oder gegen feudalistische Ziele.
Es war zwar nicht ohne Belang, ob diese Kinder des Gral nun eine Gefahr für die Capets darstellten, wie der Anjou befürchtete, der wohl mehr an seine eigenen Herrschaftspläne dachte, oder ob sie, wie jetzt die Prinzessin Yeza, von Herrn Ludwig ins Herz geschlossen wurden, aber das sollte nicht länger seine Sorge sein.
Er wollte gleichfalls nicht, wie geschehen, vom König zum Leibwächter des königlichen Kindes bestellt sein, denn auch diese »Tochter des Gral« war weltlicher Macht unterworfen, war Spielball dynastischer Bestrebungen, und wenn er sich heute auf diese Hüterrolle einließ, dann war er morgen wieder der Vollstrecker irgendwelcher Interessen.
Von Sankt Andreas nächst dem Tempel am Meer her und Sankt Sabas im Viertel der Pisaner ertönten die Glocken zum Angelusläuten. Um ihre eigene Schanze, mit der die doppelte Mauer der Stadt an ihrem nördlichsten Zipfel ins Meer mündete, bogen die Templer. Sie mussten die gesamte Altstadt und den Faubourg Montmusart[37] noch einmal durchritten haben, um von dort sich dem Tor von Maupas zu nähern.
Geschlossen galoppierten sie über das Kopfsteinpflaster des äußeren Ringes, an ihrer Spitze Gavin Montbard de Béthune. Ihre weißen Clayms mit dem roten Tatzenkreuz leuchteten im Licht der Abendsonne. Es war ein stattlicher Trupp, der da abzog, denn Renaud de Vichiers, ihr neuer Großmeister, legte Wert darauf, dem König zu zeigen, dass hier im Herzen des Heiligen Landes er allein darüber bestimmte, welche Kräfte der Orden an welchem Ort zu seiner, nicht des Königs Verfügung hielt.
Der Kreuzzug war zu Ende, in Akkon kehrte der Alltag von Outremer ein, und es galt wieder, die Außenbastionen zu besetzen, um nicht im täglichen Disput um Tribut, Handel und Erwerb den Kürzeren zu ziehen. Für die Hauptstadt des Königreiches mochte die symbolische Präsenz des Großmeisters genügen.
Für ihn, den Präzeptor von Rennes-les-Chateaux[38], den auffälligen, zu auffälligen Gesandten des Ordens hinter dem Orden, eingeweiht in die geheimen Dinge und in den »Großen Plan« und verwickelt in Machenschaften, die oft am Großmeister vorbeiliefen, war nun kein Platz mehr.
Gavin sah den Bretonen sofort, ließ seinen Trupp halten, sodass Yves wie ein Bittsteller sich ihm nähern musste.
»Auf ein Wort unter vier Augen, Präzeptor«, sagte Yves bescheiden, »lange habe ich Eurer geharrt.«
»Ich wüsste nicht«, entgegnete Gavin und lenkte sein Pferd beiseite, ohne abzusteigen, »was mir die Ehre verschafft?«
Yves schluckte die demütigende Situation – das »Zweifelhafte« hing unausgesprochen in der Abendluft. Sie war Teil der Prüfung, die zu bestehen er willens war.
»Als Postulant[39] trete ich vor Euch hin, Herr Gavin«, gestand Yves leise, »ich bitte um Aufnahme in Euren Orden.«
Der Templer hatte mehr konsterniert als höhnisch die Augenbrauen hochgezogen. »Ich bitte Euch, Herr Yves, bedenkt, was Ihr da vorbringt – bei allem Respekt vor einem trefflichen Mann des Königs: Das kann doch nicht Euer Ernst sein!«
»Prüft mich!«, sagte Yves. »Probat spiritus, si ex Deo sit«[40], fügte er hastig hinzu, um zu beweisen, dass er nicht unvorbereitet war.
»Ihr wollt anscheinend aus meinem Munde hören, damit Ihr mich noch mehr hasst, Bretone, was jeder Mann der Kirche weiß, dass jemandem wie Euch die Akzeptanz für immer verwehrt bleibt: Erstens habt Ihr die Priesterweihe[41] erhalten –«
»Ich bin nicht exkommuniziert[42]!« begehrte Yves auf. »Das wäre besser für Euch!« lachte Gavin trocken. »Doch es würde Euch, Herr Yves, auch nicht weiterhelfen, denn zweitens: Wie wollt Ihr die Frage beantworten, die Euch unweigerlich gestellt wird: ›Seid Ihr der Sohn eines Ritters und seiner Gemahlin, sind Eure Väter aus Rittergeschlecht?‹«
Der Bretone schwieg betroffen. Wie hatte er auch glauben können, der elitäre Orden würde für ihn eine Ausnahme machen? Gut, der Ritterlichkeit könnte der König mit einem Schlag nachhelfen, aber seine Vergangenheit als Kleriker konnte er nicht ohne Weiteres abstreifen, es sei denn durch Dispens[43].
»Ich sehe«, ließ sich Gavin vernehmen und zügelte sein Pferd, »Ihr habt keine weiteren Fragen. Ihr hättet Euch auch diese sparen können, aber Ihr wolltet Euch wohl quälen?«
»Ich will den Sünden dieser Welt fliehen«, sagte Yves, »und ich bin in der Lage, alle Härten zu ertragen.«
»Dazu reicht ein jedes strenge Klosterleben –«
»Ich bin ein Mann des Schwertes, wie Ihr wohl wisst, Herr Gavin«, bockte Yves, »ich kann kämpfen, ich könnte den Kindern ein Hüter sein –«
Der Templer zog sein Pferd noch einmal herum und beugte sich leicht hinab zu Yves. »Das ist nicht Eure Bestimmung, Yves«, sagte er bedächtig. »Ihr seid ein gefährlicher Prüfstein und nicht Beschützer der Königlichen Kinder. Dass Ihr Eurem Schicksal zu entgehen versucht«, sagte er leise, »zeigt mir um so mehr, dass Ihr ausersehen seid. Gott schütze die Kinder vor Euch, Yves –« Er riss sein Pferd herum. »Gehabt Euch wohl!«
Der Präzeptor schloss zu seinem Zug auf, und sie ritten mit wehenden Mänteln aus dem Tor. Blutrot ging die Sonne unter.
Yves starrte ihnen nach, bis der letzte Hufschlag verklungen war.
Der Giftzwerg
Qasr al Amir, der Emiratspalast von Homs, zog sich von der tiefer gelegenen Medina[44] in einer Folge von ansteigenden Innenhöfen bis zur höchsten Erhebung der Stadtmauern, in deren spitzen Winkel dann die eigentliche Zitadelle hoch aufragte. Die Zufahrtswege verliefen in überdachten Serpentinen. So konnte man zu Pferd bis hinauf zu den privaten Gemächern reiten, nicht aber bis zum Harem, der über den höchsten Innenhof kragte und nur von den Räumen des Herrschers aus erreichbar war.
Von hier aus hatte An-Nasir den Blick über die Stadt nach Süden bis in die Beka'a-Ebene, an deren Ende die Tempel von Baalbek lagen, im Norden auf das Nosairi-Gebirge, das sich die Ritterorden und die Assassinen des Alten vom Berge streitig machten. Auf der nach innen gewandten Seite schaute er hinab in die Gärten des Harems.