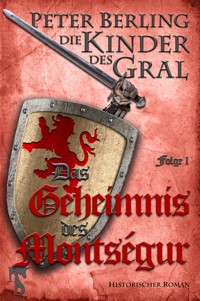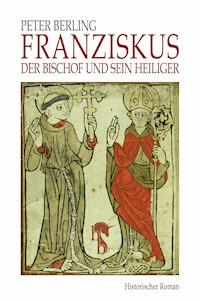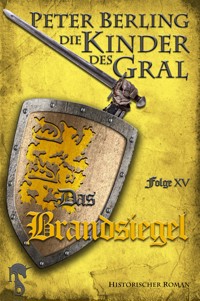3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Kinder des Gral
- Sprache: Deutsch
Erneut segeln Roç und Yeza, die Kinder des Grals, nach ihrer Flucht mit der Triëre ›Äbtissin‹ einem ungewissen Schicksal entgegen. Auf hoher See geraten sie in die Kreuzzugsarmada von Ludwig dem Heiligen, dem König von Frankreich, der unterwegs nach Zypern ins Lager seiner Armee ist. Kurzerhand werden die Königskinder gefangengenommen und nach Zypern verschleppt. Dort strecken neue Gegner ihre Krallen nach Roç und Yeza aus: allen voran ihr fürchterlichster Gegenspieler, Yves, der Bretone, seines Zeichens geheimnisvoller Scharfrichter der Krone. Auch die verfeindeten Ritterorden von Johannitern und Templern haben ein eigenes Interesse an den Gralskindern, ebenso die geistlichen Berater aus Rom, die sich im Lager von Ludwig, dem Heiligen, eingefunden haben. Als ein Fluchtversuch von der Insel misslingt, scheint das Schicksal der Zwillinge besiegelt. Doch die sagenumwobenen Assassinen, die wahren Machthaber Zyperns, schwingen sich zu ihren Beschützern auf. In deren Burg fühlen sich Roç und Yeza das erste Mal geschützt. Aber ist es wirklich Sicherheit, was den Gralskindern nun beschert ist? Denn der Schritt vom Beschützer zum Wächter ist klein und schon bald erkennen die beiden Kinder des Gral den goldenen Käfig, in dem sie nun gefangen gehalten werden … Ein spannender historischer Roman von Peter Berling, der gleichzeitig das große Epos »Die Kinder des Gral« aus der Zeit der Kreuzzüge als Teil IV fortführt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 436
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
PETER BERLING
Die Piratin der Ägäis
Folge IV des 17-bändigen Kreuzzug-Epos Die Kinder des Gral
Historischer Roman
WAS DAVOR GESCHAH IN FOLGE III
Im Lügengespinst von Byzanz
›Die Äbtissin‹, die berüchtigte Triëre von Otranto, erreicht mit dem Franziskaner William von Roebruk und den geborgenen ›Kindern des Gral‹ Konstantinopel, die prächtige Hauptstadt des einst so mächtigen Byzanz.
Doch mit ihrer glücklichen Ankunft ist der ›Große Plan‹ noch längst nicht erfüllt, der vorsieht, das ›Königliche Paar‹ zu den einzig rechtmäßigen Herrschern der Welt zu erheben, von den fernen Mongolen des allgewaltigen Großkhans ebenso anerkannt wie vom kriegslüsternen Sultan von Kairo und dem schwachen Kaiser von Konstantinopel, vom gebannten Staufer Kaiser Friedrich II ganz zu schweigen: Einer Machtfülle und Legimitation also, der sich der Papst von Rom nicht widersetzen kann.
Um diesen Plan durchzuführen, wird eine beeindruckende Inszenierung in Gang gesetzt, in der ein hochgestellter Legat der Kirche und des französischen Königs dazu gebracht wird, die ›Kinder des Gral‹, ›von den Mongolen der Welt geschickt‹, in Konstantinopel dem staunenden Orient ebenso wie dem perplexen Abendland prunkvoll feierlich zu präsentieren.
William von Roebruk ist als Bevollmächtigter des Großkhans vorgesehen, der dessen Willen bezeugen wird, die Kinder als alleinige Friedensherrscher mit allen Vollmachten einzusetzen.
Doch haben die Verfechter der Ansprüche des Grals ihre Rechnung ohne die perfide Gewalt der römischen Kurie und die tückischen Listen der Inquisition gemacht. Der Festakt gerät zu mörderischem Massaker: William opfert sich, um die ›Königlichen Kinder‹ in allerhöchster Not zu retten. Wieder gelingt der Triëre eine halsbrecherische Flucht aufs offene Meer – und keiner weiß diesmal wohin …
I DIE TRIËRE DER ÄBTISSIN
Der Rammdorn
Diarium[1] des Jean de Joinville[2]
In der Agäis, den 27. August A.D. 1248
Über den byzantinischen Kauffahrer brach das Erscheinen der Triëre wie ein finsterer Spuk am lichten Mittag herein. Einem höllischen Insekt gleich, glitt das Kampfschiff über die Wellen. Sein schwarzer Bug ragte über dem stahlblauen Meer wie ein dräuender Schatten um so schrecklicher auf, als die erschrockenen Griechen schaudernd erkannten, dass der unheimliche Gegner sich nicht mit Drohungen aufhielt noch zu Verhandlungen bereit war, sondern unerbittlich zum Rammstoß ansetzte …
Mir schnitt das Eisen in den Unterleib. Ich wollte mit einem Sprung mein Gedärm retten, parierte den Schlag – und die Klinge fuhr mir ins Gekröse! Der Schmerz ließ mich stehend die Sinne verlieren.
Alles, was ich vorher und nachher an Leibes Not und Pein erlitt, verblasste vor diesem Schnitt, der mir die Manneskraft nahm, ohne dass ich mir dessen bewusst war. Ich warf mein Schwert fort, um beide Hände in den gestochenen Schoß zu pressen, und öffnete meine Lippen zum Schrei, der nicht kam.
Das geschah mir jetzt unwillkürlich wieder angesichts der heranstürmenden Todesgefahr, doch diesmal blieb mein Gehirn bei vollem Bewusstsein, und ich hörte mich den sinnlosen Schrei ausstoßen: »Maire de Dieu![3] Die Triëre[4] der Gräfin!«
Im selben Moment erkannte ich, dass es vor diesem Schicksalsstoß so wenig Rettung gab, wie mir nichts geschehen würde. Verstohlen hob ich meine Waffe wieder auf und hielt meinen Mund. Stand doch auf dem erhöhten Heck kein geringerer als ich, Jean Graf von Joinville und Seneschall der Champagne.
Die Händler unter mir fielen auf die Knie und wedelten demütig mit weißen Tüchern, während der Kommandant in einem ohnmächtigen letzten Aufbäumen seinen Bogenschützen zurief, die beiden Katapulte zu spannen.
»Keine Gefangenen!« schrillte die Stimme der Gräfin zu uns herüber, als die steinernen Geschosse wirkungslos am Ebenholzpanzer ihrer Triëre abgeprallt waren, kein Pfeil blieb in diesem hoch aufgerichteten Schutzschild stecken, die Schläge dröhnten wie Pauken, das Zwitschern wie Zimbeln. Das war Musik in ihren Ohren.
Die Gräfin von Otranto[5] stand aufrecht vor ihrer Capanna[6] auf dem Oberheck, ihr hennarotes Haar umwehte ihr Gesicht wie die Mähne eines Löwen, ihr wahres Alter verhüllend. Schutz suchend kauerten ihre Frauen, ihr Gesinde sich hinter die Reling. Der Blick der Gräfin glitt wohlgefällig über ihre Lanzenruderer, die Lancelotti, die jetzt ihre Sensenblätter auf einen Schlag aus den aufgepeitschten Wellen nahmen und die langen, glitzernden Stangen zum tödlichen Hieb parat stellten, während unter ihnen die Ruderer der zweiten und dritten Galerie die Schlagzahl erhöhten.
Verzweifelt suchte der Kommandant der Byzantiner seine Flanke aus der Stoßrichtung zu manövrieren. Ich hörte, wie mit schnellem Befehl Guiscard[7], der Kapitän der Gräfin, steuerbords die Ruderer einen Schlag aussetzen und so das Manöver des Griechen zu einer hilflosen Fluchtgebärde verkommen ließ.
Ich sehe mich noch auf dem Oberdeck des Byzantiners stehen, breitbeinig, mit aufgepflanztem Schwert, als hätt' ich noch was an Kraft in der Hose und mein Eisen würde mir Respekt verschaffen. Ich versuchte lediglich, mir einen sicheren Stand zu verschaffen für den zu erwartenden Aufprall.
So war ich meinem Gegner auf Sizilien auch gegenübergetreten, einem jungen Engelländer, der dann an Schwindsucht starb. Törichter Liebeshändel hatte uns in das verbotene Duell getrieben, eine Zofe der Bianca di Lancia[8], der kaiserlichen Favoritin, aus normannischem Geblüt derer von Lecce, strohblond, gradnasig und kuhäugig.
Ich hatte ihr mehr aus langer Weile den Hof gemacht, denn Kaiser Friedrich[9] hielt mich damals fest als »lieben Gast und Vetter«, doch der junge Bruce of Belgrave[10], genauso gradnasig, aber rothaarig, hatte sich über beide abstehenden Ohren in Constanza verliebt.
Entsprechend furios griff er mich an. Ich nahm ihn nicht ernst und bemühte mich, ihn mit meinen Schlägen zu ermüden. Doch meine Lässigkeit machte ihn wütend, und so geschah es.
Es tat ihm furchtbar leid, ließ er mir ausrichten, als er bald nach mir im Hospital von Salerno eingeliefert wurde. Ich wollte ihn nicht sehen.
Friedrich übergab mich den besten Ärzten des Reiches, ausschließlich Muslime und Juden, die er an dieser universitas medicinae artis[11] versammelt hatte. Sie konnten mir nur die Möglichkeit zum Pinkeln retten, auch die Hoden blieben mir erhalten – für nichts. Der ductus deferens[12] sei durchtrennt, wurde mir erklärt.
»Ihr habt ja schon zwei Kinder gezeugt«, trösteten sie mich, »der unselige Trieb wird bald verkümmern, atrophieren[13]« – wie sie sich über die Zukunft meines sinnentleerten phallischen Attributs ausdrückten …
»O' sperone, maledetti![14]« brüllte Guiscard und riss mich aus meinen Gedanken. Ich sah, wie er auf seinem Holzbein herumfuhr.
»Sidi! Sidi![15]« grölten die Moriskos[16], denen die Bedienung der furchtbarsten Waffe der Triëre oblag.
Vier verwegene Gesellen aus ihren Reihen waren stumm aufgesprungen und an ihre Posten geeilt. Der sperone war das böse Geheimnis dieses so altmodisch anmutenden Kampfschiffes, das die Gräfin von ihrem Mann, dem Admiral, geerbt hatte. Und als ob es sich seines perfiden Stößels schämte, war der Rammdorn nicht fest am Bug montiert, sondern hing halb eingelassen unterm Kiel und wurde nur zum tödlichen Stoß herausgeholt. Aber davon wusste ich damals noch nichts, und es hat eine Weile gedauert, bis ich herausfand, was in diesem Augenblick geschah. Eine geniale Kettenkonstruktion, nach außen dem Ankerspill zum Verwechseln ähnlich, lief durch die Spanten und zerrte den eisenbeschlagenen Eichenstamm vorwärts, ein gutes, genau berechnetes Stück vor den Bug, als sich jetzt die vier speronisti[17] ächzend gegen die Winde stemmten. Tief unter der Meeresoberfläche schob sich die Spitze langsam wie eine Moräne aus ihrem Loch. Sie hatte einen bronzenen Kopf, phallusartig, einer Rosenknospe gleich war die Verdickung, aber dann, wenn sie voll der Strömung ausgesetzt war, klappten drei stachelbesetzte Widerhaken nach hinten und legten einen messerscharf geschliffenen Dreikant frei. Jetzt richtete sich unter Wasser der Baum leicht auf, sodass er die Wölbung des Opfers genau im rechten Winkel traf, wie ein Messer von unten gegen den Bauch geführt.
Kein Mensch sah ihn kommen, auch Guiscard musste sich auf seine Erfahrung verlassen. Der sperone stürmte unter den Wellen heran, und ich sah mit böser Vorahnung die Moriskos mit ihren Enterbeilen schweigend hinter dem Bugschild lauern.
Es fiel kein weiteres Kommando, der Steven prallte, die splitternde Reling des Griechen leicht eindrückend, gegen dessen Steuerbordseite, der Schlag und das Geräusch berstenden Holzes übertönte das vergleichsweise geringfügige Rumoren der perforatio[18], die sich unter der Wasserlinie abspielte. Der Kopf des Rammdorns hatte sich in die Bootswand gebohrt, nicht tief, davor bewahrten ihn seine eigenen Widerhaken, die wie Zecken strahlenförmig um ihn herum im Holz festhielten, damit keine Bewegung der Schiffsleiber den Spund aus dem Loch reißen konnte, der auf diese Weise jetzt noch das massenhafte Eindringen des Wassers verhinderte.
Bei uns an Deck jedenfalls hatte keiner die tödliche Verwundung wahrgenommen.
Mit dem Aufprall waren links und rechts vom Steven der Triëre die beiden gespreizten Flügel des drachenköpfigen Bugs wie Zugbrücken rasselnd auf das Deck des Griechen niedergefallen, über sie hinweg stürzten sich die Moriskos auf ihre Beute.
Es waren nicht die Händler, die sich zitternd auf dem Heck verkrochen, noch die Mannschaft, die sich unterm Mast um ihren Kommandanten scharte, keine Gegenwehr mehr wagend und auch nicht mehr willens, für die Habe der Kaufleute ihr Leben zu geben, sondern einzig und allein die Kisten und Säcke, die sie jetzt aus den Ladeluken nach oben zerrten und in rasch gebildeter Kette zurück auf die Triëre beförderten.
Das Eingreifen der Lancelotti hatte sich bis zu diesem Zeitpunkt als unnötig erwiesen, sie entfalteten die furchtbare Wirkung ihrer Waffen auch nur beim längsseitigen Entern, wenn sie wie mit einem Sensenhieb die vorderste Reihe der Verteidiger ihrer Arme, oft auch ihrer Köpfe beraubten, bevor die Moriskos an Tauen von Mast und Rahen hinübersprangen und den Rest besorgten. Jetzt wirkten sie nur als Drohung, die den Gegner in Schach hielt.
Stolz blickte die Gräfin auf ihre blinkende Kriegsmacht und begierig auf die Beute, die die Moriskos an Bord ihrer Triëre schleppten.
Ballen von kostbarem Damast, Fässer mit Gewürzen und Ambra, Myrrhe und Henna für ihr Haar, Amphoren voll öliger Essenzen – ihr schwerer Duft wehte bis zu ihr. Sie zog ihn genüsslich durch ihre Nüstern. Vermischt mit der salzigen Meeresluft, war das ihr Parfüm!
Laurence de Belgrave, verwitwete Gräfin von Otranto, war 57 Jahre alt und dachte nicht daran, diesen Freuden der Welt, ihrer Welt, zu entsagen. Das wusste jeder, der wie ich schon einmal die zweifelhafte Ehre hatte, mit ihr nähere Bekanntschaft gemacht zu haben.
Sidi – Sidi! Sie war die Herrin, die gefürchtete Piratin des Ionischen Meeres.
Da tauchten plötzlich aus der Capanna hinter ihr zwei Kinder auf, ein Bube und ein Mädchen, die sich unbefangen zu ihr gesellten und neugierig das Treiben zwischen den beiden Schiffen betrachteten.
Ich erkannte sie sofort: Es waren die Kinder des Gral.[19][20]
Ich erschrak. Ihre geglückte Flucht vor den Häschern der Kirche hatte meine damalige Mission jäh beendet. Über ein Jahr hatte mir der Kaiser seine Gastfreundschaft aufgezwungen. Und kaum habe ich mich seiner Umarmung entzogen, endlich frei, wie ein Falke fliegt, falle ich wie ein grad geschlüpftes Täublein diesen Kindern wieder vor die Füße. Sind sie mein Schicksal, oder welche Rolle ist mir in ihrem Leben zugedacht? Eigne ich mich doch weder als Häscher noch als Hüter?
Dass die Kinder immer noch an Bord der Triëre waren, verwunderte mich indes, offenbar hatte die Gräfin seit unserer Begegnung in Konstantinopel nirgendwo anlanden und sie in Sicherheit bringen können.
Darin glich ihr Schicksal dem meinen, auch mir war es nicht beschieden gewesen, nach Frankreich heimzukehren und meinem König Bericht zu erstatten über diese geheimnisvollen »Königlichen Kinder«, derentwegen er mich an den Bosporus entsandt hatte.
Meine profunde Abhandlung über die mutmaßliche Herkunft von Roç und Yeza, ihre mysteriöse Reise zum Großkhan der Mongolen mit diesem Mönch William, ihre missglückte praesentatio[21] durch die Prieuré[22] und ihren gloriosen Abgang, der mich tief beeindruckt und überzeugt hatte, dass diesen Kindern Großes bestimmt sei, die hatte statt dessen Kaiser Friedrich gelesen, und das war wohl auch der nie ausgesprochene Grund dafür, dass er mich nicht hatte weiterreisen lassen – weder nach Hause noch zum Kreuzzug.
So hatte ich denn die einzige Fluchtmöglichkeit von der Insel genutzt und war mit diesem griechischen Handelsschiff auf dem Weg gen Osten, um zum Kreuzheer König Ludwigs[23] zu stoßen, das sich auf Zypern sammeln sollte.
Quod non erat in votis![24]
Die Gräfin war gerade im Begriff, Roç und Yeza zurück in den Schutz der Hütte zu jagen, als das wachsame Auge ihres Kapitäns auf das Heckkatapult des Griechen fiel, es war geladen und zwei – offensichtlich von den Kaufleuten bestochene – Soldaten zielten auf die Gräfin.
»Scudo![25]« konnte Guiscard den Lancelotti gerade noch zubrüllen, da schnellte der Wurfarm schon vor und entließ das Geschoss, doch wie ein blitzender Fächer fuhren die Sensenblätter in die Luft und schnitten ihm die Bahn ab, zwei Lanzen zerbrachen splitternd, scheppernd fielen die Sensen, aber der Topf mit dem Griechischen Feuer prallte ab und zerbarst genau auf der Reling.
Schreie der getroffenen Ruderer aus dem Unterdeck, Flammen leckten die Bootswand der Triëre hoch und breiteten sich auf dem Deck aus.
»Kein Wasser!«, schrie Guiscard. »Nehmt Teppiche!«
Wahrend das Feuer erstickt und erschlagen wurde, hatten sich die Moriskos schon auf die Schützen geworfen, den Befehl dazu gar nicht erst abwartend. Einer sprang über Bord, dem anderen spaltete ein Axthieb den Schädel.
Die Kaufleute warfen sich auf die Knie, kippten eine Truhe um, dass sich die Goldstücke über die Decksplanken ergossen.
Die Moriskos kannten keine Gnade, sie hieben und stachen alle nieder, rafften zusammen, was sich an Kästen und Schatullen, Geschirr und Pelzen im Zelt befand, schafften es hinüber und breiteten es ihrer Herrin zu Füßen aus, als müssten sie sich für den Tort, der ihr angetan wurde, entschuldigen.
Auch auf mich kamen die wilden Gesellen zugesprungen, ihre Äxte und Enterkeulen schwingend, doch meine überlegene Art, ihnen entgegenzutreten, mich, auf mein Schwert gestützt, nicht zu rühren, ließ die erhobenen Arme innehalten, das Geschrei verstummen.
»Richtet Eurer Herrin Laurence aus«, rief ich ihnen zu, »der Graf von Joinville sei erfreut, sie wiederzusehen!«
Ohne den Bescheid abzuwarten, begab ich mich von dem Aufbau hinunter, das Gesindel wich respektvoll zurück, und ließ mir die Hände derer von Otranto reichen, damit sie mir hinüberhalfen auf die Triëre.
Die beiden Kinder waren trotz strengen Befehls der Gräfin keineswegs in die Capanna zurückgekehrt, sondern erlebten das ganze Geschehen voller Eifer, wenn nicht Entzücken. Sie waren auch die ersten, die von mir Notiz nahmen, wahrscheinlich erkannten sie mich wieder. Jedenfalls tuschelten sie und lachten mich an – so will ich hoffen.
Die Gräfin übersah geflissentlich mein Erscheinen, sie hatte wohl eine kleine Meinungsverschiedenheit mit ihrem Kapitän auszutragen, diesem Amalfitaner[26] mit dem Holzbein.
»Seht Ihr, Guiscard«, seufzte die immer noch höchst faszinierende Dame, »man kann nicht streng genug sein mit diesen falschen Griechen.«
Ich hielt mich schweigend im Hintergrund.
»›Keine Gefangenen‹ war doch die richtige Entscheidung.«
Guiscard senkte den Kopf. »Mir ist Entern lieber. Ein sauberes Hauen und Stechen, und wer sich ergibt, der soll auch verschont werden.«
»Bei diesen Sidi-Sidi-Überfällen darf es keine Zeugen, keine Überlebenden geben«, sagte die Gräfin schroff und warf mir einen knappen Blick zu, dessen Kälte mein selbstbewusstes Lächeln gefrieren ließ.
»Und alle Unterlegenen«, murrte der Kapitän – ganz in meinem Sinn –, »auch brave Seeleute, die nur ihre Pflicht tun, sind von vornherein zum Tode verurteilt.«
Mich hatte er damit wohl nicht gemeint, mich meinte überhaupt keiner, der Kapitän begab sich zurück zum Bug, Frau Laurence drehte mir den Rücken zu.
Die letzten Moriskos sprangen an Bord.
»Hosen zu!«, knurrte der Capitano, und die beiden Bugteile, die als Fallreep gedient hatten, wurden hochgezogen.
Dunkel und abweisend erhob sich jetzt wieder der schwarze Bug der Triëre vor dem ausgeplünderten Schiff der Byzantiner. Der Kommandant und seine Leute vermochten ihr Glück nicht zu fassen. Erst Hoffnung, dann Freude über das geschenkte Leben erschien auf ihren Gesichtern. Guiscard mochte ihnen nicht ins Auge schauen.
»Zieht den Schwanz ein!« zischte er wütend seinen Leuten zu, und die legten sich ächzend in die Winden, während alle Ruder, auch die der Lancelotti, ins Wasser fuhren, um sich vom Opfer wegzustemmen.
Einen Augenblick schien es, als versuchte das andere Schiff der Triëre zu folgen, dann erfolgte mit dumpfen Plop ein Ruck, und die Triëre schoss hinweg, während die Flanke des Griechen mit einem hässlichen Knacken erbebte. Dann begann das Schiff leicht zu krängen, es neigte sich wie ein waidwundes Tier seinem Jäger zu, doch auf der davoneilenden Triëre schaute keiner zurück, nur die Kinder verfolgten das Schauspiel des Untergangs, bis nichts mehr zu sehen war.
Die Prise
Seit Wochen trieb die Triëre der Gräfin ihr Unwesen in den Gewässern der südlichen Ägäis. Laurence de Belgrave war sich immer noch nicht im Klaren, wohin sich wenden, und mied die größeren Inseln, wo sie mit einer starken Garnison rechnen musste.
Die Rückkehr nach Apulien schien ihr ebenfalls nicht geraten, sie war sich des Wohlwollens des Staufers[27] nicht mehr sicher. Schuld waren die Kinder. Sie hätte sie in Konstantinopel nicht an Bord nehmen sollen, aber hatte sie denn die Wahl? Damals so wenig wie heute. Hätte sie sich diesem Dienst entzogen, wäre ihr Leben nicht eine der byzantinischen Golddublonen mehr wert gewesen, die sie gerade an die Besatzung ihrer Triëre verteilen ließ. Unsagbar grausam würde die Rache der Macht ausfallen, die ihre Hand schützend über Yeza und Roç hielt. Vor diesen geheimen Kräften gab es kein Entkommen, kein Versteck, nirgendwo auf der Welt, vom Djebel al-Tarik[28] bis hin zum fernen Reich des Mongolen-Khans. Die Gräfin seufzte. Im Handspiegel erwiderten ihre grauen Augen müde den prüfenden Blick, die Falten wollten sich auch nicht mehr glätten lassen.
Draußen, vor der Capanna, zerrten die Zofen mit verhaltener Gier an den Ballen aus Brokat, Velour und Seide, die sie ihnen überlassen hatte – nur ihre Anwesenheit zügelte die Missgunst und ließ sie nicht in tätlichen Streit ausarten.
Nicht einmal ihre eigene Ziehtochter, Clarion[29], Gräfin Salentin von Kaisers Gnaden, entblödete sich, an dem eitlen Gerangel und eifersüchtigen Anprobieren der Gewänder teilzunehmen. Letztlich war Clarion auch nur eine dumme Gans, auf nichts anderes aus, als den Männern zu gefallen, ihnen um den Hals, wenn nicht gar in den Schoß zu fallen, aufgespießt von ihrer Lenden Zier – ein Schicksal, vor dem sie bisher das Mädchen, eine Vollreife Jungfrau, eisern bewahrt hatte. Jetzt machte sie doch wahrhaftig dem Grafen von Joinville schöne Augen!
Laurence hatte den hoffärtigen Seneschall eigens bisher nicht beachtet, geschweige denn begrüßt, weil sie sich nicht im Klaren war, ob sie dessen Auftauchen begrüßen sollte. Hätten die Moriskos den Kerl doch gleich erschlagen oder mit dem Schiff ersäuft! Dem Fant hatte sein Standesdünkel das Leben gerettet. Jetzt musste sie ihn in allen Ehren willkommen heißen, gar noch mit »mon cher cousin[30]« anreden.
Diarium des Jean de Joinville
In der Agäis, den 27. August A.D. 1248
»Seid Ihr nicht Jean de Joinville?«
Es war die schöne Clarion, die meiner misslichen Lage ein Ende bereitete – unter nichts leide ich mehr als unter Missachtung. Ich dankte es ihr. »Welch unverdiente Freude, zwischen all diesen nach Fisch stinkenden Kopfhackern und Gedärmschlitzern eine Rose wie Euch, Clarion von Salentin, zu finden!«
Ich machte einen Schritt auf sie zu, um mich galant zu verneigen, doch da ging die Gräfin dazwischen, und ich erstarrte, denn hinter ihr stand, als sei es das Selbstverständlichste auf dieser Erde, freundlich grinsend William von Roebruk![31]
Hatten nicht die Assassinen[32] den Mönch vor meinen Augen erdolcht? War nicht sein Leichnam … Hexenwerk! Die Gräfin war mit dem Teufel im Bunde! Der rötliche Haarkranz des dicken Franziskaners war noch spärlicher geworden, doch sein dummdreistes Grinsen war ihm nicht vergangen.
»Als Spion der Capets[33] seid Ihr zu auffällig, Seneschall!« höhnte mich die Herrin der Triëre. »Doch Eure Fähigkeit, Euch an die Fersen der Kinder zu heften, ist beachtlich. – Wachen!« rief sie. »Nehmt dem Herrn das Schwert ab, und führt ihn in meine Capanna! Dort mag er mir Rede und Antwort stehen.«
Ich tat wie geheißen, schon weil jeder Zeitgewinn meine Überlebenschancen vergrößerte. Als Gefangenen konnte sie mich schlecht zum Tode befördern.
»Ich danke Euch, Laurence de Belgrave«, sagte ich artig im Weggehen und dachte, dass es wohl einer aus ihrer Sippe gewesen sein musste, der mich des wahren Schwertes Kraft beraubt hatte – das einen Mann zum Mann macht.
So war mir nur die Macht der geschliffenen Feder geblieben, und ich beschloss, was auch immer auf mich zukommen mochte, mit den Augen des exzellentesten Chronisten zu sehen, den diese Epoche gekannt hatte.
Clarion hatte sich betrübt, aber nicht verwundert – sie kannte diese Anwandlungen von Eifersucht bei Laurence – des Vergnügens entzogen gesehen, endlich standesgemäßen Umgang pflegen zu können. Sie rief Madulain[34], ihre Zofe, zu sich und entschwand. Die Gräfin ließ sich Zeit.
Nur die Kinder kümmerte das alles wenig. Sie tollten auf dem Heck, scherzten mit den Lancelotti, die das Oberdeck okkupierten, und neckten die Ruderer in den unteren Galerien, wo sie nicht hindurften. Gerade dort, im Innern des Schiffsbauches, herrschte ein geheimnisvolles Dunkel, es roch nach wilden Tieren und aufregenden Abenteuern.
Da Yeza verboten war, mit ihrem Dolch Zielwerfen zwischen die Beine der kreischenden Zofen zu üben, schnitzte sie Kerben in das zerbrochene Ruder, das ihr die Lancelotti geschenkt hatten. Sie hätte lieber das Stück mit der Sense gehabt, die noch daran steckte, aber da hatten die rauen Gesellen gelacht und ihr an einem Stück Tuch – ratsch! – vorgeführt, wie scharf das Blatt geschliffen war. So scharf wollte sie ihren Dolch auch schleifen. Doch wie an den Wetzstein kommen?
Yeza war jetzt acht oder neun, so genau wusste das keiner, ebenso wenig wie sie ihren richtigen Namen kannte, außer dass er wohl von Jesabel oder – schlimmer noch! – von Isabella herrühren musste.
Ihren Vater hatte sie nie bewusst wahrgenommen, an ihre Mutter hatte sie eine mehr und mehr verblassende Erinnerung: eine schöne junge Frau, eine Fee, die ihr das weißblonde Haar vererbt hatte, von stiller Freundlichkeit, wie nicht von dieser Welt, und so war sie auch lächelnd, festlich gekleidet in das große Feuer gegangen, aus dem sie nicht wieder hervorgekommen war.
Yezas Erinnerung an den Scheiterhaufen von Montségur[35] war von Lichtgestalten verklärt, die Rauchschwaden waren zu Wölkchen geworden, hinter denen das Gesicht der Mutter verschwamm.
Nichts dergleichen empfand Roç, ihr kaum jüngerer Spielgefährte und Ritter. Er schrie oft nachts im Schlaf, stammelte von Flammen, die nach ihm griffen, wenn seine Mutter ihm aus der prasselnden Glut noch einmal zuwinkte. Sollte er sie beschreiben, glich sie der Fee Yezas aufs Haar, doch ihn streichelte sie, wenn er nicht schlafen konnte, und flüsterte ihm ein Lied, dessen Melodie er des Morgens nicht mehr zusammenbekam.
Bruder William, der gut singen konnte und alle Lieder kannte, sang ihm jede Weise vor, von holder Minne bis zu denen vom herzallerliebsten Jesulein, von schlüpfrigen Zoten, die Roç nicht verstand, die aber die Moriskos zum Lachen brachten, bis zum Ave Maria, bei dem William immer die Tränen kamen.
Nein, das Lied war nicht dabei, doch weinen mochte Roç auch nicht.
Roçs Gesicht war noch kindlich und verträumt. Krauses dunkles Haar umrahmte es, und seine Augen waren kastanienfarben. Ganz im Gegensatz zu Yeza, deren Iris grüngrau schimmerte und der eine gerade Nase einen zart-herben Zug gab, eine Strenge, die durch ihre Lockenpracht jedoch gemildert wurde. Gern hätte er auch solch eine Mähne gehabt, dafür bräunte seine Haut viel stärker in der Sonne als die ihre.
Roç ergriff seinen Bogen und bewog Yeza, ihr Stück Riemen herzugeben. Sie stellten es an der hohen Heckreling auf, damit kein Pfeil oder gar der Dolch ins Wasser fliegen konnte, und begannen einträchtig, das Ziel zu beschießen.
In der Agäis, den 27. August A.D. 1248
Draußen jubelten die Kinder bei jedem Treffer. Ich wartete in der fürstlich ausgestatteten Capanna: ein eichener Kartentisch mit nautischen Instrumenten in der Mitte des Raums, ein hoher lederbezogener Sessel und wenige niedrige Sitzgelegenheiten, Teppiche, Waffen an den Wänden.
Kein Mensch wäre auf die Idee gekommen, dass hier eine Frau das Regiment führte, alles war von betonter Männlichkeit geprägt.
Aus den Nebengemächern hörte ich die kichernden Stimmen Clarions und ihrer Zofen, ein törichtes Geplapper.
Ich hatte mir schon vorgenommen, Tagebuch zu führen, als ich hörte, dass ein neuer Kreuzzug anstand, und hatte damit auch gleich begonnen, als mich der König von Frankreich rief, für ihn vorher noch in geheimer und wichtiger Mission ins alte Byzanz zu reisen – eben wegen dieser Kinder.
Vor allem aber wollte ich diese Chronik schreiben, weil sich die Gelegenheit, mit einem so bedeutenden Herrn wie dem König Ludwig gemeinsam auf bewaffnete Pilgerfahrt zu gehen, nicht ein zweites Mal im Leben bieten würde, spürte ich doch längst, ungeachtet meiner jungen Jahre, in mir das Talent zu einem seine Zeit überdauernden Chronisten schlummern.
Spätestens seit meinem Missgeschick in Palermo fühlte ich mich zu dieser Aufgabe berufen, ja, ich sah es jetzt als Fingerzeig des Himmels. Nicht Ruhm als Kriegsmann noch als Weiberheld sollte mir beschieden sein, sondern einzig der eines escollier philosophe[36]. Was heißt hier einzig? Einzigartig! Und von allen Zeitgenossen abgehoben.
In der Folge sollte ich schnell gewahren, dass ein so vom Schicksal Herausgehobener zwar viel erfahren kann, Sieg und Niederlage, Vorteil und Verzicht, nicht zu vergessen abwägenden Kompromiss, doch längst nicht alles in geschriebene Worte kleiden darf. Es sei denn, der ehrgeizige scribend[37] trägt beizeiten Sorge, dass ihm nicht jeder Neugierige über die Schulter schaut, auf der auch der Kopf sitzt. Kaiser Friedrich hatte meinen gefälligen Stil gelobt, bevor er mir meinen Bericht über die Kinder des Gral wegnahm.
Wiederum treffliche Fügung Fortunas! Sonst wäre er jetzt der Gräfin in die Hände gefallen, und ich schwämme mit dem Gesicht nach unten in der Ägäis, den Fischen ein Leckerbissen.
So war ich lebend den Kindern näher als je zuvor und würde meinem König viel beredteres Zeugnis ablegen können, falls es mir beschieden sein sollte, ihm doch noch unter die Augen zu treten. Herr Ludwig war mein leuchtendes Vorbild, Freudig hatte ich mich entschlossen, Joinville, meine kleine Burg, Weib und zwei Kinder hinter mir zu lassen, um mich an seiner Seite ins Heilige Land zu begeben. Der König hatte auf den Tod krank gelegen, Ärzte und Priester, selbst seine Mutter, die Königin Blanche[38], hatten ihn schon aufgegeben und wollten bereits das Sterbelinnen über ihn breiten, als er nach dem Kruzifix verlangte, es umfasste und plötzlich mit lauter Stimme schwor, einen Kreuzzug zu unternehmen. Da grämte sich die Königinmutter so sehr, dass sie trauerte, als ob er gestorben wäre. Doch der König war von seiner Krankheit genesen.
Sein frommes Vorbild veranlasste auch sogleich seine Brüder, ihm zu folgen –Alphonse[39] de Poitiers, Graf von Poitou, Charles[40], Graf von Anjou, und Robert[41], Graf von Artois. Da mochten denn auch der Herzog von Burgund[42] und der Graf von Flandern[43] nicht zurückstehen.
Diese Runde erlauchter Ritter mag auch ein Grund gewesen sein, dass ich meinem Herzen einen Stoß gab, zumal meine beiden Vettern, Johannes[44], der Graf von Sarrebruck, samt seinem Bruder Gobert d'Aprémont[45] sich zu ihnen gesellten. Und weil wir Verwandte waren, schlug ich vor, zusammen ein Schiff zu heuern und ein jeder neun Ritter aufzubieten.
Ich verpfändete also all den Besitz, von dem ich, ohne die Ansprüche meiner Kinder zu schmälern, nicht vererbbares Nießrecht besaß, und wir verfrachteten unser Reisegepäck und uns Rhône-abwärts nach Marseille.
König Ludwig verlangte indes, wir sollten zuvor nach Paris kommen, um ihm den Treueid zu schwören.
Ich ritt spornstreichs nach Saint-Denis und sagte dem König, dass ich als Graf von Joinville es ablehnen müsse, ihm zu schwören, denn nicht er sei mein Lehnsherr, sondern der Kaiser des Deutschen Reiches.[46] Ich könne nur als Seneschall der Champagne feierlich versprechen, auf dem bevorstehenden Kreuzzug mein Leben für das seine zu opfern, wenn es mir von Gott erlaubt würde.
Verständig und aufrechten Charakters, mit einem ausgeprägten Gefühl für das Recht, sah der König das Besondere meines Falles sofort ein und ließ alle sehen, dass er meine Teilnahme dennoch freudig begrüßte.
Die Erinnerung daran gab mir Mut, und dessen bedurfte ich auch, denn jetzt betrat die Gräfin endlich ihre Capanna. Sie war begleitet von diesem William von Roebruk, der mir aufmunternd zugrinste, während Frau Laurence sich recht kurz angebunden gab.
»Was, mein werter Cousin«, ging sie mich an, »habt Ihr Euch als Geschichte zurechtgelegt, um Euer evidentes Nachstellen zu rechtfertigen?«
Sie nahm im Sessel hinter ihrem Tisch Platz, der Mönch trat beflissen an ihre Seite, während sie mich stehen ließen. Also setzte ich mich unaufgefordert und zwang sie, ihre grauen Augen auf mich zu richten.
»Ich habe, liebe Cousine«, sagte ich im freundlichsten Plauderton, »am Hofe Eures Kaisers zu Palermo[47] von einem der jüdischen Ärzte einen Scherz gehört, den ich Euch nicht vorenthalten will.«
»Spart ihn Euch!«
Der Mönch lachte schallend, bis er sich von der hohen Dame einen Blick einfing, der ihn zum Schweigen brachte.
»Ihr habt uns nun wissen lassen, dass Ihr bei Hofe auf Sizilien verkehrtet« – wandte sie sich kühl an mich –, »doch das reicht nicht aus.«
»Auch nicht, liebe Base, wenn ich Euch sage, dass ich mütterlicherseits Herrn Friedrich engstens verwandt –«
»Das lässt Euch noch suspekter erscheinen!« zischte sie mich an. »Der Staufer ist kein erklärter Freund der Kinder!«
»In der Tat«, sagte ich, »scheint ihm nichts mehr zuwider als die Unterstellung, seinen Samen mit ketzerischem Blut vermischt haben zu können.«[48] Damit warf ich ihr einen dicken Knochen hin, an dem sie zu beißen hatte.
In Wahrheit hatte sich der Kaiser mir gegenüber, den er für einen Mann Ludwigs hielt oder gar schlimmer noch für einen verkappten Anjovinen[49], kein Wort fallen lassen über die »Königlichen Kinder«, doch dass er sie nicht lieben konnte, lag auf der Hand. Bei seiner Auseinandersetzung mit der ecclesia catolica[50], einem zähen Ringen samt heimtückischen Schlägen und Tritten bar jeder Skrupel – auf beiden Seiten! –, kam ihm nichts so unpassend wie eine offengelegte Blutsbande zu den häretischen Katharern.[51]
Die Gräfin nagte an dem Knochen.
»Es liegt also nahe, dass Herr Friedrich – wie schon oft im schönsten Einvernehmen mit dem Hause Capet – Euch ermuntert hat, die seit Konstantinopel verlorene Fährte der Kinder wiederaufzunehmen?« Sie fletschte lauernd die Zähne.
Hier half nur eine Demutsgebärde. »Ihr werdet es nicht für möglich halten, ma chère cousine, aber es verhält sich anders: Ahnungslos stattete ich dem Kaiser auf meiner Rückreise Besuch ab. Die bereitwillige Gastfreundschaft erwies sich als Falle. Er ließ mich nicht wieder gehen. Ich sandte insgeheim meinen Reisebegleiter, an den sich Herr William erinnern mag, den Franziskaner Lorenz von Orta[52], nach Frankreich, denn ich fürchtete, den Kreuzzug zu versäumen, den ich schon seit Langem gelobt. Lorenz sollte meinen Vetter Johannes, den Grafen von Sarrebruck, auffordern, über mein Geld zu verfügen, sodass er an meiner Stelle alle notwendigen Vorbereitungen treffen konnte.«
»Wie Ihr Euch erinnern mögt, werter Graf«, unterbrach mich William von Roebruk verschmitzt, »kann ich mich an gar nichts erinnern, denn ich hatte den Kreis der Lebenden verlassen, doch sagt mir der Name –«
»Den Kerl gab es«, knurrte die Gräfin, »er gab sich so schamlos, wie Ihr, William, Euch jetzt unverschämt hinter Eurem Gedächtnisverlust verkriecht und mir in den Rücken fallt!«
»Jedenfalls«, nahm ich den Faden wieder auf, »erschien dann in Palermo bei mir Oliver von Termes[53]. «
»Ah«, entfuhr es William, »der Renegat[54]! Und mit ihm spieltet Ihr wieder das Spiel der ›Blinden Kuh‹? Mit angeblich verbundenen Augen in der Gegend herumtappen und nach den Kindern tasten. Schon damals kamt Ihr den gerade vom Montségur Geretteten so nahe, dass Ihr fast auf sie getreten wärt!«
»Das ist ein unerhörter Verdacht!« verteidigte ich mich nun dummerweise vehement. »Es war Zufall!«
»In dieser Angelegenheit gibt es keine Zufälle!« beschied mich die Gräfin.
Ich ging darauf nicht ein. »Oliver von Termes trat mir seinen Platz an Bord des byzantinischen Seglers ab, mit dem er König Ludwig auf Zypern erreichen wollte, weil gerade der Graf von Salisbury[55] mit seiner englischen Flotte in den Hafen einlief und Oliver sicher war, sich diesem für den Kreuzzug anschließen zu können. Von mir hatte der Kaiser wohl nur einen Fluchtversuch in Richtung Frankreich erwartet. Ich wurde also an Bord des Seglers geschmuggelt, der mich nach Achaia bringen sollte, wo ich meinen Vetter Johannes und das gemeinsam bezahlte Schiff zu treffen verabredet hatte. Ohne Anstände verließen wir Palermo – der Rest der traurigen Geschichte ist Euch geläufig.«
Wehmut überkam mich, wenn ich des vom Munde abgesparten Schiffleins gedachte. Wie hatt' ich mir sein Herrichten und Beladen, das wohlgemute an Bord gehen mit meinen Ritterbannern immer wieder vorgerechnet und schließlich das Setzen der stolzen Segel ausgemalt, unter denen wir gemeinsam von Marseille aus in See stechen wollten.
»Zu glatt!«, spottete Laurence herzlos. »Wenn ich es zusammenzähle, kommt Ihr, lieber Jean, raffinierterweise auf mehr zufällige Begegnungen mit den Kindern als unser Tölpel William. Er hat sie nicht gesucht, wohl aber Ihr, Herr Seneschall!«
Sie hielt inne, denn von Roç und Yeza draußen vor der Capanna war nichts mehr zu hören, was ihr wohl verdächtig erschien. Ich warf einen Blick hinaus.
Die beiden waren so geübt in der Handhabung ihrer Waffen, dass sie nicht das Holz, sondern die von Yeza geschnittenen Kerben anvisierten, um die Wette und in verbissenem Schweigen.
Die Gräfin rief erleichtert eine ihrer Zofen und schickte sie hinaus mit einer güldenen Schale aus der Griechenbeute als Preis für den Sieger.
Die Kinder waren ihr doch sehr ans Herz gewachsen. Mit Klauen und Zähnen würde sie für sie kämpfen, eigenhändig jeden umbringen, der ihnen ein Haar krümmen sollte. Sie warf noch einen Blick hinaus und musste lächeln, denn natürlich diente jetzt die Schale selbst als Ziel, und jeder Treffer, wenn das kostbare Gefäß von der Stange fiel, wurde laut bejuchzt.
Welch freimütiger Umgang mit einem mythosbeladenen Gegenstand, dachte ich mir, wenn der Gral denn ein Gefäß war und nicht eine schwer fassbare Idee!
»Ihr könnt Euch vorerst frei an Bord bewegen«, riss mich Laurence aus meinem Sinnieren. »So nah werdet Ihr den Objekten Eurer Begierde nicht wieder kommen!«
Damit wurde ich aus der Capanna gewiesen.
Ein bärtiger Todesengel
Ein grosses brandrotes Kreuz auf der ganzen Segelfläche wies das Schifflein schon von Weitem als einen Kreuzfahrer aus.
Graf Johannes von Sarrebruck nebst seinem Bruder Gobert d'Aprémont waren mit ihren Mannen und denen ihres verschollen-verhindert-säumigen Vetters Jean de Joinville nicht etwa die kürzeste Route gesegelt, die Nordküste Siziliens entlang, sondern waren weit südlich von Lampedusa an der Insel vorbeigekreuzt, alles nur, um dem Staufer auszuweichen, der die Macht besaß, Lehnsleute des Reiches von der Weiterreise abzuhalten, und dafür bekannt war, nicht zimperlich im Umgang mit derselben zu sein. Zum einen betrachtete er das Königreich von Jerusalem als Stauferische Domäne, war doch sein Sohn Konrad von diesem der König, und auf eine auch nur zeitweise Inbesitznahme durch die Franzosen legte der Staufer keinen Wert. Zum anderen brauchte er jede bewaffnete Hand, um sich der päpstlichen Aggression in allen Teilen des Reiches zu erwehren.
Auf ihrem Drift nach Süden war die kleine Ritterschar aus dem lothringischen Grenzgebiet vom Regen in die Traufe geraten. Ungünstige Winde trieben sie an die felsige Küste Afrikas, ein Land, dessen Bewohner Christen auf bewaffneter Pilgerfahrt nicht wohlgesonnen waren.
Zwischen einem Steinriff und dem nächsten verfluchte Graf Johannes das segelmännische Geschick des Kapitäns, Gobert wurde schwer seekrank, und Simon de Saint-Quentin[56], der Dominikaner, wäre fast über Bord gegangen.
Dean of Manrupt[57], der Priester und Beichtvater des abwesenden Jean de Joinville, empfahl, eine Bittprozession abzuhalten. Alle beteiligten sich williglich, und sie sangen das Ave maris stella[58] und beteten mit Inbrunst. In Ermangelung einer anderen via crucis[59] umkreisten die Ritter die beiden Masten des Schiffes.
»Sumens illud ave[60]
Gabrielis ore,
Funda nos in pace
Mutans Evae nomen.«
Dean schlug vor, eine Achterfigur zu gehen. Das sei eine magische Zahl und brächte sicher Glück. Ein Adept[61] des geheimen Tarots[62] hätte ihm dies in Marseille gegen Überlassung einer geweihten Hostie verraten.
»Ave maris stella
Vitam praesta puram[63],
Iter para tutum,
Ut videntes lesum
Semper collaetemur.«
Wohl eher mithilfe Mariens löste sich der Bann, der das Schiff zwischen den Felsen festhielt, darauf bestand dann der Dominikaner, als alles vorbei war. Ein frischer Gegenwind kam auf, und nach bangen Stunden erreichten sie schließlich des Nachts wieder das offene Meer. Am Morgen konnte Graf Johannes dem immer noch elend darniederliegenden Gobert mitteilen, sie hätten Skylla und Charybdis nun hinter sich. Da fielen sich die Brüder um den Hals.
Auf Anweisung des Grafen Johannes, der nach Umfahrung der stauferischen Klippen das Kommando an sich gezogen hatte, hielt das Schiff jetzt auf Achaia zu, wo die Brüder ihren Vetter, den Seneschall und Grafen Jean de Joinville, zu treffen gedachten.
Sie segelten an Otranto vorbei, was Simon veranlasste, drei Kreuze angesichts der Burg zu schlagen und den Gefährten von der schrecklichen Gräfin zu berichten, einer Zauberin, schlimmer als die Circe[64], mit dem Teufel im Bunde – und mit den Kindern des Gral, dieser stauferischen Ketzerbrut!
In Konstantinopel sei die Kirche voriges Jahr drauf und dran gewesen, dieses Gespinst, diesen »Großen Plan[65]« zu zerschlagen, doch mit schwarzer Magie hätte die Gräfin von Otranto die Königlichen Kinder auf ihrer Triëre wieder entführt.
Seitdem treibe die Teufelin ihr Unwesen im Mittelmeer und besonders in der Ägäis, denn heim nach Otranto traue sie sich nimmer, die es als Piratin so schlimm angehen ließe, dass es selbst dem unheiligen Herrn Friedrich übel aufgestoßen sei.
»Deswegen bin ich grad froh«, rief der Dominikaner, »dass wir gen Achaia halten, denn mit dieser Nussschale möcht ich der Triëre von Otranto nicht begegnen!«
»Wer wird denn ein Schifflein wie unseres, mit dem Zeichen des Kreuzes auf dem Segel«, entgegnete ihm Dean of Manrupt, der der Älteste an Bord war, »in der Hoffnung aufbringen, dass der materielle Gewinn größer ist als der Verlust des Seelenheils?«
»Ihr kennt die Teufelin nicht!«
Grad kam eine Insel in Sicht, von der Rauch aufstieg.
»Doch nicht etwa Piraten?« entfuhr es Graf Johannes.
»Mit Sicherheit!«, antwortete der Kapitän. »Es brennt ein ganzes Dorf.«
»Dann lasst uns weitersegeln«, warb Johannes um Vorsicht.
»Wir brauchen Trinkwasser!«, sagte der Kapitän. »Diese Insel ist weit und breit die einzige, die davon reichlich besitzt –«
»Da mein Bruder Gobert immer noch in bedauernswertem Zustand darniederliegt –«, hob der Sarrebruck an, aber Dean of Manrupt hatte schon begriffen.
»– ist es nur recht und billig, dass Ihr ihn an Bord pflegt. Ich gehe gern an Land, um das Wasser zu besorgen.«
»Gern nicht, aber ich werde Euch begleiten«, sagte Simon.
Der Kapitän gab ihnen vier Mann als Träger mit und wies ihnen den Weg zum Brunnenhaus in den Hügeln.
Den Besuchern stieß auf, dass sie keine Menschenseele längs des Weges antrafen, keine lebende, keine dem Leib entwichene, nicht einen Kadaver, obwohl der Überfall frisch von der Hand sein musste, denn noch bleckten überall die Flammen, fanden reichlich Nahrung, glühten also nicht seit Stunden.
»Sie werden in der Kirche sein«, tröstete sich Dean über das Schicksal der Einwohner.
»Oder sie flüchteten ins Gebirge«, meinte Simon beruhigend.
Mittlerweile waren sie beim überdachten Brunnenhaus angekommen, und sie sahen schon von Weitem die kleinen Mädchen, die ihre Gesichter um die einzige Fensteröffnung drängten, um hineinzusehen, dann aber schweigend wegliefen, als sie die Wasserholer kommen sahen.
Warum sie nicht zur Tür hineinschauen konnten, wurde klar, als der kleine Zug um die Ecke bog.
Der Priester war kreuzweise über den Eingang genagelt. Die Männer um Simon und Dean waren dabei, den Leichnam abzulösen, als die Tür nachgab. Ihr Blick fiel in den Innenraum.
Über einer durchgehenden Stange hingen geknickt die Leiber von drei Knaben, ihr Hinterteil den Betrachtern zugewandt, die mageren Oberkörper mit dem Gesicht und den herabbaumelnden Armen auf der anderen Seite. Sie waren alle drei tot, doch es waren ihre klaffenden After, die so unnatürlich nach Leben glänzten.
»Man hat sie mit Olivenöl begossen«, stellte Simon sachkundig fest, »bevor oder nachdem sie erwürgt wurden.«
»Nachdem, will ich hoffen.« Dean of Manrupt schlug für jeden ein Kreuzzeichen und wandte sich ab.
»Ihr könnt hier Wasser schöpfen«, sagte er leise, »ich will lieber verdursten.« Er ging zurück, hinab zur Küste.
Simon gab den Trägern Anweisung, ihren Auftrag auszuführen und dann nachzukommen, bevor er sich aufmachte, den Alten einzuholen.
»Nur eine Bestie kann so gehaust haben«, murmelte Dean erschüttert.
»Ach, interessant«, dozierte gelehrt der Dominikaner. »Ihr denkt an ein Tier? An einen sodomitischen Vergeltungsakt der seit Jahrtausenden auf diesen Inseln missbrauchten Kreatur, brutae vi stupratae[66]? Die Rache des Esels, die vendetta[67] des Bocks?«
Der alte Priester starrte seinen collega verständnislos an. Er wollte dessen perfide Geisteshaltung, die ihm noch schlimmer ankam, als das Verbrechen selbst, kein Gehör schenken.
»Furchtbar«, stöhnte er, »zu was Christenmenschen nicht alles fähig –«
»Griechen«, unterbrach Simon und war erstaunt, dass der alte Dean, ein Mann von kräftiger Statur, stehen blieb und ihn langsam mit einer Hand vor der Brust an der Kutte packte und hochhob.
»Cane Domini![68]«, sagte er leise. »Warum erfahre ich von dir nichts über die Reinheit des Olivenöls – kalt gepresst?«
Er drehte mit seiner Pranke den Stoff der Kutte, dass es eng wurde für den Dominikaner.
»Erst wenn du mir das sagen kannst – und beweisen! –, dann sprich mich wieder an!«
Er ließ den Gegriffenen fahren und schritt von dannen.
Als die Wasserholer nacheinander die Küste erreichten, sahen sie ihr Schiff von drei größeren umringt, doch offensichtlich in freundschaftlicher Absicht, denn kein Waffenlärm drang ans Ufer, und kurz darauf holte ein Ruderboot den kleinen Trupp ab.
Graf Johannes stellte ihnen einen schwarzbärtigen Riesen mit dem Namen Angel von Káros[69] vor, der sogleich über das »heidnische Korsarenpack« herzog.
»Frauen und Kinder sind nicht vor ihnen sicher!« polterte er. »Grad sind diese Elenden mir wieder entwischt, als ich zum Frischwasserschöpfen vorbeikam.«
Angesichts seiner drei Schiffe mit zusammen wohl hundert Mann verkniff sich Dean of Manrupt die Frage, die ihm auf der Seele brannte, wie sich denn »das Korsarenpack« so schnell hatte in Luft auflösen können.
Das war auch gut so, denn Herr Angel war ein mächtiger Mann, der zu spaßen beliebte, aber keinen Spaß verstand. Bei jeder Anspielung, die er auf sich beziehen konnte, und das tat er mit allen, zuckte seine Pranke zur mächtigen Streitkeule, die ihm von der Hüfte baumelte. Ein kettenumwickelter Schaft mit einer stacheligen Eisenkugel an der Spitze, eine furchtbare Waffe.
Dass Graf Johannes und seine Gefährten über Pferde verfügten, das gefiel dem Angel ganz außerordentlich.
»Wie habt Ihr denn die Tiere da hineingebracht?«, scherzte er und wies auf die kleinen Futterluken.
Dean verspürte kein Verlangen, es ihm zu erklären, Graf Johannes wusste es nicht, und so sprang Simon ein, der gar nicht dabei gewesen war: »Wir haben die Seitenwand groß wie ein Tor aufgeklappt. Als alle Pferde gut im Schiffsbauch untergebracht waren, wurde das Ladetor wieder hochgeschlagen, sorgfältig vernutet und kalfatert[70], denn während der Überfahrt liegt dieser Kielraum unterhalb des Wasserspiegels.«
Das beeindruckte den Angel von Karos noch mehr, und er setzte alles daran, dem Grafen Johannes den Kreuzzug auszureden. Da biss er bei Dean of Manrupt auf Granit, und auch der bettlägrige Gobert d'Aprémont wurde obstinat. Selbst Simon de Saint-Quentin ließ den »Despotikos«[71], wie Herr Angel von seinen Leuten tituliert wurde, wissen, dass es keinen Sinn mache, auf einer Änderung des Zieles zu bestehen, solange die Kommandogewalt über das gemietete Schiff nicht geklärt sei.
Seit Tagen war nämlich Streit zwischen Johannes und Gobert ausgebrochen, wem das Stimmrecht des abwesenden Partners zustünde: dem Grafen von Sarrebruck als dem anderen Anteilsinhaber oder dem Grafen von Aprémont als Erstem Vasall des Joinville.
Um Ärger mit dem Kranken zu vermeiden, beschloss Johannes scheinbar nachzugeben und wies den Kapitän unter der Hand an, Kurs gen Süden zu nehmen, wie ihm Herr Angel, mit dem sie im Verband segelten, empfohlen hatte – »schon weil die Überfallene Insel, vor der ich das Vergnügen hatte, Euch, werter Graf kennenzulernen, dem Wilhelm von Villehardouin[72] gehört! Wenn's auch Piraten waren, die dort so übel gehaust«, er strich sich genüsslich den verwilderten schwarzen Vollbart, »kann der Fürst von Achaia sehr kurzsichtig, aber durchaus rachsüchtig reagieren!«
Das leuchtete dem Johannes ein, nicht aber dem alten Dean, der von der Kursänderung sofort Wind bekommen hatte. Der Graf von Sarrebruck sagte dem treuen Priester des Joinville nicht etwa ins Gesicht, dass der Herr Jean doch sehen solle, wie er zum Kreuzzug stieße, sondern log ihm vor, dass er von Herrn Angel insgeheim den wahren Treffpunkt mit dem Seneschall erfahren hätte.
Diarium des Jean de Joinville
In der Ägäis, den 30. August A.D. 1248
Überraschend für mich hatte Frau Laurence mich holen und in ihre Capanna bitten lassen, wo sie mich diesmal ohne Zeugen erwartete. Sie schien mir wie ausgewechselt, als habe sie sich entschlossen, einer Maskerade zu entsagen, und dahinter kam das müde Gesicht einer alternden Frau zum Vorschein. Sie machte auch keinen Hehl aus ihren Sorgen.
»Ich gleiche einem Odysseus, der ruhelos über die Meere geistert und keinem Hafen trauen darf. Die Kinder, lieber Cousin, sind ein kostbarer Schatz, aber auch eine schwere Bürde –«
»Und warum kehrt Ihr nicht heim nach Otranto, macht Euren Frieden mit Friedrich?«
Laurence lachte bitter. »Weil ich längst Gespenster sehe! Ja, lacht nur über mich törichte Frau, mal träume ich, das grausame Strafgericht des Staufers erwarte mich auf meiner Burg, mal sehe ich des Nachts völlig fremde Gestalten mit Mordfackeln, auf den Mauern Bluthunde nach den Kindern hecheln – dabei hat der Kaiser mich nie offiziell abgemahnt noch mir je das Lehen entzogen.«
Sie sah mir fest ins Auge, wohl um zu prüfen, ob ich sie noch für bei Verstande hielte. »Je länger ich von dort fort bin, um so größer der Irrsinn, der von meinem Kopf Besitz ergreift. Wahrscheinlich habt Ihr völlig recht, und jeder fragt sich, was treibt die Alte friedlos aufs Meer, was hetzt sie sich, ihre Triëre, statt sich zur Ruhe zu setzen –«
»Ich will gern bei Herrn Friedrich ein Wort für Euch einlegen –«
»Keine schlafenden Leute wecken!« fuhr sie hoch. »Vielleicht wartet er doch nur darauf, die Kinder in die Finger zu bekommen!«
Sie lächelte mich an, eine gute Portion Irrsinn war schon mit dabei. »Ich will gar nicht versuchen, Euch, lieber Jean, auf meine Seite zu ziehen, noch meine Sorgen zu den Euren zu machen, doch heische ich um Verständnis von jemandem, der es wie Ihr mit dreiundzwanzig Lenzen schon zum Seneschall einer der reichsten Provinzen Frankreichs gebracht hat, der trotz seiner blühenden Jugend sich einen Namen als doctissimus[73] gemacht hat …«
Ich dachte bei der »blühenden Jugend« an mein verwelktes Gekröse und bei der laudatio[74] meiner schriftstellerischen Fähigkeiten an den Bericht für König Ludwig aus Konstantinopel, den die Welt auch nicht zu sehen bekommen würde, soweit war auf den Staufer Verlass!
Ich sagte: »Liebe Base, mein mitfühlendes Verständnis habt Ihr, doch wenn ich Euch meinen Rat antragen darf, dann solltet Ihr mir mehr über die Kinder –«
Die Gräfin schaute mich traurig an. »Wozu?«, meinte sie. »Ihr müsst es ja doch mit ins Grab nehmen. Lasst mich jetzt allein, und genießt Eure letzten Stunden!«
»Das Gericht!« fuhr es mir durch den Sinn. Bei meiner Abreise, damals von Marseille, hatte mir ein alter Pythagoräer[75] geweissagt, dass ich von meiner Reise so schnell nicht zurückkehren und auch nicht derselbe sein würde: andros medemia andreion[76]. Ich hatte das Orakel verlacht, das er aus den jüngst dort in Mode gekommenen »Großen Arkana«, einem Satz bebilderter Pergamenttäfelchen, herausgelesen hatte.
Als ich dann im Hospital zu Salerno von den Ärzten mit dem endgültigen Verlust meiner Manneskraft konfrontiert wurde, hatte ich für unverschämt teures Geld einem Rabbi, der neben mir dort im Sterben lag, einen solchen »tarot« abgekauft. Ich war erst empört über seine hohe Forderung, aber er vertraute mir röchelnd an, dass es nicht wichtig sei, ob er das Gold mit sich nehmen könne, sondern dass Divinatorik[77] mit barer Münze bezahlt sein wolle, sonst könne sie keine Wirkung entfalten. Er nähme das Geld also um meinetwillen. Er sei auch bereit, die Karten noch zu »besprechen«, denn sonst sei mein Geld umsonst ausgegeben. Dafür müsse ich aber nochmals in den Beutel greifen. Ich tat's. Er murmelte mir Unverständliches über dem Kartenbund und jedem einzelnen Blatt.
Als er bei dem letzten angekommen war, versagte ihm die Stimme, und er war tot.
Seitdem führe ich die Kärtchen stets bei mir und befrage sie, indem ich blind in die Tasche greife. Nicht immer ziehe ich das Bild, das mir gerade vorschwebt, und oft fürchte ich mich auch vor dem verstohlenen Griff, und doch vermag ich ihm nicht zu widerstehen.
Die kleine Flotte, bestehend aus dem Kreuzfahrerschiff des Johannes von Sarrebruck, des todkranken Gobert d´Aprémont und des immer noch abwesenden Grafen von Joinville sowie den drei Seglern des Angel von Karos, die das kleine Schiff mehr in die Zange genommen hatten, als dass sie es beschützten, wie ihr ungebärdiger Kriegsherr gern behauptete, segelte gen Süden.
In Trinkgelage und Freundschaftsbeteuerungen gekleidet, nahm sein Druck auf den Grafen von Sarrebruck ständig zu.
Johannes solle doch den Kreuzzug fahren lassen und sich ihm bei der Eroberung des Peleponnes anschließen. Ein Herzogtum sei ihm gewiss – sobald er seinen Onkel Guido[78], der ihn um sein Erbe von Argos und Nauplia gebracht habe, vom Großherrenthron Athens vertrieben habe. Fürst von Theben könne Johannes werden, wenn er sich auf die Seite von Naxos schlagen würde.
Als dieser wiederholt auf den Widerstand seines kranken Bruders hinwies, war Gobert d'Aprémont eines Morgens verschwunden. Er musste in der Nacht sein Lager verlassen haben und über Bord gestürzt sein.
Eine Erklärung, die alle akzeptierten, nur der standhafte Dean of Manrupt nicht. Für ihn war es eine Erlösung, als sie, die nördliche Küste Kretas kreuzend, bei Heraklion mitten in das englische Geschwader gerieten, das erst nach ihnen Marseille verlassen hatte.
Es wurde angeführt von William of Salisbury, der ein Enkel des Plantagenet[79] und der schönen Rosamunde[80] war.
Die Engländer waren über Sizilien gereist, wo der Kaiser sie herzlich willkommen geheißen und mit allerlei Proviant und kostbaren Geschenken versehen hatte.
Bei ihnen befand sich auch Herr Oliver von Termes, der dem Grafen von Sarrebruck die erfreuliche Mitteilung machen konnte, dass sein Vetter, der Graf von Joinville, Palermo an Bord eines byzantinischen Kauffahrteiseglers verlassen habe.
Froh war darob nur Dean of Manrupt.
Angel von Karos hatte gleich versucht, sich wieder abzusetzen, er fürchtete auch wohl eine Denunzierung durch den alten Priester, aber es war William of Salisbury, selbst ein wilder Streiter und Säufer, der den Despotikos sogleich ins Herz und in seine Arme schloss und nicht wieder gehen ließ, als sei es eine ausgemachte Sache, dass Angel mit ihnen auf Kreuzfahrt ginge.
Gerade als alle Schiffe in Heraklion ihre Vorräte aufgebessert und vor allem frisches Wasser und reichlich Zitrusfrüchte an Bord genommen hatten – denn nach Kreta passiert ein Pilgerfahrer für etliche Tagesreisen kein festes Eiland mehr, um sich zu erfrischen oder gar sein Leben zu erhalten –, traf auch einer der Brüder des französischen Königs ein.
Robert d 'Artois hatte versucht, seine Freunde im Lateinischen Kaiserreich für den Kreuzzug zu gewinnen, aber Guido, Großherr von Athen, aus der burgundischen Abenteurersippe de la Roche, und der Herzog von Naxos[81], der sich »Herr des Archipelagos« nannte, lagen in Fehde, beschuldigten sich gegenseitig der Piraterie und waren keineswegs gewillt, das Kreuz zu nehmen und Seite an Seite in den Krieg gegen die Ungläubigen zu ziehen, versprachen aber nachzukommen, wenn sie – jeder fühlte sich im Recht – den anderen Frevler gezüchtigt oder, besser noch, gänzlich vernichtet hätten.
Robert fand keine Zeit, zwischen den Streithähnen zu schlichten, was er gern getan hätte, selbst mit dem Schwert in der Hand, denn er ließ ungern irgendeine Gelegenheit zur Fehde aus. So aber zwang er jeden der beiden, ihm drei Schiffe und eine Handvoll prächtiger Ritter zu überlassen, die er statt ihrer in seine Flotte einzureihen versprach.
Als ihm Angel von Karos vorgestellt wurde, umarmte er den Verblüfften aufs Herzlichste, dankte ihm für sein promptes Erscheinen und wies seinen drei mitgebrachten Schiffen ihren Platz in der Flotte an und ihm selbst einen Platz an der Tafel zu seiner Seite.
Dem Grafen von Artois als Bruder des Königs wäre unstreitbar der Oberbefehl über alle zugefallen, aber er überließ ihn großmütig dem Grafen von Salisbury, schon um nicht von dieser Verantwortung, die nur öde Disziplin versprach, in die Pflicht genommen zu werden.
Er übernahm die Vorhut und fragte den Grafen von Sarrebruck, ob er voraussegeln wolle. Das nahm dieser hochgeehrt an, und das kleine Schiff mit dem großen Kreuz auf dem Segel stach als erstes in See, die jetzt bis Zypern keine sonderlichen Aventüren versprach – nur sich endlos dehnendes Meer.
Aufgebracht
Diarium des Jean de Joinville
5. September A.D. 1248
Ich fühle mich wie ein zum Tode Verurteilter, den seine Henker schreiben lassen bis zum letzten Atemzug. Wenn schon nicht meine Taten, so sollen doch wenigstens meine zu Papier gebrachten Gedanken Zeugnis ablegen, wenn ich nicht mehr bin. Niemand hindert mich.
Ich war wie betäubt aus der Capanna der Gräfin gestolpert. Hatte ich den Fehler begangen, zu viel Interesse an Roç und Yeza zu zeigen, und hatte sie dies in den falschen Hals bekommen?
Meinen jedenfalls hatte ich noch keineswegs gerettet.