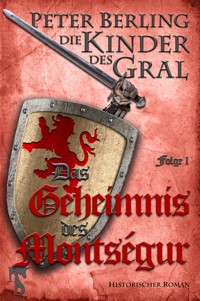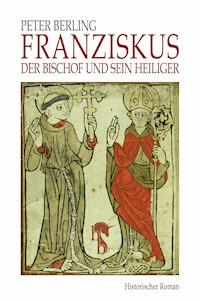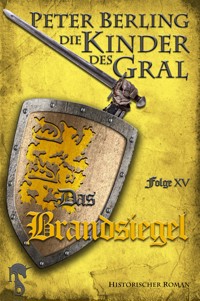3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Kinder des Gral
- Sprache: Deutsch
Roç und Yeza gehen weiterhin getrennte Wege. Während sich Yeza vom Papst überreden lässt, nach Bologna zu gehen, kämpft Roç mit Yezas ehemaligen Geliebten, einem Freibeuter, gegen die Flotte der Templer. Als sie die Nachricht erreicht, dass Yeza in Bologna in eine Falle geraten ist, gelingt es ihrem Freibeuter, sie zu retten. Roç hingegen gerät in Griechenland in die Fänge eines despotischen Herrschers, schon bald kann er sich dessen Häschern nicht mehr entziehen. Er wird blutig zusammengeschlagen und mehr tot als lebendig ins Meer geworfen. Yeza aber erreicht endlich die Küste des Heiligen Landes. Der Thron von Jerusalem ist nah … Ein spannender historischer Roman von Peter Berling, der gleichzeitig das große Epos »Die Kinder des Gral« aus der Zeit der Kreuzzüge als Teil XIV fortführt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 449
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
PETER BERLING
Die Spur des Kelches
Folge XIV des 17-bändigen Kreuzzug-Epos Die Kinder des Gral
Historischer Roman
WAS DAVOR GESCHAH IN FOLGE XIII
Die Braut von Palermo
Manfred, der Bastardsohn des verstorbenen Stauferkaisers Friedrich II., ist im Begriff, sich zum König von Sizilien zu krönen. Seine Ambitionen gehen weiter, die Wahl der Braut, eine griechische Kaisertochter, bereitet den nächsten Griff vor, den nach dem Thron von Byzanz. Und das wehrt sich!
Auf ihrem langen Weg nach Jerusalem werden die ›Kinder des Gral‹ auf einer der Sizilien vorgelagerten Inseln aufgehalten, unheilvoll kreuzt der Schwarze Kelch ihre Ungewissheit, sie verfallen dem Rausch von Drogen, den Gelüsten fleischlicher Liebe, auch mit fremden Leibern, doch als sie hören, dass ihr Hüter William von Roebruk bereits in Palermo alles für ihren Empfang vorbereitet hat, stürzen sie sich bedenkenlos in diesen Schlund mörderischer Intriganten und infamer Giftmischer. Was als vereinigendes Erlebnis für Roç und Yeza gedacht war, als Vorbereitung auf ihre Rolle als Weltfriedenskönige, führt in diesem Hexenkessel zunehmend zur Entfremdung der Liebenden.
William verhindert einen Mordanschlag der Byzantiner, Konstantinopel erpresst Manfred mit der Nicht-Herausgabe seiner Braut, Roç macht sich erbietig (nicht ganz uneigennützig), sie herbeizuschaffen … Yeza gibt im Gegenzug einer romantischen Laune nach, den jüngsten Kaiserbastard ›König‹ Enzio aus der Gefangenschaft Bolognas zu befreien. Frivol lässt sie sich mit einem Freibeuter der Meere ein, doch bereits vor Salerno wird das ungleiche Paar von der Templerflotte aufgebracht, soll dem rachsüchtigen Papst überstellt werden. Ihre letzte Hoffnung ruht auf William von Roebruk …
I ATLANTA VICTRIX
Die Hirten
Der junge Ritter vom Orden der deutschen Brüder trabte allein über die schneebedeckten Passhöhen des Appenin. Von Zeit zu Zeit, wenn sein Falbe von einem der Hügel ins nächste Tal hinabstieg, verschluckte das winterliche Weiß die schlanke Gestalt in der Clamys, nur das schwarze Kreuz auf Brust und Rücken und der eiserne Helm hoben sich noch ab, mystische Zeichen im Schnee, in dem die Hufspuren schnell verwehten. Trotz des hinderlichen Untergrundes hielt der Reiter sein Pferd zu einer schnellen Gangart an, was die Leichtigkeit der flüchtigen Erscheinung noch unterstrich, sofern das Bild sich dem Betrachter aus der Ferne darbot. Aus nächster Nähe verfolgt, war die Mühsal des Kampfes mit der widrigen Natur zu spüren.
Die Hufe des Hengstes glitten oft aus, suchten Halt auf felsigem Stein unter trügerischer Decke, die Nüstern dampften. Auch der Ritter schien unter dem schweren Topfhelm keuchend zu atmen; sein schmaler Körper musste jeden Schlag auffangen, der sich aus dem unsicheren Ritt ergab. Nur gar zu gern hätte Yeza den Helm abgenommen und ihr schwitzendes Gesicht in der kalten Luft erfrischt, aber ihr nasses Haar hätte ihr sofort eine üble Erkältung beschert. Überdies war die Gegend, die so einsam wirkte, keineswegs unbewohnt. Aus den Wäldern konnte sie den blauen Rauch der Meiler senkrecht aufsteigen sehen, und auf den Hochebenen stieß sie immer wieder auf Hütten von Schäfern. Die Glocken unsichtbarer Herden drangen zu ihr, vereinzelt Hundegebell, Schafe irgendwo im Schnee. In den Tälern lagen verstreute Weiler. Holzfäller und Jäger huschten zwischen den Bäumen abseits der Straße einher, Frauen mit Reisigbündeln und gewaltigen Kiepen grüßten am Wegesrand. Trüge sie keinen Helm, hätte Yezas Blondhaar sie sofort verraten, wie ein Lauffeuer wäre ihr die Nachricht vorausgeeilt, dass eine Frau unter dem Mantel des Deutschritters steckte. In alle Richtungen hätte sich der Hinweis auf ihre Schutzlosigkeit verbreitet, in den tiefen Tann, in die verborgenen Räuberhöhlen und Diebesnester wäre die Kunde gedrungen, dass leichte Beute im Anmarsch sei, zumindest ein gutes Pferd und auch sonst sicher einige brauchbare Gaben. So beschränkte sich Yeza mit zusammengebissenen Zähnen darauf, oben auf dem Kamm der Hügel, auf den windigen Höhen, kurz das Visier zu lüften, um einen Schluck Wein aus dem Beutel zu nehmen. Etwas Dörrobst und einige Nüsse ließen sich auch noch kauen, wenn das eiserne Gehege sich wieder geschlossen hatte.
Sie dankte in Gedanken dem alten Sigbert, dass er sie nicht aus Viterbo hatte ziehen lassen ohne eine Kleidung, die diesem Ritt durch die Kälte angemessen war. Ihm wie auch ihr wäre wohler zumute gewesen, sie hätten die Reise gemeinsam fortsetzen können. Aber dann war bereits der erste Suchtrupp des Reichsvikars erschienen, und es war zu hören, dass Oberto Pallavicini auf seinem einzigen Auge nicht blind sei und bereits in Erfahrung gebracht habe, dass die Flüchtige nicht zur Adriaküste unterwegs sei. Wie der alte Bär Sigbert es vorausgesehen, musste er einen neuen Abwehrriegel ersinnen, damit Yeza allein, aber unangefochten weiterreisen konnte. Zukünftig hatte sie alle Hauptstraßen zu meiden, niemanden nach dem Weg zu fragen noch eine Richtung auf ihrem einsamen Ritt erkennen zu lassen. Deshalb schlief sie auf abgelegenen Gehöften im Heu. Sie warf den Einödbauern eine Münze zu, knurrte mit rauer Stimme »Dormir!«[1] und wickelte sich mit ihrem Schwert in die Decke, immer dafür sorgend, dass ihr langes Blondhaar nicht zum Vorschein kam. Yeza traf ihre Wahl, wenn sie denn eine hatte, bevor es dunkelte. Meist musste sie mit Heuschobern oder Schäferkaten vorliebnehmen. Und sie brach wieder auf, bevor es hell wurde, hungrig wie ein Wolf. Dann stopfte sie ihre Mähne unter eine Wollhaube, schnürte sie fest, zog ihre Kapuze darüber und suchte nach einer Hütte, aus der ein Feuerschein ins Freie fiel. Dort gab es immer etwas zu essen, und meistens durfte sie nicht einmal dafür zahlen. In den Bergen hielten die Ärmsten der Armen die Gastfreundschaft heilig, und jeder Versuch, sie mit Gold zu entlohnen, hätte die Ehre der einfachen Leute verletzt. So brach Yeza das Brot, segnete es stumm, wie sie es als Tochter einer Ketzerin gelernt hatte, und aß, was ihr, reichlich und von Herzen kommend, zugeschoben wurde. Oft wurde der Gruß der Katharer erwidert, denn in den unzugänglichen Tälern und Hochebenen des Appenin hingen noch viele der ›Reinen Lehre‹ an. Inquisitoren trauten sich nicht in Gegenden abseits der Passstraßen und schon gar nicht ohne schwer bewaffnetes Gefolge. Dem schweigenden Gast wurden keine Fragen gestellt, das schwarze Kreuz auf dem weißen Umhang, das blitzende Schwert und das Ungetüm von Topfhelm taten das Ihre.
Für Yeza war dieser Ritt wie eine Läuterung, ein Abstreifen nichtiger Gedanken, eitler Überlegungen und Intrigen. Sie fühlte sich ihrer toten Mutter verbunden, der ›Reinen‹, die durch das Feuer in jene andere, bessere Welt eingetreten war. Hunger, Durst und Müdigkeit bewirkten auch bei Yeza das Gefühl des Losgelöstseins vom Körperlichen, eine seltsame Leichtigkeit. Es verlangte sie danach, sich in den Schnee zu betten, und die Entbehrungen empfand sie als rauschhafte Lust. Yeza träumte auf dem Rücken des Falben, der sie sicher auf steil abfallenden Kammpfaden, über schmale schwankende Stege und durch steinschlaggefährdete Geröllhalden trug. Immer häufiger erschien ihr Arslan, der Weise vom Altai, von dem sie so viel, eigentlich alles gelernt hatte, um ihren Leib mit der Natur in Einklang zu bringen.
Nachdem sie erlebt hatte, wie der Schamane sein körperliches Erscheinungsbild über riesige Entfernungen zu versetzen vermochte, war sie nicht erstaunt gewesen, Arslan an den Hängen der Pyrenäen wiederzusehen. Yeza war sich sicher, dass er auch diesmal den Weg zu ihr finden würde, wenn sie seiner Kraft bedürfte. Sie fühlte die klaren Augen des Schamanen auf sich ruhen, und das gab ihr Mut und Stärke. So ritt die junge Königin der unsichtbaren Krone unerkannt durch das winterliche Land, gewiss, von der geheimen Macht beschützt zu sein, die ihr Leben bestimmt hatte und sie durch alle Fährnisse leitete, damit sie an ihnen reifte; eine Macht, die ihr nichts ersparte und doch immer wieder eingriff, um sie vor dem Verderben zu bewahren, sodass Yeza schließlich blind darauf vertraute, in der Hand einer allmächtigen Gottheit zu sein, die sie liebte. Dennoch fragte sie sich manchmal, warum ein allgewaltiger Gott ausgerechnet ihr so viel Liebe und Beachtung schenkte.
In ihrem abgehobenen Zustand zwischen Trance und Traum, Dämmerschlaf und Höhenrausch, bemerkte Yeza zu spät, dass sie verfolgt wurde. Berittene Hirten waren schon des Öfteren auf den Höhenzügen der Berge aufgetaucht, doch jetzt drängten sie in das Hochtal. Sie trieben wilde Pferde mit langen Stangen und zusammengerollten Stricken, die sie auswarfen wie Schlingen, und trennten die Hengste von den Stuten und die Stuten von den Fohlen. Vor allem aber rückten sie näher an Yeza, kreisten sie allmählich ein. Als sie die Gefahr erkannte, hatte sich der Ring bereits geschlossen.
Yeza verspürte weder Lust, sich jagen zu lassen, noch von ihrem Schwert Gebrauch zu machen. Die Hirten betrieben das Einkreisen ihrer Beute auch nicht mit finsteren Drohgebärden, sondern spielerisch, als sei ihnen mit den Wildpferden nur versehentlich ein Ritter des Deutschen Ordens ins Netz geraten. Sie hielten auf Abstand und trieben ihren Fang vor sich her, auf den Flanken jeden Ausbruchversuch mit langen dünnen Hirtenstäben vereitelnd. Da Yeza bald von den Wildpferden dicht umdrängt war, verfiel auch sie in den schnellen Galopp der aufgeregten Tiere. So stob die Kavalkade dahin, bis sich vor ihnen Gatter auftaten. Dahinter erhoben sich Zelte und feste Hütten um ein Feuerrund. Die Pferde drängten schnaubend und wiehernd in die Gevierte.
Yeza verharrte, bis sie eine Lücke im Gedränge erspähte, gab ihrem Falben die Sporen und setzte über die Holzstangen hinweg, mitten unter die Frauen und Alten, die sich um das Feuer geschart hatten. Sie landete vor den Füßen eines jungen Mannes, der keinen Schritt zur Seite sprang, sondern mit blitzschnellem Griff ihr Pferd am Halfter packte, als hätte er sie erwartet. Deutlich vernahm sie, dass er »Willkommen, Königin!« sagte. Er bleckte sein Raubtiergebiss, und seine Augen funkelten.
Yeza begriff, dass ihr Versteckspiel nicht länger durchzuhalten war, und außerdem wollte sie endlich den grässlichen Topfhelm loswerden. Sie hob ihn mit beiden Händen von den Schultern, riss unwillig die Kapuze und den darunter getragenen Wulst herunter, der ihre Schädeldecke vor dem Druck des Eisens und vor allem vor seinen Schlägen bewahrt hatte, und schüttelte ihre blonde Mähne aus, bis sie ihr wieder lang über den Rücken fiel.
»Ich bin Sutor[2]«, sagte der Mann, offensichtlich der Anführer des Hirtenvolkes. »Ihr steht unter unserem Schutz!«
Yeza wollte sich geschmeidig und vor allem energisch aus dem Sattel gleiten lassen, doch da verließen sie die Kräfte. Ihre Beine gaben nach. Sie musste dankbar erdulden, dass sich ein starker Männerarm um ihre Taille legte und sie sicher zu Boden brachte. Ihre Knie zitterten so sehr, dass sie sich an den Leib des Pferdes lehnen musste, um sich nicht ganz dem Hirten zu überlassen oder in einem Anfall von Schwäche umzufallen.
»Ihr mutet Euch viel zu, meine Königin!«, rief Sutor vorwurfsvoll, aber er lockerte seinen hilfreichen Griff, bevor Yeza ihn dazu ermahnen musste.
»Ich bin kein schwaches Weib, das der Stütze bedarf!« wehrte sie sich. »Doch ziehe ich es vor, mit weniger Eisen behängt zu reiten.«
Sie musterte den kräftigen Mann, der seine Hand darauf gänzlich von ihr nahm, nicht aber seinen feurigen Blick.
»Stärke ist keine Frage des kühnen Mutes, sondern der richtigen Einschätzung der eigenen Kräfte und ihres besonnenen Einsatzes!«, erwiderte er zu Yezas Erstaunen. Solche Worte aus dem Munde eines Häuptlings von Pferdetreibern hatte sie nicht erwartet. So raffte sie sich zu einer gebührenden Entgegnung auf.
»Hohe Einsätze erfordern mehr als puren Wagemut, auch die Bereitschaft zum Opfer ist Voraussetzung zur Erlangung des Zieles.«
»Nehmt mit dem Haus meiner Eltern vorlieb, Königin, Ihr seid erschöpft«, bot er ihr fürsorglich an und wies auf den offenen Torbogen des hölzernen Rundbaus hinter sich. »Es wird ihrem Andenken eine Ehre sein.«
Yeza stolperte über die Schwelle, trat aber nicht darauf. Diese Regel der Mongolen war ihr noch in Erinnerung. Auch sonst erinnerte vieles an eine Jurte, angefangen mit dem Rauchabzug über der Feuerstelle in der Mitte des Raumes bis zu den Tierfellen an den Wänden und auf den Ruhebänken. Sie ließ sich unaufgefordert auf eines der Lager fallen, lehnte den Kopf nach hinten und streckte die Beine weit von sich.
»Ihr seid wohl auf dem Weg nach Bologna?«, fragte Sutor in einem Tone, der nicht verraten sollte, dass er es bereits wusste. Doch er erhielt keine Antwort. Yeza war vor Erschöpfung sofort eingeschlafen.
Er nahm einen mit Daunen gefütterten Pelz und betrachtete die schmale Gestalt. In ihrem weißen Mantel der Deutschritter mit dem langen Blondhaar, das ihr über die Schultern fiel, und dem schwarzen Schwertkreuz[3], das von der Brust bis zu den Füßen reichte, wirkte sie wie ein geharnischter Engel. Ihre hohe Stirn und ihr gerader Nasenrücken verstärkten diesen Eindruck noch, und doch ging großer weiblicher Liebreiz von ihr aus. Sutor war seltsam betroffen von diesem Zusammenweben herber, fast abweisender Jungfräulichkeit und der fordernden Lockung des sich wölbenden Schamhügels, der knospenden Brüste. Gefangen im Widerstreit seiner Gefühle, stand der muskulöse Hirte mit dem Pelzwerk vor ihr, verzaubert von dem Anblick vollendeter Keuschheit, bedrängt von den unkeuschen Gedanken, die ihm, der in jäher Leidenschaft entbrannt, durch den Kopf schossen. Schließlich siegte die Achtung vor dem Gast, und er breitete die Decke mit unbeholfener Zärtlichkeit über die Schlafende.
Die Sonne stand schon hoch im Mittag, als Yeza erwachte. Durch die geöffnete Tür sah sie die Hirten beim Brandmarken der Füllen. Die älteren wurden einzeln aus ihrem Gatter geholt, nachdem sie durch den geschickten Wurf einer Schlinge eingefangen waren, die jüngeren hoben die wilden Gesellen einfach hoch und trugen sie in die Nähe des Feuers, wo die glühenden Eisen bereitgehalten wurden. Yeza konnte ihre Läufe im Schmerz zucken und strampeln sehen, sie schrien vor Angst und staksten nach erfolgter Prozedur verstört zu ihren Müttern, die ihnen die Wunde leckten. Es waren nur noch wenige, die diesen brutalen Eingriff erdulden mussten. Auf dem Feuer, in dem die glühenden Eisen bereitlagen, brodelte in einem eisernen Kessel eine kräftige Suppe. Es duftete nach getrockneten Früchten des Feldes, Knollen, Wurzeln und Pilzen. Yeza vervollständigte sich in Gedanken das einfache Mahl mit einem Schuss Öl, einer Prise Salz und einem Stück ofenwarmen Fladenbrot. Sie bekam Hunger und erhob sich.
Man hatte ihr einen Krug und eine Schüssel mit frischem Wasser bereitgestellt. Sie zog den Vorhang zu und wusch sich. Draußen hörte sie die Stimmen der Männer, doch sie sprachen einen rauen Dialekt, der ihr nicht geläufig war. Als Yeza aus der Hütte trat, kam ihr Sutor entgegen und geleitete sie zu einem mit Fellen ausgelegten, erhöhten Sitz.
»Unsere Königin Yezabel!«, verkündete er seinen Kumpanen, die rund um das Feuer saßen und jetzt mit ihren Löffeln an die Näpfe schlugen, dass es schepperte und dröhnte.
Yeza schickte ein strahlendes Lächeln in die Runde und nahm Platz. Es war ihr nicht ganz geheuer, wieso sie zu der Ehre einer Monarchin über dies Hirtenvolk kam, und sie wollte erst mehr über die Hintergründe in Erfahrung bringen, bevor sie sich mit wohlgesetzten Worten bedankte. Während sie ihre Suppe löffelte, kam Sutor auf König Enzio zu sprechen, was sie noch mehr verwunderte.
»Wir sind Sarden«, eröffnete er das Gespräch, »verbannt von unserer Insel, weil wir unserem Herren, dem Staufer Enzio, der auf ewig König von Torre et Galura[4], die Treue halten. Ihr, Yezabel, seid seine rechtmäßige Königin und auf dem Wege zu ihm, um Euch mit ihm zu vereinen. Dem ungeborenen Spross aus dieser glorreichen Verbindung gilt schon jetzt unsere Huldigung und unser Treueschwur. Wir sind zu jedem Opfer bereit, das Ihr von uns verlangt.« Er kniete vor Yeza nieder, und alle folgten seinem Beispiel.
Es herrschte erwartungsvolle Stille.
Yeza war erschrocken. Sie war nicht gewillt, diesen Irrtum auf sich beruhen zu lassen. Schließlich war sie im Begriff, sich nach Bologna zu begeben, weil sie sich Gewissheit darüber verschaffen wollte, ob Enzio ihr leiblicher Vater war. Keineswegs hatte sie die Absicht, sich von ihm, der schon zweimal geehelicht hatte und zahlreiche Kinder sein eigen nannte, schwängern zu lassen. Sie erhob sich.
»Noch lebt König Enzio, der legitime Souverän über sein treues Volk und sein Inselreich. Lasst uns keinen Verrat an ihm begehen, indem wir voreilig bereits seinen vorhandenen wie noch ungeborenen Nachkommen huldigen, sondern lasst uns all unsere Klugheit und Kraft darauf verwenden, ihn aus der schmählichen Haft der Bolognesen zu befreien! König Enzio ist noch zu jung, als dass wir ihn einfach seinem Schicksal überlassen können!«
Da trommelten die Sarden Beifall, und Yeza fuhr flammend fort:
»Ich habe geschworen, kein Kind von ihm unter dem Herzen zu tragen, solange ich nicht alles unternommen habe, ihn zu befreien! Das ist unsere Aufgabe, und dabei sollt Ihr mir helfen!«
Yeza wartete auf erneute Zustimmung, stattdessen machte sich Unruhe um das Feuer breit, Hirten waren hastig herbeigeritten und eilten aufgeregt zu Sutor. Der trat zu Yeza.
»Recht habt Ihr, Königin, dem Nächstliegenden Vorrang einzuräumen, doch ist dies nicht die Freiheit unseres Königs, sondern der Erhalt Eures Lebens! Truppen des Oberto nehmen unser Lager von zwei Seiten in die Zange!«
»Das ist die Folge, wenn man nur auf einem Auge sieht!« Yeza lachte unbeschwert. »Der Herr Reichsvikar hat sich in mich verliebt und ist machtlos dagegen!«
»Darauf würde ich mich nicht verlassen, meine Königin. Dem Pallavicini genügt Euer Kopf samt Blondhaar, um in Verzückung zu geraten.«
»Was schlagt Ihr vor, Sutor?«
»Ihr verwandelt Euch in einen schmutzigen Hirten, ich dagegen in den Ritter des Deutschen Ordens!«
Yeza war einsichtig.
»Dann lasst uns die Kleider tauschen«, befahl sie und hieß ihn vorausgehen in die Hütte, deren Vorhang Yeza hinter sich verschloss. Sie ließ den weißen Mantel fallen und bedeutete ihm, ihr aus dem Kettenhemd zu helfen. Sutor löste die Riemen mit fahrigen Händen. Als er ihr die Last von den Schultern genommen hatte, stand Yeza nur noch in härener Leibwäsche da. »Tragen Hirten ein wollenes Hemd?«, fragte sie herausfordernd, um sich sogleich mit »Nein!« selbst die Antwort zu geben. Als sie es über den Kopf zog und ihre festen Brüste darunter hervorsprangen, griff Sutor zu. Yeza ließ ihn gewähren. Sie fühlte seine heiße raue Zunge wie ein Tier ihre Knospen umkreisen, spürte lustvoll die Schärfe seiner Zähne, während ihr Kopf und ihre gereckten Arme wehrlos im Wollkleid steckten. Schließlich stammelte der Mann:
»Behaltet Euer Hemd!«
Da zerrte Yeza das schützende Gewebe wieder über ihren Busen und stieß ihn zurück.
»Gebt mir jetzt Euren Kittel«, keuchte sie, und er riss sich das Linnen vom Leib, warf es ihr zu. Während sie es zitternd überstreifte, legte er die Rüstung an. Als sie ihm die Schnallen festzurrte, war alle Begehrlichkeit von ihr gewichen, und auch Sutor hatte sich wieder in der Hand. Er schlug den Vorhang zurück und ließ Yeza den Vortritt. An der Feuerstelle griff er sich einen verkohlten Ast, zerbröselte ihn in der Faust und rieb ihr den krümeligen Ruß ins Gesicht und in den Haaransatz. Er zog ihre hellen Augenbrauen schwarz nach, vermischte etwas kalte Suppe mit dem lehmigen Schneematsch und schmierte ihr die Paste auf jedes Stück freier Haut, vom Hals bis zu den Händen.
»Das sollte reichen, jedes Verlangen, Euch zu küssen, zunichte zu machen!«, flüsterte Sutor lachend, und Yeza antwortete ihm mit einem Blick aus ihren Augensternen.
»Nie wieder?« Bevor er schwach werden konnte, lachte auch sie und wandte sich ab.
Als die Reiter des Vikars sich von zwei Seiten dem Lager der Hirten näherten, wurde ihnen ein Rudel wilder Stuten samt den frisch gebrandmarkten Fohlen entgegengetrieben. Die schmutzigen Hirten, mit Stiefeln voller Schlamm und verschmierten Gesichtern, umkreisten die Herde mit Hunden, die jeden Ausbruchsversuch verbellten. Beide Haufen zogen aneinander vorbei, ohne sonderlich Notiz voneinander zu nehmen. Die Mannen des Pallavicini schwärmten aus, um die Gatter mit den Pferden zu umgehen und den Sammelplatz einzukreisen, als aus den dahinterliegenden Hütten ein Trupp Hirten im eiligen Ritt gen Norden entschwand. Stämmige, meist gedrungene Sarden umringten einen Ritter, dessen weiße Clamys mit dem schwarzen Kreuz deutlich von seiner Umgebung abstach, die er um Haupteslänge überragte.
Der Anführer befahl seinen Leuten mit einem Wink, die Verfolgung der Flüchtigen aufzunehmen, als plötzlich die Balken fielen, mit denen die Gatter verschlossen worden waren, kaum dass die wilden Pferde hineingestürmt. In einer riesigen Stampede überrannten die Tiere alles, was sich ihnen entgegenstellte, rissen die verwirrten Reiter mit und donnerten zurück in das schneebedeckte Hochtal. Vergeblich versuchte der Anführer, seine Leute zu halten. Als sie sich wieder um ihn versammelt hatten, waren der weiße Ritter und sein Haufen längst entschwunden. Die Mannen des Pallavicini setzten sich missmutig in Trab und folgten den Spuren im Schnee, ohne große Hoffnung, die Geflüchteten noch einzuholen.
Der kleine Haufen um den jüngsten und dreckigsten aller Hirtenjungen – diesen Eindruck vermittelte Yeza mit größtem Vergnügen – hatte die Tiere nur so lange mit sich geführt, bis feststand, dass der Gegner auf den falschen Deutschritter angebissen hatte, dann hatte er sich getrennt. Ein Teil blieb bei der Herde, um sicherzustellen, dass die noch immer verschreckten Füllen nicht Opfer der Wölfe wurden, während ein gutes Dutzend von Sutor vorher bestimmter Krieger die junge Königin auf Seitenwegen in Richtung Bologna begleitete.
An ihren einsamen Ritt durch die weiße Einöde erinnerte Yeza sich als aufwühlendes Seelenabenteuer, diese Reise durch eine sich kaum verändernde Gebirgslandschaft hingegen empfand sie als lähmend. Sie schlug ihr auf das Gemüt und bereitete ihr auch physische Pein; jeden Schritt ihres Pferdes spürte sie als Stich, ihre Augen tränten wegen des gleißenden Schnees, und ihre Nase lief. Sie hätte Rotz und Wasser heulen können vor Wut über ihre körperliche Schwäche. Sie hatte Fieber, und seltsamerweise dachte sie gerade jetzt an Roç. Er fehlte ihr. Völlig unköniglich zog Yeza den Schleim hoch, hustete und spie ihn aus wie ein Matrose, bevor sie sich den Mund mit dem Ärmel ihres Kittels abwischte. Wahrscheinlich segelte ihr Trencavel längst über das Meer. Und wenn er nicht gerade in einen der Winterstürme geriet, dann hatte er mit den sonnigen Gestaden des Südens sicher das bessere Los gezogen.
Ihre sardische Begleitmannschaft tat alles, um ihr die Strapazen der Reise zu erleichtern. Yeza litt weder Hunger noch Durst, und als sie ihren Zustand nicht länger verbergen konnte, wurde auch häufiger gerastet. Sie bekam heiße Milch mit Minze und Honig, und alle sorgten sich darum, dass sie, in warme Pelze gehüllt, ausgiebig ruhen konnte. Als sie von den Ausläufern des Gebirges in die Ebene herabstiegen, wurde die Gefahr der Entdeckung wieder größer, denn hier fielen Hirten aus den Bergen auf, und die Möglichkeiten, sich zu verstecken, waren gering. Jederzeit konnten sie Trupps des Pallavicini in die Arme reiten, zumal die Stadt Bologna nicht mehr weit entfernt sein sollte.
Das Dorf lag zwischen den letzten Hügeln am Ausgang des Tales. Hier wurden die Sarden wie alte Freunde begrüßt. Yeza erhielt nach einem heißen Bad sofort ein richtiges Bett mit riesigen Federkissen. Müdigkeit überfiel sie, trotz heftigen Schwitzens, das sogleich einsetzte.
Yeza träumte, sie läge nackt im Schnee. Doch sie spürte keine Kälte, nur ein heißes Prickeln, das sich von ihren Hinterbacken den Rücken hinauf zog, über die Schulterblätter bis in den Nacken. Ihr blondes Haar war aufgelöst, ausgebreitet wie eine Sonne mit güldenen Fingern. Unruhig warf Yeza ihren Kopf hin und her, denn anheben konnte sie ihn nicht. Ein wildes Tier lastete auf ihr, wühlte zwischen ihren Schenkeln, umklammerte mit vielen Klauen ihren Leib in der Taille. Ein Mund presste sich saugend auf ihre Brüste und biss sie in den Hals. Schweißnasses Fell verwehrte ihr die Sicht auf sein Gesicht, nahm ihr den Atem zu schreien. Sie dachte erst, Roç sei in dieser Verkleidung zurückgekehrt, triebe seine Scherze mit ihr, aber es waren nicht seine zarten, glatten, harten Glieder, es waren nicht seine Locken, und das Erschreckende war, dass sie sich nicht gegen das fremde Tier wehrte, sondern es gewähren ließ. Sie genoss seine rohe Wildheit und verspürte nicht einen Hauch von Scham, sondern Neugier und zunehmend Lust. Yeza wollte gar nicht wissen, wer sich hinter dem Raubtier verbarg, doch das mächtige Haupt hatte viele Gesichter, und sie enthüllten sich gegen ihren Willen. Erst war es der Taxiarchos, der ihr seinen heißen Atem entgegenkeuchte, und als sie ihn mit heftiger Bewegung wegscheuchte, nach seinem überlegenen Lachen schlug, mit Fäusten, die sich nicht bewegen wollten, gegen seine behaarte Brust trommelte, da machte es dem Antlitz des Hirten Platz. Sutor lächelte nicht einmal, die eisernen Klammern griffen noch härter zu, schnitten ihr in die Brüste, und unterhalb ihres Bauches Wölbung peitschte der Löwe sie mit seinem Schweif. Yeza bäumte sich auf, warf den Reiter ab, trat nach ihm, schrie ihn tonlos an, und er tat seiner Königin den Gefallen und entschwand. In die Stille, in die einsetzende Kühle trat ein Ritter, rötlich blond sein Haupthaar und Bart, strahlend sein Antlitz mit der kühnen Stirn und den grüngrauen Augen unter buschigen Brauen. Er trug seinen Kettenpanzer über kurzem Hemd offen, darunter nichts. Ehe Yeza mit sich im Reinen war, ob sie ihre Augen verschämt niederschlagen oder sich ungebührlich Keckheit herausnehmen mochte, denn das sich abzeichnende Gemächte verdiente Beachtung auf jeden Fall, erkannte sie blitzartig, dass König Enzio vor ihr stand. Vor Schreck blieb für Scham keine Zeit. Yeza erwachte schweißgebadet, aber ihre Stirn war kühl, das Fieber aus ihren Gliedern gewichen.
Frauen traten ins Zimmer, wickelten sie aus den klitschnassen Decken, trockneten sie ab und kleideten sie wie eine der ihren. Bruchstückhaft drang zu Yeza, dass in wenigen Tagen der große Markt in Bologna sei, wohin sie alle mit dem Überfluss ihrer Ernte ziehen wollten, außerdem mit Flechtarbeiten mannigfaltiger Art, großen Kiepen voller feinster Holzkohle und Tragen, in denen saftige geräucherte sowie luftgetrocknete Schinken ruhten. Doch nichts sei für die Städter so begehrenswert wie das ›Weiße Gold‹. Die Frauen zeigten Yeza zierliche Körblein, worin, eingeschlagen in ein Tuch, ein unansehnlicher, irdener Klumpen lag. Er roch würzig, herb und faulig, ein Geruch, den Yeza noch nie in der Nase hatte.
»Tartuffi[5]!«, flüsterte ihr eine Bäuerin ins Ohr. »Das macht den Mann zum Schwein!«
Die Frauen lachten, und eine andere hielt dagegen:
»Was ist schon ein Mannsbild gegen ein braves Trüffelschwein! Ich biete der Eichelhäher zehn gegen eine Sau, die ihre Eiche kennt!«
Da lachten sie noch mehr und deckten schnell wieder das Tüchlein über die schrumpelige Knolle, deren Geruch Yeza ungemein anregend empfand, wenngleich sie nichts von dem verstand, was die Frauen so bewegte. Es musste sich wohl um ein Aphrodisiakum handeln, das an Menschen wie Schweinen gleichermaßen seine Wirkung entfaltete.
Es kam der Tag, an dem sich die Dörfler aus den verstreuten Weilern der Romagna[6] aufmachten, ihre Waren auf dem großen Freimarkt der Stadt feilzubieten. Das war ihr Recht. Einmal im Monat durften weder ihre Grundherren, ob geistlich oder weltlich, den Zehnten abschöpfen, noch die Brückenwärter Maut auf den Straßen erheben, die zur Stadt führten, noch die Wachen an den Toren Steuern fordern. So war das Gedrängel groß. Es wäre leichter gefallen, eine Ale in einem Heuhaufen zu entdecken, als Yeza unter den Frauen jeden Alters herauszufinden.
Um sicherzugehen, dass keiner sie erkannte, hatte man einen Umweg durch den Wald auf sich genommen, wo die Köhler mit ihren vielen Kindern hausten. Ihre blassen Gesichter waren vom Rauch der Meiler verrußt. Auch Yeza wurde einschließlich des Haaransatzes schwarz gefärbt, dazu kam noch der Rotz ihrer noch nicht gänzlich auskurierten Erkältung, den sie verschmierte. Ihr blondes Haar verdeckte ein bäuerliches Kopftuch, und sie erhielt eine Tragkiepe voller Holzkohle. So passierte sie unangefochten das Stadttor. Der nächste Schritt bestand darin, unauffällig den Palazzo zu erreichen, in dem König Enzio als Gefangener des Magistrats von Bologna in allen Ehren residierte, und sich Zugang zu verschaffen, ohne Aufsehen oder gar Argwohn zu erregen. Holzkohle ließ sich dort nicht verkaufen, wohl aber die kostbaren Tartuffi. Also wurde dem Aschenputtel in einem Brunnen das Gesicht gewaschen, die Frauen flochten Yezas Mähne zu Zöpfen und richteten sie zum einfachen Kind des Landes her. Sie hatte etwas von einem Kräuterweiblein, das vom Brunnen ewiger Jugend getrunken, oder einer zum Schweinehüten gezwungenen Prinzessin; denn alle Prozeduren hatten nicht vermocht, Yeza die königliche Haltung und ihre natürliche Grazie zu nehmen und sie zu einer unauffälligen Erscheinung zu machen.
In aller Eile, bevor der Haufen Königstreuer vor dem Palazzo auffiel, klopften die Frauen an das Tor und begehrten, König Enzio einen Korb mit dem ›Weißen Gold‹ als Geschenk zu überreichen. Die Weiber schoben Yeza mit ihrem Körbchen vor und traten dann ehrerbietig zurück.
Die Wachen schienen noch zu beraten, wie in einem solchen Falle zu verfahren sei. Yeza stand allein pochenden Herzens vor dem großen, schweren Bohlentor, hinter dem sie das Ziel ihrer ebenso langen wie mühseligen Reise wusste. Sie vermochte sich vor Erschöpfung kaum noch auf den Beinen zu halten.
Endlich öffnete sich knarrend ein Flügel des Tores und heraus trat – Oberto Pallavicini! Sein einziges Auge musterte Yeza triumphierend, höhnisch blitzte es auf. Er wandte sich langsam um, und deutlich war sein knapper Befehl.
»Wachen!«
Weiter kam er nicht, denn Yeza hatte mit einem unterdrückten Wutschrei das Körbchen gegen den Vikar geschleudert, während in ihrer anderen Hand der zierliche Dolch aufblitzte. Oberto fing den Korb geschickt auf und schnupperte ungerührt am Inhalt, geradezu anerkennend.
»Nicht übel!«, spottete er selbstgefällig. »Verhaftet die Schnüfflerin!«
Yeza wollte sich auf ihn stürzen, da schob ein Arm den Vikar von hinten zur Seite, und vor ihr stand Enzio.
»Helft mir, Vater!«, rief sie mit kläglicher Stimme. »Jener will mich verderben!«
»Wachen!«, schrie jetzt der Vikar und trat zur Seite, um die Bewaffneten durchzulassen. Da ließ Yeza ihren Dolch losschnellen. Er wirbelte durch die Luft und blieb zitternd neben dem Hals des Pallavicini im Holz der Tür stecken. Um ihm auszuweichen, hatte er den Wachen den Weg nochmals versperren müssen. Yeza nutzte diesen letzten Aufschub und warf sich mit einem Sprung vor, um Enzios Knie zu umklammern. Doch der fing sie auf, breitete seine Arme schützend über sie und schüttelte den Vikar ab wie einen lästigen Köter. Angesichts dieser starken Geste wog Oberto nur missbilligend den Kopf, zog mit einem Ruck die Klinge aus dem Holz und reichte sie Yeza, die sich aus der Umarmung löste.
»Als Tochter wärt Ihr mir unheimlich, meine Königin!« Er hatte das gänzlich ohne Spott vorgebracht. Yeza versteckte den Dolch wieder an seinem Platz, im Kragen unter ihrer Mähne, während sie ihm antwortete:
»Unheimlich müsst Ihr, Oberto Pallavicini, vor allem dem Manne sein, der nur auf einem Auge sieht, vor dessen Blick sich Feinde wie Freunde vorkommen mögen und Freunde sich besser hüten!«
Yeza erlebte zum ersten Mal das offene Lachen Enzios.
»Ich sehe, Ihr liebt Euch heiß und innig!«
»Das mag wohl der Wahrheit des Halbblinden nahekommen«, knurrte der Vikar. »Der nur zur Hälfte Sehende empfindet des Lebens Lüge stärker als solchen Trost.«
Enzio legte seinen Arm über Yezas Schultern und nahm im Vorbeigehen dem Vikar das Körbchen aus der Hand.
»Kauft den guten Frauen alle Tartuffi ab«, befahl er freundlich Oberto, »und gebt jeder noch ein Goldstück obendrein. Sie haben sich verdient gemacht!« Er lachte Yeza an und führte sie in den Palazzo.
Meuterei
Die helle Felseninsel lag mitten im Mare Nostrum, eine Anhäufung weißlichen Muschelkalksteins, von Wind und Wasser ausgewaschen. Kein Baum, kein Strauch hatte sich darauf festkrallen können. Nur einige Agaven ließen die breiten fleischigen Blätter schlaff in der glühenden Hitze herabhängen, und ihre abgeblühten Stängel reckten sich dem Vergehen entgegen. Und dennoch gab es Leben auf Linosa[7]. In die Felsen geschnittene Höhlen verrieten menschliche Hand, und über allem thronte ein steinernes Castel, dessen Mauern so intakt gehalten waren, wie nur eine ständige Besatzung es vermochte. Linosa schien auf den ersten Blick keine Mole zu besitzen, an der Schiffe anlegen konnten, doch wenn ein Boot die Einfahrt zwischen den wie bizarre Türme aufragenden Klippen fand, dann öffnete sich hinter einem Wall aus Steinen eine riesige Grotte, ein überdachter Hafen, der vom Meer aus nicht zu entdecken war. Den bewachten die Felsennester und die darüber kragende Burg, die allesamt durch in den Stein getriebene Gänge mit ihm verbunden waren. Linosa war eine Sträflingsinsel gewesen. Sie hatte zu Sizilien gehört und sarazenischen Piraten als Stützpunkt und Versteck gedient. Dann hatte der Templerorden das Eiland gepachtet und zu einer uneinnehmbaren Festung ausgebaut. Seitdem durfte kein fremdes Schiff die Insel mehr anlaufen, nicht einmal, wenn es in Seenot geriet. Die Templer breiteten eine riesige Clamys des Geheimnisses über die einsame Insel, mit der Folge, dass der völlig bedeutungslose, unwirtliche Steinhaufen erst recht ins Gerede kam. Wilde Gerüchte von unterirdischen Tempelanlagen, in denen heidnische Opferriten an gefangenen Knaben vollzogen wurden, und vom ›Haupt des Baphomet‹, das dort als Stein der Weisen in der Tiefe des Berges bestimmte Erze in Gold verwandele, waren in Umlauf. Der Orden hatte Linosa strikten Regeln unterworfen. Den Sklaven war eine bestimmte Menge Weiber zugeteilt, die allerdings als Allgemeingut betrachtet wurden und zu entlohnen waren. Diese ebenfalls unfreien Frauen konnten feste Beziehungen eingehen, wurden sie allerdings schwanger, entfernte der Orden sie unverzüglich. Aus naheliegenden Gründen war den Sklaven das Tragen und der Besitz von Waffen nicht erlaubt. Nur die alle vier Stunden wechselnden Wachen wurden auf dem Castel mit leichten Spießen versehen. In ihren schwarzen Umhängen als Turkopolen[8] gekennzeichnet, kontrollierten sie durch Rundgänge nicht nur den verborgenen Hafen, sondern die gesamte Insel, damit kein Unbefugter sie betrat. Das äußerst einfache, aber völlig ausreichende Druckmittel der Tempelherren war der Zugang zur einzigen, reichlich sprudelnden Süßwasserquelle hoch oben hinter der Mauer des Kastells.
Selbst Piraten, von denen es in diesem Teil des Mittelmeeres nur so wimmelte, mieden die Insel, denn manches Schiff, das sich in ihre Nähe gewagt oder sogar versucht hatte, sie heimlich anzulaufen, um das Geheimnis von Linosa zu ergründen, war einfach verschwunden, mit Mann und Maus. Gefangene wurden scheint’s nicht gemacht, denn sie tauchten auf keinem Sklavenmarkt der nahen Berberesken-Küste auf.
Für die Wachen war es daher ein Ereignis im eintönigen Trott, als eines Tages am Horizont ein Schiff erschien. Es hielt arglos auf die Insel zu. Schon bald stand fest, dass es sich nicht um einen Segler des Ordens, sondern um eine maltekische Triëre altmodischer Bauart handelte. Solche Takelage war seit mindestens einem halben Jahrhundert nicht mehr üblich, und auch der prunkvolle Stander, den sie gehisst hatte, zeigte noch den schwarzen Reichsadler auf goldenem Grund aus Kaiser Barbarossas[9] Zeiten.
Die Besatzung des Castels musste das ahnungslose Schiff mit drei Reihen auffällig blitzender Ruder ebenfalls bemerkt haben, denn am Fahnenmast stieg rot das vierfache Andreaskreuz auf, das warnende Zeichen für die Verseuchung eines Ortes, für die Mannschaften der rund um den geheimen Hafen versteckten Katapulte jedoch zugleich das vereinbarte Kommando, diese in Gefechtsbereitschaft zu versetzen. Nur ein argwöhnisches und dazu noch sehr geübtes Auge vermochte von hoher See aus diese Vorbereitungen zu erspähen, denn alle Verbindungswege, welche die Insel durchzogen, glichen in den Fels gegrabenen Laufgängen tückischer Termiten, nur dass an wenigen Stellen die hölzernen Turmhauben der Steinschleudern und Ballisten herausschauten.
Auf der Triëre, die unter dem Befehl des Taxiarchos ihre Schlagzahl laufend verringerte, sodass sie der Insel nur langsam näherkam, wurden ebenfalls die letzten Vorbereitungen getroffen. Kaum dass die Vorgänge an Bord in Sichtweite des Castels geraten waren, begann an Deck ein Schaukampf zwischen den vorher eingeteilten Parteien, wobei die ›Meuterer‹ sehr bald die Oberhand gewannen. Mehrere der dem Kapitän treu Ergebenen flogen ins Wasser. Dass sie hinter das Schiff schwammen und dort wieder an Bord geholt wurden, konnte keiner von der Insel aus sehen. Einige blieben auch malerisch als Tote und Verletzte auf den Planken liegen. So trieb die anscheinend führerlose Triëre immer näher an die Felsgestade Linosas heran. Jeder von den versteckten Wachen unten am Hafen, den schussbereiten Besatzungen an den Katapulten und der Garnison oben hinter den Mauern des Kastells wurde jetzt Zeuge des sich anbahnenden kurzen Prozesses, den die siegreichen Meuterer ihrem Kapitän machten. Der Taxiarchos wurde auf eine Planke geführt, ihm wurde eine Schlinge um den Hals gelegt, das Tauende war bereits an der Großrahe befestigt. Ein Mönch hielt ihm kurz ein Kreuz zum letzten Kuss über die Reling. Die Matrosen sprangen vom Brett, das sofort emporschnellte und den Taxiarchos ins Leere sausen ließ. Der Strick spannte sich – und riss. Der Körper stürzte ins Meer. Ein Schrei der Verärgerung begleitete die missglückte Hinrichtung, denn der Taxiarchos tauchte schnell wieder auf, mit dem Strick um den Hals. Da ihm nur die Hände auf den Rücken, nicht aber die Füße gefesselt worden waren, konnte er sich mit kräftigen Beinstößen von der Triëre entfernen und auf das Ufer zu halten. Die Ruderer des Schiffes, deren Blätter wie metallene Sensen glänzten, hatten zwar anfangs nach ihm gehackt und wie wild das Wasser gepeitscht, doch sie machten keine Anstalten, sich wegen des entkommenen Opfers der Küste zu nähern. Die Triëre nahm wieder Fahrt auf, zog an Linosa vorbei und entschwand gar bald aus den Augen aller, die das dramatische Schauspiel verfolgt hatten. Einige der Wächter sprangen in die Brandung und schwammen dem Mann entgegen, der Gefahr lief, sich an den Klippen den gerade so wundersam geretteten Kopf einzuschlagen. Sie zogen ihn aus dem Wasser, auf die nächste Felsenbank, und lösten seine Handfesseln. Der Taxiarchos befreite sich von der Schlinge um den Hals und blieb erst einmal völlig erschöpft bäuchlings auf den Steinen liegen. Die Wachen brachten ihn hinauf zum Kastell.
Die Burg von Linosa war ursprünglich eine Anlage aus phönizischer Zeit. Ihre vier dicken Wachtürme waren nach den Himmelsrichtungen auf die Bergkämme gesetzt und mit breiten Mauern verbunden. Sie trafen sich in einem klobigen Hauptturm, der sie überragte, sodass sie von ihm aus alle einzusehen waren. Da die Kopfstärke der Garnison bei Weitem nicht ausreichte, die Außenforts zu bemannen, hatte der Orden sie einfach abgekappt, und die Mauern endeten nun mit Zugbrücken gegen den zentralen Donjon. Doch auch die waren nie benutzt worden, die Ketten mit der Zeit eingerostet, denn die Templer verließen sich auf die Kontrollgänge der Milizen und auf ihre Methode, die Unfreien bei der Stange zu halten. So hockte das Castel in den Felsen wie ein steinerner Polyp, dem die Tentakel abgeschlagen waren. Oder wie ein Drache, der vielköpfig einen Schatz bewachte. Aber welchen?
Der Taxiarchos konnte auf seinem Weg hinauf in die Burg nichts von dem entdecken, auf das er aus war. Sie eskortierten ihn mit Bedacht auf Umwegen, zumeist über getunnelte Pfade, die zu keiner Zeit Einblick in den Grottenhafen ermöglichten, wenngleich der Penikrat das Gefühl hatte, ihn unter den Füßen zu haben. Ständig führten in den Stein gehauene Treppen in die Tiefe, an denen er hastig vorbeigezerrt wurde.
Das Innere der Burg war karg und nur aufs Notdürftigste möbliert. Davon bildeten auch die Räume des Befehlshabers keine Ausnahme. Der Taxiarchos erkannte den jungen Offizier sofort. Es war Simon de Cadet, den er zuletzt in Rhedae erlebt hatte. Und der entsann sich auch sofort des Abenteurers, den Gavin Montbard de Béthune zu den ›Fernen Inseln‹ geschickt hatte und der es gewagt, von dort recht fremdartige Kinder mitzubringen. Als hätte der Orden bei Todesstrafe nicht strikte Weisung erlassen, alles zu vermeiden, was die Geheimhaltung gefährden konnte. Simon gab sich Mühe, streng zu erscheinen.
»Ich habe gesehen, Taxiarchos, dass sich bereits die Besatzung Eures eigenen Schiffes, wenn es denn Euer eigen war« – flocht er spöttisch ein –, »angediehen sein ließ, an Euch die Strafe zu vollziehen, deren Verhängung der Orden versäumte.«
Simon hatte das allerdings eher in fragendem Ton vorgebracht, sodass der Taxiarchos zu einer Antwort aufgefordert war.
»Ihr mögt, Simon de Cadet, es nicht verwerflich finden, dass Euer Orden seinem Kapitän Lohn und Anteil an der Prise[10] schuldig geblieben, und verdammenswert, dass der das Schiff als Pfand nahm. Diese Rechnung ist noch offen, nur hat sie mit dem Missgeschick, das mir jetzt widerfahren, nichts zu tun! Ich war tatsächlich der ordentlich bestallte Kapitän dieser Triëre in sizilianischen Diensten!«
»Und warum meuterte die Mannschaft gegen Euch?«
»Ich könnte als Gegenfrage vorbringen: Warum hat man Euch, Simon de Cadet, auf dieses Felseneiland strafversetzt? Habt Ihr Euch die Gunst des Guillem de Gisors verscherzt?«
Der junge Tempelritter lief rot an.
»Verscherzt Ihr Euch meinen Großmut nicht durch Anspielungen, die ich auf meine Ehre beziehen könnte, Taxiarchos!«
»Das liegt mir fern!«, antwortete der schnell. »Ich nehme an, dass Ihr jeden Angriff auf Eure Ehre zurückweist. So halte ich es ebenfalls! Der Mannschaft war zu Ohren gekommen, dass in den nächsten Tagen hier ein Schiff arabischer Kaufleute, randvoll beladen mit Gold und Juwelen, passieren sollte, und sie drangen in mich, hier vor Anker zu gehen, um die günstige Gelegenheit abzuwarten und dann beherzt zu ergreifen. Ich aber habe König Manfred mein Wort gegeben, seinem Schwiegervater in Epiros eine Hundertschaft christlicher Ritter zur Hilfe zu bringen. Nun aber geschah das für mich so furchtbar Enttäuschende – weitaus schlimmer als der mir zugedachte Tod! Auch der überwiegende Teil meiner Ritter hatte sich auf die Seite der Rebellen geschlagen und schlug sich für die Meuterer. Ich versuchte diese Insel anzulaufen. Das wurde mir dann endgültig als Hochverrat ausgelegt: Standgericht, Urteil und Exekution habt Ihr ja wohl mit eigenen Augen erlebt.«
»Doch wie immer hatte die heilige Jungfrau ein Einsehen!«, scherzte Simon.
»In der Hast, den Unliebsamen meuchlings ins Jenseits zu befördern, nahmen die Herren wohl einen zu morschen Strick. Das rettete mir das nackte Leben!«
Simon de Cadet sah sich den Taxiarchos nachdenklich an. »Es ist nicht meine Aufgabe, Gottes unerforschlichen Ratschluss zu korrigieren und Euch jetzt als Dieb eines Ordensschiffes zu hängen, zumal unser Großmeister dafür schon in Palermo hätte sorgen können. Also seid mein Gast, bis das nächste Schiff, das hier anlegt, Euch mit sich fortführen wird.«
»Ich danke Euch für die Gastfreundschaft«, entgegnete der Taxiarchos artig, »nur verübelt es mir bitte nicht, dass ich so schnell wie möglich von hier fort will, um mich meines Schiffes wieder zu bemächtigen und meine Aufgabe, mit deren getreulicher Erfüllung ich beim König im Wort stehe, zum guten Ende zu bringen.«
Simon lächelte.
»Rechnet nicht mit des Ordens Hilfe, wenn es darum geht, Eure Schmach zu tilgen. Auf dieser Insel steht nicht einmal ein Ruderboot für Fischer zur Verfügung.«
»Wie? Ihr habt hier kein Schiff?« fragte Taxiarchos, sein Lauern geschickt durch Erstaunen verhüllend.
»Nein!« bekräftigte der Templer mit Nachdruck. »Und selbst wenn wir eines hätten –«
»Die Triëre kann nicht weit von hier in Stellung gegangen sein, sie wird sich die Prise nicht entgehen lassen.«
»Das ist eine Sache zwischen den erwarteten sarazenischen Händlern und Euren braven Mannen und vielleicht – Ihr seid ja ein guter Schwimmer! – noch zwischen denen und Euch, keinesfalls aber die des Ordens!«
»Mir geht es nicht um schnöden Mammon, das müsst Ihr mir glauben, Simon. Ich will Gerechtigkeit und Ordnung. Die Ritter sollen, ihrem Lehnseid getreu, ihre Fahrt nach Epiros ruhmreich vollenden, und die Meuterer –«
»Erhebt Euch nicht zum Richter, Taxiarchos, der Ihr eben erst selbst wegen gleichlautender Anklage fast vor den Stuhl des höchsten Justitiators[11] getreten wärt!«
»Ich mag nicht einsehen, dass solch Unrecht auch noch Belohnung findet, ja, in purem Gold aufgewogen wird!« Der Taxiarchos spielte den Empörten mit Bravour, doch ohne Erfolg.
»Mir sind die Hände gebunden«, beschied ihn Simon de Cadet und ließ ihn von den Wachen abführen, die noch immer rechts und links von der Tür warteten, damit sie dem Taxiarchos einen Aufenthaltsraum zuwiesen. »Meine Gastfreundschaft beschränkt sich auf diese Mauern«, rief ihm der junge Tempelritter noch nach. »Es ist Euch nicht gestattet, das Castel ohne meine Erlaubnis zu verlassen!«
Der Penikrat nickte einverständig, und Simon schaute hinaus über die Felskuppel des verborgenen Hafens hinweg auf das eintönige Blau des Meeres. Es war einer dieser Wintertage, an denen der Schirokko[12] den Himmel leer gefegt hatte.
Enzios Klagelieder
»Tempo uene ki sale e ki discende,
tempo è da parlare e da taciere,
tempo è d’ascoltare e da imprende,
tempo da minaccie non temere.«[13]
Die Stimme des gefangenen Königs drang hell und klar aus den hohen dreigeteilten Fenstern. Dass kein Bolognese sie hörte, lag daran, dass die Zimmer von ›Re Enzio‹[14] wohlweislich im obersten Stockwerk des Palastes eingerichtet waren, den ihm die Stadt als Domizil zugewiesen hatte.
»Tempo d’ubbidir ki ti riprende,
tempo di molte cose pruoedere,
tempo di uegghiare ki t’offende,
tempo d’infignere di non nedere.«[15]
Dennoch waren seine Sonette[16] in aller Munde, und die Dichter Bolognas trafen sich gern bei ihrem königlichen Kollegen. Das melodramatische Schicksal des jungen Staufers bewegte ihre Gemüter, beflügelte ihre Fantasie und erhob sie über ihre biederen Mitbürger, die seit der glücklich gewonnenen Schlacht von Fossalto[17] mit ihrem prominenten Gefangenen nichts Besseres und nichts Schlechteres anzufangen wussten, als ihn am guten Leben zu erhalten. Das war jetzt bald genau zehn Jahre her, und sie hatten sich an ihre Rolle zwischen Gastgeber und Kerkermeister gewöhnt. Der König mitnichten.
»Però lo tegno saggio e canosciente
que ‘ke i facti con ragione,
e col tempo si sa comportare.«[18]
Yeza saß zu Enzios Füßen, inmitten der Trovère und Poeten, Bänkelsänger und schrulligen Tagediebe, denen ein paar Stunden im Dunstkreis historischer Tragik und königlichen Leidens für den restlichen Tag ausreichend Atzung fürs Gemüt gab, ohne einen Gedanken daran zu verschwenden, dass der edle Spender seine Zeit der Unfreiheit nach Monden und Jahren maß.
»E mettesi in piacere de la gente
ke non si troui nessuna cagione
ke lo su ’facto possa biasimare.«[19]
Bisweilen überkam den König der Gedanke an die Absurdität seiner Lage, und er musste an sich halten, um sie nicht davonzujagen. Er verfiel in düsteres Schweigen, was seine Diener dann veranlasste, die Besucher hinauszukomplimentieren. So geschah es auch heute, sodass Yeza sich endlich allein mit Enzio im hohen Raum befand.
»Ihr wolltet mir von Eurer Liebe zu meiner Mutter erzählen?«, begann sie sogleich wenig einfühlsam. Über ihr Anliegen ließ sie völlig außer Acht, dass solche Gefühle, wenn sie denn existiert hatten, längst im Nebel der Vergangenheit verweht sein mochten.
Enzio jedenfalls schwieg, und Yeza, die hartnäckig sein konnte, schob nach:
»Esclarmunde, die dann mit mir niederkam!« Auch dieser deutliche Fingerzeig bewirkte nichts. »Esclarmunde«, murmelte er schließlich, mit seinen Gedanken entfernt wie ein unbeteiligter Seher, nicht wie ein lebenslustiger Erzeuger, »Esclarmunde, die Erleuchterin der Welt.«
»Ja!« rief Yeza, beglückt, ihn nun doch auf die gewünschte Fährte gelockt zu haben. »Solch Strahlen ging von ihr aus, denn Esclarmunde war die Hüterin des Gral!«
Enzio schaute verwirrt auf die junge Frau zu seinen Füßen.
»Das mag Euch so scheinen, wie vielen der Schein als das Licht vorkam, doch sein Quell war der Stein, der lapis ex coelis, der schwarze Stein, der, vom Himmel geschickt, die Menschheit erleuchten soll, so sie denn bereit war, ihn –«
Yeza ließ ihn nicht ausreden, denn sie war überwältigt von der Vision, die sie mit dem Mann, der ihr Vater sein musste, teilen konnte.
»Gemeinsam tragen wir dies köstliche Wissen in uns!«, gab sie ihm preis, voller Stolz. »Denn auch mir ist sein Anblick widerfahren, meine Augen durften den schwarzen Stein erblicken!«
Während Enzio bisher eher widerwillig auf sie eingegangen war, brach er jetzt in helles Gelächter aus.
»Der schwarze Stein, den Ihr zu Gesicht bekommen habt, kann nur jener Marmorsarkophag der Templer gewesen sein, den sie als Ergebnis jahrelanger Wühlarbeit« – er wollte sich ausschütten vor Lachen, er bekam fast keine Luft – »aus den Tiefen des Tempelbergs der Juden voller Heimlichtuerei nicht etwa an das Licht des Tages förderten. O nein! Verhüllt und verborgen vom dunkel wabernden Mysterium Hierosolymitanum Salomonis[20], wurde der Stein in die heidnischen Untiefen von Rhedae geschleppt!« Seine Heiterkeit ließ nach. »Ich sag’ Euch, ma damna, es ist ein Grabstein! Die Templer haben sich ihr eigenes Epitaph mit nach Frankreich gebracht, wo sie offensichtlich begraben sein wollen!«
»Wieso wisst Ihr, Enzio, um diese Dinge?«, fragte Yeza kleinlaut, denn irgendetwas im Ton des Königs erschütterte sie in ihrer Überzeugung.
»Weil ich die letzten zehn Jahre Zeit hatte, über den Lauf der Welt nachzudenken. Sei es ausgehend vom Räderwerk der Gedanken, in dem wir Zeitgenossen stecken, religiones et politica[21], Geister, die wir riefen –« König Enzio zeigte sich jetzt nachdenklich. »Sei es eintauchend in die Erinnerung der Menschheit. Ich bin auf der Suche – nicht so sehr nach dem ›Wie?‹ des Vorganges als nach dem geheimen Wissen um das ›Warum?‹ der Schöpfung –, auf der Suche nach dem Gral.«
Yezas Augen leuchteten hoffnungsvoll auf.
»Es gibt ihn also doch, den Gral?«
Enzio sah belustigt auf sie hinab.
»Für jeden Berufenen, der vom Willen beseelt ist, also die Kraft und die Gabe hat, dem Herzschlag des Kosmos zu lauschen, musste es offenkundig werden, dass der Gral kein physisches Objekt ist, weder Stein noch Kelch. Beide mögen als Symbol für die Idee stehen, für das Mysterium. Wir Menschen laufen immer Gefahr, das Sinnbild und den geistigen Gehalt zu verwechseln, weil wir um Ersteres einen Kult errichten, der ein Eigenleben entwickelt und uns seinen Sinn vergessen lässt.«
»Wie konnte so klugen Männern wie den Rittern des Tempels ein solcher Irrtum unterlaufen?« begehrte Yeza auf, und Enzio lächelte milde.
»Weil sie am schwarzen Stein nicht der Ursprung interessierte, sondern der fehlende Schwarze Kelch!«
»Ja«, sagte Yeza sinnend und hütete sich diesmal, ihre Kenntnis offenzulegen, »der ist ihnen wohl abhanden gekommen. Verleiht er Macht?« fügte sie so beiläufig wie möglich hinzu.
»Vergängliche sicher, doch ist er nicht das letzte Glied in der Kette der Weisheit, sondern vielmehr das Symbol der Vermählung und somit auch des Todes; denn diese Pforte muss überwunden werden, bevor der Gralssucher aus der Quelle der reinen Erkenntnis schöpfen und trinken darf.«
»Ist es des Königlichen Paares Bestimmung, den Gral zu finden und zu hüten?«
»Ich will Euch alle drei Antworten in einer geben: Zur Suche im Diesseits fühlen sich manche berufen, doch wenige sind auserwählt, seiner teilhaftig zu werden.«
Yeza spürte die tiefe Bitternis des Mannes, so spät in seinem Erdenleben zu solch weiser Erkenntnis vorgedrungen, aber der Freiheit beraubt zu sein, sie in die Tat umzusetzen. Es musste ihn ärgern, dass andere, jüngere die Möglichkeit hatten, ihr Leben auf den Gral auszurichten, sie jedoch verstreichen ließen oder blindlings daran vorbei stolperten. Enzio konnte Roç und ihr nicht helfen, soviel stand jetzt für sie fest. Aber konnte es ihre Aufgabe darstellen, sein Los zu verändern? Yeza, die bisher sittsam und ergeben zu den Füßen des verehrten Re Enzios gesessen hatte, streckte ihre langen Beine und erhob sich. Sie sah sich nicht etwa nach ihm um, sondern durchmaß federnden Schritts den Saal, was den König unruhig machte.
Yeza wollte ihre Gedanken ordnen, bevor sie eine Entscheidung traf. Die Befreiung König Enzios aus seiner unrühmlichen Bologneser Gefangenschaft als Prüfung, die ihr auferlegt war? Das machte nur Sinn, wenn die engen Blutsbande zwischen ihr und dem Staufer nicht nur in ihrer Einbildung bestanden und mehr waren als Jungmädchenschwärmerei! Sie musste der Wahrheit ins Auge schauen. Yeza hielt inne in ihrem Schritt, wandte sich aber nicht zum König um.
»Seid Ihr mein Vater, Enzio?«
Die Frage stand unvermittelt im Raum, und der König war dabei zusammengezuckt. Enzio hob seinen Blick zu den hohen Fenstern, als hätte jemand drüben im Palazzo del Podestà[22] oder gar im Torre dell’ Arengo gelauscht. Dann stieg er hinab von seinem thronartigen Sitz und ging langsam auf die schmale Gestalt zu, die ihm den Rücken zugedreht hatte, als sei sie zu Stein erstarrt. Behutsam legte er eine Hand auf ihre Schulter.
»Lass uns ein wenig durch die Straßen wandern, mir fällt die Decke auf den Kopf.«
Yeza, die eine brüske Reaktion befürchtet hatte, mit der er sie als mögliche Tochter zurückwies oder sein Verhältnis zu ihrer Mutter glattweg leugnete, fühlte Erleichterung. Allerdings musste sie sich darauf einstellen, dass er zwar über sich und Esclarmunde reden wollte, ihr die ›natürliche‹ Folgerung jedoch auszureden gedachte, denn sonst hätte er ja zu seiner Vaterschaft stehen können. Sie empfand Traurigkeit, und fast bereute sie die Frage um ihrer Mutter willen, die allemal mehr Mut bewiesen hatte, zum Leben – und zum Tode.
Yeza versuchte, dem Gespräch eine andere Wendung zu geben.
»Als ich mich zu Euren Füßen warf, woher wusstet Ihr da eigentlich, wer ich bin, dass Ihr mich vor dem Pallavicini in Schutz nahmt?«
»Gegen Oberto nehme ich selbst für des Teufels Großmutter Partei. Doch ich wusste sofort, wen ich vor mir hatte.« Enzio grinste, trat an einen Schrank und winkte sie zu sich. Hinter der Tür hing ein Bild Yezas. Es war eines der Miniaturporträts, die Rinat Le Pulcin von ihr auf Quéribus gefertigt hatte. »Das seid doch Ihr?«
Yeza nickte stumm. Es gab kein Entrinnen. Enzio schien mit seinen Gedanken ganz woanders.
In der Tat überlegte er, ob er Yeza auch das andere Bild zeigen sollte, das der venezianische Maler von ihm angefertigt hatte. Es zeigte ihn in einem Fass, denn so könnte er eines Tages aus der Stadt fliehen, wie ihm Rinat im Scherz zugeredet hatte. Keine Torwache würde auf das Versteck kommen, wenn vom Markt heimkehrende Bauern es an ihnen vorbei trügen. Enzio hatte das Bild oft vor den Augen, wie er da mit seiner blonden Mähne im Fass hockte, die natürlich nicht so verräterisch heraushängen durfte, wie dieser Rinat es spaßeshalber gemalt hatte. Aber die Idee war nicht schlecht. Von ihr wollte er Yeza lieber nichts sagen oder wenigstens jetzt noch nicht.
Yeza ließ sich willenlos von dem Mann aus dem Raum mit den hohen Fenstern führen. Vor der Tür schlossen sich ihnen sogleich die Wachen an, und sie schritten beide die breiten Treppen hinab. Umringt von der Leibwache, die der Rat der Stadt Bologna ihrem prominenten Gefangenen Tag und Nacht stellte – denn es sollte ihm in ihren Mauern kein Leid geschehen, fanatische Messerstecher, aufgehetzte Papisten gab es schließlich überall – trat das seltsame Paar auf die Piazza Maggiore. An diesem zentralen Platz hatte die Commune ihm eigens den prunkvollen Käfig gebaut, zwischen Rathaus, Getreidebörse und Zeughaus gelegen. So hatten sie immer ein Auge auf Re Enzio, der fremden Besuchern vorgewiesen wurde wie ein exotisches Tier.
Auch diesmal richteten sich Hunderte von Augenpaaren, verborgen hinter den Vorhängen der umgebenden Fenster, auf den blonden König. Menschen winkten aus dem Dunkel der Torwege, zogen auch zum Gruß die Mütze, doch viele blieben nur stehen und gafften. Enzio grüßte zerstreut und zog Yeza am Arm mit sich. Er bog hastig in den Pavaglione ein, den Laubengang zwischen San Petronio, der Basilika des Schutzpatrons, und dem Gymnasion, dem ältesten Universitätsgebäude. Unter seinen Arkaden, inmitten der an ihnen vorbeistrebenden oder ehrerbietig Platz machenden Menschen, fand Enzio seine Fröhlichkeit wieder.
»Den festen Vorsatz, in mir den Vater zu sehen, kann dir nur die Prieuré eingeredet haben – wider besseres Wissen.« Er versuchte, Yeza mit seiner Heiterkeit anzustecken, ohne im Geringsten zu bedenken, dass ihr die Frage in einem ganz anderen Licht erscheinen musste.
Yeza erwiderte scharf:
»Wenn das alles ist, war Ihr mir zu sagen habt, ziehe ich vor, Euch nicht anzuhören!«
Enzio besann sich.