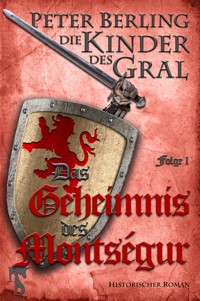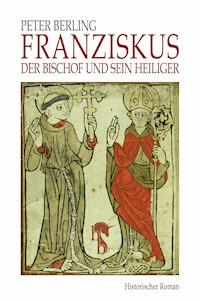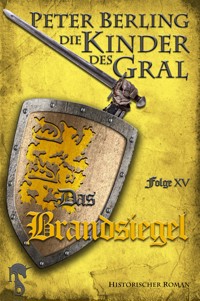6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Peter Berlings spannender Roman über eine ungewöhnliche Frau zur Zeit der Kreuzzüge: Die schöne Laurence wünscht sich insgeheim, Ritter zu werden. Sie glaubt fest daran, eines Tages in die Runde der Gralsritter aufgenommen zu werden. Und das, obwohl sie in einer der seit Menschengedenken turbulentesten und wildesten Epochen voller Gegensätze lebt. Die Hoffnung auf das Paradies ist ein Widerspruch zur unbändigen Machtgier der Menschen. Gläubige Inbrunst, Angst und Schrecken und die Abkehr von der Welt bestimmen das Zeitalter der Kreuzzüge – und auch das Leben von Laurence.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1110
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Peter Berling
Die Ketzerin
Roman
Max und Asta Berling gewidmet NEC SPE NEC METU
Dramatis Personae
Laurence de Belgrave, auch ›Laure-Rouge‹ genannt
Lionel de Belgrave, normannischer Baron, Schlossherr auf Ferouche, ihr Vater
Livia di Septimsoliis-Frangipane, die Mater superior, Äbtissin zu Rom, alias Lady d’Abreyville, ihre Mutter
Esclarmunde de Foix, okzitanische Adelige, ›Hüterin des Gral‹, ihre Patin
Gavin Montbard de Béthune, zukünftiger Tempelritter, ihr Jugendfreund
Chevalier du Mont-Soin alias Jean du Chesne alias John Turnbull alias Stephan of Turnham alias Waldemar Graf von Limburg alias Valdemarius Prior von Saint-Felix, ein Abenteurer
Okzitanien
Pedro II, König von Aragon
Raimond VI, Graf von Toulouse
Ramon-Roger II Trencavel, Vizegraf von Carcassonne, der ›Parsifal‹ der Gralslegende
Aimery de Montréal, Stadtherr von Montréal
Xacbert de Barbeira, Ritter aus dem Roussillon
Peire-Roger de Cab d’Aret, Herr von Las Tours
Roxalba de Cab d’Aret, seine Schwester, Herrin auf Roquefixade, genannt ›Loba die Wölfin‹
Titus, ihr Sohn, der spätere ›Vitus von Viterbo‹
Alazais d’Estrombèze, katalanische Adelige, katharische Perfecta, Herrin von Laroque d’Olmès
Raoul, ihr Sohn, der spätere ›Crean de Bourivan‹
Sicard de Payra, okzitanischer Adeliger, Schlossherr auf L’Hersmort
Belkassem, sein Leibmohr
Maurus (En-Mauri), katharischer Perfectus
Dos y Dos, Patron von ›Quatre Camins‹
Ramon-Drut, der Infant von Foix, ein Bastard
Frankreich
Louis VIII, Kronprinz von Frankreich
Bianca von Kastilien, seine Frau
Claire de Saint-Clair, ihre Hofdame, spätere Großmeisterin der ›Prieuré de Sion‹
Simon de Montfort, Graf von Leicester, militärischer Anführer des ›Kreuzzuges gegen den Gral‹
Alix de Montmorency, aus burgundischem Hochadel, seine Frau
Bouchard de Marly, burgundischer Adeliger, ihr Cousin und Konnetabel
Alain du Roucy, Ritter, Heerführer im Kreuzzug
Florent de Ville, Ritter, sein Waffengefährte
Charles d’Hardouin, im Gefolge des Montfort
Adrien, Baron d’Arpajon, Großgrundbesitzer aus der Ile de France
Rambaud de Robricourt, Großgrundbesitzer aus der Champagne
René de Chatillon, französischer Adeliger aus dem Orléanais
Pierre des Vaux-de-Cernay, Zisterzienserabt und Chronist im Gefolge des Montfort
Patrimonium Petri
Innozenz III, Papst
Rainer di Capoccio, Stadtherr von Viterbo, Generaldiakon der Zisterzienser, ›der Graue Kardinal‹
Roald of Wendower, Zisterzienser, Agent der ›Geheimen Dienste‹ der Kurie
Guido della Porta, Agent der Kurie, Halbbruder von Laurence, der spätere Bischof von Assisi
Arnaud de l’Amaury, Erzabt der Zisterzienser, päpstlicher Legat während des ›Kreuzzuges gegen den Gral‹, Oheim des Simon de Montfort
Peter von Castelnau, Zisterzienser, Missionar und päpstlicher Legat vor dem Kreuzzug Etienne de la Misericorde, ›Dominikaner‹ aus dem Kloster von Fanjeaux
Maître Thédise, Advocatus und päpstlicher Legat nach dem Kreuzzug
Foulques, Bischof von Toulouse, ein ehemaliger Troubadour, später Inquisitor
Reinhald de Senlis, Bischof von Tull
Marie d’Oignies, Begine und Mystikerin, Leiterin eines Lepra-Hospitals
Jacques de Vitry, ihr Beichtvater und Biograph, der spätere Bischof von Akkon
Königreich von Sizilien, Lateinisches Kaiserreich von Konstantinopel
Friedrich II, König von Sizilien, später auch König von Deutschland und Kaiser des Römischen Reiches, genannt ›der Staufer‹
Don Orlando, Benediktiner, sein Magister
Alexios, kretischer Freibeuter im Dienste der Montferrat
Sancie de la Roche, Cousine des Montferrat, Verlobte des René de Chatillon
Anadyomene, Hausdame im Stadtpalais der Montferrat zu Konstantinopel
Lydda, ihre Tochter, Zofe
Michael Marquis de Montferrat, Despotikos von Kreta
Irene di Sturla, die Aulika Pro-epistata, Oberhofmeisterin seines Palastes auf Kreta
Jago Falieri, Venezianer, sein Nauarchos, Admiral der Flotte des Despotikos
Isaak von Myron, Archimandrit von Herakleion, Beichtvater des Despotikos
Angelos, sein stummer Diener, genannt ›der Chorknabe‹, Vorkoster und Henker
Malte Malpiero, Venezianer, Kapitän der Serenissima
Kapitel 1: Das Turnier von Fontenay
Hieb und Stich
Vom Atlantik schoben sich die Gewitterwolken, der Nordwesten war bereits dunkel gefärbt. Die ersten Windböen ließen die Fähnlein am Ende des Feldes und die Girlanden über der Damentribüne stoßweise aufflattern. Hin und wieder erklang mühsam gezügeltes Kichern und Gelächter. Die beiden Ritter hatten ihre Turnierlanzen bereits an sich genommen, der Herold verkündete die Namen der Kontrahenten.
»Der edle Gavin Montbard de Béthune!« Er wies zur Linken, wo ein von der Statur her noch recht jugendlich wirkender Kämpe, das Visier bereits geschlossen, gemächlich dem Kopfende der Kampfbahn zustrebte, ohne sich um die Ansage zu kümmern.
»Der edle Charles d’Hardouin!«, rief der Herold den anderen aus. Der schien eher von trauriger Gestalt, als er sich ungelenk, wenn auch nicht ohne Eitelkeit, in Richtung der Damen verbeugte, zweimal, dreimal, bevor er eilfertig zum entgegengesetzten Ende des Platzes trabte.
Beide Reiter wendeten nahezu gleichzeitig und legten ihre Lanzen ein. Das Hornsignal ertönte. Von der Tribüne drangen vereinzelte Anfeuerungsrufe verweht zu den Rittern herüber, die jetzt ihren Gäulen die Sporen gaben. Schwerfällig setzten die sich mit der rasselnden Last in Bewegung und fielen aus Gewohnheit bald in schnellen Trab. Wie an unsichtbaren Tauen gezogen, rumpelten sie aufeinander zu. D’Hardouin nahm den Schild hoch und duckte seinen Helm dahinter, während seine Lanze ordentlich über den Schädel seines Pferdes hinweg auf den Brustkürass des Gegners zielte. Da ließ der junge Gavin die Zügel schießen, zog seinen Schild zur Seite und verschränkte die Lanze hinter dem Hals seines Tieres. Der Stoß von d’Hardouin ging ins Leere. Es warf ihn fast vornüber, so dass er eine Lanze fallen lassen musste, um sich gerade noch mit beiden Händen an der Mähne festzuhalten. Der Junge war dem vermuteten gegnerischen Angriff geschickt ausgewichen, wodurch er seinerseits darauf verzichtete, den Gegner im Nachschlag aus dem Sattel zu wischen. So flogen sie aneinander vorbei. Der Herold blies zweimal: unentschieden.
Dem Herrn d’Hardouin wurde die Lanze von den Knechten nachgetragen. Wieder begaben sich beide Kämpfer an den jeweiligen Ausgangspunkt. Dabei mussten sie den Stand des Kampfrichters passieren, der den festen Sitz der hölzernen Krönlein an der Spitze der Stangen kontrollierte. Da beide bislang auf keinen Widerstand gestoßen waren, hatten sich die aufgesetzten stumpfen Enden auch nicht gelockert. Sie wechselten kein Wort. Gavin lüftete auch diesmal nicht sein Visier, während Herr d’Hardouin sich missgelaunt frische Luft zufächelte. Er hatte trotz des Remis eindeutig die schlechtere Figur gemacht. Also sann er auf Revanche, während er an der Stirnseite der Bahn auf seinen Platz zuritt. Wenn dieses ungehobelte Bürschlein die klassischen Regeln eines Tjostes missachtete – oder wahrscheinlich gar nicht kannte –, würde er es ihm mit gleicher Münze heimzahlen. Bei der Wende wechselte er blitzschnell die Stange in die Linke, seine starke Hand. Zur Tarnung seines Manövers ließ er den Schild am gleichen Arm. Diesmal ritt er schnell los, denn er baute auf Überraschung, die dem Gegner keine Zeit ließe, sich auf die ungewöhnliche Konfrontation einzustellen.
Der Junge kam ihm sorglos entgegengeprescht, allerdings im gestreckten Galopp, die Lanze wieder völlig unorthodox schräg über den Pferdehals geführt, wie es nur Linkshänder vermögen. Jetzt würde es nur auf den besseren Stoß ankommen und den festeren Sitz im Sattel, frohlockte d’Hardouin. Da sah er mit Entsetzen, dass Gavin seine Stange gar nicht eingelegt hatte, sondern locker in der Hand hielt, sie hoch vor sich aufrichtete und genau in dem Moment in die Rechte gleiten ließ, als d’Hardouin an der Flanke völlig ungeschützt auf ihn zukam. Die Lanze fiel ihn von oben an wie der Habicht das Huhn. Sie fuhr ihm über die Brust in die Armbeuge, bevor seine eigene Lanze auch nur den Schild des anderen hatte touchieren können. Der Schmerz war schon im Ansatz so ekelhaft, dass sich d’Hardouin freiwillig vom Pferd warf, um weiterer Pein zu entgehen. Dabei stürzte er mit dem Oberarm auf den eigenen Schild, was ihm zusätzlich blaue Flecken einbrachte. Das Schlimmste aber war das schallende Gelächter, das ihm jetzt von der Damentribüne entgegenbrandete. Ausgerechnet direkt davor war er zu Fall gekommen! Er selbst hatte die Innenbahn gewählt.
Als sich d’Hardouin mit Hilfe der Knechte aufgerichtet hatte und zu seinem Zelt humpelte, war sein jugendlicher Gegner schon entschwunden. So entging ihm, dass Gavin spornstreichs und ohne abzusteigen in das Zelt des Herrn Lionel de Belgrave geritten war. Es lag abseits von den anderen, denn sein Besitzer war keineswegs angereist, um am bohurt teilzunehmen, sondern um seine Tochter Laurence unter die Haube zu bringen.
Beim Einritt in das Zelt musste der Ritter sein Haupt beugen, um nicht anzustoßen. Kaum war die Plane hinter ihm wieder zugeschlagen, riss er sich den Helm vom Kopf: Langes kupferrotes Haar flutete über die stählernen Ailletten auf seine schmächtigen Schultern. Der Ritter war ein Mädchen!
Laurence sprang ab. Ihr schmales Gesicht glühte vor Stolz über den, wenn auch trickreich, bestandenen Tjost. Schuldbewusst näherte sie sich dem Jungen, der trotzig mit ihr zugewandtem Rücken am Zeltmast stand. Er umschlang ihn mit beiden Armen. Laurence schritt um ihn herum. Seine Hände waren an den Handgelenken so verknotet, dass er die Fesselung allein unmöglich lösen konnte.
»Ihr habt es nicht glauben wollen, Gavin«, sagte sie mit rauer, Verzeihung heischender Stimme, als sie sein finsteres Gesicht sah. »Ein Ritter muss eine Wette auch mit Anstand verlieren können. Es gibt eben Knoten –«
»Weiberkram!«, grollte Gavin. Er mochte ein Jahr jünger sein als Laurence, ein stämmiger, muskulöser Typ. »Wer sich mit Euch Netzweberinnen einlässt –«
»– hat nur verloren, wenn er beim Schlingen des Stricks voller Hochmut die Augen verdreht, statt hinzuschauen!« Sie löste den Knoten mit zwei schnellen Griffen, und das Tau fiel zu Boden. Gavin umarmte jedoch weiterhin den Baum und presste ihn zornig an sich.
»Mit scharfem Schnitt«, keuchte er, »zerhaut ein wahrer Ritter solch Gespinst von Frauenhand.«
»Das war die Wette nicht«, hielt ihm Laurence entgegen. Sie löste das Schwertgehänge von ihrer Hüfte und hielt es dem Verärgerten spöttisch hin.
Gavin riss es ihr aus der Hand. »Die Wette war auch nicht, dass Ihr an meiner Stelle in die Schranken reitet.«
»Ich hab’ Euch keine Schande bereitet, Gavin«, Laurence schnallte erst die Armkacheln, dann die Diechlinge von ihren Beinen ab. »Der jüngste Teilnehmer dieses Turniers hat den erfahrenen Kämpen Charles d’Hardouin hinter die Kruppe seines Gauls gesetzt. Alle haben herzlich gelacht.«
»Ich finde das gar nicht zum Lachen, Laurence«, entgegnete der Junge. »Wie ich Euch kenne, habt Ihr mir keine Ehre eingelegt, sondern mit Euren üblen Wikingertricks einen schmählichen Sieg davongetragen.« Gavin brachte das jetzt derart ernsthaft, fast väterlich besorgt vor, dass Laurence ihre lange, gerade Normannennase schuldbewusst senkte, schon damit er nicht in ihren grauen Augen den Schalk erblickte. Nur mühsam konnte sie ihre aufsteigende Heiterkeit unterdrücken. »Ihr wisst genau, welchem Orden anzugehören mein einziges Ziel –«
»Die Ehre der Templer wurde nicht angetastet, Gavin Montbard de Béthune. Darauf habt Ihr mein Wort als Gralsritter.« Laurence glaubte, ihm damit völlige Genugtuung geleistet zu haben.
Das erschien Gavin erst recht lächerlich. »Ihr glaubt immer noch, dass ein Mädchen es mit Kühnheit, Unverfrorenheit, dreister Täuschung und hemmungsloser Abenteuersucht zu solchen Würden bringen kann?«, schnaubte er. »König Artus würde Euch der Tafelrunde verweisen, bevor Ihr auch nur –«
»Das werden wir ja sehen!« Laurence sprühte Feuer, Funken glommen in ihren Augen, sie warf ihre rote Mähne ärgerlich nach hinten. »Gegen Eure arroganten Templeisen besteh’ ich allemal! Wollt Ihr gegen mich antreten, gleich auf der Stelle?!«
Sie wusste, er wusste, sie meinten es beide nicht so. Diese Art von Streit hatte sie ihre ganze Kindheit hindurch begleitet, in der Gavin, ein Vollwaise, immer wieder aufgetaucht war. Sie waren weitläufig verwandt und schätzten einander sehr. Jetzt aber war ihr Disput nicht mehr das spielerische Necken der früheren Jahre. Beide begannen ihre eigenen Wege zu gehen, so versponnen die jeweiligen Erfolgsaussichten dem anderen auch erscheinen mussten.
»Auf diesem Turnier Ruhm zu ernten«, grollte der angehende Ritter des Templerordens, »das habt Ihr mir gründlich versaut. Einen weiteren Tjost wird man dem unbekannten Rüpel nicht zugestehen. Ich danke Euch, werte Damna.«
»Es wird ohnehin nicht zu einem weiteren Stechen kommen –« Tröstend legte Laurence den Arm um den Gefährten und wies hinauf zum Zeltdach, gegen das jetzt die ersten Tropfen klopften.
»Auch noch Herrin über das Wetter!?«, höhnte Gavin, riss sich los und stürmte aus dem Zelt.
Einer Brandfackel gleich leuchtete die feuerrote Haarpracht des jungen Weibes vom Söller gegen den sich nachtschwarz verfärbenden Himmel. Laurence de Belgrave sah mit Wohlbehagen dem herannahenden Sturm entgegen. Unter ihr lag die Turnierwiese mit dem großen weißen Segel aus Zeltbahnen, das die Ehrentribüne vor misslichen Sonnenstrahlen hatte schützen sollen. Jetzt griffen die ersten Böen dem offenen Pavillon unter den flatternden Rock, zausten an den Girlanden und ließen die Fähnlein knattern. Mit spitzen Schreien spritzten die geladenen Damen wie aufgescheuchte Hühner aus dem unsicher gewordenen Kokon, dessen Tuch sich wand und blähte und an den Seilen zerrte. Mit gerafften Roben, gestützt von ihren Zofen, sprangen, staksten und stolperten sie gackernd in Richtung Burgtor. Die Herren Ritter rannten ihrerseits wie die Hasen, um die Pferde und ihr kostbares Rüstzeug in Sicherheit zu bringen. Sie brüllten ihre Knappen an, was aber vom tosenden Wind verschluckt wurde.
Der Turm, auf dem Laurence dem Unwetter zu trotzen gedachte, gehörte zum Vorwerk der Burg von Fontenay, eine zinnenlose barbicane. Sie hatte sich hierher begeben, nicht um des besseren Blicks auf den Festplatz willen, dessen Schranken von hier aus gut einzusehen waren, sondern weil sie hoffte, dass die smaragdgrünen Augen des jungen Chatillon sie hier oben erspähen würden. Laurence hatte sich den anmutigen René zu ihrem Ritter erwählt. Als der knappe Blick aus seinen Zauberaugen unter samtenen dunklen Wimpern ihr wie ein Blitz in den züchtigen Busenansatz gefahren war, hatte es Laurence den Atem abgeschnürt. Und mit zum Halse klopfenden Herzen hatte sie ihm da ihr Tüchlein zugeworfen.
Laurence war stolze fünfzehn. Sie lebte allein mit ihrem Vater Lionel und hatte bislang nur den König Richard Löwenherz geliebt. Der aber war vor fünf Jahren so furchtbar traurig zu Tode gekommen, dass sie eigentlich nur noch den Ausweg sah, ins Kloster zu gehen. Lediglich die Tatsache, dass ihre leibliche Mutter einem solchen im fernen Rom als Äbtissin vorstand, hatte sie davon abgehalten. Laurence hatte Schwierigkeiten mit der energischen Dame, die nur selten zu Besuch kam und sich wenig um sie kümmerte. Eine solche Rabenmutter wollte sie nicht werden. Dass die Äbtissin begierig das spontane Begehren ihres Töchterchens aufgegriffen hatte, aus Trauer um Richard den Schleier zu nehmen, hatte prompt den Trotz des jungen Mädchens ausgelöst. Vehement verleugnete Laurence von Stund’ an den toten Löwenherz. Gleichzeitig schmähte sie das trübe Schicksal aller Nonnen: Ihrer Meinung nach suchten diese hinter den Mauern eines Konvents nur aus Feigheit Zuflucht, aus Feigheit, dem wahren Leben die Stirn zu bieten. Laurence aber wollte ihren Mann stehen, so werden wie ihr Vater oder – insgeheim – so wie der Löwenherz: ein Ritter eben, ohne Furcht und Tadel.
Die ersten Tropfen fielen. Die Windstöße zerrten immer heftiger am linnenweißen Segel des Tribünendachs. An einer Seite hatte es sich bereits losgerissen. Vor dem blauschwarzen Dunkel, das den gesamten Himmel erobert hatte, stieg es, wild um sich schlagend, über die Masten des Zeltes hinauf, blähte sich, um dann wie angestochen in sich zusammenzufallen. Laurence brachte es ein Bild ihrer Kindheit in den Sinn, als sie mit ihrem Vater auf einer Fahrt über den Ärmelkanal in einen Sturm geraten war. Dabei sah sie nicht Lionel das Ruder führen. Sie selbst steuerte aufrecht und mit bannergleich wehendem Haar den stampfenden Kahn durch die Wogen und bot jedem Brecher kühn die Stirn. So hätte dieser grässliche Chatillon sie erleben sollen! Er hatte nicht einmal hingeschaut, als sie das Pferdegesicht des Charles d’Hardouin hinter den Sattel setzte. Weswegen sollte er auch? Warum konnte eine Frau sich nicht offen im Tjost messen, wo es mehr auf Geschick denn auf rohe Kraft ankam? Reiten konnte sie sicher besser als die meisten, die hier den Sattel drückten und ihre Gäule nur mit den Sporen anzutreiben wussten.
René war natürlich eine Ausnahme. Er machte auch zu Pferd eine blendende Figur und war nicht nur der ungekürte Held des Turniers, sondern leider auch der Favorit aller Damen auf der Tribüne. Der Schuft! Nicht einmal jetzt sah er zu ihr auf, als er in langen Sprüngen dem Burgtor zustrebte. Dabei hatte er seinen seidenbestickten Umhang wie ein Weib zum Schutz über den Kopf geschlagen und war nur darauf bedacht, den Pfützen auszuweichen und sich die Haare nicht nass zu machen. Laurence schüttelte verächtlich ihre Mähne. Wenn da nur nicht diese verdammten grün schimmernden Augensterne gewesen wären, deren verführerisches Gleißen sich in ihr Hirn gebrannt hatte! Zum Teufel und dreimal gepupst! Das ließ sie sich nicht bieten. Der Kerl hatte ihr Tüchlein eingesteckt, und auf den Knien sollte er es ihr zurückerstatten!
Inzwischen prasselte der Regen auf Laurence ein. Auf der von Pferdehufen aufgewühlten Wiese, die sich zusehends in Morast verwandelte, hielten nur noch zwei in Kutten gehüllte Gestalten aus. Sie versuchten, einen Planwagen aus dem Schlamm zu ziehen. Die Zugpferde waren von den Stallburschen längst ausgespannt und weggeführt worden. Die sich da stemmend und schiebend mühten, waren keine Ritter, sondern Mönche im härenen Habit von Wanderpredigern.
Der ältere hatte sich der ritterlichen Gesellschaft als päpstlicher Legat vorgestellt. Dass er mit dem Blick eines traurigen Hirtenhundes die noblen Herren zum Kreuzzugsgelübde auffordern wollte, hatte Laurence amüsiert. Selbst das junge Fräulein de Belgrave aus dem Yvelines hatte mittlerweile begriffen, dass diejenigen, denen an solch frommen Unternehmen lag, längst dorthin gezogen waren, wo zwar keine rechte Ehre, dafür aber reiche Pfründe und fette Beute winkten: ins ferne Konstantinopel. Das war allerdings eine christliche Stadt, soweit Laurence bekannt war, und so wollte auch keiner der verbliebenen adeligen Burschen, die sich hier dies Stelldichein gaben, so recht auf das Angebot eingehen, nicht einmal bei ›Vergebung aller Sünden‹. Der wahre Grund lag jedoch nicht in frommen Skrupeln. Das byzantinische Fell, hieß es, sei schon verteilt, zerstückelt gleich einem Flickenrock, wie ihn das fahrende Volk trug.
Laurence wusste wenig von dem berüchtigten Kreuzzug gegen Byzanz, obgleich ihr alle märchenhaften Schilderungen dieser prächtigen Stadt am Bosporus, kühner Vorposten des christlichen Abendlandes gegen einen fremden, rätselhaften Orient, im Kopf herumgingen. Als mutiger Ritter dorthin zu ziehen – das wäre ein lohnendes Ziel! Laurence träumte im Regen. Sie achtete nicht auf die Nässe, die ihr Kleid an der Haut kleben ließ und dabei ihre ranke Gestalt und ihre straffen, runden Brüste verräterisch zur gefälligen, ja provozierenden Geltung brachte. Sie sah sich in eine schimmernde Rüstung gehüllt und mit offenem Visier dem großen Abenteuer entgegen reiten. Der jüngere Ordensbruder, wohl noch ein Novize, hatte sich den fast gleichaltrigen René vorgeknöpft. Laurence hatte seinen Namen vergessen, sein wölfisches Gesicht gefiel ihr nicht. Als wolle er unter den Augen seines Vorgesetzten sein Gesellenstück abliefern, hatte er René mit großem Geschick bearbeitet. Laurence wusste nicht, ob sie die haarspalterische Eloquenz des windigen Predigers bewundern oder sich ärgern sollte, dass er René derart mit Beschlag belegte. Und das war auch der Grund, weshalb sie sich halb schmollend, halb lockend auf den Turm zurückgezogen hatte: Eine andere wäre stolz auf ihren Ritter gewesen, als René endlich sein Knie beugte und das Kreuz nahm. Laurence war wütend gewesen. Vor ihr hätte der schöne René knien sollen, um minniglich Huld zu erbitten, die sie ihm sicher gewährt hätte.
Dann aber war das Gewitter dazwischengekommen. Sie stand im Regen, und der Chatillon hatte sie vergessen. Tränen des Zorns wären ihr in die Augen geschossen, wenn es sich noch gelohnt hätte. Stattdessen rannen Regentropfen aus klatschnassem, strähnigem Haar über ihr Gesicht. Selbst die beiden Mönche hatten ihre Bemühungen um den feststeckenden Karren aufgegeben und stapften als Letzte über die Wiese, ohne zu der Gestalt auf dem Söller aufzuschauen.
Ein kräftiger Männerarm legte sich um Laurence’ Schultern. »Du wirst dir den Tod holen, Füchslein«, brummte mit rauer Zärtlichkeit Lionel de Belgrave, »und der Klopfer hockt längst im warmen Loch.«
Er führte seine vor Zorn und Kälte bebende Tochter behutsam zum Einstieg in die gewendelte Treppe. Laurence nahm dankbar den festen Griff in Kauf, gegen den sie sich sonst gewehrt hätte. Sie wusste genau, weswegen ihr Vater sie auf dieses Turnier mitgenommen hatte: weniger, um sie in die höfische Gesellschaft einzuführen, als vielmehr, um sie baldmöglichst an den Mann zu bringen.
Der dämmerige Saal im Innern der bescheidenen, fast kargen Burg wurde nur an seiner Stirnseite durch das flackernde Kaminfeuer erhellt, das die Diener in aller Hast mitten im Sommer angefacht hatten. Die hohen, schmalen Fenster waren mit Decken und Tüchern gegen die stürmischen Regenschauer verhängt. Lionel de Belgrave schob seine Tochter in die Nähe des Feuers, das wohltuende Hitze ausstrahlte. Nur widerwillig begab sie sich in dessen Lichtkreis. Sicher sah sie aus wie eine nasse Katze. Keiner der edlen Herren, die hier mit langgestreckten Beinen ihre von den Stiefeln befreiten Füße erwärmten, würde so um ihre Hand anhalten. Das geschah ihrem Alten grad recht!
Laurence kauerte sich abseits. Sie schlug den Blick nieder, als sie ihren René unter den sich herumlümmelnden Burschen entdeckte, die blöde Witze rissen. Und wie sie stanken! Laurence warf ihr von der Nässe kastaniendunkles Haar nach vorn, dass es ihr Gesicht wie hinter einem Vorhang verbarg. Während sie die arg verfilzten Strähnen mit den Fingern kämmte, konnte sie durch die Ritzen ihr treulos’ Lieb im Auge behalten. Die anderen Söhne von Geblüt, die ihre schlanke Gestalt zwischen frech hingeworfenen Scherzworten mit gierigen Blicken verschlangen, ließen Laurence kalt, reizten sie höchstens zum Gähnen. Vater Lionel hatte sie ihr mit Namen vorgestellt: Der verschlagene Finsterling in der Mitte war ein Schwestersohn des Grafen von Montfort, dem Lionel de Belgrave als Lehnsmann diente. Daneben hockte mit seinem Pferdegesicht samt hervorstehenden Zähnen der junge Charles d’Hardouin, dessen Oheim zu den erfolgreichen Eroberern von Konstantinopel gehörte – ›ein schändliches Unternehmen‹, für das die beiden verdreckten Mönche, die jetzt eintraten, weiteren Nachschub an Wehrwilligen zu rekrutieren suchten. ›Eine Schande für das gesamte christliche Abendland!‹, hatte ihr Vater die Eroberung und Plünderung der reichen Stadt am Goldenen Horn genannt. Er sei stolz darauf, hatte Lionel hinzugefügt, dass sein Graf, der Herr Simon von Montfort, als Einziger diesem Kreuzzug brüsk den Rücken gekehrt hätte. ›Nicht die Rettung des Heiligen Landes war ihr Ziel, sondern billige Beute am Bosporus.‹
Diese harsche Kritik ihres geliebten Vaters hatte Laurence schon immer verwirrt, denn sie hielt die Teilnahme an jedem Kreuzzug für eine durchaus erstrebenswerte und ehrenvolle Aufgabe, der sich ein christlicher Ritter mit Eifer und Wonne unterziehen sollte. Ihre Zweifel an der Sichtweise ihres Vaters wurden jetzt noch bestärkt, als der päpstliche Legat, diesmal im eifernden Tonfall des geübten Missionars, erneut begann, ›des Heiligen Vaters Herzensangelegenheit‹ vorzubringen.
»Hundert Jahre! Hundert Jahre!«, rief er mit bellender Stimme, während er sich den Weg zum Kaminfeuer bahnte. Sein Adlatus stieg hinter ihm her über die gestreckten Beine der jungen Adeligen. Die dort kauernde Laurence beachtete er nicht. »Hundert Jahre hat es Byzanz, die große Hure Babylon, verstanden, die Mühen, die Entsagungen, die Blutopfer unserer Züge ins Heilige Land um ihren verdienten Erfolg zu bringen, indem es die christlichen Streiter im Zeichen des Kreuzes blockierte, misshandelte, erpresste.« Er holte Atem und beobachtete die Wirkung seiner Rede auf die Burschen. Diese zogen zögerlich ihre nackten Beine ein, vermieden es jedoch, dem Prediger ins Auge zu sehen.
Nur der grimme Montfort ließ sich zu einem Einwand herbei. Eingeleitet von einem Furz, was sogleich die Lacher auf seine Seite brachte, rief er laut genug: »Was lässt sich die Kirche auch mit Kebsen ein?«
Der Herr Legat schluckte die hässliche Kröte. Tapfer fuhr er fort: »Und hinter dem Rücken der Schwertkämpfer Gottes«, auch ein weiterer Lippenfurz, diesmal von d’Hardouin, sollte ihn nicht wanken machen, »mit wem verbündeten sich diese schismatischen Griechen?« Als geschulter Missionar ließ er die Pause nach der suggestiven Frage auf der Zunge zergehen wie eine honiggetränkte Oblate. »Mit den heidnischen Türken, den muslimischen Erzfeinden Jesu Christi, unseres Heilands!«
»Amen«, sagte der Montfort. »Was ist bitte ›schissmanzig‹?!« Er blickte sich, Aufklärung heischend, unter seinen Kumpanen um. »Dass die Byzantiner Knoblauch fressen und aus dem Maul stinken, wissen wir. Oder ist es ein giftigeres Übel, das aufs Gedärm schlägt – gar den Specht tropfen lässt wie beim Umgang mit willigen Weibern wie dieser Babylon?«
Nicht die aufbrausende, ungezügelte Heiterkeit, untermischt mit vulgären Lauten aller Art, ließ den Legaten verstummen, sondern die Einsicht, hier vergeblich gegen massierte Dummheit anzurennen. Am liebsten hätte er jetzt einfach die Hosen heruntergelassen und den blöden Burschen sein nacktes Gesäß gewiesen. Wer weiß, was dann passiert wäre! Er warf einen hilflosen Blick zu seinem Adlatus, der nur darauf gewartet zu haben schien. Wie der Pfeil von der Sehne schnellte der Novize los und sprang vor die Rüpel.
»Favete nunc linguis!« Er schnaufte vor Erregung und wäre Laurence fast auf die Füße getreten. Die Anwesenheit eines jungen Weibes so ganz in seiner Nähe, in seinem Rücken, verwirrte ihn, doch sie erwies sich auch als sein Strohhalm.
»Zügelt Eure Zunge in Gegenwart einer Dame!«, fauchte er den verdatterten d’Hardouin an. »Dann will ich Euch verraten, was es mit dem ›Schisma‹ auf sich hat.« Seine rüde Art bewirkte zumindest, dass Schweigen eintrat. »Als vor 150 Jahren Ostrom«, hob der Novize an, »den Gipfel weltlicher Macht erklomm, wollte es auch der Patriarch von Konstantinopel seinem Kaiser gleichtun und dünkte sich dem Heiligen Vater auf dem Thron des Fischers ebenbürtig. Aus seinem frevelhaften Trotz entstand die ›griechisch-orthodoxe‹ Kirche –«
»Das ist ›die große Hure Babylon‹«, fiel ihm der Legat geifernd in die Rede. »Sie musste vernichtet werden. Nur über ihre Leiche wird der Weg frei nach Jerusalem! Doch warm noch ist der Schoß, aus dem des Schismas Unheil kroch. Noch können dem byzantinischen Drachen neue Köpfe wachsen, und deshalb suchen wir Streiter des Herrn, die dem neuen, dem ›Lateinischen Kaiser von Konstantinopel‹ bei seiner schweren Aufgabe zur Hand gehen!« Der Legat suchte den Blickkontakt mit den Adeligen in der ersten Reihe. Nur René lächelte ihm zu. Er trug ja bereits voller Stolz das ihm angeheftete Stoffkreuz auf der Brust seines Wamses.
»Wieso ›lateinischer‹ Kaiser?« Auch der d’Hardouin glaubte, sich jetzt dumm stellen zu dürfen, doch der Novize nahm den Einwand dankbar auf.
»Um den Gegensatz und die Errungenschaft deutlich zu machen: Die Einnahme Konstantinopels bedeutete auch und vor allem den Triumph der alleinseligmachenden Ecclesia catholica romana, und zwar nicht nur dort, am Bosporus, sondern insbesondere in der terra sancta, wo diese verräterischen Griechen –«
»Und warum zieht jetzt keiner weiter, um das Heilige Jerusalem zu befreien?« Der Montfort hatte dem Legaten diesen Einwand entgegengezischt und gab die Antwort gleich selbst: »Weil sie auf das Grab des Herrn scheißen.«
Der Vertreter des Papstes wich erschrocken zurück, wobei er Laurence auf den Fuß trat.
»Blöder Bock!«, fluchte diese vernehmlich. Das Pferdegebiss des d’Hardouin öffnete sich zum schallenden Lacher. Aber auch René hatte feixend zu ihr hinüber geschaut.
»Sie suhlen sich im Pfuhl der alten Vettel Babylon, verteilen ihr Hurengewand, streiten sich um jeden Fetzen, als sei’s die Reliquie einer Heiligen«, höhnte der Montfort, ohne sich sonderlich zu erregen, »und denken gar nicht daran, überzusetzen nach Asia Minor, um unter Entbehrungen und Blutopfern – wie unsere Vorfahren – Jerusalem zu gewinnen, das himmlische Ziel.« Der finstere Montfort gewann in den Augen Laurence’ an Sympathie, aber nur kurz. »Da wäre ich dabei. Aber so?«
Der Montfort wartete nicht lange genug, um dem empörten Legaten die Gelegenheit zu einer Antwort zu geben. Mit einem »Drauf geschissen!«, brachte er seine Meinung bündig zum Abschluss.
Dadurch fühlte sich René de Chatillon gefordert. Er schnellte hoch wie eine Feder. »Das nehmt Ihr zurück!«, forderte der schöne Knabe aufgebracht. Laurence war stolz auf ihn und gleichzeitig besorgt.
»Wie denn?«, wieherte Charles d’Hardouin. »Wie denn?«
»Das lass’ ich nicht auf mir sitzen. Nicht von einem Montfort!«
»Zieht’s Euch nicht an, wenn’s Euch nicht passt, Chatillon.«
»Der edle Herr René hat das Kreuz genommen –«, mischte sich schnell wieder der Novize ein. Wäre er nicht von so schlaffer Fettleibigkeit gewesen, so hätte er unangenehm an einen Schakal erinnert, allein schon durch seine Bewegungen, fahrig wechselnd zwischen Gier und lauernder Vorsicht. »– sichtbares Symbol eines gottgewollten Kreuzzuges, gesegnet von unserem Heiligen Vater, dem Pontifex maximus.«
Laurence empfand seine geduckte Nähe als ekelig. Wäre er ihr auf die Füße gestiegen, so hätte sie ihm einen Tritt gegeben. Andererseits vertrat ausgerechnet dieser Novize die gerechte Sache ihres Ritters, die sie auch zu der ihren gemacht hätte.
»Das Kreuz des Leidens Jesu Christi, Zeichen seines Opfers und unseres bescheidenen Dienstes an seiner Sache –«
»Haha!«, prustete Charles d’Hardouin los. »Unser hübscher René kennt doch nur den Minnedienst, er hält sich gar für einen geschätzten Troubadour und begabten Verseschmied!«
»Wenn der Herr das Schwert handhabt wie seine Laute«, hämte der Montfort, »dann mag es schon sein, dass die Heiden Reißaus nehmen!«
Das schöne Gesicht des Chatillon war schneeweiß geworden, Laurence hielt den Atem an. Da ihr Ritter schon stand, bedurfte es nur noch des Griffs zur Waffe. Renés Hand zuckte. Er war sich nur nicht sicher, welchen der beiden Rüpel er vor seine Klinge fordern sollte. »Das sollt Ihr mir bezahlen!«, stieß er mutig hervor.
Der d’Hardouin räkelte sich lässig aus seinem Sitz. Er stützte sich mit der Hand auf des Montfort Schulter ab, diesen somit niederhaltend. »Wie viel darf’s denn sein?«, fragte er spöttelnd und griff nach einem Schürhaken. René riss sein Schwert aus der Scheide und stieß die beiden Mönche zur Seite; denn der stämmige Legat war zwischen die Streithähne getreten. Sein Adlatus verdrückte sich sofort. Laurence verspürte Lust, ihm ein Bein zu stellen.
In diesem Moment entstand Unruhe im hinteren Teil des Saales. René ließ sein Schwert sinken, während Charles d’Hardouin grinsend sein Pferdegebiss entblößte. Mit seinem Eisen peitschte er die Luft, als nähme er die seinem Gegner zugedachte Behandlung vorweg.
»Was geht hier vor, Roald of Wendower?«, ertönte eine Frauenstimme im Tonfall des okzitanischen Südens. Der Novize zuckte erschrocken zusammen, und verblüfft war auch Laurence. So konnte nur Esclarmunde, Gräfin von Foix, auftreten – ihre Patentante. Eine teure Freundin ihrer Mutter und, wie man munkelte, eine gewaltige Ketzerin vor dem Herrn. Laurence wandte den Blick ab von ihrem Ritter und verbarg sich nicht länger hinter ihrem nassen Haar.
René schob mit einem überlegenen Lächeln sein Schwert in die Scheide und sah der Gräfin herausfordernd entgegen. »Der Mönch meinte, hochverehrte fremde Dame, die Ehre eines Chatillon verteidigen zu müssen. Eines Geschlechts, das zu seinem Ruhm die Geschichte des Heiligen Landes und seines Königreiches schrieb.«
Reden kann mein Ritter, dachte Laurence und bewunderte ihn nun wieder sehr. »Und was den rechten Glauben gar betrifft«, fuhr ihr kühner René fort, »können wir Chatillons den heiligen Bernhard vorweisen. Eine solche Vergangenheit verpflichtet. Deshalb nahm ich das Kreuz und bin stolz darauf.«
Dem d’Hardouin hatte der Auftritt die Sprache verschlagen. Ehe er mit seinem Gefuchtel Unheil anrichten konnte, zog ihn sein Gefährte am Ärmel auf seinen Stuhl zurück. Laurence erhob sich, um ihre Patin zu begrüßen. Den beiden sich schon wieder lümmelnden Rittern bedeutete sie mit herrischer Handbewegung, ihre Plätze für den überraschenden Besuch zu räumen.
Esclarmunde de Foix hatte eine straffe, fast noch jugendlich zu nennende Figur. Ihr Silberhaar machte es einem schwer, ihr Alter zu schätzen. Obwohl die Folgen eines Reitunfalls sie behinderten, wirkte sie keineswegs gebrechlich. Die Gräfin stützte sich beim Vorwärtsschreiten auf zwei Herren. Der eine war Gavin, dem Laurence nicht ansah, ob er ihr verziehen hatte, der andere ihr Vater Lionel, der aus seiner Laune keinen Hehl machte.
»Hier, werte N’Esclarmunde«, begann der Belgrave mit gepresster Stimme. Laurence, die ihn kannte, hörte seinen Ärger oder zumindest Unmut über den unerwarteten Besuch heraus, »seht Ihr die Blüte Frankreichs versammelt, vielmehr jene Sprösslinge, die es noch nicht ins Land der Griechen gezogen hat –«
Hier unterbrach ihn schroff der junge Montfort: »Es steht Euch als unserem Lehnsmann nicht an, Lionel de Belgrave«, stieß er finster hervor, »darüber zu befinden, wo ich mich aufhalte oder nicht. Komm, Karlemann, wir gehen.« Die beiden drängten sich seitlich durch die Menge, vermieden so den Zusammenstoß mit den Neuankömmlingen und verließen den Raum.
»So bleibt uns doch«, ließ sich Esclarmunde vernehmen, während sie auf einem der freigewordenen Sitze Platz nahm und René huldvoll zu sich winkte, »die köstliche Knospe aus dem Hause derer von Chatillon, zu dessen ruhmreichen Vorfahren tatsächlich Bernhard von Clairvaux zählt. Was aber das so viel gerühmte Wirken des ›Doktor Honigsüß‹ anbelangt, so mag über dessen Früchte die Christenheit dereinst entscheiden, wenn sie endgültig aus dem Heiligen Land ins Meer gejagt worden ist. Die Plünderung und Schändung von Byzanz ist nur ein weiterer Hüpfer der purpurnen Kröte in diese Richtung. Sei’s drum.«
Jetzt war es jedoch nicht der verwirrte René, der empört protestierte, sondern der ältere Zisterziensermönch, der im Rang eines päpstlichen Legaten stand: »Es steht Euch ebenso wenig an, Madame, die Kirche, ihre Heiligen und unseren Herrn Papst zu schmähen, schon gar nicht auf dem Boden des katholischen Frankreich. Ihr seid eine Ketzerin, und Ihr werdet noch von mir hören.« Damit stürmte er mit hochrotem Kopf aus dem Saal, ohne sich um seinen Adlatus zu kümmern. Der machte seinerseits keine Anstalten, seinem Meister zu folgen, sondern drückte sich in die Ecke, gebeugt und für alle sichtbar ins Gebet vertieft.
Esclarmunde de Foix sah sich triumphierend um. »Der kleine Regenguss ist vorüber«, verkündete sie launig. »Nichts hindert die Herren Ritter daran, ihr Hauen und Stechen auf der grünen Wiese wieder aufzunehmen. Die Tüchlein der Damen warten schon auf ihre Helden.«
Die meisten folgten dieser unmissverständlichen Aufforderung, denn es setzte ein Geschiebe und Getrappel ein. Laurence umarmte artig ihre berühmte Patin, was das Interesse der noch im Raum Verbliebenen auf sich zog. Als Roald of Wendower merkte, dass keiner ihn beachtete, trat er schnell hinter einen Vorhang. Da sie den Novizen nicht mehr sahen, dachten alle, er sei ebenfalls gegangen.
»Wie viele Jahresringe sind hinzugekommen?« Die Gräfin hielt Laurence an beiden Armen vor sich, und ihr Blick glitt wohlgefällig über die schlanke Gestalt des Mädchens. »Eine stattliche Tochter ist Euch da ins Haus gewachsen«, wandte sie sich an Lionel, der seinen Stolz nur mühsam verbarg.
»Manchmal scheint es mir in der Tat, Laurence’ wahres Bestreben ziele darauf, mir den männlichen Erben zu ersetzen.«
Esclarmunde äußerte bestimmt: »Nicht jedes junge Weib eignet sich für das Joch der Ehe. Und dessen bedarf es auch wahrlich nicht.«
Laurence fiel ein, dass die energische Dame schon lange Witwe war und an diesem Stand auch nie etwas geändert hatte, obgleich es der hochvermögenden Werber viele gegeben hatte.
»Wie Ihr meint, verehrte Base«, presste der Belgrave heraus, dem das Auftreten der Dame und vor allem das Herausstreichen gut einvernehmlicher Beziehungen zwischen ihm und dem bekanntermaßen häretischen Hause von Foix nicht passte. Wer würde schon um die Hand eines wilden Mädchens anhalten, dessen katholische Erziehung angesichts einer solchen Patin leicht anzuzweifeln war? Ihre Bekanntschaft verdankte er natürlich Livia, deren Treue zum Glaubensbekenntnis der römischen Kirche ihm noch nie geheuer war – trotz ihres Ranges einer Äbtissin in unmittelbarer Nähe des Heiligen Stuhls. Wo nistet der Teufel am liebsten? Im Schatten der Kathedrale.
Esclarmunde hatte sich dem Chatillon zugewandt, der sich von der Einladung, den Raum zu verlassen, nicht betroffen fühlte. Die verschämt verliebten Blicke von Laurence waren der Gräfin von Foix nicht entgangen. »Verlangt Ihr nicht doch danach, Eure Fertigkeit mit Lanze und Schwert wenigstens im Turnier unter Beweis zu stellen, Edler von Chatillon? Oder was hält Euch hier noch?«, ging sie den jungen Ritter an. »Ich wünsche mein Patenkind unter vier Augen zu sprechen«, fügte sie hinzu, ihr Drängen keineswegs bemäntelnd.
Da raffte Laurence sich auf. »René muss sich nicht mit diesen Rüpeln da draußen schlagen. Jedenfalls nicht für mich.« Sie vermied es dabei, ihm in die Augen zu sehen, sondern richtete den funkelnden Blick auf ihre Patin.
Ihr Ritter trat jedoch vor die große Esclarmunde und sprach, bemüht, seiner Stimme Festigkeit zu verleihen: »Es steht mir nicht an, mich den Wünschen einer Dame zu widersetzen, ebenso wenig wie ein Chatillon sich dem Verlangen der Kirche entzieht, für sie mit dem Schwert in der Hand einzutreten. Auch will ich gern mit eingelegter Lanze für die Ehre meiner Damna streiten, wenn Ihr«, er wandte sich keck an Laurence, »holde Laurence, wieder Euren Platz auf dem Söller einnehmt.«
»Kommt nicht infrage!«, beschied ihn barsch die Gräfin, worauf er die verblüffte Laurence an sich zog und sie auf den Mund küsste, in den Mund. Erschrocken fühlte das Mädchen die Schlange, die ihr blitzschnell zwischen die halb geöffneten Lippen fuhr. René grinste ihr schelmisch in die aufgerissenen Augen, verneigte sich tief vor ihr und allen Anwesenden und sprang mit hurtigen Schritten aus dem Raum.
»Ich hoffe nicht«, Esclarmunde räusperte sich in die eingetretene Stille hinein, »dass ich jetzt den ersehnten Freier Eurer Tochter vergrault habe, lieber Lionel. Lasst Euch trösten: Dieser Bursche ist als verlustig gegangener Schwiegersohn zu verschmerzen – und nicht wert, dass du dein Herz an ihn hängst.«
Letzteres war an Laurence gerichtet, die wie begossen dastand. Die heftige Röte ihres Gesichts wetteiferte mit der Farbe ihrer Haare, die langsam trockneten.
»Er hat es nicht einmal für nötig gehalten, bei mir um die Hand meiner Tochter anzuhalten«, musste Lionel brummig zugeben.
Laurence schlug die Augen nieder und beschwor den Geschmack des Kusses herauf. Nie wollte sie diesen Stich der Lust vergessen. Ihr war, als brannten ihr die Lippen in smaragdgrünen Flammen. In ihrer Verlegenheit und auch, um ihn wieder versöhnlich zu stimmen, grinste sie Gavin zu. Das hatte zur Folge, dass sich aller Blicke auf den stämmigen Knaben richteten. Nichts aber war Gavin peinlicher, als in solchen Zusammenhang mit seiner Jugendfreundin Laurence gebracht zu werden. Dieses freche Geschöpf zum Ehegespons?
»Ich werde Templer!«, rief er abwehrend, und Laurence musste herzhaft lachen.
»In den Orden würde ich auch sofort eintreten!«, verkündete sie boshaft, als sei er selbst dort nicht vor ihr sicher.
Esclarmunde legte ihre schmalgliedrige Hand auf den Arm des Jungen. »Gavin Montbard de Béthune gilt mir wie ein eigener Sohn, und wenn ihm der Sinn nach dem harten Dienst in der weißen Clamys der Kriegermönche steht, dann soll er seinen Willen haben.«
»Ein entbehrungsreiches Leben erwartet ihn unter dem Tatzenkreuz«, pflichtete Lionel grimmig bei, »das keine Familienbande duldet.«
»Gavin ist Waise«, stellte die Gräfin klar. »Und bis zu seiner Volljährigkeit –«
»Ich werde früher aufgenommen«, unterbrach sie der Knabe selbstsicher.
Er hat den gleichen harten Schädel wie ich, dachte Laurence und schenkte dem Ernsthaften erneut ein aufmunterndes Lächeln, das Gavin endlich erwiderte. Esclarmunde fuhr ungerührt fort:
»– bis zu seiner Schwertleite steht er in meinen Diensten.«
Da blitzte der Schalk in den Augen des kräftigen Knaben auf, und Laurence wusste, dass sie sich wieder verstanden. ›Lass die Alten nur reden‹, hieß die geheime Botschaft, ›wir machen das schon!‹ Lionel hingegen empfand das Auftreten der Gräfin von Foix als völlig unpassend. »Eine sehr geeignete Vorbereitung des jungen Mannes für die Aufnahme in den allerchristlichsten Orden der Templer«, höhnte er vernehmlich.
»Wie darf ich das auffassen, Lionel de Belgrave?«, entgegnete Esclarmunde scharf.
»Weil ihr im Süden allesamt arge Ketzer seid, meine Liebe«, bestätigte ihr der Belgrave, wobei er nicht offenließ, auf welcher Seite er stand. Bei Esclarmunde kam er damit schlecht an:
»Auf dem Stuhle Petri sitzt der Antichrist, der auf Okzitaniens Verderben sinnt, und dem König in Paris ist dies nur allzu recht. Ich werde Mittel und Wege finden, eine solch unheilige Allianz zu unterbinden. Mein Plan ist es –«
Hier unterbrach Lionel sie schroff: »Ich will nichts davon wissen! Als Ritter Frankreichs begänge ich Hochverrat und würde meinen Kopf verlieren.« Er hatte sich schnell in Rage geredet. Seine Tochter grinste verstohlen Gavin zu, doch der blickte stur geradeaus, als ginge ihn das Ganze nichts an. »Und dass Ihr den Euch anvertrauten Knaben, ein Kind noch, in die Sache hineinzieht, finde ich unverantwortlich. Meine Tochter wird dem schlechten Einfluss einer solchen Patin nicht länger ausgesetzt sein! Komm, Laurence.«
Er war erregt aufgesprungen. Laurence zögerte.
»Ich bin kein Kind mehr«, sagte Gavin ärgerlich, »und Ihr seid nicht mein Vormund.«
»Verführerin!«, polterte Lionel. »Ihr mit Euren katharischen Ideen«, er griff nach der Hand seiner Tochter, »verderbt die Seelen unschuldiger Kinder!«
»Beruhigt Euch, Vater!«, forderte Laurence ihn auf. Sie vermied es, ihn, wie zwischen ihnen üblich, Lionel zu nennen, damit seine Autorität nicht noch mehr Schaden nahm. »Ich werde Euch gehorsam folgen.« Dabei hatte sie gerade den Entschluss gefasst, dass sie den Teufel tun würde. »Wenn ich schon erwachsen genug bin, dass Ihr mir, ohne mich zu fragen, einen Gemahl sucht, dann steht es mir auch zu, mich verführen zu lassen, von wem ich will.« Sie dachte natürlich an den Chatillon, das sollte ruhig jeder heraushören, ihr Herr Vater allemal. »Von Männern versteh’ ich genug – und Euer Streit über lateinische Orthodoxie, den rechten Glauben der Katzerer und die Irrlehre vom Antipapst kümmert weder Schweif noch Schleppe! Mich jedenfalls nicht! So! Und jetzt können wir gehen!«
Belgrave hatte es die Sprache verschlagen, doch er gab Esclarmunde die Schuld an seiner Tochter Aufsässigkeit. »Ihr habt Laurence heute zum letzten Mal gesehen!« Lionel erhob sich. »Ich kündige Euch die Patenschaft auf!«
Seinem Griff konnte sich Laurence diesmal nicht entziehen, auch waren Widerworte jetzt kaum ratsam. Er schubste seine Tochter rüde vor sich her und ließ ihr keine Zeit für einen Abschied. In der Tür wandte er sich noch einmal um. »Es hat mich nicht gefreut, meine Dame, werte Herren.«
Kaum war der erboste Vater aus dem Saal gestampft, lachte Esclarmunde schallend auf, und Gavin stimmte in ihre Heiterkeit ein. Selbst der Novize in seinem Versteck hinter dem Vorhang griente still vor sich hin. Was für ein Weib, diese Rote!
»Schafft mir den Chatillon herbei – und auch den Roald of Wendower«, befahl die Gräfin ihrem Begleiter. »Alsdann lasst uns aufbrechen. Ich will die Nacht nicht ohne Not in Feindesland verbringen.«
Der Lauscher in der Mönchskutte war vor Schreck erstarrt, als er seinen Namen hörte. Jetzt würden sie ihn überall suchen. Doch herauszutreten aus seinem Versteck traute sich Roald of Wendower erst recht nicht. Die Gräfin würde ihn furchtbar verprügeln lassen, wenn dem unerwünschten Zeugen nicht gar Schlimmeres drohte. Also harrte der Novize zitternd hinter dem Vorhang aus. Seine Qualen sollten rasch ihre Belohnung erfahren. Roald of Wendower glaubte seinen Ohren nicht mehr trauen zu können – bei dem, was er in der Folge noch zu hören bekam.
Die Prophezeihung
Diener hatten ein Strohlager auf dem Steinboden des Rittersaales hergerichtet und für alle Teilnehmer des verregneten Turniers, die nicht bereits am Abend die Burg von Fontenay verlassen hatten, Teppiche und Decken zusammengetragen. Beim kargen Nachtmahl in der Schlossküche, bei dem man gehörig dem gut abgehangenen Schinken vom Wildschwein zusprach und noch mehr trank, hatte der Chatillon die Toaste der Ritter auf sich gezogen, war es ihm doch gelungen, sowohl den kräftigen Montfort als auch Charles d’Hardouin hinter Sattel und Kruppe ihrer Pferde zu setzen. Beide waren davongeritten, auch die zwei Mönche waren abgereist, so dass René de Chatillon sich unbehelligt von seinen Kumpanen feiern lassen konnte. Becher um Becher widmete er seine Siege artig seiner Damna und blitzte Laurence dabei mit seinen Smaragden an. Doch mehr kam nicht von ihm, kein Wort an den Vater, der sich alsbald betrank und von seiner Tochter frühzeitig zum Nachtlager gebracht werden musste. Selbst mit schwerem Kopf sorgte Vater Lionel noch dafür, dass Laurence in einer geschützten Ecke an der Wand zu liegen kam, während sein massiger Körper wie ein treuer Bernhardiner jeglichen Zugang blockierte. Er war sofort schnarchend eingeschlafen. Laurence lag noch lange wach und stellte sich erst schlafend, als die Diener den letzten Zechern heimleuchteten.
Kaum war das Dunkel wieder über den Raum gefallen, ihre Augen hatten sich an das Nachtlicht gewöhnt, ihr Ohr an die sägenden Geräusche der Schläfer, sah sie schattenhaft eine fremde Hand hinter dem Kopf ihres Vaters auftauchen. Dann glitten schon suchende Finger über ihr Gesicht und fanden schließlich ihre Lippen. Laurence rang mit sich, ob sie diese dem drängenden Tier geöffnet darbieten sollte, da hatte die Schlange sich schon blitzschnell ihren Weg gesucht, und Laurence biss erschrocken zu. Das Reptil sprang zurück und legte sich stocksteif quer über ihren Mund, um ihn an einem Aufschrei zu hindern. Laurence’ Kopf lag in der Beuge eines Armes gebettet. Sie wagte ihn nicht zu rühren. Mit der anderen Hand suchte sie die fremden Finger, umschloss sie fest und führte sie nun aus eigenem Willen ihrem Munde zu. Diesmal ließ sich die vielfingrige Meduse Zeit. Zärtlich kraulten die fremden Kuppen die Mulde ihrer Hand, glitten fordernd zwischen ihren Gelenken auf und ab. Laurence krallte ihre Nägel in den harten Venushügel und zerrte das an seiner Oberseite pelzig behaarte Biest an sich, fuhr mit ihrer Zunge blitzschnell über die salzige Haut und gewährte dem nun hervorschnellenden Mittelfinger bebend Einlass zwischen ihren scharfen Zähnen. Ihre Lippen umschlossen weich den nackten Eindringling, den ihre Zunge immer hitziger umspielte, während der freche Kerl kreisend und stoßend die nasse Höhle erkundete. Laurence zog ihn in sich hinein bis zum Heft. Sie saugte sich an ihm fest, im erregenden Gleichklang mit seinen qualvollen Windungen, und hätte so gerne geschrien, hätte so gerne Kehle, Zunge, Lippen eingetauscht gegen all das, was in den Tiefen ihres Schoßes sehnend und aufbegehrend rumorte. Sie presste die Schenkel zusammen und stieß das Untier zurück. Sie bohrte ihr heißes Gesicht in den Teppich, bemüht, ihren Kopf nicht heftig zu bewegen oder sich durch Keuchen zu verraten. Sie hätte heulen können vor Wut, vor Glück, vor Entsagung und wilder, entschlossener Hoffnung. Die Tränen kamen ihr vor Selbstmitleid, ein Schluchzen unterdrückte sie rechtzeitig. Laurence rollte sich hinter ihren schnarchenden Vater und beschloss, in Morpheus’ Armen Vergessen zu suchen.
Sie war noch keineswegs eingeschlafen, als der smaragdgrüne Salamander tastend durch ihr rotes Haar streifte. Ihre Hand schlich ihm entgegen, wollte ihn überraschen. Da hatte er sie schon gefunden, glitt prüfend über ihre ausgestreckten Glieder, bis er den Finger gefunden hatte, den er suchte. Zitternd spürte Laurence, wie diesem ein Ringlein übergestreift, dessen fester Sitz überprüft und er dann schroff allein gelassen wurde. Sie wagte weder Ringfinger noch Hand zu rühren. Liebend gern wäre sie mit dem verräterischen Schmuckstück eingeschlafen, doch durfte es keinesfalls am Morgen von Lionel entdeckt werden.
Sie suchte noch nach einem Ort, den ihr Vater nicht einsehen konnte, als es neben ihr im Holzpaneel kratzte. Ihr erster Gedanke war: Ratten! Der zweite ließ Laurence die Luft anhalten: Sollte dieser Draufgänger René –? Sie wagte kaum zu atmen, während sie ihren Kopf ganz langsam zur Wand drehte. Zwischen den Brettern entstand mit leisem Knacken ein Schlitz. Sehen konnte Laurence ihn nicht, aber sie fühlte den zunehmend kalten Luftzug, und dann vernahm sie wie gehaucht die Stimme Gavins. Er musste ganz dicht bei ihr sein, sie glaubte, seinen warmen Odem im Ohr zu spüren.
»N’Esclarmunde«, wisperte der Freund, »wünscht Euch zu sehen.«
Laurence witterte sofort Feuer und Abenteuer, doch dämpfte mit seinem Schnarchen ihr Vater den aufkommenden Tatendrang.
»Was, wenn Lionel mich vermisst?«, flüsterte sie besorgt zum Spalt. Sie vernahm ein Gemurmel und bemerkte eine zweite männliche Stimme. Sollte der tollkühne Chatillon das Begehr der Esclarmunde nur erfunden, Gavin nur vorgeschoben haben, um sie zu entführen? Ihr zuverlässiger Freund befreite sie von solchen beglückenden Gedanken.
»Roald of Wendower schätzt sich geehrt, derweil Euren Platz einnehmen zu dürfen.«
Der Schuft! Ausgerechnet diesen geifernden Novizen musste Gavin sich einfallen lassen. Mit heruntergezogenen Hosen würde der sich in die warme Kuhle pressen, die ihr Leib dort hinterließ. Wichtig war allerdings nur, dass sie ihn wieder loswurde, wenn sie an ihren Schlafplatz zurückkehrte. Laurence glitt wie ein Salamander durch das Heu auf den Spalt zu. Sie spürte die kühle Mauer, an der sie sich vorsichtig aufrichtete, während der junge Mönch an ihren Füßen vorbei kroch. Hatte der widerliche Lurch etwa ihren Spann geküsst? Etwas Feuchtkaltes war darübergewischt. Leise, fast weinerlich, beschwerte sich dieser Wendower bei Gavin:
»Wohin enteilt meine feuerrote Flamme, die mich versengt?«, stöhnte er flüsternd, aber Laurence hatte es wohl gehört. »Statua aena, die Göttin, die Ihr mir versprochen?«
»Sie muss nur schnell noch brunzen, Bruder«, zischte Gavin mit unterdrücktem Kichern. Das Schlitzohr trat dem Novizen zwar nicht in den Hintern, aber sein Fuß schob ihn mit Nachdruck durch den schmalen Schlitz.
»Und rührt Euch nicht!«, ermahnte er ihn noch. »Wenn Herr Lionel entdeckt –« Er ließ die Drohung im Raum stehen, nahm Laurence in der Dunkelheit bei der Hand und zog sie mit sich fort.
Sie verließen die Burg durch eine offenbar schon lange nicht mehr benutzte Ausfallpforte. Draußen hatte Gavin seinen Gaul an einen Baum gebunden. Sie saßen zusammen auf. Laurence musste sich fest an den Freund klammern, denn im Dunkeln konnte das Tier jederzeit stolpern oder scheuen.
»Musste es dieser grässliche Prediger sein?«, warf sie ihm scherzhaft vor, während sie querfeldein über die vom Regen aufgeweichte Turnierwiese ritten.
»Wer sonst legt sich schon in ein leeres Bett neben einen racheschnaubenden Drachen von Vater?«, gab Gavin über die Schulter zu bedenken. »Wir fanden ihn zitternd hinter dem Vorhang, an einem nassen Tüchlein saugend, das Euch, Laurence, wohl entfallen sein muss. Er küsste es voller Inbrunst und sagte, er wolle für Euch sterben –«
»Und jetzt stirbt der Arme tausend Tode neben Lionel.« Laurence’ Mitleid dauerte nur einen hellen Lacher lang, dann kam der Stich, dass es ihr Tüchlein sein musste, von ihrem René achtlos im Dreck verloren! Doch sie fragte beherrscht: »Und warum will mich Na’Esclarmunde mitten in der Nacht sprechen?«
»Weil nur in dieser Nacht ein berühmtes Orakel, ganz hier in der Nähe – mehr darf ich Euch nicht sagen: Es geht um Eure Zukunft.«
Esclarmunde erwartete ihr Patenkind am Rand der Turnierwiese, dahinter erstreckte sich der Wald von Fontenay. Sie reiste wie immer mit ihrer Sänfte, in die sie Laurence ohne viel Federlesens einsteigen hieß. Gavin trabte neben den Trägern einher. Vorweg liefen zwei Diener mit Fackeln, und hinten ritt eine kleine Eskorte aus einem halben Dutzend Bewaffneter. Laurence fand dies alles ungemein aufregend, trotz ihrer Furcht vor Entdeckung. »Wenn nun mein Vater –?«
»Papa-la-pappa!«, wehrte die alte Dame ungehalten ab. »Lionel wird durchschnarchen bis morgen früh. Sein Wein ging durch die kundige Hand meines Mundschenks.« Sie lachte kurz auf. »Das Mönchlein müsste ihm schon kräftig zu Leibe rücken.«
Laurence beschloss, sich erwachsen zu zeigen. »Der grässliche Novize könnte ihn im Delirium der Sinne mit mir verwechseln.«
Die Vorstellung erheiterte die strenge Dame. »Der Stolz verrät die Schwänin, auch wenn die Schalen noch im Gefieder kleben, Laurence. Du weißt um deine Anziehungskraft auf Männer wie auf Frauen.«
Diese Äußerung traf Laurence wie ein Schlag in die Magengrube. »Warum sagt Ihr mir das?« Esclarmundes Gesicht war für sie im Dunkeln der Sänfte nicht zu erkennen. Als das Licht einer der vorauseilenden Fackeln durch das offene Fenster fiel, glaubte Laurence ein überlegenes Lächeln ausmachen zu können.
»Ich will, dass du dich beizeiten selbst erkennst.«
Laurence wurde es unbehaglich, aber ihre Neugier obsiegte. »Woher plötzlich dieses Interesse an mir dummer Gans?«
»Rothaarige wie du mögen den Part der Gans wohl spielen, doch meist steckt dahinter ein schlaues Füchslein. Ich will wissen, ob wir auf dich zählen können.«
»Wer wir?« Laurence dachte an ihre Mutter und war misstrauisch.
»Das wirst du erfahren, wenn es an der Zeit ist.«
Damit war das Gespräch beendet. Laurence schaute hinaus in den dunklen Wald, dessen vorbeiziehende Stämme im Schein der Fackeln unheimliche Schatten warfen, zu gewaltigen Riesen aufwuchsen, deren Arme nach ihr zu greifen schienen, während hinter den niedrigen Sträuchern Gnome hockten, die beim Auftauchen der Sänfte entsetzt das Weite suchten. Sie hörte das Gurren der Wildtauben und den Schrei des Käuzchens, das Flüstern der Blätter und hastiges Rascheln im Unterholz. Der volle Mond brach durch die Wolken und tauchte Bäume und Zweige in ein silbriges Licht.
Jetzt erst wagte es Laurence, ihren Gefühlen freien Lauf zu lassen – die Stimmung des nächtlichen Waldes überwältigte die ihr angeborene Skepsis. Alles, was bisher geschehen war, stürmte auf sie ein. Sie hatte ein Geheimnis, und auch der prüfende, durchdringende Blick der gestrengen Esclarmunde konnte es ihr nicht entreißen. Niemand sollte es wagen, sie von ihrem geliebten Prinzen zu trennen – von Gavin so herzlos gegen einen schleimigen Frosch vertauscht – um sie in den Märchenwald der großen Zauberin Esclarmunde zu entführen. Laurence stieß einen wohligen Seufzer aus. Quel nèy!
Der kleine Zug mit der Sänfte trat hinaus auf eine Lichtung, an deren Ende sich, von Efeu überwuchert, ein graues Gemäuer erhob. Im Näherkommen erkannte Laurence einen geborstenen Torbogen und vermutete gleich dahinter eine Kapelle, wenn auch kein christliches Kreuz darauf hinwies.
Esclarmunde befahl, die Sänfte abzusetzen. »Du wartest hier«, wies sie ihr Mündel an und ließ sich von dem abgesprungenen Gavin heraushelfen. Die Fackelträger leuchteten ihr die Steinstufen hinauf. Das Rankenwerk wirkte wie ein natürlicher Vorhang, hinter dem die rüstige Dame verschwand.
Gavin nahm, sein Schwert in der Hand, breitbeinig davor Aufstellung wie der Wächter eines Heiligtums und hielt so Laurence davon ab, ihrer Patin trotz des Verbots zu folgen. Die Frage, ob geheimnisvolle Mächte ihr verlässliches Mitwirken begehrten, beschäftigte sie doch sehr. Sie sah sich klein und leicht wie ein Elf in der Schale einer Waage hocken, deren Zünglein von Esclarmunde mit verbundenen Augen am Ring hochgehalten wurde. In der anderen Schale schien etwas aufgehäuft und mit einem Tuch bedeckt, das sicher viel schwerer war als sie, und doch senkte sich ihre Seite langsam, aber stetig nach unten.
Laurence wurde aus ihrem Grübeln gerissen. Gavin rief nach ihr. Sie sprang aus der Sänfte, die ausgetretenen Stufen hinauf, und wie ein Knappe schlug er galant das Efeu zur Seite, als sei’s der Vorhang zum Auftritt der Königin. Laurence betrat ein Kirchlein ohne Dach, das Gewölbe eingestürzt. Der Mond stand über der verwitterten Mauerkrone. Doch das war es nicht, was Laurence fesselte. Vor ihr öffnete sich der Boden zu einem Loch, lang und breit wie ein Grab. Unter dem Schutt der herabgefallenen Ziegel führten Stufen in die Tiefe. Von dort glomm ein Lichtschein, und sie hörte ihre Patin: »– noch jung wie ein Kälbchen, das Salz törichter Liebe, unbedachter Aventuren lecken mag, keineswegs nach dem lapis ex coelis trachtet –«
Laurence lauschte erregt und ärgerte sich. Sie war kein dummes Kalb, das sich willenlos zur Schlachtbank führen ließ, wer immer auch der Metzger sein wollte.
»Wenn sie erst einmal Blut geleckt hat«, sagte die andere Stimme, und Laurence war sich nicht sicher, ob sie einer alten Frau oder einem Greis gehörte, »ihre ersten eigenen Wunden, dann wird sie sich besser hüten, und das ist die erste Voraussetzung für eine Hüterin, wie Ihr sie Euch ersehnt –«
Laurence hatte ein Steinchen von dem Geröll auf der Treppe losgetreten, die Stimmen verstummten, und sie beeilte sich, den Abstieg zu beenden. Dabei geriet sie ins Schlittern und stolperte in die in den Fels gehauene Krypta. Nur vier Öllämpchen in den Ecken erleuchteten die Gruft. Vor ihr saß auf einer steinernen Thronbank Esclarmunde, ein weiteres Lebewesen vermochte Laurence in dem Raum nicht zu entdecken. In der Blickrichtung ihrer Patin öffnete sich die Felswand zu einer hochgelegenen Nische, und darin stand eine schwarze Frauengestalt. Sie war aus dunklem Holz geschnitzt oder mit Pech bestrichen und wirkte weniger plump als vielmehr deftig, erdverbunden: breite Hüften, ein fülliger Busen, der sich nicht züchtig verbarg, sondern sich der Betrachterin ohne falsche Scham darbot. Die wulstigen Lippen schienen leicht geöffnet, die langen Wimpern über den großen, runden Augäpfeln hingegen verheißungsvoll gesenkt. Die Statue war nicht nach dem Vorbild des Lebens geschaffen, denn solch dunkle Haut, rotglänzende Lippen und mächtige Brüste hatte Laurence noch nie gesehen. An vielen Stellen war die Farbe abgeblättert. War diese Figur eine vergessene heidnische Göttin, oder sahen so ›Götzen‹ aus?
»Wen soll die Dame darstellen?«, fragte Laurence. Sie war sich ihrer Keckheit bewusst, wollte sich aber den Schneid nicht abkaufen lassen.
Esclarmunde ging weder auf den Ton ein, noch sah sie zu Laurence hin. Ihr Blick blieb unbeirrt auf die Statue geheftet. »Dass du Maria nicht erkennst, zeigt nur, wie wenig du über sie weißt.« Sie sagte es ohne Vorwurf. »Setz dich zu mir und sprich nur, wenn du dazu aufgefordert wirst. Nicht allein deine Antworten, sondern auch dein Verhalten geben Auskunft über dich, Laurence.«
»Wem?«, platzte diese heraus. »Wem soll ich hier Rede stehen? Mitten in der Nacht, in einer Druidengrotte, angesichts –«
»Gar nicht so falsch«, lobte die Patin. »Mir, dir, uns.« Sie senkte die Stimme. »Und nun fass dich in Geduld und beherzige, was ich dir sagte.«
Damit fiel die alte Dame in ein Schweigen, das keine Störung mehr duldete. Laurence zuckte die Achseln und tat es ihr gleich. Betete Na’Esclarmunda? Wer war die Hüterin, die sie sich ersehnte? Doch nicht etwa sie selbst? Das wollte sie gleich klarstellen, dass ihr, Laurence de Belgrave, nichts daran lag, eine Hirtin abzugeben, für welche Herde auch immer. Sie wollte –
»Welche Tugenden zeichnen den Ritter aus?«, ertönte die brüchige Stimme, die sie schon vernommen hatte, aus der Nische. Laurence konnte den Sprecher nicht entdecken – oder wer sich da über sie lustig machte. Sie besann sich der Mahnung, die ihr Esclarmunde erteilt hatte.
»Das Eintreten für die Schwachen, der Wahrheit zu dienen, edel –« Sie brach wütend ab. »Gralsritter will ich werden, und sonst gar nichts!«, beschied sie die stumm und drall über ihr thronende Schwarze. Eigentlich war ihr Ausbruch an die Adresse der Patin gerichtet, die keine Miene verzog.
Auch die Stimme der unsichtbaren Priesterin verriet keine Gemütsregung. »Sei dir bewusst, Laurence, dass ein Gralsritter – so er denn in den erlauchten Kreis aufgenommen – sein Leben einzig der Suche nach dem Gral weiht, unter Verzicht auf alles, was diesem Ziel nicht dienlich ist, ohne Nachsicht sich selbst gegenüber, ohne Milde von anderen zu erfahren und ohne auch nur die Aussicht darauf, den Gral je zu Gesicht zu bekommen. Der Weg zu ihm ist die Suche. Das völlige Aufgehen in der Suche ist das Ziel.«
Das gefiel Laurence, wenn sie es sich auch nicht so erschöpfend vorgestellt hatte. Vielleicht war das hier die erste Prüfung, die sie bestehen musste?
»Dazu bin ich bereit«, erklärte sie mit fester Stimme. In Wahrheit hatte die Erklärung sie verwirrt. Sie warf einen unsicheren Blick zu Esclarmunde, die neben ihr saß und doch so weit entfernt schien wie der Mond.
»Dort, wo du Siege erwartest, wirst du bittere Niederlagen hinnehmen. Aus schwerstem Verlust wirst du Gewinn ziehen.«
Das leuchtete Laurence ein, und sie verkündete eifrig: »Keine Niederlage soll mich erdrücken, kein Sieg mich übermütig sehen.«
Die Stimme schwieg. Esclarmunde räusperte sich. »Es würde nicht einmal eine verlorene Schlacht für dich bedeuten, wenn du die Jagd nach der Gralsritterschaft aufgeben und die Rolle einer Gralshüterin in Betracht ziehen würdest?«
»Niemals!«, empörte sich Laurence und sprang auf. »Mit oder ohne Euren Konsens. Auch Ihr, werte und hochverehrte Patin, bringt mich nicht davon ab.«
»Gralsritter kannst du nur sein«, nahm die Priesterin der Schwarzen Madonna den Faden wieder auf, »wenn es dir gelingt, sein Ideal zu verkörpern und seine Geistigkeit deinen dir vom Demiurgen gegebenen Leib vergessen lässt.« Die Stimme erregte sich in dem Maße, wie ihre Worte bedeutungsvoller wurden. Laurence konnte hören, wie schwer der Alten der Atem ging, doch unerbittlich fuhr sie fort: »Wenn du dich nicht zu dieser spirituellen Höhe aufschwingst, in der der Gral weset, wenn du nur ein in der Materie dieser Welt verhafteter Ritter bleibst, dann wird dein Frausein grässlich auf dich zurückschlagen, denn die Ritter dieser Welt dulden kein Weib in ihren Rängen, sie werden dich ohne Erbarmen schlimmer noch traktieren als jede Vogelfreie. Rechtlos wirst du ihnen ausgeliefert sein, und hasserfüllt und geifernd werden sie dich verwüsten, zerbrechen. Du wirst den Hieb, der dir den Tod bringt, als Gnade erbetteln –«
Laurence hatte sich unter dem Ansturm der grausamen Bilder geduckt, die Hände vors Gesicht geschlagen. So verharrte sie völlig erstarrt. Solche Konsequenzen hatte sie sich nie ausgemalt, wie auch!
Die Junge tat Esclarmunde leid, aber sie zeigte es nicht. »Du musst diesen Weg nicht gehen, Laurence«, brach sie das Schweigen. »Ich habe dir einen anderen aufgezeigt.«
Laurence rang nach Worten, die ihr einen würdigen Abgang ermöglichen konnten. Sie fand keine, aber erpressen ließ sie sich nicht. Sie würde ihre Zukunft selbst in die Hände nehmen. »Ich will hier weg!«, rief sie wütend. Das beeindruckte niemanden. Sie fühlte sich nicht Manns genug, den Raum mit dieser schwarzen Teufelin einfach den Rücken zuzukehren.
»Du kannst deinem Leben nicht entfliehen, Laurence«, sprach die Stimme jetzt fast begütigend, »es sei denn, du wirfst es weg. Das jedoch wirst du nie übers Herz bringen, dazu liebst du es zu sehr, wie sehr es dich auch beuteln wird.« Weit entfernt klangen jetzt die Worte der Priesterin. Sie wurden immer leiser, wie vom Mondwind verweht. »Du wirst schon längst alt und grau sein, da werden dir zwei Kinder gegeben werden, die das Schicksal der Welt in den Händen halten. Ihnen wirst du mit Freuden Hüterin sein. Das ist dein Schicksal.«
Danach schwieg die Stimme. Laurence wagte lange nicht, den Kopf zu heben und Esclarmunde in die Augen zu blicken. Die zog die Brauen hoch. Sie schien mit dem Ergebnis der Sitzung nicht zufrieden.
»Wir werden sehen«, sagte sie und ließ erneut offen, wer mit wir gemeint war, »ob du beizeiten erkennst, welchen Weg du nicht einschlagen darfst.«