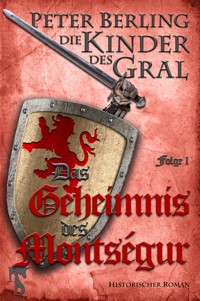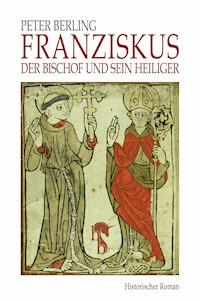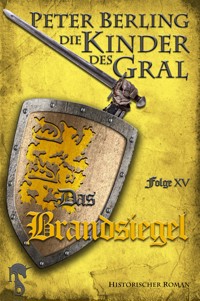3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Kinder des Gral
- Sprache: Deutsch
Roç und Yeza sind ebenso wie der französische König Ludwig in die Gefangenschaft des Sultans von Kairo geraten. Doch dessen Triumph ist nur von kurzer Dauer. Die Mameluken, die Leibgarde des Sultans, putschen im Zuge der Freilassungsverhandlungen für Ludwig und präsentieren dem hochstehenden Gefangenen stolz den Kopf des Sultans. Ohnehin genießen sowohl die Gralskinder, als auch Ludwig ungeahnte Freiheiten – sie können sich in Ägypten frei bewegen. Nichts kommt Roç und Yeza gelegener, denn die Königlichen Kinder sind gereift, langsam werden sie sich ihres Status bewusst und beide spüren in sich den Wunsch, ihre Entscheidungen nun endlich selbst zu treffen. Doch auch diese vermeintliche Freiheit hat ihren Preis. Denn Ludwig träumt schon lange davon, seine eigene Blutlinie aufzuwerten. Eine Vereinigung mit Yeza, die aus der Linie des heiligen Grals stammt, würde seinen Anspruch auf Macht unwiderruflich untermauern. In der Großen Pyramide soll diese Zeremonie vollzogen werden. Nur mit knapper Not kann Yeza dem König entkommen, sie flüchtet in die Arme ihres Bruders … Ein spannender historischer Roman von Peter Berling, der gleichzeitig das große Epos »Die Kinder des Gral« aus der Zeit der Kreuzzüge als Teil VI fortführt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 353
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
PETER BERLING
Schicksal am Nil
Folge VI des 17-bändigen Kreuzzug-Epos Die Kinder des Gral
Historischer Roman
WAS DAVOR GESCHAH IN FOLGE V
Kreuzzug ins Verderben
Den Islam trifft die Bedrohung durch die sich auf Zypern versammelnde, gewaltige Kreuzfahrer-Streitmacht. Doch wie auf christlicher Seite die Kaiserlichen und die Kirche Roms streiten, die arroganten Herren vom Tempel mit den Krämerseelen vom Hospital der Johanniter, so vergeuden die rivalisierenden Nachkommen des Großen Saladins, die Emire von Homs und Hama, die Sultane von Aleppo und Damaskus, ihre Zeit mit Fehden, Intrigen, Mord und Erpressung.
Ein Sumpf voller Gift und Blüten, berauschender Düfte und das Versprechen auf das ›Große Abenteuer‹. Nichts zieht die ›Kinder des Gral‹ unwiderstehlicher an.
Anstatt – wie erwartet und üblich – zum Kriegszug gegen Damaskus anzutreten, entscheidet sich König Ludwig für einen Angriff auf Kairo, das Herz Ägyptens und Sitz des höchsten Sultans aller Muslime. Das christliche Heer bleibt im Schlamm des Nildeltas stecken, der König gerät in Gefangenschaft. Der Kreuzzug wird zum Desaster, die ›Königlichen Kinder‹ mittendrin …
I HERRSCHERLICHE FEHLTRITTE
Kränkung der Sultana
Diarium des Jean de Joinville
Vor Mansurah, den 11. Februar A.D. 1250
Ich schätze, dass sich die Muslime als Sieger empfanden, und sie hatten dazu auch das Recht desjenigen, der uns noch viele solche Schlachten aufzwingen konnte, während wir wohl jede weitere immer schwerer, unter immer größeren Verlusten, hätten durchstehen müssen.
Nichtsdestotrotz versammelte König Ludwig am Abend seine Heerführer und besten Ritter um sich, ließ ihnen eine Messe lesen, kniete nieder und pries laut Gott den Allmächtigen:
»Herr, wir danken Dir! Zweimal hast Du uns in dieser Woche auf dem Felde die Ehre gegeben, wenn auch nicht den endgültigen Sieg über diese Heiden. Steh unserer Sache weiterhin bei, denn in Deinem Namen sind wir ausgezogen, und Dir zum Ruhm wollen wir sie zu Ende bringen! Non nobis, Domine! Non nobis, sed nominis tui ad gloriam![1] «
Der letzte Zusatz war eine klare Hommage an die Ritter des Templerordens, die auch diesen zweiten Schlachtentag mit hohem Blutzoll bezahlt hatten.
Der Marschall Renaud de Vichiers nahm den verwaisten Platz des Großmeisters ein.
Dass der König von »der Sache« gesprochen hatte, bezogen allerdings die Johanniter auf sich und schlossen daraus, dass ihm die kühnen Ambitionen seines gefallenen Bruders Robert geläufig waren und von ihm gebilligt wurden.
Dies jedenfalls glaubte ich aus seinem Gehabe herauszulesen, mit dem mich der Herr Jean de Ronay unterm Arm nahm, als ich den roten Pavillon des Königs verließ. »Habt Ihr, lieber Joinville, Nachricht von Eurem Sekretarius?« Es klang freundlich besorgt – Williams Wohlergehen scherte ihn keinen Deut. – »Meine Turkopolen sind nämlich zurückgekommen und haben erklärt, dass der Minorit – mitsamt dem edlen Haupte und sonstigen Reliquien des Grafen von Artois – sich aus dem Staube gemacht habe! Ein recht seltsames, eigenmächtiges Handeln –«
»Was soll ich dazu sagen, edler Meister« – ich wusste es auch wirklich nicht –, »William von Roebruk geht oft seine eigenen Wege, aber bisher kam er immer ans Ziel. Fasst Euch also noch etwas in Geduld!«
Ich wand mich aus seinem Arm und schritt zu meinem Zelt zurück. Wo mochte mein William wohl stecken?
Möchtet ihr den erhabenen Wesir, Allah jirhamu ua juchdu 'ala aljanni[2] , noch einmal sehen?«
»Nein«, antwortete eine herrische Stimme, die William erschreckte. »Ihr bringt ihn unverzüglich zur jasirat attahnid, zur Insel der Einbalsamierer, damit sie sich fauran –!«, Baibars Stimme nahm an Schärfe zu, »ich sagte sofort, seiner annehmen. Sie sollen alle anderen Mumien stehen oder liegen lassen, sollen Tag und Nacht arbeiten, damit der Wesir schnellstens in einem Zustand nach Kairo zurückkehrt, der uns nicht die Schamröte ins Gesicht schießen lässt – weniger vor seinem Sohn als vor Turanshah. Der neue Sultan soll sehen, dass wir einen edlen und gerechten Mann in Ehren halten, so wie er am Haupt des königlichen Frankenhundes sehen kann, wie wir mit unseren Feinden verfahren!«
Der Angesprochene schwieg, er überließ es wohl anderen, diesem mächtigen Herren die Unglücksbotschaft zu überbringen, dass der Kopf des Robert d'Artois nicht mehr herzeigbar war.
Der brannte in Williams Schoß wie glühende Kohle in seinem blutigen Wams. William wagte kaum zu atmen.
Die Sänfte wurde aufgehoben, ohne dass einer es für nötig hielt, noch einen Blick hineinzuwerfen. William quetschte sich in die gegenüberliegende Ecke, der alte Herr nickte leicht mit dem Kopf, als sie sich in Bewegung setzten. Er schien ihm Vertrauen zuzulächeln.
Die Ruinen von Helipolis lagen eingebettet in die weitläufigen Gärten der Sommerresidenz der Sultane von Kairo. Sie wurden mit Vorliebe zu Jagdveranstaltungen und für festliche Freuden im engeren Kreis der Hofgesellschaft benutzt.
Turanshah hatte seine Stiefmutter Schadschar durch Boten wissen lassen, dass er sie dort zu treffen wünsche, denn er hatte vor, Kairo gar nicht erst zu betreten, sondern sich anschließend direkt nach Mansurah zu begeben. Als er mit seinem Gefolge durch das Bab asch-schams al muschriqa, das Tor der aufgehenden Sonne, einritt, wunderte er sich schon, dort kein Begrüßungskomitee vorzufinden, auch waren über dem mit Basaltplatten ausgelegten Zufahrtsweg keine Girlanden gewunden, keine Fahnen wehten. Die Wachen standen zwar Spalier, aber sie jubelten ihm nicht zu.
Mehr noch als der frisch gekrönte Sultan ärgerte sich Madulain, die mit den Kindern auf einem offenen Wagen saß, der hart in den Rinnen der alten via triumphalis[3] rumpelte, ohne dass der Weg der Räder von ausgelegten Teppichen gedämpft wurde.
Der Rote Falke ritt leicht versetzt hinter Turanshah und sah sich mehrfach sorgenvoll nach den ihm anvertrauten Mitbringseln des neuen Herrschers um. Wenn das Willkommen tatsächlich so frostig ausfallen sollte, wie es sich ansagte, waren es die Favoritin und die Kinder, an denen der Hofstaat seinen offensichtlichen Unmut als erstes auslassen würde – wenn sie nicht sogar der Grund waren.
Die Schranzen von Kairo waren ein Hornissennest, die bunte Schar der Günstlinge aus der Gezirah nahm sich dagegen aus wie ein harmloser Schwarm Schmetterlinge. Und Blumen hatte auch keiner gestreut. Die wenigsten ritten zu Pferde, Antinoos im Damensitz, die meisten ließen sich in Sänften tragen und freuten sich an den Zimbel- und Flötenklängen der Musikanten, die sie mit sich führten. Für den sie erwartenden Ärger hatten sie kein Gespür, und wenn, dann hätte es sie kaum gekümmert.
Zwischen den Palmen tauchten jetzt die Spitzen der Pavillons auf, die Gamal Mohsen, der Obereunuch, hatte aufschlagen lassen. Sie waren samt und sonders vom Hofstaat, den Würdenträgern aus der Hauptstadt, okkupiert worden. Die Gäste konnten sehen, wo sie bleiben wollten.
Vor dem größten stand Schadschar ed-Durr, die regierende Sultana. Sie war eine stattliche, herrische Erscheinung, Armenierin von Geblüt, die sich von der türkischen Sklavin zur uneingeschränkten Gebieterin hochgearbeitet hatte. In der Tat war die ihr von den Mameluken eingeräumte Machtposition einmalig in der arabischen Geschichte, und Schadschar hatte sich in den drei Monaten ihrer Regierungszeit an diese Macht gewöhnt.
Neben ihr stand Husam ibn abi' Ali[4] , der Gouverneur, und Baha Zuhair, der Hofschreiber. Er fieberte als einziger den Ankömmlingen freudig entgegen, wenn auch nur insgeheim. Der Ruf, der Turanshah als kunstsinnigem Mäzen vorausging, ließ ihn hoffen, nun endlich als Dichter anerkannt zu werden.
Alle übrigen Höflinge, an ihrer Spitze der Chronist Ibn Wasil[5] , waren dem Sohn Ayubs, der ihnen völlig fremd war, ausgesprochen feindlich gesonnen, und sie gaben sich auch wenig Mühe, dies zu verbergen. Lediglich Gamal Mohsen, der Eunuch, suchte den Eklat zu vermeiden.
Doch der war schon da.
Turanshah ließ sein Gefolge angesichts der voll besetzten Zelte halten und wartete, dass man ihm jetzt wenigstens entgegengehen würde, um sich zu unterwerfen. Doch die Sultana hielt mit unsichtbarer Hand jeden zurück, der eventuell zu diesem Zeremoniell bereit gewesen wäre.
Turanshah war blass geworden. Er sah aber nicht zum Roten Falken hinüber, damit gar nicht erst der Eindruck entstehen konnte, er suche Rat. Mit leiser Stimme befahl er seinem Konnetabel, mit seinen Leuten vorzutreten. Sie schritten schweigend bis vor den Pavillon, den die Höflinge besetzt hielten, griffen sich plötzlich rechts und links neben Ibn Wasil je einen Schranzen, und zwar an den Ohren, und schleppten die beiden zurück vor Turanshah. Der Griff an die Ohren lässt wenig Gegenwehr zu, und mit einer Drehung zwangen sie die Opfer in die Knie. Vor jedem der Schranzen stand jetzt ein nubischer Scharfrichter und wartete auf das Zeichen seines Herrn.
Da raffte sich Schadschar wütend auf und schritt mit funkelndem Blick ihrem Stiefsohn entgegen. Der Gouverneur folgte ihr eilends, doch schneller als sie war Baha Zuhair, der Hofschreiber.
Er deklamierte noch im Laufen: »Es lächelt dir, Strahlender, die Sonne Ägyptens, seinen Teppich, blütenbestreut, rollt dir Vater Nil entgegen, zitternd vor Wonne jauchzt beider Tochter, das ewige Kairo: Ahlan wa sahlan bil sultan al kabir![6] Willkommen, großer Sultan!«
Er warf sich vor Turanshah auf den Boden, der Gouverneur tat es ihm gleich, und hinter ihnen folgte der Hofstaat ihrem Beispiel.
Nur Schadschar stand noch aufrecht. »Ich grüße Euch, Turanshah«, sagte sie mit gepresster Stimme. »Wir haben lange auf Euch gewartet.«
»Offensichtlich noch nicht lange genug«, antwortete ihr Turanshah. »Ich sehe Euch noch immer auf den Füßen, Schadschar ed-Durr – und ich vermisse auch die Begrüßung meiner Freunde –, noch habt Ihr Anstalten gemacht, der Frau an meiner Seite, der Tochter des Kaisers, zu huldigen.«
Anstatt endlich den verlangten Kniefall anzudeuten, zischte Schadschar: »Die kommt mir nicht ins Haus! Nicht solange ich Sultana –«
»Ihr seid eine der Witwen meines erhabenen Herrn Vaters«, unterbrach sie Turanshah, »und wenn Ihr mit Eurem Haus den Palast des Sultans meint, dann muss ich Euch als erstes auffordern, mir Rechenschaft für die vergangenen drei Monate dieses Haushalts abzulegen, wie über das übrige Erbe, das mein erhabener Vater mir hinterlassen hat.«
Er blickte amüsiert auf seine Stiefmutter, die jetzt doch in den Knien wankte. »Danach«, fuhr er genüsslich fort, »werdet Ihr alles meiner Sultana übergeben. Derweil« – er richtete jetzt das Wort über sie hinweg an alle, Schadschar war in die Knie gesunken, aber er achtete ihrer nicht mehr – »werden die Prinzessin und die Königlichen Kinder mich nach Mansurah begleiten, das mir so lange als Hauptstadt dienen wird, bis Kairo sich erinnert, wie es seinen Herrscher zu empfangen hat!« Er wandte sich abrupt an den Gouverneur. »Wo ist der Seneschall, wo ist der Marschall, wo ist der Vorsteher des Diwans[7]?« Turanshah gab sich die Antwort gleich selbst: »Hielten sie es nicht nötig, vor Uns zu erscheinen, so erachten Wir es für unnötig, sie in ihren Ämtern zu belassen. Teilt ihnen das mit!«
Die aus Kairo herbeigeeilten Hofschranzen, die sich ein anderes Schauspiel versprochen hatten, machten sich aus dem Staub. Gamal Mohsen ließ hastig die Zelte säubern und für das Gefolge des Turanshah herrichten. Erst dann kümmerte er sich um Schadschar ed-Durr, die noch immer am Boden kniete. Er rief eine Sänfte herbei. Ibn Wasil, der Hofchronist, leistete der Gedemütigten Gesellschaft.
In langem, trübsinnigem bis zornig erbostem Zug setzten sich die Sänften des nach Kairo zurückkehrenden Hofstaates in Bewegung.
Baha Zuhair mischte sich unter die Maler und Poeten aus der Gezirah. Seit den Krönungsfeierlichkeiten in Damaskus hatte sich die Bagage mit Wonne auf die »Infanten des Gral« gestürzt.
Yeza als jungfräuliche Göttin Artemis mit Pfeil und Bogen, als kluge Pallas Athene – ob ihrer bewunderten Rechtssprechung – waren ihre beliebtesten Motive.
Roç besangen sie als jugendlichen Helden Alexander, sein Kampf – hoch zu Ross mit den Löwen – inspirierte sie zu überschwänglichen Oden, und als Antinoos, der neidlos den beiden seine Stellung als Divus[8] und Gra'diva[9] gleichermaßen überließ, ihm einen Lorbeerkranz wand, überboten sich die Künstler mit Entwürfen für monumentale Skulpturen, Gobelins und Mosaikböden. Die Kinder saßen ihnen geduldig Modell, belustigt, doch mit ernsthafter Würde.
Die Hofschneider hatten sie völlig neu ausstaffiert. Sie konnten jetzt wählen zwischen strenger Kleidung kurdischer Krieger, den Fantasien vom Harem des Kalifen: Yeza als Sherehazade[10] , während Roç in ihrer Kostümierung mehr zum Dieb von Bagdad geriet als zum weisen Harun al-Raschid. Für die Reise ins Land der Pharaonen hatten sie sich noch übertroffen: Kein geringeres Götterpaar als Isis und Osiris[11] stand den Kunstwerken aus Damast und Seide, hauchdünnen Geweben und Goldbrokaten Pate.
Gamal Mohsen war hingerissen von den Kindern, aber mehr noch von dem Antinoos, doch er riss sich los und sorgte sich um das leibliche Wohl des Turanshah und seiner Favoritin, die er in das große Zelt geleitet hatte.
Als sie an der reich gedeckten Tafel Platz nahmen, streckte Madulain von sich aus ihre Hand nach der ihres Gebieters aus. Als habe sie sich verirrt, griff sie, vom Tischtuch vor unziemlichen Blicken geschützt, an ihr vorbei an sein Gemächte. Sie war stolz auf ihn, aber mit ihrem Instinkt für Gefahr, der der Saratztochter nicht abhanden gekommen war, spürte sie, dass er sich nun mehr tödliche Feinde geschaffen hatte, als er überleben konnte. Die Nähe des Todes verschaffte ihr eine nicht gekannte Lust. Weit stärker als jede lüsterne Gier.
Die Insel der Einbalsamierer
Die schwarze hohe Sänfte schwamm jetzt auf einer Barke ihrem Bestimmungsort entgegen. William hatte die meiste Zeit gedöst, nur als sein Harndrang sich nicht mehr bändigen ließ, hatte er, der Not gehorchend, allen im Innern verfügbaren Stoff genässt, damit nicht plötzliches Tröpfeln aus dem Edelholzgehäuse ihn verriet. Die Verdunstung bereitete ihm keine Sorgen, der Großwesir roch eh sehr stark, und die frevlerische Tatsache, dass er den alten Herren mit seinen Bandagen ebenso wenig schonen konnte wie das ihm anvertraute teure Haupt im blutigen Wams, deuchte dem Minoriten dagegen vergleichsweise gering.
Befreit wagte William, einen vorsichtigen Blick durch den Schlitz des Vorhangs zu werfen. Die Barke näherte sich einer Insel im Strom. Sie war von Palmen dicht bewachsen, und in ihrer Mitte ragte ein großes, fensterlos strenges Gemäuer auf, wohl ein Konvent.
Er sah die gekrümmten Rücken seiner Ruderer, die jetzt ihre Schläge verlangsamten, und gleich darauf knirschte der Sand unter dem Kiel der Barke. Stimmen kamen näher.
William lehnte sich erwartungsvoll zurück, er hatte den Kopf des Robert d'Artois aus dem Wams gewickelt, um ihn quasi als Legitimation sogleich vorweisen zu können, aber die hinzugetretenen Männer mit den sanften Stimmen voller Bestimmtheit öffneten den Vorhang nicht, sondern wiesen die Ruderer an, hier am Ufer in ihrer Barke zu warten, wie es dem Gesetz des jamaiat al hulud[12] entspräche, nach dem kein Lebender die Insel betreten dürfe.
Das machte William zwar erschauern, weil er sich ausrechnete, dass eine Überschreitung des Gebotes ziemlich einfach zu ahnden sei, doch sein dickfälliger Sinn für Unerlaubtes und sein durch nichts gerechtfertigtes Vertrauen, dass der Herrgott wie immer für ihn eine Ausnahme machen würde, ließ ihn mucksmäuschenstill in seiner Ecke kauern, dem Großwesir gegenüber, der ihm jetzt gar nicht mehr so freundlich zuzulächeln schien. Den Artois hielt er immer noch krampfhaft an den krausen Haaren, weil er sich jetzt nicht zu rühren wagte.
Der Bootsführer war mit den Gebräuchen des seltsamen Ortes wohl vertraut, denn er wies nur darauf hin, dass der Emir Baibars um eine zügige »Behandlung« des erhabenen Fakhr ed-Din bäte, damit er in der Hauptstadt präsentiert werden könne. Es wurde ihm wohl mit stummem Nicken geantwortet, denn die Sänfte wurde jetzt wieder aufgenommen und gemessenen Schritts landeinwärts getragen.
»Jede Eile ist unnötig, Bruder Horus[13] «, sagte eine der sanften Stimmen, »der neue Sultan ist vor Stunden schon in Kairo eingetroffen.«
»So nehmen wir uns die Zeit, die ›Unsterbliche Schönheit‹ von uns verlangt, Scarabäus.«
Nach den veränderten Schritten, die über eine Schwelle stiegen, der plötzlichen Dunkelheit und den sich entfernenden Stimmen zu schließen, hatten die Wächter der Insel, diese Brüder der Zeitlosigkeit, die Sänfte in einer ebenerdigen Kammer des Konvents abgestellt.
William wartete eine Zeit lang, bis sich sein Herzschlag beruhigte, dann schob er behutsam den Vorhang zur Seite. Der Raum war karg eingerichtet. Dünnmaschige Gaze hinderte Insekten am Eintritt durch die einzige, hoch gelegene Fensteröffnung. Festgemauerte, mannslange Steintische standen an den Wänden, aber keine Stühle. Auf einer der Marmorplatten lag ein toter Mann mit heller, weißlich ungesunder Hautfarbe, als habe man ihn aus dem Wasser gefischt. Er besaß keinen Kopf, aber einen Penis beachtlicher Größe. Seine Bauchdecke schien aufgeschnitten zu sein, Blut war keines zu sehen.
Die Neugier war stärker als Williams würgende Übelkeit. Er stieg aus seinem schützenden Gehäuse, den Kopf des Prinzen immer noch in der Hand.
Vorsichtig, als könne er den Toten wecken, trat er an das »Kopfende« und fügte das Haupt an den glatt durchschnittenen Hals. Es fiel langsam zur Seite, und die erloschenen Augen Roberts starrten ihn vorwurfsvoll an. William schaute verlegen auf die so wenig adlige Nacktheit des Rumpfes.
Da ging die Tür auf, und in ihr standen zwei weiß gekleidete Männer in bodenlangen Gewändern. »William von Roebruk?«, sagte der eine mit einem Ton milden Vorwurfs.
»Welch ein schöner Kopf!« setzte der andere hinzu.
William errötete schamvoll: »Ich hab' ihn Euch gebracht«, sagte er, »damit Ihr –«
»Ich meinte deinen flämischen Schädel, species calva flamingensis[14] «, entgegnete der Weiße lächelnd, »was uns zu tun bleibt mit dem Grafen von Artois« – er nahm dessen Kopf abwiegend in die Hand –, »wissen wir schon.« Sein Lächeln verschwand. »Auf jeden Fall kannst du das Ergebnis nicht hier abwarten«, fügte er hinzu, »nicht unter unserem Dach!«
»Und wohin soll ich –?« wehrte sich William kleinlaut.
Da ergriff der erste das Wort. »Du sollst nach Alexandria gehen. Dort wirst du den Ezer Melchsedek finden. Wenn du mit ihm hierhin zurückkehrst, steht der Graf für Frankreich bereit!«
Mit unmissverständlicher Geste wurde William aufgefordert, den Raum zu verlassen. Die weißen Männer wiesen ihm den Weg zum Nilufer. »Ein Schiff liegt für dich bereit.«
»Und hüte dich, beim nächsten Mal dies Haus zu betreten, du könntest es nicht wieder verlassen!«
»Verfahr nicht so streng mit einem Freund der Kinder, Scarabäus!«, sagte der Jüngere. Aus einem Krug schöpfte er einen Becher voll milchiger Flüssigkeit. »Der Herr Sekretarius hat sicher Durst.« William stürzte das angebotene Getränk hinunter. Es schmeckte angenehm kühl und erfrischend säuerlich, auch leicht nach Kokosmandel. Ein angenehmes Brennen durchzog sein Gedärm.
Leicht benommen torkelte der Minorit den Pfad zwischen den Palmen zum Strand des Flusses hinunter. Er hatte Hunger, doch die Datteln hingen viel zu hoch, und reif waren sie auch noch nicht. Er erreichte die Dau, hilfreiche Hände zogen ihn an Bord. Bevor er den Bootsleuten ein Wort sagen konnte, war er schon in tiefen Schlaf gefallen.
Diarium des Jean de Joinville
Vor Mansurah, den 7. März A.D. 1250
Neun Tage nach der großen Schlacht – eine weitere war nicht erfolgt – trieben die Leichen der Erschlagenen aufgebläht an die Oberfläche des Bahr as-Saghir. Sie schwammen mit der gemächlichen Strömung bis zur Schiffsbrücke, die unsere beiden Lager verband.
Inzwischen hatte das Hochwasser eingesetzt, und die Kadaver stauten sich zu Hunderten. Es waren so viele, dass sie von einem Ufer zum anderen reichten, und sie vergifteten das Wasser. Seuchen brachen aus.
Der König zahlte aus seinem Säckel den englischen Seeleuten des Salisbury einen Extralohn, damit sie den Fluss reinigten. Wer beschnitten war, flog über die Brücke, um zu den Sarazenen zu schwimmen, die Christen wurden in rasch ausgehobenen Massengräbern bestattet.
Es stank fürchterlich, und wer unter den aufgequollenen, halb verwesten Leibern nach Freunden suchte, wurde bitter enttäuscht. Die abgenagten Gesichter waren unerkenntlich.
Die einzige Art Fisch, die es im Lager zu essen gab, war Aal. Dieses widerliche Gewürm hatte sich an den Leichen fett gefressen, ein Gedanke, der jedem Übelkeit bereitete, bis dann der Hunger diese Nahrung hereintrieb.
Das ungesunde Klima trug seinen Teil bei, seit Wochen war kein Tropfen Regen gefallen, und erst faulte das stehende Wasser, dann begannen auch wir zu verfaulen. Das Fleisch dörrte, an den Beinen erschienen schwarze Flecken, schließlich bildeten sich Schwären, und die Haut platzte auf, Blut schoss aus der Nase. Das war dann schon das Zeichen für den unausweichlichen Tod. Ich hatte meinen Leuten befohlen, dem Fluss fernzubleiben und sich die Gesichter wie die Beduinen mit Stofftüchern zu verhüllen, um so wenig wie möglich von dieser verpesteten Luft einzuatmen. Die Aale ließ ich häuten und nicht kochen, sondern in Öl sieden. Wir hatten noch Wein, und von den Johannitern erhielt ich gemahlenes Korn, woraus meine Köche Fladen buken, die nicht übel schmeckten, solange Gewürze und vor allem Salz vorhanden waren.
Ich schämte mich etwas, diese lebensbewahrenden Gaben anzunehmen, denn das unrühmliche Verhalten Williams lag, auch wenn es nicht ausgesprochen wurde, den Johannitern und mir wie ein Stein im Magen – oder ein zu fetter Aal.
Jean de Ronay gab sich Gott sei Dank auch selbst Anteil an der Schuld, so es denn eine ist, meinen Sekretarius überrumpelt und quasi wider Willen auf diese Mission geschickt zu haben.
Nun war an einen glorreichen Gegenangriff unsererseits, bei dem der Graf von Artois hätte unseren Reihen wundersam vorausreiten können, gar nicht mehr zu denken. Sein Körper war unauffindbar geblieben, so angestrengt seine Kämmerer unter den Flussleichen Ausschau gehalten hatten. Sein Kopf hätte also in Frieden ruhen können, nachdem er von der höhnischen Stange heruntergeholt war. Aber wo steckte er nun, wo steckte William?
Was den amtierenden Großmeister der Johanniter – und alle anderen Barone und Heerführer – jedoch weit mehr verwunderte, war, dass uns die Ägypter nicht mehr angriffen. Hatten sie uns vergessen, wollten sie uns verfaulen lassen, oder hatten sie selbst mit der gleichen Seuche zu kämpfen wie wir?
Verfaulen im eigenen Saft
William von Roebruk hatte sich in der Kasbah von Alexandria auf die Suche nach diesem Ezer Melchsedek gemacht. Ein heruntergekommener Kabbalist offensichtlich, von dem wenige mit besonderer Ehrfurcht sprachen, die Christen bekreuzigten sich, sobald William auf ihn ansprach, die Muslime stießen Hornfinger Richtung Erde, um das Böse abzuleiten wie einen Blitz im Gewitter.
Schließlich verriet ihm eine Frau, dass der Melchsedek an einer Ecke des Basars seinen festen Standplatz hätte, wenn überhaupt, sei er dort zu finden. William ließ sich den Ort so genau beschreiben, dass er ihn nicht verfehlen konnte.
Jetzt stand er an der Ecke. Niemand saß dort. An der Hauswand stand in unbeholfenen Lettern: »Du sollst Jahwe nicht versuchen.« Jemand hatte mit roter Farbe das »nicht« durchgestrichen und wie eine Unterschrift daruntergesetzt »Sheitan«[15] .
Während der Franziskaner die Schrift noch sinnend betrachtete, legte sich eine Hand auf seine Schulter. »Nicht jeder, der sucht, wird finden!« Es war der alte John Turnbull.
William war zu erfreut, jemanden, den er kannte, zu treffen, als dass er sich über die Zufälligkeit der Begegnung Gedanken machte, zumal Turnbull auch gleich geschickt auf seinen Kaiser Friedrich zu sprechen kam. Obgleich es William überhaupt nicht interessierte, durfte er die letzten Neuigkeiten aus dem fernen Deutschen Reich vernehmen.
»Stellt Euch vor, William«, plauderte der Sonderbotschafter, den keiner von seinem Posten abberufen hatte, weil niemand auf den Gedanken kam, der alte John, dieser merkwürdige »Chevalier du Mont-Sion« könnte immer noch leben, »sie haben deinen Willem von Holland[16] zum Gegenkönig gekrönt, in Aachen!«
Der Minorit sah ein, dass es keinen Sinn hatte, dem alten Turnbull zu erklären, dass er, William von Roebruk, Flame sei, so ging er höflich auf die Nachricht ein.
»Also ist die Herrschaft des Staufers am Ende?«
»O nein!« ereiferte sich Turnbull. »Zwar starben ihm der Freunde viele, aber noch herrscht Konrad, sein Sohn.« Als habe er ihm ein Staatsgeheimnis anzuvertrauen, flüsterte der Chevalier: »König Konrad hat den Holländer vernichtend geschlagen und heimgeschickt.«
»Der Papst wird dennoch keine Ruhe geben«, gab William seine Meinung kund. »Innozenz wird so lange andere Figuren aufs Brett stellen, bis er in den Himmel oder der servus satanis[17] zur Hölle gefahren ist!«
»Oder umgekehrt«, schnaubte des Kaisers vergessener Botschafter. »Innozenz spielt falsch, Gott kann ihn nicht belohnen. Der Kaiser ist im Recht, im göttlichen Recht des Gesalbten!«
Die Frage erregte John noch jedes Mal. William besann sich seiner eigentlichen Aufgabe und verabschiedete sich von dem Alten mit einer Notlüge, er müsse noch in die Bibliothek, bevor diese schließe.
»Sucht Ihr jemanden, der Euch berät –?«, fragte Turnbull listig.
»Nein, nein«, wehrte William ab und riss sich los. »Ich muss nur jemanden treffen!«
Er verschwand, wie von Eile getrieben, schnellen Schritts im Gewühl des Basars, dann verlangsamte er ihn, weil er keineswegs wusste, an wen sich wenden. Aber den alten Turnbull einzuweihen wäre doch zu lästig gewesen.
William bemerkte nicht, dass dieser sich an seine Fersen heftete. Dafür trat ihm die Frau in den Weg, die ihn zu der Gassenecke gewiesen hatte.
»Sucht Ihr immer noch den Melchsedek?«, fragte sie freundlich.
William nickte erleichtert und überlegte, ob er ihr ein Geldstück in die Hand drücken sollte. Sie sah verhärmt, aber nicht arm aus. »Folgt mir«, sagte sie, »ich führe Euch zur Herberge des Hermes Trismegistos[18] !«
William behielt sein Geld. Die Frau blieb noch einige Male stehen in den Ladenstraßen und kaufte mit Bedacht und Sachverstand getrocknete Kräuter, grob zerstoßene Kristalle und fein gemahlenes Pulver. Sie kaufte verschnürte Säckchen und verschlossene Amphoren. Sie tat alles in Körbe, und die Körbe gab sie William zum Tragen, er war bald beladen wie ein Packesel. Sie durchquerten immer engere Gassen der Altstadt, bis sie an einer schmalen Tür ankamen.
Der sich öffnende Gang führte auf einen Innenhof. Die Frau ging ihm voraus und nahm ihm jetzt seine Lasten ab. »Wartet hier«, sagte sie, »man soll Euch nicht sehen!«
William trat in die Dunkelheit des Ganges zurück, und sie schloss die Tür hinter sich. Ihm kam ein Argwohn. Er griff nach der Klinke. Die Tür war verschlossen, so sehr er auch an ihr rüttelte. Er tastete sich zurück zu der Pforte, die auf die Gasse mündete. Sie hatte nicht einmal eine Klinke.
Er war gefangen!
William bemühte sich, seine Augen an das Dunkel zu gewöhnen.
»Ist es der Chevalier, der sich für die Prieuré de Sion in Person hält und keine Ruhe gibt«, tönte eine Stimme dumpf aus der Decke über seinem Kopf, kein Lichtstrahl war zu entdecken, »oder ist es die Versuchung des William von Roebruk, der, keiner Warnung eingedenk, schon wieder seine Nase in Dinge steckt, die nicht die seinen sind.«
Die Ironie im Tonfall deuchte William nicht unbekannt, aber es gelang ihm nicht, aus der Erinnerung die Gestalt zu beschwören, mit der er sie in Verbindung hätte bringen können.
Der Gefangene war auf der Hut. »Ich suche den Ezer Melchsedek«, sagte er und wartete.
Die Stimme ließ sich ebenfalls lange Zeit. »Angenommen, Ihr hättet ihn gefunden, was habt Ihr ihm zu sagen?«
»Ohne dem Meister ins Angesicht zu sehen, will ich nicht Rede noch Antwort stehen.«
»Wartet heute Abend nach dem plilat ha’erev, dem Abendgebet, vor dem Tempel auf ihn. Er wird Euch fragen, warum Ihr den Kopf nicht geweihter Erde übergeben habt, nachdem der Leib geschändet.«
William überlegte fieberhaft, um dann schließlich unterwürfig den törichten Minoriten herauszukehren, den der unsichtbare Inquisitor von ihm erwartete.
»Und was soll ich dem Meister antworten?«
»dass Ihr den Kopf in seine Hände legt – und schleunigst verschwindet, Mönchlein!«
Jetzt war sich William seiner Sache ziemlich sicher. »Gavin!«, rief er und griff nochmals nach der Klinke der Tür zum Innenhof. Diesmal gab sie nach. Im Hof stand aufrecht der Komtur der Templer, auf sein Schwert gestützt, so wie er ihn das letzte Mal auf Zypern gesehen hatte. Seine Züge waren in den fast zwei Jahren noch markanter geworden, härter, sein gestutzter Bart eisgrau, aber er trug noch die härene Kutte des Eremiten, kein rotes Tatzenkreuz zierte die breite Schulter. Gavin Montbard de Béthune betrachtete den Franziskaner mit seinem üblichen Lächeln, voller Sarkasmus, wenn nicht Arroganz – das William längst nicht mehr einschüchterte.
»Was wartet Ihr noch?«, fragte der Templer.
»Ich möchte erfahren«, entgegnete keck der Minorit, »wie verhält sich die Sänfte zum Sarg – oder wie kommt der Sarg zur Sänfte?«
»Sie steht, er liegt«, grinste der Templer, »oder vulgo[19] : Ihm steht er, wenn sie liegt.« Seine Stimme wurde wieder ernst. »Ihr wollt immer zuviel wissen, und Ihr wisst immer weniger. Es ist wohl Euer Schicksal, nuntiatio[20] und transitio[21] nicht auseinanderhalten zu können. So kehrt Ihr besser zu Eurem Joinville zurück, der auch nichts verstanden hat und seine Ignoranz wohlfeil solchen andient, denen es nicht gegeben ist, an den Geschicken der Welt mitzuwirken!«
»Ihr pauperes commilitones Christi templique[22] hingegen seid die Erwählten!« versuchte William zu spotten.
»Ihr habt Salomonici[23] vergessen!« Der Komtur maß ihn mit einem belustigten Blick. »William, Ihr seid zu dumm, um frech zu werden! Gebt Euch keine Mühe! Geht jetzt, pax et bonum[24] !« Gavin wandte sich ab. »Führt nur Euer kopfloses Unternehmen aus!«, rief er über die Schulter hinter William her, der sich durch den dunklen Gang schleunigst zurückzog.
Im Gedränge des Basars hörte er bei den Muslimen den Jubel über die Ankunft des Turanshah an der Front. Der neue Sultan sei ein findiger Kopf, Schiffe habe er zerlegen lassen, auf dem Landweg hinter den Rücken der Feinde schaffen und zwischen ihren bis Mansurah vorgeschobenen Feldlagern und der von ihnen gehaltenen Stadt Dumyat wieder in den Fluss setzen lassen. Eine ganze Flotte bewaffneter, schneller Kaperschiffe! Sie würden den Nachschub der Christenhunde, Allah jicharibhum, Allah verderbe sie, abfangen!
Bis William sich in der Abenddämmerung zum Tempel durchgefragt hatte, war die Zeit des Abendgebets verstrichen, und die gläubigen Juden waren schon aus dem Gebäude geströmt. Er sah den alten Turnbull mit einem hageren Mann in der Tür stehen, den seine Kopfbedeckung und sein langer Bart als Schriftgelehrten auswiesen.
William bekam noch mit, wie Melchsedek sagte: »Versteift Euch nicht auf das ›Mischen‹ des Blutes der Nachkommen ausgerechnet dieser beiden haniviim[25] « – Ezer schloss die Augen – »es trübt sich, wird unrein«, flüsterte er, laut genug, dass der Hinzugetretene es verstehen konnte. Turnbull drehte sich ärgerlich um, doch der Kabbalist ließ sich im Verkünden seiner Vision nicht stören, noch dämpfte er seine Stimme. »Beiden Linien ist der Untergang bestimmt. Der stauferische Adler wird nicht mehr lange fliegen, erschlagen sehe ich den letzten Löwen aus dem Hause Ayub«. Melchsedek starrte durch John Turnbull hindurch. »Ihr seid ein Hochzeitsbitter, der seinen Auftrag überlebt hat, die Brautleute sind längst zu Staub zerfallen.« Er seufzte tief und senkte jetzt seinen Blick in die Augen des Angesprochenen. »Erspart den Kindern, von den Greisenhänden der lebenden Toten berührt und vergiftet zu werden!«
John Turnbull erstarrte wie Lots Weib zur Salzsäule, sein Gesicht war aschfahl geworden, aber er wich nicht. William erwartete ungeduldig, dass sich der alte Herr still entfernen würde. John Turnbull tat ihm leid, selbst in seinem Altersstarrsinn. So nahm er den Zeugen in Kauf und sprach selbst den Ezer Melchsedek an.
»Großer Meister«, sagte er bescheiden. »Ihr werdet auf der Insel erwartet –«
»Ich weiß«, sagte der hagere Mann müde, »aber ich werde nicht mit Euch gehen!«
William war einen Augenblick sprachlos, er hatte diesen Widerspruch nicht erwartet. »Eure Aufgabe hat sich erledigt«, fügte der Kabbalist leise hinzu. »Lasst mich aus dem Spiel, das noch unsinniger ist als das vermessene der Prieuré!« Und er versetzte William noch einen Stoß: »Ihr betreibt es um des schnöden Mammons willen, und so ist Euer Ansinnen frevelhaft.«
Im Gegensatz zum alten Turnbull, dessen Versteinerung keine Reaktion erkennen ließ, gab sich William nicht geschlagen. Er hielt auch nicht die andere Wange hin, sondern mit dem Blut schoss ihm der boshafte Gedanke in den Kopf, mit welcher Skrupellosigkeit ein jeder im »Großen Plan« agierte oder als Rivale in »der Sache«. Die hatte er, William von Roebruk, Sekretarius des Grafen von Joinville, zu vertreten, und wenn es sein musste, ohne Samthandschuhe, ganz brutal.
»Ezer Melchsedek«, sagte er leise, »mag sein, dass die Kreuzfahrer Kairo nicht erobern werden – aber wenn sich unser Heer zurückzieht, bietet es sich an, den Weg über Alexandria zu nehmen –«
Der alte Turnbull erwachte aus seiner Starre und schaute befremdet auf den Franziskaner, den er bislang als gutmütigen Tölpel eingeschätzt hatte – ein Tor war dieser William wohl immer noch, aber ein gefährlicher, doch der ließ sich durch nichts beirren.
»Das Schicksal der jüdischen Gemeinde hier hängt von Eurer Kollaboration ab, Ezer Melchsedek! Ich muss Euch nicht in Erinnerung rufen, wie leicht unter solchen Umständen, Eroberung durch ein christliches Heer, das nach Schuldigen für seine Erfolglosigkeit sucht, gerade die Kinder Israels zu Opfern eines Pogroms werden –?«
Ezer Melchsedek schwieg. Es war, als schämte er sich für den, der die Drohung ausgesprochen hatte, mehr als vor sich selbst, der sich der Erpessung auslieferte. Doch das bemerkte nur John Turnbull, William keineswegs. »Vae, Vae, qui régis filiam das in manu leonis! Vae, qui profanas gloriam![26] – Ich werde Euch begleiten«, sagte der Kabbalist nach diesem jähen Ausbruch, der William nun doch erschauern ließ, und schloss ergeben die Augen. »König Ludwig und sein Heer werden Alexandria nicht zu Gesicht bekommen.«
William nickte befriedigt und warf dem alten Sonderbotschafter einen triumphierenden Blick zu. »Ich erwarte Euch morgen früh am Schiff«, sagte er wie ein siegreicher Feldherr.
»Wir fahren noch heute Nacht!« überraschte ihn Melchsedek, »und der Chevalier hier wird uns begleiten.«
William war's recht. Man soll den Bogen nicht überspannen.
Diarium des Jean de Joinville
Vor Mansurah, den 17. März A.D. 1250
Wir schmorten nun schon die sechste Woche in unserem aaligen Fett, gezählt ab der Schlacht von Fastendienstag. Und wenn man das Inferno, das uns in den Klauen hielt, noch so anregend beschreiben wollte, die Hölle steckte in uns, sie brannte in unseren eiternden Körpern, denen die Teufel das Fleisch bei lebendigem Leibe abrissen und das Blut aus den Nasen sogen.
Ich kämpfte gegen die teuflische Krankheit an, aber ich spürte, dass ich ihr nicht entkommen konnte, so wenig wie die sündige Seele dem glühenden Spieß, der sie unerbittlich in den siedenden Topf stößt, zu den Verdammten. Und das waren wir alle.
Zumindest nachdem die Ungläubigen uns den herbsten Schlag versetzt hatten, den wir bislang einstecken mussten, schlimmer als jede verlorene Schlacht und härter als all die Toten, die wir zu beklagen hatten. Ihnen blieb das Leiden erspart, das jetzt über uns kommen sollte. Es erklärte auch, warum die Ägypter uns so lange mit Angriffen verschont hatten.
Der neue Sultan hatte seine Macht etabliert und sich dafür Zeit gelassen. Die Muße schenkte ihm den genialen Einfall, eine Anzahl von Barken und Galeeren, die nordwärts im Delta lagen, so wie sie waren oder zerlegt, über Land zu schleifen und hinter uns wieder zu Wasser zu lassen, mit dem Erfolg, dass wir jetzt von jedem Nachschub abgeschnitten waren, kein frisches Fleisch mehr, kein Gemüse, keine Frucht – kein Wasser!
Wir hätten von der Blockade nicht einmal gewusst, wenn nicht ein paar kleine Boote des Grafen von Flandern dank ihrer flinken Ruderer durchgekommen wären und von des Sultans Kaperflottille hinter unserem Rücken berichtet hätten.
»Weit über achtzig von unseren Versorgungsschiffen, die von Damiette heraufgekommen waren, sind bereits aufgebracht worden! Ihre Mannschaften haben sie über die Klinge springen lassen!«
Sofort schnellten die Preise in unserem Lager in die Höhe: Ostern kostete ein Lamm dreißig Livres[27], ein Fässchen Wein zehn, und selbst ein Ei war nicht unter zwölf Deniers[28] zu haben.
Jenseits des Bahr as-Saghir, den 22. März A.D. 1250
Ich bin krank und kann mich nicht mehr auf den Beinen halten. Auch das Schreiben fällt mir schwer. Von William immer noch keine Spur, keine Nachricht – geschweige denn vom Ausgang seiner Mission, die mir nachgerade lächerlich vorkommen will.
Der König und seine Berater haben beschlossen, das Feldlager von Mansurah zurückzuverlegen, neben das des Herzogs von Burgund, das auf der anderen Seite des Flusses lag und näher am Nil. Um den Übergang zu sichern, ließ Herr Ludwig an beiden Brückenköpfen Tortürme errichten, die es nicht erlaubten, hoch zu Ross auf die Schiffsbrücke zu gelangen. Als diese Vorkehrungen abgeschlossen waren, wurden als erstes die Kranken und alles Gepäck hinübergeschafft. Ich weigerte mich, mich tragen zu lassen, sondern schloss mich dem königlichen Tross an, der dann als erstes übersetzte.
Kaum hatten die Sarazenen bemerkt, was im Gange war, bedrängten sie von allen Seiten unser Lager, doch unsere Nachhut war zahlreich genug, sie von dem Brückenaufgang fernzuhalten. Es stellte sich allerdings heraus, dass dort die Wehr zu niedrig war, sodass der Feind vom Pferd aus seine Pfeile unter die Abziehenden schütten konnte. Unsere Leute wehrten sich, indem sie den Anreitenden Steine und Uferschlamm ins Gesicht warfen, um sie so am Zielen zu hindern. Es war dann mal wieder der Graf von Anjou, der dazwischenfuhr und sie verjagte. Aber da war ich schon drüben und wurde nach einem neuerlichen Schwächeanfall in mein Zelt gebettet.
Plötzlich stand William da, klitschnass und verdreckt.
»Wenn Ihr, werter Herr«, schnaufte er, »Eure Adresse ändert, solltet Ihr das Euren Sekretarius wissen lassen. Fast hätte ich Order gegeben, mich auf der falschen Seite abzuladen!«
Das flämische Schlitzohr war durch keine Widrigkeit unterzukriegen! Während er sich mit Heißhunger auf mein Krankenmahl stürzte, begann er zu erzählen, wie er auf einer »Insel der Einbalsamierer« gelandet sei, nach einer gemeinsamen Reise in einer Sänfte mit dem Großwesir des Sultans, von dem doch jeder weiß, dass er von den Templern erschlagen wurde, dachte ich mir, sagte aber nichts. Mein Sekretarius stopfte weiter die Früchte in sich hinein, die mir Genesung verschaffen sollten. Dort habe er die Restaurierung des Robert d’Artois in Auftrag gegeben, vorrangig und von bester Qualität. Die weißen Brüder[29] vom »Orden der Zeitlosigkeit« hätten ihn sofort erkannt – »Wen?« fragte ich. »Den Grafen?«
»Nein, mich!« schmatzte mein William. »Ich bin ein fester Begriff in der Welt des Islam, mein Ruf-«
»Ihr wollt sagen: ein fetter Begriff!« versuchte ich zu scherzen, schwach wie ich war, und dachte an Schweinefleisch. »Ein Ruf wie die Trompeten von Jericho!«
»Das mögt Ihr wohl sagen und mich loben, denn dann bin ich nach Alexandria gereist und habe den besten Kabbalisten angeheuert, der dort an der berühmten Universität zu finden war, ein großartiger Gelehrter, der uns Verfechtern ›der Sache‹, der imperialen Herrschaftsgelüste der Capets und der munditia esoterica[30] der Johanniter große Dienste erweisen wird!« sprach mein Sekretarius mit vollem Munde, er muss wohl selbst dort eifrig studiert haben, und ich sagte nur:
»Und wo ist diese Leuchte geheimen Wissens?« Mein William war nicht auf den Kopf gefallen: »Ich habe ihn beauftragt, den wunderschön hergerichteten Pair von Frankreich –«
»Was?!«, unterbrach ich ihn. »Ihr habt den Herrn Robert nicht mitgebracht?«
»Ich habe ihn in ein würdiges Versteck schaffen lassen, bis die Umstände hier«, er wies durch den offenen Zelteingang auf das mehr hingeworfene als gestapelte Gepäck, den Dreck und die Abfälle unseres hastig errichteten Lagers, »es gestatten, den Toten, den lebendigen Toten«, korrigierte er sich, »angemessen und wohlüberlegt einzusetzen –«
»Und wo sitzt er jetzt?« Ich konnte meinen Spott nicht länger zurückhalten.
»In der Pyramide!« klärte mich mein Sekretarius auf, als sei das der normalste Aufbewahrungsort für einen Pair von Frankreich.
»In welcher Pyramide?«, fragte ich entgeistert.
»In der von Gizeh natürlich«, sagte William stolz und begoss sein Mahl mit einem tiefen Zug aus meiner Karaffe. »Ezer Melchsedek begleitet ihn und wartet dort auf uns.«
Ich musste schlucken. William reichte mir den Rest des Rotweins. »Mir scheint es«, sagte ich beherrscht, »wir bewegen uns grad entgegengesetzt, Kairo ist nicht länger das Ziel der bewaffneten Pilgerfahrt unseres frommen Königs. Ich seh' uns nicht am Fuß der Pyramiden –«
»Aber Ezer Melchsedek«, entgegnete William treuherzig. »Er hat uns dort gesehen, auch den König!«
Ich leerte die Karaffe bis auf den Grund und sagte: »Ich fasse zusammen: Der größte Kabbalist aller Zeiten, ein alttestamentarischer Seher, vor dem die uns überlieferten Fähigkeiten der Propheten zu Taschenspielertricks verblassen, reist mit Robert d'Artois – wie schaut er eigentlich nun aus?« Mir fiel die zu wenig Hoffnung verleitende Deskription der Turkupolen ein. »Es war ja nicht mehr viel von ihm übrig –?«
»Ich«, sagte William, nicht etwa kleinlaut, »ich habe ihn nicht wiedergesehen, aber Ezer –«
»Aha«, sagte ich, »also der leibhaftige Hermes Trismegistos –«
»Richtig!«, sagte William.
»– überführt den Grafen in das Grabmal der Pharaonen, ohne dass mein schlauer Sekretarius weiß, in welcher Grabkammer er ihn bettet.« Ich war jetzt doch leicht verärgert, für wie gutgläubig hielt er mich eigentlich? »War der Großwesir auch wieder dabei?«
»Nein«, sagte William, »aber der Chevalier du Mont-Sion!«
»Großer Gott«, sagte ich, »John Turnbull?« William nickte eifrig, und ehe ich meine Bedenken an den flämischen Schädel bringen konnte, beschwichtigte er: »Doch diesen Spion der Gegenseite konnte ich ausschalten. Als wir drei zur Insel der Zeitlosigkeit zurückkehrten, erfuhren wir, dass die Dinge sich hier zu unseren Ungunsten entwickelt hätten. Da erbot sich Ezer Melchsedek, allein weiter gen Süden zu fahren, denn für Christen sei dies nicht der geeignete Zeitpunkt. John Turnbull pochte auf seinen Status als Sonderbotschafter des Sultans, wobei das der Großvater des jetzigen war«, belächelte mein juveniles Schlitzohr die Senilität des Gegners, »doch ich bestach die Bootsleute –«
»Welche Bootsleute?«
»Es waren wohl Piraten«, räumte der Herr Sekretarius ein, »sie waren von den Weißen Brüdern herbeigerufen worden und nahmen uns alles Geld ab, dafür brachten sie uns sicher durch die Blockade, die der Sultan hat errichten lassen.«
»Und wo ist John Turnbull?«
»Er verließ dort das Boot und wurde von des Sultans Leuten respektvoll empfangen –«
»Und mein berühmter Sekretarius?«
»Mich warfen sie gleich danach ins Wasser, sodass ich schwimmend das Lager erreichen konnte und Euch jetzt wieder zu Diensten steh.«
»Danke, William« war alles, was mir dazu einfiel.
Zu den immer noch nicht verheilten Wunden, der jetzt offen ausgebrochenen Seuche, die von den griechischen Ärzten Blattern geheißen wird, hatte sich bei mir auch noch hohes Fieber eingestellt. Mein Priester Dean of Manrupt kam, um mir Messe zu halten. Er war selbst schwer erkrankt und grad im Moment der consecratio[31] drohte er ohnmächtig umzufallen. Ich sprang barfuß von meinem Lager und fing ihn auf. Ich hielt ihn in meinen Armen, bis er den Gottesdienst zu Ende gebracht hatte. Dann weinten wir beide bitterlich, aus unseren Nasen floss Blut.
Der König überwand seine Prinzipien, mit den Ungläubigen nicht zu verhandeln, und ließ eine Gesandtschaft zusammenstellen, die dem Sultan anbieten sollte, Damiette gegen Jerusalem zurückzugeben. Des Weitern sollte der Sultan für die Kranken und Verwundeten in Damiette sorgen, bis sie wieder transportfähig seien, sollte das Pökelfleisch trocken aufbewahren – die Muslime machten sich ja nichts aus Schweinernem – und die Belagerungsmaschinen ebenfalls, bis der Herr Ludwig Gelegenheit fände, jemanden zu schicken, um sein Eigentum abzuholen. Obgleich fast alle Barone von Outremer fließend Arabisch sprechen, legte der König Wert darauf, dass einer von seinen Herren dabei war. Wohl in Erinnerung an seinen früheren Hauslehrer, jetzt mein Sekretarius, bat er mich – samt William von Roebruk – an der Gesandtschaft teilzunehmen. Ich musste ihm absagen, aber ich schickte William.