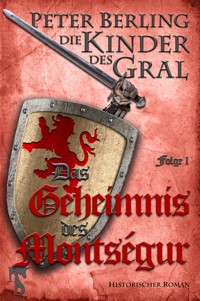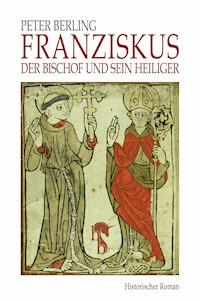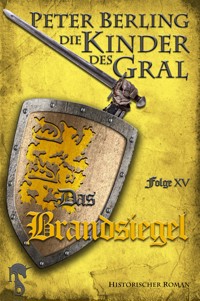3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Kinder des Gral
- Sprache: Deutsch
Für Roç und Yeza bricht endlich das große Abenteuer an. Denn der französische König Ludwig, der Heilige, der auf Zypern sein Kreuzritterheer versammelt hat, bläst zum Angriff. Zwar ist der Aufmarsch des riesigen Heeres in der islamischen Welt nicht unbemerkt geblieben, doch die knappe Zeit, die für Verteidigungsmaßnahmen geblieben war, haben die Nachkommen des großen Saladin, Emire und Sultane von Homs bis Damaskus, mit Intrigen und Mord in den eigenen Reihen vergeudet. Alle erwarten nun den Sturm auf Damaskus. Ludwigs Heer aber wendet sich Ägypten zu, sein Ziel ist Kairo. Dort residiert der mächtigste Sultan aller Muslime. Die Invasion des christlichen Heers aber wird zum Desaster – niemand hat damit gerechnet, dass diese gewaltige Armee, in deren Reihen sich auch Roç und Yeza befinden, im Schlamm des Nildeltas stecken bleiben könnte. Ludwig selbst wird gefangengenommen, in den Reihen der Kreuzritter bricht Panik aus und die Gralskinder stecken mittendrin … Ein spannender historischer Roman von Peter Berling, der gleichzeitig das große Epos »Die Kinder des Gral« aus der Zeit der Kreuzzüge als Teil V fortführt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 389
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
PETER BERLING
Kreuzzug ins Verderben
Folge V des 17-bändigen Kreuzzug-Epos Die Kinder des Gral
Historischer Roman
WAS DAVOR GESCHAH IN FOLGE IV
Die Piratin der Ägäis
Das Entkommen der ›Kinder des Gral‹ in die Ägäis gedeiht nur kurz zum abenteuerlichen Piratenleben auf der berüchtigten Triëre, der ›Äbtissin‹.
Sie geraten mitten unter das Kreuzzugsgeschwader Ludwig des Heiligen, König von Frankreich, in die gierig gereckten Krallen von dessen geistlichen Beratern – und stecken dazu noch zwischen den gnadenlosen Mahlsteinen der einander spinnefeinden Ritterorden von Johannitern und Templern. Der Kreuzzug hat Roç und Yeza nach Zypern verschleppt, wo sich das riesige Heer der Christen sammelt.
Ihre Flucht gerät zum tolldreisten Meisterstück, leider unter Zuhilfenahme eines völlig seeuntauglichen Fischerkahns. Als Schiffsbrüchige gestrandet, an die Küste Syriens gespült, fallen die alten Häscher noch entschlossener über sie her. Yves, der Bretone, der geheime Scharfrichter der Krone, ist ihr fürchterlichster Gegner. Doch die Assassinen werfen sich als die Schutzmacht der ›Königlichen Kinder‹ auf. Geborgen auf ihrer Festung, fühlen Roç und Yeza sich zum ersten Mal sicher, mit ihrer persönlichen Freiheit ist es erst mal vorbei. Klein ist der Schritt vom besorgten Heger zum strengen Wächter. ›Die Kinder des Gral‹ verzagen nicht, sie bauen auf ihre Freunde …
I LASTER IM HAFEN
Die Blaue Moschee
In dem Hohlspiegel auf der Plattform des Observatoriums von Masyaf flackerte ein Blitzen kurz auf, einmal, zweimal. Crean hielt sich zur Sicherheit die Hand vor das Auge, um besser hinüberblinzeln zu können zu dem Holzgestell, in dem schwenkbar der umgedrehte Rundschild hing, auf der Innenseite sorgsam mit Silberplättchen beschlagen. Er schaute zu seinem Kanzler hinüber, der sich auf seinem Lager aufgerichtet hatte.
Tarik ibn-Nasr war matt, aber hellwach. Das Funkeln, reflektiert von dem polierten Metall, wiederholte sich in mal kürzeren, mal längeren Abständen, wie auch die Dauer des Gleißens für das angestrengte Auge deutlich von verschiedener Länge war.
Mit halblauter Stimme las Crean die Nachricht: – »Der verjagte Emir von Homs – El-Ashraf[1]– sucht Unterstützung gegen An-Nasir. Frage: Wie sollen wir uns verhalten?« –
»Abwarten!«, sagte der Kanzler trocken. »Warum sollten die Hashaschyn in interne Streitigkeiten der Ayubiten[2]eingreifen?«
Crean antwortete nichts und justierte die Einstellung des Spiegels nun so, dass die Strahlen der Sonne gebündelt in ihm gefangen wurden, und schickte die bündige Nachricht gezielt über die Berge in die Ferne. Irgendwo am diesigen Horizont traf sie auf einen ähnlichen Spiegel. Sein Aufblinken war mit dem Auge nicht wahrnehmbar.
»Hier wimmelt es von Fledermäusen!«, flüsterte Roç. »Stimmt es, dass sie nachts den Menschen Blut aus dem Hals saugen?«
»Glaub' doch so was nicht!«, sagte Yeza. »Das verbreiten nur Leute, die nicht wollen, dass man bestimmte, geheime Orte betritt –«
»Und lassen ihre Schätze von Drachen bewachen.«
Yeza lachte ihn an: »Sieh mal, Roç, wie sie an der Wand hängen! Mit dem Kopf nach unten, Drachen tun so was nicht!«
Die Kinder krochen durch schmale Rinnen, über aufgewölbte, bizarre Kalkablagerungen.
»Ich war bei den Adlern!«, sagte Roç, vielleicht würde Yeza das beeindrucken. »Sie sind wirklich riesig, mit Krallen wie der Vogel Greif.«
»Du bist durch die Bibliothek gegangen, durch die Tür hinter dem Alten?«
Yeza ließ ihm auch diese Entdeckung nicht. Doch Roç gab nicht auf. »Die Gittertür ist nämlich unverschlossen, man kann sie öffnen, wenn man durchgreift, auf die Idee kommen die dummen Vögel nicht!«
»Sag nur«, endlich hatte er Yeza beeindruckt, »du warst im Ma'ua al Nisr, dem ›Nest der Adler‹?«
»Sicher«, sagte Roç, so beiläufig wie möglich, »das Gitter geht so nach innen auf, dass sie zurückgedrängt werden – außerdem waren sie gerade ausgeflogen.«
Roç genoss ihre Bewunderung. »Gleich dort steht nämlich der Giftschrank der Alten, der chasnih assumum. Die Adler schützen ihn, weil er furchtbar gefährlich ist.«
»Das ist gut zu wissen«, sagte Yeza, »wenn wir mal jemanden töten müssen, und es keiner wissen soll.«
»Das möchte ich lieber nicht«, schauderte es Roç, doch dann dachte er an Vitus von Viterbo[3], den hätte er auch mittels Gift umgebracht. Aber der war ja tot.
»Aber sag’s niemandem, das wir das Geheimnis kennen«, beschwor er Yeza, die sich jetzt an den Boden gepresst hatte und durch eine Öffnung in die Tiefe schaute.
»So schön stell ich es mir unter Wasser vor«, flüsterte sie aufgeregt, »es fehlen nur die Fische!«
Die Kinder hatten »Die Blaue Moschee« im Innern des Berges schon lange entdeckt, sie hatten sich durch Gänge und Höhlen bis zu ihrer Kassettendecke vorgearbeitet, aus der die Stalaktiten hinunterragten. Durch die von Menschenhand gebohrten Löcher, in denen an schweren Ketten die kristallenen Lüster hinabhingen, hatten sie schon oft ehrfürchtige Blicke in den prächtigen Saal geworfen, zu dem die natürliche Grotte unter ihnen umgestaltet worden war.
Doch vor allem Roç bestand darauf, das Heiligtum unbedingt auch von innen sehen zu wollen und zusammen mit den Gläubigen zum Gebet niederzuknien.
Ein Vorstoß bei dem alten Tarik, bei dem Yeza sonst alles erreichte, hatte beiden nur einen längeren Vortrag über den wahren Glauben eingetragen, der damit schloss, dass Ungläubige keine Moschee betreten dürften, sonst sei sie entweiht und der Frevler des Todes. Das hatte die Kinder wenig beeindruckt, doch sie verschwiegen sicherheitshalber, wie oft sie schon mit ihren Augen von oben in den verbotenen Raum eingedrungen waren.
Yeza versuchte einen letzten Durchbruch mit dem Hinweis, dass sie ja auch keine Christenkinder seien, sondern gar nichts, also auch alles –
»Also auch Muselmanen!« griff Roç ihre Beweiskette auf, doch der hinzugetretene Crean, der sowieso immer vor seinem Kanzler kuschte, verschreckte ihn mit dem Hinweis:
»Dann müssten wir dich ja sofort beschneiden?«
»Nein!«, rief da Yeza, denn das wusste sie genau, was das bedeutete, sie hatten es beide anhand des Pimmels von dem kleinen Mahmoud ausführlich studiert und diskutiert.
»Halla!«, sagte sie energisch. »Là taf'alu thalik!«[4]
Den von Roç wollte sie so behalten, wie sie ihn kannte, und dazu gehörte die Vorhaut mit allen ihren spielerischen Möglichkeiten.
Roç war durch ihren Einsatz das Gespräch noch unangenehmer geworden, und er hatte trotzig erklärt: »Wenn Ihr uns, den Königlichen Kindern, das Betreten der Moschee verweigert, dann sind wir auch keine Hashaschyn!«
Er merkte nicht, wie sehr diese Worte den alten Tarik trafen. Doch als kurz darauf John Turnbull, wohl als Vermittler in dieser heiklen Frage beauftragt, den Kindern anbot, ihnen einen Blick von der Schwelle aus ins Innere der Blauen Moschee zu gestatten, sagte Yeza: »Wir wollen nichts Halbes – und außerdem dürfen da nur Männer rein, die sich dafür initiieren[5]lassen. Richtig rein – ohne Abschneiden – und zusammen – oder gar nicht!«
Das erheiterte den John Turnbull. So liebte er die Kinder, und er war froh, noch nicht gestorben zu sein.
Ein armseliger Retter
Als der junge Emir El-Ashraf auf Masyaf eintraf, wurde er schweigend von den Wächtern hinauf ins Observatorium geleitet. Tarik ibn-Nasr empfing ihn in seinem Korbsessel sitzend, in kostbare Decken gehüllt. Rechts von ihm stand Crean im schwarzen Burnus, das Gesicht bis auf die Augen verhüllt wie ein Krieger der Wüste – er hielt eine Streitaxt waagrecht von sich gestreckt –, und links standen hintereinander drei junge Assassinen. Der vorderste hielt senkrecht drei Dolche, die so ineinander gesteckt waren, dass immer die Klinge des einen im Schaft des anderen steckte.
So wusste der Emir gleich, dass der, vor dem er stand, stellvertretend für den Großmeister der Assassinen sprach, denn nur diesem stand solcher Auftritt zu.
El-Ashraf war kein Held, ein schielendes Auge gab ihm etwas Verschlagenes, und dazu kam jetzt noch die Furcht, sein Leben verlieren zu können, denn woher sollte er wissen, ob nicht sein Vetter An-Nasir dafür gezahlt hatte, dass ihm der Kopf abgeschnitten würde. Er begann am ganzen Leib zu zittern und brachte kein Wort heraus.
Tarik sagte: »Wir wissen, weswegen Ihr uns die Aufwartung macht, El-Ashraf. Als Ihr noch in Homs saßet, habt Ihr dergleichen nicht für nötig gehalten, noch uns den Tribut gezahlt.«
Da fürchtete sich El-Ashraf noch mehr, er warf sich zu Boden und rief: »Sagt mir, erhabener Meister, was ich Euch schulde, und ich will es Euch geben – sobald ich wieder in Homs Einzug gehalten habe.«
»So wollt Ihr Eure Schuld nicht noch erhöhen«, sagte Tarik, »indem Ihr von uns Truppen ausleiht, denn es gibt eine Höhe von Schulden, die an eine Rückzahlung nicht mehr denken lässt, und daher nur noch mit Blut zu begleichen ist?–«
»Nein, nein!«, rief der Emir verwirrt. »Ich werde Homs aus eigener Kraft zurückgewinnen, und dann will ich Euch –«
»Soviel zahlen«, unterbrach ihn Tarik kühl, »wie An-Nasir, seitdem er dort herrscht –«
»Ja, ja«, stotterte El-Ashraf, immer noch gegenwärtig, dass sein Vetter schon den Korb geschickt hatte, in dem er sein Haupt zu sehen verlangte.
»Ihr wollt also keinen unserer Bogenschützen, keinen unserer Soldaten mit Dolch und Axt?«, fragte Tarik noch mal.
»Nein, wirklich nicht – Ich wünsche Euch ein langes Leben im Wohlgefallen Allahs, des Gerechten!«
»Dankt Allah«, entließ ihn Tarik, »und seid unser Gast, solange Ihr nicht wisst, wohin Ihr Euer Haupt betten sollt, ohne dass es Euch jemand abschneidet, um An-Nasir zu erfreuen.«
Der junge Emir war leichenblass geworden, er stürzte vor und bedeckte die Decke, unter der er die Füße des Kanzlers vermutete, mit Küssen. Auf einen Wink hin ergriffen ihn die Wächter und zogen ihn wieder hoch.
»Geht jetzt in Frieden!«
Sie begleiteten den Wankenden die steile Wendeltreppe hinunter. Unten angekommen, übergab er sich.
»Jetzt kann der Spiegel unsere Antwort senden«, wies der Kanzler Crean an, »das ist kein Mann, der An-Nasir die Stirn bietet«, und zum ersten Mal glaubte dieser das Zucken eines ironischen Lächelns um die müden Augen seines sonst so undurchdringlichen Meisters bemerkt zu haben: »Keine Unterstützung.«
Die Nasen der Kinder hatten schon mitbekommen, wie übel dem Gast auf Masyaf mitgespielt worden war, ehe sie ihn zu Gesicht bekamen und ehe ihre Ohren hörten, dass es der vertriebene Emir von Homs sei.
Da wurden sie natürlich sofort hellhörig, und sie stürmten durch die Gärten des Großmeisters und überfielen Clarion und Madulain, die sich in Ermangelung anderer Abwechslung das sehnsüchtige Klagen Hamos nach seiner verlorenen Prinzessin Shirat anhörten.
»Mortz sui si s'amors no-m deynha,
qu'ieu no vey ni-m puesc penssar
vas on man ni-m vir ni-m tenha,
s'ilha-m vol de si lunhar;
qu'autra no-m plai que-m retenha,
ni lieys no-m puesc oblidar;
ans ades, quon que m'en prenha,
la-mfai mielhs amors amar.«[6]
»Wir können sie befreien!«, unterbrachen sie das ziemlich unmelodische Gestöhn und berichteten von dem fremden Emir, dem Homs eigentlich gehöre und der sich daher sicherlich dort gut auskennen müsse.
»Ai las, e que-m fau miey huelh,
quar no vezon so qu'ieu vuelh?«[7]
Hamo nahm mit gebrochenem Herzen, zumindest mit brüchiger Stimme, sein Wehklagen wieder auf. Madulain bereute schon lange, dass sie ihm dafür ihre Laute geliehen und ihm beigebracht hatte, sie zu schlagen.
»Chantan prec ma douss'amia,
si-l plai, no m'auci'a tort,
que, s'ilh sap que pechatz sia,
pentra s'en quan m'aura mort;
empero morir volria
mais que viure ses conort,
quar pietz trai que si moria
qui pauc ve so qu'ama fort.
Ai las, e que-m fau miey huelh,
quar no vezon so qu'ieu vuelh?«[8]
Roç behauptete einfach: »Der Emir kennt jeden unterirdischen Gang zu seiner Zitadelle und jeden Kerkermeister bei Namen!«
Da hörte Hamo sofort auf zu seufzen, vor allem, als es aus Madulain herausbrach, sie habe schon lange die Nase voll von diesem öden Masyaf und würde sofort mitmachen.
Als auch Roç und Yeza erklärten, die Hashaschyn hätten sich nicht als würdig erwiesen, sie, die Königlichen Kinder in ihren Mauern zu beherbergen, war die Verschwörung zur Flucht aus der Assassinenfeste und das Eindringen in die Kerker von Homs eine beschlossene Sache.
Nur Clarion zeigte sich noch ängstlich, wollte aber auf keinen Fall allein in Masyaf zurückbleiben.
Als erstes war jetzt ein Geheimgespräch mit dem Emir in die Wege zu leiten. Die Kinder wussten bereits, wo er untergebracht war, und standen plötzlich vor seinem Bett.
El-Ashraf fuhr schweißgebadet aus seinem Mittagsschlaf, als er Yeza sah, die mit ihrem Dolch herumfuchtelte. Roç hatte sich ausbedungen, den jungen Emir überreden zu dürfen, ohne dass sie ihm ins Wort fiele:
»Edler Herr«, begann er, »die Kühnheit Eures Gemütes, die Stärke Eures Armes und die Verschwiegenheit Eurer Lippen«, er holte tief Luft, bevor er fortfuhr, »haben zwei der schönsten Huris[9]des Paradieses, zwei Blüten am Rosenstrauch des geheimen Gartens, zwei reife Früchte am Baum der Versuchung und der Erfüllung bewogen, Euch durch uns Botschaft zu geben, dass sie bereit sind, Euch die verborgenen Kammern ihrer … ihrer … die Kammern …«
Roc hatte den kunstvollen Faden verloren.
»Ihrer Herzen!«, flüsterte Yeza.
»Richtig: ihrer Herzen zu öffnen!« beendete Roç seine Einladung.
El-Ashraf war nicht weniger verwirrt als vorher. »Wieso zwei?«, fragte er.
»Das ist so«, sagte Yeza, und als El-Ashraf keine Anstalten machte sich zu erheben, sagte sie: »Zwei oder keine, jetzt oder nie!«
Dabei fuchtelte sie noch mehr mit ihrem Dolch herum, denn sie hatte wohl bemerkt, dass sie dem Emir damit Angst einjagte.
Der sprang jetzt auf und sagte: »Dann will ich mich sogleich erfrischen.«
»Nein«, sagte Roç, »erfrischen könnt Ihr Euch am Tau der Rosen, wenn er in des Morgens Früh –«
»Bei den Huris gibt's Wasser!«, unterbrach ihn Yeza knapp.
El-Ashraf folgte kopfschüttelnd den Kindern durch eine Tür, die er vorher nicht bemerkt hatte. Sie führte in die Tiefe.
Yeza und Roç lagen flach auf einer der Außenmauern und starrten sich aus leicht glasigen Augen beglückt an. Dann mussten sie beide völlig unmotiviert lachen.
Sie hatten ihre einzigen Freunde, die Weißbärtigen, in der Bibliothek besucht und waren mit der freudigen Nachricht empfangen worden, das Haschisch sei nun bereit.
Die Alten holten ein Gefäß hervor, das aussah wie eine große Teekanne, innen drin gluckerte auch Wasser, nur dass Schläuche herausragten mit Mundstücken am Ende.
Sie hockten sich alle im Kreis um die Nargila[10]; der Älteste tat das Haschisch in kleinen Klümpchen in die oberste Kammer des Gefäßes hinein und zündete es mit glühender Holzkohle an. Dann klappte er den Deckel zu, und alle griffen zu den Mundstücken. Das Wasser blubberte in der Kanne, aber in den Mund bekam man den kühlen Rauch.
Yeza musste husten, auch Roç hätte sich beinahe verschluckt, doch er achtete genau darauf, wie es die Alten machten, und sog in kleinen Zügen an seiner Pfeife.
Bald war den Kindern schwummerig geworden, sie hatten sich an der Hand gefasst und, sich gegenseitig stützend, schiebend und ziehend, waren sie durch den Lichtschacht hinaufgekrochen und ins Freie getaumelt. Wie in Trance hatten sie ihren Lieblingsplatz auf der äußersten Umfassungsmauer erreicht, keinmal der Steilheit achtend, mit der sie in die Tiefe fiel, obgleich ihr schwindelerregender Pfad über die Mauerkronen sich manchmal so verengte, dass sie hintereinander gehen mussten. Während sie sonst ihr Ziel Schritt für Schritt erreichten, hatten sie diesmal jede Fährnis mit schlafwandlerischer Sicherheit überwunden.
Da lagen sie nun glücklich und erschöpft und versuchten, Ordnung in ihre Gedanken zu bringen.
»Ich verstehe jetzt«, keuchte Roç »dieses Khif-Khif macht die Hashaschyn alle Gefahren vergessen –«, und er lachte.
»Der Emir Schielauge hat sich fast in die Hose gemacht, als du ihm gesagt hast –«
Yeza fand das in der Erinnerung auch furchtbar komisch – »Wir dringen in Homs ein, setzen ihn wieder auf seinen Thron und holen Mahmoud und Shirat aus dem Kerker!«
»Und dann verheiraten wir Hamo mit seiner Prinzessin und feiern ein großes Fest! «
»Komm, Roç, tanz mit mir!« lachte Yeza und versuchte sich aufzurichten, sie schaffte es nicht und entsann sich stattdessen des Fortgangs der Geschichte:
»Schielauge, der große Feldherr, sagte: ›Wir brauchen Truppen!‹«
»Eine ganze Armee!«, fügte Roç giggelnd hinzu. »Schielauge macht der Clarion schöne Augen!«
»Ist nicht wahr! Schielauge schielt nach Madulain!«
»Und da hat Hamo gesagt –«
»Nein«, beharrte Roç, »ich habe gesagt: ›Hamo, du gehst nach Antioch und leihst dir von Bo die Truppen!‹«
»Eine ganze Armee, um Homs zu befreien!«
Die Kinder wurden still und schauten von der Mauer in die Ferne.
»Jetzt ist Hamo schon eine ganze Woche weg«, sagte Yeza ernsthaft.
»Beim nächsten Vollmond werden wir ihn treffen.«
»Mit den Truppen aus Antioch – ob Bo wohl mitkommt?«
»Liebst du den Bo?«, fragte Roç unvermittelt.
»Er will mich heiraten«, sann Yeza nach, »aber er ist mir zu langweilig. Ich denke oft an Robert d 'Artois –«
»Mehr als an mich?«, fragte Roç angstvoll.
»Du bist mein lieber Ritter –«
»Wie sehr?«
Yeza kannte die Antwort. Ihre Hand war schon unter sein Hemd gekrochen und schob sich in seine Hose vor.
Roç seufzte und sagte dennoch: »Wie sehr?«
Das gehörte zum Ritual. Hätte er es nicht gesagt, hätte Yeza ihre Hand zurückgezogen. Er wäre ihr auch so gern zwischen die Beine gegangen, dort, wo jetzt schon ein weicher Haarflaum den Eingang zum Nest verbarg, aber Yeza hatte es ihm verboten, sie könne es nicht ertragen. So war er auf ihre Hand angewiesen, die jetzt mit sicherem Griff sein Glied umschloss. Yeza tastete nach seiner Vorhaut und murmelte wie einen Abzählvers:
»Naqus, la naqus![11]« eingedenk Creans grausamen Vorschlags. »Naqus! La naqus!«
Yeza hätte so gern gesehen, was ihr da zwischen den Fingern wuchs und sich verhärtete, doch die Zeiten waren lange vorbei, dass sich Roç ihr nackt zeigte oder sie sein Glied aus der Hose ans Tageslicht befördern durfte.
»Naqus! La naqus!« rief sie leise, doch ihr Atem wurde schneller. Roç krümmte sich.
»Halt mich fest!« keuchte er, und sie spürte, wie sein Glied in ihrer Faust pulsierte und etwas Warmes ihr zwischen den zusammengepressten Fingern hervorquoll.
»Yeza!«
Ihre Bewegungen wurden matter. Sie fühlte sich todunglücklich. Lediglich das Leuchten in den Augen von Roç, als der sie jetzt endlich wieder ansah, gab ihr Befriedigung. Wenigstens er war zu seinem Glück gekommen.
Sie zog ihre Hand aus der Hose und wischte sie bedächtig auf seiner Brust ab. Dann küsste sie ihn auf den Bauch, und er war endlich so lieb, ihr den Hals zu küssen und mit der Zunge in ihr Ohr zu fahren.
»Also«, sagte Roç, »das ist immer noch schöner als Khif-Khif!«
Dann sah er, dass Yeza weinte. Er zog sie zu sich, als sie ihm den Rücken zudrehte. Er schob sein Knie unter ihrem Po zwischen ihre Beine und wiegte sie sanft, während seine Lippen ihren Hals liebkosten. Sie presste sich in ihn hinein, und er ließ nicht nach in allem, was sie ihm mühsam beigebracht hatte, bis ein Zittern durch ihren zarten Körper ging und er wusste, dass sie zu weinen aufgehört hatte. Behutsam lockerte er seinen Griff, und sie rollte von ihm weg.
Roç war verunsichert. »Yeza, woran denkst du?«
Sie hatte einen Blick über die Mauerkrone getan und drehte sich jetzt zu ihm um.
Diese Augen, dachte er, ich werde nie von diesen Augen loskommen!
»Heute ist der halbe Mond, ganz wie damals, als wir Hamo losgeschickt haben«, sagte Yeza leise, und Roç verstand.
»Madulain hat gesagt, jede gelungene Flucht besteht aus drei Schritten: verschwinden – gesucht und vergessen werden – und drittens der eigentlichen Flucht!«
»Ja«, sagte Yeza, »sie ist sehr klug, keine dumme Gans wie Clarion –«
»Und Schielauge ist ein Schaf, hoffentlich verderben die nichts, wenn wir nicht mehr zu sehen sind.«
»Heute Nacht müssen wir unter die Erde, Madulain wird uns immer zu essen hinstellen bei der Göttin.«
»Mir tut nur der liebe John Turnbull leid und der gute Tarik, ich schäme mich fast, ihnen einen solchen Kummer zu bereiten!«
»Roç«, sagte Yeza, »ein Ritter schaut vorwärts. Wir müssen auch leiden, und denk' an Mahmoud und Shirat! Sollen wir sie in den Kerkern von Homs schmachten lassen?«
»O Homs!«, stöhnte Roç. »Ich mag gar nicht daran denken – vielleicht sollten wir für unsere Armee ganz viel Haschisch mitnehmen – mit Khif-Khif geht alles leichter!«
Da mussten sie beide wieder lachen.
Oben auf der Plattform standen die beiden Alten. John Turnbull, der alte Ketzer und unruhige Geist, Initiator der Rettung von Montségur, erfüllt von schwärmerischer Leidenschaft für das Schicksal der Kinder, und Tarik ibn-Nasr, der kühle Planer und Vollstrecker aller Maßnahmen zu ihrer Sicherheit. In einem Winkel seines Herzens nistete eine stille Zuneigung, fast eine Schwäche für Yeza und Roç, den Erben des Gral. Johns Augen schimmerten feucht, er konnte den Blick nicht abwenden von den beiden da unten auf der Mauer.
»Ihr braucht Euch Eurer Tränen nicht zu schämen, alter Freund«, sagte der Kanzler, »bei aller ungewissen Zukunft verfügen unsere kleinen Könige doch schon über ein gewaltiges Reich, den kostbarsten Schatz, den Allah zu gewähren vermag, den ihrer Liebe zueinander!«
»Insch'allah[12]«, murmelte John Turnbull, »ich bin ja so froh, dass sie sich bei Euch wohlfühlen – und wie sehr wird ihnen erst Alamut gefallen, die Blume des Paradieses –«
»Ihr kennt es ja nicht«, wandte Tarik ein, was Turnbull nicht davon abhielt, emphatisch fortzufahren: »Das Wunder in der Wüste, eine stählerne Rose im Fels, entstanden aus der chymischen Hochzeit[13]von Wasser und Feuer! Wenn die Kinder es erreichen, werden es meine Augen gesehen haben, mehr wünsch' ich mir nicht mehr von diesem Leben!«
Sie traten zurück unter das Vordach und begaben sich zur Ruhe. Der Abend dämmerte in der Ferne herauf, und der Mond zeigte seine letzte feine Sichel.
Der doppelte Herr de Joinville
Diarium des Jean de Joinville
Limassol, den 2. April A.D. 1249
Von der Terrasse meines Quartiers aus konnte ich das freigelassene Geviert auf dem Hafenkai gut einsehen. Meine Taverne »Zur schönen Aussicht« wäre sicher die bessere Zuschauertribüne gewesen, aber eigentlich liegen mir solche Spektakel wenig. Seit der König in Nicosia weilte und dort seine Gäste empfing, hatte hier in Limassol die Disziplin des sich ständig vergrößernden Kreuzzugheeres noch mehr nachgelassen. Das Verpflegungsamt des Hofes hatte nie mit einer so langen Liegezeit gerechnet. Und ein Ende war immer noch nicht abzusehen, obgleich es jetzt hieß, der König kehre zurück, um die letzten Vorbereitungen für den Aufbruch zu treffen.
Die Folge des untätigen Verweilens waren immer mehr Streitigkeiten, oft mutwillig vom Zaun gebrochen, und der Mangel an Nahrungsmittel führte erst zu gereizter Unzufriedenheit, zu Plünderungen in der Umgebung, schließlich zu Räubereien untereinander. Die Leute wollten weg.
Jedes Entfernen von der Truppe aber hatte der König aufs Strengste verboten, schon um dem Feind keine Informationen zuzuspielen. Es war immer mal wieder vorgekommen, dass einige mit Hilfe von bestochenen Fischern die Insel verlassen hatten. Wurden sie von den, seit dem geglückten Ausbruch der Triëre von Otranto, vor der Küste patrouillierenden Schiffen der Johanniter aufgegriffen, gab es Prügelstrafen und Karzer – wenn es sich um Gemeine handelte. Ein paar waren auch wohl von ihren Herren aufgeknüpft worden.
Jetzt, in absentia[14]seines königlichen Bruders, führte der Graf von Anjou das Regiment, und wer ihn kannte, wusste, dass er hart durchgriff. Ausgerechnet in diesen Tagen hatte den Herrn Oliver von Termes der Hafer gestochen, es hatte auch wohl Streit zwischen ihm und dem Anjou gegeben, jedenfalls glaubte er sich berechtigt, nicht länger verweilen zu müssen.
Ihm hatte sich einer der Pagen des Hofes angeschlossen, der junge Jacques de Juivet, was ich ihm nachfühlen konnte, denn seit der Schmach, die ihm der Angel von Karos vor aller Augen angetan, konnte er sich vor Hänseleien nicht mehr retten. Er war ein Kind der Auvergne und hatte zuvor ein frohes Gemüt bewiesen, wenn er mich abholte, weil mein König mich zu sehen wünschte. Jetzt übermannte ihn die Scham, wenn er sich überhaupt noch irgendwo zeigen musste.
Der Herr Oliver dürfte seine Flucht so ungeschickt bewerkstelligt haben – oder er war denunziert worden –, dass die Schergen des Anjou – angeführt von Yves dem Bretonen, wie alle gesehen hatten – sein Schiff schon enterten, kaum dass es die Segel gesetzt hatte. Der Graf von Anjou zwang Yves den Bretonen, der den Deserteur ja »in flagranti« gestellt hatte, dies beim Konnetabel anzuzeigen. Das eiligst zusammengetrommelte Hofgericht konnte gar nicht anders als, den Direktiven des abwesenden Königs folgend, Anklage wegen Fahnenflucht und Verrat vor dem Feinde zu erheben. Die Johanniter erhoben Anspruch auf ihre Rechte als Wächter und erzwangen die Auslieferung des Oliver von Termes, den sie auf ihrer Burg einkerkerten bis zur Rückkehr des Königs, denn nur dem stünde zu, über einen Noblen Frankreichs zu richten. Der Anjou aber wollte unbedingt ein Exempel statuieren. Die Fischer waren sofort am Mast ihres eigenen Schiffes aufgeknüpft worden, aber das genügte ihm nicht. Also wurde der junge Jacques de Juivet – aufgrund der Angaben Yves – zum Tode verurteilt.
William war jetzt auch an meine Seite getreten, wir sahen, wie der Junge zum Richtblock geführt wurde, die Wachen drängten die gaffende Menge zurück, der Scharfrichter hob sein Schwert – und der Kopf des armen Jacques rollte über das Pflaster des Kais. William starrte noch eine Zeit lang versonnen auf das Treiben im Hafen. Er muss wohl gedacht haben, wie oft er an solch blitzschnellem Verlust seines flämischen Bauernschädels um Haaresbreite vorbeigeschrammt war.
»Solches zu vermeiden, lieber William«, sagte ich, »solltet Ihr Euch stets der Vorsicht befleißigen, die ich bei allen meinen Handlungen zum obersten Gebot mache. Denn was nützen Ruhm und Ehr und angehäufter Reichtum, Pfründe und Titel, wenn man seinen Gegnern die Möglichkeit einräumt, unseren Leib oberhalb des Kragens zu verkürzen.«
»Ich denke darüber nach, mein Herr, ob das nicht alles eigentlich zulasten des Bretonen angezettelt wurde. Ist es nicht ein merkwürdiger Zufall, dass die Flucht exakt zusammenfällt mit dem einzigen Tag, an dem Yves nach Limassol zurückkam, um des Königs wollenes Halstuch zu holen, das der vergessen hatte – und ohne das er fürchtet, sich in den Bergen von Nicosia zu verkühlen. Irgendjemand will den Herrn Yves hinter dem Rücken des Königs wegschießen. Es wurde ihm eine Falle gestellt. Simon de Saint-Quentin, die Ratte, war ebenfalls auf dem Schiff. Gegen ihn wurde keine Anklage erhoben. Hingegen wurde der Bretone auch noch und wider Willen gezwungen, für die Durchführung der Exekution Sorge zu tragen und sie persönlich zu überwachen.«
»Ihr meint, Yves der Bretone sollte in seinem bekannten Eifer für Recht und Ordnung dazu gebracht werden, über jedes vertretbare Maß hinaus zu agieren?«
»Der König hat viele Ratgeber«, sagte William, »aber nur einen, der ihm hündisch treu ergeben ist. Da er aber weder käuflich noch stupid ist, muss er ausgeschaltet werden, wenn jemand seine Majestät beeinflussen will!«
»Oder«, sagte ich, »jemand will Yves in die Hand bekommen und sorgt dafür, dass die schützende Hand des Königs voller Abscheu vom Haupt des Bretonen abgezogen wird.«
»Aber wer sollte das wollen?« Mir war es nicht einsichtig.
»Die gleichen, die mir noch mein Leben lassen«, sagte William, »ich habe Euch verschwiegen, weil ich Euch nicht unnötig aufregen wollte und weil ich es sowieso abgelehnt hatte, dass Oliver von Termes auch mir die Mitreise angetragen hatte, mit der Begründung, ich hätte hier auf Zypern doch sowieso nichts mehr verloren. Und was meint Ihr, wer mich warnte, das Angebot anzunehmen? Ausgerechnet Simon de Saint-Quentin und Euer werter Herr Vetter!«
»Ich bin sprachlos.« Das war ich auch.
»Man braucht mich noch«, war Williams Folgerung.»Aber was haben beide Vorgänge inhaltlich gemeinsam?«
»Die Kinder?«, fragte ich, und ich sagte nicht, was ich dachte, nämlich, dass das Interesse an meiner Person zugenommen hatte, seitdem ich William eingestellt hatte. Mit ihm direkt mochte sich keiner einlassen, so bemühte man sich um den Herrn des Dieners. Ich stand in der Gunst des Königs, William hatte das Vertrauen der Kinder.
»Und weil dem so ist«, sagte William, »und ich – Ihr mögt es nun glauben oder nicht – mich Euch aus purer Lust angeschlossen habe, nur davon getrieben, weiter in ›die Sache‹, die Sache der Kinder, verwickelt zu bleiben, lasst uns nun festlegen, wie wir mit dem Schreiben der diesbezüglichen Chronik verfahren –?«
»Auch wenn Ihr mir unterstellt, ich handelte nur aus Gier nach Besitz, lasst mich festhalten, dass auch Lorbeeren aus geistiger Betätigung, sprich der Nachruhm eines bedeutenden Chronisten, für mich hinreichender Beweggrund sind. Und deswegen mache ich Euch folgenden Vorschlag zur Güte: Wir schreiben beide, jeder, wann er will und was er mag, aber das sei für einen Außenstehenden nicht erkennbar!«
»Wie?«, sagte William. »Ich soll als ›Ich‹ schreiben und dabei denken ›Ihr‹ seid es, der denkt und meine Feder lenkt?«
»Denken mögt Ihr, was Ihr wollt, und ich lenke auch nicht Stil oder Inhalt, Ihr seid einfach mein alter ego[15],ich bin höchst neugierig, was dabei herauskommt –«
»Damit Ihr es nicht mit Euren eigenen Kreationen verwechselt, werde ich also auch immer als ›A.E. von Joinville‹ das Geschriebene signieren.«
»Mögen sich meine Nachfahren darüber den Kopf zerbrechen!« lachte ich. »Lasst uns jetzt in der Taverne ›Zur schönen Aussicht‹ die Geburt eines incubus scriptoris[16]begießen!«
Diarium des A.E. de Joinville
Limassol, den 9. April A.D. 1249
Der König, der nicht der meine ist, wenngleich ich ihm von Herzen wohlwill und ihm als Seneschall treu diene, kehrt aus Nicosia zurück. Er hatte fast drei Monate im Landesinneren verweilt, drei Monate zu lange, denn hier im Heerlager ist die Stimmung inzwischen nahe an der Meuterei, die Verpflegung wird immer miserabler, die Vorräte sind längst aufgebraucht, und die Felder und Scheuern der Bauern sind leergefressen, als seien Heuschrecken oder eine Mäuseplage durchgezogen.
Dazu kommt der Terror des Angel von Karos im Hafen, gegen den keiner etwas unternimmt, obgleich es doch für die Johanniter wie für den Anjou ein Leichtes wär', dem wüsten Treiben der Griechen ein Ende zu machen. Es kann doch nicht an den inzwischen auf ein gutes Dutzend angewachsenen Schiffen des ›Despotikos‹ liegen, die keiner von der Teilnahme am Kreuzzug vergraulen will, dass keiner den Riesen ernsthaft in seine Schranken verweist? Aber selbst der Anjou, der ansonsten seine Schreckensherrschaft in der Stadt rigoros durchsetzt, scheint auf dem griechischen Auge blind zu sein. Alle hoffen auf die Rückkehr »normaler« Zustände, jetzt, da der König wieder in den Palast einzieht.
An der Seite der Königin Margarethe schreitet Marie de Brienne[17], die arme Kaiserin von Konstantinopel. Ihr Mann, der Kaiser Balduin[18], hat sie ausgeschickt, bei Herrn Ludwig Hilfe zu erbitten gegen den griechischen Kaiser von Nicäa[19]. Ludwig kann natürlich jetzt keinen Mann entbehren, denn es soll ja nun gleich losgehen – sobald das leidige Transportproblem gelöst ist. Auch wird sich der König wohl gesagt haben, dass dies »Lateinische Kaiserreich« gegen den Paläologos[20]nicht zu halten ist, nachdem die Rechnung nicht aufgegangen ist: Die Griechen würden unter einer aufgepropften römischen Kurie und fränkischen Regierung glücklicher als unter ihrem eigenen degenerierten Kaiserpack!
Diarium des Jean de Joinville
Limassol, den 14. April A.D. 1249
Natürlich hat für Herrn Ludwig der Kreuzzug, quasi sein Lebenstraum, den er jahrelang unter größten Opfern vorbereitet hat, absoluten Vorrang. Auch sind ihm Kriege von Christen gegen Christen zuwider, es reicht ihm, dass er im Süden seines »eigenen« Landes, in Okzitanien, ein Unternehmen zu Ende führen musste, das sein Großvater schon begonnen, bei dem außer Ketzern auch viele Anhänger der Kirche umgekommen waren. Das war auch der Grund, dass er den Oliver von Termes, dessen Vater von den Franzosen damals erschlagen wurde, sofort begnadigte und ihm seinen unbedachten Schritt verzieh. Sehr zum Ärger des Anjou. Die größte Sorge bereitete Herrn Ludwig das Fehlen von Schiffsraum, denn viele Truppen waren von kurzfristig angemieteten Schiffen auf Zypern angelandet worden und mussten jetzt weiterbefördert werden. Die Venezianer, die den gesamten Kreuzzug missbilligten, hatten schon vor seiner Ankunft ihre hier stationierten Flotteneinheiten abgezogen. Das Interesse ihrer Handelsbeziehungen zu Kairo überwog, und so hatte die Serenissima Herrn Ludwig abblitzen lassen.
Der König setzte dann auf Genua. Die ligurische Seerepublik war auch höchst begierig, die von Venedig geschaffene Lücke auszufüllen. Aber ausgerechnet in diesen Monaten, genau genommen seit dem Winter, hatten sich die Genuesen auf einen Seekrieg mit Pisa um irgendwelche Niederlassungsrechte in Akkon und entlang der Küste des Heiligen Landes eingelassen und diesen unerwarteterweise verloren. Und Pisa war kaiserlich. Der König schrieb also an Friedrich, erhielt aber keine Antwort. Er wusste natürlich, dass der Staufer den Kreuzzug mit höchstem Misstrauen beobachtete, denn nominell war sein Sohn Konrad König von Jerusalem, und der hätte zumindest gefragt werden müssen. Aber Herr Ludwig konnte Friedrich auch schlecht sagen, dass – was jeder aufmerksame Stratege längst als gegeben ansah – er sein Heer gar nicht in oder über die Terra Sancta führen wollte, sondern unvermittelt gegen Kairo. Denn dazu war ihm der Kaiser zu eng mit dem Sultan befreundet. Es blieb also nur die ramponierte Flotte der Genuesen, wenn man Pisa dazu bewegen konnte, diese Operation, wenn schon nicht zu unterstützen, so doch wenigstens zu dulden. Eine fatale Situation, denn die Zeit drängte.
Diarium des A.E. de Joinville
Limassol, den 15. April A.D. 1249
Die Lösung wäre natürlich ganz einfach herbeizuführen, nämlich mit Geld – barem Geld, denn Versprechen auf Handelsrechte verfangen bei allen drei Seerepubliken nicht mehr. Sie besitzen bereits alle, die verfügbar sind – weswegen sie sich ja schon untereinander streiten! Und die in Ägypten, über die König Ludwig ja seriöserweise noch nicht verfügen kann, die sehen sie eher gefährdet. Venedig würde das Heer sogar kostenlos transportieren: zurück nach Frankreich! Es bleibt, so sage ich, A.E. de Joinville, mir, nur eine Aussöhnung zwischen Pisa und Genua, und zwar eine mit Geld versüßte. Wer, frage ich mich also, sind die möglichen Mittler in dieser Angelegenheit, in der sich Herr Jean de Joinville als Friedensstifter höchsten Ruhm und Dank des Königs erwerben könnte? Und wenn es nur ein befristeter Waffenstillstand wär! Ich denke da an die erprobten Bande zwischen dem Orden des heiligen Johannes und den Genuesen, während die Pisaner sich vielleicht beschwichtigen lassen, wenn der Rat aus den Reihen derer käme, die dem Kaiser in Treue fest ergeben: die Ritter vom Orden der Deutschen. Einen Versuch ist es allemal wert!
Und das leidige Gold? Es gibt wenig Grund für die Templer, es herauszurücken. Aber auch die Johanniter haben gefüllte Kassen. Sie hätten jetzt allen Grund, hineinzugreifen und sich als Notretter darzustellen. Es ist nicht nur das Charisma, das ihnen die Templer voraushaben, sie sind auch beweglicher, zupackender und vor allem reicher an Fantasie. Das müsste dem Herrn de Ronay bei passender Gelegenheit mal gesagt werden. Wenn man auf seinen Geldsäcken nur immer hockt, dann bringt das zwar sicheren Zins, aber nie den großen Gewinn. Und vielleicht kann König Ludwig doch in ein paar Wochen, Monaten das ägyptische Handelsmonopol an die vergeben, die sich als seine wahren Freunde gezeigt haben. Dann wird der König seinen Jean de Joinville auch nicht vergessen, Herr Vizekönig!
P.S.: A.E. de Joinville begibt sich für ein paar Tage auf geheime Mission und empfiehlt dem Herrn Jean, seine Vorschläge zu beherzigen. Die Lage wird jeden Tag für den König desperater, davon hat niemand einen Vorteil, am allerwenigsten der Angesprochene.
PPS.: Daran ändert auch nichts die heutige Ankunft des Herrn Sempad[21], Konnetabel und Bruder des Königs Hethoum von Armenien. Er hat außer schönen Geschenken auch Truppen nach Zypern gebracht, die mit König Ludwig ziehen sollen, aber die Boote, auf denen sie von der nahen Küste Armeniens übergesetzt sind, nimmt er wieder mit.
Diese Nussschalen hätten auch nie die Fahrt nach Ägypten überstanden. Für den Augenblick also nur ein paar Hundert Fresser mehr.
Lieber Kuss des Todes
Goldgelb fiel die Sonne des späten Nachmittags durch die dünnen Marmorscheiben, die im Oberlicht jeden Strahl von den kostbaren Folianten und Schriftrollen der Bibliothek abhielten. Die Alten von Masyaf schauten kaum auf, als Roç und Yeza schon wieder mit einem Sack voll frisch gerupfter Cannabisstauden anrückten. Die Kinder nahmen das auch nicht übel, sondern hängten geschäftig die Blüten sachverständig nach unten über dem größten Arbeitstisch auf, den sie mit einem Tuch abdeckten, wo normalerweise die Pergamente und das Leder zugeschnitten wurden.
»Ich muss mal Pi –«, murmelte Yeza und entschwand mit größter Selbstverständlichkeit durch die Geheimtür hinter dem Platz des Ältesten, den Zugang zum Falkenhorst, eigentlich kaum der geeignete Ort für ihr Vorhaben, wenn man von dem Felsgang dorthin mal absieht. Aber niemand schenkte ihr Beachtung, und keiner bemerkte, dass sie mit sicherem Griff auch einen Schlüssel mitgehen ließ. Auch um Roç kümmerte sich keiner. Die Alten umstanden den Tisch mit dem blühenden Haschishkraut, zerrieben die Blätter prüfend zwischen den Fingern, hielten die Hände unter die Kelche, bis ein Tröpfchen Harz von den Dolden sich löste, schnupperten daran und waren höchst zufrieden.
Roç war auf eine der Leitern gestiegen, bis ziemlich hoch in die Regale. Er wusste, was er suchte. Mit gespielter Gedankenlosigkeit zog er einen schweren Folianten aus der Reihe und begann in dem Buch zu blättern, auf dem in vergoldeten Lettern stand:
DE SOPORE
INTER MORTEM ET VITAM
Mirabilia, crimina, incantamenta
per flores et plantas minerales geae
cum exemplis sicut fertur
apud naturalis historiae et superstitiones[22]
AUCTOR
DAREUS DELLA PORTA PARADISI[23]
Venenarius Trismegistos Veneratus[24]
Magister Universitatis Alexandriae[25]
Divi soporis dicatum[26]
Zielstrebig schlug Roç die Seiten um. »Sopora[27]«, murmelte er lautlos vor sich hin, »somnifer, soporifera, vide canus, soporem miscere, sopio, sopirio[28]–«
Roç schaute von der Leiter, ob sein Verweilen auffiel, doch die Alten waren längst an ihre Pulte zurückgekehrt und wieder in ihre Arbeit vertieft. Yeza sollte sich beeilen, dachte Roç.
Er hatte jetzt die Stelle gefunden, die er in Erinnerung behalten hatte: »… die mögliche Zusammensetzung der Flüssigkeit, wie sie im Schwamm enthalten war, der dem Messias am Kreuze heraufgereicht wurde, nicht zur Erfrischung, sondern zur Betäubung seiner Schmerzen und zur Verhinderung eines Wundstarrkrampfes oder des Herzstillstandes. Enim effectus tincturis simulatio mortis erat[29], damit die Römer eine vorzeitige Abnahme der Leiche vom Kreuze gestatteten.«
Das war aufregend, und Roç musste sich zwingen, mit Bedacht vorzugehen. Wo blieb nur Yeza? Fand sie nicht das, was sie suchte, was sie mühsam auswendig gelernt hatte?
»Die Mischung musste so stark sein, dass der kontrollierende Lanzenstich klaglos und ohne Zucken hingenommen wurde und eine womöglich Tage dauernde Totenstarre garantiert war. Dafür bieten sich an …«
Roç überflog die Seite mit den ihm unverständlichen Namen fieberhaft und versuchte zu memorieren, ob er Yeza auch alles richtig referiert hatte. Sein Gedächtnis war ihm zu unsicher. Darauf mochte er sich nicht verlassen. Er warf einen Blick zu den Alten, niemand schaute her, und so begann er die Seite mit zitternden, schwitzenden Fingern herauszutrennen. Niemand beachtete sein Treiben oben auf der Leiter. Hastig schob Roç sich das Pergament unter den Kittel, stellte den Wälzer wieder ins Fach und begann den Abstieg, die eine Hand fest auf die Brust gepresst. Zu seiner Erleichterung ging jetzt unten die kleine Tür auf, und Yeza erschien wieder. Sie trug den Sack, mit dem sie das Cannabis gebracht hatte, sorglos unterm Arm und zwinkerte ihm stolz zu.
Roç rief: »Oh, es ist spät geworden, wir müssen auf der Stelle gehen!«
Die Alten blickten freundlich von ihrer Arbeit auf, der Ach saheb al muftah[30] geleitete die beiden zur Tür und entließ sie aus der unterirdischen Bibliothek.
»Sagt uns Bescheid«, mahnte ihn Yeza mit schelmischem Lächeln, »wenn das Haschisch getrocknet, gepresst und im eigenen Harz geklumpt!«
Der Bruder des Schlüssels griente, vorbei waren die Zeiten, dass die Kinder sogleich die frische Ernte konsumieren wollten oder die Stauden gar ernteten, bevor sie richtig voll erblüht. Sie kannten längst alle Formen des Cannabis-Genusses, als labendes Getränk mit Honig und Limonen versetzt, in gesüßte Fladen verbacken, als Süpplein und als Naschwerk.
»Ohne Euch schmeckt es uns gar nimmer!«, sagte er und verbeugte sich.
Die Kinder eilten auf kürzestem Wege in ihren Garten, rannten zum Pavillon und verschwanden hinter der Marmorstatue des Bacchus[31]in die Tiefe.
»Habt ihr nicht gehört, wie die Adler geschrien haben?«, fragte Yeza, während sie den Inhalt ihres Beutels vorsichtig auspackte. »Sie haben sich furchtbar aufgeregt, als ich an den Schrank gegangen bin. Sie fühlen sich als die wahren ›Wächter der Gifte‹, horras as-sumum[32]!«
Roç hatte das Pergament herausgezogen und begann die Beute, lauter kleine Ampullen, Flakons und lasierte Keramikgefäße, lateinisch beschriftet, mit dem Text der Seite zu vergleichen: »Absinthiatum sic facies, atropa bella donna[33]–«
»Das klingt gut!« lachte Yeza. »Das nehmen wir. Da schwimmen kleine Kirschen –«
»Halt!«, sagte Roç. »Ist wegen seiner Gefährlichkeit in der Dosierung nicht zu empfehlen, ein Tropfen zu viel, und es weht der Hauch des Todes – non solum spiritus, sed corpus morietur[34]«
»Dann lieber nicht«, sagte Yeza, »ich hatte mir schon ausgemalt, wie du eine in den Mund nimmst und sie mir dann mit einem Kuss –«
»Kuss des Todes«, verwies Roç sie ihrer Heiterkeit. Durch den schmalen Schlitz oben neben dem Sockel der Statue fiel ein Lichtschein auf das Pergament, das er jetzt weiter entzifferte:
»… zu harmlos und zu schwach sind exotica occidentales[35]wie Passiflora[36]und alba spina[37]. Als wahrscheinlichste Lösung drängt sich ein Potium[38]auf: tinctura Thebana[39] vermischt mit Haschischsaft … cum herba sine nomine quam vidi apud Arabes: aliquot eorum vidi herbam istam edere; ›Hashishin‹ esse dicitur …«[40]
»Och«, sagte Yeza enttäuscht. »Wozu habe ich dann –« sie hob die Flakons ins Licht, »Digitalis[41] und Styrax und –« sie hatte Schwierigkeiten mit der Aussprache – »Escholtzia angeschleppt? Lass uns von jedem ein bisschen nehmen!«
»Kommt nicht infrage«, sagte Roç, »wir halten uns an Jesus, der hat es auch überlebt – Hast du die Tinktur aus Theben?«
»Sicher«, sagte Yeza stolz und wies die Ampulle vor, »vis papaveris[42] steht darunter.«
»Also«, sagte Roc, »ich würde sagen: ein Drittel davon, und den Rest pressen wir aus dem Cannabis –«
»Das holst du«, entschied Yeza, »und ich besorge einen Krug mit Wasser und Honig. Es ist ganz gut, wenn wir noch mal gesehen werden.«
»Ich werde Madulain Bescheid geben, dass wir heute Abend –«
»Aber verrat ihr nicht, wo wir uns hinlegen. Clarion könnte hysterisch werden.«
Roç erhob sich. Nacheinander verließen sie das Versteck. »Sag der Saratz«, mahnte Yeza, »sie soll die Milch nicht vergessen. Wir werden sicher sehr hungrig und durstig sein!« rief sie ihm leise nach, dann lenkte sie ihre Schritte ein letztes Mal zu den Küchenräumen.
Nach dem Abendessen, bei dem sie beide kräftig zulangten und dem Ruf des Muezzin zum salat al maghreb[43], zum Abendgebet, hörte man sie noch lange fröhlich im Garten toben, bis die schrille Stimme Clarions sie laut und energisch aufforderte, zu Bett zu gehen. Dann wurde es still in Masyaf.
Roç und Yeza hatten ihr »Nest« sorgfältig vorbereitet, sie hatten im Lauf der letzten Tage Heu und Kissen dorthin geschafft und sich einen Vorrat von nicht so schnell verderblicher Nahrung angelegt, sie hatten an Decken gedacht und an genügend Wasser, falls sie vorher aufwachen sollten, dann würde der Durst das schlimmste sein. Sie hatten ihr Versteck mit Bedacht gewählt und den Zugang hinter sich mit Steinen verbarrikadiert, denn sie waren gewiss, dass bei Entdeckung ihres Verschwindens von den Assassinen eine Suchaktion unternommen würde, die auch ihre üblichen Schlupfwinkel unter dem Pavillon und über der Moschee nicht aussparen würde.
Deswegen war es auch wichtig, sich im Schlaf nicht durch kräftiges Atmen zu verraten. Sie kuschelten sich aneinander, und Yeza goss zwei Becher voll aus dem Krug mit dem Gebräu, das sie zusammen angerührt hatten. Sie wollten unbedingt zur gleichen Zeit in den Schlaf fallen.
»Und wenn wir nicht wieder aufwachen?« wagte Roç noch das Schicksal aufzuhalten.
»Dann merken wir es beide nicht und sind zusammen –«, Yeza war entschlossen, dem Hades zu trotzen. »Man stirbt nicht von Haschisch«, sagte sie, »und seit wann ist Mohn giftig?!«
»Liebst du mich?«, fragte Roç und nahm seinen Becher.
»Würde ich sonst mit dir trinken«, sagte Yeza und schmiegte ihr Gesicht an das seine. »Ich liebe dich.«
Sie tranken beide ihren Becher aus bis auf den Grund.
»Schmeckt faulig«, sagte Roç, und Yeza schenkte ihnen mit unsicherer Hand noch einmal nach. »Schnell ein zweites, sonst hält es nicht lange genug vor!«
Sie tranken die Becher bis zur Hälfte und setzten sie dann in schon eintretender Schlaffheit ab, Roç, immer noch krampfhaft bemüht, mit ihr gleichzuziehen.
»Ich liebe …«, murmelte Roç noch, erfasste aber nicht mehr, dass Yeza keine Antwort gab. Sie war an seiner Brust eingeschlafen, sein Kopf senkte sich langsam ihrem Haar entgegen.
Der Mönch und seine Hur
William von Roebruk ritt auf seinem Esel durch Episkopi. Der alte, längst aufgegebene Bischofssitz glich mehr einer Sommerresidenz für die begüterten Herren unter den Kreuzfahrern, die es vorzogen, den überfüllten Hafen von Limassol zu meiden, als einem Fischerstädtchen, obgleich man die gesamte einheimische Fangflotte hierin ausquartiert hatte. Die buntgestrichenen Boote, gedrängt am Strand und in der Bucht hinter Kap Gata, ergaben eine malerische Kulisse, die der Turm an der Spitze der Halbinsel überragte.
William hatte, weil »in geheimer Mission«, seine alte Franziskanerkutte übergeworfen und hielt Ausschau nach der Schenke, die ihm Ingolinde als Treffpunkt beschrieben hatte. Ihre weinüberwachsene Pergola lag der Hauptstraße zugewandt, was den Nachteil hatte, dass jedermann ihn sehen konnte, wenn er dort saß und sie ihn warten ließ.
Der Mönch band seinen Esel an, um sich ins Innere zurückzuziehen. Die Hur war natürlich unpünktlich, und um den Ärger vollständig zu machen, prallte er auf Simon de Saint-Quentin, der im hintersten Winkel wie eine Spinne hockte, bei einem Krüglein Wasser.
Der Dominikaner, den er auf den Tod nicht ausstehen konnte und der bekanntlich für ihn ähnliche Gefühle hegte, begrüßte ihn mit einer Freundlichkeit, die man eigentlich nur mit einer Ohrfeige beantworten konnte. William ließ sich auf das Spiel ein:
»Meinen aufrichtigen Glückwunsch«, feixte er, »dass Ihr so glimpflich davongekommen!«
Simon verstand sofort. »Als Legat des Heiligen Vaters kann ich auf Zypern kommen und gehen, wann und wie es mir beliebt, die königlichen Anordnungen greifen bei mir nicht – außerdem lag es mir fern, Limassol zu verlassen und davonzusegeln.«
»Ihr wolltet nur den törichten Oliver von Termes in seinem Vorhaben bestärken.«
»Das habt Ihr gesagt«, lächelte Simon unverschämt, »und es trifft auch nur zum Teil zu.«
»Jacques de Juivet hat es den ganzen Kopf gekostet.«
»Sein Pech, in ein Räderwerk geraten zu sein, das nichts mit ihm zu tun hatte: Der Bretone musste zugreifen, Herr Charles konnte nicht mit leeren Händen dastehen.«
William bekam Gefallen an der Fechterei und bestellte sich demonstrativ einen »Großen«. Simon lehnte dankend ab, noch bevor der Franziskaner ihn einladen konnte.
»Wann geht der Anjou je leer aus!«, sagte William provokant und tat einen ordentlichen Schluck.
»Ein Besessener in seiner Sucht nach Macht, seinem Streben nach Herrschaft«, erklärte Simon kühl. »Dabei lau wie ein Reptil. Das macht ihn so gefährlich!«
William, der den Dominikaner immer für einen Parteigänger des Anjou gehalten hatte, legte noch eins drauf: »Herrn Charles beliebt es, über Leichen zu gehen, weil er das für den Zustand ansieht, in dem andere ihm nicht gefährlich werden können.«
»Ich bin kein Mann des Anjou«, sagte Simon de Saint-Quentin, »ich stehe an seiner Seite, solange ich dies mit den Interessen der Kirche vereinbaren kann, William von Roebruk!«
Der Franziskaner begann sich unwohl zu fühlen und griff wieder zum Krug. Simon ließ ihn zappeln, dann sagte er: »Ihr hingegen habt Euch der Ketzerei verschrieben, wenn nicht gar dem Teufel.«
William dachte an die Gräfin und schwieg.
»Die heilige Inquisition hat mich ermächtigt«, fuhr der Dominikaner genüsslich fort, »jede Maßnahme zu ergreifen, die ich für nützlich erachte, und dafür auch den weltlichen Arm in Anspruch zu nehmen, um Häresien in jeder Form und Person mit Stumpf und Stiel auszurotten.«