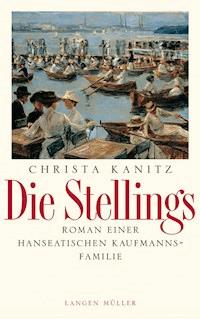5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Langen-Müller
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Einfühlsam und lebendig beschreibt Christa Kanitz jene Zeit zwischen der Jahrhundertwende und den zwanziger Jahren, in der Krieg und Inflation das Leben vieler veränderten. Auch die unbeschwerten Jahre im Haus am Feenteich sind vorbei. Doch die Begegnung zwischen Friederike Bramfeld und Martin Stelling bringt wieder das Glück zurück, das für immer verloren schien.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 454
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Christa Kanitz
Das Haus am Feenteich
Roman
LangenMüller
Besuchen Sie uns im Internet unter
www.langen-mueller-verlag.de
© für die Originalausgabe: 2004 LangenMüller in der F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München © für das eBook: 2013 LangenMüller in der F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München Alle Rechte vorbehalten
Erstes Kapitel
Die Nacht war kalt und ungemütlich, diese letzte Nacht des alten Jahres. Seit Tagen wechselten sich Schneeschauer und Regen mit Nebelschwaden und Sturmböen ab. Das Wetter kam aus Nordwest von der Nordsee herein, unberechenbar wie immer, wenn die Wolken vom Meer her wehten. Fußgänger wärmten sich mit heißen Getränken, die an Straßenecken auf primitiven Kochstellen aus Kesseln voller Glühwein angeboten wurden. Aber wer nicht unbedingt nach draußen musste, blieb in der warmen Stube – wenn er eine hatte. Viele Menschen in den alten Gängevierteln hatten keine Öfen oder nichts Brennbares und so manches Kleinkind und viele alte Menschen erkrankten in den Tagen zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel. Die Kirchen richteten Suppenküchen ein, um die Ärmsten der Armen wenigstens einmal am Tage mit einer heißen Mahlzeit zu versorgen. Aber viele Menschen waren so geschwächt, dass sie ihre Stuben nicht verlassen konnten, um Suppe zu holen.
Das Leben in Hamburg war in dieser Silvesternacht fast zum Erliegen gekommen. Nur wenige unverdrossene Bürger versuchten an den Ufern der Binnenalster mit Feuerwerk und Straßenmusik ein Fest zu feiern, meist aber herrschte Schweigen auf den Straßen, wo nur vereinzelte Gaslaternen mit schwachem gelben Licht die leeren Gassen beleuchteten. Die Automobile blieben stehen, weil das Wasser in den Kühlern gefroren war. Die Droschkenkutscher ließen die Pferde im Stall und viele von ihnen schliefen mit der ganzen Familie in den Verschlägen, weil die Tiere wenigstens eine geringe Wärme abgaben. Auch die Ringbahn verkehrte nicht mehr, die meisten Weichen waren vereist.
Doch im Haus der Bramfelds herrschte reges Treiben. In allen Räumen brannte Licht und warf Bündel voller Helligkeit auf den Vorhof und in den Garten. Hinter den Fenstern mit den kleinen Butzenscheiben eilten Menschen geschäftig hin und her: Hausangestellte, Pflegerinnen, eine Hebamme und Doktor Wallner, der Arzt.
Sophie Bramfeld bekam ihr erstes Kind. Sie war achtunddreißig Jahre alt und es grenzte an ein Wunder, dass ihre Gebete nach einem Kind doch noch erhört wurden. So war die Aufregung verständlich, die in dieser Nacht in der Villa am Feenteich herrschte und sogar den besonnenen Hausherrn ergriffen hatte. Angespannt saß Kommerzienrat Ferdinand Bramfeld, Eigentürmer der Bramfeld-Bank am Hopfenmarkt und angesehener Repräsentant des Hamburger Geldadels, im Herrenzimmer, in einer Hand ein Glas Portwein, in der anderen eine erkaltete Zigarre, und lauschte auf die Geräusche im Hause.
Seit vielen Jahren hatten Ferdinand Bramfeld und seine Frau Sophie auf ein Kind gewartet und nun, beinahe zu spät, hatte Gott ihre Ehe gesegnet.
Er dachte zurück an die glücklichen Jahre, die er und Sophie erlebt hatten und an den ersten Augenblick, als er ihr im Bankhaus begegnete. Sie kam in Begleitung eines älteren Herren und wurde ihm als Fräulein Maienberg vorgestellt. Es gehörte zu seinen Aufgaben als Juniorpartner, Kunden zu begleiten, sie nach ihren Wünschen zu fragen und in die entsprechenden Kontore zu geleiten. Eine solche Begrüßung überließ man in dem traditionsbewussten Bankhaus nicht dem Portier. So hatte er Gelegenheit, die schlanke, hochgewachsene junge Frau zu beobachten, die ihn in ihrem taubenblauen Maßkostüm mit dem seidenblumengeschmückten Hut und den passenden Handschuhen freundlich anlächelte. Welch ein Lächeln, dachte er entzückt, und diese Augen, in denen sich das Blaugrau des Kleides so wundervoll widerspiegelte.
Er hatte sich sofort in sie verliebt, aber es dauerte noch ein halbes Jahr, bis er sie wiedersah und zum ersten Mal mit ihr sprechen konnte. Natürlich hatte er sich damals nach der jungen Dame erkundigt, hatte erfahren, dass sie sehr zurückgezogen lebte und viel auf Reisen war, um ihre kränkelnde Mutter in die Kurbäder von Baden-Baden und Bad Pyrmont zu begleiten. Außerdem war es in den Kreisen des Hamburger Geldadels nicht üblich, öffentliche Veranstaltungen zu besuchen. Ausnahmen bildeten lediglich Gottesdienste, ehrenhafte Theatervorstellungen oder Konzerte berühmter Komponisten.
Wer in Hamburg zu den Reichen zählte, blieb unter sich. Man verkehrte nur mit Gleichgestellten, heiratete in die passenden Kreise und hielt sich der Öffentlichkeit gegenüber verschlossen. Nicht, dass die namhaften Familien arrogant und intolerant waren, im Gegenteil, caritatives Engagement gehörte zu den Hauptanliegen der Begüterten, man engagierte sich in kirchlichen Hilfsorganisationen, im Johanniter-Orden und bei den Maltesern, aber gesellschaftlich zog man strenge Grenzen.
Obwohl die Familie Bramfeld eine der tragenden Säulen dieser Gesellschaft war, gelang es Ferdinand nicht, Sophie Maienberg näher zu kommen. Sie lebte mit ihrer Familie in Blankenese, einem kleinen Dorf an der Elbe, in dem vor allem Lotsen und Kapitäne wohnten, das sich aber seit einigen Jahren zu einem bevorzugten Wohngebiet wohlsituierter Hamburger Familien entwickelte. Erst als er anlässlich der Hochzeit seines besten Freundes Martin Brandner Tischherr der heimlich angebeteten jungen Dame wurde, gelang es ihm, den ersten Kontakt zu knüpfen.
Ferdinand, damals fünfunddreißig Jahre alt und selbstsicher genug, um Hemmungen zu ignorieren, wusste, dass er die Gelegenheit nutzen musste. Er sah gut aus, war Juniorpartner in einem der angesehensten Bankhäuser, war gebildet und liebenswürdig und im Blickfeld vieler Mütter, die einen Mann für ihre Töchter suchten. Jetzt setzte er seinen ganzen Charme ein, um der Dame an seiner Seite den Hof zu machen. Und wie er sehr schnell feststellen konnte, war Sophie Maienberg beeindruckt von ihrem Tischherrn und seinen vortrefflichen Manieren.
Er lächelte bei der Erinnerung an dieses behutsame Vortasten während der höflichen Gespräche. Und er hatte Erfolg, denn der Unterhaltung am Tisch folgte wenig später ein wohlgesitteter Spaziergang durch den zum Haus gehörenden Park. Dann tanzten sie zu Walzermusik und am Abend, als es bereits dunkelte, suchten sie in wortloser Übereinstimmung die intime Abgeschiedenheit im Rosengarten, wo Bänke zum Verweilen einluden und diskrete Gäste einen anderen Weg einschlugen, um nicht zu stören.
Als Sophie sich wenig später verabschiedete, um mit den Eltern nach Hause zu fahren, bat Ferdinand sehr korrekt Daniel Maienberg um ein Wiedersehen mit seiner Tochter. Die Eltern, die wachsamen Augen stets auf die Tochter gerichtet, waren, nachdem was sie an diesem Nachmittag beobachtet hatten, kaum überrascht.
»Ich würde mich freuen, Sie in der nächsten Woche zum Tee bei uns begrüßen zu dürfen«, erwiderte Sophies Mutter anstelle ihres Mannes und nickte zustimmend. Und Ferdinand, wohl wissend, dass in diesen Familien Tradition und Etikette das Verhalten bestimmten, sagte höflich: »Es ist mir eine große Ehre, gnädige Frau.« Er hätte sich ein Wiedersehen in einer anderen Atmosphäre gewünscht, aber er wusste, was von ihm erwartet wurde.
Ein halbes Jahr später hatten sie in der St. Michaeliskirche geheiratet.
Ja, so hatte vor zwanzig Jahren alles angefangen. Ferdinand löste sich aus seinen Träumen und sah auf die Uhr über dem Kamin. Gleich Mitternacht, sinnierte er und nahm einen Schluck Portwein aus einem Glas, das in seiner Hand längst viel zu warm geworden war. Aber bevor er sich entschließen konnte, kühleren Wein nachzuschenken, begannen die Glocken der St. Johanniskirche am gegenüberliegenden Ufer des großen Alstersees das alte Jahr auszuläuten und das neue zu begrüßen. Er zählte im Stillen die Schläge und gemeinsam mit dem zwölften Schlag hörte Ferdinand den ersten Schrei seines Kindes. Er stellte das Glas zur Seite, denn seine Hand zitterte plötzlich unkontrolliert, legte die erkaltete Zigarre in den Aschenbecher und trat hinaus in die Halle. Von oben, wo die Schlafräume lagen, kam ihm Doktor Wallner entgegen.
»Ich gratuliere Ihnen, Herr Kommerzienrat«, rief er nach unten, »Sie sind Vater einer wunderschönen Tochter geworden. Mutter und Kind sind wohlauf.«
Für einen kurzen Augenblick erlitt der Hausherr einen kleinen Schwächeanfall und musste sich an dem schweren geschnitzten Treppengeländer festhalten, dann durchströmte ihn ein maßloses Glücksgefühl. Er drückte dem Arzt wortlos die Hand und wollte hinaufeilen. Aber der Doktor hielt ihn zurück.
»Nicht so schnell, lieber Kommerzienrat, gönnen Sie Ihrer Frau eine Atempause. Sie wird glücklich sein, Sie zu sehen, aber sie wird sich wohler fühlen, wenn die Zofe sie frisch gemacht und umgekleidet hat. Bitte, geben Sie ihr zehn Minuten.«
Ferdinand lachte, »Sie haben Recht, aber das Warten fällt mir schwer. Wie sieht sie aus, meine Tochter, wem sieht sie ähnlich, wird sie mich schon erkennen? Auf jeden Fall hat sie eine kräftige Stimme, sie hat den letzten Glockenschlag übertönt.«
Der Arzt lächelte bewegt, er kannte die Glücksgefühle später Väter. »Sie ist ein wunderschönes Mädchen und sie ist mit Sicherheit das erste Baby des neuen Jahres in dieser Stadt. Ich werde sie morgen in der Registratur eintragen lassen, die Ehre wird ihr keiner nehmen. Ich müsste dann nur noch ihren Namen erfahren.« Doktor Wallner nahm einen Notizblock aus der Tasche, trug Datum und Uhrzeit ein und wartete.
»Das erste Baby des neuen Jahres, welch ein großes Glück.« Ferdinand schwieg einen Augenblick bewegt, dann sagte er nachdenklich: »Wenn meine Frau einverstanden ist, soll sie Friederike heißen, der Name muss dem Ereignis angepasst sein.«
»Ein königlicher Name für ein kleines Mädchen, Herr Kommerzienrat.«
»Der passende Name für meine kleine Prinzessin, Doktor, und jetzt gehe ich hinauf, ich kann nicht mehr warten.«
Zaghaft klopfte er an die Tür und als ihm eine Pflegerin öffnete, fragte er bescheiden: »Darf ich eintreten?«
Im Zimmer roch es nach Desinfektionsmitteln und Seife, nach frischem Bettzeug, aber auch nach Blut und Schweiß. Bei dem nasskalten Wetter wagte niemand, das Fenster zu öffnen. Aber das alles nahm Ferdinand nicht wahr. Er sah nur seine Frau, in Kissen gebettet und, in weiße Tücher gehüllt, das Kind in ihrem Arm.
Verlegen und auf Zehenspitzen näherte er sich dem Bett, kniete nieder und umschlang Frau und Kind. »Du hast mich zum glücklichsten Menschen gemacht, meine liebe Sophie. Ich danke dir von ganzem Herzen.« Seine Stimme zitterte und es gelang ihm kaum, die Tränen der Freude zurückzuhalten. Zärtlich küsste er seine Frau auf die Stirn und berührte mit bebenden Lippen die Wange seines Kindes. Und als er sich etwas gefasst hatte und seiner Stimme wieder mächtig war, fragte er bescheiden: »Ist es dir Recht, wenn wir unseren kleinen Liebling Friederike nennen? Ich kann mir keinen schöneren Namen für unser Kind vorstellen.«
Sophie lächelte, sie kannte ihren Mann, der so überschwänglich reagierte, wenn die Gefühle Besitz von ihm ergriffen. Sie überlegte einen Augenblick und sah ihn nachdenklich an. »Es ist ein sehr anspruchsvoller Name, Ferdinand. Eine Verpflichtung beinahe. Darf man ein Kind damit belasten?«
»Ein kleines Kind vielleicht nicht, liebste Sophie, aber eine junge Frau bestimmt. Unsere Tochter wird einmal das Bankhaus erben, sie wird die künftige Patriarchin der Familie sein, dann soll ein guter, großer Name sie begleiten.«
Eine leichte Hand legte sich auf seine Schulter. »Ihre Frau muss jetzt ruhen, Herr Kommerzienrat.« Die Pflegerin sah ihn freundlich, aber bestimmt an. Er erhob sich und strich liebevoll über die Wangen seiner Frau. »Schlaf gut, mein Liebling.« Noch immer sehr gerührt, drehte er sich um und folgte der Pflegerin aus dem Zimmer.
Sophie schloss die Augen. Die Schmerzen der vergangenen Stunden waren vergessen. Zärtlich drückte sie das kleine Bündel in ihrem Arm an sich. Von dir erwartet man viel, mein Schatz, hoffentlich kannst du diese Erwartungen erfüllen. Sie wusste, dass die kleine Friederike ihr einziges Kind sein würde, und sie wusste auch, welche Hoffnungen ihr Mann an dieses Kind knüpfte, denn er lebte und arbeitete nur noch für die Zukunft seiner Familie, nachdem er erfahren hatte, dass sie ein Kind haben würden. Früher hatte er oft, und oft auch verzweifelt, gefragt: »Was wird einmal aus unserem Bankhaus, wenn ich nicht mehr arbeiten kann? Was wird aus dieser Familie, wenn niemand da ist, der unseren Namen weiterträgt?«
Sie hatten die besten Ärzte konsultiert, Kurorte aufgesucht, Heilwasser und Medikamente zu sich genommen und immer wieder erfahren, dass sie zwei gesunde Menschen seien. Und dann waren doch zwanzig Jahre vergangen bis zu dieser Stunde.
Zwanzig glückliche, wundervolle Jahre, dachte sie dankbar. Ihre große Liebe hatte sich bewährt, wenn sie Tiefen durchschreiten mussten und Höhen erklimmen durften. Hand in Hand sind wir gewandert, dachte sie beglückt und erinnerte sich an die Bilder ihres Lebens, die wie eine Fotofolge an ihr vorüberzogen.
Wie eine Märchenbraut in schimmerndem Weiß war sie am Arm ihres Vaters durch die festlich geschmückte St. Michaeliskirche geschritten. Zwei kleine Pagen führten sie durch die Bankreihen, in denen dicht beieinander die Freunde und Verwandten der Familien Maienberg und Bramfeld saßen. Vier Brautjungfern trugen die Schleppe ihres Kleides, das die Mutter in Paris gekauft hatte. Und als sie den Altarraum betraten, stellte sich Ferdinand neben sie und ergriff zärtlich ihre Hand, und sie wusste: Mit diesem Mann an meiner Seite will ich durchs Leben gehen und nichts und niemand wird mich daran hindern.
In einer von vier Schimmeln gezogenen Hochzeitskutsche waren sie nach der Zeremonie in ihr Elternhaus zum großen Empfang gefahren und danach in ihr neues Heim am Feenteich. Ferdinand hatte die weiße Villa mit den taubenblauen Säulen neben der Eingangstür und den gleichfarbigen Fensterläden – eine Erinnerung an das Kleid, in dem ich dich zum ersten Mal gesehen habe, hatte er gesagt – während der Verlobungszeit bauen lassen und sie durfte bei der Einrichtung ihre Wünsche äußern. Nun wollten sie das neue Heim in Besitz nehmen. Die Hochzeitsnacht sollte ihre lange Wartezeit besiegeln und auf eine Reise verzichteten sie, weil ihr neuer, gemeinsamer Lebensweg durch nichts mehr verzögert werden sollte. Es folgten die ersten wundervollen Wochen des Miteinanders, das Gewöhnen an den anderen, das gegenseitige tiefe Kennenlernen und das einzigartige Verstehen, das es nur zwischen Menschen gibt, die ineinander Geborgenheit gefunden haben. Sie dachte an Feste, die sie gefeiert, und Reisen, die sie unternommen hatten, sie erinnerte sich an Probleme, die gelöst, und an Schwierigkeiten, die überwunden werden mussten – und dann war sie trotz der großen Freude, die sie erfüllte, mit dem Kind in ihrem Arm eingeschlafen.
Die kleine Friederike war ein zierliches, lebhaftes Baby und die Kinderschwester hatte alle Hände voll mit ihr zu tun. Am Ostersonntag wurde die Kleine auf den Namen Friederike Sophia Bramfeld getauft. Zu Ehren des Festtages und zum Gedenken an die feierliche Handlung, die im großen Saal des Hauses stattfand, hatte Ferdinand auf der Rasenfläche seines Gartens eine Sonnenuhr installieren lassen. Auf einem quadratischen Sockel aus weiß gestrichenen Backsteinen mit taubenblau abgesetzten Ecksteinen ruhte eine runde, gehämmerte Bronzeschale von einem Meter Durchmesser. Ein schlanker Stundenzeiger offenbarte dem Betrachter die Zeit.
Friederike konnte kaum krabbeln, als sie sich bereits zu dieser Sonnenuhr im Garten hingezogen fühlte, und wann immer das Kind gesucht wurde, man fand es bei den weißen Steinen. Später, als sie sich aufrichten und laufen konnte, kletterte sie auf den kleinen Sockel und legte sich in die Schale, den kleinen Körper vorsichtig um den Zeiger geschmiegt. Oft fand Sophie sie schlafend in der flachen Schale.
Friederike Bramfeld wuchs als glückliches, fröhliches Kind heran, umsorgt von der Mutter, vergöttert vom Vater und erzogen von Kinderschwestern und später von Gouvernanten. Mit dem Ernst des Lebens wurde sie konfrontiert, als sie mit zwölf Jahren in dem renommierten Internat von Schloss Wolfenhagen an der Ostsee angemeldet wurde. Die Eltern hatten sich diesen Entschluss nicht leicht gemacht, aber sie wussten, dass ihre Tochter eine erstklassige Schulausbildung, verknüpft mit dem Lernen tadelloser Manieren, brauchte, um in der Hamburger Gesellschaft anerkannt zu werden.
Sophie und Ferdinand hatten lange überlegt, ob sie ihr geliebtes Kind in ein Schweizer Internat geben sollten, wie es seit ein paar Jahren in ihren Kreisen üblich war, oder Frankreich bevorzugen sollten, weil die französische Sprache wie die französischen Umgangsformen comme il faut und mit nichts zu vergleichen waren. Aber zum großen Glück der kleinen Friederike und zur persönlichen Erleichterung der Eltern entschlossen sie sich dann für Schloss Wolfenhagen. Sie brachten es nicht über sich, so weit entfernten Häusern ihr einziges Kind anzuvertrauen.
Zweites Kapitel
Schloss Wolfenhagen, ehemaliger Sitz der dänischen Fürsten zu Baltenburg, war ein gewaltiger Bau und nach dem deutsch-dänischen Krieg, als Schleswig-Holstein Preußen zugesprochen wurde, als staatlicher Besitz gemeinnützigen Zwecken zugeführt worden. Es diente nach den Schlachten von 1864 und 1866 und nach dem Krieg mit den Franzosen als Erholungsheim für verletzte Soldaten, war eine Zeit lang Waisenhaus und wurde in den ersten Jahren des neuen Jahrhunderts zu einer finanziell einträglichen Lehranstalt mit angegliedertem Pensionat für junge Damen der feinen preußischen Gesellschaft eingerichtet. Die Leitung rühmte sich einer strengen Erziehung und die Einrichtung wie auch die Lebensweise waren spartanisch einfach. Harte Kriterien sorgten bei der Aufnahmeprüfung dafür, dass nur die besten Schülerinnen den Eintritt schafften. Dabei wurde nicht so sehr auf Reichtum und Einfluss der Eltern, sondern auf Herkunft und Tradition der Familien geachtet. Man wollte die Elite und man bekam die Elite.
Diese Einstellung und die Beschreibung des Schlosses durch Bekannte wie etwa die Familien Buderus, Stelling oder Nienhagen, gaben schließlich den Ausschlag für den Entschluss der Familie Bramfeld, Friederike nach Wolfenhagen zu schicken. Das imposante Anwesen in der Nähe der alten Hansestadt Lübeck machte seinem Ruhm, ein Fürstensitz gewesen zu sein, alle Ehre. Dem dreigeschossigen Mittelteil mit der Kuppel schlossen sich rechts und links gleich hohe Flügel an. Das aus rotem Backstein gebaute Schloss öffnete sich U-förmig nach Osten. Der große Park reichte bis an den Strand der Ostsee. Im Erdgeschoss des Hauses waren die Unterrichtsräume und in dem von einer Kuppel gekrönten turmartigen Mittelteil befand sich der Festsaal. In der ersten Etage waren die Wohn- und Gemeinschaftsräume sowie ein Andachtssaal untergebracht. In der zweiten Etage schliefen die Schülerinnen in Zwei- und Vier-Bett-Zimmern. Wobei man die jungen Damen dem Alter entsprechend in den einzelnen Teilen des Schlosses getrennt unterbrachte. Auf der gleichen Etage wohnten die Lehrerinnen, die zugleich die Aufsicht führten. In den Mansardenräumen des Dachgeschosses war das Hauspersonal untergebracht und im Keller befanden sich die Wirtschaftsräume. Am Rande des Parks gab es einen Gutshof, eine Gärtnerei, eine Fischzucht und eine Baumschule. Man lebte in Wolfenhagen wirtschaftlich unabhängig.
Sophie und Ferdinand, von der Richtigkeit einer Fortbildung in einem solchen Internat überzeugt, wollten dennoch nicht ohne die Zustimmung ihrer Tochter handeln und beschlossen, eine Besichtigungsfahrt nach Wolfenhagen zu unternehmen.
»Wir möchten, dass du dich wohl fühlst«, versicherte Sophie und griff nach der Hand ihrer Tochter, die nicht nur erschrocken war bei dem Gedanken an die Trennung von den Eltern, sondern auch die Notwendigkeit einer solchen Trennung nicht begriff. Sie war in der Einsamkeit eines wohl behüteten Einzelkindes aufgewachsen, kannte kaum andere Kinder und konnte sich ein Leben in einer so großen Gemeinschaft überhaupt nicht vorstellen.
»Aber Mami, was soll ich denn in einem Pensionat? Miss Danny bringt mir doch hier alles bei, was ich wissen muss. Sie sagt immer, ich besitze eine sehr gute Erziehung, bin gut ausgebildet und weiß viel mehr als andere Kinder meines Alters.«
»Liebling, es geht darum, dass du lernst, mit anderen Mädchen zusammenzuleben, dich fremden Anordnungen anzupassen, dich einzuordnen und dich auch hin und wieder unterzuordnen.«
»Und das heißt dann, ich kann nicht tun, was ich möchte, ich muss immer nur gehorchen.« Die Worte schnürten ihr fast die Kehle zu und in ihrem Gesicht zeigte sich der Ausdruck tiefster Enttäuschung. »Ich glaube, ihr wollt mich los sein, ich glaube, ihr habt mich gar nicht mehr lieb. Papa«, sie sah ihren Vater traurig an, »bin ich euch so sehr im Wege?«
Entsetzt richtete er sich auf. »Gütiger Himmel, Kind, du bist das Liebste, was wir haben.« Er stand auf und ging zu ihr. »Liebling, alle kleinen Mädchen in deinem Alter besuchen eine Schule. Manche haben nicht die Möglichkeit, in ihrer Schule auch zu wohnen, aber die, die es dürfen, haben großen Spaß dabei.«
Friederike schüttelte entsetzt den Kopf. »Spaß, wie kann man in einer Masse von Mädchen noch Spaß haben. Papi, wo hast du denn so etwas gehört?« Sie wandte sich unwillig ab und kauerte sich in der Ecke des Kanapees zusammen. »Bitte, ich möchte dort wirklich nicht hin.«
Ferdinand sah seine Frau unschlüssig an. Widerspruch von ihrer Tochter hatten sie noch nie erlebt. Sophie setzte sich neben ihr Kind und legte ihr den Arm um die Schultern. »Auch ich war in einem Internat, mein Liebes, in einem sehr strengen Haus, das von Klosterschwestern geführt wurde und wo es fast verboten war zu lachen. Aber glaube mir, wir Mädchen hatten trotzdem einen ungeheuren Spaß und mit einigen von ihnen bin ich noch heute befreundet. Ich mache dir einen Vorschlag, mein Kleines. Wir fahren morgen in das Schloss, du schaust dir alles genau an, fragst die Mädchen, die schon dort wohnen, wie es ihnen gefällt, und dann entscheiden wir uns gemeinsam. Einverstanden?«
Friederike nickte, wischte eine heimliche Träne ab und fragte: »Und wenn ich fort bin, habt ihr mich dann trotzdem noch sehr lieb?«
»Aber natürlich«, lächelte Sophie erleichtert. »Nichts und niemand könnte unsere Liebe zu dir schmälern, Kind. Du bist das Wunderbarste, was es auf der Welt für uns gibt.« Sie sah ihren Mann fragend an. »Wann könnten wir fahren?«
Ferdinand glättete zufrieden seinen vollen Bart, Sophie hatte das wieder einmal sehr gut geregelt. »Morgen früh, denke ich, im Morgengrauen, damit wir abends wieder hier sind.«
»Dann wird es Zeit, dass wir uns zur Ruhe begeben.« Sophie stand auf. »Komm, meine Kleine, ich begleite dich in dein Zimmer. Ich bin sicher, die Reise wird das reinste Vergnügen.«
Ferdinand ordnete an, dass Willi Wilde, der Chauffeur, am nächsten Morgen mit dem Automobil um sieben Uhr vor der Tür stand. Er bevorzugte den Horch mit seinem aufklappbaren Lederverdeck. Bei sonnigem Wetter konnten sie dann im offenen Wagen fahren, was seine Frau und seine Tochter besonders liebten.
Die Fahrt war sehr abwechslungsreich. Die Köchin hatte einen Picknickkorb vorbereitet, der Chauffeur Decken in den Wagen gelegt und Ferdinand hatte sich mit Landkarten und einem Fernglas ausgerüstet. Von Hamburg aus ging es durch die kleine preußische Stadt Wandsbek und dann auf einer viel befahrenen Landstraße durch die mittelalterliche Stadt Ahrensburg mit dem weißen Wasserschloss und durch Oldesloe, das nach dem verheerenden Feuer von 1798 ganz neu aufgebaut worden war, nach Lübeck. Als man die alte Hansestadt hinter sich hatte und die höher steigende Sonne das Land wärmte, suchte Ferdinand am Ufer der Trave nach einem geeigneten Rastplatz.
»Wir werden hier unsere Stärkung zu uns nehmen, dann sind wir wohl gerüstet für alles, was uns in Wolfenhagen begegnet.«
Willi Wilde breitete die Decken aus, Sophie servierte die Speisen und Friederike, viel zu aufgewühlt, um essen zu können, lief am Traveufer entlang und pflückte ein paar Sumpfdotterblumen und ein paar Stängel von dem zartvioletten Wiesenschaumkraut. Hin und wieder blickte sie zurück auf die Silhouette der Stadt mit den sieben Kirchtürmen und versuchte, sich ihr Leben in der Fremde vorzustellen. Schließlich kauerte sie sich an den Rand des Wassers und weinte. Sie dachte an ihr schönes Zimmer, das ganz allein ihr gehörte und an dessen Tür jeder anklopfen musste, der zu ihr wollte. Sie dachte an die vielen Bücher in den Regalen, die sie bestimmt nicht mitnehmen durfte, an ihren Schrank voller zauberhafter Kleider, an ihre Wiege, in der jetzt ihre Puppen schliefen, mit denen sie schon längst nicht mehr spielte, und an die geliebte Sonnenuhr im Garten, die ihr bald nicht mehr die Zeit ansagen würde. Denn eines war ganz sicher, sie würde in diese Lehranstalt gehen müssen, ob sie wollte oder nicht. Wenn der Besuch kleiner Mädchen in einem Pensionat Tradition war, würden sich Vater und Mutter nicht umstimmen lassen. Sie kannte ihre Eltern und was die einmal für richtig hielten und beschlossen hatten, das wurde durchgeführt. Da mochte die Mutter noch so verständnisvoll reden und sagen: »Wir entscheiden uns gemeinsam.« Diese Entscheidung war längst gefallen.
Sie sah zurück zu der Wiese, auf der die Eltern tafelten, und dachte an die vielen wundervollen Jahre, die sie gemeinsam verbracht hatten. Freilich, der Vater war oft abwesend, die Bank, Geschäftsreisen, Konferenzen in anderen Städten – er war eben Bankier und ein erfolgreicher Mann, das hörte sie immer wieder, wenn die Erwachsenen miteinander sprachen. Aber die Mutter war immer für sie da, und wenn sie Besuche machte, in der Stadt einkaufte oder in einem Caféhaus Freundinnen traf, durfte sie sie begleiten. Und das alles sollte nun vorbei sein? Sie wischte die Tränen vom Gesicht und putzte sich die Nase. Niemand sollte sehen, dass sie weinte, niemand brauchte zu wissen, wie weh das alles tat. Wenn diese Schule eine beschlossene Sache war, dann würde sie dorthin gehen, aber dann brauchte auch niemand zu wissen, wie sehr sie leiden würde.
Friederike sah, dass der Vater winkte. Er wollte weiterfahren. Langsam schlenderte sie zum Auto am Straßenrand zurück und beobachtete, wie der Vater am Arm der Mutter den leichten Abhang hinaufging. Er ist älter geworden, dachte sie, ein grauhaariger Mann, der einen Gehstock benutzt, wenn er sich unbeobachtet glaubt. Wann hat er eigentlich zuletzt mit mir im Garten Ringewerfen gespielt, überlegte sie, und wann war das, als er mit mir über die Alster ruderte? Das ist bestimmt viele Jahre her, grübelte sie erschrocken und beeilte sich, um die Eltern nicht warten zu lassen.
Das Land wurde leicht hügelig, Felder, Wiesen und Wälder wechselten sich ab. Auf vielen Weiden standen die berühmten schwarzbunten Holsteiner Kühe im ersten saftigen Futter des Jahres. Als der Vater feststellte, dass sie das Gebiet von Wolfenhagen erreicht hatten, kamen sie an Pferdeweiden vorbei, die säuberlich mit weiß gestrichenen Weidezäunen eingegrenzt waren. Einige übermütige Fohlen rannten mit dem Automobil um die Wette und Friederike lachte laut, wenn sie übermütige Bocksprünge machten.
Der Park war von einer zwei Meter hohen Mauer umgeben. Wilde musste hupen, damit das Tor geöffnet wurde, und Friederike dachte: Hier werden kleine Mädchen also richtig eingesperrt.
Sie fuhren durch eine lange Allee direkt auf das Schloss zu. Ein Hausmädchen öffnete ihnen die Tür und führte sie in einen Salon, in dem sie kurze Zeit warten mussten. Irgendwo sang ein Mädchenchor mehrstimmig Frühlingslieder. Es hört sich schön an, ich muss immer allein zur Klavierbegleitung von Miss Danny singen, dachte Friederike, das macht überhaupt keinen Spaß.
Dann trat eine gut aussehende Frau von etwa fünfzig Jahren ein und stellte sich als Vorsteherin Fräulein Berlinghoff vor. Friederike machte einen wohlerzogenen Knicks, als sie ihr die Hand reichte, und zog sich wieder hinter die Eltern zurück. Eigentlich sieht sie ganz nett aus, dachte sie, aber wer weiß, wie sie ist, wenn die Eltern nicht mehr da sind. Sie folgte der Unterhaltung kaum, sie lauschte auf die Geräusche, die von draußen zu hören waren: Die Schulglocke läutete, auf den Fluren schwatzten und lachten Mädchen in jeder Lautstärke, mahnende Stimmen von Erwachsenen versuchten, Ruhe zu schaffen, dann klingelte wieder eine Glocke, Türen wurden zugeschlagen, in einem Sprechchor deklamierten Mädchen ein Gedicht, dann war es wieder still im Schloss.
Die Eltern unterhielten sich noch immer und von Zeit zu Zeit versuchte Fräulein Berlinghoff Friederike in das Gespräch mit einzubeziehen, fragte sie nach dem Verlauf der Fahrt, nach ihren Vorlieben und nach ihren ersten Eindrücken vom Schloss und der Umgebung. Friederike antwortete sehr zurückhaltend, sie wollte keine Fehler machen und die Eltern nicht verärgern. Dann lud die Vorsteherin sie zu einer Besichtigung des Hauses ein und Friederike war entsetzt über die Einrichtung. Schlichte, grob zusammengenagelte Betten mit Strohmatratzen auf lose liegenden Brettern, einfache Schränke, von denen jede Schülerin nur einen halben Schrank benutzen durfte, und ein roh gezimmerter Tisch mit Stühlen, das war die ganze Zimmereinrichtung. Dann gab es ein paar große Waschräume mit aneinander gereihten Becken aus Eisen und auf jeder Etage einen Toilettenraum, in dem nur halbhohe Holzwände die Becken voneinander trennten. Im Speisesaal saßen die Mädchen an langen Tischen, an deren Enden die Lehrerinnen über die jungen Damen wachten. Wie Friederike erfuhr, durfte nicht gesprochen werden und alle zwei Tage wurden die Stühle gewechselt: Man rutschte einen Sitz weiter und damit im Laufe des Schuljahres einmal um alle Tische herum.
Nach einem gemeinsamen Mittagessen mit der Vorsteherin, musste sich Friederike einer schulischen Prüfung unterziehen. Die Fragen waren leicht, viele Themen hatte sie schon vor ein oder zwei Jahren mit Miss Danny durchgenommen. Sie beantwortete die Fragen in Deutsch, Französisch und Englisch, je nachdem, in welcher Sprache gefragt wurde, und baumelte nicht ein einziges Mal mit den Beinen, was ihr sehr schwer fiel. Die Lehrerinnen, die sie in einem unbenutzten Klassenzimmer prüften, waren sehr zufrieden. Aber dann kamen Fragen, bei deren Beantwortung Friederike fassungslos blieb, Fragen wie: Was benutzt du zum Waschen von schwarzen Strümpfen? Wie kochst du eine Haferflockensuppe? Wieviel Maschen nimmst du auf, wenn du einen Strumpf stricken willst? Wie arbeitest du in einer Abwaschküche? Wie spänt man einen Holzfußboden? Wie viele Instrumente spielst du? Kannst du reiten, tanzen, töpfern, malen und Blumen binden? Was weißt du von der Gartenarbeit und wie putzt man Waschbecken? Friederike schüttelte immer wieder den Kopf, von solchen Schulaufgaben hatte sie noch nie etwas gehört. Dafür gab es Hausangestellte, denen man die Arbeit nicht wegnehmen durfte, weil sie sonst keinen Verdienst hatten und hungern mussten.
Als die Prüfung beendet war, hörte sie, wie die Lehrerinnen den Eltern und der Vorsteherin sagten: »Die junge Dame ist in den Wissensfächern hochbegabt und bei den häuslichen Aufgaben mit einem absoluten Mangelhaft zu beurteilen. Entsetzt sahen die Eltern zu ihr hinüber, niemand der Familie Bramfeld hatte geahnt, dass man in diesem Schloss Hausarbeiten leisten musste.
Aber Fräulein Berlinghoff lächelte nur: »Man kann alles lernen, und ich garantiere Ihnen eine perfekte Hausfrau, wenn Ihre Tochter diese Lehranstalt verlässt. Damit stand fest, dass Friederike trotz allem die Aufnahmeprüfung bestanden hatte. Etwas still und nachdenklich trat die Familie die Rückfahrt an, die Mutter mit einer langen Liste in der Hand, auf der vermerkt war, was Friederike mitbringen musste, was nicht erwünscht war, wie oft Besuch erlaubt war und wann sie einmal im halben Jahr die Eltern daheim besuchen durfte. Ferien wie in anderen Schulen gab es nicht.
Auch Sophie Bramfeld war leicht entsetzt, als sie die Liste studierte. Die Kinder mussten eine Schuluniform tragen, deren Stoffqualität, Farbe und Schnitt genau vorgeschrieben waren. Dazu kamen passende Hüte, Handschuhe und Schuhe. Alles musste für den Sommer und für den Winter angeschafft werden. Dann waren Hauskleider und Schürzen in bestimmten Farben notwendig. Die Anzahl der Wäschestücke und Nachthemden, der Strümpfe und sogar der Taschentücher war vorgeschrieben. Und jedes Stück musste mit dem vollen Namen der Besitzerin ausgezeichnet sein. Dazu kamen mehrfache Bettwäsche von schlichter Baumwollqualität und grobe, weiße Leinenhandtücher. Kleidung für Garten- und Stallarbeit war ebenso erwünscht wie Sport- und Badebekleidung. Sogar die Seifensorten waren vorgeschrieben.
Wie es in der Liste hieß, dienten alle diese Anordnungen der Gleichstellung der Mädchen, die aus begüterten, aber auch aus verarmten namhaften Familien stammten. Sophie hatte dafür zwar Verständnis, lehnte aber die Strenge, die in den Vorschriften deutlich wurde, ab. Sie würde mit Ferdinand darüber sprechen, sobald das Kind im Bett war. Schließlich würde ihr Mann monatlich ein Vermögen für die Unterbringung in dieser Lehranstalt bezahlen.
Ferdinand, der die Schlossbesichtigung nicht mitgemacht, sondern sich auf einer Parkbank ausgeruht hatte, musste außerdem erfahren, wie primitiv die Unterbringung war.
Aber Ferdinand, wohl wissend, dass das Pensionat für seine spartanische Lebensweise bekannt war, beruhigte seine Frau. »Nichts wird so schlimm sein, wie es zuerst erscheint, mein Schatz. Wenn all die anderen Mädchen dort fröhlich und zufrieden sind, wird sich auch Friederike eingewöhnen.«
Aber Sophie war noch nicht beruhigt. Sie griff über den Tisch und nahm seine Hand: »Unser kleiner Liebling und so viel ungewohnte Strenge, ob das gut geht?«
Ferdinand schwieg einen Augenblick. Dann sagte er sehr bestimmt: »Sie muss das schaffen, Sophie, sie muss lernen, mit dem Leben da draußen fertig zu werden. Sie kann nicht immer dieses umsorgte Kind bleiben. Das Dasein besteht nicht nur aus Liebe und Fürsorge, sie muss ganz einfach auch den Ernst und die Härte des Lebens erfahren.«
Und Sophie wusste, dass sie ihren Mann nicht mehr umstimmen konnte.
Um seinen Entschluss den beiden Damen etwas schmackhafter zu machen, lud Ferdinand sie zu einem Bummel durch das berühmte neue Kaufhaus der Firma Rudolph Karstadt ein, das an der Mönckebergstraße viel Aufsehen erregt. Die Firma, 1881 in Wismar gegründet, will den Hamburger Bürgern nicht nur einen Konsumtempel offerieren, in dem sie vom Kochtopf bis zur Seidenwäsche alles unter einem Dach erstehen können, sondern ein ganz neues Einkaufsgefühl vermitteln. Die weniger angenehme Seite des Geldausgebens soll zu einem Erlebnis ganz besonderer Art werden. Die breiten, reich geschmückten Treppenaufgänge, die schon beim Betreten der ersten Stufen einen Rundblick in die vielfältigen Auslagen gestatten, sind mit einer großzügigen elektrischen Beleuchtung ausgestattet, sodass der Besucher die Tageszeit vergisst und mit Muße durch die Etagen streifen kann, ohne auf die Uhr zu schauen.
Ferdinand war freigiebig an diesem Tag. »Ihr könnt euch etwas kaufen, der Preis spielt keine Rolle«, versicherte er galant, »ich möchte, dass ihr euch eine Freude macht.«
Sophie, begeistert von diesem neuen Einkaufsgefühl, besuchte die Etage mit den Stoffen und konnte sich nicht satt sehen an der reichen Auswahl. Sie, die nur die eingeschränkten Angebote ihrer Schneiderin kannte, schwelgte in Samt und Seide, in Blütenmustern und strengen, unifarbenen Stoffen bester Qualität. »Ich schwanke zwischen diesem zarten Musselin für ein duftiges Sommerkleid und diesem Goldlamé für ein neues Abendkleid.« Fragend sah sie ihren Mann an. »So nimm doch beides, heute wollen wir den Kaufrausch genießen.«
Friederike, noch immer geschockt von dem Gedanken, Vater und Mutter und die Stadt verlassen zu müssen, lief unschlüssig hinter ihren Eltern her. Erst als der Vater sie bedrängte: »Nun such dir doch endlich aus, was dir Freude macht«, nahm sie zwei Bücher aus einem Regal und gab sie dem Vater.
»Das ist alles? Zwei Bücher über Haushaltsführung und Gartenarbeit? Das ist doch nicht dein Ernst, mein Kind.«
»Doch, in diesen Fächern habe ich die Prüfung nicht bestanden, da muss ich mein Wissen aufbessern. Für hübsche Abenteuerromane oder nette Liebesgeschichten haben wir sowieso keine Zeit in dieser Lehranstalt«, erklärte sie schlecht gelaunt und ließ die Eltern spüren, was sie über den Verlauf der letzten Tage dachte.
Nach dem Besuch dieses ersten Großstadt-Kaufhauses der Firma Karstadt befahl Ferdinand dem Chauffeur, durch die Mönckebergstraße zu fahren, die in den letzten Jahren deutlich ihr Aussehen verändert hatte und zu beiden Seiten von großen Geschäfts- und Kontorhäusern begrenzt wurde. Von außen mussten die Gebäude sich strengen baulichen Auflagen beugen und dem Charakter der traditionellen Hamburger Kontorhäuser entsprechen. Um die dreißig Meter breite Straße zwischen Bahnhof und Rathaus modern gestalten zu können, wurde ein dicht bebautes Altstadtquartier der St. Jacobikirche abgerissen. Kleine Handwerksbetriebe, Arbeiter und zahlreiche Stifte für Alte, Kranke und Arme verloren ihr Zuhause.
Ferdinand bemühte sich, seine beiden Damen zu unterhalten, und erklärte ihnen, dass die Straße ihren Namen vom verstorbenen Bürgermeister Johann Georg Mönckeberg bekommen hätte. Aber Sophie und Friederike waren müde von den ungewohnten Eindrücken und folgten seinen Ausführungen nur noch mit Anstrengung. So befahl er schließlich Willi Wilde, den Wagen zu wenden und nach Hause zu fahren.
Am ersten Juli brachten die Eltern ihre Tochter nach Wolfenhagen. Am Morgen vor der Abfahrt lief Friederike noch einmal in den Garten, um Abschied von der Sonnenuhr zu nehmen, die sie erst zu Weihnachten wiedersehen würde. Und als sie so davorstand, sah sie, wie ein Schatten über die bronzene Fläche zog und der geliebten Schale allen Glanz nahm. Aber dann, ganz schnell, war der Eindruck vorüber und die Uhr erstrahlte im gewohnten Glanz.
Drittes Kapitel
Ferdinand saß im Fond des Wagens. Willi Wilde fuhr ihn in die Stadt. Er hatte eine Konferenz im Bankhaus vor sich und ein Essen mit seinem besten Freund. Martin Brandner hatte finanzielle Probleme mit seiner Kaffeerösterei in Altona und Ferdinand um Rat gebeten.
Sie fuhren am Ostufer der Außenalster entlang und Ferdinand genoss den Blick über das Wasser und hinüber zu den Villen am anderen Ufer. Das ganze Gebiet zwischen dem Wasser und den höher gelegenen Straßen war jetzt eng bebaut und er war froh, hier am ruhigeren Ostufer mit dem Feenteich seinen behaglichen Besitz zu haben.
Er dachte einen Augenblick an sein Haus. Still ist es geworden, nachdem Friederike ins Pensionat gereist ist. Kein fröhliches Lachen, wenn sie mit den Nachbarskindern durch den Garten tobte, den jungen Gärtnergehilfen einen Streich spielte oder sich kichernd vor der Gouvernante versteckte.
Ach ja, Friederike, überlegte er. Nun ist sie schon seit drei Monaten in Wolfenhagen und noch immer nicht mit uns versöhnt. Ihre Briefe kommen so selten und sind so kurz, als wolle sie uns strafen und dabei meinen wir es doch nur gut mit ihr. Sie ist noch zu jung, um zu erkennen, wie wichtig die Erziehung in einer Gemeinschaft ist. Zum Glück sind die Meldungen aus dem Büro der Vorsteherin etwas ausführlicher und häufiger. Frau Berlinghoff betont immer wieder, dass Friederike sich gut eingelebt hat, fröhlich und fleißig ist und keinen Anlass zu irgendeiner Sorge gibt. Nun ja, überlegte er, noch knapp drei Monate, dann können wir sie für die Weihnachtstage nach Hause holen. Dann ist für kurze Zeit alles so, wie es früher war.
Er wusste, dass seine Frau diesen Tagen entgegenfieberte und bereits jetzt und in aller Heimlichkeit mit den Vorbereitungen für den Besuch begonnen hatte. Ich muss ihr das noch ausreden, dachte er, der Unterschied zwischen dem Feenteich mit seinen Annehmlichkeiten und Wolfenhagen mit der dortigen Einfachheit ist sowieso schon groß genug, da dürfen wir die Unterschiede nicht noch betonen. Das muss ich Sophie ganz ernsthaft plausibel machen.
Er sah auf seine Uhr. Der Verkehr wird mit jedem Tag dichter, überlegte er. Wenn das so weitergeht, müssen wir morgens früher abfahren, und er beschloss, den Chauffeur vom nächsten Tag an eine viertel Stunde früher zu bestellen. Sophie wird das nicht gefallen, er schmunzelte verständnisvoll, ihr fehlt dann die Zeit zum geruhsamen Morgenkaffee. Wir werden also auch etwas zeitiger aufstehen, um gemütlich frühstücken zu können.
Bei dem Gedanken an seine Frau nickte er zufrieden. Sie versteht es immer wieder, mich morgens zu überraschen. Ein besonders hübsch gedeckter Tisch, ein neues Parfum, mit dem sie sich umgibt, oder ein attraktives Morgenkleid, das mir den Abschied schwer machen soll. Er lächelte bei dem Gedanken an seine hübsche, noch immer reizvolle Frau, sie hat es eben nicht gern, wenn ich sie allein lasse. Wenn es nach ihr ginge, könnten wir gemeinsam den ganzen Tag vertrödeln, aber das geht nun einmal nicht. Und schon dachte er wieder an seine Bank, an die Aufgaben, die ihn erwarteten, und an die Verantwortung, die er trug.
Vorsichtig bahnte sich Wilde seinen Weg durch das Gewirr der Pferde, Kutschen, Ringbahnen, Fußgänger und Omnibusse. Hier an der Kreuzung zur Lombardsbrücke und kurz vor dem Bahnhof war der Verkehr besonders lebhaft. Dann fuhren sie über den neuen Damm an der Binnenalster entlang, links über den Berg und dann nach rechts am neuen Rathaus vorbei zum Hopfenmarkt. Zahlreiche Straßen waren nach dem verheerenden Brand von 1842 dem wachsenden Verkehr angemessen entstanden.
Auf dem Hopfenmarkt vor der neuen Nikolaikirche herrschte reger Marktbetrieb. Vor allem die Vierländer Bauern mit Obst, Gemüse und Blumen beherrschten mehrere Male in der Woche den Platz vor dem Bankhaus. Ferdinand liebte den bunten Marktbetrieb, Willi Wilde weniger, denn an diesen Tagen hatte er besondere Schwierigkeiten, den großen Wagen durch das Gewühl von Pferdegespannen, Handkarren, Marktbuden, Hunden, Straßenmusikanten und kauffreudigen Menschen zu lenken.
Endlich hatte er seinen Halteplatz erreicht, stieg aus und öffnete für seinen Herrn die Wagentür. Ferdinand bedankte sich und blieb einen Augenblick vor dem backsteinroten Bankgebäude stehen. Die Zahl 1730 wies auf den Gründungstermin hin, denn seit fünf Generationen war das Bankhaus im Besitz der Familie Bramfeld. Eine neue, vergoldete Zahl aber wies auf den Wiederaufbau des Hauses nach dem großen Brand, als sein Vater schon 1846 das Haus neu einweihen konnte. Ferdinand war sich seiner großen Verantwortung durchaus bewusst und er war stolz darauf, das Unternehmen weiter vergrößert und längst über die Grenzen der Hansestadt hinaus bekannt gemacht zu haben. Dennoch, trotz Stolz und Zufriedenheit, gab es ein großes Problem in seinem Leben. Er hatte keinen Nachfolger. Wem sollte er dieses gut florierende Haus übergeben? Würde Friederike eines Tages einen würdigen Schwiegersohn in die Familie einbringen? Einen Mann, dem er vertrauen und das Lebenswerk seiner Vorfahren übergeben konnte?
Ferdinand stieg die zwei Stufen zum Eingang hinauf, der Pförtner begrüßte ihn höflich und er erwiderte den Gruß freundlich, wie es seine Art war. Er warf einen Blick auf die Porträts seiner Ahnen in der großen Halle und dachte mit Wehmut an die Zukunft. In solchen Augenblicken beneidete er seinen Freund Martin Brandner, dem Gott drei wohlgeratene Söhne geschenkt hatte.
Bei aller Liebe zu meinem zauberhaften Mädchen, dachte er, ein Sohn wäre so wichtig für den Fortbestand des Bankhauses gewesen. Die jungen Frauen von heute haben ihre eigene Art, mit der Zukunft umzugehen und sehen ihr Leben schon lange nicht mehr zwischen Kindern, Küche und Kirche eingegrenzt. Sie streben, und zwar mit Recht, dachte er bekümmert, wie die jungen Burschen nach einem beruflichen Leben, und, nachdem 1850 die Frauenhochschule gegründet wurde, gibt es viele junge Damen, die eine berufliche Ausbildung dem Dasein als Hausfrau vorziehen. Weiß Gott, dachte er, mit welchen Plänen uns Friederike eines Tages überrascht. Ich bin wirklich kein rückständig denkender Mann, aber der Fortschritt in der Frauenbewegung kommt viel zu schnell und behagt mir wenig.
Mit Martin Brandner war er im Ratsweinkeller zum Essen verabredet. Die Küche dort war berühmt für ihre internationalen Speisenangebote, der Weinkeller der bestsortierte in der Stadt und die Bedienung von ausgesuchter Höflichkeit und Diskretion.
Nach der langwierigen und ermüdenden Konferenz ging Ferdinand, beschwingt und die spätsommerliche Wärme der ersten Oktobertage genießend, zu Fuß durch die Straßen zum Rathaus. An den Kreuzungen sorgten uniformierte Schupos, wie die Polizisten respektlos genannt wurden, für einen reibungslosen Verkehr und auf dem Rathausplatz wurden Tribünen errichtet. Vielleicht ein hoher Staatsgast, der unsere Stadt besucht, dachte Ferdinand. Der große Platz vor dem neuen Rathaus eignet sich vorzüglich für Paraden, Aufmärsche und pompöse Begrüßungen. Ich muss heute Abend die Zeitung studieren, dachte er, für meine Geschäfte ist es wichtig zu wissen, wer die Stadt besucht und mit welchem Gefolge. Nach dem Aufschwung Hamburgs zur Welthandelsmetropole kommen immer öfter ausländische Delegationen zu uns. Diese Ereignisse darf ich nicht aus den Augen verlieren.
Er hatte den Eingang zum Ratsweinkeller erreicht und stieg die Stufen hinunter. Hinter der schweren Tür war ein schmaler Gang mit roten Teppichen ausgelegt und von künstlichen Kerzen in Wandhaltern erhellt. Ein Diener kam, nahm ihm Hut und Gehrock ab und führte ihn zu dem bestellten Tisch in einer Nische. Das Kellergewölbe war in zahlreiche kleine Räume unterteilt, die dem Gast den Charakter von Intimität und Ungestörtheit vermittelten. Darauf legte Ferdinand großen Wert, denn er traf sich oft hier mit Kunden der Bank und die Gespräche waren meist nicht für Fremde bestimmt.
Martin Brandner saß bereits am Tisch. Er stand auf und begrüßte seinen Freund. »Danke, dass du gekommen bist. Ich hoffe, du hast einen guten Appetit mitgebracht, der Oberkellner hat mir Salzwiesenlamm von der Nordseeküste mit farcierten Kartoffelscheiben empfohlen.« Er reichte dem Freund die ledergebundene Speisekarte mit dem goldgeprägten Hamburger Wappen auf dem Einband. Aber Ferdinand gab die Karte zurück: »Ich schließe mich dir an. Wenn die Empfehlung vom Oberkellner kommt, sollte man zugreifen. Aber auf Wein werde ich verzichten.« Er legte die Weinkarte zur Seite. »Er macht mich müde und ich denke, zu einem Lamm passt auch ein gut gezapftes Bier vom Fass.«
Während des Essens wurde wenig gesprochen, ein paar Fragen nach den Familien, nach gemeinsamen Freunden – über Geschäfte sprach man niemals, wenn man speiste, es hätte den Genuss geschmälert und den Koch beleidigt. Doch Ferdinand spürte, dass der Freund unruhig war. Er kannte die finanziellen Probleme der Firma Brandner, die wiederholt mit unbekannten Kaffeesorten experimentiert, neue Röstmaschinen gekauft hatte und mit der Bonität in Verzug geraten war. Er wusste aber auch, dass man mit etwas Geschick ein offizielles Insolvenzverfahren abwenden konnte. Weshalb also war der Freund so beunruhigt?
Nach dem Essen wählten die Herren mit Bedacht ihre Zigarren aus dem reichhaltig angebotenen Sortiment, bestellten ihren Cognac und warteten, bis der Tisch geräumt war. Dann beugte sich Ferdinand vor, legte dem Freund vertraulich die Hand auf den Arm und fragte: »Was ist los, Martin?«
Brandner streifte die Asche von der Zigarre, nahm einen Schluck aus seinem Glas und erwiderte: »Ich habe große Probleme in der Firma und nicht nur auf finanziellem Gebiet. Mir laufen die Arbeiter weg. Und die, die bleiben, murren, sind unzufrieden, drohen mit Streiks und widersetzen sich den Anordnungen.«
Ferdinand hörte aufmerksam zu. Er wusste, dass in vielen Betrieben Arbeiter aufständisch wurden und mit dem Boykott der Arbeit drohten. Aber bei seinem Freund hatte er nicht damit gerechnet. Die Firma galt als mustergültig im Umgang mit den Arbeitern und als besonders fortschrittlich in Bezug auf die Arbeitsbedingungen und die Freizeitregelungen. Was war da passiert?
»Hast du Gründe dafür?«
»Man hört von allgemeiner Unzufriedenheit der Arbeiter. Vor allem in Altona kommt es immer wieder zu kleinen Aufständen. Ich nehme an, ein paar Unzufriedene hetzen die anderen auf, ich habe auch davon gehört, dass diese neumodischen Gewerkschaftsvereine an diesen Boykotts beteiligt sein sollen. Sie versprechen den Männern wirtschaftliche, soziale und kulturelle Vorteile und mehr Lohn. Bei uns in Altona sind sie bereits fest involviert.«
»Und was bedeutet das für deine Firma?«
»Wir müssten mehr arbeiten, schneller und effizienter sein, einfach mehr schaffen, um mit den finanziellen Schwierigkeiten fertig zu werden, dann kann man auch über mehr Lohn reden. Stattdessen laufen mir die Männer weg und die Arbeit bleibt liegen. Meine Lagerhäuser sind voll mit teurer Rohware, aber ich kann sie nicht verarbeiten. Die Kunden murren und mir verderben die kostbaren Bohnen.«
»Und was würde Abhilfe schaffen?«
»Geld, viel Geld, um die Lohnforderungen zu bezahlen. Geld, das ich nicht habe, weil ich es nicht verdienen kann. Weil, verdammt noch mal, mir die Arbeiter dafür weglaufen. Du siehst, die Katze beißt sich in den Schwanz und ich drehe mich dabei im Kreise.«
Ferdinand war konsterniert. So aufgebracht hatte er seinen besonnenen Freund noch nie erlebt. Es dauerte eine gewisse Zeit, bis er antwortete, dann war höchste Wut aus seiner Stimme zu hören. »Diese Schweine. Wenn es ein Trost für dich ist, kann ich dir sagen, dass du nicht der Einzige bist, der unter diesen Streiks leidet. Immer mehr meiner Kunden haben ähnliche Probleme. Aber wenn es um einen finanziellen Engpass geht, Martin, dann musst du dir keine Sorgen machen. Das kann geregelt werden.«
»Ich weiß, dass du mir helfen würdest. Aber das kann ich nicht annehmen, denn aus meiner Firma ist ein Fass ohne Boden geworden. Leider muss man das so sehen«, versicherte er mit erstickter Stimme.
»Was sagen deine Söhne zu der Situation? Sie arbeiten doch inzwischen alle drei in der Rösterei.«
Brandner zuckte mit den Schultern. »Sebastian, der Älteste, sympathisiert mit den Gewerkschaftsvereinen. Er ist seit langem sozialistisch engagiert und steht dem Kapitalismus seit Jahren kritisch gegenüber. Bruno, der Zweite, ist das genaue Gegenteil. Er will, dass ich Geld in die Firma stecke, ganz gleich, woher es kommt, Hauptsache, sein Wohlstand ist gesichert. Und der Jüngste, Heinrich, will von dem ganzen Dilemma nichts wissen. Er macht seine Lehre bei mir und will dann so schnell wie möglich auf Kaffeeplantagen in Übersee arbeiten.«
Ferdinand hörte erschrocken zu, so war das also mit den Söhnen und für einen Augenblick war er dankbar für seine kleine, unkomplizierte Tochter. »Und was sagt deine Frau dazu? Sie kommt doch aus einer vermögenden Familie.«
»Um ehrlich zu sein, Ferdinand, sie ist mit ihrem Vermögen sehr zurückhaltend. Es ist nie nach Hamburg überwiesen worden. Um unser Ansehen zu bewahren, hat sie mir einen kleinen Teil zur Verfügung gestellt.«
»Und du hast es angenommen?«
»Ich musste, sonst hätten wir unser Haus an der Palmaille verkaufen müssen und alle hätten von unserem Fiasko erfahren, das wollte sie unbedingt vermeiden.«
Ferdinand nickte. Ja, so war das mit dem hanseatischen Geldadel, das Ansehen musste um jeden Preis erhalten bleiben. Auf der Palmaille wohnte eine kleine, privilegierte Elite in sehr exquisiten Häusern hoch über dem Hafen und repräsentierte das Image des Reichtums. Da durfte es einfach nicht zum Bankrott einer Firma kommen. »Wir werden einen Weg aus deiner Misere finden, Martin. Ich werde mich darum kümmern.«
»Du wirst dich nur selbst in Schwierigkeiten bringen. Das Geld deiner Bank gehört dir schließlich nicht.«
»Das brauchst du mir nicht zu sagen. Ich hatte an eine persönliche Bürgschaft gedacht. Mit meinem Namen im Hintergrund bekommst du Darlehen in jeder Höhe und auch die Zahlungsaufschübe, die du brauchst, um wieder solvent zu werden. Wir werden eine schwierige Phase überbrücken und in einem Jahr denkst du nicht mehr an dieses Problem.«
»In einem Jahr! Was kann in einem Jahr alles passieren, Ferdinand. Ich spüre, dass diese Streiks zunehmen, das wir ganz am Anfang einer Entwicklung stehen, die uns allen über den Kopf wächst.« Er schüttelte den Kopf. »Nein, ich kann deine Hilfe nicht annehmen. Und außerdem, zwischen Freunden sollte man nie über Geld verhandeln, das zerstört jede Freundschaft.«
»So ein Unsinn!« Jetzt war Ferdinand spürbar verärgert: »Wozu hat man denn Freunde, wenn man in der Not nicht mit ihnen rechnen kann. Wie willst du denn aus diesem Dilemma ohne Hilfe herauskommen, mach mir einen akzeptablen Vorschlag.«
»Genau dafür brauche ich deinen Rat. Ich möchte die Firma verkaufen, aber ich weiß nicht an wen. Du als Bankier kennst die Geschäfte deiner Kunden, ihre Solvenz und ihre Interessen. Hilf mir beim Verkauf.«
Ferdinand sah den Freund verständnislos an. »Verkaufen? Du willst deine renommierte und im ganzen Land bekannte Kaffeerösterei verkaufen, das Lebenswerk deiner Vorfahren, die Zukunft deiner Söhne? Die Hamburger schwören auf deinen Kaffee und deine Versandabteilung schickt eure Pakete bis an die Oder, bis an den Rhein und bis in die Alpen. Du kannst doch deine Kunden nicht dermaßen enttäuschen.«
Brandner nickte verzweifelt. »Ich sehe keinen anderen Ausweg.«
Aber Ferdinand schüttelte den Kopf. »Das kann ich nicht zulassen. Und, um ehrlich zu sein, ich sehe auch keinen potenziellen Käufer. Die Händler sind in letzter Zeit sehr zurückhaltend mit ihren Investitionen, vielleicht wegen der Streiks und der damit verbundenen Unsicherheiten. Nein Martin, diese Zeit ist für einen Verkauf nicht geeignet. Wir überbrücken sie und dann geht es wieder aufwärts.«
Als die Herren am späten Nachmittag den Weinkeller verließen, hatte Ferdinand sich durchgesetzt. Er war sehr zuversichtlich, als er zu seiner Bank zurückging. Alles wird sich zum Besten wenden, überlegte er, wirtschaftliche Engpässe gibt es immer wieder und aufmüpfige Arbeiter auch. Seine gute Laune wurde noch verstärkt, als er in seinem Büro einen elegant bedruckten Briefumschlag aus cremefarbenem Büttenpapier vorfand, der ein eindrucksvolles Billett mit einer Einladung enthielt.
Kirchenvorstand und Hauptpastor der St. Michaeliskirche gaben sich die Ehre, ihn und seine Frau Gemahlin zur Einweihung des neugebauten Gotteshauses in der Neustadt und im Anschluss daran zu einem Empfang im Kaisersaal des Rathauses am 19. Oktober einzuladen.
Ferdinand war hocherfreut. Seit Jahren hatte die Familie auf die Fertigstellung des ›Michel‹, wie die Kirche liebevoll von den Hamburgern genannt wurde, gewartet. Hier hatten er und seine Sophie geheiratet, hier fühlten sie sich bei allen festlichen Anlässen und an vielen Sonntagen im Jahr wohl. Und plötzlich war sie sechs Jahre zuvor bei Lötarbeiten am Turm abgebrannt. Ein langer Streit zwischen Stadt und Bauherren folgte. Sollte die Kirche als gewohnter, historischer Barockbau oder als modernes Gotteshaus aufgebaut werden? Er hatte, wie die Mehrheit der Bevölkerung, für die Rekonstruktion des historischen Gebäudes gestimmt und den Bau, als 1907 endlich damit begonnen wurde, durch zahlreiche Spenden unterstützt. Er schmunzelte, man hat meine Spenden nicht vergessen, wir gehören zu den geladenen Gästen und wir werden die feierliche Kirchweihe in Anwesenheit von Kaiser Wilhelm II. erleben. Er ließ sich von Willi Wilde nach Hause an den Feenteich fahren und, noch immer hochgestimmt, überreichte er Sophie das Billett.
»Liebling, ich habe eine wunderbare Überraschung für dich.«
Auch Sophie war höchst erfreut, dachte aber sofort an die praktische Seite der Einladung. »Ferdinand, wir brauchen eine neue Garderobe. Hier steht klein gedruckt: Frack und Zylinder für den Herren, festliche Bekleidung mit Hut für die Dame.«
»Selbstverständlich, meine Liebe. Ich überlasse alles dir. Mein Schneider und der Hutmacher haben meine Maße und bei dir wird es auch so sein. Nimm die beste Stoffqualität und lass dich in der Modefrage beraten und bitte denke daran, wir haben nur eine Woche Zeit.«
Festlich und gewaltig ertönte das Geläut von St. Michaelis am 19. Oktober. Leider ließ das Wetter zu wünschen übrig, aber alle Gäste fuhren in ihren geschlossenen Limousinen vor und Kirchendiener mit Regenschirmen geleiteten die Ankommenden von der Autotür bis zum Kirchenportal. Ferdinand nahm ergriffen Sophies Arm. »Hörst du, Liebes, die kleine, feine Glocke, einen Teil davon haben wir gestiftet. Möge sie uns recht oft einladen herzukommen.«
Drinnen wurden sie von Helfern zu ihren Plätzen geführt, und Sophie war glücklich, einen guten Blick auf den Kaiser zu haben, der als Letzter seinen Platz einnahm. Die Predigt hielt Hauptpastor August Wilhelm Hunzinger, ein beliebter Prediger in der Stadt. Er weihte und segnete das Gotteshaus und führte neue kirchliche Mitarbeiter ein. Unter ihnen auch Carsten Splitt, den Turmbläser, dessen Aufgabe es war, zweimal täglich einen Choral vom Turm aus über die Stadt hinweg zu spielen. Sein Vorgänger, der getreue Beuerle, war bei dem Brand damals ums Leben gekommen, als er versuchte, das Feuer zu löschen. Ihm widmete die Gemeinde eine stille Gedenkminute.
Nach dem Festgottesdienst begaben sich die geladenen Gäste ins Rathaus. Fahnen und Girlanden und Hunderte von Schaulustigen säumten die Straßen und die Plätze vor der Kirche und vor dem Rathaus. Kinder schwenkten trotz des schlechten Wetters bunte Papierfähnchen, Straßenhändler boten Souveniers an und alle Hamburger Zeitungen hatten dem Ereignis im Beisein des Kaisers ihre ersten Seiten gewidmet.
Sophie und Ferdinand waren glücklich. Sie trafen zahlreiche Bekannte aus dem Hamburger Geldadel. Komplimente, Eindrücke, Beobachtungen und hinter vorgehaltener Hand auch ein paar Bemerkungen über das Aussehen des Kaisers wurden ausgetauscht und lächelnd verabschiedete man sich, um mit dem nächsten Anwesenden einen kleinen Plausch zu beginnen.
Ferdinand organisierte ein paar Gläser Hamburger Rotspon und Sophie gelang es, einige exquisit belegte Schnittchen zu bekommen, und so prostete man sich zufrieden zu und wünschte einander eine glückliche Zukunft, bevor man beschwingt auseinander ging.
An die Bürgschaft dachte Ferdinand erst wieder zwei Tage später, als sein Justiziar ihm die Papiere für die Unterschrift vorlegte. Auch er verwies auf das hohe Risiko, aber Ferdinand wischte alle Bedenken mit einer Handbewegung beiseite. »Keine Diskussion«, erklärte er unwirsch, »einen Freundesdienst diskutiere ich nicht.«
Er ahnte nicht, welche Folgen dieses Arrangement für seine eigene Firma haben sollte. Sophie war die Erste, die ratlos die Hände zusammenschlug, als sie von der Bürgschaft und dem damit verbundenen finanziellen Wagnis hörte. Sie, die eigentlich immer und bedenkenlos den Vorhaben ihres Mannes zustimmte, erklärte ganz offen: »Das war falsch. Du hättest mich fragen müssen.«
Viertes Kapitel
Z