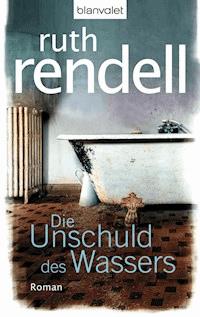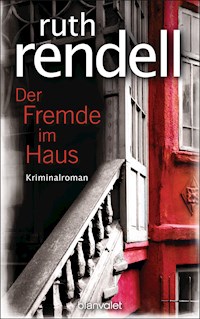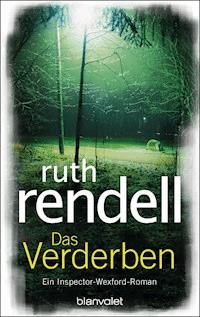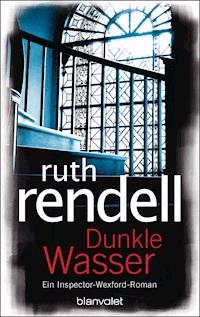8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Jedes Jahr verbringen die Geschwister Piers und Petra die Sommerferien auf Mallorca. Es war immer eine glückliche Zeit für die beiden, und bis zu jenem einen verhängnisvollen Sommer waren sie unzertrennlich. In dem Paradies aus Sonne und blauem Meer lernt Piers eines Tages Rosario kennen und lieben, und Petra fühlt sich schmerzhaft zurückgesetzt. Kurz darauf kommen Piers und Rosario von einem Ausflug nicht zurück und bleiben spurlos verschwunden. Unfall oder Verbrechen? Erst vierzig Jahre später soll Petra, die fortan eine ruhelose, getriebene Frau ist, die Wahrheit erfahren …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 133
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Ruth Rendell
Das Haus der geheimen Wünsche
Buch
Jedes Jahr verbringen die Geschwister Piers und Petra die Sommerferien auf Mallorca. Es war immer eine glückliche Zeit für die beiden, und bis zu jenem einen verhängnisvollen Sommer waren sie unzertrennlich. In dem Paradies aus Sonne und blauem Meer lernt Piers eines Tages Rosario kennen und lieben, und Petra fühlt sich schmerzhaft zurückgesetzt. Kurz darauf kommen Piers und Rosario von einem Ausflug nicht zurück und bleiben spurlos verschwunden. Unfall oder Verbrechen? Erst 40 Jahre später soll Petra, die fortan eine ruhelose, getriebene Frau ist, die Wahrheit erfahren …
Autorin
Ruth Rendell wurde 1930 in South Woodford/London geboren. Zunächst arbeitete sie als Journalistin, bevor sie sich ganz dem Schreiben von Romanen widmete. Dreimal bereits erhielt sie den Edgar-Allan-Poe-Preis und zweimal den Golden Dagger Award. 1997 wurde sie mit dem Grand Master Awardder Crime Writer‘s Association of America, dem renommiertesten Krimipreis, ausgezeichnet und darüber hinaus von Königin Elizabeth II. in den Adelsstand erhoben. Ruth Rendell, die auch unter dem Pseudonym Barbara Vine bekannt ist, lebt in London.
Die Reihenfolge der Inspector-Wexford-Romane sowie weitere Romane finden Sie hier.
Ruth Rendell
Das Haus der geheimen Wünsche
Roman
Aus dem Englischen von Renate Orth-Guttmann
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.Die Originalausgabe erschien 1990 unter dem Titel The Strawberry Tree bei Pandora Press, Unwin Hyman Ltd., London.
E-Book-Ausgabe 2015
bei Blanvalet, einem Unternehmen der
Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Copyright © der Originalausgabe 1990 by Kingsmarkham Enterprises Ldt.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 1991 by Blanvalet Verlag GmbH, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: www.buerosued.de
Umschlagmotiv: Arcangel Images/Hayden Verry
Satz: EDV-Fotosatz Huber/Verlagsservice G. Pfeifer, Germering
ISBN: 978-3-641-15137-9V002
www.blanvalet.de
1
_____
Das Hotel, in dem wir wohnen, hat mein Vater gebaut. Es soll, so versichert man mir allenthalben, das beste Hotel in Llosar sein, und das größte und hässlichste ist es allemal. Von weitem meint man, es sei aus weißem Karton gemacht oder aus Hunderten von Umschlägen zusammengesetzt, deren Klappen offen stehen. Die Innenausstattung brüstet sich mit den üblichen Attributen konventioneller Eleganz, bronzefarbenen Spiegelflächen und kupferfarbenen Marmorplatten, und in der Halle steht in Terrakottagefäßen von unbestimmt klassisch-römischem Aussehen ein Heer von Hibiskuspflanzen mit trompetenförmigen Blüten, rot wie Husarenröcke.
Das Hotel hat einen Swimming-Pool und einen Raum voller Fitnessgeräte, drei Restaurants und zwei Bars. Ein Apparat putzt einem die Schuhe, ein anderer bereitet Eiswürfel. Einst sahen wir den jungen Männern zu, wie sie palo tranken, aus langen, dünnen bogenförmigen Gefäßen, die den Alkohol in einem kühnen Bogen verspritzten. Jetzt mixt der Barkeeper im Hotel Cocktails, die Mañanas heißen und berühmt sein sollen. Wir haben sie gestern probiert, auf der Terrasse hinter dem Hotel. Von dort kann man, wenn man nicht – wie die meisten Leute – auf den Swimming-Pool schaut, das Auge im doppelten Sinne auf dem Garten ruhen lassen. Hier blüht und gedeiht der Arbutus, der zur gleichen Zeit weiße Blüten und reifende Erdbeeren trägt, ein Phänomen, von dem ich gehört, das ich aber bislang nie mit eigenen Augen gesehen hatte, denn es ist Oktober, und damals war ich im Sommer hier.
Wir haben Zimmer mit jenen Balkonen, die wie Briefumschläge aussehen, mit Blick auf die Bucht. Fischerboote gibt es nicht mehr, der Pier des alten Hotels mit seinem Weinlaubbaldachin ist verschwunden, und aus dem alten Hotel selbst ist ein Kasino geworden. Doch der Hafen ist noch da mit dem Standbild der Jungfrau, Nuestra Doña de los Marineros, wo Piers und Rosario und ich, im tiefen grünen Wasser schwimmend, zum ersten Mal Will sahen, der auf der gedrungenen Steinmauer saß.
Die ganze »Promenade« – so muss ich sie wohl nennen – säumen an Stelle der früheren Häuserzeile Hotels und Restaurants, Souvenirläden und Reisebüros, Cafés und kleine Bars. Die Kirche mit ihrem braunen Glockenturm und dem flachen Ziegeldach, die einst diesen Küstenstrich beherrschte, steht wie verloren zwischen den Neubauten, zur Bedeutungslosigkeit geschrumpft vor dem riesigen Thomson Holiday Hotel. Ich habe das Zimmermädchen gefragt, ob sie in letzter Zeit Quallen in Llosar hätten, aber sie hat nur den Kopf geschüttelt und etwas von contaminación gemurmelt.
Das Haus, das uns José-Carlos und Micaela zur Verfügung gestellt hatten, ist noch da, allerdings erheblich ausgebaut und vergrößert, zuckergussrosa getüncht und von dem schnörkeligsten schmiedeeisernen Gitter umgeben, das ich je gesehen habe, eiserne Klöppelspitze für ein Riesentischtuch um die Zuckergusstorte eines Riesenkindes. Ich glaube kaum, dass Rosario es wiedererkennen würde. Im Binnenland hat sich, soweit ich das beurteilen kann, nicht allzu viel verändert. Bisher habe ich mich noch nicht dorthin gewagt, obgleich unser Leihwagen sehr ordentlich ist. Ich gehe ein Stückchen hügelan, bis das Dorf hinter mir liegt, schaue zu den gelben Hügeln hoch, zu den Ölbäumen und Wacholdern und den breiten, geraden Straßen, die jetzt Schneisen durch die Landschaft schlagen, aber das Spukhäuschen, die Casita de Golondro, kann ich nicht erkennen. Von hier hat man es auch damals nicht sehen können. Es verbirgt sich in einer Talmulde, die von Pinien und Johannisbeergehölz gesäumt ist. Unser Hoteldirektor hat mir heute Vormittag erzählt, dass es jetzt ein parador ist, der erste auf Mallorca.
Wenn das, was mich hergeführt hat, erledigt ist, will ich es mir einmal ansehen. Diese in staatlicher Regie betriebenen Hotels, von denen es auf dem Festland schon viele gibt, sollen sehr angenehm sein. Wir könnten zum Abendessen hinfahren. Ich werde es den anderen vorschlagen. Sollten sie aber auf die Idee kommen, dass man doch dorthin umziehen könnte, werde ich Nein sagen, das habe ich mir vorgenommen. Würde ich dort wohnen, müsste ich früher oder später jenen Raum wiederentdecken oder ihn absichtlich meiden. Ehrlich gesagt wünsche ich mir gar keine Erklärung mehr. Ich möchte meine Ruhe haben, ich möchte, wenn das nicht zu überspannt klingt, glücklich sein.
Mein Termin in Muralla ist morgen Früh um zehn, ein Beamter der Guardia Civil erwartet mich, sein Rang entspricht, soweit ich weiß, dem eines Superintendents in unserer Kriminalpolizei. Er wird mir zeigen, was es zu sehen gibt, ich werde mir alles ansehen und versuchen, mich zu erinnern, und ihm meine Antwort geben. Ich habe noch nicht entschieden, ob ich die anderen mitnehmen soll, und weiß auch nicht, ob ihnen daran läge, mitzukommen. Es wird wohl das Beste sein, wenn ich dies – wie so vieles in den vergangenen Jahren – allein erledige.
2
_____
Fast vierzig Jahre ist es her, seit wir, Piers und ich und unsere Eltern, zum ersten Mal nach Mallorca reisten, in das Haus, das unser spanischer Vetter uns zur Verfügung stellte, weil meine Mutter krank gewesen war. Sie litt an Depressionen und einem generellen Gefühl der Mattigkeit und Lethargie, aber der Grund dafür war das Kind, das sie verloren hatte, war eine Fehlgeburt. Schon damals, ehe es wirklich nötig gewesen wäre, bemühten sich meine Eltern darum, weitere Kinder zu bekommen, bemühten sich darum – wovon ich natürlich nichts wusste –, seit ich dreizehn Jahre vorher zur Welt gekommen war. Es war, als wüssten sie dank einer traurig-abergläubischen Vorahnung, dass sie ihr Taubenpaar nicht immer haben würden.
Ich erinnere mich an den Brief, den José-Carlos an meinen Vater schrieb. Die beiden hatten im spanischen Bürgerkrieg zusammen gekämpft, waren seither eng befreundet und schrieben sich sporadisch, obgleich er der Vetter meiner Mutter und nicht meines Vaters war. Die Tante meiner Mutter hatte einen Spanier aus Santander geheiratet, und José-Carlos war ihr Sohn. Wir wussten deshalb alle, wo Santander war, von Mallorca aber wussten wir so gut wie nichts. Zumindest mussten wir es auf der Karte suchen. Bis auf Piers natürlich, der sich in diesen Dingen auskannte. Piers hätte uns sagen können, dass Mallorca die größte der Baleareninseln war, Provinz Baleares im westlichen Mittelmeer, und wohl auch, dass sie eine Ausdehnung von etwas über 1400 Quadratmeilen hatte. Aber zu den vielen erfreulichen Eigenschaften meines gescheiten Bruders, dieses Glückskindes, gehörte auch seine Bescheidenheit. Ungebetene Belehrungen zu erteilen war nicht seine Art. Auch er stand da und sah über Vaters Schulter auf den Universitätsatlas von Goodall & Darby, eine Vorkriegsausgabe, für den das britische Empire der Nabel der Welt und das Mittelmeer nur ein unbedeutendes Binnengewässer war. Er stand da und schwieg wie wir.
Die winzigen Balearen schwammen grüngolden auf hellem Blau in den Armen von Barcelona und Valencia. Majorca (in Klammern Mallorca) war ein Planet mit Begleitmonden: Formentera, Cabrera, aber auch Menorca und Ibiza. Wie seltsam es heute anmutet, dass wir von Ibiza noch nie gehört hatten, dass wir keine Ahnung hatten, wie man es ausspricht, während Minorca nur ein Ort war, nach dem man eine Haushuhnsorte benannt hatte.
Das Haus von José-Carlos stand in einem Ort, der Llosar hieß. Er schilderte Haus und Umgebung in fast entschuldigendem Ton, die Schönheit herunterspielend, rustikale Unzulänglichkeiten unterstreichend. Das Haus lag an der Nordwestküste mit Blick aufs Meer, einen Steinwurf vom Dorf entfernt, einem durchaus unbedeutenden Dorf mit einigen wenigen kleinen Läden und einem Hotel. Sein Englisch ist so gut, dass er uns richtig beschämt, sagte mein Vater, wir werden unser Spanisch aufpolieren müssen, Mutter und ich.
Das Haus gehöre uns den ganzen Juli und August über oder solange wir Kinder Ferien hätten. Es sei sehr ruhig dort, man könne nicht viel unternehmen, nur schwimmen und in der Sonne liegen, Fisch essen und in der Taverne etwas trinken, falls meine Eltern Lust dazu hätten. Im Südosten der Insel gab es Tropfsteinhöhlen und unterirdische Seen, die einen Besuch lohnten, sofern wir uns den Leihwagen anvertrauen mochten, die auf der Insel zur Verfügung standen. Allmählich kämen auch Touristen, aber allzu viele würden es nicht sein, da es nur ein Hotel gab.
Llosar war auf unserer Karte eingetragen, auf einer Landzunge im Norden der Insel. Die Hauptstadt, Palma, erschien uns ziemlich groß, bis wir sahen, dass die Buchstaben die gleiche Größe hatten wie Alicante auf dem Festland. Piers und ich waren noch nie im Ausland gewesen. Wir waren Kriegskinder, vor Beginn des Krieges geboren und durch ihn auf unserer belagerten Insel festgehalten. Und seit Kriegsende hatten wir geduldig auf eine solche Gelegenheit warten müssen – eine Reise, die nicht allzu viel kostete und keine langfristigen Planungen erforderte.
Ich freute mich unbändig auf diese Ferien. Ich war nie krank gewesen, jetzt aber, da das Trimester seinem Ende zuging, hatte ich die größte Angst davor, irgendein Leiden könne mich plötzlich und unerwartet heimsuchen. Denkbar war das durchaus. Damals, vor der allgemeinen Impfpflicht, bekam jeder früher oder später die Masern. Ich hatte sie noch nicht gehabt. Piers war im vergangenen Jahr für eine Operation im Krankenhaus gewesen, aber mir hatte man noch nicht mal die Mandeln herausgenommen. Möglich war alles. Ich kam mir verletzlich vor, lebte täglich in der Angst vor den unerklärlichen Bauchschmerzen, den roten Pünktchen auf der Haut, dem Husten. Ich fing sogar an, frühmorgens Temperatur zu messen, genau wie es meine Mutter tat, die allerdings andere Gründe dafür hatte. Sie würden ohne mich fahren. Warum nicht? Es wäre nicht fair, vier Leute um einer einzigen Person willen zu Hause fest zu halten. Man würde mich, wenn ich aus dem Krankenhaus kam, zu Tante Sheila schicken.
Doch dann kam alles ganz anders. Unsere Gruppe sollte sich nicht verkleinern, sondern um ein Mitglied vergrößern. Der zweite Brief von José-Carlos klang noch entschuldigender, und zwar diesmal mit Recht, wie ich fand. Er habe eine Bitte. Natürlich sollten wir gleich Nein sagen, wenn es uns nicht recht sei. Rosario würde sehr gern im Haus bleiben, solange wir da waren. Rosario liebe das Haus und sei es gewöhnt, die Sommerferien dort zu verbringen.
»Rosario? Was ist denn das für einer?«, fragte ich.
»Es ist ein Mädchen«, sagte meine Mutter. »Die Tochter von José-Carlos. Inzwischen dürfte sie fünfzehn oder sechzehn sein.«
»Einer dieser spanischen Namen«, erläuterte mein Vater, »die eine Kurzform für Maria von Sowieso sind. Maria del Pilar, Maria del Consuelo oder in diesem Falle Maria del Rosario, Maria vom Rosenkranz.«
Ich war sehr betroffen. Ich wollte sie nicht dabeihaben. Der Gedanke an eine junge Spanierin in unserem Kreis erfüllte mich mit Bestürzung. Ich konnte sie mir vorstellen, groß und dunkel, mit schwarzem, wallenden Haar, beim Tanzen schwingenden Stufenröcken, Kamm und Mantilla – hätte nicht viel gefehlt, und ich hätte ihr in meiner Fantasie noch eine Rose zwischen die Zähne gegeben.
»Wir können José-Carlos schreiben, dass es uns nicht recht ist.« Mir erschien das durchaus plausibel. »Wo er es doch selbst vorschlägt … Wenn wir es gleich machen, weiß sie rechtzeitig Bescheid, dass sie nicht da sein soll.«
Meine Mutter lachte, mein Vater blieb ernst. Wenn ich jetzt, nach so langer Zeit, zurückdenke, vermute ich, dass er damals schon meine Art verstand und sich Gedanken darüber machte. Er sagte freundlich, aber ohne zu lächeln: »Er hat es nicht so gemeint, es war nur eine Höflichkeitsfloskel. Wir können ihm die Bitte unmöglich abschlagen.«
»Außerdem«, sagte Piers, »ist sie vielleicht sehr nett.« Diese Möglichkeit kam für mich überhaupt nicht in Betracht. Ich begegnete damals fast allen Menschen mit Argwohn und habe mich in dieser Hinsicht kaum geändert.
Noch immer stelle ich mich darauf ein, meine Mitmenschen abzulehnen und von ihnen abgelehnt zu werden. Ich rechne mit ihrer Lieblosigkeit, ihrer Niedertracht, ihrem Neid. Wenn jemand mich zum Abendessen einlädt und hinzufügt, ein Bekannter oder eine Bekannte sei da, mit dem oder mit der ich mich prächtig verstehen würde, sage ich sofort ab. Ich fürchte solche Begegnungen. Die neue Bekanntschaft ist in meiner Voreinschätzung kalt, egozentrisch, boshaft, darauf aus, mich zu kränken oder zu verletzen, ist hübsch oder bildschön, gut gekleidet und geistsprühend, findet mich unattraktiv oder dumm, wird entweder nicht mit mir reden wollen oder wenn, dann mit dem Ziel, mich zu demütigen.
Ich kann nicht über meinen Schatten springen. Ich habe es versucht. Psychotherapeuten haben es versucht. Das ist – unter anderem – der Grund dafür, dass ich, obwohl ich reicher bin, als die meisten Leute es sich in ihren kühnsten Träumen vorstellen können, dazu durchaus intelligent und eloquent, bis vor kurzem ein einsames Leben geführt habe, isoliert, nicht so sehr vernachlässigt als der Gegenstand von Bemerkungen wie:
»Petra kommt ja doch nie, man braucht sie im Grunde gar nicht erst einzuladen …« und: »Man muss Petra so weit im Voraus anrufen oder ihr schreiben und so viele Vorbereitungen treffen, ehe man auf eine Tasse Tee vorbeischaut, dass es kaum den Aufwand lohnt.«
Es ist nicht so sehr Schüchternheit, nein, da ich selbst eine kalte Natur bin, habe ich Verständnis für die Verachtung und Gleichgültigkeit der Kaltherzigen und mag nicht ihr Opfer werden. Ich mag mich nicht einem Blick, einem Lachen, einer verletzenden Bemerkung aussetzen, die mich »klein und hässlich« machen könnten, wie es in einer Redensart so treffend heißt. Eine andere Redensart aber kann ich nachvollziehen, wenn jemand von sich sagt, er würde am liebsten im Erdboden versinken; es ist dies nicht etwas, was ich mir wünsche, sondern etwas, was mir Tag für Tag geschieht. Erst im letzten Jahr hat in dieser Beziehung Tauwetter eingesetzt, beginnt sich langsam, mit großer Verspätung, mein Herz zu öffnen.
Und deshalb vergällte mir die Aussicht auf Rosarios Gesellschaft die letzten Tage vor unserer Spanienreise. Sie würde hübscher sein als ich. Und größer. Später betrachtet man es eher als Vorteil, wenn man eine ältere Freundin hat, nicht aber mit dreizehn. Rosario war älter und deshalb gescheiter, weltgewandter, sie war mir überlegen und wusste es. Auch war mir der erschreckende Gedanke gekommen, dass sie möglicherweise kein Englisch sprach. Sie würde eine Erwachsene sein, die Spanisch mit meinen Eltern parlierte und sich mit ihnen in der großen Erwachsenenverschwörung zusammentat gegen all jene, die noch Kinder waren.
So war denn die Vorfreude durch düstere Befürchtungen zunichte gemacht, und auch in meinem späteren Leben ist es mir nie anders gegangen – bis jetzt.