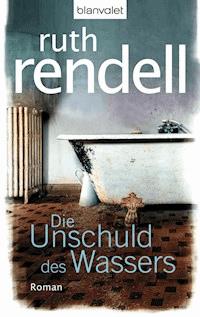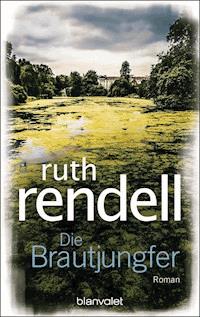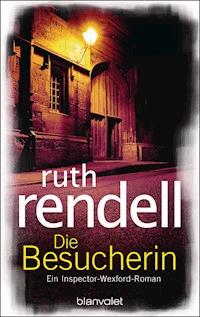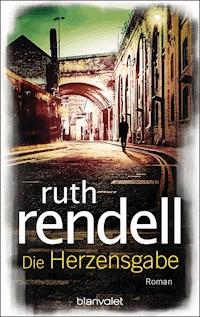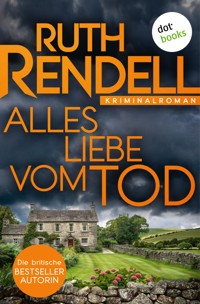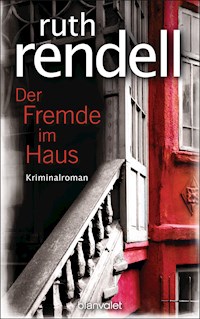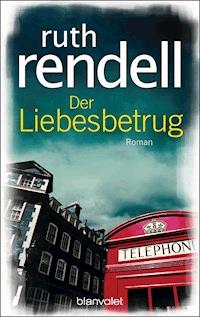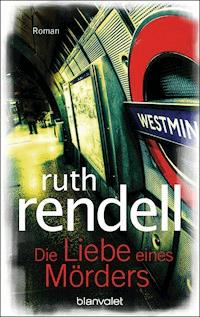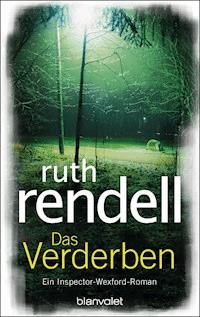
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Der beschauliche Ort Kingsmarkham wird durch eine Serie von Gewalttaten erschüttert. Zuerst verschwinden kurz nacheinander zwei junge Mädchen. Als sie nach wenigen Tagen scheinbar unbeschadet wieder zurückkehren, weigern sie sich, über ihre Erlebnisse Auskunft zu geben. Dann wird ein Sittlichkeitsverbrecher aus der Haft entlassen, und sofort sind den braven Bürgern von Kingsmarkham die Zusammenhänge klar. Der Unmut gegen den ehemaligen Häftling schlägt hohe Wellen, es kommt zu Protesten und Tumulten, bei denen ein Polizist ums Leben kommt. Und dann verschwindet die dreijährige Sanchia, die Tochter eines wohlhabenden Ehepaars. Angesichts der öffentlichen Erregung fällt es Inspector Wexford und seinem Assistenten Burden immer schwerer, Ruhe zu bewahren. Denn eines ist inzwischen klar geworden: Irgendwo besteht ein Zusammenhang zwischen den Ereignissen um die drei verschwundenen Mädchen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 717
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Ruth Rendell
Das Verderben
Buch
Der beschauliche Ort Kingsmarkham wird durch eine Serie von Gewalttaten erschüttert. Zuerst verschwinden kurz nacheinander zwei junge Mädchen. Als sie nach wenigen Tagen scheinbar unbeschadet wieder zurückkehren, weigern sie sich, über ihre Erlebnisse Auskunft zu geben. Dann wird ein Sittlichkeitsverbrecher aus der Haft entlassen, und sofort sind den braven Bürgern von Kingsmarkham die Zusammenhänge klar. Der Unmut gegen den ehemaligen Häftling schlägt hohe Wellen, es kommt zu Protesten und Tumulten, bei denen ein Polizist ums Leben kommt. Und dann verschwindet die 3-jährige Sanchia, die Tochter eines wohlhabenden Ehepaars. Angesichts der öffentlichen Erregung fällt es Inspector Wexford und seinem Assistenten Burden immer schwerer, Ruhe zu bewahren. Denn eines ist inzwischen klar geworden: Irgendwo besteht ein Zusammenhang zwischen den Ereignissen um die drei verschwundenen Mädchen …
Autorin
Ruth Rendell wurde 1930 in South Woodford/London geboren. Zunächst arbeitete sie als Journalistin, bevor sie sich ganz dem Schreiben von Romanen widmete. Dreimal bereits erhielt sie den Edgar-Allan-Poe-Preis und zweimal den Golden Dagger Award. 1997 wurde sie mit dem Grand Master Awardder Crime Writer’s Association of America, dem renommiertesten Krimipreis, ausgezeichnet und darüber hinaus von Königin Elizabeth II. in den Adelsstand erhoben. Ruth Rendell, die auch unter dem Pseudonym Barbara Vine bekannt ist, lebt in London.
Die Reihenfolge der Inspector-Wexford-Romane sowie weitere Romane finden Sie hier.
Ruth Rendell
Das Verderben
Ein Inspector-Wexford-Roman
Aus dem Englischen von Cornelia C. Walter
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.Die Originalausgabe erschien 1999 unter dem Titel Harm Done bei Hutchinson, London.
E-Book-Ausgabe 2015
bei Blanvalet, einem Unternehmen der
Verlagsgruppe Random House GmbH, München
Copyright © der Originalausgabe 1999 by Kingsmarkham Enterprises Ldt.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2000 by Blanvalet Verlag GmbH, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Umschlaggestaltung: www.buerosued.de
Umschlagmotiv: plainpicture/Millennium/Haarala Hamilton
Satz: EDV-Fotosatz Huber/Verlagsservice G. Pfeifer, Germering
ISBN: 978-3-641-15143-0V003
www.blanvalet.de
Den »Kinderkreuzzug« nannte er es, als alles vorbei war, weil Kinder eine so große Rolle darin spielten. Doch eigentlich ging es überhaupt nicht um Kinder. Kein einziges trug körperlichen Schaden davon, keinem war etwas getan worden, keines hatte über das in seinem Alter normale Maß hinaus weinen müssen, nicht einmal das. Der erlittene seelische Schmerz, das emotionale Trauma und die psychische Schädigung – nun, das war etwas anderes. Wer weiß, welchen Eindruck ein bestimmter Anblick auf Kinder ausübt? Und wer kann sagen, welche Handlungen solche Eindrücke nach sich ziehen? Wenn überhaupt. Vielleicht sind sie ja, wie man früher glaubte, charakterbildend. Sie machen uns stark. Das Leben ist schließlich hart, und darüber sollte man sich am besten schon in jungen Jahren klarwerden. Jede Kindheit ist unglücklich, sagt Freud. Allerdings, überlegte Wexford, ist die eine unglücklicher als die andere.
Diese Kinder, die Kreuzzügler, waren Zeugen. Viele meinen, man sollte nie zulassen, dass Kinder Zeugen werden. Und es gibt ja auch Gesetze, die sie vor der Ausbeutung durch die Gerichtsbarkeit schützen. Aber wer will verhindern, dass sie etwas sehen, dass sie überhaupt erst Augenzeuge werden? Seine Tochter Sylvia, die Sozialarbeiterin, sagte, nach allem, was sie schon gesehen hatte, glaube sie manchmal, alle Kinder sollten ihren Eltern gleich nach der Geburt weggenommen werden. Andererseits würde sie selbst sich mit Händen und Füßen wehren, falls irgendein übereifriger Sozialarbeiter versuchen würde, ihr ihre eigenen Kinder wegzunehmen.
Die Kinder, um die es in Wexfords Fragen und Ermittlungen ging, stammten von überallher aus Kingsmarkham und den umliegenden kleinen Ortschaften, aus einem Sozialwohnungsgebiet, das die Zeitungen mit ihrem derzeitigen Lieblingsausdruck als »verrufen« bezeichneten, aus dem Millionärsviertel, das bei ihnen »im Grünen« lag, und aus der Mittelschicht dazwischen. Sie trugen die Vornamen – waren gelegentlich sogar darauf getauft worden –, die in den achtziger und neunziger Jahren beliebt waren: Kaylee und Scott, Gary und Lee, Sascha und Sanchia.
In einer bestimmten Klasse der St.-Peter-Grundschule in Kingsmarkham war es taktlos, nach dem Namen des Vaters zu fragen, weil die meisten Kinder nicht recht wussten, wer ihre Väter waren. Auch wenn diese Kindergeneration mit Kartoffelchips, Pommes frites, Schokolade und Fertigmahlzeiten aufgezogen worden war, war es trotzdem die gesündeste, die das Land je besessen hatte. Hätte eins dieser Kinder jemals eine Ohrfeige verpasst bekommen, so hätte es den Übeltäter vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gezerrt. Seelische Grausamkeit war eine andere Geschichte, keiner kannte sich so recht aus mit ihr, obwohl viele sie jeden Tag zu schreiben versuchten.
Das älteste Kind, für das Wexford sich interessierte, war schon fast keines mehr. Sie war sechzehn, alt genug zum Heiraten, aber nicht zum Wählen, alt genug, um von der Schule abzugehen, wenn sie sich dafür entschied, und auch ihr Elternhaus zu verlassen, wenn sie das wollte.
Ihr Name war Lizzie Cromwell.
1
_____
An dem Tag, an dem Lizzie von den Toten zurückkehrte, waren Polizei, Familie und Nachbarn schon dabei, nach ihrer Leiche zu suchen. Sie bearbeiteten das offene Land zwischen Kingsmarkham und Myringham, durchkämmten die Hügel und streiften durch den Wald. Obwohl bereits April, war es kalt und nass, und es blies ein schneidender Nordostwind. Ihre Aufgabe war nicht angenehm; keiner lachte oder machte Witze, und es wurde wenig gesprochen.
Unter den Suchenden befand sich auch Lizzies Stiefvater, doch ihre Mutter war zu erschüttert, das Haus zu verlassen. Am Vorabend hatten die beiden im Fernsehen einen Aufruf durchgegeben, Lizzie möge doch wieder nach Hause kommen, und an ihren etwaigen Entführer oder Angreifer appelliert, sie freizulassen. Ihre Mutter sagte, sie sei erst sechzehn, was bereits bekannt war, und habe Lernschwierigkeiten, was noch nicht bekannt war. Ihr Stiefvater war ein gutes Stück jünger als ihre Mutter, vielleicht zehn Jahre, und sah auch sehr jung aus. Er hatte langes Haar und einen Bart und trug mehrere Ohrringe, alle im selben Ohr. Nach der Fernsehausstrahlung riefen einige Leute auf dem Polizeirevier von Kingsmarkham an und gaben ihrer Vermutung Ausdruck, Colin Crowne habe seine Stieftochter ermordet. Eine Anruferin behauptete, er habe sie auf dem Baugrundstück an der York Street vergraben, etwa eine Viertelmeile vom Muriel Campden Estate entfernt, einer Siedlung des sozialen Wohnungsbaus, wo die Crownes mit Lizzie wohnten. Eine andere sagte zu Sergeant Vine, sie habe Colin Crowne zu Lizzie sagen hören, er würde sie umbringen, weil sie »dumm wie Bohnenstroh« sei.
»Leute, die zum Fernsehen gehen und über ihre vermissten Kinder reden«, meinte eine Anruferin, die sich weigerte, ihren Namen zu nennen, »sind immer die Schuldigen. Es ist immer der Vater. Wie oft hab’ ich das schon erlebt. Und wenn Sie das nicht wissen, haben Sie bei der Polizei nichts zu suchen.«
Chief Inspector Wexford hielt sie für tot. Nicht weil es die anonyme Anruferin gesagt hatte, sondern weil sämtliche Indizien darauf hindeuteten. Lizzie hatte keinen Freund, war alles andere als frühreif, hatte einen niedrigen IQ und war ziemlich langsam und schüchtern. Drei Abende zuvor war sie zusammen mit ein paar Freundinnen mit dem Bus ins Kino nach Myringham gefahren, nach dem Film hatten die beiden anderen Mädchen sie aber allein nach Hause fahren lassen. Sie hatten gefragt, ob sie noch mit in die Disco käme, doch Lizzie hatte gesagt, dann würde ihre Mutter sich Sorgen machen – ihre Freundinnen glaubten, Lizzie hätte es bei der Vorstellung selbst mit der Angst bekommen –, und so hatten sie sich an der Bushaltestelle von ihr getrennt. Es war kurz vor halb neun und wurde schon dunkel. Um Viertel nach neun hätte sie zu Hause in Kingsmarkham sein müssen, aber sie kam dort nicht an. Um Mitternacht hatte ihre Mutter dann die Polizei verständigt.
Wäre sie ein – nun ja, ein etwas anderes Mädchen gewesen, hätte Wexford der Angelegenheit nicht soviel Aufmerksamkeit geschenkt. Wenn sie eher wie ihre Freundinnen gewesen wäre. Selbst in Gedanken zögerte er etwas bei dem Ausdruck, denn er hielt sich gern an seine eigenen Standards politischer Korrektheit, in Gedanken wie in der Rede. Er wollte es nicht auf die Spitze treiben, wollte keine lächerlichen Ausdrücke wie etwa »intellektuell herausgefordert« benutzen, aber auch nicht unsensibel sein und ein Mädchen wie Lizzie Cromwell schwachsinnig oder zurückgeblieben nennen. Abgesehen davon war sie weder das eine noch das andere, sie konnte lesen und schreiben, zumindest einigermaßen, besaß ein gewisses Maß an Unabhängigkeit und war selbständig. Am hellen Tag jedenfalls. Trotzdem hätte man sie nach Einbruch der Dunkelheit nicht an einer abgelegenen Straße allein lassen dürfen. Aber bei welchem Mädchen hätte man das schon gedurft?
Wexford hielt sie also für tot. Von irgendjemandem ermordet. Colin Crowne hatte ihm auf Anhieb nicht besonders gefallen, allerdings hatte er keinen Grund, ihn des Mordes an seiner Stieftochter zu verdächtigen. Zugegeben, ein paar Jahre vor der Heirat mit Debbie Cromwell war Crowne wegen tätlichen Angriffs auf einen Mann vor einem Pub verurteilt worden, und danach noch einmal, weil er ein Auto entwendet und weggefahren – mit anderen Worten, gestohlen – hatte. Aber was besagte das schon? Nicht viel. Wahrscheinlicher war, dass jemand angehalten und Lizzie angeboten hatte, sie mitzunehmen.
»Würde sie mit Fremden mitfahren?« hatte sich Vine bei Debbie Crowne erkundigt.
»Manchmal dauert es, bis sie was kapiert«, hatte Lizzies Mutter erwidert. »Dann sagt sie ja und nein und lächelt ein bisschen – lächeln tut sie viel, sie ist ein glückliches Kind –, aber man weiß nie, ob es, na ja, angekommen ist. Stimmt’s, Col?«
»Ich hab’ ihr gesagt, sie soll nicht mit Fremden reden«, sagte Colin Crowne. »Ich hab’s ihr gesagt bis zum Geht-nicht-mehr, und was tut sie? Lächelt, nickt, lächelt noch mal, und dann sagt sie was ganz was anderes, irgendwas Bescheuertes, zum Beispiel, dass die Sonne scheint, oder sie fragt, was es zum Abendbrot gibt.«
»Sag nicht bescheuert, Col«, bat die Mutter, offensichtlich verletzt.
»Du weißt schon, was ich meine.«
Als sie drei Nächte verschwunden und der dritte Tag angebrochen war, machten sich Colin Crowne und die Nachbarn zu beiden Seiten der Crownes im Muriel Campden Estate dann auf die Suche nach Lizzie. Wexford hatte bereits mit ihren Freundinnen gesprochen und mit dem Fahrer des Busses, den sie hätte nehmen sollen, und Inspector Burden und Sergeant Vine hatten Dutzende von Autofahrern befragt, die die Straße täglich um etwa diese Uhrzeit befuhren. Als der Regen sich zu einem Wolkenbruch verstärkte, was gegen vier Uhr nachmittags geschah, blies man die Suche für diesen Tag ab, verabredete aber, sie gleich bei Tagesanbruch wieder aufzunehmen. In Begleitung von Detective Constable Lynn Fancourt fuhr Wexford in die Puck Road, um sich noch einmal mit Colin und Debbie Crowne zu unterhalten.
Als die drei Straßen und die Häuserblocks auf der Grünfläche dazwischen in den sechziger Jahren zwischen dem oberen Abschnitt der York Street und der Westseite der Glebe Road auf einem offenen Grundstück, das man heute als »grüne Wiese« bezeichnen würde, gebaut worden waren, hießen sie noch York Estate. Der damalige Vorsitzende des Wohnungsbauausschusses, der in seiner Schulabschlussprüfung den Sommernachtstraum und den Sturm bearbeitet hatte und auf sein dort gewonnenes Wissen stolz war, benannte die Straßen nach Personen aus diesen zwei Shakespeare-Stücken: Oberon, Ariel und Puck. Letztere stellte für Bewohner, Polizei und örtliche Behörde seit jeher ein Problem dar, da sie der ortsansässigen Jugend Gelegenheit bot, einen unschuldigen Namen mittels Farbsprühdose und minimaler Anstrengung in eine Obszönität zu verwandeln.
Muriel Campden hatte länger als irgendjemand sonst den Vorsitz (wie es heute geschlechtsneutral heißen muss) des Bezirksrates von Kingsmarkham innegehabt, und als sie starb, wurde York Estate nach ihr benannt. Es waren Bestrebungen im Gange, auf der Grünfläche gegenüber dem Sozialamt – einem Gebäude, das kürzlich die Bezeichnung Gemeindezentrum erhalten hatte – ein Standbild von ihr zu errichten. Die eine Hälfte der Bevölkerung war dafür, die andere vehement dagegen.
»Ich hätte gedacht, die Siedlung ist schon Denkmal genug«, meinte Wexford, während er das Dreieck aus gedrungenen Sechziger-Jahre-Häusern betrachtete, aus deren Mitte sechs Stockwerke hoch ein Wohnsilo mit Flachdach hochragte. Die Ariel, Oberon und Puck Road wirkten wie aus porösen Schlackensteinblöcken erbaut, die die Nässe vieler regenreicher Winter aufgesaugt und dadurch einen kohlschwarzen Farbton angenommen hatten. »Passt sehr gut zu Muriel Campden. Sie war ja eine dunkle, graue, düstere Person.« Er deutete auf das schon wieder verunstaltete Straßenschild am oberen Ende der Puck Road. »Sehen Sie sich das an. Man sollte doch meinen, es wird ihnen irgendwann langweilig.«
»Schlichter Spaß für schlichte Gemüter, Sir«, sagte Lynn in dem Moment, als die Tür aufging und die Bewohnerin von Nummer 47 sie zu Nummer 45 hereinließ. Die Nachbarin, eine gewisse Sue Ridley, geleitete sie zu Debbie und Colin Crowne hinüber, die einträchtig nebeneinander auf dem Sofa saßen. Beide rauchten, und beide verfolgten gerade eine Ratesendung im Fernsehen beziehungsweise starrten auf den Bildschirm.
Bei ihrem Eintreten sprang Debbie auf und kreischte: »Sie haben sie gefunden! Sie ist tot!«
»Nein, nein, Mrs. Crowne, es gibt noch nichts Neues. Es hat sich noch nichts getan. Darf ich mich setzen?«
»Machen Sie, was Sie wollen«, entgegnete Colin Crowne in seinem üblichen mürrischen Ton.
Er steckte sich eine Zigarette an und gab seiner Frau ohne zu fragen ebenfalls eine. Die Luft in dem kleinen Raum war bereits rauchgeschwängert. Der Regen schlug unaufhörlich an die Scheiben. Auf dem Bildschirm wusste ein Quizteilnehmer auf die Frage, ob Oasis eine Stadt in Saudi-Arabien, eine Popgruppe oder ein Kino im West End war, keine Antwort. Debbie Crowne bat ihre Nachbarin quengelnd, noch eine Tasse Tee zu machen, ach bitte, Sue, sei so gut.
Wexford, der mit seinem Team bereits alle relevanten Fragen gestellt hatte, war eigentlich eher gekommen, um Mrs. Crowne zu versichern, dass getan werde, was man könne, als um weitere Auskünfte von ihr einzuholen. Er erkundigte sich aber noch einmal nach den Namen auswärtiger Verwandter oder Freunde, zu denen Lizzie eventuell gegangen sein könnte. Jemand hätte jedoch ohne Zeitung, Radio und Fernsehen auf einer Insel der Äußeren Hebriden festsitzen müssen, um von Lizzies Verschwinden und der polizeilichen Suchaktion nichts mitzubekommen. Trotzdem fragte er nach. Nur um etwas zu sagen, um Debbie Crowne von ihren schrecklichen Befürchtungen abzulenken.
Es klingelte gerade in dem Moment an der Tür, als Sue Ridley den Tee in vier Henkeltassen hereinbrachte, in denen noch die Teebeutel schwammen. Die Milch war bereits im Tee, Löffel gab es keine. Sie stellte die Tassen dicht nebeneinander auf dem Tisch ab und ging an die Tür, um zu öffnen. Dabei sagte sie, es sei bestimmt ihr Lebensgefährte, der vom Suchtrupp zurückkam.
Ihr lauter Ausruf ließ Wexford zusammenschrecken. »Du böses Mädchen, du, wo hast du bloß gesteckt?«
Alle erhoben sich, die Tür ging auf, und ein Mädchen kam mit triefenden Haaren und Kleidern herein – sie sah aus, als wäre sie gerade aus der Wanne gestiegen. Debbie Crowne schrie auf und warf schreiend die Arme um ihre Tochter, ungeachtet der klatschnassen Kleider.
»Mir ist kalt, Mum«, sagte Lizzie zähneklappernd mit einem wässrigen Lächeln. »Mir ist unheimlich kalt.«
Sie war wohlbehalten wieder da, offensichtlich auch unversehrt, und alles andere zählte vorerst nicht. Wexford verabschiedete sich und wies Mike Burden und Lynn Fancourt an, mit Lizzie zu reden, nachdem sie heiß gebadet hatte. Er selbst sollte sie am nächsten Tag und den darauffolgenden Tagen noch mehrmals befragen, weil ihre Antworten alles andere als zufriedenstellend waren. Anders ausgedrückt, sie weigerte sich – oder war außerstande – zu sagen, wo sie gewesen war.
Davon erwähnte er nichts, wusste er nichts, als er – früher als gewöhnlich – um sechs Uhr sein Haus betrat, erzählte seiner Frau aber, dass Lizzie Cromwell gefunden worden war. »Das heißt, anscheinend ist sie aus eigenem Entschluss zurückgekommen. Sie bringen es bestimmt um neun in den Nachrichten.«
»Wo war sie denn?« fragte Dora.
»Keine Ahnung. Mit irgendeinem Jüngling unterwegs, nehme ich an. So ist es doch meistens. Es hat gar nichts zu bedeuten, wenn die Eltern nicht wissen, dass es einen Knaben gibt.«
»Bei uns war es wahrscheinlich genauso. Sylvia und Sheila hatten bestimmt Freunde, von denen wir gar nichts wussten, und dann noch die, von denen wir wussten. Apropos, Sylvia bringt Robin und Ben über Nacht zu uns. Neil ist irgendwo unterwegs, und sie hat ja diesen neuen Job.«
»Ah ja, den Telefonnotdienst bei The Hide. Ich wusste gar nicht, dass sie da auch nachts hinmuss. «
»Mir wäre lieber, sie müsste es nicht. Es ist doch viel zu viel für sie. Schließlich arbeitet sie tagsüber ja auch noch. Ich glaube kaum, dass sie ihr bei The Hide viel bezahlen.«
»Ich könnte mir vorstellen«, meinte Wexford, »dass sie bei The Hide überhaupt nichts zahlen.«
Er telefonierte gerade mit Burden, als seine ältere Tochter mit den Enkelsöhnen ankam. Burden hatte sich bei ihm gemeldet, wutentbrannt über Lizzie Cromwells Weigerung, den Mund aufzumachen.
»Heißt das, sie will nicht verraten, wo sie war?«
»Ich dachte schon, sie könnte gar nicht reden. Ich dachte wirklich, sie ist stumm. Na, ganz normal ist sie ja wohl auch nicht, oder?«
»Sprechen kann sie«, sagte Wexford reserviert. »Ich habe sie gehört.«
»Ach, ich auch – inzwischen schon.«
»Und sie ist so normal wie Sie auch oder jedenfalls so normal wie die meisten Leute dort. Sie ist nur eben kein Genie.« Wexford räusperte sich. »Wie Sie und Ihresgleichen«, fügte er boshaft hinzu, denn Burden war gerade Mitglied bei Mensa geworden, mit einem IQ von 152, wie man munkelte. »Wieso sagt sie nicht, wo sie gewesen ist?«
»Keine Ahnung. Aus Angst. Aus Sturheit. Will nicht, dass ihre Mum und der Ohrring-Kerl was erfahren, nehme ich an.«
»Na gut, wir probieren es morgen noch mal.«
Wexfords Tochter Sylvia war Sozialarbeiterin. Sie hatte als reiferes Semester noch Soziologie studiert, nachdem sie mit achtzehn geheiratet hatte. Die beiden Jungs, die aus der Küche gerannt kamen, als ihr Großvater gerade den Hörer auflegte, stammten aus dieser Ehe. Wexford begrüßte die beiden, bewunderte ein neues Nintendo und einen Gameboy und fragte, ob ihre Mutter noch hier sei.
»Die quatscht mit Gran«, sagte Ben abschätzig, als wollte er damit ein zutiefst unsoziales Benehmen geißeln.
Eltern haben unter ihren Kindern immer einen Liebling, wenngleich sie, wie im Fall von Wexford, stets darauf bedacht sind, diese Vorliebe zu verbergen. Er hatte die Bevorzugung seiner jüngeren Tochter nie verhehlen können, war sich dessen voll bewusst und versuchte es daher immer wieder. Sylvia gegenüber war er überschwänglicher, versäumte es nie, ihr bei jedem Treffen einen Kuss zu geben, hörte aufmerksam zu, wenn sie ihm etwas erzählte, und tat so, als machte es ihm nichts aus, wenn sie ihm auf die Nerven ging. Denn Sylvia fehlte die charmante Art ihrer Schwester, und obwohl sie recht nett aussah, hatte sie nichts von Sheilas Schönheit. Sie war eine rechthaberische, schulmeisternde und oft aggressive Feministin mit der Gabe, ins Fettnäpfchen zu treten, eine Nörglerin und eine unbegabte Ehefrau, aber Expertin in Sachen Kindererziehung. Im Übrigen hatte sie – und das wusste Wexford – das Herz auf dem rechten Fleck und ein enormes soziales Gewissen.
Er traf sie am Küchentisch sitzend an, einen Becher Tee vor sich, wie sie ihrer Mutter gerade einen Vortrag über häusliche Gewalt hielt. Dora hatte offensichtlich die klassische Frage gestellt, die Sylvias Meinung nach von Ignoranz gegenüber dem ganzen Thema zeugte: »Aber wenn ihre Männer sie schlagen, warum verlassen sie sie dann nicht?«
»Die Frage ist mal wieder typisch«, sagte Sylvia gerade, »für eine Frau, die keine Ahnung hat, was in der Welt eigentlich vorgeht. Ihn verlassen, sagst du. Wo soll sie – sprechen wir mal nur von einer – wo soll sie denn hin? Sie ist doch abhängig von ihm, sie hat ja nichts Eigenes. Sie hat Kinder – soll sie ihre Kinder mitnehmen? Klar, er verprügelt sie, er bricht ihr die Nase und schlägt ihr die Zähne aus, aber danach sagt er jedes Mal, es tut ihm leid, er wird es nie wieder tun. Sie will, dass alles normal bleibt, will die Familie nicht auseinanderreißen – ach, hallo, Dad, wie geht’s?«
Wexford küsste sie, sagte, alles in Ordnung, und erkundigte sich, wie die Arbeit am Krisentelefon denn ginge.
»Notruf heißt das bei uns. Ich habe Mutter gerade davon erzählt. Also, es bricht einem wirklich das Herz, das alles. Und mit das Schlimmste ist die Haltung der Öffentlichkeit dazu. Es ist wirklich unglaublich, aber viele Leute finden es immer noch komisch, wenn ein Mann eine Frau schlägt. Es ist ein Witz, wie auf diesen blöden Urlaubspostkarten. Die sollten mal einige von den Verletzungen sehen, die wir zu sehen kriegen, ein paar Narben. Und was die Polizisten anbelangt …«
»Moment mal, Sylvia.« Wexfords gute Vorsätze verflüchtigten sich. »Wir haben hier in Mid-Sussex ein Programm zum Thema häusliche Gewalt, das heißt, wir behandeln es absolut nicht als Bestandteil des ehelichen Alltags, wenn Frauen zu Hause tätlich angegriffen werden.« Seine Stimme wurde lauter. »Im Moment läuft gerade ein Projekt an, mit dem wir Freunde und Nachbarn ermutigen wollen, Fälle von häuslicher Gewalt zu melden. Es heißt Hurt-Watch, und falls du davon noch nichts gehört hast, ist das ein Fehler. «
»Schon gut, reg dich nicht auf. Aber du musst zugeben, dass das alles noch recht neu ist. Das gibt es erst seit kurzem.«
»Für mich hört es sich an wie die Stasi oder der KGB«, meinte Dora. »Die entfesselte Bevormundung, jeder braucht ein Kindermädchen.«
»Mutter, und wenn schon, was ist dagegen einzuwenden, wenn sich ein Kindermädchen um einen kümmert? Ich hätte mir oft gewünscht, mir eins leisten zu können. Manche von diesen Frauen sind vollkommen hilflos, um die hat sich nie jemand geschert, bis das mit den Frauenhäusern anfing. Und falls das noch nicht genug Beweis für den Bedarf ist: Es gibt überhaupt nicht genügend Frauenhäuser, es gibt nicht einmal annähernd genug, um den Bedarf zu decken …«
Wexford ging leise aus dem Zimmer, um seine Enkel zu suchen.
Die Knabenschule lag am Stadtrand von Myfleet, und am nächsten Morgen chauffierte Wexford sie dorthin, bevor er zur Arbeit fuhr. Sein Weg führte ihn durch das Flusstal der Brede, unterhalb von Savesbury Hill und am Waldrand von Framhurst Great Wood entlang. Sooft er diesen Weg fuhr, verspürte er große Dankbarkeit darüber, dass die im Vorjahr geplante Umgehungsstraße aufgrund des Regierungswechsels auf Eis gelegt worden war. Newbury war bereits fertig, aber Salisbury würde nie gebaut werden und Kingsmarkham auch nicht (wenn man in diesem Zusammenhang überhaupt von »nie« sprechen konnte). Es war ungewöhnlich, sich über Sparsamkeit zu freuen und erleichtert zu sein, wenn man sich etwas nicht leisten konnte, doch war dies ein seltenes Beispiel dafür. Die Gelbe Köcherfliege war gerettet, ebenso der Landkärtchenschmetterling. Man könnte sogar sagen, bestimmte Arten von Wildtieren hätten von der geplanten Umgehungsstraße profitiert, denn die Dachse hatten ihre alten Baue behalten und neue, eigens für sie konstruierte dazu bekommen, während der Schmetterling sich nun von zwei Nesselplantagen ernähren konnte statt nur von einer.
An der Stelle, an der die Umgehungsstraße anfangen sollte, hatte man schon mit den Arbeiten begonnen und den Erdboden mit Schaufelbaggern und Aushubmaschinen umgesetzt. Wie es schien, hatte niemand die Absicht, das Terrain in seinen ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen, und Gras und Wildpflanzen waren über die neue Landschaft aus Erdwällen und Abhängen gewachsen, so dass diese Hügel und Täler in zukünftigen Jahren ganz natürlich wirken würden. So lautete jedenfalls Wexfords Kommentar zu der seltsamen Szenerie.
»Und in ein paar hundert Jahren, Grandad«, sagte Robin, »denken die Archäologen vielleicht, diese Hügel wären die Grabstätten eines alten Stammes.«
»Wahrscheinlich«, meinte Wexford, »das leuchtet ein.«
»Tumuli«, sagte Robin, das Wort auskostend, »so werden sie sie nennen.«
»Freust du dich?« fragte Ben.
»Worüber? Dass sie die Umgehungsstraße nicht gebaut haben? Ja, doch, ich freue mich sehr. Es hat mir gar nicht gepasst, dass sie die Bäume gefällt und die Hecken rausgerissen haben. Mir haben die Straßenarbeiten nicht gefallen.«
»Mir schon«, sagte Ben. »Mir haben die Bagger gefallen. Wenn ich groß bin, fahre ich Schaufelbagger, und dann grab’ ich die ganze Welt um.«
Es war die schönste Jahreszeit, obwohl es Anfang Mai, also in einem Monat, noch üppiger und blumenreicher wäre. Doch schon jetzt im April trugen die Bäume einen grünen und hellgelben Schleier, und im Framhurst Great Wood, der im Mai mit einem Glockenblumenteppich überzogen sein würde, zeigten sich schon Schöllkraut und Eisenhut hellgolden auf dem Waldboden. Nachdem er die beiden am Schultor abgesetzt und abgewartet hatte, bis sie ins Gebäude gebracht worden waren, fuhr er davon. Unterwegs dachte er über kindliche Vorlieben nach, über die Schönheit der Natur und die Frage, wann Kinder zum ersten Mal davon berührt werden. Mädchen früher als Jungs, dachte er, Mädchen schon mit sieben, während Jungen die Landschaften, Flüsse und Hügel, den Anblick der Niederungen in der Ferne und die Wolken am hohen Himmelszelt erst weit im Teenageralter bemerken. Und doch waren die großen Naturdichter alle Männer gewesen. Natürlich hatte Sylvia vermutlich recht, und es hatte auch große Dichterinnen gegeben – dazu geboren, ohne Anerkennung zu bleiben und ihre Süße an die Wüstenluft zu verschwenden.
Nun, vorerst hatte er mit einem Mädchen zu reden, das sich aus der Schönheit von Weideland, Dachsen und Schmetterlingen vielleicht etwas machte oder auch nicht, das jedoch recht liebenswert schien und auch dann noch zaghaft lächelte, wenn ihr Stiefvater sie ausschimpfte und sie bis auf die Haut durchnässt war. Kein wilder Teenager, keine Rebellin.
Sie saß auf dem Wohnzimmersofa in der Puck Road Nummer 45 und sah sich gerade einen Trickfilm über Dinosaurier an, der für halb so alte Kinder gedacht war und JurassicParks hieß. Oder starrte darauf, ohne richtig hinzusehen, dachte Wexford. Nur um ihn oder Lynn Fancourt nicht ansehen zu müssen.
Auf ein Nicken von Wexford hin griff Lynn nach der Fernbedienung auf dem Tisch. »Das schalten wir jetzt aus, Lizzie. Jetzt ist es Zeit zum Reden.«
Während der rosafarbene Brontosaurus verblasste und der Pterodaktylus mit dem kleinen Ichthyosaurus im Maul flimmernd verschwand, stieß Lizzie einen missbilligenden Laut aus, eine Art schnaubenden Protest. Sie starrte weiter unverwandt auf den leeren Bildschirm.
»Aus der kriegen Sie nichts raus«, sagte Debbie Crowne. »Die ist so stur, da können Sie auch gleich an die Wand hinreden.«
»Wie alt bist du, Lizzie?« fragte Wexford.
»Sechzehn ist sie.« Debbie ließ ihrer Tochter keine Chance zu antworten. »Im Januar ist sie sechzehn geworden.«
»Wenn das so ist, Mrs.Crowne, wäre es vielleicht am besten, wenn wir uns mit Lizzie allein unterhalten.«
»Was, ohne dass ich dabei bin?«
»Nur bei einem Kind unter sechzehn ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass ein Elternteil oder eine verantwortliche erwachsene Person zugegen ist.«
Ohne den Kopf zu drehen, ließ sich Lizzie plötzlich vernehmen: »Ich bin kein Kind.«
»Seien Sie bitte so gut, Mrs.Crowne.«
»Okay, wie Sie wollen. Aber sie wird nichts sagen.« Debbie Crowne schlug sich die Hand vor den Mund, als sei ihr gerade etwas eingefallen. »Und wenn sie doch was sagt, dann sagen Sie’s mir, ja? Ich meine, sie hätte ja weiß Gott wo sein können, mit wer weiß wem. Man kann nie wissen, stimmt’s? Ich meine, sie könnte ja auch schwanger sein.«
Lizzie stieß den gleichen Laut aus wie vorhin, als man ihr Video ausgeschaltet hatte. Mit den Worten: »Brumm du nur hier rum. Ich finde, sie gehört untersucht«, ging Debbie Crowne aus dem Zimmer und machte die Tür etwas zu forsch hinter sich zu. Das Mädchen rührte sich nicht.
»Du warst drei Tage weg von zu Hause, Lizzie«, sagte Wexford. »So was hast du noch nie gemacht, stimmt’s?«
Schweigen. Lizzie senkte den Kopf noch weiter nach unten, so dass ihr Gesicht vom herunterhängenden Haar völlig verdeckt war. Es war hübsches Haar, rotgolden, lang und wellig. An den Händen auf ihrem Schoß waren die Fingernägel abgebissen. »Du bist nicht allein gegangen, oder? Hat dich jemand mitgenommen, Lizzie?«
Als klar war, dass sie auch diese Frage nicht beantworten würde, sagte Lynn: »Egal, was du getan hast und wohin du gegangen bist, niemand wird dich bestrafen. Hast du Angst, du kriegst Ärger? Kriegst du aber nicht.«
»Niemand wird dir was tun, Lizzie«, sagte Wexford. »Wir wollen bloß wissen, wo du hingegangen bist. Wenn du weggegangen bist, weil du mit jemandem zusammen sein wolltest, den du magst, hattest du ein Recht darauf. Daran kann dich niemand hindern. Aber, weißt du, alle haben dich gesucht, die Polizei und deine Eltern und deine Freunde haben dich alle gesucht. Also haben wir jetzt auch ein Recht. Wir haben ein Recht darauf zu wissen, wo du warst. «
Wieder kam das Brummen, ein langgezogener Laut wie unter Schmerzen. »Ich verstehe ja, dass du es mir vielleicht nicht sagen willst«, sagte Wexford. »Ich kann auch gehen. Dann könntest du mit Lynn allein sein. Du könntest mit Lynn reden. Hättest du das gern?«
Da hob sie den Blick. Ihr Gesicht, ein recht hübsches, rundliches Gesicht mit Sommersprossen auf Nase und Stirn, war ausdruckslos, ihre blassblauen Augen starrten ins Leere. Sie befeuchtete sich die schmalen, rosaroten Lippen. Sie legte die Stirn in Falten, als konzentrierte sie sich sehr, als ginge die intellektuelle Anstrengung aber über ihre Kräfte. Dann nickte sie. Kein gewöhnliches Nicken mit mehrmaligen Auf-und-Ab-Bewegungen des Kopfes, sondern nur einmal, ruckartig, fast schroff.
»Also gut.« Wexford ging aus dem Zimmer in den Flur hinaus, einen schmalen Durchgang, in dem ein Fahrrad und ein Kasten leere Flaschen standen. Er klopfte an eine Tür am anderen Ende und wurde in eine Wohnküche gebeten. Colin Crowne war nirgends zu sehen. Seine Frau saß auf einem Barhocker an der Anrichte in der Essecke, trank Kaffee und rauchte. »Möglicherweise kann Ihre Tochter mit Detective Constable Fancourt allein eher sprechen.«
»Wie Sie meinen, aber wenn sie nicht mal mit ihrer eigenen Mutter spricht …«
»Was würden Sie davon halten, wenn sich herausstellt, dass sie mit einem Freund zusammen war?«
»War sie aber nicht«, sagte Debbie Crowne und drückte ihre Zigarette in einem Unterteller aus, »also kann ich auch nichts davon halten.«
»Dann lassen Sie es mich anders formulieren. Hätte sie vielleicht Angst vor den Folgen, wenn Sie herausbekommen, dass sie mit einem Freund zusammen war?«
»Hören Sie, sie hat keinen Freund. Das wüsste ich. Ich weiß immer genau, wo sie ist – jede einzelne Minute. Muss ich auch, sie ist nicht – na, Sie wissen ja, wie sie ist. Sie ist ein bisschen – also, man muss sich um sie kümmern.«
»Trotzdem war sie am Samstagabend mit ihren Freundinnen allein unterwegs, und obwohl sie mit ihnen in Myringham war, haben sie sie allein nach Hause fahren lassen.«
»Das hätten sie nicht dürfen. Wie oft hab’ ich ihnen eingeschärft, sie sollen Lizzie nicht sich selbst überlassen. Ihnen hab’ ich’s gesagt und ihr auch.«
»Sie sind sechzehn, Mrs. Crowne, sie tun nicht immer das, was man ihnen sagt.«
Nun verlegte sie sich auf ein Thema, das ihr offenbar mehr am Herzen lag. »Aber was ist, wenn sie doch schwanger ist, wie ich gesagt habe, dann muss man sie untersuchen, dann muss man sich doch um sie kümmern. Mal angenommen, er hat ihr was getan, wir wissen doch nicht, was er ihr getan hat.«
»Wollen Sie damit andeuten, sie wurde vergewaltigt?«
»Nein, das nicht, natürlich nicht, das wüsste ich doch.«
Wenn sie also keinen Freund hat und nicht vergewaltigt wurde, wie sollte sie dann schwanger sein? Er fragte es nicht laut, sondern ging wieder ins Wohnzimmer, nicht ohne vorher anzuklopfen. Dort saß Lynn, doch das Mädchen war verschwunden.
»Ich hätte sie schlecht davon abhalten können, Sir. Sie wollte nach oben in ihr Zimmer, und daran konnte ich sie ja nicht hindern. «
»Nein. Für heute lassen wir es gut sein.« Im Wagen draußen fragte er, was bei dem Gespräch herausgekommen war, falls es überhaupt ein Gespräch gewesen war. »Hat sie etwas gesagt?«
»Einen Haufen Lügen hat sie mir aufgetischt, Sir. Ich weiß, dass es gelogen war. Es war, als ob sie – na ja, als hätte sie begriffen, dass sie irgendwas sagen muss, damit wir sie in Ruhe lassen. Ihr Pech ist, dass sie eine ziemlich beschränkte Phantasie hat, aber sie hat’s versucht.«
»Was für tolle Geschichten sind ihrer beschränkten Phantasie denn eingefallen?«
»Sie hat im Regen an der Bushaltestelle gewartet. Eine Dame – so hat sie sich ausgedrückt – eine Dame kam im Auto vorbeigefahren und bot ihr an, sie mitzunehmen, doch sie lehnte ab, weil Colin ihr gesagt hatte, sie soll sich nie von Fremden im Auto mitnehmen lassen. Weil der Bus nicht kam und es in Strömen goss, ging sie in ein unbewohntes Haus mit vernagelten Fenstern – das Haus mit dem Apfelbaum, nennt sie es – und setzte sich dort auf den Boden, um abzuwarten, bis es aufhörte zu regnen …«
»Ist doch nicht zu glauben!«
»Was hab’ ich gesagt? Ich hab’s auch nicht geglaubt.«
»Wie ist sie hineingekommen?«
»Die Tür war nicht verschlossen. Sie hat sie aufgestoßen. Und als der Regen aufgehört hatte und sie wieder zur Bushaltestelle gehen wollte, kam sie nicht mehr heraus, weil jemand vorbeigekommen war und sie eingesperrt hatte. Sie blieb drei Tage und drei Nächte ohne Essen dort drin, konnte sich aber Wasser aus der Leitung besorgen und fand ein paar Decken, in die sie sich einwickeln konnte, um sich warmzuhalten. Dann wurde die Tür wieder aufgeschlossen, sie entkam und nahm den Bus nach Hause.«
Obwohl niemand Lizzies Geschichte Glauben schenkte, lohnte es doch die Mühe, nach Myringham zu fahren und sich die Sache anzusehen.
»Das müssen Sie aber doch nicht, Sir«, sagte Lynn. Damit meinte sie, es war unter seiner Würde. »Das kann ich doch machen.«
»Entweder das oder wieder ab an den Schreibtisch«, meinte Wexford.
Vine hatte mit den Freundinnen Hayley Lawrie und Kate Burton gesprochen, die beide behaupteten, sie hätten Lizzie bis an die Bushaltestelle gebracht. Sie hatten versprochen, sie nicht allein zu lassen, und das hatten sie doch auch nicht, nur für fünf Minuten, der Bus sollte in fünf Minuten kommen. Hayley sagte, inzwischen wünsche sie sich, sie wäre bei Lizzie geblieben, bis der Bus kam, aber Kate meinte, es sei doch egal, Lizzie wäre ja nichts passiert.
Die Bushaltestelle lag gleich neben dem Kino, in dem sie gewesen waren, aber schon am Ortsrand von Myringham an der alten Straße nach Kingsmarkham. Als erstes fiel Wexford das verfallene Haus auf. Die Bushaltestelle befand sich direkt davor. Alle Fenster waren mit Brettern vernagelt, die Hälfte der Dachschieferplatten fehlte, und das Gartentörchen hing nur noch an einer einzigen Angel. Das Haus stand in einem überwucherten Garten, in dem das einzig Schöne ein pinkrosa blühender Kirschbaum war. Kein Apfel, wie Lizzie gesagt hatte, sondern eine Japanische Kirsche. Die Haustür war vor etwa zwanzig Jahren in einem aggressiven dunkelgrünen Farbton gestrichen worden, und inzwischen blätterte die Farbe ab. Wexford drehte den schwarz angelaufenen Messingknopf und drückte dagegen. Dabei überlegte er, was er von Lizzie halten sollte, falls die Tür nachgab. Doch sie war verschlossen.
Sie gingen hinten ums Haus. Hier hingen die Bretter an einem Fenster lose herunter, vielleicht hatte auch jemand den Versuch unternommen, sie zu entfernen. Wexford entschied kurzerhand: »Wir gehen hier hinein. Und danach lassen wir das Fenster wieder ordentlich zunageln. Tun wir dem Besitzer den Gefallen, wer immer es sein mag.«
Vielleicht war Lizzie auf diesem Weg hinein- oder herausgelangt oder beides. Die Öffnung war groß genug, dass kleine oder zierliche Menschen sich durchquetschen konnten, doch für Wexford musste Donaldson sie mit Hilfe von Werkzeugen aus dem Autokofferraum erweitern. Wexford trat über das Fensterbrett hinein, Lynn und Donaldson folgten. Drinnen war es kalt und feucht und roch modrig. Unter den abgelösten Bodenbrettern waren schwarze Löcher zu sehen, in denen teilweise Ölpfützen standen. Die meisten Möbel waren längst herausgeschafft worden, nur ein kleines schwarzes Rosshaarsofa war in dem Raum zurückgeblieben, in dem sie jetzt waren, und in dem eisernen Korb im Kamin lagen leere Chipstüten und Zigarettenkippen. Die Tapete hing in langen gekringelten Streifen von den Wänden.
Abgesehen von der Küche war im Erdgeschoß nur noch ein anderes Zimmer, an dessen angeschimmelten Wänden zwei Ölbilder hingen, das eine zeigte einen Hirsch, der aus einem Teich trank, das andere ein präraffaelitisch angehauchtes Mädchen, das an einem Strand Muscheln sammelte. Decken waren nirgends zu sehen. Nun blieb noch das Obergeschoß zu erforschen. Vorher wollte sich Wexford das schäbige Küchengelass genauer ansehen. Er drehte an beiden Wasserhähnen. Aus einem kam gar nichts, aus dem anderen tröpfelte blutrotes Rostwasser. Aus dem hatte Lizzie nicht getrunken. An der hinteren Tür steckte kein Schlüssel im Schloss, und sie war nicht verriegelt. Über die Türeinfassung waren Holzlatten genagelt. Durch die Haustür war Lizzie ebenfalls nicht hereingekommen, denn sie war von innen verriegelt. Die Riegel waren verrostet und hätten sich ohne Werkzeug nicht zurückschieben lassen.
»Meinen Sie, die Stufen halten, Lynn?« erkundigte sich Wexford. »Sieht aus, als hätte sich jemand mit der Spitzhacke daran zu schaffen gemacht.«
»Gerade noch, Sir.« Lynn betrachtete ihn, nicht die Treppe, etwas abschätzend, als zweifelte sie eher an seinen athletischen Fähigkeiten als an der Stabilität von Trittflächen und Setzstufen.
Offensichtlich hatte man den Versuch gemacht, die Trittflächen zu erneuern, sie zu entfernen oder die ganze Konstruktion zu erweitern, und das Vorhaben dann aufgegeben, aber erst als die Treppe schon teilweise demoliert war. Wexford ließ Lynn vorausgehen, weniger aus Höflichkeit, sondern weil er wusste, dass er so, wenn er rückwärts fiel, nicht auf eine kleine, zierliche Frau fallen würde, die vermutlich keine fünfzig Kilo wog. Er trat behutsam auf, hielt sich dabei vielleicht unvorsichtigerweise an dem wackligen Geländer fest und gelangte sicher nach oben. Seine Mühe wurde durch den Anblick einer großen, grauen Decke belohnt, die über eine Art Wassertank oder dergleichen, jedenfalls einen großen, würfelförmigen Gegenstand gebreitet lag. Ansonsten waren die beiden kleinen Dachzimmer absolut leer.
»Kann ja sein, dass sie sich in die eingewickelt hat«, sagte Lynn und streckte Wexford die Hand entgegen, die durch die Berührung mit der Decke feucht geworden war. »Obwohl sie ein bisschen muffig riecht.« Über ihnen war durch ein Loch im fleckigen Verputz der Rand einer Dachplatte zu sehen und dahinter ein Stück blauweißer Himmel.
»Vielleicht hat sie Leitungswasser im Bad getrunken«, sagte Wexford, »wenn es hier ein Bad gibt.« Er schüttelte den Kopf. »Kann schon sein, dass sie hier war, aber keine drei Tage.«
»Ist das denn so wichtig, Sir?« fragte Lynn, als sie sich die gefährliche Treppe wieder hinunterwagten. »Ich meine, sie ist doch wieder da, und es fehlt ihr nichts. Geht es uns was an, wo sie gesteckt hat?«
»Vielleicht nicht. Vielleicht haben Sie recht. Ich würde es eben einfach nur gern wissen.«
Burden gegenüber drückte er sich am nächsten Tag ähnlich aus, als der Inspector Einwände gegen Wexfords Interesse an so einer trivialen Sache erhob. Sie waren nicht auf dem Revier, sondern hatten sich nach der Arbeit auf ein feierabendliches Bier im Olive and Dove getroffen.
»Mir scheint, ich habe heute überhaupt nicht gearbeitet«, meinte Wexford, »bloß verdammte Formulare ausgefüllt.«
»Vielleicht sind wir ja drauf und dran, das Verbrechen zu besiegen.«
»Sie machen Witze. Ich nehme nicht an, dass an Lizzie Cromwell eine Straftat verübt wurde oder dass sie selbst eine verübte, aber ich würde es doch gern wissen. Drei Tage war sie weg, Mike, drei Tage und drei Nächte. In dem Haus war sie nicht – nun gut, eindeutig feststellen können wir das nur, indem wir ihre Fingerabdrücke abnehmen und das Haus mit der Lupe untersuchen, aber ich weiß, dass sie nicht dort war. Sie wäre gar nicht reingekommen, und wenn, wäre es ihr nicht gelungen, es zu verlassen und das Fenster wieder in den Zustand zu versetzen, in dem wir es vorfanden. Sie log, als sie sagte, sie hätte aus dem Wasserhahn getrunken, sie log, als sie sagte, dass sie sich in die Decke gewickelt hätte, und sie log, als sie sagte, sie sei eingesperrt und dann wieder herausgelassen worden. Sie war also überhaupt nicht dort. Ich frage mich, ob es einen Sinn hat, einen Aufruf an diese Frau zu richten, die ihr angeboten hat, sie mitzunehmen.«
»Das war vielleicht auch gelogen.«
»Stimmt. Vielleicht.« Wexford kippte den letzten Rest seines Bieres hinunter. »Wo war sie dann?«
»Bei einem Mann. Diese Dinger sind immer bei einem Mann, das wissen Sie doch. Die Tatsache, dass ihre Mutter behauptet, es gäbe keinen Freund, heißt überhaupt nichts, und wenn sie sagt, sie hätte gar keine Gelegenheit gehabt, jemanden kennenzulernen, heißt das auch nichts. Es ist völlig egal, wie ein Mädchen aussieht oder wie schlicht von Gemüt sie ist – schon gut, schauen Sie nicht so, Sie wissen, was ich meine – oder wie schüchtern und so weiter, der Fortpflanzungstrieb in diesen jungen Dingern ist dermaßen stark, dass die unwahrscheinlichsten Kandidaten zusammentreffen wie – wie Magnete.«
»Ich hoffe, in dem Fall gibt es keine Fortpflanzung, obwohl ich zugebe, dass es am wahrscheinlichsten ist, dass sie mit einem Mann zusammen war, mit einem Jungen. Damit wissen wir aber immer noch nicht, wo.«
»Bei ihm natürlich.«
»Aha, aber da liegt doch das Problem. Wenn er in ihrem Alter ist, wohnt er aller Wahrscheinlichkeit nach noch bei seinen Eltern oder einem Elternteil und vielleicht Geschwistern. Wenn er älter ist, ist er vermutlich verheiratet oder lebt, wie man sich heute ausdrückt, ›in einer Beziehung‹. Die anderen Beteiligten wüssten von ihrem Verschwinden. Jemand hätte uns verständigt.«
»Er hätte sie auch mit in ein Hotel nehmen können. «
»Drei Tage und drei Nächte, Mike? Hat er es so üppig? Nein, ich sehe nur eine Möglichkeit: Er lebt allein, hat ein Zimmer oder eine Wohnung, und dorthin hat er sie mitgenommen. Er behielt sie die ganzen drei Tage und drei Nächte bei sich, und niemand im Haus oder in der Wohnanlage hat sie zu Gesicht bekommen. Die Sache gefällt mir nicht so recht, ich glaube eigentlich auch nicht dran, aber wir wissen ja, was Sherlock Holmes sagte.«
Burden hatte es schon zu oft von Wexford gehört, um nicht Bescheid zu wissen. »Wenn alles andere unmöglich ist, muss das, was übrigbleibt, so sein – oder so ähnlich.« Er holte noch eine Runde Getränke. Er würde es nicht sagen, jedenfalls jetzt noch nicht, aber er hatte von Lizzie Cromwell die Nase voll, die ganze Geschichte langweilte ihn. Wexford war seiner Meinung nach drauf und dran, sich schon wieder in etwas zu verrennen, bloß dass es früher, wenn er so einen Fimmel gehabt hatte, um bedeutsamere Ereignisse gegangen war. Falls Burden jedoch hoffte, als er mit den beiden Biergläsern zum Tisch zurückkehrte, Wexford würde sich einem neuen Gesprächsthema zuwenden, wurde er enttäuscht.
»Als ihre Freundinnen sie an der Bushaltestelle stehenließen, wartete sie demnach darauf, dass dieser Kerl im Auto vorbeikam, stimmt’s? Aber wieso an einer Haltestelle? Wieso nicht an einem warmen und trockenen Ort wie einem Café?«
»Weil sie vor ihren Freundinnen so tun musste, als würde sie auf den Bus warten«, sagte Burden abschließend und hoffte, damit habe es sein Bewenden.
»Sie haben genug von der Sache, stimmt’s? Ich weiß es, das merke ich. Nun, ich will Ihnen nicht mehr lang auf die Nerven gehen. Ich glaube, Sie haben recht mit Ihrer Erklärung, weshalb sie an der Bushaltestelle gewartet hat, aber ich will doch noch ein bisschen nachbohren. Wieso wollte sie, dass ihre Freundinnen glauben, sie wartet auf den Bus?«
»Damit sie das mit dem Freund nicht rauskriegen. «
»Aber warum sollen sie es nicht erfahren? Wäre sie denn nicht stolz auf einen Freund? Besonders auf einen mit Auto und eigener Wohnung? Sie hätte sich doch auf sie verlassen können. Ihrer Mutter hätten sie es bestimmt nicht verraten.«
»Vielleicht ist er verheiratet.«
»Dann könnte er sie nirgendwohin mitnehmen«, sagte Wexford, und obwohl Burden auf die nächste Phase seiner Ausführungen wartete, ließ er sich nicht weiter darüber aus. »Das Hurt-Watch-Treffen ist morgen früh«, sagte er stattdessen. »Sie wissen doch? Um Punkt zehn. Southby wird auch da sein, falls ich Ihnen das noch nicht gesagt habe.«
Beim Gedanken auf die bevorstehende Begegnung mit dem zukünftigen stellvertretenden Chief Constable stöhnte Burden leise auf. Operation Safeguard, wie das Projekt ursprünglich geheißen hatte, interessierte ihn herzlich wenig. Seine persönliche Meinung war, was immer innerhalb der eigenen vier Wände vor sich ging, gehörte auch dorthin und sollte so wenig wie möglich in den Zuständigkeitsbereich des Gesetzes fallen. Doch da er wusste, wie Wexford dazu stand, hielt er den Mund.
Am nächsten Morgen, eine halbe Stunde vor dem geplanten Beginn der Versammlung, kam eine Frau auf dem Weg zur Arbeit ins Revier, um zu melden, sie habe Lizzie Cromwell am vergangenen Montag Abend an der Bushaltestelle gesehen. Es war reiner Zufall, dass sie überhaupt mit Wexford sprechen konnte. Er kam in dem Moment mit Barry Vine am Empfang in der Eingangshalle vorbei, als sie mit dem diensthabenden Sergeant sprach. Trotzdem sagte Barry sein übliches Sprüchlein, er würde sich schon darum kümmern, es sei doch nicht nötig, dass Wexford …
Dass ich mir mein hübsches Köpfchen darüber zerbreche, dachte Wexford, sagte es aber nicht laut. »Gehen wir hinauf in mein Büro«, sagte er.
2
_____
Inzwischen war Freitag, und Lizzie war am Dienstagnachmittag zurückgekommen. Diese Tatsache teilte Wexford Mrs. Pauline Ward mit, überrascht, dass sie es noch nicht wusste. »Darf ich fragen, warum Sie nicht schon früher gekommen sind?«
»Ich habe ihr Foto erst gestern Abend gesehen. Es war in der Zeitung, in die die Krabbe eingewickelt war.«
»Wie bitte?«
»Hören Sie, ich habe keine Zeitung abonniert. Ich meine, keine Tageszeitung. Ich sehe mir auch keine Fernsehnachrichten an. Ich sehe fern, aber nicht die Nachrichten. Das regt mich nur auf. Wenn es nicht um Grausamkeiten in Albanien geht oder Kinder, die in einem Feuer zugrunde gehen, dann sind es erschlagene Seehundbabys. Das tu’ ich mir gar nicht mehr an.«
»Die Krabbe, bitte, Mrs. Ward.«
Sie war Mitte Fünfzig, chic gekleidet, der Rock zwar etwas zu kurz und die Augenlider zu blau, aber ansonsten eine ansehnliche, gepflegte Frau, die in einem dunkelblauen, spiegelblank polierten Audi vorgefahren war, den sie auf dem für den zukünftigen stellvertretenden Chief Constable reservierten Parkplatz abgestellt hatte. Wenn sie – wie in diesem Moment – lächelte, waren ihre schönen, strahlendweißen Zähne zu sehen.
»Ach ja, die Krabbe«, sagte sie. »Also, gestern Abend nach der Arbeit fuhr ich auf dem Nachhauseweg bei dem guten Fischgeschäft in der York Street vorbei. Ich hatte zum Abendessen Besuch eingeladen und brauchte noch eine Vorspeise, also dachte ich mir, eine Krabbe wäre doch was Feines, und der Fischhändler packte sie mir in diese Zeitung ein. Es war, glaube ich, die Times. Na jedenfalls, als ich meine Krabbe auspackte und das Foto sah, fiel mir wieder ein, dass ich sie am Montag Abend gesehen hatte.«
»Aha. Und als Ihre Freundin kam, sprachen Sie mit ihr darüber?«
»Mit ihm«, sagte Mrs. Ward. »Ein Er, es ist mein Freund.« Sie hörte sich an wie eine Frau, die sich kaum die Mühe machen würde, für einen weiblichen Gast eine Krabbe zu besorgen. »Äh, nein, habe ich nicht. Hätte ich das sollen?«
»Er hätte Ihnen vielleicht gesagt, dass man Lizzie Cromwell gefunden hat. Das heißt, falls es ihn nicht auch davor graust, sich die Nachrichten anzusehen.«
Pauline Ward warf ihm einen argwöhnischen Blick zu. »Keine Ahnung. Über solche Sachen reden wir nicht.« Fast hätte sie unwillig den Kopf zurückgeworfen. »wollen Sie das mit Montag Abend denn nicht hören?«
Wexford nickte.
»Also gut. Ich leite im Heaven-Spent-Einkaufszentrum in Myringham den Crescent Minimarket. Samstags haben wir bis halb neun geöffnet. Als ich ging, war es zwanzig vor neun. Ich musste noch abschließen und zu meinem Wagen gehen, und so war es schließlich schon zehn vor, als ich an der Bushaltestelle vorbeifuhr.«
Wexford unterbrach sie. »wie kommt es, dass Sie sich bei der Uhrzeit so sicher sind?«
»Bin ich immer, auf die Minute genau. Ich schaue ständig auf die Uhr. Na ja, auf die Armbanduhr. Ich sah, wie spät es war, als ich aus dem Geschäft ging, und warf einen Blick auf die Digitaluhr an der Midland Bank, als ich gerade losfuhr, und die zeigte acht Uhr vierundfünfzig an. Ich dachte, das kann doch nicht sein, so spät ist es doch noch nicht, und verglich es mit meiner Armbanduhr und der Uhr im Auto – ich wusste, dass beide auf die Sekunde genau gehen –, und auf beiden war es acht Uhr neunundvierzig. Na, dachte ich, ich gehe in die Midland und sage es ihnen – was ich am Dienstag auch tat. Und bis ich es zu Ende gedacht hatte, das mit der Bank, meine ich, kam ich bereits an der Bushaltestelle vorbei, an der das Mädchen stand, und dachte, armes Ding, steht da im Regen und wartet auf den Bus. Soll ich fragen, ob sie mitfahren will, dachte ich, aber dann dachte ich, lieber nicht, man kann ja nie wissen, stimmt’s?«
Das war also nicht die Frau, die Lizzie angeboten hatte, sie mitzunehmen, und deren Angebot abgelehnt worden war. Aber zehn vor neun … Hatte das Mädchen tatsächlich zwanzig Minuten an der Bushaltestelle gewartet?
»Sind Sie sich ganz sicher, dass es zehn vor neun war?«
»Habe ich doch gesagt, oder? Ich merke mir immer die Uhrzeit. Wieso wollen Sie das alles eigentlich wissen, wo sie doch zurückgekommen ist?«
»Das kann ich Ihnen nicht sagen, Mrs. Ward.«
Sie stand auf. »Wollen Sie sich nicht bei mir bedanken? Ich hätte ja nicht herkommen müssen. Wäre ich auch nicht, wenn ich nicht zufällig diese Krabbe gekauft hätte.«
Er brachte sie hinunter, und am Ausgang drehte sie sich noch einmal um und sagte: »Sie haben da ein Problem mit Ihrer Einstellung, wissen Sie. Darum sollten Sie sich mal kümmern.«
Wexford verkniff sich das Lachen, bis sie weg war. Er hatte durchaus ein Problem, aber nicht mit seiner Einstellung. Vielmehr ließ er sich in geradezu lächerlicher Weise auf diese Geschichte mit Lizzie Cromwell ein. Sie war wieder da, wie ihm von allen Seiten immer wieder versichert wurde, sie war mit einem Freund unterwegs gewesen, aber nun war sie wieder da, und nichts Schlimmes war passiert. Hatte der Freund sie zwanzig Minuten an der Bushaltestelle warten lassen? Im Regen? Vielleicht. Schon möglich. Da fiel ihm plötzlich ein – und die Vorstellung war alles andere als willkommen –, dass Lizzie, niedlich, auf kindliche Weise hübsch, nicht besonders hell im Kopf und vermutlich höchst naiv, genau die Art von Person war, die ein gewissenloser Mensch ausnutzen würde.
Ging sie auf eine Art Sonderschule? Und wenn nicht, warum nicht? Und wäre diese Schule überhaupt der richtige Ort, um bei ihr Selbstvertrauen und Lebenstüchtigkeit herauszubilden? Wexford bezweifelte es. Doch er beschloss, sich von Lizzie, ihren Problemen und ihrer Familie abzuwenden. Es war nicht Sache der Polizei. Polizeiressourcen und das Geld des Steuerzahlers waren darauf verschwendet worden, aber das war nichts Neues. Man musste schon froh sein, dass kein Verbrechen stattgefunden hatte, dass es keine Toten und nicht einmal Verletzte gab, und nachdem es so gut ausgegangen war, würden manche sogar behaupten, Zeit und Ausgaben hätten sich gelohnt. Also, adieu, Lizzie Cromwell, wollen wir hoffen, dass du nicht schwanger bist.
Die Hurt-Watch-Versammlung ging ohne besondere Vorkommnisse, ja sogar zufriedenstellend vonstatten. Zur Abwechslung waren sich Wexford und Malcolm Southby einmal einig. Beide wollten häusliche Gewalt als ernstzunehmendes Verbrechen priorisieren (Southbys Ausdruck, mit dem Wexford nicht einverstanden war), und beide fanden die Idee gut, Frauen als deren Opfer mit Mobiltelefonen und Funkempfängern auszustatten. Allein ihnen das Bewusstsein zu vermitteln, dass die Polizei hinter ihnen stand, war schon ein Schritt in die richtige Richtung.
»Und was ist mit den Opfern, die uns noch nie angerufen haben?« fragte Karen Malahyde. »In diesem Bereich gibt es eine Menge Heimlichtuerei, wissen Sie. EinGroßteil dieser Frauen würde fast alles tun, um nicht zugeben zu müssen, dass sie Opfer sind.«
»Ich weiß nicht, was wir dagegen tun können, Sergeant Malahyde«, gab Southby zurück, der mit dem Geld der Steuerzahler recht knauserig umging, »außer jedem weiblichen Wesen im Einzugsgebiet von Kingsmarkham teure elektronische Geräte zur Verfügung zu stellen«. Sogar wenn er eine Sache unterstützte, konnte sich der zukünftige stellvertretende Chief Constable den Sarkasmus kaum verkneifen. Er führte es weiter aus. »Oh, Verzeihung, natürlich nur denen, die in einer festen Beziehung leben.« Er gackerte über seinen eigenen Witz.
Karen fand es nicht lustig, verzog das Gesicht aber kaum und blickte nur finster drein; dabei bemerkte sie missbilligend, dass einige ihrer Kollegen liebedienerisch lächelten. »Das ist ja alles schön und gut, Sir.« Sie traute sich nicht recht zu sagen, das sei ja alles recht witzig, da sie wusste, dass ihr »Sir« nicht alles rechtfertigte. »Aber müssen wir nicht noch mehr tun, um herauszufinden, wo die Opfer sind? Ich meine, diejenigen, die um jeden Preis verheimlichen wollen, was mit ihnen passiert?«
»Dazu haben wir doch Hurt-Watch, Karen«, sagte Wexford und erntete einen komischen Blick von Southby, weil er ihren Vornamen benutzt hatte. »Wir machen per Anzeige im Courier darauf aufmerksam und verteilen Handzettel an alle Haushalte. Ein Vertreter der Polizei – einer von uns hier – geht in Newsroom South-East auf Sendung und spricht darüber. Ich sehe im Augenblick nicht, was wir sonst noch tun können.«
»Okay. Danke, Sir. Es ist nur – die ganze Geschichte nimmt momentan immer mehr zu – trotzdem, danke.«
Wexford hatte sich während des einstündigen Treffens auf das Thema konzentriert, und es war ihm auch nicht schwergefallen, über Southbys witzige Bemerkung nicht zu lächeln. Sobald es vorbei war, schlich sich der Gedanke wieder ein: Apropos Heimlichtuerei, was hatte es eigentlich mit diesem Freund auf sich, der vor Lizzies Freundinnen sowie vor ihren Eltern versteckt werden musste, und wieso wollte sie sich jetzt nicht zu ihm bekennen?
The Hide war vermutlich nicht das langweiligste und uninteressanteste Gebäude in ganz Kingsmarkham. Das Muriel-Campden-Wohnsilo war noch hässlicher, und einige Büroblocks waren trister, doch unter den größeren Häusern auf eigenem Grundstück war The Hide in der Kategorie langweiliger Häuser, die keinen zweiten Blick verdienten, ohne Konkurrenz. Dass die wenigsten dem Haus einen zweiten Blick geschenkt oder es überhaupt bemerkt hätten, war ein wesentlicher Gesichtspunkt gewesen, als Griselda Cooper und Lucy Angeletti beschlossen hatten, es als Zentrum und zeitweiliges Zuhause für die Opfer häuslicher Gewalt zu erwerben.
Es war wichtig, dass das Haus unscheinbar wirkte, aber so, als hätte es nichts zu verbergen, langweilig, ohne unheimlich auszusehen, und von einer Düsterkeit, die keine Kommentare herausforderte. Früher hatte es die Hausnummer 12 im Kingsbrook Valley Drive getragen, doch das Schild war entfernt, ein Schild mit dem Namen »The Hide« nicht angebracht worden. Die Nummer war nicht im Telefonbuch eingetragen, nur die Notrufnummer war bekannt. In jeder Telefonzelle in Kingsmarkham, Stowerton, Pomfret und auf den Dörfern hing ein Kärtchen mit der Notrufnummer von The Hide. Allerdings stand auf der Karte nicht, wo sich das Haus befand oder wozu es diente, noch wer dort Zuflucht suchte und auch fand.
Als sie mit der Arbeit beim Notruf anfing, hatte Sylvia Fairfax fast als erstes die Frage gestellt: »Wozu die Heimlichtuerei?«
»In neun von zehn Fällen«, sagte Griselda Cooper, »kommen Ehemänner und Partner oder Freunde, eben die, die für den Missbrauch verantwortlich sind, und suchen sie. Auf die Art wird es ihnen schwerer gemacht, sie zu finden. Nicht unmöglich, aber schwerer.«
»Aber sie finden her?«
»Manche schon. Wir hatten einen da, der ist über die Mauer gekommen. Die ist zwar drei Meter hoch und hat obendrauf Stacheldraht, aber er hat es geschafft. Danach haben wir den Stacheldraht durch Natodraht ersetzt.«
Es gab einen riesengroßen Garten. Gitterwerk erhöhte die Mauern zwischen The Hide und den Hausnummern 10 und 14 im Kingsbrook Valley Drive. Abgesehen davon, dass der Rasen gemäht und die Büsche gelegentlich gestutzt wurden, war der Garten ungepflegt. Für die Kinder gab es eine Schaukel und ein Klettergerüst, und Lucy Angeletti, die die finanziellen Mittel für The Hide auftrieb, wollte genügend Geld zusammenbringen, damit ein richtiger Spielplatz angelegt werden konnte.
Die Nachbarn in Nummer 10 und 14 und auch in Nummer 8 und 16 hatten von dieser Absicht Wind bekommen und bemühten sich nun nach Kräften, der Sache einen Riegel vorzuschieben. The Hide und dessen Bewohnerinnen waren im Kingsbrook Valley Drive nicht gerade beliebt. Die Leute fanden, es stelle eine Gefahr für den Frieden in der Gegend dar und locke das Verbrechen an. Das Haus selbst, ein großer, quadratischer Kasten ohne Seitenflügel, Giebel oder Veranda war 1886 von einem Mann mit vielköpfiger Familie gebaut worden, der Kosten hatte sparen wollen. Nicht einmal das Dach war von der Straße her auszumachen, obwohl es nicht ganz flach war – es lag hinter einer kahlen Backsteinmauer versteckt, die über den Fenstern im dritten Stock um das Haus verlief. Als Baumaterial waren Ziegel in einem stumpfen Rotbraun verwendet worden, und die einzige Zierde war die gelbbraune Verblendung, mit der die flachen Schiebefenster abgesetzt waren. Das Ganze wurde halb verdeckt von den im Vorgarten dominierenden Lorbeerbüschen sowie von zwei Stechpalmen, Friedhofsbäumen, deren Blätter nie abfielen, sondern mit der Zeit nur dunkler und staubiger wurden.
Drinnen sah es ganz anders aus: Pastellfarben, hübsche Vorhänge und Bilder an den Wänden. Eigentlich waren es eher Plakate als Bilder. Lucy hatte die glorreiche Idee gehabt, mehrere Bögen Geschenkpapier zu kaufen, auf denen Blumenbilder, Weltkarten oder Die Dame mit dem Einhorn abgebildet waren, und sie rahmen zu lassen. Das Mobiliar stammte aus Trödelläden oder war von Sponsoren beigesteuert worden, und der Fußbodenbelag kam aus dem Teppichlager an der Stowerton Road, wo die Ware wegen Feuerschadens billig zu haben war. Ständig mangelte es an Geld. Lucy hatte schon graue Haare vor lauter Sorgen, ob sie genügend finanzielle Mittel zusammenbekäme, damit The Hide weiterexistieren konnte – obwohl ihr Haar sich vielleicht sowieso verfärbt hätte, da vorzeitiges Ergrauen bei ihr in der Familie lag.
Am Geldmangel lag es, dass Sylvia und Jill Lewis und Davina Crewe nicht dafür bezahlt wurden, dass sie am Telefon mit den Frauen sprachen, die um Hilfe und manchmal auch um Zuflucht baten. Im Idealfall hätte die Notrufnummer von einem anderen Ort aus betrieben werden sollen. Doch einen anderen Ort gab es nicht. Griselda Cooper wohnte im Haus und Lucy Angeletti in einer Einzimmerwohnung in Stowerton. Außer den zwei Zimmerchen im Keller von Kingsbrook Valley Drive Nummer 12 besaß The Hide keine Büroräume. Die beiden Telefone, die von Jill und Davina, manchmal von Griselda und Lucy und nun auch von Sylvia betreut wurden, befanden sich in einem Raum im Obergeschoß neben Griseldas winziger Wohnung. Platz war so kostbar, dass die beiden anderen Räume auf diesem Stockwerk in möblierte Zimmer für geflohene Frauen umgewandelt worden waren, mit zwei Einzelbetten in einem und drei Betten und einem Klappbett im anderen. Ideal war es nicht, aber etwas Besseres konnten sie nicht bieten.
Einen Aufzug gab es nicht. Sylvia musste sich die drei Treppen vom Erdgeschoß hochquälen, wo sich die Wohnzimmer befanden, Gemeinschaftsraum und Fernsehzimmer, Kinderspielzimmer, Küche und Waschküche, durch den ersten und zweiten Stock, die ganz mit möblierten Zimmern und Bädern besetzt waren – der Einbau von zusätzlichen Badezimmern stand dringend an, sobald Lucy die Mittel bekam – und nach oben zu den Telefonen. Normalerweise spielten Kinder auf der Treppe. Das durften sie eigentlich nicht, auch nicht die Geländer herunterrutschen, doch wenn das Spielzimmer überfüllt war und es regnete, blieb ihnen kaum etwas anderes übrig.
An zwei Abenden pro Woche, und zwar nicht immer denselben Abenden, arbeitete Sylvia von sechs Uhr bis Mitternacht in The Hide. Normalerweise war ihr Mann dann zu Hause, um sich um die beiden Söhne zu kümmern, und falls er einmal verhindert war, konnte sie sie zu ihren Eltern bringen. Sie hatte die Aufgabe teils aus sozialem Gewissensdruck und dem Engagement für die Sache der Frau übernommen, teils um ein wenig aus dem Haus zu kommen. Wenn sie zu Hause war, schwiegen Neil und sie sich gegenseitig an, wandten sich nur indirekt über ihre Kinder aneinander oder stritten. Ihrer Mutter und ihrem Vater erzählte sie nie, wie es um ihre Ehe stand, sprach darüber jedoch mit Freundinnen, und Griselda Cooper wurde für sie rasch zu einer Freundin.