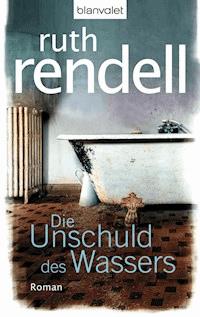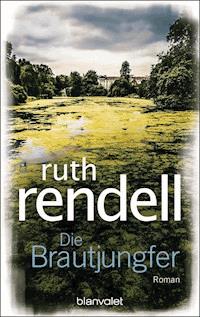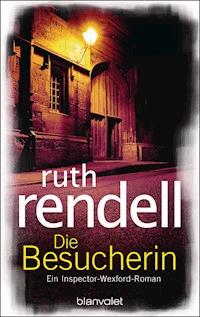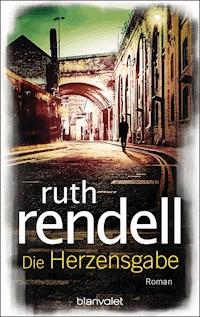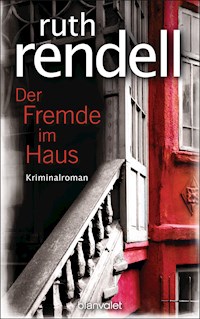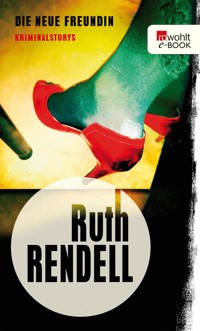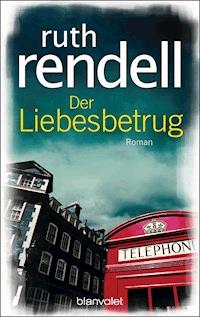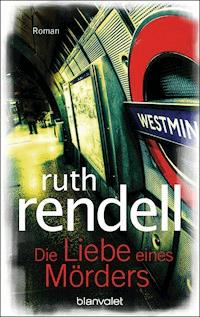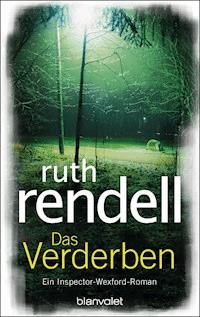4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Chief Inspector Wexford wird von seinem Neffen zu einer Chinareise eingeladen. Zuerst genießt er das Abenteuer. Doch dann ist er beunruhigt: Ständig taucht vor ihm eine alte Chinesin mit gebundenen Füßen auf, ebenso schnell verschwindet sie wieder. Warum verfolgt ihn diese alte Frau durch halb China? Als Wexford und die anderen Mitglieder der kleinen Reisegruppe auf dem Li-schuei entlangschippern, geht ein Mann über Bord. Wong kann nicht schwimmen. Er stirbt. Wexford ist geschockt. Er hatte Wong schon vor der Schiffsfahrt gesehen. Verfolgte der ihn auch?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 339
Ähnliche
Ruth Rendell
Durch das Tor zum Himmlischen Frieden
Roman
Aus dem Englischen von Edith Walter
Rowohlt E-Book
Inhaltsübersicht
Teil I
1
Der vollständig erhaltene Leichnam der Frau, die man die Marquise von Tai nennt, lag etwa einen Meter tiefer auf der unteren Plattform in einem Glaskasten. Sie war, als sie vor etwas mehr als zweitausend Jahren starb, ungefähr fünfzig Jahre alt gewesen. Ein weißes Hemd bedeckte ihren dünnen fünfundsiebzig Pfund schweren Körper vom Hals bis zu den Oberschenkeln. Ihre Beine waren von einem fischähnlichen rötlichen Weiß und von Streifen entstellt, ihr rechter Arm durch einen schlecht verheilten Bruch ziemlich stark verkürzt. Ihr Gesicht war weiß, aufgedunsen, das Nasenbein eingedrückt, und aus dem offenen Mund quoll die Zunge heraus. Das ganze Gesicht war so qualvoll verzerrt, als sei sie erwürgt worden.
Das war jedoch nicht der Fall. Im broschierten Museumsführer stand, und Mr. Sung hatte es bestätigt, dass die Marquise an Tuberkulose und an einer Erkrankung der Gallenblase gelitten hatte. Kurz bevor sie an einem Herzanfall gestorben war, hatte sie hundertzwanzig Kerne der Wassermelone gegessen.
«Sie hatte Myokaldinfalkt, wissen Sie», sagte Mr. Sung, die Museumsbroschüre aus dem Gedächtnis zitierend, wie es seine Gewohnheit war. «Sie wal sehl klank, wissen Sie, schlechtes Helz, innen ganz schlimm. Wil wollen gehen.»
Sie schlenderten weiter, um durch eine zweite Öffnung die Innenorgane und die dura mater der Marquise zu betrachten, die in Flaschen mit Formaldehyd schwammen. Fragend blickte Mr. Sung seinem Begleiter ins Gesicht und hoffte vielleicht, dort Anzeichen von Übelkeit oder Bestürzung zu entdecken. Doch die Miene des anderen blieb genauso unergründlich wie die seine. Mr. Sung seufzte leicht auf.
«Wil wollen gehen.»
«Ich wünschte, Sie würden das nicht ununterbrochen sagen», meinte Wexford gereizt. «Darf ich Sie korrigieren? Es wäre nämlich viel besser, wenn Sie sagten: ‹Gehen wir› oder ‹Wir müssen weiter›.»
«Sie dülfen kolligielen», erwiderte Mr. Sung ernst. «Vielen Dank. Ich will gut splechen lelnen. Gehen wil? Wil müssen weitel.»
«Gut, dann gehen wir.»
«Antwolten Sie nicht, bitte. Ich übe nul. Gehen wil. Wil müssen weitel. Gut, ich habe velstanden. Kommen Sie, wil wollen gehen. Sind Sie beleit, zul Ausglabungsstätte zu fahlen? Jetzt dülfen Sie antwolten, bitte.»
Sie stiegen wieder in das Taxi. Zwischen Museum und Auto, die beide Klimaanlagen hatten, war die Luft so heiß wie ein Ofen, auf dem langsam eine Kasserolle schmurgelte. Der Fahrer brachte Wexford und Mr. Sung quer durch die Stadt zu den Ausgrabungen, wo Archäologen die Leichname der Marquise, ihres Gatten und ihres Sohnes entdeckt hatten. Außerdem Tonnachbildungen von Bediensteten, Lebensmittel und Artefakte, die die Reisenden auf ihrer Reise über das Grab hinaus begleiten sollten. Die anderen Leichen waren skelettiert, ihre Kleidung zu Staub zerfallen. Nur die Marquise, hässlich, grotesk, aus leeren Augenhöhlen starrend, hatte sich in ihrem gemalten Gewand, den zwanzig Schichten reiner Seide, in die sie gehüllt war, die wächsernen Züge des Lebens bewahrt.
Wexford und Mr. Sung blickten durch den Holzrost in den großen, tiefen rechteckigen Schacht des Grabes, und Mr. Sung zitierte beinahe wortwörtlich einen langen Abschnitt aus Fodor’s Führer durch die Volksrepublik China. Er hatte ein ausgezeichnetes Gedächtnis und schien zu glauben, Wexford könne, da er die chinesischen Schriftzeichen nicht entziffern konnte, auch seine eigene Sprache nicht lesen. Es war sogar Wexfords Exemplar des Fodor, das Sung sich am Abend ganz einfach ausgeliehen hatte, aus dem er zitierte. Wexford hörte nicht zu. Er hätte viel darum gegeben, den schlitzäugigen Mr. Sung mit dem rosigen Babygesicht loswerden zu können. In jedem anderen Land hätte eine Bestechungssumme in Höhe eines Monatsgehalts ihn ohne weiteres von seinem Führer und Dolmetscher für immer befreit – und hier hätte ein Monatsgehalt sich durchaus im Rahmen von Wexfords finanziellen Möglichkeiten gehalten. Aber in China durfte nicht einmal Trinkgeld gegeben werden. Mr. Sung ließ sich nicht korrumpieren. Obwohl noch sehr jung, war er schon Parteimitglied. Seine Augen glänzten fanatisch, wenn er von den großen Staatsmännern sprach. Natürlich zählte auch Mao Tse-tung dazu, der aus Mr. Sungs Heimat, der Provinz Hunan, stammte. Manchmal fragte sich Wexford, ob er eines Tages – in zwanzig Jahren vielleicht, wenn er dann noch lebte – die Times aufschlagen und lesen würde, der neue Vorsitzende der Kommunistischen Partei Chinas sei ein gewisser Sung Lao Zhong, 47, aus Tschangscha. Das war durchaus möglich. Mr. Sung beendete seinen auswendig gelernten Vortrag, seufzte unter den Lasten seiner Pflicht, weigerte sich jedoch, sich ihr zu entziehen.
«Lichtig», sagte er. «Gehen wil? Wil besuchen jetzt Polzellanfablik und vol dem Abendessen Lehlelbildungsanstalt.»
«Nein, das tun wir nicht», widersprach Wexford. Ein Moskito biss ihn eben dicht über dem Sprungbein. Die Hitze war unerträglich. Wie die nur in seiner Phantasie existierende Kasserolle begann auch er allmählich zu schmurgeln. Zäher, dickflüssiger Schweiß lief ihm klebrig über den ganzen Körper. Das lag ebenso an der hohen Luftfeuchtigkeit wie an der Temperatur von siebenunddreißig Grad. «Nein, das tun wir nicht. Wir fahren ins Hotel, duschen und halten Siesta.»
«Wil haben dann abel keine Zeit mehl fül Polzellanfablik.»
«Da kann man nichts machen.»
«Es ist abel dlingend, dass Sie besuchen Lehlelbildungsanstalt, an del gloßel Volsitzendel Mao studielte.»
«Nicht heute», sagte Wexford. Die Eiseskälte im Auto ließ den Schweiß nicht mehr rieseln, sondern strömen. Er wischte sich das Gesicht ab.
«Sehl gut, ich hoffe, Sie welden nicht beleuen», sagte Mr. Sung. Wie jede Gefühlsaufwallung richtete auch Entrüstung großes Unheil bei seiner Aussprache des Englischen an. «Ich fülchte, Sie welden bestimmt beleuen.» Seine Stimme klang auf unbestimmte Weise drohend. Sollte sein widerspenstiger Besucher noch mehr rebellieren, dachte Wexford, behauptet er vielleicht, derartige Unterlassungen seien ihm nicht gestattet. Wenn Lüxingshe, das Internationale Chinesische Reisebüro, dessen Vertreter Mr. Sung praktisch war, von Wexford verlangte, dass er Fabriken, Kindergärten, Hochschulen und Ölraffinerien besichtigte, dann würde er Fabriken, Kindergärten, Hochschulen und Ölraffinerien sehen, daran war nicht zu zweifeln.
Mr. Sung wandte sich ab und sah aus dem Fenster. Sein Gesicht drückte nur selten etwas anderes aus als unbarmherzige Liebenswürdigkeit. Sein Scheitel schwebte irgendwo in Wexfords Schulterhöhe, obwohl er für einen Südchinesen nicht gerade klein war. Er trug ein schneeweißes Baumwollhemd, sackartige olivgrüne Baumwollhosen und walnussbraune Plastiksandalen. Sein Vater, hatte er Wexford erzählt, gehörte dem Parteikader an, seine Mutter, seine Schwester und seine Frau waren Ärztinnen. Sie lebten alle zusammen in einer Zweizimmerwohnung in einem der kasernenartigen grauen Betonblocks der Stadt. Zur Familie gehörte außerdem Mr. Sungs kleiner Sohn Tsu Ken, der noch ein Baby war.
Fußgänger und Radfahrer anhupend, die auf ihren Rädern einfach alles transportierten – angefangen bei zwei Ferkeln und einem Huhn bis zu mehreren Kleinmöbeln –, schlängelte sich der Wagen durch düstere und freudlose Straßen zum Xiangjiang Hotel. Es gab in Tschangscha nicht mehr viele Gebäude, die vor der Revolution im Jahr 1949 erbaut worden waren: nur noch das Haus des Kuomintang-Generals mit dem geschwungenen grünen Dach in der Nähe des Hotels und die Ruine einer europäischen Kirche mit grauer Stuckfassade, über deren Ursprung niemand mehr etwas zu wissen schien. Mr. Sung stieg aus dem Wagen und begleitete Wexford in die Halle. Dort schüttelten sie sich die Hände. Ein zwangloseres Benehmen hätte der Chinese für eine Pflichtverletzung gehalten. Wexford war schon froh, dass er ihn daran hindern konnte, ihn mit dem Lift in die achte Etage zu bringen. Er stehe, bitte, um sieben Uhr wieder zur Verfügung, sagte Mr. Sung. Sie wollten dann gemeinsam ein Freilichtkino besuchen, in dem ein Film über die Geschichte der Revolution gezeigt wurde.
«O nein, besten Dank», erwiderte Wexford. «Zu viele Moskitos.»
«Sie nehmen jeden Fleitag Anti-Malalia-Pille, hoffe ich?»
«Trotzdem lasse ich mich nicht gern beißen.» Wexfords Sprungbein schien auf das Doppelte seiner normalen Größe angeschwollen. «Rätselhafterweise –» in einem der wenigen im Hotel vorhandenen Spiegel erhaschte er einen Blick auf sein schweißüberströmtes, sonnenverbranntes Gesicht, das man schon unter normalen Umständen nicht gut aussehend nennen konnte – «wirke ich auf Anophelesmücken besonders anziehend, doch ist diese Leidenschaft nicht gegenseitig.» Mr. Sung musterte ihn mit verständnisloser unbarmherziger Freundlichkeit. «Und ich habe keine Lust, im Freien zu sitzen und sie dazu einzuladen, mir das Blut auszusaugen wie Vampire.»
«Ich velstehe. Sehl gut. Sie gehen in das Hotel-Kino und sehen sich ‹Shanghai Gill› und Challie Chaplin in ‹Del gloße Diktatol› an. ‹Shanghai Gill› sehl gutel chinesischel Film übel Baualbeitel. Ich sitze neben Ihnen, damit Sie die Stolly velstehen.»
«Möchten Sie denn nicht lieber zu Hause bei Ihrer Frau und bei Ihrem Baby bleiben?»
Mr. Sung lächelte rätselhaft. Er schüttelte Wexford noch einmal die Hand. «Ich tue meine Albeit, odel?»
Wexford lag auf dem eisenharten Bett, unter sich die dünne Steppdecke. Das Laken war aus einem unerfindlichen Grund ein blau-weiß kariertes Tischtuch. Aus der japanischen Klimaanlage kam in unregelmäßigen Abständen ein Schwall kalter Luft, während vor dem Fenster das Haus des Generals und die braunen Pfannendächer von Tschangscha in der feuchten Hitze brieten. Er hatte sich mit dem Wasser aus der Thermosflasche, die zu den Annehmlichkeiten seines Zimmers gehörte, in einer mit Apfelblüten verzierten Kanne grünen Tee gebraut. Zu Abend essen musste man hier um sechs – Frühstück gab es um sieben und Lunch um halb zwölf, was entsetzlich war –, aber bis dahin hatte er noch anderthalb Stunden Zeit. Er schaffte es einfach nicht, die Limonade und die Erdbeer- und Zimtbrause in sich hineinzuschütten, die man hier stündlich gegen den allzu großen Wasserverlust des Körpers trinken sollte. Er trank immer nur grünen Tee, den er sich selbst sehr stark zubereitete oder an einem Straßenstand für einen einzigen fen – ungefähr ein Drittel Penny – pro Glas kaufte.
Nach der zweiten Tasse Tee döste er ein, und dann war es auch schon Zeit, zu duschen und zum Abendessen ein frisches Hemd anzuziehen. Später wollte er seiner Frau schreiben, jetzt hatte er keine Zeit. Hongkong, wo sie ihn erwartete, schien unendlich weit weg zu sein. Er ging in den Speisesaal hinunter. Dort hatte er einen Tisch und einen Ventilator für sich allein. Hinter einem Wandschirm aus Bambus saß die einzige im Augenblick anwesende ausländische Reisegruppe an einem großen runden Tisch. Es waren Italiener. Er setzte sich und bat die Bedienung, ihm eine Flasche Bier zu bringen.
Die Italiener kamen herein und begrüßten ihn. Die Bedienung schaltete den Ventilator ein, rückte den Wandschirm zurecht und begann Wexfords Essen aufzutragen. Es gab Huhn mit Bambussprossen in Ingwersoße, in Öl gebratene Erdnüsse, hellgrünen, fast rohen Spinat, gebratenen Kürbis und gebratenen Fisch.
Da er ursprünglich mit seinem Neffen Howard und mehreren Polizeibeamten gereist war, die alle einen viel höheren Rang hatten als er, hatte er im Koffer ein Essbesteck mitgenommen, weil er befürchtete, dass man im Peking Hotel weder Gabel noch Löffel kannte. Wie grün er gewesen war! So grün wie der Tee. Das Peking Hotel war wie ein strenges, nüchternes Ritz mit einer Klimaanlage, die arktische Luft erzeugte, einer riesigen Ladenstraße und Vorhängen, die sich elektrisch öffnen und schließen ließen. Doch aus irgendeinem Grund hatte keiner von ihnen die Silberbestecke benutzt, die man ihnen brachte. Von Anfang an hatten sie alle wie die Chinesen gegessen, und inzwischen konnte er mit den Essstäbchen so geschickt umgehen wie ein Würdenträger in der Verbotenen Stadt. Er brachte es sogar fertig, wie er jetzt entdeckte, mit den Stäbchen eine ölige Erdnuss aufzunehmen, so gut konnte er sie handhaben. Die Bedienung brachte ihm eine Schüssel mit Reis und die große grüne Flasche Tsingtao-Bier.
Ein Gefühl ungeheuren Wohlbehagens überkam ihn, als er zu essen begann. Obwohl er sich schon zwei Wochen in China aufhielt, konnte er noch nicht glauben, dass er, der einfache Dorfpolizist, hier in Cathaysia und über die Große Mauer gegangen war. Er hatte die Tatarenstadt gesehen, den Fuß in das Marmorboot im Sommerpalast gesetzt, die scharlachroten Säulen im Tempel des Himmels berührt und fuhr jetzt nach Süden, um so viele wunderbare Dinge zu sehen und so viele Freuden zu erleben, wie Lüxingshe ihm gestattete.
Als Chief Superintendent Howard Fortune von Scotland Yard, der Sohn von Wexfords verstorbener Schwester, bei einem Familientreffen zum ersten Mal verlauten ließ, er habe die Absicht, im Sommer 1980 nach China zu reisen, hatte sein Onkel etwas empfunden, von dem er normalerweise nicht geplagt wurde – Neid. Natürlich würde Howard viel Zeit am Konferenztisch verbringen. Die Abteilung der chinesischen Regierung, die ihn eingeladen hatte, wollte sich über Methoden zur Vorbeugung und Aufklärung von Straftaten informieren. Darüber hinaus würde sie wohl dem liebsten Zeitvertreib aller Kommunisten huldigen und den Gästen stolz alle nationalen Institutionen und Errungenschaften zeigen – in Howards Fall vermutlich Polizeidienststellen, Gerichte, Gefängnisse. Trotzdem würden er und sein Team noch Zeit haben, den ehemaligen Kaiserpalast, in dem jetzt ein Museum untergebracht war, den Kohlenhügel und die Marco-Polo-Brücke zu besichtigen. Sein Leben lang hatte sich Wexford gewünscht, die Verbotene Stadt zu sehen, sich jedoch damit abgefunden, dass es ihm nie vergönnt sein würde. Aber er hatte nichts davon erwähnt und Howard gutmütig geneckt, indem er ihm sagte, er müsse unbedingt Seide, Jade und einen Stein der Großen Mauer als Souvenir mitbringen.
Eine Woche später hatte Howard angerufen und erklärt, er habe in Brighton zu tun und wolle auf der Rückfahrt seinen Onkel in Kingsmarkham besuchen. Er kam am Samstagabend gegen sechs, ein ungewöhnlich blasser Riese von einem Mann, der zwar völlig gesund war, es aber schon seit jeher fertiggebracht hatte, zwanzig Jahre älter auszusehen. Seine Schwiegereltern lebten in Hongkong, wo seine Frau ihn erwarten wollte. Was halte Tante Dora davon, Denise dort zwei oder drei Wochen Gesellschaft zu leisten?
«Reg auch?», hatte Dora rasch gefragt. Sie war es gewohnt, viele Stunden, manchmal sogar Tage von ihm allein gelassen zu werden. Doch nie wäre sie bereit gewesen, zu verreisen und ihn allein zu lassen – solange sie nicht dazu gezwungen war.
«Das geht nicht», erwiderte Howard, den Kopf schüttelnd. «Er hat etwas anderes zu tun.»
Wexford dachte, er meine Kingsmarkham, und warf ihm, eine Braue hochziehend, einen schrägen Blick zu, weil er fand, Howard habe sich recht merkwürdig ausgedrückt.
«Ich brauche ihn in Peking», ergänzte der Neffe.
Schweigen. Dann sagte Wexford: «Das meinst du doch nicht ernst, Howard, oder?»
«Natürlich meine ich es ernst. Ich habe freie Hand, mir mein eigenes Team auszusuchen, und du gehörst dazu, weil du bei weitem der beste Ermittlungsbeamte bist, den ich kenne. Und ich gebe dir rechtzeitig Bescheid, damit ihr euch Einzelvisa besorgen könnt. Die Gruppenvisa sind schrecklich lästig, wenn man sich allein ein bisschen im Land umsehen will. Was du bestimmt vorhast, wie ich dich kenne.»
Und das tat er jetzt, während Howard, der Amateurantiquar, hingerissen durch die gelb überdachten Pavillons von Peking schlenderte und die anderen Mitglieder des Teams über den Wolken und unter asiatischen Himmeln zu britischen Sorgen und britischen Verbrechen zurückjagten. Wexford nahm jetzt zwei Wochen seines Jahresurlaubs. Er war vor drei Tagen von Peking heruntergeflogen, und am Flughafen von Tschangscha hatte ihn Mr. Sung sofort unter seine Fittiche genommen. Den Flug würde er nie vergessen, auf dem die Stewardess ihm eine sehr seltsame Mahlzeit aus hartgekochten Eiern, Biskuitkuchen und wie Bonbons verpackten getrockneten Pflaumen serviert hatte. Er war der einzige Passagier weißer Rasse gewesen, und die anderen – Jungen und Mädchen in blauer Baumwolle, hohe koreanische Offiziere, sehr korrekt in ihren khakigrünen Uniformen – hatten sich mit Fächern aus goldbestickter schwarzer Seide gefächelt.
Ein diskretes Hüsteln riss Wexford aus seiner Nachdenklichkeit. Vor ihm stand Mr. Sung, der ihn zweifellos ins Kino führen wollte. Wexford forderte ihn auf, sich zu setzen und ein Bier zu trinken, doch das lehnte Mr. Sung ab. Er war Antialkoholiker. Den angebotenen Platz hingegen schlug er nicht aus und begann Wexford im gleichen Atemzug einen Vortrag über die höhere Bildung in China mit besonderem Hinweis auf das Pekinger Fremdspracheninstitut zu halten, das er seine Alma mater nannte. Habe Wexford während seines Aufenthalts die Universität besichtigt? Nein? Wie merkwürdig. Doch das werde er bestimmt bereuen, es werde ihm leidtun. Wexford trank zwei Tassen grünen Tee und aß vier Litschipflaumen und ein Stück Wassermelone.
«Passen Sie auf, dass Sie nicht schlucken die Kölnel wie die zweitausend Jahle alte Dame», sagte Mr. Sung, der einen recht eigenartigen Humor hatte.
Der ‹Große Diktator› war chinesisch synchronisiert. Wexford hielt es genau zehn Minuten im Kino aus. Es kam ihm so vor, als seien alle Kinder von Tschangscha ebenfalls da, und sie lachten so viel und so laut, dass sie ihren Müttern fast vom Schoß fielen. Er entschuldigte sich bei Mr. Sung und sagte ihm – was sehr merkwürdig, aber die absolute Wahrheit war –, dass er fror. Die Klimaanlage jagte ihm eisige Luft über die linke Schulter und in den Hals. Er schlenderte auf die Straße hinaus, wo sich die Luft warm, pelzig und staubig anfühlte wie das Innere eines Muffs. Gegenüber war ein Laden, in dem Tee verkauft wurde. Wexford überlegte, dass er sich am Morgen frischen Tee kaufen wollte, da das Paket fast leer war, das vom Hotel gestellt wurde.
Er ging spazieren. Er hatte einen sehr guten Orientierungssinn, was wichtig war, da er die chinesischen Schriftzeichen auf den Straßenschildern nicht lesen konnte und sich wie ein Analphabet vorkam. Die Stadt war schlecht beleuchtet, ein Straßengewirr, exotisch und phantastisch, ohne den geringsten Anspruch auf Schönheit zu erheben. Auf einer breiten Hauptstraße spielten die Leute im Licht der Straßenlaternen auf dem Gehsteig Karten. Wexford machte kehrt und schlug den Weg zum Fluss ein. Menschenmengen drängten sich in den Straßen, freundliche Leute, zu höflich, um ihn anzustarren, aber die Kinder zeigten natürlich kichernd auf den blauäugigen Riesen. Zehn Uhr ist schon mitten in der Nacht, wenn man um sechs aufstehen muss. Wexford machte sich noch eine Tasse Tee, ging ins Bett, schlief ein und tauchte bald darauf in einen Traum, wie er ihn noch nie – oder zumindest seit Jahren nicht mehr – gehabt hatte.
Ein Albtraum. Er war in China, doch es war das China seiner Jugend, bevor die Kommunisten an die Macht kamen, bevor die Kulturrevolution die Tempel der Taoisten, die Tempel von Buddha und Konfuzius zerstörte und die Städte noch von unzähligen Pagoden eingefriedet wurden. Er war ein junger Mann, ein Chinese vielleicht sogar. Und er wusste, dass er auf der Flucht war – möglicherweise vor den nationalistischen Soldaten, vielleicht aber auch vor den Kommunisten oder den Japanern. Er ging barfuß und mit einem Packen auf dem Rücken außerhalb der Stadtmauern auf einem Pfad zum nördlichen Teil der Stadt.
Die steinerne Tür, die in den Hügel eingelassen war, stand ein wenig offen. Er ging hinein, als sei hier der Ort, an dem er Zuflucht für die Nacht finden konnte, und geriet in einen höhlenartigen Gang, der bis ins Herz des Hügels zu führen schien. Es war kalt und die Luft stickig und modrig, und sie roch, wie es vor fast zweitausend Jahren zur Zeit der Han-Dynastie gerochen haben mochte. Er ging immer weiter, ohne Angst. Er fühlte sich höchstens ein bisschen unsicher. Der Gang war finster, und doch fiel es ihm nicht schwer, den Weg in das rechteckige Gemach mit den holzverkleideten Wänden zu finden, das von einer einzigen kleinen Öllampe aus grüner Bronze erleuchtet wurde.
Die Lampe brannte neben einem hölzernen Tisch oder einer Bank, und er hatte den Eindruck, dass dies das Bett war, auf dem er die Nacht verbringen sollte. Er ging darauf zu, hob die bemalte Seidendecke, mit der es zugedeckt war, und blickte auf die Marquise von Tai hinunter. Er hatte einen Sarkophag aufgedeckt, der in einer Gruft stand. Das Gesicht der Frau war qualvoll verzerrt, die Wangen aufgedunsen, die schwarzen Augen traten aus den Höhlen, und die Lippen waren so weit geöffnet, dass die zusammengeschrumpften Kiefer, die wenigen noch vorhandenen gelben Zähne und die geschwollene Zunge sichtbar waren. Er wich zurück und wollte sich entfernen, denn aus der dunklen Tiefe des Sarges stieg süßlicher Verwesungsgeruch. Aber als er das seidene Tuch in die Hand nahm, um das grässliche tote Ding wieder zuzudecken, schien ein Schauer durch die merkwürdig streifigen Glieder zu gehen, und die Marquise erhob sich und legte ihm die eisigen Arme um den Hals.
Wexford befreite sich gewaltsam von seinem Traum und erwachte mit einem Schrei. Er setzte sich auf, knipste das Licht an und wurde sich der überlaut summenden Klimaanlage und seines dröhnenden Herzschlags bewusst. Was war er doch für ein Narr! Kam es daher, dass er im Kino gewesen war, lag es daran, dass er mit Ingwer gewürzten gebratenen Fisch gegessen hatte, oder war ganz einfach die Hitze an diesem Traum schuld, der direkt aus ‹Der Fluch des Mumiengrabes› zu stammen schien. Schließlich war die Marquise nicht die erste Frauenleiche, die er gesehen hatte, und die meisten, zu denen er gerufen worden war, waren bei weitem nicht so gut erhalten gewesen. Er trank ein Glas Wasser und schaltete das Licht aus.
Am nächsten Tag sah er die Frau mit den gebundenen Füßen zum ersten Mal.
2
Sie war nicht die erste Frau ihrer Art, der er begegnete. Die erste war ihm auf einer der Marmorbrücken entgegengekommen, die den Graben um das Tor des Himmlischen Friedens überspannen. Es war eine winzige alte Frau gewesen, zusammengeschrumpft, was für alte Chinesen typisch ist, mit schwarzer Jacke und Hose bekleidet. In einer Hand hatte sie einen Stock gehabt, mit der anderen den Arm ihrer Tochter oder Schwiegertochter festgehalten, denn sie konnte nur humpeln. Ihre Füße glichen Hufen, waren, als sie jung war, vielleicht zierliche Hufe gewesen, jetzt aber nur noch schlurrende Klumpfüße in rötlichen Strümpfen und schwarzen Pantoffeln, die einem fünfjährigen Kind gepasst hätten.
Wexford war fasziniert und dann plötzlich angewidert gewesen. Die gebundenen Füße waren um das Jahr 500 Mode geworden, wenn er sich recht erinnerte, und die Kuomintang hatten die Sitte oder, besser gesagt, die Unsitte abgeschafft. Zuerst hatte man sie nur in Adelskreisen praktiziert, doch dann hatte die Mode sogar unter den Landbewohnern um sich gegriffen, sodass man in China kaum noch ein Mädchen mit nicht verkrüppelten Füßen gefunden hatte. Er hatte sich gefragt, wie alt die Frau sein mochte, die am Arm ihrer Tochter über die Marmorbrücke ging. Vielleicht nicht älter als 60. Man hatte mit dem Bandagieren der Füße, wobei die Zehen unter die Fußsohlen gebunden wurden, begonnen, wenn ein Mädchen noch im Babyalter und die Knochen biegsam waren. So groß war die Macht der Mode, dass kein Mann eine Frau mit normalen Füßen geheiratet hätte, eine Frau, die sich leicht und mühelos bewegen konnte. In den dreißiger Jahren dieses Jahrhunderts wurde die Sitte gesetzlich verboten, und Füße, die nicht unwiderruflich verkrüppelt waren, mussten aufgebunden werden. Faszination besiegte Abscheu, Mitleid und Widerwillen, und Wexford starrte die Frau an. Schließlich starrten alle auch ihn an.
Wie empfand eine solche Frau jetzt? Was fühlte sie? Selbstmitleid, Groll, Neid auf ihre freieren weiblichen Nachkommen und, schlimmer noch, auf ihre befreiten Altersgenossinnen? Wexford glaubte es nicht. Die menschliche Natur reagierte anders. Trotz aller Schmerzen, die sie gelitten hatte, obgleich sie in ihrer Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt war und täglich von neuem litt, weil die Füße gesäubert und frisch bandagiert werden mussten, verachtete sie zweifellos die Mädchen, die auf großen, gesunden Füßen über die Brücke liefen, und stolperte mit einem geringschätzigen und arroganten Schnauben nur umso stolzer auf ihren winzigen, spitzen Missbildungen einher.
Sie war die erste von etwa zehn solcher Frauen, die Wexford gesehen hatte. Sie waren der Grund gewesen, dass er sich die abgeknickten Füße der Marquise von Tai neugierig betrachtet hatte, obwohl er wusste, dass die Sitte erst Jahrhunderte nach ihrem Tod in Mode gekommen war. Als er sich den Traum am Morgen noch einmal vergegenwärtigte, kam er ihm lächerlich vor. Er hatte keine Albträume, hatte nie welche gehabt und auch nicht die Absicht, jetzt damit anzufangen. Es musste das Essen gewesen sein.
Das Frühstück war bei weitem das am wenigsten schmackhafte Essen, das er vorgesetzt bekam, und er musterte es resigniert. Getoastete Brötchen aus dunklem Brotteig, Zwieback, ranzige Butter, Pflaumenmarmelade, Schokoladecremekuchen und Kokosbiskuits. Tee wurde in einem Aluminiumkessel gebracht, und er trank zwei Tassen. Mr. Sung erschien, bevor er mit dem Essen fertig war.
Er hatte ein frisches blassrotes Hemd an – er war einer der am saubersten aussehenden Menschen, denen Wexford je begegnet war –, und sein schwarzes Haar war noch feucht von der Morgenwäsche. Wie schaffte man es nur, einen solchen Eindruck zu machen, wenn man das Bad nicht nur mit vier oder fünf Mitgliedern der eigenen Familie, sondern mit allen Mietern eines Stockwerks teilte? Es war einfach bewundernswert. Wexford erinnerte sich voller Unbehagen daran, dass man sagte, die Menschen des Westens röchen für den Chinesen unangenehm, weil sie Molkereiprodukte aßen. Wenn das stimmt, müsste eigentlich mein Körpergeruch in letzter Zeit wesentlich besser geworden sein, dachte er und schob die fast flüssige grünliche Butter beiseite.
«Sie haben nichts dagegen, mit Bus-Leisegesellschaft zu fahlen?»
«Nein, durchaus nicht. Warum sollte ich?»
Als habe Wexford protestiert, anstatt sich einverstanden zu erklären, sagte Mr. Sung mit unterdrücktem Vorwurf: «Es ist nicht wiltschaftlich, den Bus fünfzig Kilometel fül einen Mann zu fahlen. Das gloße Velschwendung. Viel bessel ist, Sie kommen mit Gesellschaft, sehl nette Eulopäel und Amelikanel. Lichtig?»
Die sehr netten Europäer und Amerikaner marschierten gerade zum Bus, als Wexford aus dem Hotel kam. Sie sahen müde und ein bisschen aufgelöst aus und machten nicht den Eindruck, als wünschten sie sich nichts so sehnlich wie eine Fahrt durch die vor Hitze brodelnde chinesische Landschaft zu den Stätten, an denen Mao Tse-tung geboren und aufgewachsen war. Es blieb ihnen jedoch kaum eine andere Wahl. Ihr Führer, mit dem Mr. Sung sich auf Mandarin unterhielt – womit vor allem in England und Amerika der Dialekt gemeint ist, der heute in Peking gesprochen wird –, schien noch unerbittlicher. Sie rauchten beide Mentholzigaretten und schwatzten unheimlich schnell drauflos, wobei der andere Führer genauso unnachgiebig, entschlossen, fröhlich und sauber wie Mr. Sung aussah. Außerdem war er ein bisschen größer, bisschen dünner, sein Englisch ein bisschen schlechter, und er wurde Wexford als Mr. Yu vorgestellt. Sie schüttelten sich die Hand. Als Nächstes erfuhr Wexford, dass Mr. Yu ein ehemaliger Kommilitone von Mr. Sung war und ebenfalls die Alma Mater für Fremdsprachen absolviert hatte.
Das Grünste von allem, was da wächst, ist Reis. Wexford blickte aus dem Fenster auf Reispflänzchen, halbreifen Reis und Reis, der bald geerntet werden konnte. Es war der absolute Inbegriff von Grün, vielleicht das vollkommene Grün des Aristoteles, dem jedes andere nacheifern müsse. Männer und Frauen im traditionellen chinesischblauen Baumwollanzug, den spitz zulaufenden Strohhut auf dem Kopf, arbeiteten mit schwerfälligen grauen Wasserbüffeln auf den Feldern. Um Mr. Sung und Mr. Yu von ihren begeisterten Vorträgen über Maos politische Karriere abzulenken, fragte Wexford, um was für Feldfrüchte es sich hier handle. Um Erdnüsse, Auberginen, Rizinuspflanzen, Manioksträucher, Wasserbrotwurzeln und Sojabohnen, erfuhr er. Wasserflächen – Teiche, Seen, Kanäle – waren in die ordentlich aussehende Landschaft hineingetupft und wirkten wie Edelsteine auf gemusterter Seide.
Nach einer Weile stand Mr. Yu auf, ging nach vorn zum Fahrer und begann zu Nutz und Frommen der Touristen Zeitungsartikel in schlechtes Englisch zu übersetzen. Wexford überlegte eben, was mit einem Piratenstreik in Ungarn und Masern in Afghanistan gemeint sein konnte, als sich ein Mann neben ihn setzte, der zur Busgesellschaft gehörte.
«Haben Sie etwas dagegen?», fragte er.
Was konnte Wexford schon anderes sagen, als dass er nichts dagegen hatte.
«Ich heiße Lewis Fanning», sagte sein neuer Nachbar, ein kleiner Mann mit einem roten Gesicht voller Falten und einem dichten semmelblonden Schopf. «Ich dachte, ich muss mich entweder zu Ihnen setzen oder schreiend aus dem verdammten Bus springen. Schlimmer als diese Bande können Sie nicht sein, und es besteht immerhin die Möglichkeit, dass Sie besser sind.»
«Besten Dank.» Wexford stellte sich vor und fragte Fanning, ob er aus Mr. Yus Enthüllungen schlau geworden sei.
«Er meint Piloten und Raketen. Hätte ich gewusst, dass er diese Fahrt mitmacht, wäre ich im Hotel geblieben und hätte mich besoffen. Wie die Dinge liegen, glaube ich nicht, dass ich noch bei Verstand bin, wenn wir Kanton erreichen.»
Wexford fragte ihn, warum er die Reise überhaupt mitmache, wenn er sie so verabscheue.
«Lieber Gott im Himmel, das ist für mich kein Urlaub. Ich arbeite. Ich bin der Reiseleiter. Ich habe die Bande mit dem Zug hierhertransportiert. Wundert es Sie immer noch, dass ich langsam durchdrehe?»
«Mit dem Zug von wo?»
«Von Calais», sagte Fanning. Wexfords ungläubiges Staunen schien ihn aufzuheitern. «Sechsunddreißig Tage habe ich in Eisenbahnzügen gesessen, unter anderem im Transsibirien-Express. Zehn Irre durch Asien führen – wissen Sie, was das heißt? An der Berliner Mauer hätte ich eine davon fast verloren. Der Waggon wurde abgekoppelt, und sie blieb im anderen Zugteil sitzen. Sie sprang schreiend heraus und rannte die Gleise entlang. Eine ist Alkoholikerin, und eine kann die Männer nicht in Ruhe lassen. Meines Wissens hatte sie unterwegs vier in verschiedenen Schlafwagen.»
Wexford musste unwillkürlich lachen. «Und wohin geht die Reise?»
«Nach Hongkong. Wir fahren morgen Abend – über Kweilin. Ich schlafe in einem Abteil mit zwei Kerlen, die seit Irkutsk nicht miteinander reden.»
Auch Wexford wollte diesen Zug nehmen und teilte, soviel er wusste, sein Vierbettabteil nur mit Mr. Sung. Doch er zögerte, Lewis Fanning einzuladen, sich ihnen anzuschließen, und am Ende unterließ er es. Er hörte sich einen sehr eingehenden Bericht über die Neigungen der trunksüchtigen Touristin an, der darin gipfelte, dass sie – die täglich eine ganze Flasche Whisky trank – in Ulan-Bator von vier Männern in den Zug zurückgetragen werden musste. Der Bericht dauerte bis Shaoshan, wo sie Tee tranken, bevor sie den Hügel zum Bauernhof der Mao hinaufkletterten. Die Landschaft hatte hier das Frische, Funkelnde, das man an einem schönen Tag nach einem ausgiebigen Regen auch in England findet. Vor dem Haus erhoben Lotospflanzen die runden, sonnenschirmähnlichen Blätter, und in einem flachen Teich blühten rosa Lilien. Der Reis war von dem hellen, zarten Grün kaiserlicher Jade. Dennoch war die Hitze fast unerträglich. «39 Grad», sagte Mr. Yu. Wexford multiplizierte mit neun, teilte durch fünf und zählte 35 dazu und erhielt beängstigende 102 Grad Fahrenheit. Im Schatten wurde es plötzlich erschreckend kühl, aber sie hielten sich nicht oft im Schatten auf, und als sie, die Köpfe mit Maoismen vollgestopft, den Hügel wieder hinuntergingen, mussten sie – noch vor dem Lunch – das Museum für Maoiana besichtigen.
Wexford gehörte zu jenen Engländern, die behaupten, ein heißes Getränk wirke viel kühlender und erfrischender als ein kaltes. Im Speisesaal des Hotels bestellte er sofort eine sehr große Kanne starken, heißen Tee. Mr. Sung und Mr. Yu saßen mit zwei einheimischen Fremdenführern zusammen. Die Reisegesellschaft wurde aus irgendeinem unerforschlichen chinesischen kulinarischen Grund hinter einen Wandschirm platziert, und Wexford fand sich wieder allein an einem Tisch.
Er ärgerte sich über sich selbst, weil ihm die Hitze so zusetzte. Fühlte er sich vielleicht so kaputt und völlig erschlagen, weil er aus einem nördlich gelegenen Land kam? Hinter ihm rührte ein Ventilator in der schweren, heißen Luft herum. Zwei Mädchen servierten ihm ein wahres Festessen – nicht weniger als sieben Platten. Hartgekochte Eier, die zerstoßen und dann gebraten worden waren, Lotosknospen, Schweinefleisch mit Ananas, Ente mit Rosenkohl, Pilzen und Bambusspitzen und Garnelen mit Erbsen und rohen geschnittenen Tomaten. Er bestellte noch mehr Tee. Von dem Augenblick an, in dem er die geschnitzten Essstäbchen in die Hand nahm, begann er so stark zu schwitzen, dass sein Hemd und die Stuhllehne klatschnass wurden.
Am anderen Ende des Raumes aßen die Führer getoastete dunkle Brötchen und hundert Jahre alte Eier und etwas, das wie eine Schlange aussah.
«Sie essen alles, was sich bewegt», hatte Lewis Fanning leise zu Wexford gesagt, als er den Speisesaal betreten hatte. «Sie essen auch Mäuse, wenn sie sie fangen.»
Die beiden Bedienungen – junge Mädchen – kicherten leise. Es klang wie Vogelgezwitscher bei Sonnenuntergang. Die Stimmen der Männer schwollen an und senkten sich im Rhythmus des merkwürdig rein und klar klingenden uralten Mandarin. Wexford fragte sich, wie die Europäer eigentlich dazu gekommen waren, Chinesen gelb zu nennen. Die Haut dieser vier war von einem fast durchsichtigen Elfenbein, die Wangen leicht gerötet, und sie hatten schmale braune Hände. Er wandte sich ab, zwang sich, nicht hinüberzustarren, und blickte stattdessen in den im Schatten liegenden Teil des Raumes, aus dem die Kellnerinnen kamen. Und plötzlich entdeckte er die alte Frau auf der Schwelle.
Sie sah ihn eindringlich an. Ihr Gesicht war blass, sie hatte Pausbacken und Augen, die so dunkel waren wie Rosinen. Das Haar der Chinesen wird nur selten weiß und bleibt meist bis ins fortgeschrittene Alter kohlschwarz. Obwohl diese Frau schon sehr alt zu sein schien, war ihr Haar nur ganz leicht angegraut. Sie trug eine graue Jacke über schwarzen Hosen, und ihre gebundenen Füße in den grauen Strümpfen und den Kinderschuhen waren keilförmig. Sie stand sehr aufrecht da, stützte sich aber trotzdem auf einen Stock. Es sah so aus, als wolle sie ihn ansprechen, als wappne sie sich, den Mut zu finden und ihn anzusprechen. Ihr Blick war fast verwirrend. Aber das war lächerlich. Mit allergrößter Wahrscheinlichkeit sprach sie ohnehin nur Chinesisch. Noch einmal trafen sich ihre Blicke. Wexford legte die Stäbchen aus der Hand, wischte sich den Mund ab und stand auf. Er wollte zu Mr. Sung gehen und ihn bitten zu dolmetschen, so offensichtlich war es, dass sie mit ihm sprechen wollte.
Aber bevor er Mr. Sungs Tisch erreicht hatte, war die Frau verschwunden. Er schaute zurück, doch der Platz, an dem sie gestanden hatte, war leer. Ohne Zweifel hatte er sich nur eingebildet, dass sie etwas von ihm wollte. Schließlich, sagte er sich, bin ich nicht in Kingsmarkham, wo man ihn häufig konsultierte, über ihn murrte und ihn manchmal sogar um Hilfe anflehte.
Nach dem Lunch ging es wieder hinaus in die unbarmherzige Sonne, um die Schule zu besichtigen, die Mao besucht hatte, und in Ehrfurcht vor dem Teich zu verharren, in dem er geschwommen war. Auf dem Rückweg zum Bus hielt Wexford nach der alten Frau Ausschau. Er warf einen Blick in die dämmerige Hotelhalle, sah sie jedoch nirgends. Sehr wahrscheinlich hatte sie ihn aus demselben Grund angestarrt wie die Kinder. Mit seiner Größe, seiner Kleidung, der rötlich braunen Haut und dem schütteren blonden Haar fiel er hier so auf, wie ein weißes Einhorn aufgefallen wäre, das die Straße entlanggaloppierte.
«Wil fahlen jetzt», sagte Mr. Sung, «zu Nummel eins Nolmalschule, zum Haus von gloßem Volsitzenden Mao am Teich zum Klalen Wassel.» Mit jugendlichem Schwung stieg er in den Bus.
Den letzten Tag seines Aufenthalts in Tschangscha verbrachte Wexford auf der Orangeninsel und in dem Museum, in dem die Artefakte aus den Grabmalen von Mawangdui ausgestellt waren. Dort lag, eine Nachbildung aus Wachs diesmal, die Marquise von Tai, ebenfalls hinter Glas, aber aus größerer Nähe zu betrachten. Wexford trank im Museumsladen einen halben Liter grünen Tee, kaufte für Dora ein bisschen Jade und für seine jüngere Tochter einen Fächer aus Büffelknochen, die wie Elfenbein aussahen. Sheila, die fanatische Natur- und Tierschützerin, hätte Elfenbein abgelehnt. Außerdem erstand er für sie ein Bild mit Bambusstangen und Heuschrecken und dem Siegel des Malers in Rot und seiner kalligraphischen Unterschrift in Schwarz.
Die alten Häuser auf der Insel mit ihren von Mauern umfriedeten Gärten, den Blumen und Gemüsen und dem gemächlich strömenden Fluss hatten etwas Englisches an sich. Die Wände bestanden aus mit Lehm beworfenem Flechtwerk wie die der Cottages in Sewingbury. Doch hier duftete die Luft nach Ingwer, und die Cannalilien glühten in der dunstigen Hitze ziegelrot. In der Nähe der Stelle, an der einst Mao geschwommen war, badeten Jungen und Mädchen im Fluss. Mr. Sung nahm die Gelegenheit wahr, Wexford einen Vortrag über die politische Struktur Chinas zu halten, dem Wexford nicht zuhörte. Um sein Visum zu bekommen, hatte er in den Antrag seine Konfession und seine politische Einstellung eintragen müssen. Er hatte, nicht ohne Humor, die gängigsten eingetragen: Kirche von England und konservativ. Manchmal fragte er sich, ob diese reaktionären Angaben an seinen Führer weitergegeben worden waren. Er setzte sich in den Schatten und betrachtete bewundernd den Torbogen mit dem spitzen grünen Dach, der sich zart und wie eine Kostbarkeit vom silberblauen Himmel abhob.
Durch den Torbogen kam, diesmal auf einen Spazierstock mit einem Griff aus geschnitztem Büffelknochen gestützt, die alte Frau mit den gebundenen Füßen, die er in Shaoshan gesehen hatte. Wexford entfuhr ein Ausruf des Erstaunens. Mr. Sung unterbrach seinen Vortrag und fragte scharf: «Stimmt etwas nicht?»
«Nein. Es kommt mir nur ungewöhnlich vor. Die Frau dort drüben habe ich gestern in Shaoshan gesehen. Wie klein die Welt ist.»
«Klein?», fragte Mr. Sung. «China ist ein sehl gloßes Land. Walum soll Dame aus Shaoshan nicht nach Tschangscha kommen? Sie kommt, sie geht, wie es ihl gefällt, alle chinesischen Menschen sind flei. Lichtig? Ich sehe keine Dame. Wohin ist sie gegangen?»
Die Sonne schien Wexford in die Augen, und er musste blinzeln. «Dort drüben am Tor. Eine kleine Frau in Schwarz mit gebundenen Füßen.».
Mr. Sung schüttelte heftig den Kopf. «Sehl schlechte feudale Sitte, nul sehl wenige haben jetzt noch Füße gebunden, alle tot.» Unter gröblicher Missachtung der Wahrheit fügte er hinzu: «Können nicht gehen, müssen zu Hause bleiben.»
Die Frau war verschwunden. Durch den Torbogen zurück? Einen der gepflasterten Wege zwischen den Beeten mit Cannalilien entlang? Wexford beschloss, die Initiative zu ergreifen.
«Können wir gehen?»
Erstaunen malte sich auf Mr. Sungs glattem Gesicht. Wexford vermutete, dass es bisher kein anderer Tourist gewagt hatte, sich ihm nicht widerspruchslos zu unterwerfen.
«Okay, in Oldnung. Fahlen wil in den Yunlu-Palast.»
Als sie die Insel verließen, trafen sie die Reisegesellschaft unter der Führung von Mr. Yu. Lewis Fanning war nirgends zu sehen, und neben Mr. Yu ging, in eine ernste Unterhaltung mit ihm vertieft, der jüngere und besser aussehende der beiden Männer, die sich in der transsibirischen Eisenbahn gestritten hatten. Sein «Feind», ein großer, dicker Mann, bildete das Schlusslicht der Gruppe und warf nervöse und unglückliche Blicke um sich. Die Kleider der Frauen hatten während der sechsunddreißig Tage im Zug so gelitten, dass sie nie wieder gut aussehen würden. Entweder waren sie vom allzu häufigen Waschen ausgeblasst und lappig oder schmutzig und zerdrückt, weil sie nie gewaschen worden waren.
Es war Wexford nicht schwergefallen, die Nymphomanin und die Alkoholikerin herauszufinden: übertrieben stark geschminkt die eine, unscheinbar und grau die andere. Außer diesen offensichtlich alleinreisenden vier Leuten gehörten noch eine alleinstehende recht betagte Dame und zwei ältere Ehepaare zu der Gruppe, von denen eines von einer Tochter mittleren Alters begleitet wurde. Alles in allem, dachte Wexford, scheinen sich die Jungen und die Schönen keine so langen Reisen durch Asien leisten zu können.
Beim Abendessen wurde ihr Tisch so eng mit Wandschirmen umstellt, dass er die Gruppe erst wieder zu Gesicht bekam, als sie in den Bus nach Zhuzhou stiegen, wo sie den Zug Shanghai–Kweilin nehmen wollten.
3
Es wäre schneller und einfacher gewesen zu fliegen. Fannings Gruppe musste natürlich jede Etappe mit dem Zug fahren, aber Wexford hätte den Luftweg vorgezogen. Es ging jedoch nicht nach seinem, sondern nach dem vereinigten Willen von Lüxingshe und Mr. Sung.
Im Bus hatte er einen Doppelsitz für sich allein. Unauffällig beobachtete er seine Mitpassagiere. Zwei Tage im Hotel in Tschangscha hatten viel zu ihrer Wiederbelebung beigetragen, und sie sahen bei weitem nicht mehr so struppig aus, als seien sie verkehrt herum durch eine Hecke gezerrt worden.
Von den beiden Feinden hatte sich auch jeder einen Doppelsitz gesichert. Einer hinter dem Fahrer, der andere in der gleichen Sitzreihe wie Wexford auf der anderen Seite des Mittelgangs. Aus den Augenwinkeln las Wexford das Schildchen, das am Handkoffer des älteren Mannes hing. A.H. Purbank mit einer Adresse irgendwo in Essex. Purbank war etwa 45, mager und sah aus, als sei er nicht gesund. Er trug ausgebeulte Jeans und ein am Hals offenes hellgrünes Hemd. Sein flotterer Widersacher hatte ebenfalls Jeans an, aber es waren engsitzende, schicke, und dazu ein «Freundschafts»-T-Shirt. Er hatte sich auf dem Sitz umgedreht und unterhielt sich mit der Frau hinter ihm. Es war die nicht mehr junge Tochter eines der beiden Ehepaare. Nach einer Weile stand sie auf und setzte sich auf den Platz neben ihm.
Wie unangenehm muss es gewesen sein, die vielen, vielen Meilen von Irkutsk zum Baikalsee mit einem Mann zusammengepfercht zu sein, mit dem man nicht spricht, dachte Wexford mit einem zweiten Blick zu Purbank hinüber. Was für ein Streit mochte die beiden friedlich aussehenden Reisenden entzweit haben? Beide waren Engländer, beide stammten aus der Mittelklasse, waren vermutlich erfolgreich, hatten einen Hang zu Abenteuern und im Grunde sehr viel gemeinsam. Und doch hatten sie eine so bittere Auseinandersetzung gehabt, dass sie auf diesen ungeheuer weiten Strecken, die sie in Ostasien zurücklegten, kein Wort miteinander wechselten. In den Hotels mussten sie bei Tisch wenn auch nicht zusammen, so doch nahe beieinandergesessen haben, vielleicht sogar in nebeneinanderliegenden Zimmern gewohnt. Jetzt würden sie ein Schlafwagenabteil teilen müssen, einen Raum mit anderthalb mal zweieinhalb Metern Platz für jeden. Sie würden daliegen und in der ratternden Dunkelheit acht bis neun Stunden lang dieselbe warme Luft atmen müssen. Es war grotesk.