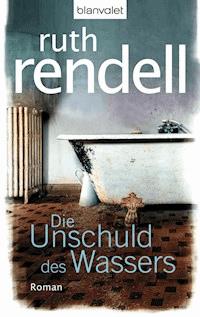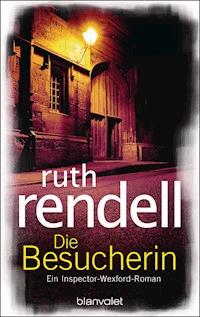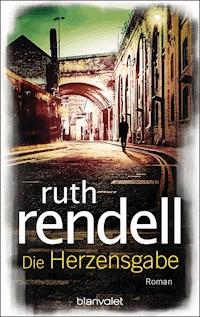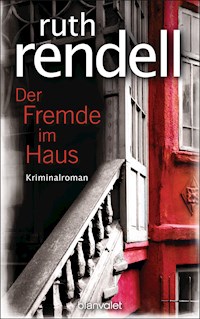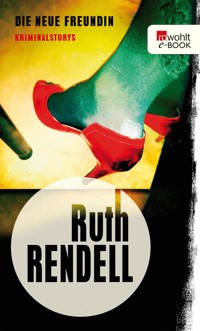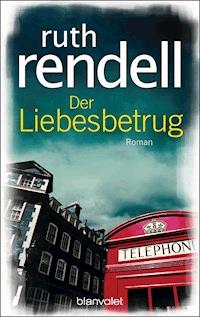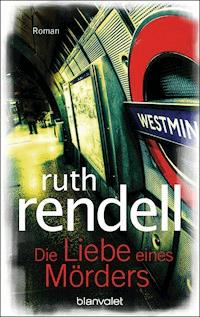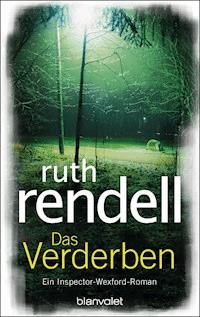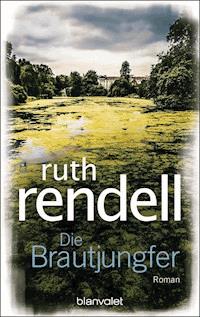
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Philip Wardmann hasst nichts so sehr wie Gewalt. Nach dem Tod seines Vaters, eines besessenen Spielers und Wettsüchtigen, ist Philip zum Familienoberhaupt geworden. Er arbeitet in einer kleinen Firma und wohnt zusammen mit seinen beiden Schwestern Fee und Cheryl noch immer zu Hause bei seiner Mutter Christine. Doch dann lernt Philip bei Fees Hochzeit Senta Pelham, eine der fünf Brautjungfern, kennen: eine schlanke, bleiche Kindfrau mit fast farblosen Augen. Von Senta geht eine schwer fassbare Faszination aus, und Philip kann es anfangs kaum glauben, dass sie sich ihrerseits zu ihm hingezogen fühlt. Immer tiefer gerät Philip in den Bann seiner neuen Geliebten, doch was als Liebe auf den ersten Blick begann, steigert sich mit jeder Begegnung zu einer fatalen Gratwanderung. Denn Senta, von Philip heiß begehrt, verlangt von diesem einen ganz besonderen Beweis seiner Liebe …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 490
Ähnliche
Ruth Rendell
Die Brautjungfer
Buch
Philip Wardmann hasst nichts so sehr wie Gewalt. Nach dem Tod seines Vaters, eines besessenen Spielers und Wettsüchtigen, ist Philip zum Familienoberhaupt geworden. Er arbeitet in einer kleinen Firma und wohnt zusammen mit seinen beiden Schwestern Fee und Cheryl noch immer zu Hause bei seiner Mutter Christine. Doch dann lernt Philip bei Fees Hochzeit Senta Pelham, eine der fünf Brautjungfern, kennen: eine schlanke, bleiche Kindfrau mit fast farblosen Augen. Von Senta geht eine schwer fassbare Faszination aus, und Philip kann es anfangs kaum glauben, dass sie sich ihrerseits zu ihm hingezogen fühlt. Immer tiefer gerät Philip in den Bann seiner neuen Geliebten, doch was als Liebe auf den ersten Blick begann, steigert sich mit jeder Begegnung zu einer fatalen Gratwanderung. Denn Senta, von Philip heiß begehrt, verlangt von diesem einen ganz besonderen Beweis seiner Liebe …
Autorin
Ruth Rendell wurde 1930 in South Woodford/London geboren. Zunächst arbeitete sie als Journalistin, bevor sie sich ganz dem Schreiben von Romanen widmete. Dreimal bereits erhielt sie den Edgar-Allan-Poe-Preis und zweimal den Golden Dagger Award. 1997 wurde sie mit dem Grand Master Award der Crime Writer‘s Association of America, dem renommiertesten Krimipreis, ausgezeichnet und darüber hinaus von Königin Elizabeth II. in den Adelsstand erhoben. Ruth Rendell, die auch unter dem Pseudonym Barbara Vine bekannt ist, lebt in London.
Die Reihenfolge der Inspector-Wexford-Romane sowie weitere Romane finden Sie hier.
Ruth Rendell
Die Brautjungfer
Roman
Aus dem Englischen von Christian Spiel
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.Die Originalausgabe erschien unter dem Titel The Bridesmaid bei Hutchinson, London.
E-Book-Ausgabe 2015
bei Blanvalet, einem Unternehmen der
Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Copyright © der Originalausgabe 1989 by Kingsmarkham Enterprises Ldt.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 1990 by Blanvalet Verlag GmbH, München
Umschlaggestaltung: www.buerosued.de
Umschlagmotiv: Arcangel Images/Lenny Carter
Satz: EDV-Fotosatz Huber/Verlagsservice G. Pfeifer, Germering
ISBN: 978-3-641-15132-4V002
www.blanvalet.de
Für Don
1
_____
Ein gewaltsamer Tod fasziniert die Leute. Auf Philip hingegen wirkte Gewalt abstoßend. Er hatte geradezu eine Phobie dagegen. Jedenfalls nannte er es sich selbst gegenüber manchmal so, eine Phobie gegen Mord und Totschlag in jeglicher Form, gegen die willkürliche Vernichtung menschlichen Lebens im Krieg und seine sinnlose Vernichtung durch Unfälle. Physische Gewalt verstörte ihn, in der Realität, auf dem Bildschirm, in Büchern. So empfand er schon, seit er ein kleiner Junge gewesen war und andere Kinder mit Spielzeugpistolen aufeinander gezielt und Totschießen geübt hatten. Wann es begonnen oder was es ausgelöst hatte, das wusste er nicht. Dabei war er seltsamerweise nicht feige oder überempfindlich, und er hatte nicht mehr oder weniger Angst als alle anderen auch. Es war nur so, dass ein unnatürlicher Tod für ihn weder unterhaltsam war, noch einen makabren Reiz hatte. So entzog er sich nach Möglichkeit derlei Dingen, in welcher Form auch immer. Er wusste, dass das ungewöhnlich war. Und so verbarg er seine Phobie oder versuchte es wenigstens.
Wenn die anderen fernsahen, saß er dabei, ohne die Augen zu schließen. Auch zog er nicht über Zeitungen und Romane her. Aber alle kannten seine Gefühle, auch wenn sie keinen besonderen Respekt davor hatten. Sie sprachen dennoch über Rebecca Neave.
Philip selbst hätte sich für ihr Verschwinden nicht interessiert und noch viel weniger Spekulationen darüber angestellt. Er hätte den Apparat abgeschaltet. Wahrscheinlich hätte er ihn schon zehn Minuten vorher abgeschaltet, um sich Nordirland, den Iran, Angola und das Zugunglück in Frankreich genauso zu ersparen wie das Mädchen, das verschwunden war. Er hätte sich niemals das Foto ihres hübschen Gesichts angesehen, den lächelnden Mund, die im grellen Sonnenlicht zusammengekniffenen Augen, das im Wind wehende Haar.
Rebecca Neave war an einem Herbstnachmittag gegen drei Uhr verschwunden. Ihre Schwester hatte an jenem Mittwochvormittag mit ihr telefoniert, und ein Mann, der seit kurzem mit ihr befreundet und gerade viermal mit ihr ausgegangen war, hatte sie an diesem Tag mittags angerufen. Das war das letzte Mal gewesen, dass jemand ihre Stimme hörte. Eine Nachbarin hatte gesehen, wie sie den Wohnblock verließ, in dem sie lebte. Sie trug einen hellgrünen Trainingsanzug aus Samt und weiße Turnschuhe. Das war das letzte Mal, dass jemand sie zu Gesicht bekommen hatte.
Als das Foto des Mädchens auf dem Bildschirm erschien, sagte Fee: »Sie war auf meiner Schule. Der Name kam mir gleich bekannt vor. Rebecca Neave. Ich wusste, dass ich ihn schon mal gehört hatte.«
»Du hast nie erwähnt, dass du eine Freundin hattest, die Rebecca heißt.«
»Wir waren keine Freundinnen, Cheryl. Wir waren dreitausend an dieser Schule. Ich glaube nicht, dass ich irgendwann einmal mit ihr gesprochen habe.« Fee starrte auf den Bildschirm, während ihr Bruder ebenso angestrengt versuchte, nicht hinzusehen. Er hatte die Zeitung zur Hand genommen und eine Innenseite aufgeschlagen, zu der die Rebecca-Neave-Story nicht vorgedrungen war.
»Die Polizei nimmt sicher an, dass sie ermordet wurde«, sagte Fee.
Rebecca Neaves Mutter erschien auf dem Bildschirm und bat die Zuschauer um Hinweise auf ihre verschollene Tochter. Rebecca war dreiundzwanzig. Sie hatte einen Töpferkurs für Erwachsene gegeben, sich aber zur Aufbesserung ihres Einkommens in einem Inserat als Babysitter und Haushüter angeboten. Es erschien denkbar, dass sich auf ihr Inserat hin jemand telefonisch gemeldet hatte. Rebecca hatte für jenen Abend eine Verabredung getroffen und war dann hingegangen. Jedenfalls nahm ihre Mutter das an.
»Ach, die arme Frau«, sagte Christine, die gerade mit Kaffee auf einem Tablett hereinkam. »Was sie durchmachen muss! Ich kann mir gut vorstellen, wie mir zumute wäre, wenn es um einen von euch ginge.«
»Nun ja, um mich brauchst du keine Angst zu haben«, sagte Philip, der kräftig gebaut, wenn auch mager, und beinahe einen Meter fünfundneunzig groß war. Er sah seine Schwester an. »Kann ich das jetzt abschalten?«
»So was hältst du nicht aus, was?« Cheryl hatte einen finsteren Gesichtsausdruck und gab sich nur selten Mühe, freundlicher dreinzublicken. »Vielleicht ist sie gar nicht ermordet worden. Jedes Jahr verschwinden Hunderte von Leuten.«
»Da steckt sicher mehr dahinter, als wir ahnen«, sagte Fee. »Die würden keinen solchen Wirbel machen, wenn sie nur einfach fortgegangen wäre. Komisch, jetzt fällt mir ein, dass sie im gleichen Werkkurs für die Abschlussprüfung war wie ich. Sie wollte weitermachen und Lehrerin werden, und die anderen fanden das alle komisch, weil sie nichts anderes im Kopf hatten, als zu heiraten. Komm, schalt schon ab, Phil, wenn du willst. Über Rebecca kommt sowieso nichts mehr.«
»Warum können sie eigentlich keine guten Nachrichten bringen?« fragte Christine. »Man sollte denken, die wären genauso sensationell. Es kann doch nicht sein, dass es keine guten Nachrichten gibt, oder?«
»Katastrophen haben eben Nachrichtenwert«, sagte Philip. »Aber vielleicht wäre es keine schlechte Idee, es zur Abwechslung auch mal anders zu versuchen. Etwa mit einer Liste, wer an einem bestimmten Tag alles Glück im Unglück hatte – all die Leute, die vor dem Ertrinken gerettet wurden, all jene, die in einen Autounfall verwickelt waren und überlebt haben.« In einem düsteren Ton setzte er hinzu: »Mit einer Liste von Kindern, die nicht misshandelt wurden, und von Mädchen, die Sittenstrolchen entkommen sind.«
Er schaltete den Apparat ab. Es war eine Wohltat zu sehen, wie das Bild kleiner wurde und rasch verschwand. Fee hatte sich an Rebecca Neaves Verschwinden zwar nicht gerade geweidet, aber darüber zu spekulieren gab ihr offensichtlich viel mehr, als über eine von Christines »guten Nachrichten« zu sprechen. Er machte einen ziemlich angestrengten Versuch, über etwas anderes zu reden.
»Um welche Zeit sollen wir uns morgen auf den Weg machen?«
»Aha, Themawechsel! Wie ähnlich dir das sieht, Phil.«
»Er hat gesagt, wir sollen gegen sechs bei ihm sein.« Christine blickte ziemlich schüchtern ihre Töchter und dann Philip an. »Könnt ihr alle bitte mal auf einen Sprung mit in den Garten hinauskommen? Wollt ihr? Ich hätte gern euren Rat.«
Es war ein kleiner, armseliger Garten, der noch am besten um diese Tageszeit wirkte, wenn die Sonne unterging und die Schatten lang waren. Eine Reihe Leylandzypressen machte es den Nachbarn unmöglich, über den Zaun am anderen Ende zu blicken. In der Mitte des Rasens war eine runde Betonplatte zu sehen, auf der nebeneinander ein Vogelbad und eine Statue standen. Die Platte war zwar nicht mit Moos bewachsen, doch durch einen Spalt unter dem Vogelbad drängte sich Unkraut hervor. Christine legte eine Hand auf den Kopf der Statue und streichelte ihn leicht, so wie sie vielleicht ein Kind liebkost hätte. Dabei sah sie ihre Kinder auf ihre besorgte Art an, halb schüchtern, halb tapfer.
»Was würdet ihr dazu sagen, wenn ich ihm Flora schenken würde?«
Fee zögerte selten, hatte immer entschiedene Ansichten. »Man kann jemand doch keine Statue schenken.«
»Warum nicht, wenn sie ihm gefällt?« sagte Christine.
»Er hat gesagt, sie gefällt ihm, und sie würde sich in seinem Garten nett ausnehmen. Angeblich erinnert sie ihn an mich.«
Als hätte ihre Mutter kein Wort von sich gegeben, sagte Fee: »Man schenkt jemand Pralinen oder eine Flasche Wein.«
»Er hat mir Wein mitgebracht.« Christine sagte es in einem staunenden, hocherfreuten Ton, als wäre es besonders aufmerksam und großzügig, eine Flasche Wein mitzubringen, wenn man bei einer Frau zum Abendessen eingeladen ist. Sie fuhr mit der Hand über Floras Marmorschulter. »Sie hat mich immer an eine Brautjungfer erinnert. Wohl wegen der Blumen.«
Philip hatte das Mädchen aus Marmor noch nie genauer betrachtet. Flora, das war einfach die Statue, die bei ihnen neben dem Teich im Garten stand, solange er zurückdenken konnte. Sein Vater, so war ihmgesagt worden, hatte sie auf der Hochzeitsreise mit Christine gekauft. Sie war gut einen Meter groß, dieMiniaturkopie einer römischen Statue. In der linken Hand hielt sie einen Blumenstrauß, mit der andern griff sie nach dem Saum ihres Gewands und hob ihn über den rechten Fußknöchel. Sie stand zwar mit beiden Füßen auf dem Boden, schien aber in einemgemessenen Rhythmus zu gehen oder zu tanzen. Doch besonders schön an ihr war das Gesicht. Während Philip sie ansah, wurde ihm bewusst, dass er die Gesichter antiker Statuen, griechischer wie römischer, im Allgemeinen nicht sonderlich attraktiv fand. Die schweren Unterkiefer und die langen, gerade in die Stirn übergehenden Nasen gaben ihnen einen abweisenden Ausdruck. Vielleicht hatten sich die Schönheitsideale eben geändert. Vielleicht sprach ihn auch etwas Zarteres mehr an. Doch Flora hatte ein Gesicht, wie es ein schönes Mädchen von heute hätte haben können: die ausgeprägten Wangenknochen, die kurze Oberlippe und der Mund, die reizendste Vereinigung zart geschürzter Lippen. Ihr Gesicht war wie das eines lebendigen Mädchens, wenn man von Floras Augen absah. Sie standen extrem weit auseinander und schienen mit einem entrückten und heidnischen Ausdruck zu fernen Horizonten zu schauen.
»Ich finde schon seit einer Ewigkeit, dass sie für hier zu gut ist«, sagte Christine. »Sie wirkt albern. Nein, eigentlich meine ich, sie lässt das übrige albern erscheinen.«
Sie hatte recht. Die Statue war zu gut für ihre Umgebung. »Wie wenn man Champagner in einen Plastikbecher schüttet«, sagte Philip.
»Du sagst es.«
»Von mir aus kannst du sie verschenken«, sagte Cheryl. »Sie gehört schließlich dir, nicht uns. Papi hat sie dir geschenkt.«
»Ich sehe es so, dass all das auch euch gehört«, sagte Christine. »Er hat einen hübschen Garten, sagt er. Ich glaube, ich sähe Flora lieber in einem Rahmen, der ihr angemessen ist. Versteht ihr, was ich meine?«
Sie sah Philip an. Trotz aller Bekehrungsversuche seitens ihrer Töchter war sie von der Gleichheit der Geschlechter nicht zu überzeugen; selbst der Druck, der von Presse und Fernsehen ausging, vermochte nicht, sie eines Besseren zu belehren. Da ihr Ehemann tot war, erwartete sie von ihrem Sohn, nicht von ihrem ältesten Kind, Ratschläge, Urteile, Entscheidungen.
»Wir nehmen sie morgen mit«, sagte Philip.
Damals schien es keine sehr wichtige Angelegenheit zu sein. Warum auch? Es erschien nicht als einer jener gravierenden Entschlüsse wie die Entscheidung, ob man heiraten, ein Kind bekommen, den Beruf wechseln oder die lebensnotwendige Operation auf sich nehmen soll oder nicht. Und doch war es ebenso bedeutsam wie all dies.
Natürlich sollte viel Zeit vergehen, bis Philip es in diesem Licht sah. Um Floras Gewicht zu prüfen, hob er sie ein paar Zentimeter an. Sie war so schwer, wie er erwartet hatte. Plötzlich ertappte er sich bei dem Gedanken dass Flora irgendwie ein Symbol für seine Mutter sei, die einst sein Vater für sich gewonnen hatte und die nun an Arnham übergehen sollte. Hieß das, dass Christine sich mit dem Gedanken trug, ihn zu heiraten? Die beiden hatten sich bei der letzten Weihnachtsfeier im Büro von Philips Onkel kennengelernt, und es war eine ausgedehnte Werbung gewesen, wenn man von Werbung überhaupt sprechen konnte. Das hatte seinen Grund zum Teil darin, dass Arnham so oft für seine Firma ins Ausland reiste. Soweit Philip wusste, war Arnham nur ein einziges Mal in ihrem Haus gewesen. Und jetzt gingen sie zu ihm, um ihn kennenzulernen. Offensichtlich nahmen die Dinge eine ernstere Wendung.
»Ich denke, es ist gescheiter, wir nehmen Hardy nicht mit«, sagte Philips Mutter. Der kleine Hund, ein Jack Russell, den Christine nach dem Modeschöpfer Hardy Amiens getauft hatte, weil sie dessen Kreationen liebte, war in den Garten gekommen und stand jetzt dicht neben ihr. Sie beugte sich hinab und tätschelte ihn zärtlich auf den Kopf. »Er mag keine Hunde. Nicht, dass er grausam oder sonst was zu Hardy wäre.« Sie sprach, als ob sich mit einer Abneigung gegen Hunde häufig die Bereitschaft verbände, sie zu quälen. »Er macht sich einfach nicht viel aus Hunden. Als er damals hier war, habe ich gleich gemerkt, dass er Hardy nicht mochte.«
Als Philip ins Haus zurückging, sagte Fee: »Flora hat mich daran erinnert, dass Rebecca Neave einmal einen Mädchenkopf gemacht hat.«
»Wie meinst du das – einen Mädchenkopf gemacht?«
»In der Schule. Im Töpferkurs. Sie hat ihn aus Ton gemacht. In Lebensgröße. Die Lehrerin hat darauf bestanden, dass sie ihn wieder zerbrach. Sie wollte ihn nicht brennen lassen, weil wir Tontöpfe machen sollten. Und jetzt, man muss sich das vorstellen, liegt vielleicht irgendwo in einem Winkel ihre Leiche.«
»Danke, das stell’ ich mir lieber nicht vor. Diese Dinge faszinieren mich nicht so wie dich.«
Fee nahm Hardy auf den Schoß. Um diese Stunde kam er immer bettelnd an, weil er hoffte, dass ihn jemand spazieren führen würde. »Es ist nicht so, dass es mich fasziniert, Phil. Wir interessieren uns alle für Mord und Gewalt und Verbrechen. Angeblich kommt das davon, dass wir selbst den Trieb dazu in uns haben. Wir sind alle zu einem Mord fähig, wir alle wollen manchmal auf andere Leute losgehen, sie schlagen, ihnen weh tun.«
»Ich nicht.«
»Er wirklich nicht, Fee«, sagte Cheryl. »Das weißt du doch. Und er mag es auch nicht, wenn man darüber spricht. Also halt die Klappe.«
Er trug Flora, weil er der einzige Mann in der Familie und deshalb, wie anzunehmen, vermutlich am kräftigsten war. Ohne einen Wagen war es eine schreckliche Plackerei von Cricklewood bis nach Buckhurst Hill. Sie hatten den Bus zur U-Bahn-Station Kilburn genommen, waren von dort zur Bond Street gefahren und hatten dann eine Ewigkeit auf einen Zug der Circle Line gewartet. Kurz vor vier Uhr hatten sie das Haus verlassen, und jetzt war es zehn Minuten vor sechs.
Philip war noch nie in dieser Gegend gewesen, wo London in die Grafschaft Essex überging. Sie erinnerte ihn ein wenig an Barnet, wo es sich angenehm gelebt und offenbar immer die Sonne geschienen hatte. An der Straße, die sie entlanggingen, standen zwar Häuser, aber sie waren hinter Hecken und Bäumen verborgen, so dass man den Eindruck eines Landsträßchens hätte gewinnen können. Seine Mutter und die Schwestern waren jetzt vor ihm, und er ging rascher, wobei er Flora auf die andere Seite hievte. Cheryl, die nichts zu tragen hatte, aber zu ihren hautengen Jeans Schuhe mit hohen Absätzen anhatte, jammerte: »Ist’s noch weit, Mami?«
»Ich weiß es nicht, Kind. Ich weiß nur, was Gerard mir gesagt hat: die Anhöhe hinauf und die vierte Straße nach rechts abbiegen. Es ist eine sehr nette Gegend, findet ihr nicht auch?« Christine benutzte immerfort das Wort »nett«. Es war ihr Lieblingswort.
Sie hatte ein rosafarbenes Leinenkleid mit einer weißen Jacke an. Sie trug eine weiße Perlenkette und rosa Lippenstift und sah aus wie jene Art von Frau, die schwerlich lange ohne Mann blieb. Ihr Haar war weich und locker, und die Sonnenbrille verbarg die Fältchen unter den Augen. Philip hatte bemerkt, dass sie zwar ihren Ehering trug – er hatte sie nie ohne ihn gesehen –, den Verlobungsring aber abgezogen hatte. Sie hatte vermutlich irgendeinen geheimen, verrückten Grund dafür, etwa den, dass ein Verlobungsring die Liebe eines lebenden Gatten symbolisiere, Eheringe hingegen für verheiratete Frauen und ebenso für Witwen ein gesellschaftliches Muss seien. Fee trug natürlich ihren eigenen Verlobungsring. Um ihn besser zur Geltung kommen zu lassen, hielt sie ein winziges Täschchen in der linken Hand. Das strenge, dunkelblaue Kostüm mit dem zu langen Rock ließ sie älter erscheinen, als sie war, zu alt, würde Arnham vielleicht denken, um Christines Tochter sein zu können.
Philip hatte sich keine besondere Mühe mit seinem Äußeren gegeben. Er hatte sich darauf konzentriert, Flora für den Transport herzurichten. Christine hatte ihn gebeten, doch zu versuchen, ob er nicht den grünen Fleck auf dem Marmor wegbekam, und er hatte sich, freilich vergebens, mit Seife und Wasser ans Werk gemacht. Sie hatte ihm Seidenpapier zum Einwickeln der Statue gebracht. Philip hatte sie außerdem noch mit Zeitungspapier verpackt; mit der Morgenzeitung, auf deren Titelseite die Rebecca-Neave-Story ausgewalzt war. Dort war ein weiteres Foto der Verschwundenen und ein Bericht über einen vierundzwanzigjährigen, ungenannten Mann zu finden gewesen, der den ganzen vorigen Tag damit verbracht hatte, der Polizei »bei ihren Ermittlungen zu helfen«. Philip hatte die Statue rasch in die Zeitung gerollt und sie dann in die Plastiktüte gesteckt, in der Christines Regenmantel von der Reinigung gekommen war.
Das war vielleicht keine so glückliche Idee gewesen, denn das Paket war dadurch gefährlich glatt geworden. Es rutschte immerfort nach unten und musste dann wieder hochgezogen werden. Die Arme schmerzten ihm von den Schultern bis zu den Handgelenken. Endlich waren die vier in die Straße eingebogen, in der Arnham wohnte. Die Häuser standen hier nicht für sich, wie damals ihres in Barnet, sondern klebten in gebogenen Linien aneinander, Reihenhäuser mit Gärten voller Sträucher und Herbstblumen. Philip sah jetzt schon, dass einer dieser Gärten ein passenderes Ambiente für Flora abgeben würde. Arnhams Haus war dreistöckig, mit Stabjalousien an den Fenstern und einem Löwenkopf aus Messing als Klopfer an der dunkelgrünen, georgianischen Haustüre. Christine blieb staunend am Gartentor stehen.
»Was für ein Jammer, dass er es verkaufen muss! Aber da lässt sich wohl nichts machen. Er muss das Geld mit seiner Exfrau teilen.«
Es war eine Unglücksfügung, dachte Philip später, dass Arnham die Haustüre gerade in dem Augenblick öffnete, als Cheryl mit lauter Stimme sagte: »Ich dachte, seine Frau ist gestorben! Ich wusste nicht, dass er geschieden ist. Ist das nicht schauerlich!«
Nie sollte Philip vergessen, wie er Gerard Arnham zum ersten Mal sah. Nach seinem ersten Eindruck war der Mann, den sie besuchen wollten, keineswegs davon angetan, sie zu sehen. Er war mittelgroß, kräftig gebaut, doch nicht dick. Sein Haar war grau, aber dicht und glänzte, und er sah gut aus, auf eine, wie Philip fand – ohne erklären zu können, warum –, italienische oder griechische Art. Seine wohlgestalteten Züge waren fleischig und seine Lippen voll. Er trug eine cremefarbene Freizeithose, ein weißes Hemd mit offenem Kragen und eine leichte Jacke mit großen, doch nicht übergroßen Karos, dunkelblau, cremefarben und braun. Der Ausdruck auf seinem Gesicht wechselte von Bestürzung zu einem Nicht-fassen-Können, das bewirkte, dass er kurz die Augen schloss.
Er öffnete sie rasch wieder, kam die Stufen herab und verbarg, was ihn aus der Fassung gebracht hatte, unter jovialer Höflichkeit. Philip erwartete, dass er Christine küssen würde, und Christine erwartete es vielleicht auch, denn sie hob das Gesicht, als sie auf ihn zutrat. Aber er küsste sie nicht. Stattdessen gab er allen die Hand. Philip stellte Flora auf einer Stufe ab, während sie sich begrüßten.
Christine sagte: »Das ist Fee, meine Älteste. Sie wird nächstes Jahr heiraten, wie ich dir erzählt habe. Und das ist Philip, der vor kurzem sein Diplom gemacht hat und in der Ausbildung als Innenarchitekt steht, und das ist Cheryl – sie hat gerade die Schule abgeschlossen.«
»Und wer ist das?« fragte Arnham.
So wie Philip die Statue abgesetzt hatte, wirkte sie wie ein fünftes Mitglied ihrer Gruppe. Ihre Verpackung löste sich auf, und der Kopf und ein Arm ragten aus dem Loch in der Plastiktüte. Ihr gelassen-heiteres Gesicht, aus dem die Augen immer an einem vorbei in die Ferne zu blicken schienen, war nun völlig freigelegt, ebenso die rechte Hand, in der sie den Strauß Marmorblumen hielt. Der grüne Fleck auf Hals und Busen trat, wie auch die Kerbe an einem ihrer Ohren, plötzlich sehr hervor.
»Du erinnerst dich an sie, Gerard. Es ist die Statue aus unserem Garten, die dir so gefallen hat. Wir haben sie dir mitgebracht. Sie gehört jetzt dir.« Als Arnham schwieg, wiederholte Christine: »Ein Geschenk. Wir haben sie dir mitgebracht, weil du gesagt hast, dass sie dir gefällt.«
Arnham war genötigt, den Begeisterten zu spielen, was ihm jedoch nicht sehr gut gelang. Sie ließen Flora draußen und gingen ins Haus. Da der Flur so eng war, mussten sie im Gänsemarsch eintreten, so dass es schien, als marschierten sie hinein. Philip war froh, dass sie wenigstens Hardy nicht mitgebracht hatten. Hier wäre ein Hund fehl am Platz gewesen.
Das Haus war wunderbar tapeziert und möbliert. Philip hatte einen Blick für so etwas. Andernfalls hätte er wahrscheinlich die Ausbildung bei Roseberry Lawn Interiors nicht begonnen. Eines Tages – eines notwendigerweise fernen Tages – würde er gern in seinem Haus einen Salon wie diesen haben, mit efeugrünen Wänden und Zeichnungen in schmalen, vergoldeten Rahmen und einem Teppich, dessen prachtvoll tiefes, weiches Gelb ihn an chinesisches Porzellan erinnerte, das er in Museen gesehen hatte.
Durch einen kleinen, gewölbten Gang konnte er ins Speisezimmer sehen. Auf einem kleinen Tisch war für zwei Personen gedeckt. Darauf standen zwei hohe, rosafarbene Gläser mit gleichfarbigen Servietten darin und eine einzige hellrote Nelke in einer ausgekehlten Vase. Ehe ihm noch richtig klarwurde, was das zu bedeuten hatte, führte Arnham sie alle nach hinten hinaus in den Garten. Er hatte Flora geholt und trug sie jetzt, dachte Philip, ganz so, als befürchtete er, sie könnte seinen Teppich beschmutzen, wobei er sie im Gehen schwenkte wie eine Tüte mit Einkäufen.
Als sie im Freien waren, legte er sie in das Blumenbeet, das den Rand eines kleinen Steingartens bildete, und verschwand mit einer Entschuldigung wieder im Haus. Die Wardmans standen auf dem Rasen. Fee sah hinter Christines und Cheryls Rücken Philip an, zog die Augenbrauen hoch und nickte jenes befriedigte Nicken, das ein »Prima!« ausdrückt. Sie wollte damit zu verstehen geben, dass sie mit Arnham einverstanden war, Philip antwortete mit einem Achselzucken. Er wandte sich ab, um noch einmal Flora anzusehen, das marmorne Gesicht, das mitnichten Christines Gesicht oder das sonst einer lebenden Frau war, die er jemals gesehen hatte. Die Nase war klassisch, die Augen standen eher zu weit auseinander, die weichen Lippen waren zu uneben, und auf dem Gesicht lag ein seltsam glasiger Ausdruck, wie unbeschwert von normalen menschlichen Ängsten, Zweifeln und Hemmungen.
Arnham kehrte mit Entschuldigungen zurück, und dann stellten sie Flora auf, in einer Position, in der sie ihr Spiegelbild im Wasser eines winzigen Teichs betrachten konnte. Sie klemmten sie zwischen zwei große, graue Steinbrocken, über die eine goldblättrige Pflanze ihre Ranken ausgebreitet hatte.
»Hier wirkt sie genau richtig«, sagte Christine. »Eigentlich schade, dass sie nicht immer auf diesem Platz bleiben kann. Du musst sie einfach mitnehmen, wenn du umziehst.«
»Ja.«
»Du wirst doch sicher wieder einen hübschen Garten haben, wo du hinziehst, oder?«
Arnham sagte nichts. Es ist durchaus möglich, dachte Philip, der seine Mutter kannte, dass sie in aller Form von Flora Abschied nimmt. Es hätte ihr ähnlich gesehen. Es hätte ihn nicht überrascht, wenn sie zu Flora Lebewohl gesagt und sie ermahnt hätte, artig zu sein. Aber sie schwieg, und die würdige Art, in der sie Arnham voran ins Haus zurückging, erfreute ihn. Er begriff. Es war nicht notwendig, sich von jemandem zu verabschieden, mit dem man schon bald für den Rest seines Lebens zusammenleben würde. Hatte außer ihm noch jemand bemerkt, dass von dem kleinen Tisch im Speisezimmer Tischtuch, Silberbesteck, die Gläser und die rosa Nelke verschwunden waren? Deswegen war Arnham wieder ins Haus gegangen – um den Tisch abzuräumen. Philip ging ein Licht auf. Christine war allein erwartet worden.
Seine Mutter und die Schwestern schienen nicht zu ahnen, dass man irgendeinen Fauxpas begangen hatte. Cheryl fläzte sich auf dem Sofa, die Beine breit auf dem Läufer ausgestreckt. Sie konnte natürlich nicht anders sitzen. Da ihre Jeans so eng und die Absätze so hoch waren, war es ihr unmöglich, die Knie abzubiegen und die Sohlen ihrer Schuhe auf den Boden zu stellen. Fee hatte sich eine Zigarette angezündet, ohne Arnham zu fragen, ob er etwas dagegen hätte. Während sie sich nach einem Aschenbecher umsah – ein Gegenstand, der inmitten der Vielfalt von Schmuckgegenständen, Tässchen und Untertassen, Porzellantieren und Miniaturvasen durch Abwesenheit glänzte – und während sie darauf wartete, dass Arnham ihr einen aus der Küche brachte, fielen die zwei Zentimeter Asche vom Ende ihrer Zigarette auf den gelben Teppich.
Arnham sagte nichts. Fee begann über die verschwundene Rebecca Neave zu sprechen. Sie war überzeugt, dass der Mann, der der Polizei bei ihren Nachforschungen geholfen hatte, jener Martin Hunt gewesen sein musste, von dem es in der Presse und im Fernsehen geheißen hatte, er habe am Tag ihres Verschwindens mit ihr telefoniert. Das sagten sie ja immer, so drückten sie sich immer aus, wenn sie andeuten wollten, dass sie den Mörder erwischt hatten, ihn jedoch noch nicht überführen konnten. Wenn die Zeitungen mehr schrieben, beispielsweise den Namen des Mannes nannten oder behaupteten, er werde des Mordes verdächtigt, würden sie möglicherweise eine Verleumdungsklage riskieren. Oder sich strafbar machen.
»Ich wette, dass die Polizei ihn gnadenlos in die Mangel genommen hat. Vermutlich haben sie ihn geprügelt. Es gehen ja alle möglichen Dinge vor sich, von denen wir keine Ahnung haben, ist’s nicht so? Sie wollten ein Geständnis von ihm, weil sie oft zu doof sind, wirkliche Beweise zu finden, wie es die Detektive in den Krimis schaffen. Sie haben ihm sicher nicht abgenommen, dass er nur viermal mit ihr ausgegangen ist. Und der Fall ist schwierig für sie, weil sie keine Leiche haben. Sie wissen ja nicht mal mit Gewissheit, ob sie ermordet worden ist. Deswegen brauchen sie ein Geständnis. Sie müssen ein Geständnis erzwingen.«
»Unsere Polizei ist so maßvoll und zivilisiert wie keine andere auf der Welt«, sagte Arnham steif.
Statt ein Wort dagegen zu sagen, lächelte Fee leicht und zog die Schultern hoch. »Wenn eine Frau umgebracht wird, ist es für die Polizei selbstverständlich, dass es der Ehemann war, falls sie einen hat, oder ihr Freund. Finden Sie das nicht schrecklich?«
»Müssen wir uns darüber den Kopf zerbrechen?« fragte Christine. »Wen interessieren denn schon diese abstoßenden Dinge?«
Fee achtete nicht auf sie. »Wenn man mich fragt, war es die Person, die sie wegen ihres Inserats angerufen hat. Es war irgendein Verrückter, der anrief, sie in sein Haus lockte und umbrachte. Ich nehme an, die Polizei glaubt, dass es Martin Hunt war, der seine Stimme verstellt hat.«
Philip meinte, auf Arnhams Gesicht Widerwillen und vielleicht einen gelangweilten Ausdruck zu entdecken, aber vielleicht war das nur eine Projektion seiner eigenen Gefühle. Er riskierte es, von Fee des Themenwechsels beschuldigt zu werden, und sagte rasch: »Ich habe vorhin dieses Bild bewundert.« Er deutete auf eine recht eigenartige Landschaft über dem Kamin. »Ist es ein Samuel Palmer?«
Natürlich meinte er einen Druck. Jeder andere hätte gewusst, dass er das meinte, aber Arnham sagte mit ungläubigem Ausdruck: »Das kann ich mir nicht vorstellen, wenn Samuel Palmer der sein sollte, den ich meine. Meine geschiedene Frau hat es auf einem Flohmarkt gekauft.«
Philip wurde rot. Ohnedies hatten seine Bemühungen die Flut von Fees Kriminalgeschichte nicht aufhalten können. »Sie ist wahrscheinlich bereits tot, und sie haben die Leiche gefunden, halten es aber noch geheim, weil sie ihre Gründe haben. Um jemandem eine Falle zu stellen.«
»Wenn das zutrifft«, sagte Arnham, »dann kommt es spätestens ans Licht, wenn die gerichtliche Untersuchung zur Klärung der Todesursache eingeleitet wird. In unserem Land hält die Polizei nichts geheim.«
Nun sprach Cheryl, die kein Wort von sich gegeben hatte, seit sie aus dem Garten hereingekommen war. »Wem wollen Sie denn das weismachen?«
Arnham gab keine Antwort darauf. Er sagte sehr steif: »Möchten Sie etwas trinken?« Sein Blick schweifte über sie hinweg, als wären nicht vier, sondern ein Dutzend Leute im Raum. »Möchte irgendjemand von Ihnen etwas trinken?«
»Was haben Sie denn da?« Das war Fee. Philip konnte sich gut vorstellen, dass man Leute wie Arnham so etwas nicht fragte, während in den Kreisen, in denen Fee und Cheryl verkehrten, vermutlich überhaupt nichts dabei war.
»Alles, was Sie sich vorstellen können.«
»Kann ich dann einen Bacardi mit Coke haben?«
Gerade das hatte er natürlich nicht anzubieten. Er gab ihnen Getränke zweiter Wahl, Sherry, Gin Tonic. Obwohl Philip wusste, wie seltsam unempfindlich Christine sein konnte, erstaunte es ihn doch, dass sie anscheinend nicht merkte, wie frostig die Atmosphäre geworden war. Mit einem Glas Bristol Cream in der Hand führte sie das Gespräch fort, wie er selbst es begonnen hatte, und äußerte sich bewundernd über verschiedene Möbelstücke und Ziergegenstände. Das und jenes war nett, alles war sehr nett, besonders nett waren die Teppiche, und von so guter Qualität. Philip wunderte sich, wie durchsichtig sich alles anhörte. Sie sprach wie jemand, den Dankbarkeit für ein unerwartet generöses Geschenk erfüllte.
Arnham ging schroff darüber hinweg und sagte: »Es muss alles verkauft werden. Gemäß einer richterlichen Anordnung muss alles verkauft und der Erlös zwischen meiner ehemaligen Frau und mir aufgeteilt werden.« Er holte tief Luft, was sich stoisch anhörte. »Und jetzt schlage ich vor, dass Sie sich alle von mir zum Essen ausführen lassen. Ich glaube nicht, dass wir hier etwas auf die Beine stellen können. Das Steakhause nicht weit von hier – wäre das das richtige?«
Er fuhr sie in seinem Jaguar hin. Es war ein großer Wagen, in dem sie alle ohne Schwierigkeiten Platz fanden. Philip dachte, er müsste eigentlich dankbar dafür sein, dass Arnham sie ausführte und einlud, aber er war es nicht. Er fand, es wäre besser gewesen, wenn Arnham mit der Wahrheit herausgerückt wäre, wenn er gesagt hätte, er habe nur mit Christine gerechnet, und mit ihr allein gegessen hätte, wie er es ursprünglich vorgehabt hatte. Ihm und Fee und Cheryl hätte es nichts ausgemacht, es wäre ihnen – auf jeden Fall ihm selbst – lieber gewesen, als hier in der schummrigen Atmosphäre mit dem Kerzenlicht, der Pseudogutshausdekoration eines zweitklassigen Restaurants über einem Supermarkt zu sitzen und mühsam mit jemandem Konversation zu machen, der sich offenkundig danach sehnte, dass sie endlich nach Hause aufbrachen.
Leuten aus Arnhams Generation fehlt es an Offenheit, dachte Philip. Sie sind nicht ehrlich. Sie sind unaufrichtig. Christine war genauso, sie würde nicht sagen, was sie dachte, sie würde es ungehörig finden. Er konnte es nicht hören, wie sie jedes Gericht, das serviert wurde, in Tönen pries, als hätte Arnham es selbst gekocht. Nun, da er nicht mehr bei sich zu Hause war, war Arnham viel umgänglicher geworden. Er unterhielt sich in liebenswürdigem Ton, fragte Cheryl aus, was sie nach ihrem Schulabschluss vorhabe, fragte Fee nach ihrem Verlobten und womit er sein Geld verdiene. Er schien seine anfängliche Enttäuschung oder Verärgerung überwunden zu haben. Das Interesse, das er an ihr zeigte, veranlasste Cheryl, über ihren Vater zu sprechen, das unpassendste aller denkbaren Gesprächsthemen, wie Philip fand. Aber Cheryl hatte Stephen näher gestanden als seine anderen beiden Kinder. Sie hatte seinen Tod auch jetzt noch nicht verwunden.
»O ja, es stimmt durchaus, er war so«, sagte Christine, mit einer Spur Verlegenheit in der Stimme, nachdem Cheryl über die Spielleidenschaft ihres Vaters gesprochen hatte. »Aber denke dir nichts, niemand hatte darunter zu leiden. Er hätte nie zugelassen, dass es seiner Familie schlechtgegangen wäre. Im Gegenteil, wir haben davon profitiert, nicht? Viele von den netten Dingen, die wir haben, verdanken wir der Tatsache, dass er gespielt hat.«
»Mamis Hochzeitsreise ist mit Papis Gewinn beim Derby finanziert worden«, sagte Cheryl. »Aber mit Pferden war es bei Papi nicht getan, stimmt’s, Mami? Er hat auf alles gewettet. Wenn man mit ihm zusammen auf einen Bus gewartet hat, hat er gewettet, welcher zuerst käme, der Sechzehner oder der Zweiunddreißiger. Wenn das Telefon klingelte, hat er immer gesagt: ›Fünfzig Pence, dass es eine Männerstimme ist, Cheryl, oder fünfzig Pence darauf, dass es eine Frau ist.‹ Ich bin oft mit ihm zum Windhundrennen gegangen, das fand ich toll, es war so irre, dazusitzen und ein Coke zu trinken oder vielleicht etwas zu essen und den Hunden zuzuschauen, wie sie um die Bahn herumhetzten. Er ist nie sauer geworden, mein Paps. Wenn er gespürt hat, dass seine Stimmung schlecht wurde, sagte er jedes Mal: ›Okay, worauf wollen wir wetten? Auf dem Rasen sind zwei Vögel, eine Amsel und ein Sperling. Ein Pfund, dass der Sperling als erster wegfliegt.‹«
»Das Spielen war sein ein und alles«, sagte Christine mit einem Seufzer.
»Und wir!« sagte Cheryl heftig. Sie hatte zwei Glas Wein getrunken, der ihr zu Kopf gestiegen war. »Wir kamen zuerst, dann das Spielen.«
Es war wahr. Selbst seine Arbeit war, sozusagen, Glücksspiel gewesen, Börsenspekulation, bis eines Tages, während er dasaß, den Telefonhörer in der einen, eine Zigarette in der anderen Hand, sein Herz nicht mehr mitmachte und zu schlagen aufhörte – vielleicht das zwangsläufige Ende eines mit Sorgen und Stress, Kettenrauchen, langen Tagen und kurzen Nächten verbrachten Lebens. Wegen des Herzleidens, an dem er schon lange laborierte, das er aber seiner Frau und den Kindern verheimlicht hatte, hatte er keine Lebensversicherung, kaum Rücklagen irgendwelcher Art, und auf dem Haus in Barnet lag eine Hypothek, die nicht durch eine Versicherungspolice gedeckt war. Ohne begründeten Anlass hatte er damit gerechnet, noch Jahre zu leben und in dieser Zeit durch Spekulationen und andere Formen des Hasardspiels ein Vermögen zusammenzubringen, von dem seine Familie leben konnte, wenn er einmal nicht mehr da war.
»Wir haben sogar Flora durch eine Wette bekommen«, sagte Christine gerade. »Wir waren auf unserer Hochzeitsreise in Florenz, gingen durch eine Straße voller Antiquitätenläden, und ich sah Flora in einem Schaufenster und sagte, wie hübsch sie sei. Das Haus, das wir uns gebaut hatten, hatte einen kleinen Garten, und ich konnte mir Flora gut neben unserem Teich vorstellen. Cheryl, erzähl doch Gerard die Geschichte so, wie Papi sie dir erzählt hat.«
Philip bemerkte, dass Arnham recht interessiert war, dass er lächelte. Schließlich hatte er seine geschiedene Frau erwähnt, warum also sollte Christine nicht über ihren verstorbenen Mann sprechen?
»Mami sagte, sie wäre sicher schrecklich teuer, aber Paps hat sich nie viel Gedanken gemacht, wenn etwas viel kostete. Er sagte, sie sehe Mami ähnlich, obwohl ich das eigentlich nicht finde, oder Sie?«
»Ein bisschen vielleicht«, sagte Arnham.
»Jedenfalls, sie gefiel ihm, weil sie wie Mami aussah. Er sagte zu ihr: ›Hör zu, lass uns wetten. Wetten, es ist Venus, wetten, dass es die Göttin Venus ist? Wenn nicht, kaufe ich sie dir. ‹«
»Ich habe Venus für einen Stern gehalten«, sagte Christine.
»Stephen sagte, nein, eine Göttin. Cheryl kennt sich aus, sie hat das alles auf der Schule gehabt.«
»Also, sie sind in den Laden reingegangen, und der Mann dort drinnen hat Englisch gesprochen und zu Paps gesagt, dass es nicht Venus sei. Venus hat oberhalb der Taille fast nie was an, sozusagen topless …«
»Das ist doch nicht nötig, Cheryl!«
»Paps hat sich nichts dabei gedacht, es mir zu erzählen – es handelt sich ja um Kunst, oder nicht? Der Mann in dem Laden hat gesagt, es wäre eine Kopie der Farnesischen Flora. Flora, das war die Göttin des Frühlings und der Blumen, und ihre eigenen Blumen waren die Weißdornblüten. Solche hält sie in der Hand. Jedenfalls, Paps musste sie also kaufen, und sie hat ein Heidengeld gekostet, Hunderttausende von dem, wie das Geld dort heißt, und sie mussten sie nach Hause schicken lassen, weil sie sie nicht ins Flugzeug mitnehmen konnten.«
Die Unterhaltung war zu ihrem Ausgangspunkt zurückgekehrt, als Arnham die Statue als Geschenk präsentiert worden war. Das war vielleicht für ihn das Signal, die Rechnung zu verlangen. Als Cheryl mit ihrer Geschichte fertig war, sagte er: »Ihr gebt mir das Gefühl, dass ich sie nicht hätte annehmen sollen«. Er schien im Kopf Zahlen zu addieren, vielleicht Lire umzurechnen. »Nein, ich kann sie wirklich nicht annehmen. Sie ist viel zu wertvoll.«
»Doch, Gerard, ich möchte, dass du sie bekommst.« Sie waren inzwischen draußen vor dem Restaurant, als Christine das sagte. Es war dunkel. Philip bekam die Worte mit, obwohl Arnham und Christine ein bisschen abseits von ihnen gingen. Christine hatte seine Hand genommen. Oder war es umgekehrt? »Es liegt mir sehr daran, dass du sie bekommst. Bitte. Es macht mich glücklich, wenn ich daran denke, dass sie hier ist.«
Wie war er darauf gekommen, dass Arnham sie nur bis zur U-Bahn-Station Buckhurst Hill bringen wollte. Kein Wort war darüber gefallen. Vielleicht war er wirklich in Christine verliebt und fand es selbstverständlich, sich diese Mühe zu machen. Oder vielleicht fühlte er sich Floras wegen verpflichtet. Philip hatte den Eindruck, dass die anfängliche Befangenheit ziemlich verschwunden war. Christine saß vorne und plauderte über die Gegend und darüber, wo sie früher gewohnt hatten und ob sie in ihren alten Beruf als Friseuse zurückkehren sollte oder nicht, da es Zeit war, dass »ein bisschen mehr Geld ins Haus« kam. Das war alles sehr naiv vorgetragen, aber Philip zuckte zusammen. Es wirkte, als ob sie sich ihm an den Hals warf. Sie wolle aber eigentlich abwarten, »was sich tut«, ehe sie sich endgültig entschloss, es bei sich zu Hause als private Friseuse zu versuchen.
Arnham sprach recht vergnügt über seine eigenen Pläne. Das Haus und das gesamte Mobiliar mussten verkauft werden. Er habe mit seiner ehemaligen Frau vereinbart, es samt Mobiliar versteigern zu lassen, und hoffe, dass dies geschehe, während er auf einer Geschäftsreise im Ausland sei. Eine Wohnung wäre nichts für ihn, er würde sich wieder ein Haus kaufen müssen, möglichst in derselben Gegend oder nicht weit davon entfernt. Was Christine zu Epping meine, fragte er.
»Als Kind war ich oft zum Picknick im Epping Forest.«
»Mein altes Haus ist ganz in der Nähe vom Epping Forest«, sagte Arnham, »aber ich habe mehr an Epping selbst gedacht. Oder auch Chigwell. Vielleicht finde ich sogar ein kleineres Haus in der Chigwell Row.«
»Du könntest ja mehr in unserer Richtung etwas suchen.«
Damit waren Cricklewood und die Glenallan Close gemeint, wohin Christine hatte umziehen müssen, bald nachdem sie Witwe geworden war. Selbst der überschwänglichste aller Makler hätte die Gegend schwerlich als »besseres Viertel« bezeichnet. Philip fiel ein, dass Arnham schon einmal dort gewesen war – die aneinandergedrängten Backsteinhäuser mit ihren Fenstern in Metallrahmen, den Ziegeldächern, den Drahtzäunen und kläglichen Gärten würden ihn also nicht mehr erschrecken. Außerdem verbargen die Dunkelheit und das neblige Licht der von Laub umgebenen Straßenlaternen das Ärgste. Es war kein Elendsviertel, nur eine arme, öde, schäbige Gegend. Wie in stillem Einvernehmen eilten Philip, Fee und Cheryl ins Haus und ließen Christine und Arnham zurück, damit sie allein voneinander Abschied nehmen konnten. Doch Christine kam bald nach und lief den Pfad entlang, als sich gerade die Haustür öffnete und Hardy herausgeschossen kam. Kläffend vor Freude sauste er auf sie zu.
»Wie habt ihr ihn gefunden? Hat er euch gefallen?« Der Jaguar war kaum losgefahren. Christine stand da, Hardy auf den Armen, und sah dem davonfahrenden Wagen nach.
»Er ist schon okay.« Fee, die auf dem kleinen Sofa saß, fahndete im Evening Standard nach den letzten Neuigkeiten über den Fall Rebecca Neave.
»Hat er dir gefallen, Cheryl? Ich spreche von Gerard.«
»Mir? Klar doch. Er hat mir gefallen. Er ist ganz okay.« Er ist viel älter als Paps, nicht? Jedenfalls wirkt er älter.«
»Ich bin allerdings ins Fettnäpfchen getreten, nicht? Schon als wir unter der Tür standen, ist mir das klargeworden. Ich hatte zu ihm gesagt, du musst irgendwann mal meine Kinder kennenlernen, und er hat ein bisschen gelächelt und gesagt, das würde er gerne, und als nächstes hat er davon gesprochen, ich solle doch nächsten Samstag zu ihm kommen. Ich dachte – ich weiß nicht, warum –, damit hätte er uns alle gemeint. Aber natürlich hat er nur mich gemeint. Es war mir schrecklich peinlich. Habt ihr den kleinen, nur für zwei Personen gedeckten Tisch mit der Blume und alldem gesehen?«
Philip führte Hardy um den Block, ehe er schlafen ging. Er kam durch die hintere Gartentür zurück, blieb dort einen Augenblick stehen und sah die leere Stelle neben dem Vogelbad an, auf die Licht aus dem Küchenfenster fiel. Hier hatte Flora gestanden. Inzwischen war es zu spät, um das Geschehene rückgängig zu machen. Zum Beispiel am nächsten Tag nochmals nach – zu fahren und Flora zurückzuholen – dafür war es jetzt zu spät.
Ohnedies dachte er damals nicht so. Er hatte nur das Gefühl, dass die Dinge nicht richtig gelaufen waren und dass der Tag vergeudet worden war.
2
_____
Knappe zwei Wochen später traf eine Ansichtskarte ein, die das Weiße Haus zeigte. Arnham hielt sich in Washington auf. Christine hatte sich, typisch für sie, nur vage darüber ausgelassen, was für einen Job er hatte, doch Philip fand heraus, dass er als Exportmanager für eine Firma nahe der Zentrale von Roseberry Lawn tätig war. Fee brachte am Samstagvormittag die Post herein, registrierte den Namen des Absenders und die Briefmarke, las aber anständigerweise nicht, was auf der Karte stand. Christine überflog sie zuerst stumm für sich, und dann las sie sie ihren Kindern vor.
»Bin aus New York hierhergekommen und werde nächste Woche in Kalifornien, beziehungsweise an ›der Küste‹ sein, wie sie hier sagen. Das Wetter ist viel besser als zu Hause. Ich habe Flora die Aufsicht über mein Haus anvertraut! Herzlichst, Gerry.«
Sie stellte die Karte auf den Karminsims, zwischen die Uhr und das Foto, auf dem Cheryl Hardy als kleines Hündchen in den Armen hielt. Später am Tag sah Philip, wie Christine die Karte noch einmal las, diesmal mit aufgesetzter Brille, und sie dann umdrehte und die Abbildung studierte, als hoffte sie, irgendein Zeichen oder Kreuz zu entdecken, das Arnham vielleicht gemacht hatte, um anzuzeigen, wo sein Zimmer war. In der Woche darauf kam ein Brief, mehrere Briefbogen in einem Luftpostumschlag. Christine öffnete ihn nicht vor ihren Kindern, geschweige denn, dass sie ihn vorgelesen hätte.
»Ich glaube, der Anruf gestern Abend, das war er«, sagte Fee zu Philip. »Als das Telefon klingelte, so gegen … Nein, es muss tatsächlich schon halb zwölf gewesen sein. Ich dachte, wer ruft uns denn um die Zeit noch an? Mami sprang auf, als hätte sie darauf gewartet. Aber sie ist danach gleich ins Bett gegangen und hat kein Wort darüber verloren.«
»Das wäre um halb sieben abends in Washington gewesen. Er hätte seinen Arbeitstag hinter sich gehabt und wäre wahrscheinlich schon auf dem Sprung gewesen auszugehen.«
»Nein, inzwischen ist er in Kalifornien. Ich habe mir alles durchüberlegt – es wäre früher Nachmittag in Kalifornien gewesen, und er hätte gerade sein Mittagessen hinter sich gehabt. Er war eine Ewigkeit am Telefon, offensichtlich war es ihm egal, was es kostet.«
Philip dachte bei sich, dass Arnham die Telefonate mit London sicher auf sein Spesenkonto setzte. Aber wesentlicher war, dass er mit Christine sehr viel zu bereden gehabt hatte.
»Darren und ich haben jetzt beschlossen, kommenden Mai zu heiraten«, sagte Fee. »Wenn Arnham und Mami sich zu Weihnachten verloben sollten, dann können wir ja alle zur selben Zeit heiraten. Ich denke, dass du das Haus hier bekommen solltest, Philip. Mami wird es nicht mehr brauchen, man merkt ja, dass er reich ist. Du könntest mit Jenny das Haus übernehmen. Ihr werdet doch eines Tages heiraten, oder nicht?«
Philip lächelte nur. Die Idee, das Haus zu bekommen, hatte etwas für sich. Darüber hatte er noch nie nachgedacht. Er hätte es sich zwar nicht ausgesucht, aber es war immerhin ein Haus, etwas, worin man wohnen konnte. Dass das gar nicht so unwahrscheinlich war, wurde ihm mehr und mehr bewusst. Seine Befürchtung, ihre unerwartete Invasion bei Arnham könnte dessen Gefühle für Christine verändert oder ihn wenigstens zur Zurückhaltung veranlasst haben, schien unbegründet. Es blieb bei der einen Ansichtskarte, aber ein zweiter spätabendlicher Telefonanruf kam, und ein paar Tage danach vertraute ihm Christine an, dass sie am Nachmittag ein langes Gespräch mit Arnham geführt habe.
»Er muss noch ein bisschen länger drüben bleiben. Als nächstes fliegt er nach Chicago.« Sie sprach in einem ehrfurchtsvollen Ton, als hätte Arnham einen Raumflug zum Mars erwogen oder soeben abgeschlossen. »Hoffentlich stößt ihm nichts zu.«
Philip war nicht so unbesonnen, zu Jenny ein Wort über das Haus zu sagen. Es gelang ihm, sich im Zaum zu halten, selbst als sie eines Abends, auf dem Rückweg vom Kino, durch eine ihm fremde Straße gingen und sie auf ein Gebäude mit einer Maklertafel deutete, auf der mehrere Mietwohnungen angeboten wurden.
»Wenn du mit deiner Ausbildung fertig bist …«
Es war ein schmuckloses, hässliches Haus, etwa sechzig Jahre alt, mit abblätternden Art-déco-Verzierungen über dem Eingang. Er schüttelte den Kopf und sagte etwas von einer exorbitanten Miete.
Sie drückte seinen Arm. »Ist es wegen Rebecca Neave?«
Er sah sie erstaunt an. Mehr als ein Monat war seit dem Verschwinden des Mädchens vergangen. In der Presse erschienen von Zeit zu Zeit Theorien, ganze Artikel voll Spekulationen, deren Verfasser sich darüber verbreiteten, was aus ihr geworden sein mochte. Echte Neuigkeiten gab es keine, es hatten sich keinerlei weiterführende Hinweise ergeben. Sie war verschwunden, als wäre sie unsichtbar gemacht und weggezaubert worden. Eine Sekunde lang sagte ihr Name Philip überhaupt nichts, so energisch hatte er sie aus seinem Gedächtnis verbannt. Es wurde ihm unbehaglich, als ihm einfiel, um wen es sich handelte.
»Rebecca Neave?«
»Sie hat dort drinnen gewohnt, nicht?«
»Das wusste ich nicht.«
Er musste in einem sehr kalten Ton gesprochen haben, denn er spürte, dass sie ihn ansah, als dächte sie, er gäbe etwas vor, was er in Wahrheit nicht empfand. Doch seine Phobie war durchaus real, und manchmal erstreckte sie sich auch auf Leute, die zuließen, dass Gewaltakte von ihren Gedanken Besitz ergriffen. Er wollte nicht blasiert oder verklemmt wirken. Weil sie es von ihm erwartete, schaute er an dem Wohnhaus hinauf, das in das orangefarbene Licht der Straßenlaternen auf ihren Stelzen getaucht war. An der Fassade war kein einziges Fenster geöffnet. Die Eingangstüre ging auf, und eine Frau kam mit raschen Schritten heraus und stieg in ein Auto. Jenny konnte nicht genau angeben, wo Rebecca Neave gewohnt hatte, aber sie nahm an, hinter den beiden Fenstern ganz oben rechts.
»Ich dachte, dass du deswegen keine Lust auf eine der Wohnungen hier hattest.«
»Ich habe keine Lust, so weit hier oben zu wohnen.« Nördlich der North Circular Road, wollte er damit sagen. Er dachte, wie überrascht sie sein würde, wenn er ihr erzählte, dass er bald umsonst wohnen könnte, doch irgendetwas hemmte ihn, eine innere Vorsicht hielt ihn zurück. Es handelte sich vielleicht nur um ein paar Wochen, bis er es sicher wusste – solange konnte er die Sache für sich behalten. »Überhaupt sollte ich warten, bis ich einen richtigen Job habe«, sagte er.
Soviel er wusste, hatte Arnham Christine zum letzten Mal Ende November angerufen. Er hörte sie spätabends mit jemandem sprechen, den sie mit Gerry anredete. Er nahm an, dass Arnham bald darauf zurückkommen werde – beziehungsweise Fee nahm es an. Fee beobachtete ihre Mutter, wie in früheren Zeiten eine Mutter ihre Tochter beobachtet haben mochte, hielt nach Zeichen von Aufgeregtheit, nach Veränderungen in ihrem Äußern Ausschau. Fragen stellen wollten sie nicht. Christine fragte ihre Kinder nie nach ihren Privatangelegenheiten aus. Fee sagte, Christine wirke niedergeschlagen, aber Philip stellte nichts dergleichen fest; soviel er sagen konnte, war sie ganz wie immer.
Weihnachten ging vorüber und sein Ausbildungskurs zu Ende. Er war nun bei Roseberry Lawn fest angestellt, als ein kleiner Assistent mit einem Gehalt, von dem er ein Drittel an Christine abliefern musste. Wenn Fee auszog, würde es mehr als ein Drittel sein, und er musste lernen, auch das klaglos auf sich zu nehmen. Ganz ohne Aufhebens begann Christine ein bisschen Geld zu verdienen, indem sie bei sich zu Hause Nachbarinnen das Haar richtete. Wenn mein Vater noch am Leben wäre, dachte Philip, hätte er verhindert, dass Cheryl im Supermarkt Tesco als Kassiererin arbeitet. Freilich ging es ohnehin nicht lange gut. Sie hielt es nur drei Wochen aus, und danach ging sie stempeln, ohne sich viel dabei zu denken oder den Versuch zu machen, einen anderen Job zu bekommen.
In ihrem Wohnzimmer in der Glenallan Close, das aus zwei früher getrennten Räumen bestand – winzige, enge Zimmerchen mussten es gewesen sein, denn zusammen maßen sie nicht viel mehr als sechzehn Quadratmeter –, war noch immer die Ansichtskarte mit dem Weißen Haus auf dem Kaminsims. Alle Weihnachtskarten waren inzwischen wieder heruntergenommen worden, nicht aber Arnhams Karte. Philip hätte sie gerne weggeworfen, hatte aber das unbehagliche Gefühl, dass Christine an ihr hing. Als er die Karte einmal im Sonnenlicht von der Seite ansah, bemerkte er, dass die glänzende Oberfläche mit ihren Fingerabdrücken bedeckt war.
»Vielleicht ist er einfach noch nicht zurückgekommen«, sagte Fee.
»Er kann doch nicht vier Monate lang auf einer Geschäftsreise sein.«
Cheryl sagte unerwartet: »Sie hat ihn anzurufen versucht, aber er war nicht zu erreichen. Sie hat es mir gesagt, sie hat gesagt, sein Anschluss ist gestört.«
»Er wollte wegziehen«, sagte Philip langsam. »Das hat er doch zu uns gesagt – wisst ihr nicht mehr. Er ist umgezogen, ohne ihr was davon zu sagen.«
Wenn Philip nicht unterwegs war, um Kunden oder potentielle Kunden zu besuchen, war er entweder in den Ausstellungsräumen in der Brompton Road oder in der Zentrale der Firma, die sich in der Nähe der Baker Street befand. Wenn er seinen Wagen geparkt hatte oder auf dem Weg zum Mittagessen in irgendeinem Lokal war, kam ihm oft der Gedanke, dass ihm vielleicht Arnham begegnen werde. Eine Zeitlang hoffte er, es käme dazu, möglicherweise nur deswegen, weil Arnham durch ihn vielleicht an Christine erinnert werden würde, doch als er die Hoffnung zu verlieren begann, schreckte er vor einer Begegnung zurück. Die Sache wurde allmählich peinlich.
»Findest du nicht, dass Mami gealtert ist?« fragte Fee ihn. Christine führte gerade Hardy aus. Auf dem Tisch vor Fee lag ein Stapel Hochzeitseinladungen, und sie war damit beschäftigt, Umschläge zu adressieren. »Sie sieht um Jahre gealtert aus, findest du nicht auch?«
Er nickte, da er nicht recht wusste, was er darauf antworten sollte. Und doch hätte er noch ein halbes Jahr vorher gesagt, ihre Mutter sehe jünger aus denn je seit Stephen Wardmans Tod. Er war zu dem Schluss gekommen, dass sie eine Frau von jenem Typ war, dem nur die Jugend gut steht, wie es auch bei Fee selbst einmal der Fall sein würde. Diese weiße und rosige Haut mit ihrer samtigen Textur würde als erstes welken, wie die Blütenblätter von Rosen, die an den Rändern braun werden. Hellblaue Augen verlieren ihren Glanz früher als dunkle. Goldenes Haar wird strohfarben, aschgrau – besonders dann, wenn man von dem Bleichmittel, mit dem man das Haar von Kundinnen behandelt, nichts für sich selbst reserviert. Fee verfolgte das Thema nicht weiter. Stattdessen sagte sie: »Ich nehme an, du hast dich mit Jenny entzweit, ja? Eigentlich wollte ich sie bitten, eine meiner Brautjungfern zu sein, aber wenn ihr euch getrennt habt, lass’ ich das.«
»Es sieht danach aus«, sagte er. Und dann: »Ja, wir haben uns getrennt. Du hast recht, es ist alles aus.«
Er wollte ihr die Sache nicht erklären. Seiner Meinung nach war er niemandem dafür eine Rechtfertigung schuldig. Es bedurfte keiner feierlichen Verkündigungen, so als hätte er in einer festen Beziehung gelebt, als wäre seine Ehe oder auch nur Verlobung aus dem Leim gegangen. Tatsächlich war es nicht so, dass Jenny ihn zum Heiraten gedrängt hätte. So war sie nicht. Aber sie waren mehr als ein Jahr miteinander gegangen. Verständlicherweise hatte sie den Wunsch gehabt, dass er zu ihr zog oder vielmehr, dass sie sich etwas suchten, wo sie zusammenleben konnten, wie es an jenem Abend zum Ausdruck gekommen war, als sie ihm das Wohnhaus gezeigt hatte, in dem Rebecca Neave gelebt hatte. Er hatte nein sagen müssen, er könne Christine nicht verlassen, ja, er könne es sich gar nicht leisten, sie zu verlassen.
»Ihr beide, du und Mami«, sagte Fee seufzend. »Nur gut, dass wenigstens die Beziehung zwischen Darren und mir unerschütterlich ist wie ein Fels«.
Ein Ausdruck, der eigentlich nur zu gut auf Fees künftigen Ehemann passt, dachte Philip. Selbst Darrens unbestreitbar gut geschnittenes Gesicht hatte etwas Steinernes an sich. Er hatte sich nicht sehr angestrengt, darüber nachzudenken, wie Fee eigentlich darauf kam, Darren heiraten zu wollen. Es war ein Thema, dem er aus dem Wege ging. Vielleicht war es so, dass sie alles getan hätte, nur um sich der Verantwortung für Glenallan Close und alles, was damit zusammenhing, entziehen zu können.
»Dann werd’ ich wohl Senta bitten müssen«, sagte Fee. »Sie ist eine Kusine von Darren, und seine Mutter möchte, dass ich Senta darum bitte. Sie sagt, Senta würde sonst beleidigt sein. Und dann hab’ ich noch Cheryl und Janice und eine andere Kusine von ihm, Stephanie heißt sie. Ich möchte unbedingt, dass du Stephanie kennenlernst. Sie ist absolut dein Typ«.
Philip glaubte nicht, dass er einen bestimmten Typ hatte. Seine Freundinnen waren groß und klein, dunkelhaarig und blond gewesen. Es fiel ihm schwer, sich in den Verzweigungen von Darrens riesiger Verwandtschaft zurechtzufinden. So viele von ihnen waren zwei- oder dreimal verheiratet gewesen, hatten jedes Mal Kinder in die Welt gesetzt und Enkel angesammelt. Darrens Eltern hatten beide einen geschiedenen Ehepartner. Neben ihnen wirkten die Wardmans recht kümmerlich und isoliert. Sein Blick fiel wieder auf die Ansichtskarte auf dem Kaminsims, und ohne sie tatsächlich noch einmal zu lesen, fiel ihm wieder Arnhams Bemerkung über Flora ein, der das Haus anvertraut worden sei. Ein ums andre Mal wiederholte er sie stumm, bis sich der Sinn verflüchtigte. Auch begann er die leere Stelle draußen im Garten zu bemerken, wo Flora früher gestanden hatte.
Eines Tages, während seiner Mittagspause, fand er das Gebäude, in dem die Firma, für die Arnham arbeitete, ihren Hauptsitz hatte. Er kam am Eingang vorbei, als er von dem Café, wo er sein Sandwich und die gewohnte Tasse Kaffee zu sich genommen hatte, zurück zur Zentrale ging, auf einem etwas anderen Weg als sonst. Aus irgendeinem Grund war er überzeugt, dass er Arnham begegnen, dass Arnham um diese Stunde ebenfalls vom Mittagessen zurückkehren werde. Er traf ihn zwar nicht, aber es wäre gewissermaßen beinahe dazu gekommen. Er sah Arnhams Wagen, den Jaguar, auf einem der markierten Plätze eines kleinen Parkplatzes für die Angestellten der Firma, deren Gebäude daran angrenzte. Wäre Philip gefragt worden, hätte er gesagt, dass er sich an die Nummer des Wagens nicht erinnern könne, aber kaum hatte er ihn gesehen, wusste er, dass sie es war.
Seine Mutter richtete gerade in der Küche einer Kundin das Haar. Das war eines der Dinge, die Philip am Leben zu Hause am meisten missfielen: heimzukommen und die Küche in einen Frisiersalon verwandelt vorzufinden. Und er wusste es immer sofort, wenn er die Haustüre aufschloss. In der Luft hing schwer der mandelähnliche Geruch von Shampoo oder auch ein ärgerer, wenn sie, wie es manchmal vorkam, Dauerwellen gelegt hatte. Dann stank es nach faulen Eiern. Er hatte Christine Vorhaltungen gemacht und gefragt, warum sie nicht das Badezimmer benutze. Natürlich, so die Antwort, könne sie es benutzen, aber es müsse geheizt werden, und warum Kosten verursachen, wenn es in der Küche, wo der Rayburn-Herd brannte, ohnedies warm war.
Als er seine Jacke aufhängte, hörte er eine Frauenstimme sagen: »Oh, Christine, Sie haben mich ins Ohr geschnitten!«
Sie war keine gute Friseuse, immer wieder passierten ihr kleine Missgeschicke dieser Art. Philip bekam manchmal Alpträume bei dem Gedanken, eine Kundin würde sie wegen einer Brandwunde am Kopf oder einer kahlen Stelle, die plötzlich zutage trat, oder, wie in diesem Fall, wegen eines verstümmelten Ohrs verklagen. Doch bislang hatte dies noch keine getan. Sie war so billig und unterbot die Frisiersalons in der High Road. Deswegen kamen sie zu ihr, diese Hausfrauen vom Gladstone Park, die Verkäuferinnen und Teilzeitsekretärinnen, die ebenso wie sie selbst an allen Ecken und Enden knauserten, die ebenso dauernd nach neuen Möglichkeiten suchten, Geld zu sparen. Doch angesichts dessen, was das heiße Wasser und der Strom oder das eigentlich unnötige Ingangsetzen des Herdes kosteten, ganz zu schweigen von den Shampoos und Gels und Feuchtigkeitssprays, bezweifelte er, dass seine Mutter viel besser daran war, als wenn sie geblieben wäre, was sie, wie sie sagte, noch unlängst gewesen war – eine Dame mit Muße.
Er gab ihnen fünf Minuten. Bis dahin konnte seine Mutter sich darauf einstellen, dass er nach Hause gekommen war. Fee war irgendwohin gegangen, zu Darren vermutlich, aber Cheryl war zu Hause und im Badezimmer. Erhörte ihren Transistor und dann, wie das Wasser gurgelnd aus der Wanne lief. Er öffnete die Küchentür und gab zuerst ein Räuspern von sich. Sie konnten ihn trotzdem nicht hören, denn seine Mutter hatte den Haartrockner angeschaltet. Philip blickte als erstes auf das Ohr der Kundin, auf das Läppchen, an dem ein blutiger Wattebausch klebte.
»Ich nehme an, Mrs. Moorehead hätte gern eine Tasse Tee«, sagte Christine.
Der Tee, der Zucker, den sie in die Tasse schaufeln, und der Kuchen, den sie essen würde, dezimierten die vier Pfund fünfzig, die Christine für Haarwäsche, Schneiden und Föhnen bekam, weiter. Aber es war widerwärtig, so zu denken, verachtenswert, so denken zu müssen. Er war ebenso schlimm wie seine Mutter, und wenn er nicht aufpasste, ließ er sich noch dazu verleiten, der blutenden Kundin ein Glas von ihrem sorgsam gehüteten Sherry-Vorrat anzubieten. Er hätte selbst ein Gläschen vertragen, musste sich aber mit Tee begnügen.
»Hast du einen angenehmen Tag gehabt, Phil? Was hast du getan?« Zu ihren Eigenschaften gehörte eine gewisse naive Taktlosigkeit, wenn sie, mit den besten Absichten, die verkehrten Dinge sagte, wie jetzt: »Ist es nicht wunderbar für uns zwei alte Frauen, mit einem jungen Mann plaudern zu können, Mrs. Moorehead? Das ist doch eine nette Abwechslung.«
Er sah, wie sich die Kundin, blondiert, bemalt und im Glauben, sie wirke noch jung, auf ihrem Stuhl reckte und den Mund verzog. Rasch begann er ihnen von dem Haus zu erzählen, das er an diesem Tag besucht hatte, von dem geplanten Umbau eines Schlafzimmers in ein Bad, der Farbgestaltung. Das Wasser im Teekessel begann zu sieden. Blubbernd tanzte er auf dem Herd. Phil hängte einen zusätzlichen Teebeutel hinein, obwohl er wusste, dass solche Verschwendung Christine bekümmerte.
»Wo war das, Philip? In einer netten Gegend?«
»Ach, droben in Chigwell«, sagte er.
»Es geht um ein zweites Bad, nicht?«
Er nickte, reichte der Kundin ihre Tasse und stellte die für Christine bestimmte zwischen dem Elnettspray und einer Dose gebackener Bohnen ab.