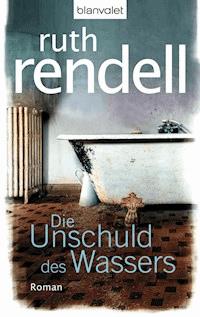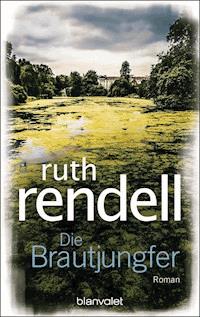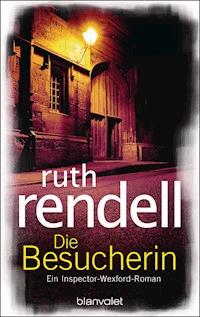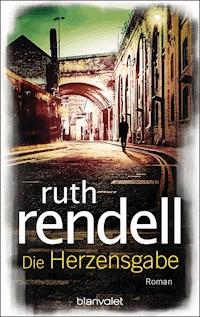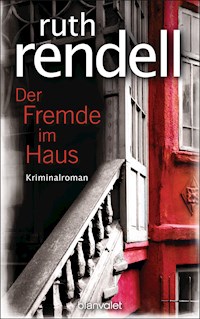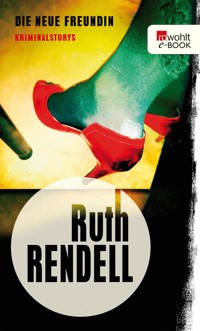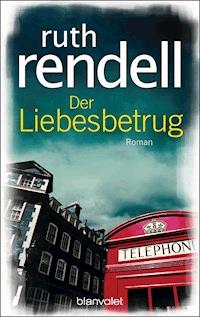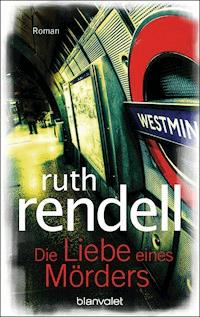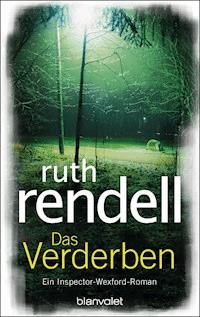8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Es ist der schlimmste Albtraum eines jeden Vaters: Der Tag bricht an, und George Marshalsons Tochter Amber ist noch immer nicht nach Hause gekommen. Noch ahnt George nicht, dass Amber nie mehr heimkehrt – und er weiß auch nicht, dass er selbst schon bald ihre Leiche entdecken wird.
Chief Inspector Wexford war in seiner langen Karriere noch nie mit einem so schrecklichen Fall konfrontiert, und als Vater zweier Töchter empfindet er grenzenloses Mitgefühl für die Familie Marshalson. Doch dann muss der erfahrene Ermittler erkennen, dass Böses allzu oft im Namen der Liebe geschieht. Und je länger Wexford ermittelt, desto verlorener fühlt er sich in einer Welt, deren Vorstellung von Moral ihm völlig fremd ist …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 517
Ähnliche
Buch
Es ist der schlimmste Albtraum eines jeden Vaters: Der Tag bricht an, und George Marshalsons Tochter Amber ist noch immer nicht nach Hause gekommen. Noch ahnt George nicht, dass Amber nie mehr heimkehrt – und er weiß auch nicht, dass er selbst schon bald ihre Leiche entdecken wird.Chief Inspector Wexford war in seiner langen Karriere noch nie mit einem so schrecklichen Fall konfrontiert, und als Vater zweier Töchter empfindet er grenzenloses Mitgefühl für die Familie Marshalson. Doch dann muss der erfahrene Ermittler erkennen, dass Böses allzu oft im Namen der Liebe geschieht. Und je länger Wexford ermittelt, desto verlorener fühlt er sich in einer Welt, deren Vorstellung von Moral ihm völlig fremd ist …
Autorin
Ruth Rendell wurde 1930 in South Woodford/London geboren. Zunächst arbeitete sie als Journalistin, bevor sie sich ganz dem Schreiben von Romanen widmete. Dreimal bereits erhielt sie den Edgar-Allan-Poe-Preis und zweimal den Golden Dagger Award. 1997 wurde sie mit dem Grand Master Awardder Crime Writer’s Association of America, dem renommiertesten Krimipreis, ausgezeichnet und darüber hinaus von Königin Elizabeth II. in den Adelsstand erhoben. Ruth Rendell, die auch unter dem Pseudonym Barbara Vine bekannt ist, lebt in London.
Die Reihenfolge der Inspector-Wexford-Romane sowie weitere Romane finden Siehier.
Ruth Rendell
Ein Ende mit Tränen
Ein Inspector-Wexford-Roman
Aus dem Englischen von Eva L. Wahser
Die Originalausgabe erschien 2005 unter dem Titel End in Tears bei Hutchinson, London.
E-Book-Ausgabe 2015
bei Blanvalet, einem Unternehmen der
Verlagsgruppe Random House GmbH, München
Copyright © der Originalausgabe 2005 by Kingsmarkham Enterprises Ltd.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2008 by Blanvalet Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: www.buerosued.de
Umschlagmotiv: Arcangel Images/CollaborationJS
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-15129-4www.blanvalet.de
1______
Als er den Rucksack vom Sitz hob, kam er ihm schwerer vor als beim Beladen des Wagens. Langsam stellte er ihn auf den weichen, mit Farn bewachsenen Boden, dann setzte er sich wieder hinters Lenkrad, um das Auto tief in eine Höhle aus den überhängenden Zweigen von Weißdornbüschen, Brombeersträuchern und wildem Hopfen hineinzufahren, der in diesem Wald buchstäblich alles überwucherte. Die üppige Vegetation hatte jetzt, Ende Juni, ihren Höhepunkt erreicht.
Nun stieg er zum zweiten Mal aus und trat prüfend einen Schritt zurück. Er konnte den Wagen kaum erkennen. Wahrscheinlich sah er ihn nur, weil er wusste, dass er dort stand. Ein anderer würde nichts bemerken. Er ging in die Hocke, hievte den Rucksack auf die Schultern und richtete sich langsam auf. Diese Bewegung erinnerte ihn an etwas, aber erst nach einem Moment wurde ihm klar, woran: So fühlte es sich an, wenn er seinen kleinen Sohn auf den Schultern reiten ließ. Doch das schien hundert Jahre her zu sein. Der Rucksack wog weniger als der Junge, auch wenn er ihm schwerer erschien.
Er hatte Angst, die Last könnte ihn im Stehen ruckartig nach hinten reißen und ihm das Rückgrat brechen. Natürlich würde es nicht dazu kommen, aber das bange Gefühl blieb. Trotzdem würde er sich nicht völlig aufrichten, ja, er würde es nicht einmal versuchen. Stattdessen machte er einen Buckel und beugte sich beinahe waagrecht nach vorn. Es war ja nicht weit. So würde er die zweihundert Meter bis zur Brücke zurücklegen können. Ein Beobachter aus der Ferne müsste ihn in diesem Dämmerlicht für einen Buckligen halten.
Weit und breit war niemand zu sehen. Die kurvige Landstraße schlängelte sich um den Yorstone Wood herum und über die Brücke. Er hätte bis an die Brücke heranfahren können, doch dann wäre sein Wagen zu sehen gewesen. Deshalb war er bei einem Feldweg von der Straße abgebogen und anschließend über eine Lichtung gefahren, wo er die überwucherte Höhle entdeckt hatte. Er bildete sich ein, aus der Ferne ein Auto zu hören, und danach ein noch schwereres Fahrzeug mit einem Dieselmotor. Sie würden drunten auf der Straße fahren, auf der Brimhurst Lane, die von Myfleet nach Brimhurst Prideaux führte, und dabei die vor ihm liegende Yorstone Bridge passieren. Es war nicht mehr weit bis zu seinem Ziel, und doch kam es ihm wie Kilometer vor. Wenn seine Beine den Dienst versagten, würde er nie mehr hochkommen. Und wenn er den Rucksack hinter sich her zöge? Wäre das einfacher? Doch was, wenn ihm jemand begegnete? Wer etwas zieht, wirkt viel verdächtiger als einer, der etwas trägt. Er drückte die Schulterblätter ein wenig zusammen. Zu seiner Überraschung ging es nun besser. Keine Menschenseele konnte ihm hier begegnen. Zwischen den Bäumen konnte er die Straße mit der kleinen Steinbrücke sehen, die man bisher weder mit Stahlträgern verstärkt noch durch eine bunt bemalte Holzbrücke ersetzt hatte.
Die Brücke hatte ein kleines Geländer, das laut den Berichten der Lokalzeitung viel zu niedrig war, um Sicherheit zu bieten. Ständig erschienen Artikel über diese Brücke und die Gefahren, die von dem niedrigen Geländer für die Straße ausgingen. Er betrat die Brücke, ging in die Hocke und ließ den Rucksack von seinen Schultern auf den Boden rutschen. Dann schlug er die Lasche zurück und zog den Reißverschluss auf. Jetzt tauchte im Inneren ein Betonklotz auf, der vage Ähnlichkeit mit einer Kugel hatte und etwas größer als ein Fußball war. Außerdem lagen im Rucksack ein Paar Handschuhe. Er zog sie an. Er wollte auf Nummer sicher gehen, auch wenn nie einer auf die Idee käme, seine Hände genauer zu inspizieren. Trotzdem wäre es dumm, wenn er sich Kratzer oder blaue Flecken holen würde.
Rasch schwand der letzte Rest Tageslicht. Mit Anbruch der Dunkelheit wurde es kühler. Seine Armbanduhr verriet ihm, dass es einundzwanzig Uhr fünfzehn war. Jetzt würde es nicht mehr lange dauern. Er hob den Betonklotz hoch und wollte ihn schon auf dem Geländer balancieren, um sofort einsatzfähig zu sein, doch dann überlegte er es sich wieder anders. Vielleicht würde jemand auf dem Feldweg, den er genommen hatte, daherkommen und die Brücke überqueren. Warte auf den Anruf, dachte er. Jetzt kann es nicht mehr lange dauern.
Seit er auf der Brücke stand, hatte sich drunten auf der Straße nichts mehr bewegt, aber jetzt näherte sich ein Auto, das Richtung Brimhurst Prideaux fuhr, höchstwahrscheinlich sogar weiter bis nach Kingsmarkham. Er umklammerte das Handy in seiner Tasche. Es hatte noch nicht geklingelt. Er war unruhig. Dann läutete es.
»Ja?«
»Sie ist losgefahren. Willst du noch mal das Kennzeichen?«
»Hab’s mir gemerkt. Ein silberner Honda.«
»Genau.«
»Ein silberner Honda. Müsste in vier Minuten hier sein.«
Das Gespräch brach ab. Inzwischen war es dunkel. Richtung Brimhurst St. Mary und Myfleet fuhr ein Auto unter der Brücke durch. An dieser Stelle fiel die Straße ab und mündete in eine scharfe Linkskurve, in der hohe Bäume mit dicken uralten Stämmen standen. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite war ein schwarz-weißer Pfeil angebracht, der den Verkehr nach links lenkte. Eine Minute war vergangen.
Er ging mit dem Rucksack im Schlepptau auf die andere Brückenseite, wo er sich bückte, mühsam mit schmerzenden Armen den Betonklotz hochhievte und auf dem Geländer absetzte. Zum Glück brauchte er ihn nicht weit hochzuheben. Wieder war eine Minute vergangen. Aus Richtung Myfleet kam mit Fernlicht ein weißer Van angebraust, gefolgt von einem Pkw, der kurz hinter ihm ein Motorrad überholte, das aus Kingsmarkham kam. Das Scheinwerferlicht blendete ihn vorübergehend und ließ seine Umrisse erkennen. Er fluchte. Niemand sollte ihn sehen. Bald würde der silberne Honda kommen, dessen Nummer er auswendig gelernt hatte. Schon sehr bald. Die dritte Minute verging. Und eine vierte.
Er hasste Enttäuschungen. Der silberne Honda hatte vielleicht eine andere Strecke genommen. Dass er das nie tat, war leicht gesagt, aber so etwas konnte man nie behaupten, besonders dann nicht, wenn menschliches Verhalten im Spiel war. Er schaute in die Richtung, aus der der Wagen kommen sollte, Richtung Myfleet. Unter der Brücke würde er noch durchkommen, aber noch vor der Linkskurve … Er konnte in der Ferne die Scheinwerfer erkennen, die auftauchten und verschwanden, sobald ihm eine Hecke oder ein Baumstamm die Sicht verstellte, und dann erneut auftauchten. Zwei Scheinwerferpaare. Nicht ein Auto, sondern zwei, zwei silberne PKW, dicht hintereinander. Einer war der Honda, aber welcher? Das konnte er nicht erkennen, jedenfalls nicht von hier aus, nicht im Dunkeln. Aber das Nummernschild konnte er lesen, wenigstens die letzten drei Ziffern.
Kaum hatte er den Brocken mit Wucht vom Geländer geschoben und fallen gespürt, wusste er, dass er auf den falschen Wagen gezielt hatte. Es gab einen Riesenknall, wie bei einer Bombe. Der erste Wagen – er hatte den Treffer abbekommen – bohrte sich mit aufgeplatzter Kühlerhaube, kaputter Windschutzscheibe und halb eingedrücktem Dach in einen Baumstamm. Es sah aus, als hätte man ihn halbiert und in die Luft gesprengt. Das Auto dahinter hatte bislang nichts abbekommen, doch nun knallte es mit voller Wucht ins Heck des ersten Wagens, sodass die Kühlerhaube aufsprang. Es war der silberne Honda, sein eigentliches Ziel. Als die Fahrerin schreiend und wild gestikulierend heraussprang, war ihm klar, dass er die Sache vermasselt hatte.
Ohne länger zu warten, packte er den Rucksack und setzte sich in Bewegung. Nur einmal schaute er zurück. Soeben ging der vordere Wagen in Flammen auf. In dem gleißenden Licht, das alles ausleuchtete, sah er zum ersten Mal die Frau, der sein Mordversuch gegolten hatte.
2______
George Marshalson hatte schlecht geschlafen. Das tat er immer, wenn sie ausging. Kurz nachdem sie das Haus verlassen hatte, hatte er sich hingelegt und ein, zwei Stunden geschlafen, dann war er aufgewacht und lag seither wach. Auch Dianas Nähe bot ihm keinen Trost, schon lange nicht mehr. Es war eine warme Augustnacht und trotz der weit offenen Fenster stickig und schwül. Da lag er nun und lauschte den Geräuschen der Nacht: dem trägen Glucksen des Flusses, dem unheimlichen Klageruf eines unbekannten Vogels.
Als er am Wecker den Beleuchtungsknopf für das Zifferblatt drückte, sah er, dass es erst dreiundzwanzig Uhr einundvierzig war. Er musste ins Bad. Dieser Drang machte ihm schmerzhaft bewusst, dass auch seine Prostata, wie bei den meisten Männern seines Alters, nicht mehr ganz perfekt funktionierte. Er teilte die bodenlangen Vorhänge ein paar Zentimeter und spürte einen Lufthauch im Gesicht. Am wolkenlosen Himmel war der Mond aufgegangen. Ach, wäre doch nur irgendetwas passiert, das sie früh nach Hause getrieben hätte. Das wäre schön gewesen. Wenn zum Beispiel diese schreckliche Disco zugemacht hätte. Sogar eine Polizeirazzia wäre ihm recht gewesen, auch wenn er sich kaum vorstellen konnte, dass Amber etwas anstellte, wodurch die Polizei auf sie aufmerksam würde. Oder doch? Bei der heutigen Jugend wusste man das nie so genau. Trotzdem wäre es schön, wenn man die Vorhänge fallen lassen und wieder teilen könnte, um dann zu sehen, wie sie den Weg herunterkäme …
Manchmal war er nachts auf die Straße hinausgegangen und hatte nach ihr Ausschau gehalten. Eine hoffnungslose Dummheit. So etwas konnte man keinem Menschen beichten, das wusste bis jetzt nicht einmal Diana. Er war ins Freie gegangen, war die zwei- oder dreihundert Meter bis zur Ecke gelaufen, hatte die Landstraße, die von Myfleet nach Kingsmarkham führte, nach links und rechts abgesucht und war dann wieder umgedreht. So ein Verhalten wäre auch heute wieder sinnlos, aber solche Sachen machten ängstliche Eltern oder Verliebte nun mal. Doch selbst wenn er sich heute erneut dazu aufraffen würde, wäre es noch viel zu früh. Sie säße noch in dieser Disco, die in seiner Fantasie ein unterirdischer Bau war, und würde mit ihren Freunden irgendetwas machen. Er ließ die Vorhänge fallen und betrachtete Diana, die mit einer Hand an der Wange still schlief. Im Schlaf war sie wieder jung. Dieses Phänomen trat angeblich auch bei frisch Verstorbenen auf. Hatte sie vielleicht jemanden? »Einen anderen«, wie man so schön sagte? Plötzlich empfand er es als obszön, wenn sie das Bett mit ihrem Mann teilte, obwohl sie einen Liebhaber hatte. Aber vielleicht hatte sie ja gar keinen. Vermutlich nicht. Sie hatte einfach kein Interesse an ihm, und das beruhte auf Gegenseitigkeit. Dieser Gedanke kam ihm nur selten, aber in solchen Momenten merkte er, dass ihm außer Amber eigentlich nichts und niemand wirklich am Herzen lag.
Er fiel in einen unruhigen Schlaf. Ein Geräusch weckte ihn. Ein Auto auf dem Weg? Vielleicht hatte dieser Junge sie heimgebracht, auch wenn er sie normalerweise an der Ecke absetzte. Aber vielleicht hatte er sie doch ganz nach Hause gebracht. Noch einmal beleuchtete er das Zifferblatt. Ein Uhr sechsundfünfzig. Ihre übliche Zeit. Normalerweise verhielt sie sich ganz leise, um ja nicht das Kind aufzuwecken oder ihn und Diana zu stören. Vielleicht war sie doch zu Hause. Vielleicht hatte er die vordere Haustür klappen gehört. Lauschend lag er da. Stille. Dann stieß der unbekannte Vogel seinen traurigen Ruf aus. Zwei Uhr, halb drei, zehn vor drei … Er stand auf und ging auf den Treppenabsatz hinaus. Beim Heimkommen würde sie ihre Schlafzimmertür schließen. – Die Tür stand weit offen.
Die chaotische Unordnung, das ungemachte Bett, die überall achtlos verstreute Kleidung starrten ihn an. Nur die Mondnacht milderte den Anblick, den er normalerweise als Beleidigung empfand. Sie war nicht daheim. Drei Uhr war sehr spät, und inzwischen war es nach drei Uhr. Er ging die Treppe hinunter und lief barfuß durch die große Diele mit dem Holzboden, die einzig kühle Oberfläche im ganzen Haus. Dabei redete er sich ein, er würde sie im Wohnzimmer finden oder in der Küche, wo sie eine Kleinigkeit aß und dazu dieses seltsame Mineralwasser trank, das heutzutage alle ständig in sich hineinschütteten. Dort war sie nicht. Es war sinnlos, wieder ins Bett zu gehen, dachte er. Ich kann sowieso nicht mehr schlafen. Aber was sollte er dann tun? Nachts gab es keine Beschäftigung, diese Tageszeit war zum Schlafen gedacht. Während er die Treppe hinaufstieg, drang ein Schrei an sein Ohr, aber nicht von diesem Vogel, sondern von dem Baby. George hätte den Kleinen schreien lassen, wenn es nach ihm gegangen wäre, obwohl er Amber nie hatte schreien lassen. Er ging ins Schlafzimmer und sah Diana splitterfasernackt auf der Bettkante sitzen. So schlief sie eben, schon immer. In der ersten Zeit, am Anfang ihrer Ehe, hatte ihm das natürlich gefallen, jetzt hielt er es für – unschicklich. In seinem Alter und, wenn er’s genau nahm, auch in ihrem. Wortlos stand sie auf, warf den blauen Seidenmantel über, den sie vor dem Schlafengehen abgelegt hatte, und sah nach dem Kleinen.
Erst nach knapp zehn Minuten hatte sie ihn wieder beruhigt. Als sie zurückkam, hatte er das Licht angeknipst und saß im Bett.
»Sie ist immer noch nicht heimgekommen«, sagte sie.
»Ich weiß.«
»Du musst endlich ein Machtwort sprechen. Du musst ihr erklären, dass wir so ein Verhalten einfach nicht akzeptieren. Wenn sie unter unserem Dach leben und sämtliche Vorteile daraus genießen will, dann muss sie spätestens um Mitternacht daheim sein. Schließlich ist sie gerade erst achtzehn, Himmelherrgott noch mal!«
»Sie wird erst achtzehn, im November.«
Sie gab keine Antwort. Sie wird erleichtert sein, dachte er und knipste das Licht aus. Erneut herrschte Dunkelheit. Er hörte die blaue Seide von ihrem nackten Körper gleiten. Die glatte warme Haut ihres Oberschenkels streifte ihn und ließ ihn trotz der Hitze zittern.
Der Mond war verschwunden, die Dämmerung noch nicht angebrochen. Eine geschlagene Stunde lang konnte er nicht einschlafen, dann stand er auf, ging ins Bad und zog sich an: Flanellhose, Hemd mit Kragen und Manschettenknöpfen, Socken und Budapester. Amber bezeichnete so etwas als Altherrenkleidung, aber er wusste nicht, was er sonst anziehen sollte. Wahrscheinlich hatte er doch ein bisschen geschlafen, nachdem Diana wieder ins Bett gekommen war. Angeblich schlief oder döste man ja auch, wenn man nicht sicher wusste, ob es so war. Vielleicht war Amber während seines unruhigen Schläfchens heimgekommen. Erwartungsvoll blieb er fünf, zehn Minuten am Schlafzimmerfenster stehen. Erst dann trat er auf den Treppenabsatz hinaus. Er wollte den Moment der Freude beim Anblick ihrer geschlossenen Tür oder aber den Schrecken hinauszögern, wenn er entdecken sollte, dass die Tür immer noch offen stand.
Sie stand offen.
Erst jetzt verlieh er seiner lange verdrängten Angst Ausdruck. Irgendetwas musste ihr zugestoßen sein. Was achtzehnjährigen Mädchen eben so passiert, wenn sie nachts allein unterwegs sind. Es war zehn Minuten vor fünf, und es wurde allmählich hell. Der blasse Himmel schimmerte in einer Farbe, für die es keine Bezeichnung gibt, es sei denn, man vergleicht sie mit einer Perle. Stundenlang hatte sich die Luft im Freien wie ein nasses Tuch angefühlt, jetzt war sie frisch und kühl. Ich werde bis zur Ecke vorgehen, dachte er. Wenn es sein muss, werde ich kilometerweit die Landstraße entlanglaufen, bis ich sie finde. Und wenn nicht, dann liege ich wenigstens nicht daheim in diesem Bett neben dieser Frau und muss mir dieses Babygeschrei anhören.
An der Mill Lane standen nur sein Haus und auf der anderen Straßenseite, hundert Meter weiter weg, drei kleine Reihenhäuser im Villenstil, das sogenannte Jewel Terrace. Offensichtlich wusste niemand, warum und für wen man diese Häuser hier vor hundertfünfzig Jahren gebaut hatte. Vor dem mittleren Haus parkte ein Auto am Grünstreifen. George wunderte sich kurz, warum John Brooks seinen Wagen über Nacht dort stehen gelassen hatte, obwohl es dafür genug Platz in seiner Einfahrt gab. Kaum war ihm dieser Gedanke durch den Kopf geschossen, musste er unweigerlich wieder an Amber denken. Brooks hatte Amber über ihre anfänglichen Schwierigkeiten mit Dianas Computer hinweggeholfen. Warum hatte sie Diana nicht selbst gefragt? Die beiden hatten einander nie leiden können, von Anfang an nicht. Wie konnte jemand seine kleine Amber nicht mögen?
Aber wo war sie? Was war mit ihr passiert? Wie er auf der Seite von Jewel Terrace weiterging, kam er ans Ende der Mill Lane und schaute so weit wie möglich in die Myfleet Road, die hier für eine längere Strecke schnurgerade verlief. Es handelte sich um eine von Feldern und Wäldern gesäumte einspurige Durchgangsstraße. Bis auf den Wegweiser »Nach Brimhurst St. John«, der in die Mill Lane hineinzeigte, gab es hier weder Verkehrszeichen noch Fahrbahnmarkierungen. Es war sinnlos, diese Straße entlangzugehen. Am besten würde er wieder nach Hause gehen und den Wagen holen. Er hätte auch diesen Jungen anrufen können, diesen Ben Miller. Natürlich wäre es unerhört, jemanden um fünf Uhr morgens anzurufen; Miller war nicht einmal Ambers Freund. Sie hatte keinen. Aber auch das kümmerte ihn herzlich wenig. Ach, wie erleichtert wäre er, wenn sie bei den Millers in Myfleet wäre. Aber natürlich würde sie nicht dort sein. Warum sollte sie auch?
Er drehte um und ging auf der anderen Straßenseite wieder zurück. Vielleicht hatte sie bei einer ihrer Freundinnen aus Kingsmarkham übernachtet, bei Lara – oder hieß sie Megan? Oder bei Samantha, oder bei Chris. Wider besseres Wissen klammerte er sich an Strohhalme. Gerade ging die Sonne auf und brachte schon jetzt einen Hauch Hitze mit. Er trat auf den Grünstreifen. Der weiche Boden war ihm unter den Füßen lieber. Sein Blick wanderte nach links, in den Baumschatten hinein, wo er, halb verdeckt unter dem hohen spillerigen Unkraut, etwas Weißes aufschimmern sah. Ein Hammerschlag traf sein Herz, das Entsetzen brach wie eine Flutwelle über ihn herein. Er trat einen Schritt näher an das weiße Etwas heran, versuchte, etwas zu sehen. So weh hatte ihm noch nie etwas getan, und doch, er musste es tun. Er musste hinsehen. Und er sah. Ihre ausgestreckte Hand, die blöde weiße Uhr mit der Gollumfratze. Er stürzte vornüber. Vielleicht wurde er ohnmächtig, vielleicht gab es für ihn aber auch nur einen einzigen Platz auf dieser Welt: quer über ihrem Körper.
Er würde nie wirklich wissen, wie lange er dort gelegen hatte. Am liebsten wäre er gestorben. Er dachte, wenn er sich mit aller Kraft dazu zwinge, dann würde er sterben, und man würde sie gemeinsam finden. Aber es kam anders. Der Zeitungsbote, der sein Haus und Jewel Terrace belieferte, ließ seinen Lieferwagen an der Ecke stehen und ging zu Fuß den Weg hinunter. Dabei fand er ihn und sie. Als er reglos verharrte, rief der Bote die Polizei an und wartete, bis die Beamten eintrafen.
3______
Als sie die Auffahrt hinaufgingen, trat eine Frau mit einem ungefähr einjährigen Kind auf dem Arm aus dem Haus. Wexford und Detective Sergeant Hannah Goldsmith stellten sich vor. Die Frau sagte: »Er schläft. Unser Hausarzt hat ihm eine Beruhigungsspritze gegeben.«
»Ich würde gern mit Ihnen reden«, sagte Wexford. »Sind Sie Mrs. Marshalson?«
Sie nickte. Bisher war Wexford noch nie ein Fall untergekommen, bei dem ein Vater seine ermordete Tochter aufgefunden hatte. Nie hätte er sich den Anblick eines trauernden Vaters träumen lassen, der auf der Leiche seines Kindes lag. Obwohl er selbst Töchter hatte, konnte er sich nur schwer in George Marshalsons Lage hineinversetzen.
Kaum hatten sie den Mann davon überzeugt, dass er den Tatort verlassen musste, kaum hatte man ihn heimgebracht, war der Pathologe erschienen. Und in dessen Gefolge das übliche Aufgebot von Leuten, die am Schauplatz eines Mordes zu tun haben, von den Fotografen bis zu dem vor Ort zuständigen Polizeibeamten. Wexford hatte vorläufig die Feststellung genügt, dass das Opfer noch sehr jung war, unter zwanzig, und sehr gut aussah, und dass der Tod infolge eines Hiebes auf den Kopf, mit einem Ziegel oder einem Stück Mauerwerk, eingetreten war.
Nachdem er den Zeitungsträger, der Vater und Tochter gefunden hatte, befragt hatte, war er mit Hannah den schmalen Weg nach Clifton gelaufen, zum Haus der Marshalsons. Bereits jetzt wurde die Hitze drückend, obwohl man sich inzwischen schon so daran gewöhnt hatte, dass man sie als normal empfand. Man spürte förmlich, wie die Temperatur anstieg. Die Luft lag reglos und schwer da wie sonst nur mittags. Über der Mill Lane wölbten sich dicht belaubte Baumkronen, durch die immer wieder gleißende Lichtpfeile brachen.
Im blumenlosen Vorgarten von Clifton gab es nur welke Büsche und gelben Rasen. Noch ehe Wexford und Hannah in Rufweite waren, ging die Haustür auf und die Frau trat heraus. Hannah – Wexford empfand ihr übertriebenes Maß an politischer Korrektheit als lächerlich – sagte zu ihm in jenem freundlich-nachsichtigen Ton, den sie oft in Gesprächen mit ihm anschlug: »Das müsste seine Partnerin sein.«
»Höchstwahrscheinlich seine Ehefrau.«
Hannah warf ihm einen jener Blicke zu, mit dem sie ausschließlich Männer mittleren Alters bedachte, die ihre Frau immer noch als Ehefrau bezeichneten. Anscheinend war das Kind, ein kleiner Junge, ziemlich schwer, denn sie setzte ihn ab. Da er noch nicht laufen konnte, krabbelte er blitzschnell über den polierten Parkettboden und rief dabei: »Mama, Mama.«
Diana Marshalson beachtete ihn nicht. »Kommen Sie herein. Ich weiß nicht, was ich Ihnen erzählen kann. Als er wiederkam, brachte er keinen Ton heraus. Er ist völlig gebrochen.« Offensichtlich hatte sie ihren Mienen entnommen, dass hier ein Missverständnis vorlag. »Ach so, ich bin nicht ihre Mutter. Ich bin Georges zweite Ehefrau.«
Wexford hatte gelernt, aus dem Gesicht von Detective Sergeant Goldsmith und aus ihrer Körpersprache – so hätte sie es genannt – Zeichen der Befriedigung abzulesen. Und genauso war es auch jetzt: Ihr Mund signalisierte Zustimmung, ihre normalerweise verkrampften Schultern entspannten sich. Das alles hatte Diana Marshalsons Bemerkung, sie sei die Stiefmutter des toten Mädchens, ausgelöst. Hannah liebte komplizierte Familienverhältnisse. In ihrer Welt symbolisierte so etwas freie Wahl und Durchsetzungsvermögen. Ihr Ideal wäre ein Haufen Kinder – alle von verschiedenen Vätern und einige sogar von unterschiedlichen Müttern –, die mit vier bis fünf nicht miteinander verwandten Erwachsenen unter einem Dach lebten. Jedenfalls stellte sich Wexford das so vor.
Sie betraten ein geräumiges Wohnzimmer mit weit offen stehenden Terrassentüren. Die Marshalsons waren Innenarchitekten mit einem Büro im Kingsbrook Centre von Kingsmarkham: Marshalson – Studio für Design & Restaurierungen. Allerdings hätte Wexford das auch ohne Vorkenntnisse gewusst. Solche Leute bewohnten stets unverwechselbar schöne Räume, in denen sich ein exquisiter Geschmack spiegelte. Kein Accessoire war hier zu viel, und alles passte stilvoll zusammen. Wer ein Gespür für so etwas hätte, würde genau solche Farben auswählen. Und doch strahlte dieses Interieur keinen Hauch von Behaglichkeit aus. In solchen Räumen verspürte man nicht das Bedürfnis, es sich mit einem Buch und einem Glas Wein gemütlich zu machen. Wexford setzte sich auf ein dunkelgraues Sofa, Hannah in einen hellgrauen Sessel und Diana Marshalson in einen Lehnstuhl, der aussah, als hätte sein Leben in einem Palast in Mandalay begonnen. Zornige Götter starrten von der hohen geschwungenen Lehne herab.
»Mrs. Marshalson, was hat Ihren Mann veranlasst, heute Morgen in aller Frühe auf die Straße hinauszugehen? Und wann war das genau?«
»Ich weiß es nicht«, sagte sie. »Ich habe geschlafen. Immer wenn sie nachts weg war, hat er sich schreckliche Sorgen gemacht. Vermutlich hatte er gemerkt, dass sie nicht heimgekommen war.«
»Er ist sie suchen gegangen?« Hannahs Stimme drückte Ungläubigkeit aus.
»Vermutlich. Er muss gewusst haben – nun ja, dass sie entweder nicht da war, oder dass etwas Schreckliches passiert ist. Doch das weiß ich nicht. Er ist nach draußen gegangen. Ich bin vom Weinen des Kindes aufgewacht. Das war um halb sieben.« Sie lauschte, als rechnete sie jeden Moment mit einem solchen Schrei. »Ich muss nach George sehen. Macht es Ihnen etwas aus, eine Minute zu warten? Ich bin möglichst schnell wieder bei Ihnen.«
Als sie hinausging, kam der Kleine auf allen vieren hereingekrabbelt. Trotzdem schaffte er es, sich aufzurichten, indem er sich an der Kante eines vermutlich aus Ebenholz und einer sehr hellen Holzart gefertigten Intarsientisches hochzog. Er war ein hübscher Junge, der trotz seiner olivfarbenen Haut rote Wangen hatte. Sein dunkler Lockenschopf kringelte sich zu Korkenzieherlöckchen, wie man sie nur bei ganz kleinen Kindern sieht.
»Hallo«, sagte Wexford, »wie heißt du denn? Lass mich raten. James? Jack? Angeblich steht momentan Archie ganz hoch im Kurs.«
»Guv, er ist noch zu jung, um zu verstehen, was Sie sagen.«
Am liebsten hätte er ihr erklärt, das wisse er, er habe selbst zwei Kinder und schon vier Enkel, aber er biss sich auf die Zunge und meinte stattdessen nachsichtig, Kleinkinder hätten es gern, wenn man mit ihnen redete. Sie liebten den Klang und die Aufmerksamkeit. Was man dabei sage, sei ziemlich egal. Hannah rang sich ein winziges Schulterzucken ab, eine ihrer Lieblingsgesten. Wexford grübelte. Diana Marshalson wirkte gerade noch jung genug, um die Mutter des Kindes zu sein. Annähernd fünfundvierzig oder sechsundvierzig. Eine zweite Ehefrau, die vorher vielleicht nie geheiratet hatte und unbedingt ein Kind haben wollte, bevor es zu spät war. Er bewunderte ihr Äußeres. Große, gut aussehende, wohlproportionierte Frauen mit dunklen Haaren waren sein Typ. Seine eigene Ehefrau gehörte dazu.
Sie kam zurück. »Er schläft tief und fest. Das ist das Beste für ihn, auch wenn ich mich vor dem Zustand fürchte, in dem er aufwachen wird. Irgendwann einmal wird er aufwachen müssen. Er hat Amber vergöttert. Sie war gerade erst achtzehn. Was ist passiert?«
»Das können wir noch nicht sagen, wir stehen erst am Anfang«, erwiderte Hannah. »Sie ist tot. Man hat sie überfallen. Das ist alles, was wir wissen, wirklich.«
Der Kleine versuchte, auf Diana Marshalsons Schoß zu klettern. Wexford hatte den Eindruck, sie würde ihn lustlos und mit wenig Begeisterung hochhieven. »Amber ist gestern Abend ausgegangen? Um welche Zeit denn, und wohin?«
Ambers Stiefmutter wählte ihre Worte sorgfältig. »Sie ist in die Disco gegangen. Ins sogenannte Bling-Bling in Kingsmarkham. Zwischen halb neun und neun, würde ich mal sagen. Ich weiß, das hört sich schrecklich an, aber das tun sie alle. Der Freund, der sie sonst heimgebracht hat, hätte sie am Ende der Mill Lane abgesetzt. So war das schon früher. Sie ist regelmäßig in die Disco gegangen, und es ist nie etwas passiert.« Das Kind bekam die Perlenkette zu fassen, die sie trug, und begann, daran zu ziehen. »Nein, Brand, nein, bitte.« Sie bog seine Finger auf. »Amber hat auf ihre Abiturnoten gewartet. Sie hatte gerade die Schule abgeschlossen … Sehen Sie, mein Mann schläft. Trotzdem sollte ich wohl bei ihm sein und neben ihm sitzen. Sie wissen schon, falls er aufwacht. Ich kann ihn nicht länger allein lassen.«
»Wir würden nur gern …«, fing Hannah an, aber Wexford unterbrach sie.
»Wir werden heute zu einem späteren Zeitpunkt wiederkommen, Mrs. Marshalson. Dann können vielleicht Sie oder Ihr Mann uns sagen, wie dieser Freund heißt, und uns noch ein paar weitere Details über Amber selbst geben. Wir werden jetzt gehen.«
Diana Marshalson nahm sich gerade noch Zeit, um ihnen die Tür zu öffnen. Der Kleine saß dabei auf ihrer Hüfte.
»Wir hätten uns ruhig den Namen dieses Freundes geben lassen können, Guv,« sagte Hannah. »Schließlich war sie ja nicht die Mutter des Mädchens.«
Wexford konnte es nicht ausstehen, wenn man ihn »Guv« nannte, auch wenn dies, wie er wusste, im ganzen Land bei der Polizei üblich war. Obwohl er heutzutage kein »Sir« mehr erwartete, wäre es ihm beinahe lieber gewesen, sie hätte ihn mit Vornamen angesprochen statt mit dieser schrecklichen Abkürzung. Als sie damals neu zu seinem Team gestoßen war, hatte er sie vorsichtig gebeten, diese Anrede sein zu lassen, aber es war, als hätte er nichts gesagt. Hätte sie es auch nur im Geringsten an Respekt fehlen lassen, hätte er Grund gehabt, sie zurechtzuweisen, aber das hatte sie nicht gewagt. So etwas käme für sie nie infrage. Sie mochte ihn, davon war er überzeugt, ja, sie bewunderte ihn sogar – trotz seiner altmodischen Redeweise und der Ausdrücke, deren er sich bediente.
Da er keine Antwort gegeben hatte, wiederholte sie ihren Satz. »Vielleicht hing sie sehr an dem Mädchen«, sagte er. »Bisher wissen wir noch gar nicht, seit wann sie ihre Stiefmutter war. Vielleicht seit Ambers früher Kindheit.«
Auf dem Rückweg zum Tatort sagte Hannah nichts mehr. Wexford hatte das Wort »Mädchen« benutzt, und das ärgerte sie. Amber war eine Frau, sie war achtzehn. Er muss sich die korrekten Ausdrücke aneignen, dachte sie, sonst lässt ihn die sich rasend schnell verändernde Welt einfach links liegen. Erst gestern hatte sie ihn vom »Volk« sprechen gehört, womit aber eigentlich »die Öffentlichkeit« gemeint gewesen war.
Die Leiche war weg. Noch immer standen mehrere uniformierte Polizisten im Gras herum, ein halbes Dutzend Autos verstopfte die Straßenmündung, und soeben sperrte der zuständige Tatortbeamte die Stelle, an der Amber Marshalson gelegen hatte, mit blau-weißem Polizeiband ab. DS Karen Malahyde stand neben einer ungefähr vierzigjährigen Frau in Jeans und weißem T-Shirt.
»Das ist Miss Burton, Sir. Sie wohnt in einem der Häuser gegenüber. Sie war gestern Abend weg und ist gegen Mitternacht heimgekommen.«
»Lydia Burton«, sagte die Frau. »Ich wohne in Jewel Terrace, Nummer drei. Ich bin mit einem Freund weg gewesen. Er hat mich in seinem Wagen heimgebracht, und nachdem er weg war, habe ich noch meinen Hund Gassi geführt. Nicht lange, wissen Sie. Aber man muss mit ihnen raus, sonst machen sie Rabatz.«
Sie war mehr hübsch als schön, hatte eine gesunde rosige Haut und blonde Locken und war ungeschminkt. Nur ihre langen Wimpern hatte sie getuscht, was ihrem unprätentiösen Äußeren, zusammen mit den langen Silberohrringen, an denen ein Hundekopf baumelte, eine leicht frivole Note verlieh.
»Oh ja, selbstverständlich«, antwortete sie auf Wexfords Frage, ob sie Amber Marshalson gekannt habe. »Ich bin Rektorin an der Grundschule in Brimhurst. Amber ist dort zwei, drei Jahre gewesen, nachdem ihr Vater nach Brimhurst gezogen war.«
»Haben Sie sie letzte Nacht gesehen?«
»Wenn’s doch nur so wäre.«
»Was ist passiert?«
»Leider bin ich keine sehr gute Beobachterin.«
Hannah Goldsmith konnte es nicht leiden, wenn sie mitanhören musste, dass Leute schlecht von sich selbst redeten, besonders wenn es sich um Frauen handelte. Vielleicht war das ein Ausdruck von geringem Selbstwertgefühl. Inzwischen war doch klar, dass alle Menschen gleich wertvoll waren. Alle Frauen verfügten über Fähigkeiten und Begabungen, und jede – vielleicht auch jeder – war etwas ganz Besonderes. »Sie haben Ihren Hund Gassi geführt. Wann war das? Nachts um halb eins?«
»Ich denke schon. Ungefähr um diese Zeit. Wegen der Bäume war es auf der Straße ganz dunkel, und ich hatte keine Taschenlampe dabei. Ich habe das schwache Mondlicht ausgenutzt und bin zur Straße nach Myfleet hinaufgegangen. Da bin ich dann vielleicht zweihundert Yards gelaufen.« Meter, dachte Hannah, Meter. Warum dauert es so lange, bis die Leute das lernen? »Als ich zurückkam – an die Ecke zur Mill Lane, meine ich –, sah ich einen Mann. Er stand unter den Bäumen, da drinnen.« Lydia Burton deutete in den Wald, wo man Amber Marshalsons Leiche gefunden hatte. »Ich habe mich ziemlich erschreckt. Er drehte mir den Rücken zu. Ich glaube nicht, dass er mich gesehen hat. Ich bin über die Straße gegangen. Ich wollte ganz schnell … bei seinem Anblick wollte ich unbedingt heim.«
»Miss Burton, können Sie diesen Mann beschreiben?«
Ungeduldig schüttelte Hannah den Kopf. Warum konnte sich Wexford nicht die Anrede »Mrs.« merken? »Sein Gesicht habe ich nicht gesehen. Er trug eine Kapuze. Ich meine, er hatte eine Fleecejacke mit Kapuze an. Na ja, meistens tragen so etwas die jungen Leute. Aber ich glaube nicht, dass er so jung war. Ein Jugendlicher war das nicht.«
»Groß oder klein? Dick oder dünn? Wie alt?«
»Eher groß«, sagte sie. »Ziemlich dünn, meine ich. Hätte ich nur genauer hingeschaut! Aber das sagen die Leute vermutlich immer, oder? Meiner Ansicht nach war er nicht mehr so jung; vierzig, denke ich. Mindestens vierzig.«
»Schade, dass Sie nichts Genaueres wissen«, meinte Hannah. »Amber haben Sie nicht gesehen? Nein, vermutlich nicht. Wissen Sie, ob sie oft in die Disco gegangen ist?«
Wexford wünschte, Hannah würde sich zusammenreißen und nicht so scharf klingen. Jedes männliche Wesen sah in ihr eine schöne Frau: groß, schlank, mit dem Gesicht einer El-Greco-Heiligen und mit rabenschwarzen Haaren. Und doch fragte er sich, ob sie jemals in einer Disco gewesen sei. War sie, außer im Dienst, jemals nach elf Uhr nachts wach gewesen?
»Ich weiß es wirklich nicht«, sagte Lydia Burton. »Ich hatte zu Amber nie eine enge Verbindung. Wenn wir uns begegnet sind, haben wir lediglich Hallo gesagt.« Wexford erkundigte sich nach den Bewohnern der beiden anderen Häuser von Jewel Terrace. »In Nummer eins wohnt ein älterer Herr, Mr. Nash, und dann kommen Mr. und Mrs. Brooks in Nummer zwei. Sie heißen John und Gwenda.«
Sie sahen zu, wie sie das erste Reihenhaus aufsperrte, ein gepflegtes Cottage wie die anderen auch. Rote Backsteinmauern mit einem Schieferdach. Ihr Vorgarten bestand aus einem kleinen quadratischen Rasenstück, das von Lavendelbüschen eingerahmt war. Mr. Nash hatte bei sich riesige, drei Meter hohe Sonnenblumen angepflanzt, die ihre gelben Blütenköpfe zum Himmel reckten. Das Ehepaar Brooks hatte sein Rechteck zwischen säuberlich gestutzten Buchsbaumhecken gepflastert. Trotz der frühen Stunde herrschte bereits eine große Hitze, wie man sie nur in England kennt, mit hoher Luftfeuchtigkeit und einer Sonne, die alles verbrannte, was sie berührte. Hannah Goldsmith wirkte auf Wexford so ordentlich wie eh und je. Ihre blasse glatte Haut war winterweiß, und jedes Härchen an seinem Platz.
»Hannah, Sie können mit Jewel Terrace anfangen«, sagte er, »bevor die Bewohner arbeiten gehen. Nehmen Sie Baljinder mit.«
Was für ein schönes Paar, dachte er, als Hannah und Detective Constable Baljinder Battacharya über die Straße gingen: die gertenschlanke Frau, deren Haare sich wie ein dunkler Wasserfall über ihren Rücken ergossen, und der große, unglaublich schlanke Mann, der sich kerzengerade hielt. Im Vergleich zu seinen kurz geschnittenen, pechschwarzen Haaren wirkten ihre fast braun. Vom Profil her sahen sie sich leicht ähnlich. Beide hatten ebenmäßige klassische Gesichtszüge. Sie hätten Geschwister sein können, vielleicht die Kinder eines Iraners und einer Spanierin. Wie sehr hatte sich doch diese Gegend seit dem Fall Simisola verändert. Damals hatte es gerade mal ein Dutzend Menschen aus ethnischen Minderheiten gegeben.
Mit diesen Gedanken ging er mit Karen Malahyde zurück zu seinem Wagen, wo Donaldson auf der Fahrerseite wartete.
»Wird noch ein heißer Tag, Jim.«
Donaldson strafte diese völlig banale Bemerkung mit der nötigen Verachtung, die er in einem kühlen »Ja, Sir« zum Ausdruck brachte.
»Wissen Sie, ich glaube, hier bin ich noch nie gewesen. In Brimhurst, meine ich.«
»Hier kommt keiner her, außer wenn er Bekannte im Ort hat. Hier gibt es lediglich das Rathaus und die Kirche, und die ist seit dem Tod des Vikars abgeschlossen. Der Dorfladen hat vor zehn Jahren dichtgemacht.«
»Woher wissen Sie das alles?«
»Meine Mama wohnt hier«, sagte Donaldson. »Die Leute mögen es, weil’s ruhig ist. Hier passiert nie etwas – jedenfalls bisher nicht.«
»Nein. Könnten Sie die Klimaanlage höher stellen?«
Obduktionen hatten für ihn nichts Reizvolles. Trotzdem nahm er daran teil, wobei er möglichst oft wegsah. Detective Inspector Burden war weniger zimperlich. Alles, was mit Gerichtsmedizin zu tun hatte, faszinierte ihn. So saßen sie nun aufmerksam da – Wexford tat allerdings nur so –, während die Pathologin Amber Marshalsons Leiche öffnete und die schreckliche Kopfwunde untersuchte, die man ihr mit einem schweren Gegenstand zugefügt hatte. Der Tod sei zwischen Mitternacht und drei Uhr morgens eingetreten; noch genauer wollte sie sich nicht festlegen.
»Meiner Vermutung nach handelte es sich bei der Waffe um einen Ziegelstein«, sagte Carina Laxton, »aber darauf könnt ihr mich selbstverständlich nicht festnageln.«
»Natürlich nicht«, erwiderte Burden, der sie nicht ausstehen konnte. Wie hatte er zu Wexford gesagt? Bis auf ihren Namen und den fehlenden Adamsapfel hätte sie genauso gut ein Mann sein können. Vielleicht sei sie ja mal einer gewesen. Heutzutage wisse man das ja nie. Sie hatte weder Busen noch Hüften, trug einen Bürstenschnitt, und ihr jungfräuliches Gesicht hatte noch nie einen Hauch Make-up gesehen. Trotzdem musste auch Burden zugeben, dass sie ihren Job gut machte. Im Gegensatz zum rüden Mavrikian hielt sie ihre Zunge wesentlich besser im Zaum, und ihr Verhalten stach wohltuend vom pompösen Gehabe eines Sir Hilary Tremlett ab.
»Sie ist an diesem Schlag auf den Schädel gestorben, aber das muss ich euch ja wohl nicht erst erzählen«, sagte sie jetzt. »Die genaue Bestimmung der Tatwaffe steht mir allerdings nicht zu.« Hinter dieser spröden Formulierung klang fast unverhohlen Arroganz durch. »Ihr werdet mit Sicherheit die Dienste eines Plinthologen benötigen.«
»Eines was?«
»Eines Spezialisten für Ziegelsteine.« Carina gab diese Erläuterung in einem Tonfall, als hätte Burden Mühe, das einfachste Vokabular zu verstehen.
»Zweifellos«, sagte er.
»Ihr müsst wissen, Ziegel ist nicht gleich Ziegel.« Kaum hatte Carina diesen Satz einsickern lassen, meinte sie: »Vergewaltigt wurde sie nicht. Das wird alles noch im Bericht stehen. Sie hatte bereits einmal entbunden, wie ihr wahrscheinlich bereits wisst.«
»Das ist mir neu«, entfuhr es Wexford. »Sie war doch erst achtzehn.«
»Was soll das heißen, Reg?« Kopfschüttelnd verzog Carina Laxton den Mund. »Bei einer Zwölfjährigen wäre eine derartige Bemerkung vielleicht angebracht gewesen. Gerade noch.«
Er musste an Brand denken. Ist er nun Ambers Kind oder das von Diana? Und heißt er Brand wie bei Ibsen oder handelt es sich um eine Abkürzung von Brandon? Zu Burden meinte er: »Mike, komm mit in mein Büro. Später können wir dann wieder zur Mill Lane hinaus und gemeinsam den Marshalsons einen Besuch abstatten.«
Wann immer es ging, arbeiteten sie als Team zusammen, besonders wenn Wexford das Gefühl hatte, er könnte Dinge sagen, die er später bedauern würde, wenn er Hannah Goldsmith noch ein bis zwei Stunden länger ertragen müsste. Mit Mike verstand er sich gut. Sie konnten zwar nicht jeden Gedanken austauschen, der ihnen durch den Kopf ging, kamen aber diesem Ideal so nahe, wie es zwei Menschen eben können. Mike kam für ihn sofort nach seiner Frau, den Kindern und seinen Enkeln – in gewisser Weise vielleicht sogar ein wenig früher. Denn diese sieben Menschen liebte er, und niemand wusste besser als er, dass Mögen und Lieben zwei grundverschiedene Dinge sind. Nicht einmal der dogmatischste Teil der Katholischen Kirche hatte je versucht, die Gläubigen zu beschwören, einander zu mögen.
Droben in Wexfords Büro mit dem neuen grauen Teppich, einem Geschenk der dankbaren Steuerzahler von Kingsmarkham, und den beiden gelben Sesseln, die im Gegensatz dazu Wexfords persönliches Eigentum waren, nahm Burden wie immer auf einer Ecke des Schreibtisches aus Rosenholz Platz. Auch dieses große Möbelstück gehörte Wexford. Genau wie die Sessel diente es ihm als Vorzeigestück, wenn wieder einmal die Lokalpresse auf der Suche nach Beweisen für die Verschwendungssucht und Korruption der Polizei neugierig herumschnüffelte. In jüngster Zeit hatte der stets schick gekleidete Burden eine Vorliebe für Kleidungsstücke entwickelt, die man im Branchenjargon als »smart casual« bezeichnete. Die schönen Anzüge waren im Schrank nach hinten, die älteren, zu Wohltätigkeitsorganisationen gewandert. Der Detective Inspector erschien in Jeans und weißem, offenem Hemd unter einer Wildlederjacke. Dass sein Freund einen Tick zu alt für Jeans sei, gehörte zur Kategorie jener Bemerkungen, die Wexford durch den Kopf schossen, ohne dass er sich getraut hätte, sie laut zu äußern. Allerdings war es wirklich nur ein Tick, und Burden war noch schlank genug, um solche Hosen mit Eleganz tragen zu können.
Wexford hatte auf seinem Schreibtisch die Gegenstände ausgebreitet, die man in Amber Marshalsons Jackentaschen gefunden hatte. Die weiße Baumwolljacke mit den großen Blutflecken war genauso ins Labor gewandert wie ihr rosa Minirock, das schwarze Trägerhemdchen, der gleichfarbige BH und der rosa-schwarze Tanga. Der Inhalt ihrer Taschen lag nun auf dem roten Lederbezug.
»Handtaschen trägt man jetzt nicht mehr«, meinte Wexford.
Burden musterte einen Haustürschlüssel an einem zu ihrer Armbanduhr passenden Schlüsselring mit dem Gesicht von Gollum, eine durchsichtige Plastiktube mit irgendeiner grellrosa Substanz, vermutlich eine Art Lippenstift, die Zigarettenschachtel, in der noch zwei Filterzigaretten übrig waren, den noch in Silberpapier eingewickelten, halb geschmolzenen Schokoriegel und das Kondom. Auf dem letzten Objekt verweilte sein Blick etwas länger. Burden war immer schon ein bisschen prüde gewesen. Er kniff die Lippen zusammen.
»Ist sicher besser, wenn man eines dabei hat«, sagte Wexford.
»Das hängt davon ab, wie man einen Abend verbringen möchte. Hatte sie denn kein Geld dabei?«
Wexford zog eine Schublade auf und holte eine Plastiktüte mit Banknoten heraus. Eigentlich war es sogar ziemlich viel Geld, samt und sonders in Fünfzigerscheinen.
»Die müssen noch auf Fingerabdrücke untersucht werden«, sagte er. »Da drinnen stecken tausend Pfund. Die Scheine lagen mit dem Schlüssel und dieser Tube – ich glaube, darin befindet sich Lipgloss – in ihrer rechten Jackentasche. In der anderen waren das Präservativ, die Zigaretten und der Schokoriegel.«
»Woher hatte sie tausend Pfund?«
»Das herauszufinden wird unsere Aufgabe sein«, meinte Wexford.
4______
Der Wagen bog in die Mill Lane ein. Den ganzen Grünstreifen entlang durchsuchten Polizisten in Uniform, allerdings ohne Jacke und Mütze, den Graben und das Feld auf der anderen Seite der Hecke nach der Tatwaffe. Das gesamte Gebiet war am Rande des Asphalts durch Polizeiband abgesperrt. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite stand, auf einen Stock gestützt, ein alter Mann zwischen den Sonnenblumen und ließ den Suchtrupp nicht aus den Augen.
»Es ist schon so lange trocken«, gab Wexford zu bedenken. »Der Mörder könnte sein Auto irgendwo auf dem Grünsteifen abgestellt haben, ohne dass er Spuren hinterlassen hätte.«
Das Haus namens Clifton schien wie in eine seltsame Ruhe gehüllt unter seinen Bäumen und Büschen zu liegen. Wie alle Gebäude während großer Hitzeperioden schien es sich auszuruhen und zu verschließen. Eine wache erwartungsvolle Ausstrahlung war den Zeiten bitterer Kälte im tiefsten Winter vorbehalten. Die Fenster standen sperrangelweit offen, aber niemand war zu sehen. Trotz der frühen Abendstunden war es, als liefen sie gegen eine heiße Wand, als sie aus dem kühlen Wageninneren stiegen.
»So fühlt es sich an, wenn man im Urlaub nach dem Hinflug in Griechenland aus dem Flugzeug klettert«, meinte Wexford. »Man möchte es nicht glauben. Es tut einem richtig gut. Und am besten noch mitten in der Nacht. Aber hier gibt es kaum warme Nächte. Warum eigentlich nicht?«
»Frag mich was Besseres. Vermutlich hat’s irgendwas mit dem Golfstrom zu tun. Wie die meisten Wetterphänomene.«
»Der Golfstrom bringt doch Wärme und keine Kälte.«
Diesmal kam ihnen niemand entgegen. Wexford klingelte an der Haustür, Diana Marshalson öffnete. Wieder war der Kleine bei ihr. Er brachte es fertig, aufrecht zu stehen, solange er sich seitlich an ihre weiten Hosenbeine klammerte.
»Heute Morgen hatte ich selbstverständlich angenommen, dass er ihr Sohn ist«, sagte Wexford, »aber seine Mutter war Amber, nicht wahr?«
»Wahrscheinlich hätte ich es Ihnen sagen sollen.«
Weder Wexford noch Burden ging auf diesen Satz ein. »Ist Brand eine Abkürzung, oder heißt er so?«
Sie schnitt ein Gesicht, rümpfte die Nase und zog die Mundwinkel nach unten. »Leider heißt er so. Aber in Anbetracht der Namen heutzutage ist es gar nicht so schlimm, finden Sie nicht auch? Mein Mann ist aufgestanden. Er wird mit Ihnen reden. Aber, bitte, gehen Sie behutsam mit ihm um, ja? Er hat einen entsetzlichen Schock hinter sich.«
Sie brachte sie in das große Wohnzimmer, wo ihr Mann zwischen grau-weißen Kissen auf dem grauen Sofa lag. Nach Wexfords Recherchen war er noch nicht einmal sechzig. Ein dünner weißer Haarkranz um den kahlen Hinterkopf, tiefe Gesichtsfalten und ein schlaffes Bäuchlein ließen ihn viel älter aussehen. Natürlich musste man nachsichtig sein. Schließlich hatte er erst vor Kurzem einen traumatisierenden Verlust erlitten. Beim Eintreten der Polizisten drehte er den Kopf. Sein Blick fiel auf das Kind.
»Mein Gott, er sieht ihr so ähnlich«, rief er. »Genau wie sie in diesem Alter.«
Er hielt ein gerahmtes Foto in der Hand, das er Wexford hinstreckte. »Ist er seiner … seiner Mutter nicht wie aus dem Gesicht geschnitten?«
Wexford betrachtete das Porträt einer jungen Heiligen mit verklärtem Blick. »Ja. Ja, das ist er. Ein reizender kleiner Junge.« Und er fügte hinzu: »Sie war eine Schönheit.« Der Anblick von Diana Marshalsons Miene traf ihn wie ein Schlag. Wenn er sie hätte beschreiben müssen, hätte er den Begriff »aufgebracht« gewählt. Vielleicht hatte sie in jüngster Zeit zu oft hören müssen, wie schön Amber gewesen war und wie hübsch Brand sei.
Er stellte sich vor, wobei er gleichzeitig sein Beileid aussprach. »Mr. Marshalson, fühlen Sie sich in der Lage, ein paar Fragen zu beantworten?«
»Ja, ja natürlich.«
»Das hier ist Detective Inspector Burden, ein leitender Mitarbeiter meines Teams. Mrs. Marshalson, wären Sie so freundlich, uns für, sagen wir mal, eine Viertelstunde allein zu lassen? Wenn ich darf, komme ich dann anschließend noch einmal zu Ihnen.«
Sie hob Brand hoch und setzte ihn erneut auf ihre rechte Hüfte. Eine sehr praktische Methode für eine Frau, ein Kind zu tragen, überlegte Wexford. Ein direkt zupackender Mann hätte damit Mühe. Allerdings erlaubte diese Variante kaum liebevolle Gesten, ganz im Gegensatz dazu, wenn man ein Kind auf den Arm oder Huckepack nahm. Vermisste der Kleine seine Mutter? Ganz gewiss. Im Rahmen seiner Möglichkeiten hatte er sicher gefragt, wo sie sei. Dann erinnerte sich Wexford wieder an die Mama-Rufe vom Vormittag.
»Warum nehmen Sie denn nicht Platz?«, fragte Marshalson mit leerer Stimme.
»Vielen Dank. Ich bedauere, dass ich Ihnen zu einem solchen Zeitpunkt Fragen stellen muss, aber leider lässt es sich nicht vermeiden. Mr. Marshalson, wann haben Sie gestern Nacht Ihre Tochter zurückerwartet?«
»Eigentlich nicht direkt zu einem konkreten Zeitpunkt. Ich wusste, sie konnte bei jemandem mitfahren. Nun ja, sagen wir mal, ich dachte, sie würde gegen zwei Uhr wieder zurück sein.«
Wexford musste schwer an sich halten, um nicht zu zeigen, wie sehr ihm diese Einstellung missfiel. Burden dagegen gab sich keine Mühe und platzte direkt heraus: »Kam so etwas häufig vor?«
»Amber hatte mit der Schule aufgehört, das heißt, mit der Mittleren Reife ist sie abgegangen. Nach Brands Geburt ging sie wieder zur Schule.« Seine Stimme zitterte, er musste abbrechen. Dann räusperte er sich. »Heute Morgen kamen ihre Abiturnoten, mit der Post. Dreimal eine Eins und eine Zwei. Sie hätte nach Oxford gehen können.« Tränen stiegen ihm in die Augen. Es glänzte verdächtig. »Ich dachte … ich dachte, es sei zu streng, ihr das Ausgehen zu verbieten. Schließlich sollte sie doch auch noch ein bisschen Spaß haben, nach allem, was sie durchgemacht hat.«
»Durchgemacht?«
Wexford schoss seinem Freund einen warnenden Blick zu, den Burden geflissentlich ignorierte.
»Weil sie schwanger wurde, meine ich. Weil sie ein Kind bekam. Weil sie mit ihrem Freund Schluss gemacht hat. Na ja, in meinen Augen ist er ein Verführer. Ein schlechter Charakter.«
»Handelt es sich dabei um Brands Vater, Mr. Marshalson?«
»Ja, sicher, einen anderen hat es nie gegeben«, sagte Marshalson zur Verteidigung seiner toten Tochter. »Meiner Ansicht nach hat er sie vergewaltigt. Nun, wenigstens beim … ersten Mal. Falls es danach überhaupt noch zu etwas gekommen ist, was ich bezweifle.«
Als ob Eltern so etwas wüssten … »Könnten wir seinen Namen erfahren?« Burden gab sich alle Mühe, den puritanischen Unterton aus seiner Stimme zu verbannen. Wexford kannte ihn nur zu genau. »Stammt er von hier?«
»Er heißt Daniel Hilland und studiert an der Universität in Edinburgh. Momentan wird er natürlich nicht dort oben sein. Jetzt sind Sommerferien. Seine Eltern leben hier in der Gegend, in Little Sewingbury. Irgendwo habe ich ihre Telefonnummer.«
»Bemühen Sie sich nicht, Sir. Wir finden das schon heraus. Jetzt zu den Freunden, mit denen sich Amber gestern Abend getroffen hat. Wer sind sie? Und dann wäre da noch der junge Mann, der sie bis zum Ende der Straße gebracht hat. Wir bräuchten nur die Namen, dann würden wir Sie in Frieden lassen.«
»Frieden!«, rief Marshalson, aus dem es jetzt förmlich herausbrach. Er hatte Tränen in den Augen, und seine Stimme bebte. »Frieden! Ich weiß schon gar nicht mehr, was das ist. Vor langer, langer Zeit gab es einmal so etwas. Vielleicht schon nicht mehr seit meiner Heirat mit Diana. Was nicht ihre Schuld ist, das möchte ich damit wirklich nicht sagen. Das ist ganz und gar nicht ihre Schuld. Amber – nun, sie wurde schwanger, und das war fürchterlich, ein fürchterlicher Schock. Sie bekam das Baby und brachte es nach Hause, damit wir uns darum kümmerten. Diana sollte sich darum kümmern. Jedenfalls lief es darauf hinaus.« Seine Lippen zitterten. »Diana musste ihre Mitarbeit im Studio abbrechen. Aber im Vergleich dazu war das alles nichts. Gar nichts. Wie soll ich jetzt seinen Anblick ertragen? Er sieht ihr so ähnlich. Er sieht genauso aus wie sie damals als kleines Mädchen.«
Wexford dachte, Marshalson würde jeden Augenblick losheulen, aber mit enormer Anstrengung brachte der Mann sich wieder unter Kontrolle, indem er tief einatmete und den Kopf in die grau-weißen Kissen drückte. Dann meinte er mit geschlossenen Augen: »Entschuldigung. Ich habe mich gleich wieder in der Gewalt. Diese Freunde – fragen Sie Diana. Diana wird’s wissen.«
»Sir, Sie haben draußen nach Amber Ausschau gehalten«, sagte Burden. »Warum denn das?«
Marshalson schüttelte den Kopf, nicht ablehnend, sondern vielleicht aus Kummer. »Wenn sie ausgegangen war, habe ich nie gut geschlafen. Nie. Und damit hatte ich doch recht, oder? Meine Sorgen waren gar nicht grundlos, wie Diana gemeint hat, stimmt’s? Sondern nur allzu berechtigt.«
»Vielleicht, Sir, aber was wollten Sie eigentlich damit erreichen, dass Sie um – war es fünf Uhr? – um fünf Uhr morgens auf die Straße hinausgegangen sind?«
»Ich weiß es nicht. Um diese Tageszeit macht man nur irrationale Dinge. Ich dachte, ich könnte sehen, wie sie aus dem Auto dieses Jungen aussteigt. In diesem Alter fehlt den jungen Leuten jegliches Zeitgefühl. Sie werden nicht müde. Ich dachte, ich könnte sie heimbegleiten, mich bei ihr unterhaken, bei meiner Prinzessin, bei meinem armen Engelchen …«
Burden sprach das aus, was Wexford nicht sagen wollte oder wozu er zu diesem Zeitpunkt nicht rücksichtslos und entschlossen genug war. »Sind Sie schon früher auf die Zufahrt hinausgegangen? So gegen zwei oder, sagen wir, drei Uhr?«
Erkannte George Marshalson, worauf Burdens Fragen abzielten? Jedenfalls ließ er es sich nicht anmerken. »Nur einmal. Nur um fünf Uhr bin ich hinausgegangen. Zuvor bin ich zwar schon durchs Haus gegeistert und habe gesehen, dass ihr Bett leer war, aber ins Freie bin ich erst um fünf Uhr gegangen …« Ein Schluchzen schnitt ihm die letzten Worte ab.
Draußen im Gang sah Wexford eine der glatten hellen Holztüren mit den Edelstahlgriffen offen stehen. Dahinter hörte er plötzlich eine Kinderstimme rufen: »Mama, Mama.«
Der Ausdruck »es zerreißt mir das Herz« kam ihm in den Sinn, und er ermahnte sich selbst, kein sentimentaler Narr zu sein. Er drückte die Tür vollends auf und ging, mit Burden im Schlepptau, hinein. Brand stand am Fenster. Wie alle Kinder seines Alters lernte er offensichtlich mit jeder Stunde besser laufen. Er drehte sich um und wiederholte dann enttäuscht seinen traurigen Refrain: »Mama, Mama.«
Auf dem Boden saß Diana Marshalson zwischen Holzspielzeug, einem Plüschhund auf Rädern und Bergen bunter Bauklötzchen. »Hoffentlich geht das nicht so weiter. Ich meine, hoffentlich vergisst er sie. Das wäre für ihn am besten.«
Wexford wartete auf irgendeine Geste, die auf Mitgefühl für den Kleinen und Kummer um seine Mutter hindeutete, aber es kam nichts. Brand ließ sich auf alle viere fallen und krabbelte mit fragender Miene auf sie zu. Es sah aus, als würde sie ihn in die Arme nehmen und trösten, aber sie tat es nicht. Sie stand auf.
»Nehmen Sie doch Platz. Was kann ich für Sie tun?«
Sie befanden sich in einer Art Arbeitszimmer, das neben Schreibtisch, Aktenschrank und einem Computerarbeitsplatz auch Polstermöbel mit hellgrauen und orangefarbenen Tweedbezügen enthielt. Die Glastür, durch die Brand in der Hoffnung geschaut hatte, seine Mutter sehen zu können, gab den Blick auf einen großen Garten frei, der hauptsächlich aus Rasen und Sträuchern bestand. Die unmäßige Hitze der vergangenen Wochen hatte das Gras wie die Hügel in Kalifornien gelb versengt. Burden stellte Diana Marshalson jene Frage, die er ihrem tieftraurigen Mann kein zweites Mal zu stellen gewagt hatte.
»Von ihren Freunden kenne ich nur die Vornamen. Bis auf den, der sie immer bis ans Ende der Straße gebracht hat. Er heißt Ben Miller. Soweit ich weiß, wohnt er in Myfleet. Ja, genau, dort wohnt er. Hilft das weiter?«
»Sogar sehr viel«, sagte Wexford. »Vielleicht sagen Sie uns noch die Namen der Freunde, die Ihnen bekannt sind.«
»Wie gesagt, Familiennamen kenne ich keine. Da gab es einen Chris und eine Megan und eine Veryan. Letztere war ein- oder zweimal hier. Ach, und Sam – keine Ahnung, ob sich dahinter ein Samuel oder eine Samantha verbirgt – und Lara. Lara und Megan sind, glaube ich, Schwestern. Ich kann allerdings nicht sagen, ob sie sich gestern Abend mit einem von ihnen getroffen hat. Nein, Brand, jetzt nicht, Di hat zu tun.« Sie schob das Kind nicht direkt weg, sondern legte ihm die Hände auf die Schulter, bückte sich zu ihm hinunter und schüttelte mehrmals den Kopf. »Nein, Brand, hörst du? Spiel mit deinem Hund. Führ ihn durchs Zimmer spazieren.« Ihr kühler Tonfall erinnerte mehr an die Volkschullehrerinnen aus Wexfords Kindheit als an eine moderne Erzieherin. »Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll«, sagte sie zu den Polizeibeamten. »Es war schon hart genug, als Amber wenigstens noch einen Teil des Tages hier gewesen ist. Dabei ist sie nicht mal meine Tochter. Das ist mir gegenüber nicht fair, oder?«
Der selten um Worte verlegene Wexford war sprachlos. Er stand auf. Burden auch. Brand tappte mit dem Hund auf Rädern im Schlepptau durchs Zimmer. Statt »Mama« sagte er diesmal »Di«, und danach »Di, Di, Di.«
Wahrscheinlich tat er das nicht zum ersten Mal. Trotzdem hätte Wexford erwartet, dass sich Diana Marshalson sichtbar freute. Aber ohne eine Miene zu verziehen, hörte sie sich an, wie der Kleine ihren Kosenamen wiederholte, sah ihn kurz an und wandte sich dann ab.
»Seit seiner Geburt habe hauptsächlich ich mich um dieses Kind gekümmert«, sagte sie. »Das ist doch wirklich nicht fair, oder? Amber hat mich vom ersten Moment an gehasst. Sie hätte jede Frau gehasst, die ihren Vater heiratet. Ach, damit behaupte ich nicht, dass sie einen Rachefeldzug geführt hat. Sie hat sich an mich gewöhnt und mich mehr oder weniger akzeptiert, aber gemocht hat sie mich nie. Und doch war nach seiner Geburt ich diejenige, die sich um ihn kümmern musste, wenn sie in der Schule war. Nach einer Weile habe ich meinen Job aufgegeben. Ich war Mitinhaberin, zusammen mit George, aber ich musste aufhören. Sie hat mich nie darum gebeten, sie hat es einfach als selbstverständlich genommen. Weil ich selbst keine Kinder hatte, musste es mir doch ein Bedürfnis sein, mich um ihres zu kümmern. Wenn sie die halbe Nacht unterwegs war, musste ich aufstehen, wenn er weinte. Trotzdem hilft jetzt alles Jammern nichts mehr. Das ist mehr als sinnlos. Wollen Sie sonst noch etwas wissen?«
Nach einem raschen Blick auf Wexford meinte Burden: »Momentan nicht. Vielen Dank, Mrs. Marshalson. Wir werden aber sicher noch mal bei Ihnen vorbeikommen.«
Schweigend traten sie aus der stickigen Luft in die mörderische Hitze eines Augusts hinaus, der alle Chancen hatte, der heißeste seit Beginn der Wetteraufzeichnung zu werden. Einige Augenblicke, ehe die Hitze erdrückend wurde, empfand Wexford sie sogar als angenehm und reckte sein Gesicht der Sonne entgegen. Da explodierte Burden.
»Himmelherrgott noch mal, wegen dieses Kindes werde ich noch schlaflose Nächte haben. Armer Kleiner! Sein Großvater kann seinen Anblick nicht ertragen, weil er ihn an seine tote Tochter erinnert. Seine angeheiratete Großmutter macht keinen Hehl daraus, dass sie ihn lästig findet. Seine Mutter ist tot und scheint nicht gerade eine Kandidatin für einen Preis in Sachen liebevolle Erziehung gewesen zu sein. Dabei sind diese Leute nicht gerade arm. Sie könnten sich ein ordentliches Kindermädchen leisten, eine, die ihn vielleicht sogar lieb hätte. Mir ist speiübel.«
»Mike, beruhige dich. Sonst bin ich doch immer der Emotionale. Oder haben wir jetzt die Rollen getauscht?«
Sie stiegen ins Auto. Da es lange gestanden hatte, war es im Inneren sehr warm. Donaldson startete und stellte die Klimaanlage ein. Der Suchtrupp durchkämmte noch immer die Wiese.
»Ich würde ja gerne hinübergehen und nachsehen, ob sie etwas gefunden haben«, meinte Wexford, »aber ich habe um halb sieben eine Pressekonferenz. Ach, übrigens, ich teile deine Meinung über die Marshalsons und den Kleinen voll und ganz.«
»Warum hat ihn das Mädchen behalten? Wenn sie nichts für ihn empfindet, hätte sie ihn doch zur Adoption freigeben können. Viele Leute würden – würden ihn über alles schätzen. Die ganze Situation ist grundverkehrt. Da hat dieses Mädchen eben erst die Schule beendet und geht nächtelang in die Discos. Was ist nur mit den Leuten passiert? Und auch noch so schnell? Ich habe keine Ahnung. Zwanzig Jahre, und die ganze Einstellung zum Leben hat sich verändert.«
»Vielleicht müssen wir sie noch ein bisschen besser kennenlernen, ehe wir uns ein Urteil erlauben können.« Wexford spürte, wie ihm der Schweiß über die Brust lief. Gerne hätte er noch vor dem Eintreffen der Journalisten ein frisches Hemd angezogen. »Diese Leute mussten ungefähr den schlimmsten Schock ertragen, den man sich denken kann. Weißt du, was mir am meisten zugesetzt hat? Als Brand nach seiner Mutter rief.«
»Diese Diana hat das offensichtlich nicht im Mindesten gekratzt. Dir bricht es fast das Herz, während sie völlig ungerührt wirkt.« Beinahe misstrauisch musterte er Wexford. »Woran denkst du gerade?«
Wexford, der nicht oft zum Lügen neigte, sah keine Veranlassung, seine wahren Gedanken auszusprechen. »Nur, dass ich mich lieber jederzeit der Londoner Presse stellen würde als diesem neuen Typen vom Courier.«
Dann widmete er sich wieder dem, was ihn tatsächlich beschäftigte: seine eigene Tochter.
5______
Die Konferenz dauerte nicht lange. Wexford und Sergeant Vine hatten der Presse nicht viel mitzuteilen, und Darren Lovelace, der neue Mann vom Courier, brachte es wenigstens einmal fertig, keinem auf die Nerven zu gehen. Wexford gab ein Zwei-Minuten-Interview für die regionalen Abendnachrichten auf BBC 1 und ein dreiminütiges für Radio Mid-Sussex. Dann war alles vorbei.
»Willst du Marshalson mit einem Appell vor die Kamera bringen?«, wollte Burden von ihm wissen.
»Weißt du, ich glaube, diese Prozedur werde ich niemandem mehr zumuten. Erstens macht man das heutzutage so oft, und es ist dermaßen zur Routine geworden, dass das Publikum mit Schulterzucken darüber hinweggeht. Vermutlich schalten die Leute ab, sobald ein Elternteil, ein Freund oder eine Ehefrau auf dem Bildschirm erscheint und den Mörder ihrer Lieben – so sollen wir doch die Verwandten nennen – bitten, sich zu stellen. Zweitens steht fest, dass sich der Hinterbliebene unangenehmerweise oft als Täter entpuppt.«
»Willst du etwa andeuten, dass du Marshalson verdächtigst?«
»Mike, zu diesem Zeitpunkt habe ich noch keine Verdächtigen.«
Wexford ließ sich nicht von Burden zu einem gemeinsamen Drink im Olive and Dove überreden, sondern ging nach Hause. Dabei dachte er über seine Bemerkung von vorhin nach, ob sie heute die Rollen getauscht hätten. Normalerweise war er es, der den Inspector nach Dienstschluss zu einem gemütlichen Abendessen überredete, und selten umgekehrt. Wexford wollte unbedingt hören, was seine Frau von Sylvia zu erzählen hatte.
Dass sie schwanger war und weder Ehemann noch Partner hatte, wusste er schon, und auch, dass etwas nicht in Ordnung war. Das hatte ihm Dora erzählt. Das Wenige, was sie wusste, hatte sie ihm gesagt. Ob mit Sylvia oder mit dem Kind etwas nicht in Ordnung war, wussten beide nicht. Allerdings hatte Sylvia versprochen, sich heute mit ihrer Mutter zu treffen und ihr »die ganze Geschichte« zu erzählen.
»Was soll das heißen?«, hatte er gefragt.
»Ich weiß es nicht, Reg. Mir wäre es lieber, wenn sie mir nicht so viel gesagt hätte. So spukt mir dauernd im Kopf herum, sie hätte herausgefunden, dass das Kind ein Chromosom zu viel oder zu wenig hat. Ach, ich wünschte, sie hätte uns das vorerst verschwiegen.«
»Das wäre mir auch lieber gewesen.«