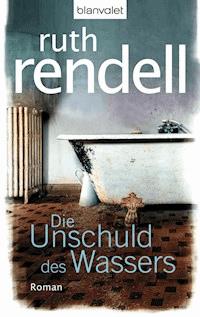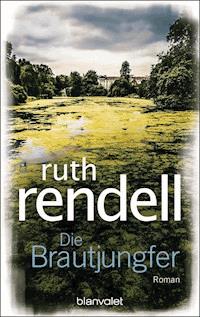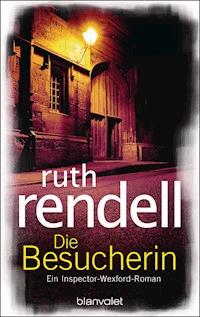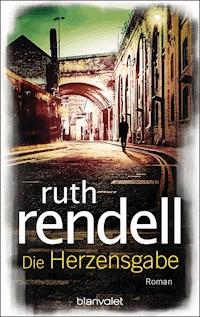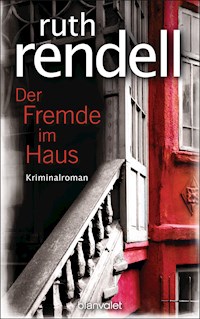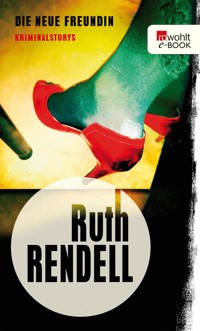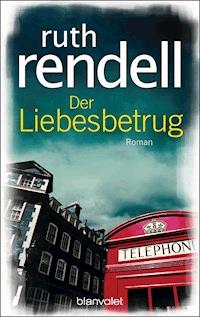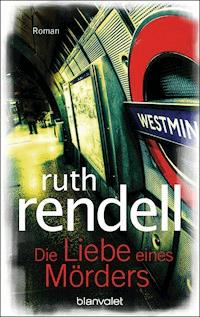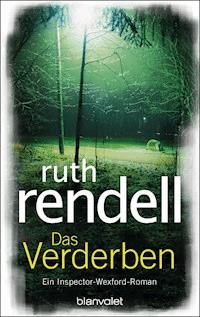4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Als sie das Opfer des Überfalls fanden, lag es halb auf dem öffentlichen Fußweg und blutete aus einer Wunde an der Schulter. Noch während sie sich über den Mann beugten, tauchte unter den Bäumen des Wäldchens auf der Nordseite des Wegs ein junges Mädchen auf. Sie erklärte, sie heiße Edwina Klein, und reichte den Polizisten ein Federmesser, von dem sie das meiste Blut abgewischt hatte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 426
Ähnliche
Ruth Rendell
Die Grausamkeit der Raben
Roman
Aus dem Englischen von Edith Walter
Rowohlt E-Book
Inhaltsübersicht
Die Hauptpersonen
führt zwei Leben und verliert (s)eines.
Joy Williamsvermisst ihren Mann hauptsächlich als Brötchenverdiener.
Wendy Williamsvermisst ihren Mann hauptsächlich als Prestigeobjekt.
Veronica, Sarah, Kevinkennen sich und wissen doch nichts voneinander.
Edwina Klein und Caroline Petershaben nicht nur Ideen, sie leben auch danach.
John und Hope Harmerwerden von den Ereignissen überrollt.
Paulette Harmergeht dabei unter.
Detective Inspector Michael Burdenmacht eine Veränderung durch, die er nie für möglich gehalten hätte.
Detective Chief Inspector Reginald Wexfordtritt erst auf der Stelle und läuft dann um sein Leben.
Für Sonia und Jeff
1
Sie wohnte in der Nachbarschaft. Dora kannte sie, und wenn sie sich auf der Straße trafen, wechselten sie ein paar Worte miteinander. Das letzte Mal war es allerdings nicht nur bei einem freundlichen Guten Tag geblieben.
«Ich habe versprochen, es dir zu erzählen», sagte Dora. «Oder es wenigstens zu erwähnen. Sie hatte wieder diesen seltsamen Gesichtsausdruck, der mir schon öfter an ihr aufgefallen ist. Ehrlich gesagt, war mir das Ganze sehr peinlich.»
«Und was hat sie nun gesagt?», fragte Wexford.
«‹Rod wird vermisst›, oder ‹Rod ist verschwunden› – oder so ähnlich. Dann wollte sie wissen, ob ich es dir vielleicht sagen könnte. Sie weiß natürlich, wer du bist.»
Ein Detective Chief Inspector vergeudet seine Zeit nur ungern damit, sich die Klagen einer Frau anzuhören, deren Ehemann mit einer anderen durchgebrannt ist. Wexford war noch keine fünf Minuten bei Joy Williams, als für ihn bereits feststand, dass genau das passiert sein musste. Aber sie war eine Nachbarin, wohnte praktisch «um die Ecke». Ich sollte froh sein, dachte er, dass es kein Fall zu sein scheint, in dem ich ermitteln muss.
Sein Haus und das der Williams waren zur gleichen Zeit gebaut worden, Mitte der dreißiger Jahre, als Kingsmarkham sich vom Dorf zur Kleinstadt entwickelt hatte. Von der Struktur her waren sie sich sehr ähnlich: drei Schlaf- und zwei Wohnzimmer, Bad und Toilette im Erdgeschoss. Aber sein Haus war ein gemütliches Zuhause, mit Liebe eingerichtet, und dies hier war … Ja, was war es eigentlich? Ein Unterschlupf, der vor Regen schützte, vier Wände, in denen Menschen essen, schlafen und fernsehen konnten?
Joy Williams führte ihn in das vordere Zimmer, das sie Wohnraum nannte. Es enthielt nicht ein einziges Buch. Der viereckige Teppich wurde von senfgelben Kunststofffliesen eingerahmt. Die dreiteilige Sitzgarnitur hatte einen genarbten senfgelben Kunstlederbezug. Der Kamin aus dem Jahr 1935, der in Wexfords Haus längst durch einen aus Yorkstein gemauerten ersetzt worden war, wurde künstlich beheizt. Der elektrische Einsatz, eine Ungeheuerlichkeit aus Regency- und mittelalterlichem Stil, hatte vorn ein Gitter gegen Funkenflug, das aussah wie das Fallgatter einer Burg. Über dem Kamin hing ein Spiegel mit einem Rahmen aus grünem und gelbem Mattglas, für einen Liebhaber des Art déco eine Augenweide. Wexford gefiel er nicht besonders. Das einzige Bild war eine Komposition aus buntem Silberpapier. Sie stellte zwei Katzen dar, die mit einem Wollknäuel spielten.
«Sie ist eine ziemlich farblose Person», hatte Dora gesagt. «Scheint sich für nichts zu interessieren und kommt mir oft irgendwie niedergeschlagen vor. Die zwanzig Jahre mit Rodney Williams haben ihr offenbar nicht besonders gutgetan.»
Joy. Der Name, hatte Dora fast entschuldigend hinzugefügt, der Name sei irreführend. Die Frau sei innerlich völlig ergraut, nicht nur ihr Haar. Sie musste früher recht hübsche Züge gehabt haben, hatte sie vermutlich immer noch, nur waren sie hinter ihrer faltigen, aknenarbigen, rötlich grauen, rauen und verbrauchten Haut versteckt wie hinter einer hässlichen Maske. Sie musste ungefähr fünfundvierzig sein, sah aber zehn Jahre älter aus. Bevor Wexford gekommen war, hatte sie ferngesehen. Der Apparat lief auch jetzt noch, aber ohne Ton. Es war das größte Fernsehgerät, das Wexford je gesehen hatte, auf jeden Fall in einer Privatwohnung. Er vermutete, dass Joy Williams einen großen Teil ihrer Zeit vor dem Bildschirm verbrachte und sich vielleicht unbehaglich fühlte, wenn er dunkel war.
Es gab keine einzige Sitzgelegenheit im Raum, die dem Fernseher nicht zugewandt war. Wexford setzte sich so ans Sofaende, dass er dem Gerät den Rücken kehrte. Joy Williams’ Blick schweifte immer wieder zu den Eisläufern ab, die bei irgendeiner Meisterschaft im Rhythmus einer unhörbaren Musik über das Eis flogen. Sie saß auf der äußersten Kante ihres Sessels.
«Hat Ihnen Ihre Frau gesagt, was ich …»
«Sie hat es erwähnt», unterbrach er sie, um ihr die Peinlichkeit zu ersparen, es noch einmal aussprechen zu müssen, denn um ihre Nase herum und auf ihren Wangen bildeten sich schon dunkelrote Flecken. «Sie hat gesagt, dass Ihr Mann vermisst wird.»
Joy Williams lachte. Es war ein Lachen, das er noch oft hören und sehr gut kennenlernen sollte – ein raues Gackern ohne Humor, ohne Heiterkeit, ohne Belustigung. Sie lachte, um Gefühle zu verbergen oder weil sie Gefühle nicht anders ausdrücken konnte. Die Hände, die auf ihren Knien lagen, ballten sich zur Faust. Sie trug einen sehr breiten, reichziselierten Ehering aus Weißgold oder Platin und einen noch reicher verzierten Verlobungsring aus Platin oder Weißgold mit einem Brillantsplitter.
«Rodney musste auf seine übliche Tour nach Ipswich, und ich habe ihn seither nicht wiedergesehen.»
«Ihr Mann ist Geschäftsreisender, soviel ich von Dora weiß.»
«Ja, bei Sevensmith Harding», antwortete sie. «Farben und Lacke.»
Das hätte sie gar nicht hinzufügen müssen. Von Sevensmith Harding bezogen vermutlich die meisten Einzelhändler für Baumaterialien und Raumausstattung in Südengland ihre Waren. Sevenstar Matt- oder Seidenglanzfarbe bedeckt wahrscheinlich eine Million Wände zwischen Dover und Land’s End, dachte Wexford. Er und Dora hatten eben das zweite Schlafzimmer damit streichen lassen, und wenn er sich nicht sehr irrte, war die Farbe in Mrs. Williams’ Diele die neueste Schattierung von Sevenshine, nicht tropfend und hochglänzend – Weizengelb.
«Er bereist ganz Suffolk», sagte sie, «das ist sein Gebiet.» Sie fing an, die Ringe am Finger hin und her zu schieben. «Er ist vergangenen Donnerstag losgefahren – ja, gestern vor einer Woche. Heute haben wir den Dreiundzwanzigsten – ja, es muss der Fünfzehnte gewesen sein. Er hat gesagt, er fahre nach Ipswich und übernachte dort, um am nächsten Morgen gleich anfangen zu können.»
«Wann ist er aufgebrochen?»
«Gegen Abend. Um sechs Uhr herum. Er war den ganzen Nachmittag zu Hause.»
Und genau hier kam Wexford der Gedanke, es müsse eine andere Frau im Spiel sein. Sogar durch den Dartford-Tunnel fuhr man von Kingsmarkham gut dreieinhalb Stunden nach Ipswich. Ein Handelsvertreter, der tatsächlich nach Suffolk wollte, wäre bestimmt schon um vier aufgebrochen, nicht erst um sechs.
«Wo hat er in Ipswich gewohnt? Vermutlich in einem Hotel?»
«In einem Motel außerhalb der Stadt, glaube ich.»
Sie sprach so lustlos, als wisse sie nicht viel über die Arbeit ihres Mannes und interessiere sich auch nicht dafür. Die Tür ging auf, ein Mädchen kam herein, blieb auf der Schwelle stehen und sagte: «Oh, Verzeihung!»
«Sara, wann ist Vater vorige Woche losgefahren?»
«Gegen sechs.»
Mrs. Williams nickte. «Das ist meine Tochter Sara», sagte sie und betonte den Namen auf der ersten Silbe.
«Sie haben doch auch einen Sohn?»
«Kevin. Er ist zwanzig. Studiert an der Universität in Keele.»
Das Mädchen stützte die Arme auf die Lehne des gelben Plastiksessels, in dem niemand saß, die Augen mehr oder weniger ausdruckslos auf die Mutter gerichtet. Wenn man allerdings genauer hinsah, waren sie eher feindselig als freundlich. Sie war sehr schlank, hell, mit dem Gesicht eines Malermodells aus der Renaissance, mit feinen Zügen, einer hohen Stirn und einem leicht verschlagenen Ausdruck. Sie hatte ungewöhnlich langes Haar, das ihr fast bis zur Taille reichte und so gewellt war, als werde es oft zu Zöpfen geflochten. Sie trug Jeans und ein T-Shirt mit einem aufgedruckten Raben und den Buchstaben ARRIA darüber.
Vom einzigen Tisch im Raum, einem Rattantisch mit Glasplatte, der hinter der Sofalehne fast verschwand, nahm sie eine Fotografie in einem verchromten Rahmen. Sie hielt sie Wexford hin und zeigte mit dem Daumen auf den Kopf eines Mannes, der mit einem halbwüchsigen Jungen und dem Mädchen, das sie selbst vor fünf Jahren gewesen war, an einem Strand saß. Wexford nahm das Foto in die Hand. Der Mann war groß und breit, aber außer Form geraten und um die Taille herum sogar ziemlich fett. Er hatte eine riesige, gewölbte Stirn. Seine Züge wirkten, vielleicht weil sie von der kahlen Stirn beherrscht wurden, unbedeutend und irgendwie zusammengequetscht. Der Mund, ein lippenloser Schlitz, war für die Kamera zu einem Lächeln verzogen.
Wexford reichte Sara das Foto zurück. Sie stellte es wieder auf den Tisch, ihre Augen ruhten kurz mit einem seltsamen und leicht verächtlichen Ausdruck auf ihrer Mutter, dann ging sie hinaus. Wexford hörte sie die Treppe hinaufgehen.
«Wann haben Sie Ihren Mann zurückerwartet?»
«Sonntagabend wollte er wieder da sein. Als er nicht kam, habe ich mir nicht viel dabei gedacht. Ich war der Meinung, er sei einfach noch eine Nacht geblieben und komme Montag. Aber er kam nicht, und er hat auch nicht telefoniert.»
«Haben Sie denn nicht das Motel angerufen?»
Sie sah ihn an, als habe er ihr eine ungeheure, schwierige Aufgabe zugemutet, die ihre Fähigkeiten weit überstieg.
«Das würde ich nie tun. Es ist doch ein Ferngespräch. Außerdem habe ich die Nummer nicht.»
«Haben Sie irgendetwas unternommen?»
Wieder dieses trockene, humorlose, gackernde Lachen. «Was könnte ich denn unternehmen? Kevin war übers Wochenende zu Hause, ist aber am Sonntag nach Keele zurückgefahren.» Sie sprach, als könnte in einer solchen Angelegenheit nur ein Mann die Initiative ergreifen. «Ich weiß, dass ich verständigt worden wäre, wenn er einen Unfall gehabt hätte. Man hätte ihn schnell identifiziert. Er hat Scheckkarte und Scheckbuch bei sich, viele Sachen, in denen sein Name steht.»
«Und Sevensmith Harding haben Sie auch nicht angerufen?»
«Was hätte das wohl für einen Sinn gehabt? In der Firma hat er sich oft wochenlang nicht sehen lassen.»
«Und Sie haben seither nichts von ihm gehört? Seit – lassen Sie mich mal überlegen –, seit acht Tagen haben Sie keinen Hinweis darauf, wo er sein könnte?»
«Das ist richtig. Aber eigentlich sind es nur fünf Tage. Während der ersten drei Tage habe ich ihn ja nicht zurückerwartet.»
Er musste die Frage stellen. Schließlich hatte sie ihn gerufen. Als Nachbarn, dem sie sich anvertrauen konnte, gewiss, aber vor allem als Polizeibeamten. Nichts, was er bisher zu hören bekommen hatte, machte es seinem Gefühl nach erforderlich, Nachforschungen nach Rodney Williams einzuleiten. Wenn er Mrs. Williams betrachtete, das Haus, die Tochter, das ganze Drum und Dran, fragte er sich nur mit einer Gehässigkeit, die er nicht einmal Dora offen eingestanden hätte, wieso der Mann eigentlich so lange geblieben war. Er war mit oder zu einer anderen Frau durchgebrannt, und nur Feigheit hinderte ihn daran, den notwendigen Brief zu schreiben oder anzurufen, wie es neuerdings üblich war.
«Entschuldigen Sie, aber ist es möglich, dass Ihr Mann …» Er suchte nach einer Wendung und rettete sich dann in die geheuchelt rücksichtsvolle, die er verabscheute. «Wäre es möglich, dass Ihr Mann mit einer anderen Frau befreundet ist? Kann er sich mit einer anderen getroffen haben?»
Sie warf ihm einen langen, kalten, ungerührten Blick zu. Was sie auch sagen mochte, Wexford wusste jetzt, dass der Gedanke ihr auch schon gekommen war. Vielleicht war es sogar mehr als nur ein flüchtiger Gedanke gewesen. Etwas in diesem Blick sagte ihm, dass sie zu den Frauen gehörte, die es sich fast zum Prinzip machen, nie etwas Unangenehmes zuzugeben.
Natürlich konnte er ihr auch unrecht tun. All das existierte ja nur in seiner Phantasie. «Es ist nur eine Möglichkeit», sagte er. «Tut mir leid, dass ich’s überhaupt erwähnen musste.»
«Ich weiß schließlich nicht, was er tut, wenn er Tag und Nacht unterwegs ist, nicht wahr? Seit wir verheiratet sind, war er genauso oft auf Geschäftsreise wie zu Hause. Ich weiß nicht, wie viele Flittchen er gehabt hat, und ich würde auch nie fragen.»
Das Wort passte irgendwie zu diesem Zimmer und zu Mrs. Williams grauer, in Kräuselkrepp gehüllter, ein bisschen unappetitlicher Ehrpusseligkeit. Erst jetzt fiel ihm auf beiden Schultern ihrer Bluse die dicke Schuppenschicht auf, die aussah wie darübergestäubtes Mehl. Er hatte ihr eine Lösung geboten, die für die meisten Frauen die am wenigsten akzeptable gewesen wäre. Aber sie, dachte er, wirkt erleichtert. Vermutete sie, ihr Mann könnte sich in etwas Ungesetzliches eingelassen haben, sodass etwas Unmoralisches immer noch die bessere Alternative gewesen wäre?
Du misstraust allem und jedem, sagte er sich. Du Polizist!
«Glauben Sie, dass wir etwas unternehmen sollten?» Es war, von den rein rhetorischen abgesehen, die erste Frage, die sie ihm stellte.
«Wenn Sie damit meinen, ob Sie eine Vermisstenanzeige aufgeben und ihn von der Polizei suchen lassen sollen, dann lautet meine Antwort: Nein, ganz gewiss nicht. Wahrscheinlich werden Sie in den nächsten Tagen von ihm hören. Ist das nicht der Fall, wenden Sie sich am besten an einen Anwalt oder an das für Sie zuständige Büro der Bürgerberatung. Aber auch das sollten Sie erst tun, nachdem Sie bei Sevensmith Harding waren. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie ihn durch die Firma finden, ist sehr groß.»
Sie bedankte sich nicht bei ihm, weil er gekommen war. Dabei war er noch nicht einmal zu Hause gewesen, sondern hatte auf dem Heimweg zu ihr hineingeschaut. Sie entschuldigte sich auch nicht, dass sie seine Zeit in Anspruch genommen hatte. Er blickte zurück und sah sie, die Haustürklinke in der Hand, auf der Schwelle stehen, eine sehr dünne, eckige Frau in einer rehbraunen Bluse und einem unmodernen dunkelgrünen Hosenanzug mit stark taillierter Jacke und überweitem Schlag. Ihr Vorgarten war in der Alverbury Road der einzige, in dem keine Frühlingsblumen blühten. Nicht eine einzige Narzisse hellte das Stückchen Rasen oder die dunkle Eibenhecke auf.
Es war ein wolkenverhangener Abend, noch ziemlich hell, aprilkühl. Dieses kleine wabenähnliche Viertel glich einem Obstgarten im Frühling. In allen Gärten üppige rosafarbene und weiße Blütenpracht und auf den Gehsteigen schon dicke Polster aus abgefallenen Blütenblättern. Auf dem Rasen von Wexfords Vorgarten dominierte eine große Trauerkirsche mit bonbonrosa Blüten.
Seine Frau saß in einem Lehnsessel, der fast im gleichen Winkel zum Kamin stand wie der, in dem Joy Williams gesessen hatte, in einem Raum, der so groß war und die gleichen Proportionen hatte wie der, aus dem er kam. Damit war aber auch jede Ähnlichkeit zu Ende. Das Kaminfeuer – ein echtes Holzfeuer! – brannte. Sie hatten einen kalten Winter hinter sich, und auch der Frühling war kalt und hatte sich verspätet. Noch immer bedrohten Nachtfröste die Blüten. Dora arbeitete an einer Patchworkdecke – einer Tagesdecke in Blau und Rot, in allen Schattierungen von Blau und Rot mit vielfältigem Muster. Der fertige Teil lag auf dem langen roten Samtrock ihres Hauskleids, das sie wegen der Kälte jetzt am Abend zu tragen pflegte. Ihr Haar war dunkel und üppig. Wexford hatte ihr einmal gesagt, sie müsse eine Zigeunerin sein, weil sie mit fast sechzig Jahren noch kein graues Haar hatte.
«Hast du Mike heute gesehen?»
Sie meinte Detective Inspector Burden. Wexford sagte nein, er sei in Myringham bei Gericht gewesen.
«Jenny war heute hier, um mir zu sagen, dass jetzt das Ergebnis der Amniozentese vorliegt. Das Baby ist gesund. Es ist ein Mädchen.»
«Was ist eine Amniozentese?»
«Eine vorgeburtliche Untersuchung. Sie durchstechen die Bauchwand und entnehmen der Gebärmutter etwas Fruchtwasser. Es enthält Zellen des Fötus, und die setzen sie wie eine Kultur an. Auf jeden Fall kommt es zu einer Zellteilung, und dann kann man feststellen, ob das Kind mongoloid wird oder an der sogenannten Spina bifida – einer angeborenen Missbildung der Wirbelsäule – leidet. Und ob es ein Junge oder Mädchen ist, sagen ihnen die Chromosomen, die sie auch im Fruchtwasser finden: XY oder XX.»
«Was du alles weißt! Woher hast du das?»
«Jenny hat es mir erzählt.» Dora stand auf und legte die Patchworkdecke auf den Sessel. «Eine Amniozentese kann übrigens erst ab der sechzehnten Schwangerschaftswoche gemacht werden, und es ist immer ein Risiko dabei. Man kann das Baby verlieren.»
Wexford ging ihr in die Küche nach. Noch mehr als sonst war er sich heute der Wärme und der Helligkeit seines Hauses bewusst. Ihm fiel ein, dass Joy Williams ihm nichts angeboten hatte, nicht einmal eine Tasse Tee. Dora hatte die Tür des Backrohrs geöffnet und begutachtete die Steak- und Nierenpastete, die fast fertig war.
«Möchtest du was trinken?»
«Warum nicht?», sagte Dora. «Feiern wir Jennys und Mikes gesundes Baby.»
«Ich bin überrascht, dass sie ein solches Risiko auf sich genommen hat», sagte er, als sie ihren Sherry und er seinen Scotch mit drei Teilen Wasser hatte. «Sie will dieses Kind doch unbedingt haben. Schließlich haben sie jahrelang darauf gewartet.»
«Sie ist einundvierzig, Reg. In diesem Alter ist das Risiko, ein mongoloides Kind zu bekommen, viel höher. Auf jeden Fall ist alles in Ordnung.»
«Soll ich dir von Mrs. Williams erzählen?»
«Die arme Joy», sagte Dora. «Sie war wirklich hübsch, als ich sie kennenlernte. Aber das ist natürlich auch schon achtzehn Jahre her. Ich nehme an, er ist mit einer anderen auf und davon. Habe ich recht?»
«Warum hast du sie mir auf den Hals gehetzt, wenn du das wusstest?»
Dora lachte. Sie hatte ein leises, warmes, ein bisschen kehliges Lachen. Sofort sagte sie jedoch, sie wisse, dass die Sache nicht zum Lachen sei. «Er ist ein schrecklicher Mensch. Du hast ihn nie kennengelernt, nicht wahr? Er wirkt irgendwie verschlossen, unaufrichtig. Ich war immer der Meinung, dass sich so wirklich nur jemand benimmt, der etwas zu verbergen hat.»
«Doch jetzt bist du nicht mehr so sicher.»
«Ich will dir jetzt etwas sagen, was ich mich seinerzeit einfach nicht zu sagen traute. Ich hatte Angst, du würdest gewalttätig.»
«Na klar», sagte er. «Ich war ja schon immer ein übler Schläger. Wovon redest du?»
«Er hat Sylvia belästigt.»
Es klang trotzig. In ihrem langen roten Kleid, das Sherryglas in der Hand, die Augen plötzlich groß und wachsam, sah sie erstaunlich jung aus.
«Und?» Seine älteste Tochter war dreißig, seit zwölf Jahren verheiratet und Mutter zweier hochgeschossener Jungen. «Sie ist eine attraktive Frau. Ich bin überzeugt, dass sie von allen möglichen Männern alle möglichen Anträge bekommt und es sehr gut versteht, sie abzuwimmeln.»
Dora warf ihm von der Seite her einen langen Blick zu. «Ich habe gesagt, ich hätte Angst gehabt, es dir zu erzählen. Sylvia war damals fünfzehn.»
Die gewalttätigen Gefühle, von denen sie gesprochen hatte, waren tatsächlich da. Nach so vielen Jahren! Seine fünfzehnjährige Tochter. Am liebsten hätte er losgebrüllt, doch er beherrschte sich. Er stampfte auch nicht mit den Füßen. Er trank einen Schluck und sagte kühl: «Und sie kam wie ein braves kleines Mädchen zu ihrer Mami gelaufen und hat ihr alles erzählt?»
«Lieb von ihr, nicht wahr?», entgegnete Dora leichthin. «Ich war gerührt. Aber meiner Meinung nach war sie starr vor Angst, Reg.»
«Hast du etwas unternommen?»
«O ja. Ich bin zu ihm gegangen und habe ihn über deinen Beruf aufgeklärt. Er wusste nicht, was du bist. Joy und er haben wohl nie viel miteinander geredet. Auf jeden Fall hat es genutzt. Er ließ sich kaum noch blicken, und Sylvia hat dort nie wieder den Babysitter gemacht. Joy habe ich nichts davon gesagt, doch ich denke, sie wusste auch so, was gespielt wurde, und machte sich keine Illusionen mehr über ihn. Auf jeden Fall hat sie ihn nicht mehr so angebetet wie früher.»
«‹Einst wurde auch ich angebetet›», zitierte Wexford.
«Und wirst es noch heute, Liebling. Du weißt, dass wir dich alle anbeten. Du hast dir ja auch nicht unsere Achtung verscherzt, indem du hinter kleinen Mädchen herläufst. Kann ich noch ein bisschen Sherry haben?»
«Den musst du dir schon selber holen», antwortete Wexford und machte das Ofenrohr auf. «Immer nur trinken und klatschen! Ich möchte mein Abendessen.»
2
Das Unternehmen Sevensmith Harding war 1875 von Septimus Sevensmith gegründet worden, der sich Farbenhändler nannte. In seinem Laden auf der High Street von Myringham verkaufte er Farben und Zeichenmaterial für Kunstmaler. Farben für den Außenanstrich und die Innendekoration von Häusern kamen erst später hinzu. Eigentlich erst nach dem Ersten Weltkrieg, als Septimus’ Enkelin einen Major John Harding heiratete, der bei Passchendaele ein Bein verloren hatte.
Der erste große Bauboom der achtziger und neunziger Jahre war vorüber, und der nächste stand kurz bevor. Major Harding machte sich ihn zunutze. Er begann in riesigen Mengen die Braun- und Grüntöne herzustellen, an denen die Herzen der Baumeister hingen, die im Süden Londons Reihen- und Doppelhäuser wie Pilze aus dem Boden schießen ließen. Wie Fühler streckten sich die neuen Siedlungen aus der Stadt aufs Land hinaus. Und gegen Ende des Jahrzehnts brachte Harding eine gewagte Nuance in Creme heraus.
Schon war die Firma in Sevensmith Harding umbenannt worden. Die Büros waren in der High Street von Myringham geblieben, aber die Produktion sollte bald aus dem Rückgebäude in einen Industriekomplex außerhalb der Stadt verlegt werden. Da sich niemand mehr mit dem Einzelhandel befasste, wurde das ursprüngliche Geschäft aufgelöst.
Während der sechziger und frühen siebziger Jahre erlebte die Farbenindustrie in der ganzen Welt eine ständig wachsende Konjunktur. Man schätzt, dass es im Vereinigten Königreich fast fünfhundert Firmen gibt, die Farben herstellen, hohe Umsätze machen jedoch nur ein paar große Unternehmen. Vier von diesen großen Unternehmen beherrschen den Markt auf den Britischen Inseln, und zu ihnen gehört Sevensmith Harding.
Ihre Farben Sevenstar Vinyl Seidenglanz und Sevenstar Vinyl matt, Sevenshine Firnis und Satin-Lack werden heute in Harlow, Essex, erzeugt, und ihre Tapeten, Leisten und die farblich darauf abgestimmten Fliesen in Crawley, Sussex. Die Hauptverwaltung in der High Street in Myringham, gegenüber vom Old Flag Hotel, gleicht eher der Kanzlei eines sehr gediegenen Anwalts oder dem Geschäft eines sehr vornehmen Antiquitätenhändlers als den Büros von Farbenherstellern. Tatsächlich weist kaum etwas darauf hin, dass es Farbenhersteller sind. In den abgerundeten Erkerfenstern zu beiden Seiten der Tür werden keine Farbbüchsen oder Pappfiguren begeisterter Hausfrauen mit Pinseln in der Hand ausgestellt. Der Vorübergehende kann höchstens einen Blick auf eine Famille-noir-Vase mit getrockneten Gräsern in dem einen Fenster und einen Hepplewhitestuhl im anderen bewundern. Aber über der Tür findet man im Stil Georgs V. und auf poliertem Mahagoni das königliche Wappen und den Text: Von Ihrer Majestät Königin Elizabeth und der Königinmutter bestellter königlicher Hoflieferant, Hersteller feinster Farben und Lacke.
Der Präsident des Unternehmens, Jeremy Harding-Grey, teilte seine Zeit zwischen seinem Haus in Monte Carlo und seinem Haus in Nassau auf, und obwohl der geschäftsführende Direktor George Delahaye in Sussex lebte, wurde er in Myringham nur selten gesehen. Der stellvertretende geschäftsführende Direktor jedoch war ein bescheidenerer Mann und viel eher auf dem Niveau eines Durchschnittsmenschen. Wexford kannte ihn. Sie waren sich im Haus von Sylvias Schwiegervater begegnet, der Architekt war, und seither waren die Gardners einmal bei den Wexfords und die Wexfords einmal bei den Gardners zu Gast gewesen. Dennoch hatte Wexford nicht das Gefühl, mit Miles Gardner auf so gutem Fuß zu stehen, dass er ganz formlos bei Sevensmith Harding hineinplatzen und Miles zu einem Drink und einem Sandwich einladen konnte.
Vierzehn Tage waren verstrichen, seit er mit Joy Williams gesprochen hatte, und er hatte die Angelegenheit buchstäblich vergessen, hatte sie noch am selben Abend, bevor er zu Bett ging, aus seinen Gedanken verdrängt. Und wenn sie ihm zwischendurch wieder einfiel, sagte er sich, dass Mrs. Williams und ihr Anwalt entweder alles zur ihrer Zufriedenheit geregelt hatten oder Williams längst wieder zu Hause saß. Weil er, wie schon viele Männer vor ihm, festgestellt hatte, dass der häusliche Herd immer noch der sparsamste war.
Doch selbst wenn Williams noch nicht wiederaufgetaucht war, hatte Wexford keinen Anlass, bei Sevensmith Harding Erkundigungen nach ihm einzuziehen. Das überließ er Joy Williams, das musste sie schon selbst tun. Gleichgültig, wie abenteuerlich das Liebesleben eines Mannes sein mag, er muss zur Arbeit gehen und sich sein Brot verdienen. Außerdem verdiente Williams dieses Brot in einer so bescheidenen Position, dass Miles Gardner kaum je von ihm gehört haben würde.
Wexford und Burden hatten bei verschiedenen Prozessen, die in Myringham verhandelt wurden, als Zeugen ausgesagt, und beide Kammern hatten sich bis nach dem Lunch vertagt. Burden musste nach dem Essen wieder zu seinem Fall zurück – einer kniffligen Sache, bei der es um Hehlerei ging –, und er musste bis zum bitteren Ende bleiben. Wexford hingegen brauchte nicht mehr aufs Gericht, er konnte nach Hause fahren. Auf dem Weg zum Hotel war Burden schweigsam und mürrisch, war es schon, seit sie das Gerichtsgebäude verlassen hatten. Wäre es nicht Burden gewesen, hätte Wexford gedacht, er sei so schlecht gelaunt, weil der Anwalt des mutmaßlichen Hehlers ihn wie einen Schuljungen heruntergeputzt hatte. Aber auf Burden machte so etwas keinen Eindruck. Eine solche Anwaltsschelte hatte er schon zu oft einstecken müssen, um sie noch ernst zu nehmen.
Es muss was anderes sein, dachte Wexford, etwas viel Persönlicheres. Und nachträglich fiel ihm auf, dass Burden schon seit längerer Zeit mürrisch und verdrießlich war. Das Problem schien ihn also schon seit Tagen, nein, sogar seit Wochen, zu belasten. Zwar litt seine Arbeit nicht unter seiner Stimmung, sie wirkte sich jedoch sehr negativ auf seine Beziehungen zu seinen Mitmenschen aus.
Äußerlich war er unverändert, man merkte ihm weder Angst noch Sorge an. Er war zwar mager, aber das war er immer gewesen. Wexford wusste nicht, ob er einen neuen Anzug trug oder ob es der vom vergangenen Jahr war – frisch gereinigt und allabendlich mit dem elektrischen Hosenbügelgerät aufgebügelt, das ihm seine Frau zu Weihnachten geschenkt hatte. («So eins wie die Dinger, die man in schicken Hotels auf den Zimmern findet», hatte Burden stolz erklärt.) Burdens zweite Ehe war genauso glücklich wie seine erste. Aber fast jede Ehe, die Burden einging, würde glücklich sein. Er war der geborene Ehemann, der es fertigbrachte, sich seiner Frau unterzuordnen, ohne dabei eine lächerliche Figur abzugeben. Was ihn jetzt bedrückte, konnte nichts mit seiner Ehe zu tun haben. Seine Frau erwartete das langersehnte Kind – auf jeden Fall von ihr lang ersehnt. Burden hatte erwachsene Kinder aus erster Ehe, einen Sohn und eine Tochter. Wexford beschäftigte sich kurz mit einer Idee, die ihm gekommen war, verwarf sie jedoch sofort wieder, denn sie war absurd und passte nicht zu Burden. Er fürchtete sich bestimmt nicht davor, mit Mitte vierzig noch einmal Vater zu werden und wieder einen Säugling im Haus zu haben. Damit wurde er auf seine Art bestimmt fertig.
«Was ist los, Mike?», fragte Wexford, als das Schweigen allzu drückend wurde.
«Nichts.»
Die klassische Antwort. Einer jener Fälle, bei denen eine Erklärung genau das Gegenteil von dem bedeutet, was sie aussagt.
Wexford drängte nicht. Er ging weiter und sah sich in dem alten Marktflecken um, der sich in den letzten Jahren sehr verändert hatte. Man hatte zuerst ein riesiges Einkaufs- und später ein Kulturzentrum mit Theater, Kino und Konzertsaal gebaut. Vor drei Wochen hatte an der Universität das neue Semester begonnen, und in der Stadt wimmelte es von Studenten in Blue Jeans. Doch hier, an diesem Ende der Stadt, wo man immer mehr Häuser unter Denkmalschutz stellte, war alles fast noch beim Alten. Es war alles besser geworden, seit die Stadtverwaltung endlich aufgewacht war und begriffen hatte, dass Myringham schön war und der Kern erhalten werden sollte. Seither war viel gesäubert, aufgeräumt, gestrichen und gepflanzt worden.
Er warf einen Blick in die Erkerfenster von Sevensmith Harding, zuerst auf den Hepplewhitestuhl und dann auf die Vase. Hinter dem getrockneten Gras sah er eine junge Empfangsdame, die telefonierte. Dann überquerten er und Burden die Straße und betraten das Old Flag.
Wexford kannte das Hotel, er war schon ein- oder zweimal da gewesen. Es war tagsüber nie sehr voll. Die Leute gingen zum Lunch lieber in billigere Pubs, in denen es außerdem fröhlicher zuging. Auch Weinbars waren sehr beliebt. In der kleineren Salonbar, in der man auch essen konnte, waren mehrere Tische frei. Wexford ging auf einen zu, als er Miles Gardner entdeckte, der allein saß.
«Wollen Sie sich nicht zu mir setzen?»
«Sie sehen so aus, als warteten Sie auf jemand», sagte Wexford.
«Auf jede unterhaltsame Gesellschaft, die sich anbietet.» Gardner hatte eine warmherzige Art zu sprechen und drückte sich gewählt aus, was jedoch durchaus nicht gekünstelt wirkte. Wexford erinnerte sich, dass er das immer besonders sympathisch gefunden hatte. «Sie haben hier einen ausgezeichneten Garnelensalat», sagte Miles Gardner. «Und wenn man es schafft, vor ein Uhr herzukommen, holen sie ein frisches Filetsteak vom Metzger.»
«Was geschieht um eins?»
«Der Metzger schließt. Er macht um zwei wieder auf, aber dann schließt das Restaurant. Das ist Myringham, wie es leibt und lebt.»
Wexford lachte. Burden lachte nicht. Er saß mit jener Miene steifer Höflichkeit da, die sogar dem unsensibelsten Menschen begreiflich macht, dass man allein glücklicher – oder zumindest weniger unglücklich – wäre. Wexford beschloss, ihn zu ignorieren. Gardner schien sich über ihre Gesellschaft zu freuen und begann, nachdem er eine Runde bestellt hatte, auf die ihm eigene leichte und elegante Art von dem neuen Haus zu erzählen, das er eben bezogen hatte und das von Sylvias Schwiegervater entworfen worden war. Es ist, dachte Wexford, eine wertvolle Gabe, wenn man mit Menschen, die man kaum oder nur oberflächlich kennt, sprechen kann wie mit alten Freunden, mit denen man regelmäßig zusammenkommt.
Gardner war ein kleiner, unauffälliger Mann, der nicht besonders vornehm wirkte. Sein Stil lag in seiner Stimme und in seinem Verhalten. Er hatte eine Frau, die viel größer war als er, und zwei grässlich laute Töchter. Nachdem er von seinem neuen Haus und den Nöten eines Bauherrn erzählt hatte, kam er auf die Arbeit zu sprechen, auf den Arbeitsmangel und die Arbeitslosigkeit. Ein Thema, das bei Burden auf ein mildes Interesse stieß, sodass er sich sogar zu ein paar einsilbigen Bemerkungen aufraffte. Sevensmith Harding, sagte Gardner, habe alles getan, um im Harlower Werk Massenentlassungen zu vermeiden, und das sei auch gelungen. Man habe nur ein paar Angestellte und Arbeiter freigestellt, es habe jedoch für die betroffenen Männer und Frauen keine Härte bedeutet. Behauptete Gardner.
«Das glaube ich gern», sagte Burden.
Schon immer reaktionär, hatte er sich bis vor ein paar Jahren immer weiter und bis zur Unerträglichkeit nach rechts orientiert, bis Jenny gekommen war und ihn «umgedreht» hatte. Er hatte jetzt viel gemäßigtere Ansichten und begann auch nicht gleich, wie er es früher getan hätte, gegen Arbeitslosengeld, Sozialversicherung und die um sich greifende Arbeitsunlust oder Faulheit zu wettern. Vielleicht stimmte ihn aber auch nur seine eigene Niedergeschlagenheit so nachsichtig.
«Ich stelle fest, dass die Einstellung zur Arbeit sich verändert», sagte Gardner. «Einen Job zu haben und zu halten hat heute einen ganz anderen Stellenwert als früher.» Er begann darüber zu dozieren, wo seiner Meinung nach die Ursachen dieser neuen sozialen Verhaltensweisen lagen, und er wusste viel Interessantes darüber zu sagen. Das fand zumindest Wexford. Burden, der den Garnelensalat viel zu hastig in sich hineinschlang, sah ständig auf die Uhr. Er wurde um zwei wieder im Gerichtssaal erwartet. Ich werde nicht traurig sein, wenn ich ihn eine Weile los bin, dachte Wexford.
«Damit», wandte er sich an Gardner, «wollen Sie doch eigentlich sagen, dass die Leute trotz drohender Arbeitslosigkeit und zu geringem Arbeitslosengeld die nagende Furcht vor dem Verlust ihrer Stellung verloren haben, von der sie in den dreißiger Jahren geradezu besessen waren?»
«Ja, und sie sind, wenigstens in den mittleren Schichten, auch nicht mehr bereit, ihr Leben lang auf Biegen oder Brechen an einem verhassten Beruf festzuhalten, weil es nun einmal der Beruf ist, den sie mit zwanzig erlernt haben.»
«Und wie ist es zu dieser veränderten Haltung gekommen?»
«Das weiß ich nicht. Ich habe darüber nachgedacht, doch die Antworten, die ich gefunden habe, befriedigen mich nicht. Ich kann Ihnen aber sagen, dass mit der Angst um die Stellung und dem Respekt vor dem Arbeitgeber – nur weil er eben der Arbeitgeber ist – leider auch der Stolz auf die Leistung und die Loyalität gegen eine Firma verlorengegangen sind. Mein Marketingmanager ist ein typisches Beispiel dafür. Früher konnte man sich darauf verlassen, dass ein Mann in einer solchen Position auch ein verantwortungsbewusster Mensch war, jemand, der einen ganz bestimmt nie im Stich ließ. Er wäre stolz darauf und – ja, ich spreche es aus – dankbar gewesen, an der Stelle zu stehen, an der er stand, und das Wohlergehen seiner Firma hätte ihm ehrlich am Herzen gelegen.»
«Was hat er getan?», fragte Burden. «Hat er beschlossen, mitten im Strom die Schiffe – ich meine, den Beruf – zu wechseln?»
Das klang hämisch, aber Gardner tat so, als habe er nichts gemerkt.
«Das nicht, soweit ich weiß», antwortete er ganz gelassen. «Er ist eines Tages einfach nicht mehr erschienen. Er hat eine dreimonatige Kündigungsfrist – oder sollte sie haben. Zuerst hat uns seine Frau angerufen und gesagt, er sei krank. Und dann kein Wort mehr, bis zu seinem Kündigungsbrief. Einem kurzen, fast schroffen Brief mit einem P.S. …» Gardner sah aus, als müsse er sich rechtfertigen, und fügte fast um Entschuldigung bittend hinzu: «Es war eine ziemlich unverschämte Bemerkung. Wegen seiner Altersrente, schrieb er, werde er sich mit unserer Buchhaltungsabteilung in Verbindung setzen.»
«War er lange bei Ihrer Firma?»
«Ich glaube, er ist sofort nach der Schule zu uns gekommen und war seit fünf Jahren Marketingmanager.»
«In diesen schweren Zeiten werden Sie wenigstens keine Mühe haben, Ersatz zu finden.»
«Es bedeutet Beförderung für einen unserer besten Verkäufer. Es war schon seit jeher Firmenpolitik, einen von unseren Leuten nachrücken zu lassen. Aber in der Regel natürlich nur dann, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben.»
Burden stand auf und sagte, er müsse wieder aufs Gericht. Er schüttelte Gardner die Hand und hatte wenigstens den Anstand, etwas vor sich hin zu murmeln, das so ähnlich klang wie: «Hat mich gefreut, Sie kennenzulernen.»
«Darf ich Ihnen noch ein Bier bestellen?», sagte Wexford, nachdem Burden gegangen war, den Gardner – zu Wexfords größter Überraschung – einen netten Kerl nannte.
«Besten Dank, ja. Ich nehme nicht an, dass man uns hier vor halb drei hinauswerfen wird, oder?»
Das Bier kam, eine von hundertdreißig verschiedenen «echten» Ale-Sorten, die das Old Flag angeblich führte.
«Haben Sie vielleicht rein zufällig vor, meinen Nachbarn Rodney Williams zu befördern?», fragte Wexford.
Gardner sah ihn überrascht an.
«Rod Williams?»
«Ja. Er wohnt ganz in meiner Nähe, praktisch nur um die Ecke.»
«Rod Williams ist unser ehemaliger Marketingmanager», sagte Gardner geduldig. «Der, von dem ich eben erzählt habe, dass er uns auf sehr unschöne Weise verlassen hat.»
«Williams?»
«Ja. Ich dachte, ich hätte Ihnen die Sache erklärt. Vielleicht habe ich den Namen nicht genannt.»
«Ich habe das deutliche Gefühl, dass hier jemand etwas missverstanden hat», sagte Wexford.
«Sie, mein Lieber», antwortete Gardner lächelnd.
«Ja, es sieht ganz danach aus. Jemand hat mich falsch informiert. Soll ich also daraus schließen, dass Williams keiner Ihrer Firmenvertreter war und nicht den Bezirk Suffolk bereiste?»
«Das war er früher, und das hat er früher getan. Bis vor fünf Jahren. Dann musste unser damaliger Marketingmanager wegen eines Herzfehlers vorzeitig in den Ruhestand treten, und getreu unserer Firmenpolitik haben wir Rod Williams befördert.»
«Für seine Frau ist er immer noch Vertreter. Was bedeutet, dass er die Hälfte seiner Zeit immer noch in Suffolk verbringt.»
Gardner zog die Brauen hoch und lächelte schief. «Sein Privatleben geht mich nichts an.»
«Mich auch nicht.»
Gardner wechselte das Thema. Er fing an, von seiner ältesten Tochter zu sprechen, die im Spätsommer heiraten wollte. Wexford trennte sich schließlich mit dem Versprechen, sich wieder zu melden, «Dora zu bitten, Pam anzurufen und etwas zu verabreden». Auf der Heimfahrt nach Kingsmarkham dachte er eine Zeitlang über Rodney Williams nach. In seiner eigenen Ehe hatte er nie ein Alibi gebraucht. Er fragte sich, wie es sein mochte, wenn fünf Jahre lang ein feststehendes Alibi wesentlicher Bestandteil einer Ehe war? Undenkbar. Unvorstellbar. Er gab es auf, sich in eine solche Situation hineinzudenken, sie auf sich zu beziehen, und betrachtete sie nur noch mit Abstand.
Möglicherweise hatte Williams vor fünf Jahren ein Mädchen kennengelernt, mit dem er zusammen sein wollte, ohne seine Ehe zu beenden. Dadurch, dass er seine Beförderung vor seiner Frau geheim hielt, hatte er die Möglichkeit dazu. Wahrscheinlich wohnte das Mädchen in Myringham. Während Joy Williams ihren Mann in einem Motel bei Ipswich vermutete, hielt er sich bei der anderen auf, lebte wahrscheinlich mit ihr zusammen und saß von neun bis fünf im Büro bei Sevensmith Harding in Myringham.
Es war eine jener Situationen, über die Männer sich amüsieren. Wexford gehörte nicht zu ihnen. Und es gab noch einen anderen Aspekt – einen, den nur wenige Männer komisch finden würden. Wenn Williams seiner Frau nichts von seiner Beförderung erzählt hatte, dann hatte er ihr wahrscheinlich auch verschwiegen, dass er jetzt wesentlich mehr verdiente. Trotzdem war das Rätsel gelöst. Williams hatte an die Firma geschrieben, Joy hatte angerufen und ihn entschuldigt. Und in der Alverbury Road gelang es Williams vielleicht auch noch jetzt, sich mit einem Rest von Täuschung und Lüge davor zu schützen, dass man ihm hinter die Schliche kam.
Es war neun Uhr abends, er saß noch immer im Büro und ging zum zehnten Mal die Aussagen durch, die er gegen einen gewissen Francis Wingrave Adams gesammelt hatte, der wegen Betrugs angeklagt werden sollte. Wexford bezweifelte jedoch, dass es ihnen gelingen würde, lückenlose Beweise zu finden, und der Polizeianwalt war derselben Meinung wie er, obwohl sie beide wussten, dass Adams schuldig war. Beim letzten Schlag der Kirchenuhr – die von St. Peter klang genauso dumpf wie die von St. Mary Woolnoth – räumte er die Papiere auf und machte sich zu Fuß auf den Heimweg.
In letzter Zeit ging er immer zu Fuß ins Büro und nach Hause. Dr. Crocker hatte es ihm dringend empfohlen und darauf hingewiesen, dass es ja nicht einmal eine halbe Meile war.
«Dann lohnt es sich doch kaum», hatte Wexford erwidert.
«Zwei Meilen täglich könnten Ihnen das Leben um zehn Jahre verlängern.»
«Heißt das, dass ich dreißig Jahre länger leben kann, wenn ich jeden Tag sechs Meilen zu Fuß gehe?»
Auf diese Frage hatte der Doktor nicht geantwortet. Und Wexford, der so tat, als habe er für den ärztlichen Rat nur Spott und Hohn, befolgte ihn nun doch bis zu einem gewissen Grad. Manchmal ging er durch die Tabard Road, an Burdens Bungalow vorbei, manchmal durch die Alverbury Road, in der die Williams wohnten. Gelegentlich schlug er auch den längeren Weg über einen Wiesenpfad ein. Heute Abend wollte er schnell noch bei Burden hineinschauen, um mit ihm ein letztes Mal über den Fall Adams zu sprechen.
Plötzlich hatte er das Gefühl, dass es über den Mann, der eine ältere Frau um 20000 Pfund betrogen hatte, eigentlich kaum noch etwas zu sagen gab. Er wollte auch gar nicht über ihn sprechen. Er wollte versuchen, aus Burden herauszubekommen, warum er so niedergeschlagen war.
Die Burdens lebten noch immer in dem Bungalow, den Burden kurz nach seiner ersten Heirat bezogen hatte. Der Garten sah nicht sonderlich gepflegt aus, und der Efeu, der sich an den Hausmauern emporranken wollte, war rücksichtslos zurückgeschnitten worden. Nur die Haustür veränderte sich von Zeit zu Zeit. Sie hatte schon alle Farben durchgespielt – Burden ersparte einem in dieser Hinsicht nichts –, aber Wexford hatte das Rosenrot am besten gefallen. Jetzt prangte sie in einem dunklen Grünblau – Sevenshine Pfauenblau, orientalisch vermutlich. Da der Abend allmählich hereinbrach, brannte die Außenleuchte, eine bleigefasste sternförmige Laterne.
Jenny öffnete ihm. Sie war jetzt im fünften Monat, «und man sah es schon», wie die alten Weiber sagten. Sie trug keinen Schwangerschaftshänger, sondern ein Kleid mit weiten Ärmeln, viereckigem Ausschnitt und hoher Taille wie die Frau auf dem Vermeer-Gemälde Der Brief. Sie hatte sich das goldbraune Haar wachsen lassen, und es reichte ihr jetzt bis auf die Schultern. Trotzdem erschrak Wexford über ihr Aussehen. Sie wirkte mutlos und verhärmt.
Burden, der sich vor Jahren damit einverstanden erklärt hatte, Wexford nicht mehr «Sir» zu nennen, umging seither jede Anrede. Aber Jenny nannte ihn Reg. «Mike ist im Wohnzimmer, Reg», sagte sie und fügte auf eine für sie ganz und gar untypische Weise hinzu: «Ich wollte eben ins Bett gehen.»
Er fühlte sich genötigt zu sagen, es tue ihm leid, dass er so spät noch störe, obwohl es erst zwanzig nach neun war. Sie zuckte mit den Schultern und sagte, das mache doch nichts, und es klang, als sei ihr alles gleichgültig. Er folgte ihr in das Zimmer, in dem sich Burden aufhielt.
Er saß in der Mitte des dreisitzigen Sofas und las die Polizeizeitung. Wexford hätte erwartet, dass Jenny neben ihm gesessen hatte, doch das war nicht der Fall gewesen. Neben einem Sessel am anderen Ende des Zimmers lagen ein aufgeschlagenes Buch mit den Seiten nach unten und ein weißes Strickzeug, das so aussah, als werde nicht gerade mit Begeisterung daran gearbeitet. Auf dem Fensterbrett stand in einer gläsernen Vase welkender Goldlack in einer knappen Handbreit alten bräunlichen Wassers.
«Was zu trinken?», fragte Burden. «Es ist Bier da. Es ist doch Bier da, nicht wahr, Jenny?»
«Keine Ahnung. Ich rühr das Zeug nie an.»
Burden sagte nichts. Er ging in die Küche und kam mit zwei Büchsen Bier auf einem Tablett zurück. Seine erste Frau hätte gesagt, und auch Jenny hatte es noch vor kurzem getan, dass sie Gläser brauchten. Heute setzte sie sich nur matt nieder, hob Buch und Strickzeug auf, sah jedoch keins von beiden an und sagte: «Ihr könnt aus der Dose trinken, nicht wahr?»
Wexford begann sich unbehaglich zu fühlen. Eine starke, zornige Spannung schien in der Luft zu hängen wie Rauch, der ihm in die Luftröhre drang, sodass er glaubte, ersticken zu müssen. Er riss die Lasche von seiner Bierdose ab. Jenny hielt die Stricknadeln in der Faust und starrte die Wand an. Wexford hatte nicht die Absicht, in ihrer Gegenwart über Francis Wingrave Adams zu sprechen. Wenn sie früher etwas Ähnliches zu bereden gehabt hatten, waren sie immer in ein anderes Zimmer gegangen. Burden rührte sich jedoch nicht von der Stelle und runzelte leicht die Stirn, wie immer in letzter Zeit. Er riss mit einer heftigen, unachtsamen Bewegung seine Bierdose auf, sie schäumte über, und der Schaum landete auf dem Teppich.
Vor drei Monaten hatte Wexford erlebt, wie Jenny ihren Mann getröstet und sofort praktische Hilfe geleistet hatte, als er nicht nur einen Löffel voll Bier verschüttet hatte, sondern ein Schälchen mit Erdbeermousse auf den helleren und neueren Speisezimmerteppich fallen ließ. Sie hatte gelacht und gesagt, die «Aufräumungsarbeiten» solle er ruhig ihr überlassen. Jetzt stieß sie einen zornigen Schrei aus und sprang aus dem Sessel auf.
«Schon gut, schon gut», sagte Burden. «Ich bring das schon in Ordnung. Außerdem ist doch kaum was passiert. Ich hole ein Tuch.»
Sie brach in Tränen aus, schlug eine Hand vor das Gesicht und stürzte hinaus. Burden folgte ihr. Das heißt, Wexford hatte gedacht, Burden sei hinter ihr hergelaufen, doch er kam fast umgehend mit einem Putzlumpen zurück.
«Tut mir leid», sagte er, auf dem Boden kniend. «Es geht natürlich nicht um das Bier. Sie fährt wegen jeder Kleinigkeit aus der Haut. Achten Sie einfach nicht darauf.» Er sah mit ärgerlicher Miene auf. «Ich habe jedenfalls beschlossen, in Zukunft nicht mehr darauf zu achten.»
«Aber wenn es ihr nicht gutgeht, Mike …»
«Es geht ihr ausgezeichnet.» Burden stand auf und ließ den Lumpen auf den gefliesten Kaminsockel fallen. «Ihre Schwangerschaft verläuft geradezu ideal und beschwerdefrei. Sie leidet nicht einmal unter Übelkeit. Wenn ich daran denke, was Jean durchgemacht hat …» Wexford traute seinen Ohren nicht. Ein Ehemann – und noch dazu ein Ehemann wie Burden – zog einen solchen Vergleich! Ihm schien auf einmal klarzuwerden, was er da gesagt hatte, und er wurde feuerrot. «Nein, es geht ihr wirklich bestens. Ehrlich. Sie sagt es ja selbst. Sie ist einfach nur neurotisch.»
Wexford hatte schon früher manchmal gedacht, dass fast die ganze Bevölkerung mit Tranquilizern ruhiggestellt oder gar in Nervenheilanstalten eingeliefert werden müsste, wenn tatsächlich alles neurotisch gewesen wäre, was Burden so bezeichnete. «Die Amniozentese war doch in Ordnung, oder?», sagte er. «Haben die Ärzte ihr vielleicht etwas gesagt, was sie beunruhigt?»
Burden zögerte. «Ja, das haben sie. Leider.» Er lachte auf. Es klang hässlich und unfroh. «Genau das haben sie getan. Sie haben ihr etwas gesagt, was sie beunruhigt. Damit haben Sie den Nagel auf den Kopf getroffen. Mich beunruhigt es nicht, und ich bin der Vater des Kindes. Aber sie macht sich schreckliche Sorgen, und ich bin derjenige, der darunter zu leiden hat.» Er setzte sich und sagte sehr laut, schrie es fast heraus: «Aber ich will nicht drüber reden! Ich habe schon zu viel gesagt und nicht die Absicht, noch mehr zu sagen! Ich habe das Gefühl, eine Formel zu lernen, um das Benehmen meiner Frau zu erklären, und mit dieser Formel jeden Besucher an der Haustür empfangen zu müssen.»
«Dazu brauchen Sie nichts zu lernen», antwortete Wexford gelassen, «das können Sie aus dem Stegreif, weil Sie ohnehin nur brüllen.»
Burden warf ihm einen finsteren Blick zu.
«Ich bin wegen Adams gekommen», sagte Wexford. «Oder nehmen Ihre häuslichen Probleme Sie so in Anspruch, dass Sie sich für unsere Angelegenheiten nicht mehr interessieren?»
«Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich einfach nicht mehr darauf achten werde», erwiderte Burden, und dann sprachen sie eine halbe Stunde lang über Adams, obwohl nicht viel dabei herauskam.
Als Wexford nach Hause kam, saß Dora im Bett und las. Während er sich auszog, berichtete er ihr, was er bei den Burdens erlebt hatte.
«Sie sind schon zu alt, um Babys zu bekommen», war ihr einziger Kommentar.
«Du meinst, sie handeln wider die Natur?»
«Du wirst überrascht sein, mein Junge, aber das meine ich wirklich. – Übrigens, Rodney Williams ist noch immer nicht aufgetaucht. Ich habe Joy getroffen, und sie hat noch kein Wort von ihm gehört.»
«Aber ich dächte, sie hätte bei Sevensmith Harding angerufen», warf Wexford ein.
«Du meinst, du hast ihr dazu geraten. Du hast ihr gesagt, sie soll dort anrufen und feststellen, ob die ihr was sagen können. Und das will sie jetzt auch tun.»
Das hatte Wexford nicht gemeint. Und er ging mit der festen Überzeugung zu Bett, dass er heute nicht zum letzten Mal von der Affäre Williams gehört hatte.
3
Länger als zwei Wochen beobachtete er jetzt schon den dunkelblauen Ford Granada, der vor seinem Haus in der Arnold Road in Myringham parkte. Das erste Mal hatte er ihn kurz nach Ostern dort entdeckt. Aus seinen Vorderfenstern konnte Graham Gee ihn ebenso wenig sehen wie aus dem Vorgarten, weil ihm dort die hohe Geißblatthecke die Sicht versperrte. Er sah ihn, wenn er selbst am Morgen aus seiner Garage fuhr und am Spätnachmittag um halb sechs nach Hause kam.
Zuerst – sagte er bei der Polizei aus – habe er gedacht, der Wagen könnte etwas mit dem Jungen von gegenüber zu tun haben, dem Teenagersohn der Leute, die den Bungalow bewohnten. Doch dann schien ihm das Auto für einen Jugendlichen zu gediegen. Nachdem er diese Theorie verworfen hatte, fragte er sich, ob der Wagen vielleicht einem Pendler gehörte, der die Arnold Road als ständigen Parkplatz benutzte. Zwar war es von hier noch ein gutes Stück zum Bahnhof Myringham-Süd – etwas mehr als eine Viertelmeile –, doch war es vermutlich die dem Bahnhof nächstgelegene Straße, in der nicht auf beiden Seiten Stoßstange an Stoßstange die Autos anderer Pendler parkten.
Für Graham Gee war der Ford Granada vor seiner Gartentür der Anfang vom Ende. Bald würden die Autos von hundert Bahnreisenden die Arnold Road verstopfen. Man musste dem Übel wehren, solange noch Zeit war. Graham Gee brauchte nicht zu pendeln. Er war Wirtschaftsprüfer und arbeitete in Pomfret.
Die Arnold Road war das, was man eine «gehobene Wohngegend» nennt. Freistehende Häuser inmitten großer Gärten. Dort gab es keine zwielichtigen Elemente, und es gab keine Vergehen oder gar kriminellen Delikte – außer dass im vergangenen Herbst jemand aus Nachbars Vorgarten Dahlien gestohlen hatte. Graham Gee war daher ziemlich überrascht, als eines Morgens die Radkappen des blauen Ford Granada verschwunden waren. Vielleicht hatten sie aber auch schon immer gefehlt, das wusste er nicht so genau. Dass die Räder aber noch dran gewesen waren, das wusste er. Der Wagen hatte nicht immer auf Ziegelsteinen aufgebockt gestanden. Schmutzig, mit getrockneten Regentropfen gesprenkelt, hockte er jetzt unelegant auf seinen Ziegeln und sah aus, als gehöre er doch dem Teenager von gegenüber.
Graham Gee unternahm noch immer nichts, obwohl er jetzt wusste, dass das Auto immer da war, nicht morgens abgestellt und abends abgeholt wurde. Seit einer Woche war es fahruntüchtig, seiner Beweglichkeit beraubt. Erst als jemand die Heckscheibe zertrümmert hatte, hielt Graham Gee es für richtig, etwas zu tun.
Die Heckscheibe war zertrümmert, die vorderen Türen geöffnet und das Wageninnere ausgeschlachtet worden: das Radio herausgenommen, die Kopfstützen entfernt und aus dem Armaturenbrett etwas herausgebohrt worden – eine Uhr vermutlich. Obwohl der Kofferraum aufgebrochen war, hatten die Diebe sich nicht an der Schneeschaufel vergriffen, die darin lag. Gee rief die Polizei an.
Die Polizei brauchte nicht einmal die überregionale Zulassungsstelle in Swansea zu bemühen, um den Halter des Wagens zu ermitteln. Die Wagenpapiere lagen zusammen mit einer Straßenkarte von Südengland, einem Kugelschreiber und einer Sonnenbrille im Handschuhfach.
In den Zulassungspapieren eines Fahrzeugs stehen Name und Adresse des Halters, nicht des Eigentümers, was der Polizei die Arbeit ebenfalls erleichterte. Halter des blauen Ford Granada war ein gewisser Rodney John Williams, wohnhaft in Kingsmarkham, Alverbury Road 31.
Warum hatte Williams den Wagen in der Arnold Road abgestellt, wenn der Firmenparkplatz von Sevensmith Harding hinter dem Bürohaus in der High Street nur eine knappe Viertelmeile entfernt war? Der Parkplatz wurde nie abgeschlossen, es gab auch kein Tor, sondern nur eine Öffnung im Zaun und am Zaun eine kleine Tafel, auf der «Unbefugte» gebeten wurden, den Parkplatz nicht zu benutzen.
«Ich begreife das nicht», sagte Miles Gardner. «Offen gesagt, haben wir uns überlegt, ob wir den Wagen abschleppen lassen sollen, aber wir wissen nicht, wo Williams ist. Er hat das Fahrzeug in seinem Kündigungsbrief nicht erwähnt. Und wo immer er gewesen sein mag, als er kündigte, mit seiner Frau ist er nicht mehr zusammen, sonst hätten wir uns an sie gewandt. Er scheint sich buchstäblich in Luft aufgelöst zu haben. Ein bisschen viel, das Ganze, nicht wahr? Ich vermute, der Wagen sieht schlimm aus, wahrscheinlich ist nur noch das leere Gehäuse übrig.»
«Der Motor ist noch da», sagte Wexford.
Gardner verzog das Gesicht. Sie saßen in seinem zwar luxuriösen, aber ziemlich düsteren Büro, einem Raum, der vollständig mit Eiche getäfelt war. Die Ausstattung stammte aus der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen, in der es Hartholz noch in Hülle und Fülle gab. Eure eigenen vier Wände streicht ihr nicht mit Sevenstar matt, dachte Wexford.
Es gab hier mehr gerahmte Fotografien als im Wohnzimmer eines älteren Ehepaars: auf Gardners Schreibtisch, gewissermaßen als Blickfang für ihn, wenn er von der Arbeit aufsah, ein großes Bild der langen Mrs. Gardner und ihrer drei Töchter, liebevoll aneinandergeschmiegt, mit verschlungenen Armen; an den Wänden verschiedene Männergruppen bei Jubiläen, anderen Feiern und Festen oder sportlichen Ereignissen der Firma. Unter anderem ein Foto von einem Kricketmatch. Der Schlagmann war ein hochgewachsener, schlaksiger Typ. Rodney Williams. Die hohe Stirn, die ein wenig hohlen Züge, die man vom Profil bestimmt noch deutlicher sah, der schmale Mund, zu einem Lachen verzogen, waren unverkennbar.
Gardner betrachtete ihn bekümmert.