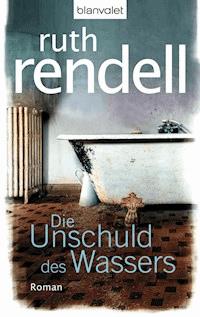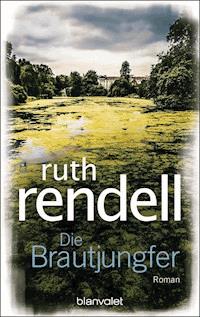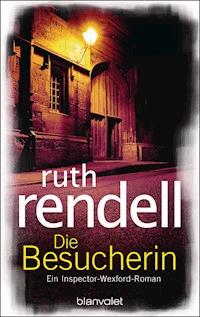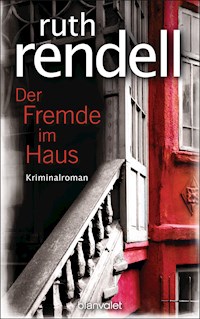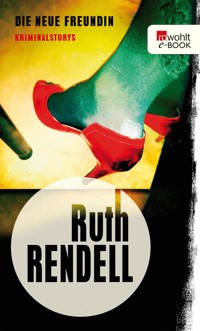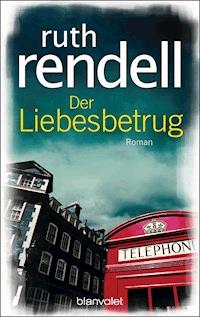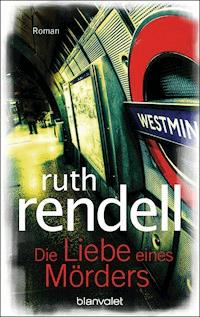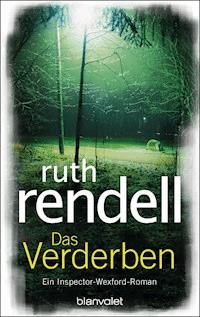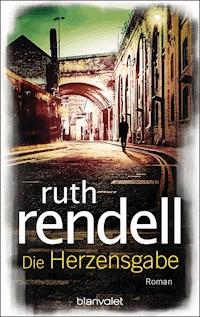
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Ein gefährlicher Schritt in die Unabhängigkeit: Die 28-jährige Mary Jago hat sich ihrem dominanten Verlobten Alistair lange untergeordnet – bis sie eines Tages aufbegehrt. Gegen Alistairs Willen spendet sie Knochenmark für einen unbekannten Leukämiekranken. Aber Alistair wacht weiterhin eifersüchtig über jeden ihrer Schritte, erst recht, als ganz in der Nähe Obdachlose brutal ermordet werden. Doch dann lernt Mary jenen jungen Mann kennen, dem sie mit ihrer Spende helfen konnte ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 578
Ähnliche
Ruth Rendell
Die Herzensgabe
Buch
Ein gefährlicher Schritt in die Unabhängigkeit: Die 28-jährige Mary Jago hat sich ihrem dominanten Verlobten Alistair lange untergeordnet – bis sie eines Tages aufbegehrt. Gegen Alistairs Willen spendet sie Knochenmark für einen unbekannten Leukämiekranken. Aber Alistair wacht weiterhin eifersüchtig über jeden ihrer Schritte, erst recht, als ganz in der Nähe Obdachlose brutal ermordet werden. Doch dann lernt Mary jenen jungen Mann kennen, dem sie mit ihrer Spende helfen konnte ...
Autorin
Ruth Rendell wurde 1930 in South Woodford/London geboren. Zunächst arbeitete sie als Journalistin, bevor sie sich ganz dem Schreiben von Romanen widmete. Dreimal bereits erhielt sie den Edgar-Allan-Poe-Preis und zweimal den Golden Dagger Award. 1997 wurde sie mit dem Grand Master Award der Crime Writer‘s Association of America, dem renommiertesten Krimipreis, ausgezeichnet und darüber hinaus von Königin Elizabeth II. in den Adelsstand erhoben. Ruth Rendell, die auch unter dem Pseudonym Barbara Vine bekannt ist, lebt in London.
Die Reihenfolge der Inspector-Wexford-Romane sowie weitere Romane finden Sie hier.
Ruth Rendell
Die Herzensgabe
Roman
Aus dem Englischen von Cornelia C. Walter
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Die Originalausgabe erschien unter dem Titel The Keys to the Streetbei Hutchinson, London.
E-Book-Ausgabe 2015
bei Blanvalet, einem Unternehmen der
Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Copyright © der Originalausgabe 1996 by Kingsmarkham Enterprises Ldt.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 1997 by Blanvalet Verlag, München, in der Verlagsgruppe Bertelsmann GmbH
Umschlaggestaltung und -motiv: www.buerosued.de
Satz: EDV-Fotosatz Huber/Verlagsservice G. Pfeifer, Germering
ISBN: 978-3-641-15138-6V002
www.blanvalet.de
1
_____
Jedes Tor zum Park wird von Eisenspitzen gekrönt, an manchen Toren sind es bis zu siebenundzwanzig, an anderen nur achtzehn oder elf. Der Park selbst ist zum größten Teil von Dornenhecken umgeben, doch daneben gibt es Hunderte von Metern dieser schmiedeeisernen, lanzenartig geformten Gitterstäbe. An einigen sind die Spitzen stumpf, wie an dem Gitter um die Gartenanlage am Gloucester Gate, andere sind reich verziert und wieder andere in der Mitte gebogen. Vor einer der Villen haben die Spitzen an den hohen Eisengittern je sechs klauenförmige Auswüchse, gebogen und scharf wie Krallen. In einer bestimmten Zeile von Stadthäusern tragen die Säulen gespreizte Spitzen, die wie blühende Dornenbäume wirken. Würde man alle Eisengitterspitzen im Park und in seiner Umgebung zusammenzählen, käme man auf einige Millionen. Die Spitzen passen gut zu der Architektur des 18. Jahrhunderts.
Nachts ist der Park für den Publikumsverkehr geschlossen. Die Lebewesen, die bleiben dürfen, sind hauptsächlich Zootiere und Wasservögel. Das ganze Jahr über öffnen sich die Gittertore allmorgendlich um sechs und schließen abends bei Sonnenuntergang, im Winter also um halb fünf, im Mai jedoch nicht vor halb zehn. Der Park erstreckt sich kreisförmig über eine Fläche von vierhundertvierundsechzig Acre Land. Parallel zum umgebenden Straßenring verläuft ein zweiter Ring, der Outer Circle. Darin liegen, weit voneinander abgesetzt, das gleichschenklige Dreieck des Londoner Zoos, der See mit seinen drei Armen und vier Inseln und um die Ziergärten herum eine weitere Straße, die auf dem Stadtplan wie ein Rad mit zwei vorspringenden Speichen aussieht, der Inner Circle.
Der Park ist bei Nacht wie ausgestorben. Jedenfalls wird dies angestrebt. Bei ihren Patrouillen zwischen Sonnenuntergang und Morgengrauen wirft die Parkpolizei ein besonders wachsames Auge auf die Restaurantzugänge – potentielle Unterkünfte –, auf die parknahen Wohnhäuser, Villen und teuren Anwesen sowie auf Winfield House, die Residenz des amerikanischen Botschafters. Kein Obdachloser könnte unbehelligt auf der windgeschützten Seite eines Pavillons oder des Musikpodiums schlafen, aber da es unmöglich ist, jede Nacht die ganze Gegend abzusuchen, bleiben als Versteck immer noch das Kanalufer, die weitläufigen Rasenflächen und im Sommer das hohe Gras unter den Bäumen.
An der Nordseite des Parks, hinter dem Zoo und der Prince Albert Road, liegen die Viertel Primrose Hill und St. John’s Wood; dort befinden sich die Kirche von St. John’s Wood, Lord’s Cricket Ground und südöstlich davon die Londoner Moschee. Die Park Road verläuft in Richtung Baker Street und Sherlock Holmes Street an der Londoner Wirtschaftshochschule und der anglokatholischen Kirche St. Cyprian vorbei, in deren weißgoldenem Inneren es nach Weihrauch duftet. Weiter geht es über die Marylebone Road, das Planetarium und Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett – diese beliebteste aller Londoner Touristenattraktionen zählt mehr Besucher als der Tower oder Buckingham Palace – zur Königlichen Musikakademie, zum Park Crescent und Park Square mit der abgeschiedenen Gartenanlage und dem unterirdischen Tunnel, der den halbmondförmigen Straßenzug mit dem Garten verbindet. Hier grenzt der Park an die Albany Street, die von der U-Bahnstation Great Portland Street schnurgerade wie eine römische Heeresstraße in nördlicher Richtung verläuft und weiter oben auf die Albert Road und die Gloucester Avenue stößt. In Primrose Hill bilden die Straßenzüge die Form eines Tennisschlägers, wobei Gloucester Avenue den Griff darstellt. Und überall ragen die Eisengitter mit ihren geraden und scharfen, rechtwinklig gebogenen oder verzierten und stumpfen Spitzen empor.
Albany Street ist nicht so begrünt und abgeschieden wie die meisten anderen Straßen in unmittelbarer Nachbarschaft des Parks, sondern breit, grau und baumlos. Auf der einen Seite der Straße stehen Mietskasernen, auf der anderen, etwas zurückversetzt, die hochherrschaftlichen, großzügig angelegten Häuserzeilen von Cambridge, Chester und Cumberland Terrace mit ihren Kolonnaden, Ziergiebeln und Statuen – und ihren wohlhabenden Bewohnern. Hinter den Mietskasernen auf der anderen Seite wirkt die Gegend plötzlich weniger respektabel, wenngleich noch lange nicht so heruntergekommen wie Somers Town zwischen den Bahnhöfen Euston und St. Pancras. Aus einer dieser Straßen – in der Nähe von St. James’ Gardens – kam ein junger Mann und überquerte den Munster Square in Richtung Albany Street.
Er wurde allgemein mit Hob angesprochen, den Anfangsbuchstaben seiner beiden Vornamen und seines Familiennamens. Ansonsten unterschied er sich von seinen Mitmenschen hauptsächlich durch die Größe seines Kopfes. Sein Körper war zwar kräftig, trotzdem wirkte sein Kopf im Verhältnis zu groß. Falls er, was fraglich schien, einmal die Fünfzig erreichen sollte, würden ihm seine Hängebacken bis auf die Schultern reichen. Das helle, etwa zwei Zentimeter kurz geschorene Haar auf seinem riesigen Schädel glänzte im gelblichen Licht der Neonlampen. Die Mischung aus hellem Haar und braunen Augen war ungewöhnlich. In seinen Augen, die eine seltsame Maserung hatten, wie Schokoladenmousse, weiteten sich die Pupillen manchmal wie bei einer Katze und zogen sich dann wieder auf die Größe eines Punktzeichens auf der Schreibmaschine zusammen.
Hob hatte einen Job zu erledigen, für den er soeben die Hälfte des Honorars von fünfzig Pfund erhalten hatte, also fünfundzwanzig. Diese Summe wollte er mit seinen übrigen Ersparnissen zusammenlegen, um sich den Stoff zu kaufen, ohne den er überhaupt nichts zuwege brachte. Oft wünschte er sich, eine Frau zu sein, denn Frauen konnten schnell und – soweit er es beurteilen konnte – leicht Geld verdienen. Er dachte an eine der ersten Bemerkungen, die er von einem Erwachsenen – einem dieser Onkel, ein Freund seiner Mutter – gehört hatte: Jede Frau sitzt auf einem Geldsack.
Hob hatte einen Affen. Mit diesem Ausdruck bezeichnete er seinen gegenwärtigen Zustand. Als ihm eine seiner Stiefschwestern einmal ihre Panikanfälle beschrieb, erkannte er darin seinen eigenen Zustand wieder. Nur dass er bei ihm länger dauerte und schlimmer verlief. Dieser Zustand war allumfassend und ging so weit, dass er sich vor allem fürchtete, was er sah oder hörte, aber auch vor dem, was er nicht sehen konnte, und vor der Stille. Wenn dieser Zustand sich verstärkte, fühlte er sich in einer riesigen Blase aus Angst wie in einer gläsernen Kugel eingeschlossen und wollte auf sie einschlagen und ihre gekrümmten Wände zertrümmern. Manchmal tat er es auch, sogar auf offener Straße wie jetzt. Dann wechselten die Leute auf die andere Straßenseite hinüber, um dem Verrückten aus dem Weg zu gehen, der in die leere Luft boxte.
Noch hatte er dieses Stadium nicht erreicht. Er hatte weder Schmerzen noch Ekelgefühle. Doch mehr als zielstrebig diese breite, graue Straße entlangzugehen, auf der sich momentan keine herüberglotzenden oder ausweichenden Leute aufhielten, hätte er nicht zuwege gebracht, und schon gar nicht den Job, für den er das halbe Honorar bekommen hatte. Seine Füße bewegten sich wie von selbst. Sogar auf Entzug glaubte er manchmal, ewig weiterlaufen zu können, immer weiter, über die dunklen Rasenflächen, die grüne Anhöhe, die Hügel im Norden der Stadt bis zu den weit dahinterliegenden Feldern und Wäldern.
Doch so weit zu laufen war gar nicht nötig. Gupta oder Carl oder Lew standen bestimmt schon auf der anderen Seite der Cumberland Gate bei den Ginkgobäumen. Er ging weiter über die Bodensenken und Durchgänge den Abhang hinauf auf die Häuserzeile von Cumberland Terrace zu. Sein Schatten schleppte sich schwerfällig dahin, ein Scherenschnitt auf dem verwitterten Kopfsteinpflaster. An Außenwänden und hinter üppigen Laubkaskaden leuchteten Lichter auf.
Die ringförmige, tagsüber dichtbevölkerte Straße am äußeren Parkrand, der sogenannte Outer Circle, war nachts völlig ausgestorben. Kein einziger Wagen parkte auf der glänzenden Fläche. Die herrschaftlichen Stadthäuser, eigentlich eher von Bäumen umstandene Paläste, schlummerten tief hinter dem dichten Blattwerk, und obwohl die meisten ihrer Fenster hinter Rollläden verschwunden waren, leuchtete allenthalben noch orangegelbes Licht. An den Gehwegen brannten auf jeder Seite Straßenlampen, so weit das Auge reichte. Dazwischen schimmerte die Dunkelheit. Er überquerte die Straße. Das Cumberland Gate war schon seit fast drei Stunden abgesperrt.
Oben auf dem Gittertor saßen Eisenspitzen, achtzehn auf jedem Torflügel. Wenn er gut drauf war – so nannte er es, wenn er keinen Affen hatte –, wäre er mühelos über das Tor geklettert. Nun aber kämpfte er sich wie ein Greis auf die andere Seite hinüber, mit der gleichen Behutsamkeit und Angst vor Fleischwunden und Knochenbrüchen wie ein alter Mann. Jenseits des Tores erstreckte sich im Halbdunkel eine freie Fläche aus grauem Rasen, blass erleuchteten Fußwegen und schwarzen Bäumen, den dünngliedrigen Ginkgobäumen, bei deren Anblick er an Skorpione denken musste.
Die Polizei patrouillierte in Streifenwagen, zu Fuß, auf Fahrrädern, und manchmal auch mit Hunden. Einer von Hobs – und Carls – Leitsätzen besagte, dass die Polizei nicht überall gleichzeitig sein konnte, und meistens war sie tatsächlich nicht da, wo Carl oder er sich gerade aufhielt. Er ging auf die Bäume zu. Eigentlich wollte er kein Geräusch verursachen, doch als ein junger Skorpion sich vom elterlichen Rücken löste, Flügel bekam und sich in einen Flugsaurier verwandelte – eine Taube hatte sich aus einer Baumkrone erhoben –, schrie er erschrocken auf.
Eine Hand legte sich von hinten über seinen Mund. Er hatte keine Angst, denn er wusste, wem sie gehörte.
Gupta fragte: »Bist du verrückt?«
»Ich bin nicht gut drauf.«
Sogar im Dunkeln konnte er Guptas blutige Zähne beim Sprechen sehen. Es sah aus, als hätte er von einem rohen Steak abgebissen, tatsächlich hatte er aber Betel im Mund. Hobs gesamte Barschaft wechselte für das, was Gupta daraufhin hervorzog, den Besitzer: ein Säckchen mit Reißverschluss, in dem sich ein kleiner Klumpen befand, eine Art weißer Kieselstein, jedoch rau und unregelmäßig, nicht vom Meer glattgewaschen. Nicht zum ersten Mal dachte Hob an seine eigene Kraft und an Guptas Zierlichkeit und an die vielen anderen weißen Steinchen in dem Joghurtbecher, mit denen er lange gut drauf sein würde. Doch er verwarf den Gedanken sofort wieder. Die Vergeltung würde auf dem Fuße folgen. Er hatte sie für die anderen ein paarmal selbst ausgeführt, wusste also Bescheid. Als erstes würden sie ihm die Beine brechen. Er bezweifelte, dass er über den ersten Faustschlag in Guptas schmächtigen Bauch hinauskommen würde.
Seltsam, aber er hatte es aufgegeben, die Sache verstehen zu wollen: Wenn sein Zustand so entsetzlich war, weshalb wollte er ihn dann verlängern? Immer war es das gleiche. Irgend so ein Onkel von damals hätte gesagt, es ist, als schlüge man den Kopf gegen die Wand. Es tut so gut, wenn man damit aufhört! Aber das traf es nicht ganz. Eher so, dass der Schmerz des Entzugs, die Panik und die totale Sinnlosigkeit sich in Wohlgefühl verwandelten, sobald er wusste, dass er ein Mittel hatte, dem Ganzen ein Ende zu setzen. Dann empfand er seinen Zustand fast als angenehm, während er in die Glaskugel eingeschlossen weiterging, den Kopf dabei hin und her rollte und den Mund zu einem schiefen Lächeln verzog.
Wenn er in Richtung Chester Road zur inneren kreisförmigen Straße, dem sogenannten Inner Circle, ging, würde er mit Sicherheit der Polizei begegnen, also machte er kehrt. Doch anstatt wieder über das Cumberland Gate zu klettern, hielt er sich auf dem Grasstreifen dicht an der Hecke und merkte plötzlich, dass ihm kalt war. Es war eine typische kühle Aprilnacht. Der Schweiß brach ihm wiederholt im Gesicht und am Oberkörper aus und trocknete kalt und salzig an. Als er sich mit der Zunge über die ausgedörrte Oberlippe fuhr, schmeckte sie nach Salz.
Wenn sich sein Zustand noch länger hinzog, würde bald dieses Zittern einsetzen, das Ekelgefühl und eine große Schwäche, als ob er in wenigen Minuten um Jahre alterte. Es kam darauf an, sich in der goldenen Mitte zu halten. Wieder erklomm er ein spitzengekröntes Eisengitter, diesmal am Gloucester Gate, und diesmal fiel es ihm schwerer, denn er war ein noch älterer Greis mit noch schlimmerer Arthritis und noch furchtsameren Knochen.
Er schaffte es auf die andere Seite und blieb am oberen Ende der Albany Street an der Ampel stehen. Es dauerte einige Sekunden, vielleicht eine Minute, bevor er merkte, dass die Ampel von Rot auf Grün und wieder auf Rot geschaltet hatte. Ein einsames Auto blieb stehen und wartete. Er überquerte die Straße und hielt sich an der Brückenbrüstung fest – für die anderen Passanten wieder nur so ein Betrunkener –, bog dann abrupt in die Park Village East ein und stieß das Törchen zu dem verwahrlosten Garten auf.
Das Haus, das in der Dunkelheit vor ihm aufragte, wurde gerade renoviert. Von den Fenstern waren nur noch schwarze Löcher übrig. Überall lag Baumaterial herum, Holz, Ziegel, eine Leiter. Beinahe wäre er über eine Betonmischmaschine gestolpert, ein riesiges bleiches Tier mit schwerem Hinterteil und einem winzigen, dümmlichen Kopf. Unten am Hang lag die Grotte, rabenschwarz bis auf das schimmernde Wasser in ihrer Tiefe. Beim Hinunterstolpern zerkratzte er sich die Hände an den Dornbüschen, als er versuchte, den Stacheldrahtrollen auszuweichen. Unten angekommen, hockte er sich zitternd und zusammengekrümmt in den schmalen Lichtstrahl, der von einer Laterne auf der Brücke auf die Mauerkrone fiel, und kramte in seiner Jackentasche nach den Utensilien. Er bewahrte sie in einem kleinen roten Samtbeutel auf, wie sie beim Juwelier für Ringschatullen oder Halsbänder verwendet werden. Er hatte den Beutel oben an der York Terrace, wo selbst der Abfall von hoher Qualität ist, in einem Mülleimer gefunden. Als erstes zog er jedoch sein anderes Fundstück hervor, die metallene Brause einer verzinkten Gießkanne, dann einen Blechdeckel, nach dem er ziemlich lange hatte suchen müssen und der genau auf den Rand der Brause passte, dann den Schraubverschluss einer Wodkaflasche mit der roten Aufschrift Hoflieferant des russischen Zaren 1887-1917, sodann einen noch originalverpackten Strohhalm, den er sich im Park nicht weit vom Broad Walk an einem Imbissstand von der Theke genommen hatte, und ein Feuerzeug.
Zunächst nahm er die von Gupta erstandene weiße, kristalline Substanz zwischen Daumen und Zeigefinger. Seine Hand zitterte zwar, doch das machte nichts, denn er musste die Substanz nur zerbröseln. Dann ließ er sie behutsam durch den Hals der Gießkannenbrause fallen, in den er im Abstand von etwa einem Zentimeter zwei Löcher gebohrt hatte. Er wickelte den Strohhalm aus und schnitt ihn mit einer Nagelschere in zwei gleiche Hälften, die er bis auf eine Länge von ungefähr drei Zentimetern in die Löcher steckte. Es war noch hell genug, um es zu sehen, doch er hätte es auch im Stockfinstern bewerkstelligen können.
Nachdem er sich durch Betasten vergewissert hatte, dass die beiden Strohhalmhälften bis zur richtigen Länge eingeführt waren, was sehr wichtig war, steckte er das Feuerzeug an und hielt die Flamme an die Löcher, auf denen der Klumpen lag. Sobald dieser Feuer gefangen hatte, schloss er den Deckel über der Brause, nahm die Halme in den Mund und inhalierte tief. Bei diesem ersten Zug entwich ihm jedes Mal ein Laut. Es war eigentlich ein Freudenschrei, voll orgastischem Glücksgefühl, andere jedoch hätten es eher für verzweifeltes Stöhnen gehalten.
Keiner hatte ihn gehört. Es war keiner da, der ihn hätte hören können. Als Lew ihn damals eingearbeitet hatte, hatte er ihm erklärt, dass Jumbo bloß zehn Sekunden braucht, um ins Gehirn zu gelangen. Er hatte behauptet, Jumbo würde einen anderen Menschen aus ihm machen, und er hatte recht gehabt. Hob grunzte zufrieden. Als ein Wagen über die Brücke fuhr, zitterten die Bäume leicht. Wie ein Monster im Traum, das durch eine Tür fortgesogen wird, verflüchtigte sich der schlimme Zustand allmählich, wehrte sich zwar zunächst, doch dann schlug die Tür zu, und wohlige Wärme, süßer Gesang und Hoffnung erfüllten den Raum. Hob schloss die Augen. Früher hatte er die Brause einfach umgedreht und direkt durch die Löcher inhaliert, dann aber festgestellt, dass man auf diese Weise eine Menge verschwendete. Und Verschwendung war ein Verbrechen.
Nach einer Weile entfernte er den Schraubdeckel von der Gießkannenbrause, schüttelte beides aus, steckte es wieder in das Schmucksäckchen und warf die Strohhalme ins Gebüsch. Er fühlte sich stark und selig vor Glück. Dabei war das erst der Anfang.
Der Verkehr war jetzt am schwächsten, keine Schwertransporter oder Containerlastzüge, nur der übliche Personenverkehr. In der Camden High Street, einer der Hauptgeschäftsstraßen, sind zu jeder Uhrzeit Leute. Nach Mitternacht pulsiert London nur noch leise, doch es pulsiert weiter. Neonlichter verleihen der Dunkelheit ein grünlichweißes und matt orangefarbenes Licht, und die Ampeln an den oft menschenleeren Straßen springen stumm von Grün über Sattgelb auf Rot um und wieder auf Sattgelb und Grün. An einer solchen sinn- und zwecklos umschaltenden Ampel überquerte Hob die verlassene Straße in Richtung Prince Albert Road und Parkway. Wenn er gut drauf war, war er ein anderer Mensch, und sein Schritt wurde federnd.
Dieser andere Mensch, der keinen Affen hatte, witzelte herum, war ein Spaßvogel, der in einem ulkigen Slang daherredete. Alles konnte ihn zum Lachen bringen. Er war stark, er konnte alles, auf jeden Fall aber konnte er den Auftrag erledigen, für den er die Hälfte des Honorars erhalten hatte. Die Armbanduhr, die er schon so oft um ein Haar verkauft hätte, zeigte zwölf Minuten nach eins.
Sein markiertes Opfer sollte mit dem Neun-Uhr-Fünfundzwanzig-Zug aus Shrewsbury um ein Uhr vierzehn in der Euston Station ankommen. Euston, der nächstgelegene Londoner Endbahnhof, war weniger als eine Meile entfernt. Falls der Zug pünktlich ankam und schon ein Taxi wartete, hatte er gerade genug Zeit, um es bis zu St. Mark’s Crescent zu schaffen – reichlich Zeit eigentlich. Das war auch wieder komisch: ein markiertes Opfer, das in St. Mark’s Crescent wohnte. Er kicherte leise in sich hinein.
Nachdem er die Gloucester Avenue entlanggegangen war, bog er in die Regent’s Park Road ein und nahm die Abzweigung nach rechts. Vom Park, der nur wenige Meter hinter den von Bäumen überschatteten Mauern lag, war nichts zu sehen. Die Blätter an den dunklen Bäumen raschelten leicht. Hinter den Mülleimern, die auf die nächste Leerung warteten, schlich eine Katze lautlos durch die Stille, horchte, blieb abrupt stehen, witterte oder spürte seine Anwesenheit und flitzte flink wie ein Wiesel über die Mauer.
In den Häusern brannte nur vereinzelt Licht. Das Haus, auf das er zusteuerte, lag völlig im Finstern. In dem verwilderter Vorgarten stand büschelweise Unkraut. Er merkte, dass auch Dornen darunter waren, denn sie verfingen sich in seinen Sachen, als er sich zwischen sie fallen ließ. Dorniges Gestrüpp ziepte an seinem Handrücken und zerkratzte ihm die Haut. Es sah aus wie ein blutiger Reißverschluss.
So still war es, dass er das Taxi bereits in der Regent’s Park Road hören konnte. Er war seelenruhig und glücklich und bedauerte nur, dass keiner da war, mit dem er reden und herumalbern und vor dem er vielleicht seine Killernummer aus dem Fernsehfilm abziehen konnte. Das Taxi bog um die Ecke und hielt vor dem Garten. Die Scheinwerfer waren direkt auf ihn gerichtet und schienen ihm in die Augen. Er duckte sich so tief wie möglich und lauschte dem Wortwechsel.
»Hier sind drei Pfund.«
»Schönen Dank, Sir.«
Das Gartentor ging auf. Das Taxi fuhr an, um zu wenden. Er hätte nicht gewusst, was er tun sollte, falls der Fahrer gewartet hätte, bis die Haustür aufging. Ein Koffer wurde auf den Gartenweg geschoben, dann fiel das Tor hinter dem Gepäck und seinem Besitzer leise ins Schloss. Die Rücklichter des Taxis wurden schwächer, bis sie ganz verschwanden, und das pochende Motorengeräusch verebbte.
Er stand auf und ging mit bloßen Händen ans Werk, erst mit den Händen, dann mit den Füßen. Eine Hand von hinten über den Mund halten, ihn mit dem anderen Arm im Schwitzkasten zu Boden zwingen und dort mit den Füßen bearbeiten. Nicht um das Opfer umzubringen oder zum Krüppel zu machen, nur genug, um es zu verletzen, ihm ein paar Rippen zu brechen und die Zukunftsaussichten seiner Milz nicht gerade zu verbessern. Höchstwahrscheinlich wäre auch etwas zahnärztliche Zuwendung vonnöten.
Es machte ihm Spaß. Hob staunte über sich selbst, wie geschickt und vor allem wie lautlos er seine Aufgabe ausführte.
Jahrelange Übung und die Tatsache, dass er die bloßen Hände benutzt hatte, hatten dafür gesorgt, dass dem Mund, aus dem nun ein dünnes Rinnsal Blut tropfte, kein Laut entwichen war. Seine Anweisungen sahen zwar nicht vor, dass er den Mann beraubte, doch im Grunde genommen war sein Honorar so lachhaft, dass er ein Anrecht darauf hatte. Als er dem Mann in die Jackentasche griff und herumfühlte, fand er eine Brieftasche. Kreditkarten nützten ihm nichts, denn er wollte nur eins kaufen, und weder Carl noch Gupta akzeptierten Visa. Zehn Pfund, zwanzig und noch einmal zwanzig ... Ein wohliges Gefühl durchströmte seinen ganzen Körper. Achtzig Pfund! Hastig stopfte er die Scheine zu dem roten Samtsäckchen in die Tasche.
Dann – weil er immer zu einem Scherz aufgelegt war und gute Laune hatte – öffnete er den Koffer und warf einen Blick hinein. Kaum überraschend, war er voller Kleidung. Das Überraschende war, dass es sich um Frauenkleider handelte, vor allem um Damenunterwäsche. Hob fiel wieder ein, dass jemand gesagt hatte, mit dem Opfer stimme irgendetwas nicht, doch er hatte schon wieder vergessen, was es war.
Er machte sich daran, die Sachen an den Büschen aufzuhängen: rote Seidenschlüpfer, französische Höschen, einen schwarzen Büstenhalter, ein schwarzes Spitzennachthemd. Es sah aus, als hätten ein paar Mädchen dort gezeltet und ihre Sachen vor dem Schlafengehen noch schnell gewaschen. Wie dieses schwarze, durchsichtige Ding hieß, eine Art Einteiler, das man zwischen den Beinen zumachte, wusste er nicht. Er drapierte es über das Gartentor und warf noch ein paar Hüftgürtel über den ausgestreckt daliegenden Körper des Opfers.
Das schwache Stöhnen aus dem halbgeöffneten Mund bedeutete, dass es gefährlich wurde, noch länger zu bleiben. Er verließ den Garten und leckte sich das Blut von dem Kratzer auf seinem Handrücken, während er mit raschen Schritten in die entgegengesetzte Richtung auf Primrose Hill zusteuerte.
Seine Laune verschlechterte sich zusehends. Lew hatte ihm zwar vom Zehnsekundeneffekt erzählt, aber dass man nach einer halben Stunde wieder Depressionen bekam, hatte er nicht erwähnt. Jetzt war es zu spät. Gupta war bestimmt nicht mehr bei den Ginkgobäumen, aber vielleicht fand er Carl oder Lew auf dem Hill oder an der Macclesfield Bridge. Seine Beute in den Hosentaschen verstaut, steuerte er darauf zu.
»Jumbo, Jumbo«, brummte Hob, dann sang er es laut, um sich bei Laune zu halten. »Jumbo, Jumbo ...«
2
_____
Der Brief kam an dem Tag, als sie auszog. Die Post brachte eine Ansichtskarte von ihrer Großmutter, die Wasserrechnung und besagten Brief in einem braunen Umschlag mit dem Harvest-Trust-Logo, das einem knallroten Pilz ähnelte, was es natürlich nicht war, sondern etwas völlig anderes. Sie würde ihn später öffnen. Die Karte von ihrer Großmutter kam aus einem Ort namens Jokkmokk in Nordschweden. Sie schrieb:
Liebe Mary, nächsten Donnerstag bin ich wieder in London. Bis dahin hast Du Dich bestimmt im Haus in Park Village eingelebt. Ich rufe Dich an. Hier herrscht eine ungewöhnliche Hitze, und die Mitternachtssonne scheint. Alles Liebe ...
»Ich kriege noch einen Scheck für deinen Wasseranteil«, sagte Alistair verdrossen. Er klang schlechtgelaunt und trotzig vor Groll.
Mary hielt ihm nicht vor, dass sie die gesamte Stromrechnung bezahlt hatte. Er hatte den Briefumschlag entdeckt und betrachtete das rote Symbol.
»Kann ich bitte meinen Brief haben?«
Er reichte ihn ihr widerstrebend. »Die wollen wahrscheinlich noch mehr.«
»Glaube ich nicht.« Sie bemühte sich um einen sachlichen, höflichen, gleichmütigen Ton. Auseinandersetzungen gehörten der Vergangenheit an. »Es ist bestimmt bloß der aktuelle Bericht. Die halten mich immer auf dem laufenden.«
»Hoffentlich steht drin, dass er tot ist«, entgegnete Alistair gehässig.
Es fiel ihr schwer, gelassen zu bleiben. »Bitte, sag so etwas nicht.«
»Dann würdest du ein für alle Mal kapieren, dass du deine Zeit verschwendet und deinen Körper versaut hast.«
»Ich muss noch zu Ende packen«, sagte sie.
Er folgte ihr ins Schlafzimmer. Auf dem Bett lagen zwei geöffnete Koffer, der eine bereits halb voll mit ihren Kleidern. Sie legte den Brief und die Postkarte auf ein blaues T-Shirt und darauf ihren in Seidenpapier eingeschlagenen Hosenanzug. Eine Woche war vergangen, seit sie zum letzten Mal mit ihm in diesem Bett geschlafen hatte. Er hatte hier geschlafen und sie auf dem Sofabett im Wohnzimmer. Es war leichter so, wenn sie die restliche Zeit mit ihm in Ruhe und Frieden verbringen wollte. In einer Schublade fand sie ihr Scheckheft und schrieb ihm einen Scheck über die Hälfte der Wasserrechnung aus.
Ein Nicken, kein Lächeln, kein Dankeschön, als er ihn in seine Tasche steckte. »Wenn du die schicke Bude nicht gefunden hättest, würdest du hierbleiben, stimmt’s? Wenn es, sagen wir, bloß ein möbliertes Zimmer wäre? Oder würdest du wieder zu Grandma ziehen?«
»Das hatten wir doch alles schon durch, Alistair.«
»Und wenn die von ihrer ultralangen Reise wiederkommen und dich aus dem Glitzerpalast rausschmeißen – was dann? Dann kommst du angekrochen und sagst, du hättest einen Fehler gemacht und ob du bitte dein altes Bett wiederhaben könntest.«
»Kann sein, obwohl ich es nicht glaube. Es soll doch eine Trennung sein.«
»Ein Trennung auf Probe.«
»Wenn du meinst.« Warum wurde sie immer schwach und gab klein bei?« Vielleicht denken wir in vier Monaten beide anders darüber.«
»Das räumst du immerhin ein, ja? Dass ich anders darüber denken könnte. Dass ich dich vielleicht nicht mehr heiraten will? Das ist allmählich futsch, meine Liebe, das hat sich schön langsam verflüchtigt, seit du mich mit dieser Knochenmarkgeschichte hintergangen hast, von der ich nicht reden soll. Seit du dich wegen nichts krank gemacht hast, bloß um dir ganz toll vorzukommen, wie eine Märtyrerin, die ›auf dieser Welt Gutes getan hat‹ – das war doch der Slogan!«
»Meiner nicht«, entgegnete sie und merkte, wie sie die Fassung verlor, gleich einem Ball, der einem entgleitet und den Abhang hinunterrollt. Sie streckte die Hand danach aus, umklammerte den Ball. »So etwas habe ich nie gesagt.« Ein Glück, dass ich dich nicht geheiratet habe, dachte sie. Es könnte alles noch schlimmer sein, ich hätte dich ja heiraten können.
Sie klappte den Kofferdeckel zu und begann, den anderen Koffer vollzupacken. Er sah ihr zu, den Mund zu einer fast tierischen Grimasse verzerrt, ein Ausdruck, den sie früher nie an ihm gesehen hatte. »Wenn meine Großmutter anruft, gibst du ihr bitte diese Nummer? Ich bin sicher, sie hat sie, aber für alle Fälle.«
Die Adresse hatte sie ebenfalls aufgeschrieben: Charlotte Cottage, Park Village West, Regent’s Park, London NW1.
»Cottage!« höhnte er.
»Als das Haus damals gebaut wurde, galt es als klein.«
»Wie protzig«, sagte er.« So eine Art Petit Trianon.«
»Es ist nicht weit bis zu meiner Arbeit«, sagte sie. »Ich kann zu Fuß gehen.« Als ob sie deswegen hinzöge, als ob die Nähe zum Museum der Grund wäre.
Er hatte die unheimliche Gabe, solche Dinge zu bemerken, sich an einem Schwachpunkt festzumachen. Sein Gesichtsausdruck wurde schmeichlerisch. Das kannte sie gar nicht an ihm: »Du lädst mich doch mal ein, ja? Überhaupt – ich sehe eigentlich keinen Grund, weshalb ich nicht auch dort einziehen sollte.«
»Es gibt einen Grund«, entgegnete sie ruhig. Sie hatte ihre Fassung wieder, die nie besonders unabhängig von ihr war, fast nie verlorenging, scheu war wie ihre Besitzerin und nicht besonders durchsetzungsfähig. Sie zurrte den zweiten Koffer zu, nahm ihre Tasche und legte sie gleich wieder weg, um in die Jacke zu schlüpfen. »Es gibt sogar mehrere Gründe, Alistair, aber darüber zu reden hat doch keinen Sinn.«
»Du glaubst doch nicht im Ernst, ich würde dich jemals wieder ...« – er zögerte, suchte nach einem Wort, einem witzigen Wort vielleicht, einem Babywort, das Gewalt in ein Spiel verwandelte – »hauen, ich würde dich wieder hauen, oder?«
Doch, das glaubte sie. Er hatte es zwar nicht oft getan, aber oft genug. Oft genug, um sie, die typische, normale Frau, die behauptet: Der schlägt mich nicht noch mal, die von misshandelten Frauen sagt: Warum bleiben sie dann bei ihm?, in eine Frau zu verwandeln, die ergeben meint: Es war ja nur dies eine Mal, die sogar sagt: Er fühlte sich eben provoziert. Mit dem Unterschied, dass sie nicht blieb, es nicht akzeptierte und aushielt, sondern auszog.
Er stand in der Tür und verstellte ihr den Weg in den Flur. Was habe ich mir nur gedacht, fragte sie sich in dem Moment, was habe ich mir eigentlich dabei gedacht, auch nur fünf Minuten bei einem Mann zu bleiben, der mir Angst macht? Bei einem jähzornigen Kerl, der mich mit Leib und Seele als sein Eigentum betrachtet?
Sie nahm in jede Hand einen Koffer und ging an ihm vorbei, mit angespannten Muskeln und angehaltenem Atem. Statt ihr Platz zu machen, blieb er stur stehen, so dass sie sich an ihm vorbeizwängen musste. Er fasste sie nicht an. Einmal, erinnerte sie sich, hatte er den Fuß vorgestellt und sie stolpern lassen. Es war in den ersten Tagen nach ihrer Knochenmarkspende, als er es gerade entdeckt hatte. Er hatte den Fuß ausgestreckt, so dass sie der Länge nach hinfiel, und als sie sich wieder aufgerappelt hatte, hatte er gesagt: »Das war nicht ich, das waren deine Knochen. Du hast sie geschwächt, du hast eine alte Frau aus dir gemacht.«
Doch diesmal berührte er sie nicht. »Leb wohl, Alistair«, sagte sie aus sicherer Entfernung.
Er streckte eine Hand aus, dann beide Hände und legte den Kopf etwas schief. »Bekomme ich einen Kuss?«
Und wenn er sie nun packte, ihr mit der einen Hand ins Gesicht schlug, dann mit der anderen, sie schüttelte, sie zu Boden warf, seine Fäuste nahm ...? So etwas hatte er nie getan, nicht in der Größenordnung, und doch merkte sie, wie sie den Kopf schüttelte. Sie öffnete die Wohnungstür. Draußen am Aufzug wartete jemand. Gott sei Dank ... Alistair sagte mit seiner alten weichen Stimme: »Leb wohl, Liebling. Lass mal was von dir hören«, doch ob es ihr galt oder für den Zuhörer am Aufzug bestimmt war, konnte sie nicht sagen.
Sie hatte ganz vergessen, ein Taxi zu rufen, das sie bis zur U-Bahn fahren sollte. Also schleppte sie die Koffer um die Ecke bis zu einer Stelle, die man von den Wohnungsfenstern nicht mehr sehen konnte, und setzte sich auf das Mäuerchen vor dem Maklerbüro, um auf ein Taxi zu warten.
Ruby, der Beagle, lebte von allen Hunden, die Bean betreute, in der am weitesten südlich gelegenen Ecke, in der Devonshire Street. Der nächste war Boris, der Barsoi oder russische Windhund, in Park Crescent. Beide gehörten reichen Leuten, waren gut genährt, wurden tierärztlich erstklassig versorgt, waren schlank, stolz und verwöhnt. Doch das traf auf alle von Beans Hunden zu, andernfalls hätte er sie nicht genommen. Es wäre für ihn undenkbar gewesen, ein gemischtrassiges Tier oder gar eine Promenadenmischung spazieren zu führen.
Mit Boris und Ruby an der Doppelleine ging er den Hang hinunter auf den Nursemaids’ Tunnel zu, der die Park Crescent Gardens im Süden mit dem Park Square auf der Nordseite verbindet. Der Tunnel verläuft über der Jubilee-U-Bahn-Linie und unter der Marylebone Road hindurch. Tag und Nacht donnert der starke Verkehr hier in Richtung Westway zur Autobahn und östlich zu den Bahnhöfen Euston und King’s Cross. Er ebbt eigentlich nie ab, nicht einmal morgens um drei oder vier. In den frühen Morgenstunden oder am späten Nachmittag, wenn Bean seine Hunde ausführte, war er am stärksten. Laut dröhnte er über das Tunneldach hinweg und erschütterte den unterirdischen Gang, dessen bräunliche Wände und feuchter Steinboden vom natürlichen Licht an den Zugängen auf beiden Seiten erhellt wurden.
Die andere Möglichkeit, die Straße zu überqueren, war zu jeder Tageszeit mit Schwierigkeiten verbunden. Das grüne Männchen leuchtete so kurz auf, dass Bean es mit zwei Hunden an der Leine, die beide ohne Vorwarnung zum Schnüffeln stehenbleiben wollten, nicht bis auf die Verkehrsinsel und von dort bis zur anderen Seite schaffte. Als Bewohner der Crown Estates besaß Bean einen eigenen Schlüssel zum Garten und damit zum Tunnel. Früher war der Garten von Liebespaaren und Kindermädchen mit ihren jungen Schützlingen bevölkert gewesen. Bean bezweifelte, dass außer ihm heute noch jemand den Tunnel benutzte.
Seine Route hatte Bean sorgfältig ausgeklügelt, so dass die sportlichsten Hunde den größten und die kleinen, kurzbeinigen den kürzesten Auslauf hatten. Er fing mit dem Beagle um Viertel vor vier an, fünf Minuten später kam der Barsoi dazu, und dann holte er in St. Andrew’s Place den Golden Retriever Charlie und in Cumberland Terrace den schokoladenbraunen Pudel Marietta ab und führte sie alle über die Durchgänge zwischen den eleganten Häuserzeilen auf die Albany Street hinaus.
Es war ein sonniger, nicht besonders warmer Nachmittag Ende April, und ein kühler Wind trieb die Wolken über den blauen Himmel. Die Bäume trugen zartes Frühlingslaub, und in den Fensterkästen sprießten bereits Blumen. Mit seinen siebzig Jahren war Bean ein kräftiger, drahtiger, wenn auch kleiner Mann, der von weitem wie fünfundfünfzig aussah. Als er sich 1986 um seine letzte Stelle beworben und sein Alter mit neunundvierzig angegeben hatte, hatte man ihm geglaubt. Er kleidete sich jugendlich, jedoch nicht so, dass er lächerlich wirkte. Obwohl er mehrere Anzüge des verstorbenen Maurice Clitheroe besaß, die er sich hatte umändern lassen, trug er im Winter gewöhnlich gebügelte Bluejeans, einen Rollkragenpullover und eine blaue gefütterte Jacke. Wie hieß es so schön: Mach dich nicht frei vor dem Monat Mai, und der April war ja noch nicht vorbei. Sein Haar hatte Bean immer militärisch kurz getragen, inzwischen rasierte er sich aber den Schädel, um einen dichten weißen Stoppeleffekt zu erzielen.
Bean hatte sich ausbedungen, keine alten oder zu fetten Hunde auszuführen oder Hunde mit körperlichen Gebrechen. Sechs war sein Maximum, und er nahm nie Hunde, die per Gesetz einen Maulkorb tragen mussten. Mit dieser Tätigkeit verdiente er mehr als nur ein Zubrot zur Rente und hatte eine Menge strenger Regeln aufgestellt, wie er einer gewissen Mrs. Goldsworthy in der Albany Street erklärte, deren Scotchterrier er zum ersten Mal ausführte.
»Eine Woche im Voraus ist mitzuteilen, wenn der Hund in Ferien fährt, Madam«, sagte er zu ihr, »und einen Monat im Voraus, falls der Vertrag gekündigt wird. Außer natürlich, es kommt eine Krankheit dazwischen. Und falls jemand anders oder Sie selbst den Hund Gassi führen, ist das Ihre Sache und für mich unerheblich, wenn Sie verstehen.«
»O ja, natürlich.«
»Und das ist also McBride! Geschickte Hundchen sind das, diese Scotties, aber ein bisschen kurz in den Beinen. Ich nehme ihn in den mittleren Auslauf zusammen mit dem Shih-Tzu von Lady Blackburn-Norris.« Bean scheute sich nicht, mit der Erwähnung erlauchter Namen Eindruck zu schinden, das war gut fürs Geschäft. »Wir sehen uns dann in einer Dreiviertelstunde wieder.«
Bean war (wie er selbst sagte) durch das viele Spazierengehen gut in Form, die alte Pumpe funktionierte so gut wie vor dreißig Jahren, und er legte auf der langen, leicht ansteigenden geraden Straße ein strammes Tempo vor. Er war Vegetarier und genehmigte sich nur Freitagabends etwas Stärkeres als Coca Cola. Gesundheitsbewusst betrachtete er die Straßen nur als Übungsgelände für sich und »seine« Hunde und hatte weder Augen für Geschichte und Architektur seiner Umgebung noch für den Park selbst. Lasdun’s Royal College of Physicians, die medizinische Fachschule, ein imposantes Gebäude aus den sechziger Jahren, bemerkte er kaum, und nie fiel ihm auf, dass er gewöhnlich direkt vor der dänischen Gemeindekirche St. Katherine, einer nicht ganz geglückten Kopie der Kapelle von King’s College in Cambridge, die Straße überquerte.
Das Halbrund von Park Village West wird – besonders von den Anwohnern – als schönste Straße Londons bezeichnet. Sie zweigt auf der Seite von Camden Town von der Albany Street ab, einer vielbefahrenen Durchgangsstraße, die lediglich nachts und am Sonntagmorgen frei von Schwerlastverkehr ist. Park Village West dagegen ist eine kleine Oase des Friedens mit ländlichem Charme, eine Mischung aus Landsträßchen und Kirchhof, wo es im Frühling nach blühenden Bäumen, Narzissen und Goldlack duftet.
Bean bog mit seinen Hunden in die dicht von Bäumen gesäumte Straße ein. »Die freundlichen Villen« hatte man diese Häuser im Stil der Zeit um 1840 genannt, »Meisterwerke aus der Nash-Schule«. Eingebettet in einen Garten, steht jedes Haus für sich und unterscheidet sich im Stil seiner klassischen Ornamente, blanken Fensterscheiben, reich verzierten Urnen, Kaiserbüsten, Della-Robbia-Medaillons, Gartenpavillons, Wetterfähnchen und als olympische Tempel kaschierten Garagen von den anderen.
Das Haus, dem Beans nächster Besuch galt, war durch einen großzügigen Vorgarten und ein niedriges Mäuerchen vom Gehsteig getrennt, frisch gestrichen und trug, in den Stuck eingraviert, die Inschrift »Charlotte Cottage«. Bean befestigte die Leine an einem Torpfosten, ermahnte seine Schützlinge zur Ruhe und ging auf dem Gartenweg zum Haus. Rote Tulpen verloren ihre letzten Blütenblätter, und die rußschwarzen Kelche kamen zum Vorschein. Stiefmütterchen und Aurikeln waren schon aufgeblüht, der Goldregen würde bald folgen. Eine Klematis mit flachen Blüten wie aus mattblauem Satin rankte sich über die helle, leicht glänzende Fassade. Zu beiden Seiten der blauen Eingangstür standen kannelierte Säulen. Sie wurden von einem Dreiecksgiebel gekrönt, auf dem sich Nashs Götter und Göttinnen als cremefarbiges Relief auf blauem Grund tummelten. Aus einem offenen Fenster im Erdgeschoss streckte eine Frau etwa in Beans Alter oder älter den Kopf heraus.
»Ist es schon soweit?« fragte sie. »Ich hätte gedacht, es ist erst kurz nach drei.«
»Es ist bereits vier Uhr sechzehn, Lady Blackburn-Norris«, entgegnete Bean höflich. Er war immer höflich, denn gute Manieren kosteten ja nichts.
Sie verschwand und öffnete ein paar Sekunden später die Haustür, auf dem Arm den Shih-Tzu, das goldgelockte Hündchen. Gushis flusige goldene Stirnmähne, die ihm immer wieder in die Augen wehte, ähnelte dem rotblonden Haar seiner Besitzerin, nur dass deren Fransen von einer blaugerahmten, verspiegelten Sonnenbrille gehalten wurden. »Was um alles in der Welt treibt denn der Beagle mit dem Barsoi da?«
»Einfach ignorieren, Madam«, meinte Bean. Wenn sie es immer noch nicht kapiert hatte, war es jedenfalls nicht seine Aufgabe, sie aufzuklären. Er nahm ihr den Shih-Tzu ab und gerade als er ein freies Stück Leine am Halsband des Hündchens befestigen wollte, wobei er Rubys Annäherungsversuche abwehrte, bog ein Taxi um die Ecke und hielt vor Charlotte Cottage.
Die junge Frau, die ausstieg und zwei Koffer vom Beifahrersitz hievte, war bestimmt die neue Haussitterin von Sir Stewart und Lady Blackburn-Norris. Bean erschien sie recht jung, allerdings musste er zugeben, dass ihm der größte Teil der Bevölkerung jung vorkam und er nicht mehr sagen konnte, ob jemand achtzehn oder dreißig war. Diese Frau – eigentlich ein Mädchen, dachte er – hatte etwas Zerbrechliches an sich, fast als könnte der Wind sie umblasen. Mit ihrer schmalen Gestalt, dem langen Hals, der weißen Haut und dem weizenblonden Haar ließ sie ihn unwillkürlich an eine Lilie denken. Sie sah nicht so aus, als würde sie Gushi stundenlang spazieren führen, und das sollte ihm recht sein.
Er nickte ihr grüßend zu. Viele hätten sie als attraktiv, ja sogar schön bezeichnet, doch er fand sie nicht besonders anziehend. Was immer er – insbesondere in den letzten Jahren – mit Sex zu tun gehabt hatte, war ihm bestenfalls grotesk und schlimmstenfalls beängstigend vorgekommen. Als Maurice Clitheroe starb, hatte Bean jeden Gedanken an dieses Thema mit einem mehr als erleichterten Seufzer ein für alle Mal aus seinem Kopf vertrieben. Er überlegte kurz, ob er der jungen Dame vielleicht mit den Koffern bis zur Haustür helfen sollte, verwarf die Idee aber gleich wieder. Er hatte mit den Hunden alle Hände voll zu tun. Und im Übrigen sollte sie keine so schweren Koffer mitbringen, wenn sie nicht selbst damit fertig wurde. Als Trinkgeld würden für ihn bestimmt nicht mehr als die bei Frauen üblichen lächerlichen zwanzig oder höchstens fünfzig Pence herausspringen.
Inzwischen zerrten die Hunde ungeduldig an der Leine und wollten endlich los, auf ihren richtigen Ausflug. Bean überquerte die Straße und den Outer Circle und führte die Tiere durch das Gloucester Gate in den Park. Auf der weiten Grünfläche südlich vom Zoo machte er sie los und ließ sie freilaufen.
In einiger Entfernung sah er die Frau, die immer ein Dutzend Hunde ausführte und ihre Schützlinge mehr wie ein Kindermädchen behandelte, mit drei Labradors und einem Boxer Ball spielen. Bean warf ihr einen grimmigen Blick zu, doch sie war viel zu weit weg und bemerkte es nicht.
»Von Brasilien aus geht es los«, sagte Lady Blackburn-Norris, »dann weiter nach Mexiko und Costa Rica. Später Kalifornien, dann Utah mit den großen Nationalparks oder wie die heißen und schließlich Neuengland. Im September sind wir dann wieder hier, nicht wahr, Liebling?«
Ihr Mann ähnelte vom Gesicht und der Figur her dem Barsoi, den Mary draußen am Gartentor gesehen hatte, hatte sogar dessen dürre Beine, gebeugte Schultern und einen Rüssel wie ein Ameisenbär. »Wenn wir bis dahin nicht kaputt sind«, sagte er. »Sie denken wahrscheinlich, wir wären viel zu alt für so eine Reise, Miss Jago. Recht haben Sie, ich bin zweiundachtzig, und Madam ist neunundsiebzig.«
»Meine Großmutter ist noch viel älter und reist immer noch gern«, entgegnete Mary.
»Ach, die liebe Frederica! Wenn sie uns doch begleiten könnte! Aber sie ist ja noch in Schweden, außerdem hat sie den Trattons schon vor langem zugesagt, nächsten Monat mit ihnen nach Kreta zu fahren. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie dankbar wir sind, dass sie Sie uns vermittelt hat, Miss Jago. Ohne jemand so Zuverlässigen wie Sie im Haus könnten wir überhaupt nicht wegfahren, habe ich recht, Liebling?«
Sir Stewart pflichtete ihr in seiner etwas trockenen, reservierten Art bei. In den letzten Wochen hatte er Frederica Jago gegenüber, der besten Freundin seiner Frau, häufig Mordgedanken gehegt, weil sie diese ausgedehnte Reise ermöglicht hatte. Die Polizei von ihrer Abwesenheit zu unterrichten war ja schön und gut, und sie hatten schließlich einen Hund – falls man Gushi so bezeichnen konnte –, doch es ging nichts über »jemanden im Haus«. Ohne »jemanden im Haus« hätte es sich sogar seine Frau zweimal überlegt wegzufahren. Er hatte natürlich keine Lust, wie er seinen engsten Freunden anvertraute. Er wollte hierbleiben, jeden Morgen gemächlich in seinen Klub in der Brook Street schlendern und dort zu Mittag essen, nachmittags dann mit dem Taxi zurück zum Park Square fahren, um mit seinem Freund, dem Leiter der Crown Estates, in dessen Privatresidenz, einem tempelartigen Gebäude neben dem Nursemaids’ Tunnel, ein Schwätzchen zu halten, und jeweils dreimal pro Woche bei Odette oder Odin und sonntags im Mumtaz zu Abend essen.
»Es hat nicht sollen sein«, sagte er laut, ließ sich aber nicht weiter darüber aus, als Fredericas Enkelin ihn fragend ansah.
Er zeigte ihr, wie die Heizung funktionierte, und von seiner Frau erfuhr sie, wie man den Videorecorder bediente. Dann gaben sie ihr eine Liste mit den wichtigsten Telefonnummern und nützlichen Anlaufstellen und schärften ihr ein, unter keinen Umständen morgens zwischen acht und neun und nachmittags zwischen Viertel nach vier und Viertel nach fünf mit Gushi spazieren zu gehen. Das sei Beans Aufgabe, aber natürlich könne sie ihn sonst jederzeit ausführen, falls sie – oder er – dazu Lust oder Energie hatten.
»Wahrscheinlich nicht«, sagte Mary. »Tagsüber bin ich ja in der Arbeit.«
»Ach natürlich, Sie arbeiten ja!« sagte Sir Stewart, als hörte er zum ersten Mal, dass Frauen einer dermaßen abartigen Beschäftigung nachgehen, als könnte sich höchstens eine von tausend unter irgendeinem abnormen Zwang oder aufgrund einer seltenen charakterlichen Absonderlichkeit dazu bereitfinden. »In dem Sherlock-Holmes-Haus unten in der Baker Street, stimmt’s?«
Mary lachte. »Nein, nein, nicht Sherlock Holmes. Irene Adler. Ich arbeite im Irene-Adler-Museum in der Charles Lane.« Sie dachte, der Name würde ihnen vielleicht etwas sagen, doch offenbar irrte sie sich. »Das ist in St. John’s Wood. Ich kann von hier aus gut zu Fuß zur Arbeit gehen.«
Sir Stewart ließ es sich nicht nehmen, in seinem Londoner Stadtatlas nachzusehen. Er war gerade dabei, die Entfernung auszurechnen und abschließend wohl festzustellen, dass der Weg zu weit war, insbesondere für ein so zart wirkendes Persönchen wie sie, als Bean den Hund zurückbrachte. Man machte sich gegenseitig bekannt, und Bean sagte: »Dann also bis morgen früh Viertel nach acht, Miss.«
Noch nie hatte jemand »Miss« zur ihr gesagt. Sie kam sich vor wie die höhere Tochter in einem viktorianischen Roman. Weil sie ihn gleich am Hals kraulte und etwas Nettes sagte, sprang Gushi an ihr hoch, leckte sie und schmiegte sich wie ein Strauß Chrysanthemen in ihre Arme.
»Runter mit dir, blödes Vieh«, sagte Sir Stewart.
»Wieso heißt er eigentlich Gushi?« wollte Mary wissen. »Woher kommt der Name?«
»Gushi Khan war im 17. Jahrhundert Herrscher von Tibet, nicht wahr, Liebling?«
»Weiß der Himmel!« erwiderte Sir Stewart. »Den Namen hat ihm sein früherer Besitzer verpasst. Ich hätte ihn Sam genannt.«
Mary schlenderte durch die Zimmer, während Sir Stewart und Lady Blackburn-Norris letzte Hand ans Kofferpacken legten. Es war ein hübsches Haus, gemütlich und elegant. Das reizende Mobiliar unterschied sich jedoch in nichts von der Inneneinrichtung tausend anderer Häuser und Wohnungen am Rand des Parks: Chintz, Samt, Wilton-Teppiche, chinesisches Porzellan, Silber aus dem 18. Jahrhundert, Mohnblumen und Pfauenfedern, Polstersessel, Chaiselongues, Beistelltischchen, Hope-Stühle und vielleicht sogar ein echter Duncan Phyfe. Sie kannte sich mit diesen Sachen aus und hoffte manchmal sehnsüchtig, auf eine etwas andere Inneneinrichtung zu stoßen, die sie überraschte oder entzückte. Eines Tages könnte sie sicher einmal ihr eigenes Haus einrichten.
Die Rollläden vor den Fenstern boten zusätzliche Sicherheit. Nirgends kaschierten Spitzengardinen die Fenstergitter oder verhängten die Aussicht. Sie sah auf die Pergola und den Zierteich im Garten und die dahinterliegende Grünfläche hinaus, die die Anliegerstraße in zwei Hälften teilte. Zu dieser Jahreszeit grünten die Bäume und Sträucher üppig, blühende Kletterpflanzen rankten sich über jede Mauer und Erhebung, das Mauerwerk lag unter einem dichtgewobenen Laubteppich verborgen, so dass der Eindruck entstand, man befinde sich mitten auf dem Lande. In frisches Goldgrün und Jadegrün gehüllte Bäume verdeckten die irgendwo weit in der Ferne aufragenden Wohntürme. Die durchbrochenen Kondensstreifen der Flugzeuge am blauen Himmel sahen aus wie Federwolken.
Im Garten schob der weiße Flieder seine Blütendolden zwischen die späten Forsythien und das schneeige Geflecht einer Spiräe. Die Schönheit dieses Anblicks ließ bei Mary plötzlich ein Gefühl von Einsamkeit aufkommen. Sie hatte lange nicht mehr allein gelebt, und in einer halben Stunde würde sie nun ganz für sich sein. Bis auf Gushi natürlich, doch Mary gehörte nicht zu den Leuten, die die Gesellschaft eines Tieres der eines menschlichen Wesens gleichsetzen. Sie strich dem Hund über den Kopf, denn der Gedanke schien ihr ein wenig unfair.
Das Taxi kam früher als erwartet, und Mary ließ den Fahrer herein. Sir Stewart und Lady Blackburn-Norris waren noch oben, doch als Sir Stewart Stimmen hörte, rief er dem Fahrer zu, er solle heraufkommen und ihm mit den Koffern helfen. Für einige Minuten herrschte Chaos, während der Fahrer protestierte und etwas von Rückenschmerzen brummte. Lady Blackburn-Norris flatterte nervös im Kreis herum und gab Mary plötzlich und unerwartet einen Abschiedskuss, und Sir Stewart wollte Mary ausgerechnet in diesem letzten Moment erklären, wie die Fensterverriegelung funktionierte.
Dann waren sie fort. Der Hund hatte sich schlafen gelegt. Mary sah immer noch aus dem Fenster, als das Taxi schon längst verschwunden war. Es war sehr still, so still wie auf dem Land, und obwohl sie angestrengt horchte, war vom Lärm und Getöse der Großstadt nichts zu hören. Alistair fiel ihr ein, und sie dachte darüber nach, was es bedeutete, sich vor jemandem zu fürchten, den man einst geliebt und bewundert hatte. Heute Abend würde er wahrscheinlich anrufen. Sie fragte sich, was passieren würde, wenn sie sich einfach nicht meldete und es weiterklingeln ließ und der Anrufer ein Freund von Sir Stewart und Lady Blackburn-Norris war.
Die Vorstellung, mit Alistair zu sprechen, kam ihr plötzlich schrecklich vor. Vielleicht sollte sie auf einen kleinen Spaziergang oder ins Kino gehen. Nicht weit von der U-Bahnstation Baker Street war ein Kino und noch eins in der Baker Street. Aber wäre es nicht verantwortungslos, gleich nach der Ankunft das Haus und den Hund allein zu lassen? Sie ging nach oben und begann, ihre Sachen auszupacken.
Ihr Zimmer hatte einen Ausblick auf den Garten und die Grünanlage von Park Village East und über die Gleise der Mornington-Crescent-Linie. Hoch über dem Bahnhof Euston schwebte ein rot-gelb gemusterter Gasballon am Himmel. Sie packte den ersten Koffer aus und hängte ihre Kleider in einen Wandschrank aus Mahagoniholz mit Klauenfüßen. Die Sachen, die im zweiten Koffer obenauf lagen, wurden in Schubladen verstaut. Als sie den Hosenanzug herausnahm, entdeckte sie darunter die Ansichtskarte aus Jokkmokk und den Brief vom Harvest Trust.
Mary setzte sich aufs Bett und betrachtete nachdenklich den Umschlag in ihren Händen, bevor sie ihn schließlich öffnete. Das machte sie jedes Mal, wenn sie Post vom Trust bekam. Einerseits wollte sie wissen, was darin stand, andererseits scheute sie sich davor, und so zögerte sie jedes Mal, wappnete sich, bereitete sich innerlich vor. Aber konnte man sich darauf vorbereiten? Wäre es, wenn ihre schlimmste Befürchtung eintrat, nicht doch ein Schock, egal, wie sehr sie damit gerechnet hatte?
Alistair hatte gehofft, der Mann, den sie nur als »Oliver« kannte, sei tot. Bestimmt hatte er es nicht so kategorisch gemeint, er war unlogisch, unvernünftig gegenüber allem, was mit ihrer Knochenmarkspende zu tun hatte, aber vielleicht war »Oliver« tatsächlich tot, und nun stand es in diesem Brief.
Wann hatte sie das letzte Mal vom Trust gehört? Sie überlegte. Vor Weihnachten, im Oktober oder November, vor über einem halben Jahr. Doch das war ganz normal. Sie hatte den Trust gebeten, ihr nach drei Monaten Mitteilung zu machen, und dann nach sechs, neun, zwölf und achtzehn Monaten. Inzwischen mussten über achtzehn Monate vergangen sein, eher zwanzig, seit man ihr die Spende entnommen hatte.
Vielleicht war er tot. Die Erfolgsquote lag bei nur zwanzig bis fünfzig Prozent. Es war sogar wahrscheinlicher, dass er tot war, als dass er noch lebte. Kurzentschlossen öffnete sie den Umschlag, riss die Klappe mit ihrem Daumennagel auf. Der Brief war von der Spenderbetreuungsreferentin des Harvest Trust und erinnerte sie daran, dass »Sie darum gebeten hatten, die Anonymität nach anderthalb Jahren aufzuheben, falls alles gut verlaufen ist«. Daher werde nun, gegenseitiges Einverständnis vorausgesetzt, »Oliver« ihren Namen und ihre Adresse erhalten und umgekehrt. Sie könne aber auch selbst mit »Oliver« Kontakt aufnehmen, sobald sie seine Anschrift erhalten habe. Es sei für beide Parteien ratsam, erst einmal miteinander zu korrespondieren, bevor ein persönliches Treffen vereinbart wurde. Die Spenderbetreuerin erklärte sich bereit, auf jede erdenkliche Weise zu helfen. Sie hoffte, »Helen« würde sich an sie wenden, falls es irgendwelche Probleme gäbe, und unterzeichnete mit Deborah Cox.
Mary las den Brief noch einmal. Sie hatte etwas bekommen, das sie an ihrem ersten Abend vollauf beschäftigen würde.
3
_____
Irene Adler, Abenteurerin, Schönheit, einstige Mätresse des Königs von Böhmen, residierte, nach Angaben von Conan Doyle, in Briony Lodge an der Serpentine Avenue in St. John’s Wood. Doch da es sich bei diesen Angaben um pure Fiktion handelt und die einzige, »Serpentine« genannte Straße in London im Distrikt West Zwei und nicht in Nordwest Acht liegt, mussten sich die Gründer des Museums, das ihren Namen trägt, mit einem Haus in einer Seitenstraße von St. John’s Wood High Street zufriedengeben.
Das Museum beherbergt keine Irene-Adler-Memorabilien. Wie könnte es auch? Die einzige Frau, die Sherlock Holmes je liebte – oder zumindest bewunderte –, kommt lediglich in einer einzigen Geschichte vor. Kaum hatte Holmes sie zu Gesicht bekommen, heiratete sie auch schon einen gewissen Mr. Norton und hinterließ Holmes nichts weiter als ein Foto, das er anhimmeln konnte. Die im Museum ausgestellten Stücke sind jedoch von der Art, wie sie sie besessen haben könnte: eine Sammlung von Kleidern aus dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert, Gemälde der Präraffaeliten, zahllose Jugendstilskizzen, Möbel im Stil der Einrichtung von Sir Stewart und Lady Blackburn-Norris, Schmuckstücke aus Silber und Achat, Talmi, Rauchquarz und Mondstein, ein paar wohlgehütete Exemplare des Yellow Book, Werke von Swinburne und Watts-Dutton, zahlreiche Zeichnungen von Beardsley und eine Erstausgabe von Zuleika Dobson.
Mary Jago machte bald nach ihrem Abschluss an der Kunstschule Bekanntschaft mit der Sammlung, als sie sich mit der Restaurierung von Kostümen selbständig machte. Dies war zwar kein besonders einträgliches Geschäft gewesen, verschaffte ihr jedoch den Kontakt zu Dorothea Borwick, der Leiterin des Irene-Adler-Museums, die ihr später eine Teilhaberschaft anbot. Das Museum, das von der einheimischen Bevölkerung weitgehend ignoriert wurde, war nämlich bei Touristen, vor allem bei Amerikanern, ein großer Erfolg. Manchmal sahen sich Mary und Dorothea sogar gezwungen, den Zutritt zu beschränken und den Eingang für eine halbe Stunde mit einem Seil abzusperren, hocherfreut über den Anblick der Menschenschlange, die sich bis um die Ecke zu der Häuserzeile von St. John’s Wood Terrace hinzog.
Montags kam Dorothea nie zur Arbeit, und Mary hatte dafür an den Samstagen frei. Als sie nun ankam, war es erst zwanzig nach neun, und Stacey, die immer am Kartenschalter saß und im Museumsshop bediente, war noch nicht eingetroffen. Kurz nachdem Gushi von Bean wieder abgeliefert worden war, war Mary von Charlotte Cottage aufgebrochen. Sie wusste nicht genau, wo sie ihren Antwortbrief an den Harvest Trust einwerfen konnte, hatte aber an der Ecke Park Village West und Albany Street gleich einen Briefkasten gefunden.
Der Brief war das Ergebnis sorgfältigen Nachdenkens und behutsamer Überlegungen und hatte fast den ganzen Abend in Anspruch genommen, weshalb sie die Idee eines Kinobesuchs wieder verworfen hatte. Ob sie dem Harvest Trust ihre neue Adresse zukommen lassen sollte? Hatte das überhaupt einen Sinn, da sie doch nur vorübergehend dort wohnte? Sir Stewart und Lady Blackburn-Norris kamen Anfang September zurück, und dann musste sie sich eine eigene Wohnung suchen, falls sie ihre Meinung bis dahin nicht grundlegend geändert und beschlossen hatte, zu Alistair zurückzukehren.
Die Antwort auf ihren Brief war ihr sehr wichtig, denn endlich würde sie »Olivers« Identität erfahren. Fast hätte sie schon beim Trust angerufen; aber ob sie es ihr am Telefon sagen würden? Natürlich nicht, sie könnte ja irgendwer sein, eine Enthüllungsjournalistin oder Spionin. Beim Trust würde niemand ihre Stimme erkennen. Also zurück zu dem Brief, dem leeren Blatt Papier, auf das sie noch nicht einmal die Adresse geschrieben hatte. Wenn sie Chatsworth Road, Willesden, angab, obwohl sie dort nicht mehr wohnte, würde Alistair ihr das Antwortschreiben des Trusts nachschicken? Oder würde er sich einen Spaß daraus machen, es zu zerreißen?
Die einfachste Lösung wäre, die Adresse ihrer Großmutter auf den Briefkopf zu schreiben. Sie besaß einen Hausschlüssel, und im Übrigen kam Frederica in ein paar Tagen zurück. Nach diesem Brief würde höchstwahrscheinlich keine Post mehr vom Trust kommen, die Auskünfte über »Olivers« Gesundheitszustand bekäme sie dann direkt von ihm. Rechts oben in die Ecke schrieb sie »bei Mrs. F.M. Jago, Lamballe Hause, Belsize Park Gardens, London NW 3«. Der Inhalt ihres Briefes war im Grunde nur die Bitte um »Olivers« richtigen Namen und seine Adresse. Auf diese Weise hätte Alistair keinen Zugriff darauf. In den vergangenen anderthalb Jahren hatte er ihr Tun mit wachsendem Missfallen betrachtet und zunehmend verärgert reagiert. Irgendwie schien er sich an diesem Mann rächen zu wollen, den sie beide noch nie gesehen hatten und dessen einziges Vergehen darin bestand, an akuter myeloischer Leukämie zu leiden. Auf ihrem Weg durch den Park über den Broad Walk und an der Südseite des Zoos entlang musste sie wieder an Alistairs unerklärliches Verhalten denken. Was sie getan hatte, schien ihn verändert zu haben, er war unvernünftig und bisweilen direkt grausam geworden.
Beim Trust empfahlen sie einem, sich mit der Familie zu beraten, bevor man sich endgültig für eine Knochenmarkspende entschied. In ihrem Fall bestand die Familie aus Alistair und ihrer Großmutter, andere Angehörige hatte sie nicht, doch während ihre Großmutter sie nach anfänglichen Befürchtungen unterstützt hatte, waren von Alistair nur Zorn, Skepsis und Ablehnung gekommen.
Schon wenn der Name des Trusts erwähnt wurde, war Alistair aufgebraust. Er schien eine Gabe dafür zu haben, jeden auch nur entfernt bedrohlich klingenden Punkt aus der Informationsbroschüre herauszupicken.
»Harvest, das heißt doch abernten, abzapfen – so nennen die das, was sie treiben. Das spricht doch Bände, oder? Die zapfen dir das Mark aus den Knochen ab.«
Und weiter: »Sie versichern dich für eine Viertelmillion Pfund. Da, hier steht es. Glaubst du, das täten die, wenn es nicht gefährlich wäre?«
»Ich bin jung und gesund«, hatte sie entgegnet. »Die würden mich nicht nehmen, wenn ich nicht geeignet wäre. Ich bin gar nicht so zart, ich sehe bloß so aus.«
Damals hatte man sie noch gar nicht um die Spende gebeten, sondern nur ihren Namen in die Kartei eingetragen. Alistairs, wie ihr schien, unvernünftiger Aufforderung nachzugeben wäre ihr schwach und völlig verkehrt vorgekommen. Sie wusste, dass sie zu den typischen Opfern gehörte: eine stille, sanftmütige Person, die um des lieben Friedens willen nachgibt und beschwichtigend lächelt und bei der ein brutaler Kerl sich von seiner schlimmsten Seite zeigt. Dieser Rolle hatte sie sich in letzter Zeit entgegenzustellen versucht. Doch als der Trust sich mit einem potentiellen Empfänger wieder bei ihr meldete und sie zur medizinischen Untersuchung in die Klinik bat, hatte sie sich nicht selbstbewusst behauptet.
In ihrer Mittagspause ging sie zur Untersuchung. Alistair sagte sie nichts davon. Natürlich hatte sie vor, es ihm später zu sagen. Es war paradox: Wenn es zwischen ihnen gekriselt hätte, hätte sie ihn vielleicht informiert, hätte sich durch seine negative Haltung noch bestärkt gefühlt, doch ihre Beziehung befand sich gerade in einer harmonischen und glücklichen Phase – warum sollte sie es also verderben? Trotzdem beschloss sie, es ihm rechtzeitig vor der Knochenmarkentnahme zu sagen. Denn sagen musste sie es ihm, das war klar.
Dann schickte seine Bank ihn nach Hongkong. Während der Woche, die er verreist war, sollte die Spende erfolgen. Die Spender sollten, so wurde angeraten, vom Krankenhaus abgeholt und nach Hause begleitet werden. Darauf würde sie entweder verzichten oder ohne Alistair auskommen müssen. Dorothea könnte sie abholen, sie war diskret und würde den Mund halten. Vielleicht brauchte Alistair es nie zu erfahren. Trotz aller Fortschritte, die sie gemacht hatte, war inzwischen ihr altes Selbst wieder durchgebrochen, da half es auch nicht, dass sie sich sagte, sie sei feige und idiotisch. All dies durchlebte Mary noch einmal in Gedanken, während sie durch den Park zum Monkey Gate ging und von dort über den Kanal in die Charlbert Street. Ein Tag wie heute war es gewesen, sonnig und ein wenig windig, allerdings im Herbst statt im Frühling, als sie damals zur Knochenmarkentnahme ins Krankenhaus gegangen war. Entgegen Alistairs Annahme war der einzige Risikofaktor die Vollnarkose. Etwa zwei Stunden war sie »weg vomFenster«, während man ihr einen Liter Knochenmark und Blut entnahm, fünf Prozent der Gesamtmenge in ihrem Körper.
Als sie wieder zu sich kam, verspürte sie zunächst eine freudige Erregung. Es war vorbei, sie hatte es geschafft. Sie hatte ihren gesunden Körper zur Verfügung gestellt, um einem kranken Menschen zu helfen, um einen Irrtum der Natur zu korrigieren. Selbst wenn sie bis dahin nichts zuwege gebracht hatte, selbst wenn sie in den kommenden Jahren nie etwas Gutes täte, so konnte sie durch diese eine gute Tat ihre Existenz doch rechtfertigen. Das hätte sie natürlich keiner Menschenseele so gesagt. Bei Dorotheas Besuch spielte sie es herunter und sagte, es sei nichts Besonderes gewesen, ein Klacks. Innerlich verspürte sie jedoch eine tiefe Zufriedenheit. Auch wenn es missglückt wäre, auch wenn die Transplantation nichts nützte, hätte sie es doch versucht, hätte getan, was alle philosophischen und religiösen Lehren als Zweck unseres Daseins weisen: seinen Nächsten zu lieben und Gutes zu tun.