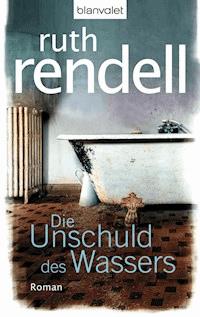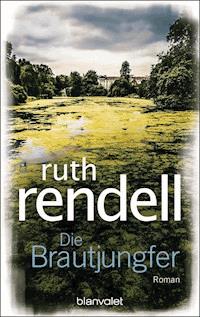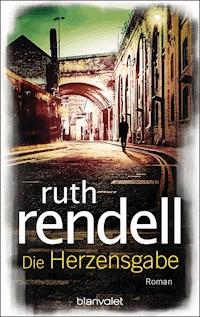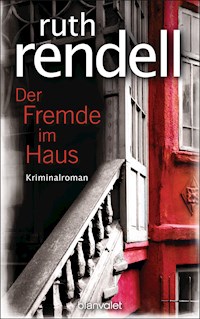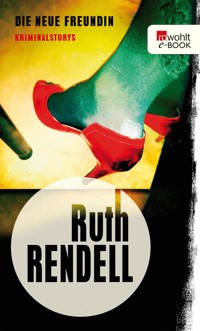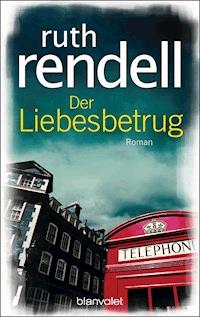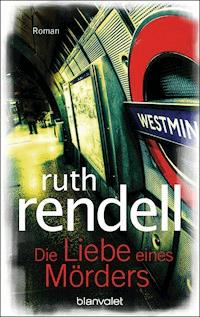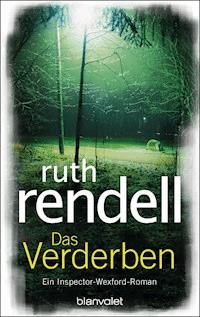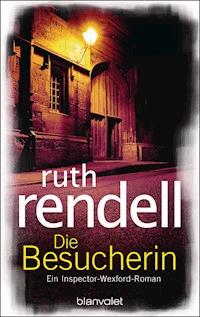
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Nur achtzehn Mitbürger schwarzer Hautfarbe gibt es in Kingsmarkham, und einer von ihnen ist Inspector Wexfords neuer Hausarzt: Dr. Raymond Akande. Als Melanie, die Tochter des Arztes spurlos verschwindet, bewegt den Inspector mehr als nur berufliches Interesse an dem Fall. Melanie hatte erst vor kurzem die Universität verlassen, und da sie arbeitslos war, hatte sie mehrmals beim Arbeitsamt vorgesprochen. Seit ihrem letzten Termin dort ist sie wie vom Erdboden verschluckt ... Kurz darauf wird eine junge schwarze Frau tot aufgefunden, und Wexford bittet die Akandes, ihre Tochter zu identifizieren. Doch bei der Leiche handelt es sich gar nicht um die der vermissten Melanie …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 554
Ähnliche
Ruth Rendell
Die Besucherin
Buch
Nur achtzehn Mitbürger schwarzer Hautfarbe gibt es in Kingsmarkham, und einer von ihnen ist Inspector Wexfords neuer Hausarzt: Dr. Raymond Akande. Als Melanie, die Tochter des Arztes spurlos verschwindet, bewegt den Inspector mehr als nur berufliches Interesse an dem Fall. Melanie hatte erst vor kurzem die Universität verlassen, und da sie arbeitslos war, hatte sie mehrmals beim Arbeitsamt vorgesprochen. Seit ihrem letzten Termin dort ist sie wie vom Erdboden verschluckt … Kurz darauf wird eine junge schwarze Frau tot aufgefunden, und Wexford bittet die Akandes, ihre Tochter zu identifizieren. Doch bei der Leiche handelt es sich gar nicht um die der vermissten Melanie …
Autorin
Ruth Rendell wurde 1930 in South Woodford/London geboren. Zunächst arbeitete sie als Journalistin, bevor sie sich ganz dem Schreiben von Romanen widmete. Dreimal bereits erhielt sie den Edgar-Allan-Poe-Preis und zweimal den Golden Dagger Award. 1997 wurde sie mit dem Grand Master Award der Crime Writer’s Association of America, dem renommiertesten Krimipreis, ausgezeichnet und darüber hinaus von Königin Elizabeth II. in den Adelsstand erhoben. Ruth Rendell, die auch unter dem Pseudonym Barbara Vine bekannt ist, lebt in London.
Die Reihenfolge der Inspector-Wexford-Romane sowie weitere Romane finden Sie hier.
Ruth Rendell
Die Besucherin
Ein Inspector-Wexford-Roman
Aus dem Englischen von Cornelia C. Walter
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.Die Originalausgabe erschien unter dem Titel Simisola bei Hutchinson, London.
E-Book-Ausgabe 2015
bei Blanvalet, einem Unternehmen der
Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Copyright © der Originalausgabe 1994 by Kingsmarkham Enterprises Ldt.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 1995 by Blanvalet Verlag GmbH, München
Umschlaggestaltung: www.buerosued.de
Umschlagmotiv: Arcangel Images/Paul Gooney
Satz: EDV-Fotosatz Huber/Verlagsservice G. Pfeifer, Germering
ISBN: 978-3-641-15131-7V002
www.blanvalet.de
Für Mané
1
_____
Außer ihm saßen noch vier Leute im Wartezimmer, von denen aber keiner krank aussah. Die braungebrannte Blondine im Designer-Jogginganzug strotzte vor Gesundheit, ihr Körper war muskulös, die sehnigen Hände glänzten golden, bis auf die grellroten Fingernägel und die Nikotinflecken am rechten Zeigefinger. Sie hatte sich umgesetzt, als eine Zweijährige mit ihrer Mutter hereingekommen und auf den Stuhl neben ihr zugesteuert war. Nun saß die Blonde im Jogginganzug so weit weg wie nur möglich, zwei Sitze von ihm und drei von dem steinalten Mann entfernt, der mit zusammengepressten Knien, seine karierte Mütze krampfhaft festhaltend, dahockte und wie gebannt auf das Schild mit den Namen der drei Ärzte starrte.
Über jedem Namen befand sich ein Lämpchen und darunter ein Haken, an dem bunte Ringe hingen: rotes Licht und rote Ringe für Dr. Moss, grün für Dr. Akande, blau für Dr. Wolf. Wexford bemerkte, dass der alte Mann einen roten Ring bekommen hatte und die Mutter des Kindes einen blauen, was genau dem entsprach, was er erwartet hätte, im einen Fall die Präferenz für den älteren Mann, im anderen für die Frau. Die Frau im Jogginganzug hatte überhaupt keinen Ring. Entweder wusste sie nicht, dass man sich am Empfang melden musste, oder sie scherte sich nicht darum. Wexford fragte sich, wieso sie nicht Privatpatientin war und sich später am Vormittag einen Termin geben ließ, statt hier nervös und ungeduldig herumzuwarten.
Inzwischen hatte das Kind die Turnerei zwischen den Stuhlreihen satt und machte sich über die Zeitschriften her, die auf dem Tisch lagen, und fing an, die Titelseiten herunterzureißen. Wer von den beiden wohl krank war, die Kleine oder ihre übergewichtige, blasse Mutter? Niemand machte Anstalten, das Kind an seinem Zerstörungswerk zu hindern, der alte Mann starrte bloß wütend herüber, und die Frau im Jogginganzug tat das Unverzeihliche, Unerhörte. Sie griff in ihre krokodillederne Handtasche, nahm ein flaches goldenes Etui heraus, dessen Funktion den meisten Leuten unter Dreißig ein Rätsel gewesen wäre, und entnahm ihm eine Zigarette, die sie mit einem goldenen Feuerzeug anzündete.
Wexford, der sich bisher erfolgreich von seinen eigenen Sorgen hatte ablenken lassen, beobachtete sie nun vollkommen fasziniert. Unter den Schildern an der Wand befanden sich, neben den Ermahnungen, Kondome zu benutzen, seine Kinder impfen zu lassen und auf sein Gewicht zu achten, nicht weniger als drei, die auf das Rauchverbot hinwiesen. Was würde jetzt wohl passieren? Ob es vielleicht ein Warnsystem gab, das, sobald Rauch im Wartezimmer aufstieg, den Empfang oder die Ambulanz alarmierte?
Die Mutter des Kindes reagierte schließlich, jedoch nicht mit einer Bemerkung an die Frau im Jogginganzug, sondern mit einem Schnüffeln; dann zerrte sie mit der einen Hand die Kleine grob zu sich herüber und verabreichte ihr mit der anderen einen kräftigen Klaps, woraufhin ein großes Geheul ertönte. Der alte Mann begann kummervoll den Kopf zu schütteln. Zu Wexfords Überraschung wandte sich die Raucherin an ihn und sagte unvermittelt: »Ich habe den Doktor angerufen, aber er wollte nicht kommen. Unglaublich! Ich musste wohl oder übel selbst herkommen.«
Wexford murmelte etwas von praktischen Ärzten, dieheutzutage keine Hausbesuche mehr machten, außer in besonders ernsten Fällen.
»Woher will er wissen, dass es nichts Ernstes ist, wenn er nicht kommt?« Doch sie hatte Wexfords erstaunten Gesichtsausdruck wohl richtig interpretiert. »Oh, es geht nicht um mich«,sagte sie und fügte seltsamerweise hinzu, »es geht um eine von den Hausangestellten.«
Er hätte gern mehr erfahren, aber die Gelegenheit war vorbei, denn nun passierten mehrere Dinge gleichzeitig. Das blaue Lämpchen für Dr. Wolf leuchtete auf, die Tür öffnete sich, und die Sprechstundenhilfe kam herein. Sie sagte scharf: »Machen Sie bitte die Zigarette aus. Haben Sie das Schild nicht gesehen?«
Die Frau im Jogginganzug hatte alles noch schlimmer gemacht, indem sie die Asche auf den Fußboden hatte fallen lassen. Sicher hätte sie auch noch den Stummel dort ausgetreten, wenn die Arzthelferin ihn ihr nicht mit einem leisen ungehaltenen Knurren abgenommen und in bis dahin unverpestete Gefilde gebracht hätte. Der Frau war die Sache anscheinend überhaupt nicht peinlich. Sie zuckte nur leicht mit den Schultern und warf Wexford ein strahlendes Lächeln zu. Mutter und Kind verließen gerade das Wartezimmer, um Dr. Wolf aufzusuchen, als zwei weitere Patienten hereinkamen und Dr. Akandes Lämpchen aufleuchtete. Jetzt ist es soweit, dachte Wexford, und seine Angst war wieder da, jetzt werde ich es erfahren. Er hängte den kleinen grünen Ring hin und ging, ohne sich noch einmal umzudrehen, hinaus. Sofort war es, als hätten diese Leute nie existiert, als hätte sich nichts von alledem zugetragen.
Angenommen, er würde auf dem kurzen Weg zu Dr. Akandes Sprechzimmer hinfallen? Er war heute Morgen schon zweimal gestürzt. Dann wäre ich ja am rechten Ort, sagte er sich, in der Arztpraxis – nein, verbesserte er sich, man muss mit der Zeit gehen – im Gesundheitszentrum. Es gibt keinen besseren Ort, um krank zu werden. Aber wenn es nun etwas mit dem Gehirn ist, ein Tumor, ein Blutgerinnsel … Obwohl dies nicht üblich war, klopfte er an.
Raymond Akande rief: »Herein.«
Wexford war erst zum zweiten Mal bei ihm in der Sprechstunde, seit Akande nach Dr. Crockers Pensionierung in die Gemeinschaftspraxis eingetreten war. Damals hatte er, nachdem er sich im Garten geschnitten hatte, eine Tetanusspritze bekommen. Er sonnte sich in dem Glauben, dass sie einen ganz guten Draht zueinander gefunden hätten. Gleich darauf schalt er sich für derartige Gedanken; denn er wusste verdammt gut, dass er sich um Sympathie oder Abneigung nicht gekümmert hätte, wenn Akande ein x-beliebiger anderer gewesen wäre.
Um solche Betrachtungen ging es an jenem Morgen allerdings nicht. Wexford war nur um sich selbst besorgt, war ganz mit seiner Angst und den schrecklichen Symptomen beschäftigt. Er versuchte ruhig zu bleiben und unbeteiligt zu beschreiben, wie er morgens beim Aufstehen hingefallen war, wie er das Gleichgewicht verloren hatte, wie ihm der Fußboden entgegengekommen war.
»Irgendwelche Kopfschmerzen?« fragte Dr. Akande. »Übelkeit?«
Nein, nichts dergleichen, meinte Wexford, der bei Akandes Bemerkung gleich wieder etwas Hoffnung schöpfte. Ach, ein bisschen erkältet sei er gewesen. Aber seit er vor ein paar Jahren ein Blutgerinnsel im Auge gehabt habe, hätte er immer … Nun, er sei eben immer auf der Hut vor so etwas, einem Schlaganfall womöglich, was Gott verhindern möge.
»Ich dachte, es ist vielleicht die Meniéresche Krankheit«, rutschte es ihm heraus.
»Grundsätzlich halte ich ja nichts von Zensur«, meinte der Arzt, »aber wenn es nach mir ginge, würde man alle medizinischen Lexika verbrennen.«
»Na schön, ich habe nachgeschlagen«, gab Wexford zu. »Und ich habe wohl auch nicht die richtigen Symptome, abgesehen vom Hinfallen.«
»Ich schlage vor, dass Sie sich ans Gesetzbuch halten und mir die Diagnose überlassen!«
Das war ihm recht. Akande untersuchte Kopf und Brustkorb und überprüfte die Reflexe. »Sind Sie mit dem Auto gekommen?«
Wexford nickte erschrocken.
»Fahren Sie ein paar Tage lieber nicht Auto. Nach Hause können Sie natürlich noch fahren. Halb Kingsmarkham hat diesen Virus. Ich hatte ihn auch.«
»Ein Virus?«
»Ganz recht. Komische Geschichte, er greift anscheinend die Bogengänge im Innenohr an, da, wo der Gleichgewichtssinn sitzt.«
»Ist es wirklich bloß ein Virus? Ein Virus kann einen tatsächlich so umhauen, aus heiterem Himmel? Gestern bin ich im Garten draußen der Länge nach hingefallen.«
»Ist ja auch eine beachtliche Länge«, meinte Akande. »Aber irgendwelche Erleuchtungen hatten Sie dabei nicht? Niemand hat Ihnen untersagt, wider den Stachel zu locken?«
»Sie meinen, Erleuchtungen gehören auch zu den Symptomen? Nein, ach so, ich verstehe. Wie Paulus auf dem Weg nach Damaskus. Sie wollen mir doch nicht weismachen, dass das alles war, dass der nur einen Virus hatte?«
Akande lachte. »Allgemein wird angenommen, er sei Epileptiker gewesen. Nein, machen Sie nicht so ein Gesicht. Ich kann Ihnen versichern, es ist ein Virus und kein Fall von plötzlich auftretender Epilepsie. Ich werde Ihnen auch nichts dagegen verschreiben. Das gibt sich in ein, zwei Tagen von selbst wieder. Es würde mich sogar wundem, wenn Sie sich nicht gleich besser fühlen, nachdem Sie jetzt wissen, dass es kein Gehirntumor ist.«
»Woher wissen Sie …? Ach ja, Sie sind wahrscheinlich an Patienten mit übertriebenenÄngsten gewöhnt.«
»Es ist ja kein Wunder. Wenn’s nicht die medizinischen Bücher sind, dann die Zeitungen, die lassen die Leute ja nicht mal fünf Minuten ihre Gesundheit vergessen.«
Akande stand auf und streckte ihm die Hand hin. Wexford gefiel der Brauch, den Patienten die Hand zu schütteln, das war wie früher, als Ärzte noch Hausbesuche machten und Rechnungen schickten.
»Der Mensch ist doch ein seltsames Wesen«, sagte der Arzt. »Heute Morgen kommt zum Beispiel eine Frau in Vertretung ihrer Köchin. Schicken Sie doch die Köchin, sagte ich, aber das ging anscheinend nicht. Ich habe das Gefühl – nebenbei bemerkt, völlig unbegründet, es ist nur so eine Ahnung –, dass sie mir vor Freude nicht gerade um den Hals fallen wird, wenn sie sieht, dass ich das bin, was der Chef meines Schwiegervaters als ›farbig‹ zu bezeichnen pflegte.«
Diesmal verschlug es Wexford die Sprache.
»Ist Ihnen das peinlich? Tut mir leid. Diese Dinge sind unterschwellig immer da, und manchmal kommen sie hoch.«
»Es ist mir nicht peinlich«, sagte Wexford. »Es fiel mir bloß gerade nichts ein als – äh, Entgegnung oder Trost. Ich dachte, Sie liegen mit Ihrer Vermutung wohl richtig, ich wollte das nur nicht sagen.«
Akande klopfte ihm auf die Schulter, wenigstens zielte er darauf, landete aber auf dem Oberarm. »Nehmen Sie sich ein paar Tage frei. Bis Donnerstag sind Sie wieder auf der Höhe.«
Auf dem Korridor begegnete Wexford der Blonden, die auf Akandes Sprechzimmer zusteuerte. »Bestimmt verliere ich meine Köchin, das sehe ich schon kommen«, sagte sie und hinterließ im Vorbeigehen eine Duftwolke aus Paloma Picasso und Rothman Kingsize. Wollte sie damit etwa sagen, ihre Köchin würde sterben?
Beschwingt stieß er die beiden Flügeltüren auf und trat ins Freie. Von den Autos auf dem Parkplatz konnte nur eines ihr gehören, und zwar der Lotus Elan mit dem Kennzeichen AK 3. Es war eines der frühesten Modelle, bestimmt hatte sie dafür ein Vermögen bezahlt. Annabelle King, spekulierte er. Anne Knight? Alison Kendall? Nicht allzu viele englische Nachnamen beginnen mit K, allerdings war sie mit Sicherheit keine Engländerin. Anna Karenina, überlegte er spaßeshalber.
Akande hatte ihm erlaubt, mit dem Wagen nach Hause zu fahren. Eigentlich wäre Wexford gern zu Fuß gegangen, die Idee gefiel ihm, weil er jetzt keine Angst mehr hatte hinzufallen. Seltsam, was der Geist mit dem Körper alles anstellen konnte. Wenn er den Wagen daließe, müsste er ihn später doch irgendwann holen.
Die junge Frau kam die flache Treppe des Gesundheitszentrums heruntergewatschelt, das Kind hüpfte hinunter. Leutselig kurbelte Wexford sein Fenster herunter und fragte, ob sie mitfahren wollten. Egal wohin, er war in der Stimmung, meilenweit irgendwohin zu fahren, auch wenn es nicht auf seinem Weg lag.
»Von fremden Leuten lassen wir uns nicht mitnehmen.« Zu dem Kind gewandt, sagte sie laut und vernehmlich: »Stimmt’s, Kelly?«
Brüskiert zog Wexford den Kopf wieder ein. Sie hatte ganz recht. Sie hatte sich vernünftig verhalten und er nicht. Er könnte ja ein Vergewaltiger und Kinderschänder sein und sein infames Vorhaben mittels eines Arztbesuchs schlau zu verschleiern trachten. An der Ausfahrt kam ihm ein Auto entgegen, das ihm bekannt erschien: ein alter Ford Escort; den man knallig pink gespritzt hatte. Pinkfarbene Autos sah man selten. Aber wem gehörte es? Er hatte eigentlich ein ausgezeichnetes visuelles Gedächtnis, Gesichter und Stadtlandschaften prägten sich ihm in Farbe ein, nur Namen konnte er sich nicht merken.
Er fuhr auf die South Queen Street hinaus und freute sich schon darauf, Dora die gute Nachricht mitzuteilen. Dabei malte er sich aus, wie es auch hätte kommen können – den Schrecken, die Bestätigung der Befürchtungen, den Versuch, eine tapfere Miene aufzusetzen, falls er ihr hätte sagen müssen, er sei zu einer Computertomographie des Gehirns ins Krankenhaus bestellt worden. Nichts dergleichen war nötig. Ob er im Fall des Falles tapfer gewesen wäre? Oder sie angelogen hätte?
Dann hätte er gleich drei Leute anlügen müssen. Denn als er in die Garageneinfahrt bog, sah er Neils Auto dort stehen, vorsorglich auf der linken Seite geparkt, damit er selbst vorbeikam. Neils und Sylvias Auto, sollte er wohl besser sagen, denn sie teilten es sich, nachdem Sylvias Stelle gestrichen worden war und sie ihren Wagen aufgegeben hatte. Und so wie die Dinge standen, würden sie sich vielleicht bald nicht einmal mehr diesen leisten können.
Ich sollte mich eigentlich freuen, dachte er. Ich sollte mich geschmeichelt fühlen. Nicht alle Kinder kommen an die elterliche Brust geeilt, wenn sie vom Missgeschick verfolgt werden. Seine kamen immer. Er sollte eigentlich nicht so reagieren, sich beim Anblick des Autos der Familie Fairfax nicht gleich fragen: Was ist denn nun schon wieder los?
Ein Schicksalsschlag tut manchen Ehen ganz gut. Das streitende Paar schiebt seinen Zwist beiseite und stellt sich der Welt vereint entgegen. Manchmal. Aber dazu muss eine Ehe schon ziemlich angeschlagen sein. Die Ehe von Wexfords älterer Tochter ging schon seit langem nicht mehr gut und unterschied sich von anderen schlechten Ehen vor allem darin, dass sie und Neil ihren Söhnen zuliebe unbeirrt zusammenblieben und nach immer neuen Rettungsmitteln suchten.
Zu seinem Schwiegervater hatte Neil einmal gesagt: »Ich liebe sie doch. Ich liebe sie wirklich«, doch das war schon lange her. Seither waren viele Tränen geflossen und viele Gemeinheiten ausgeteilt worden. Oft hatte Sylvia die Jungs zu Dora gebracht, und ebenso oft hatte Neil sich in einem Motel an der Straße nach Eastbourne einquartiert. Es half ihnen nichts, dass Sylvia sich weitergebildet und für das Jugendamt gearbeitet hatte, und auch die luxuriösen Auslandsreisen und ihre Umzüge in immer noch größere und noch schönere Häuser konnten die Probleme nicht lösen. Wenigstens war Geld oder der Mangel daran nie ein Thema gewesen. Geld hatten sie mehr als genug.
Bis jetzt. Bis das Architekturbüro von Neils Vater (bestehend aus zwei Partnern, nämlich Vater und Sohn) die Rezession erst leise zu spüren bekam, dann voll von ihr getroffen wurde und schließlich aufgeben musste. Inzwischen war Neil bereits seit fünf Wochen arbeitslos, Sylvia schon fast ein halbes Jahr.
Wexford schloss auf und trat ins Haus. Einen Augenblick blieb er stehen und lauschte den Stimmen: Doras gemessener, ruhiger, Neils indignierter, immer noch fassungsloser, Sylvias herrischer. Zweifellos warteten sie auf ihn, hatten eigentlich mit seiner Anwesenheit gerechnet, um sich durch seinen Gehirntumor oder seine Embolie von ihren vielfältigen Schwierigkeiten – Arbeitslosigkeit, keine Aussichten, steigende Hypothekenschulden – ablenken zu lassen.
Er öffnete die Esszimmertür, und Sylvia stürzte ihm entgegen und warf ihm die Arme um den Hals. Sie war groß und kräftig, und wenn sie ihn umarmte, musste sie sich nicht darauf beschränken, ihn bloß um die Hüfte zu fassen. Einen Augenblick lang dachte er, ihre Zärtlichkeit habe mit der Sorge um seine Gesundheit, um sein Leben zu tun.
»Dad«, sagte sie schluchzend, »Dad, stell dir vor, wie weit es mit uns gekommen ist! Mit uns. Es ist unglaublich, aber wahr. Du wirst es nicht glauben. Neil geht auf Stütze!«
»Nicht direkt auf Stütze, Liebling«, sagte Neil, eine zärtliche Anrede benutzend, die Wexford schon seit Jahren nicht mehr aus seinem Munde gehört hatte. »Nicht Stütze. Ich bekomme Arbeitslosengeld.«
»Ach, das läuft doch auf das gleiche hinaus. Stütze, Sozialversicherung, Arbeitslosengeld, das kommt doch aufs gleiche raus. Es ist unglaublich, furchtbar, dass das uns passieren muss!«
Interessant, wie Doras sanfte Stimme das schrille Geschrei zu durchdringen vermochte. Sie durchschnitt es, wie ein feiner Draht ein Stück reifen Cheddar durchschneidet. »Was hat Dr. Akande gesagt, Reg?«
»Es ist ein Virus, der anscheinend gerade umgeht. Ich soll ein paar Tage freinehmen, das ist alles.«
»Na, zum Glück«, sagte Dora schlicht. »Ein Virus.«
Sylvia schnaubte durch die Nase. »Das hätte ich dir gleich sagen können. Den hatte ich letzte Woche auch, ich konnte mich kaum auf den Beinen halten.«
»Schade, dass du es mir nicht gesagt hast, Sylvia.«
»Ich habe im Moment andere Sorgen. Ich wäre froh, wenn ich bloß mit ein bisschen Schwindelgefühl fertig werden müsste. Gut, dass du da bist, Dad, vielleicht kannst du es Neil ausreden. Ich schaffe es nicht, auf mich hört er sowieso nie. Alle anderen haben mehr Einfluss auf ihn als seine eigene Frau.«
»Ihm was ausreden?« fragte Wexford.
»Hab’ ich doch gesagt. Auf dieses – wie heißt es gleich? – ESJ zu gehen. Was weiß ich, was das heißen soll, jedenfalls ist da die Stütze und die Arbeitsvermittlung – nein, so heißt es gar nicht mehr, oder?«
»So heißt es schon seit Jahren nicht mehr«, sagte Neil. »Es heißt Jobcenter.«
»Wieso soll ich es ihm ausreden?« fragte Wexford.
»Weil es entsetzlich ist und erniedrigend, da gehen doch Leute wie wir nicht hin.«
»Und was tun dann Leute wie wir?« fragte Wexford in einem Ton, der sie hätte vorwarnen sollen.
»Die finden etwas unter den Stellenanzeigen der Times.« Neil fing an zu lachen, und Wexford, dessen Ärger sich rasch in Mitleid verwandelte, lächelte bekümmert. Seit Wochen hatte Neil täglich die Stellenangebote studiert und, wie er seinem Schwiegervater erzählt hatte, mehr als dreihundert Bewerbungsbriefe geschrieben – alles umsonst.
»Die Times gibt einem aber kein Geld«, sagte Neil, und Wexford konnte im Gegensatz zu Sylvia die Verbitterung in seiner Stimme hören. »Außerdem muss ich wissen, wie ich mit unserer Hypothek dran bin. Vielleicht können sie was tun, damit die Bausparkasse das Haus nicht pfänden lässt. Ich kann es jedenfalls nicht. Vielleicht können sie mir raten, was ich wegen der Schule für die Kinder unternehmen soll, und wenn sie nur sagen, wir sollen sie auf die Gesamtschule von Kingsmarkham schicken. Jedenfalls bekomme ich dort Geld – einen Barscheck per Post, so läuft das wohl. Na ja, das werde ich ja erfahren. Es ist aber auch höchste Zeit, Reg. Wir haben bloß noch zweihundertsiebzig Pfund auf unserem gemeinsamen Konto, und andere Konten haben wir nicht. Ist auch gut so, die fragen einen bestimmt, was für Ersparnisse man hat, bevor sie zahlen.«
Wexford sagte ruhig: »Soll ich euch Geld leihen? Wir könnten euch schon etwas geben.« Er dachte nach und schluckte. »Sagen wir, tausend?«
»Danke, Reg, vielen Dank, aber lieber nicht. Das würde das dicke Ende nur hinausschieben. Jedenfalls danke für dein Angebot. Geliehenes Geld sollte man zurückzahlen, und ich weiß nicht, wie ich es dir zurückzahlen könnte, jedenfalls in den nächsten Jahren nicht.« Er schaute auf seine Uhr. »Ich muss los«, sagte er. »Ich habe um halb elf einen Termin wegen dem Antrag auf Arbeitslosengeld.«
Unwillkürlich rutschte es Dora heraus: »Ach, bekommt man da einen Termin?«
Seltsam, wie ein Lächeln ein Gesicht traurig aussehen lassen konnte. Neil war nicht direkt zusammengezuckt. »Merkt ihr, wie degradierend Arbeitslosigkeit sein kann? Ich gehöre nicht mehr zu denen, die zuvorkommend behandelt werden. Ich bin jetzt einer von denen, die in der Schlange stehen und froh sein können, wenn sie überhaupt jemand empfängt, die unverrichteter Dinge nach Hause geschickt werden und gesagt bekommen, sie sollen morgen wiederkommen. Meinen Status habe ich wohl schon verloren, und meinen Nachnamen auch. Man wird mich aufrufen: ›Neil, Mr. Stanton ist jetzt frei für Sie‹ Um zehn vor eins, obwohl ich auf halb elf bestellt war.«
»Entschuldige, Neil, ich wollte nicht …«
»Nein, natürlich nicht. Es geschieht ganz unbewusst. Oder sagen wir, das Bewusstsein verändert sich, man denkt anders über einen erfolgreichen Architekten, der so viele Aufträge hat, dass er kaum mehr nachkommt, als über jemanden, der arbeitslos ist. Ich muss gehen.«
Er ließ den Wagen da. Sylvia brauchte ihn. Er würde die halbe Meile bis zum Arbeitsamt zu Fuß gehen, und danach …
»Na, mit dem Bus fahren«, sagte Sylvia. »Wieso nicht? Muss ich ja meistens auch. Pech, wenn er bloß viermal am Tag fährt. Wir müssen auf unseren Benzinverbrauch achten. Er wird ja wohl fünf Meilen weit laufen können. Du hast selbst erzählt, dass Großvater fünf Meilen zur Schule gelaufen ist und fünf zurück, als er gerade mal zehn war.«
Der resigniert verzweifelte Unterton in ihrer Stimme machte Wexford Sorgen, obwohl er ihr Selbstmitleid und ihre Gereiztheit missbilligte. Er hörte Doras Angebot, die Jungen über das Wochenende zu nehmen, damit Sylvia und Neil einmal rauskämen, und wenn sie nur zu Neils Schwester nach London fuhren, und unterstützte ihren Vorschlag etwas zu eilfertig.
»Wenn ich dran denke«, meinte Sylvia, die gerne in trübseligen Erinnerungen schwelgte, »wie ich geackert habe, um Sozialarbeiterin zu werden.« Sie nickte ihrem Mann zum Abschied zu und fuhr fort, während er noch in Hörweite war: »Neil hat sich nie besonders bemüht, seinen Lebensstil dem anzupassen und mir zu helfen. Ich habe jemanden suchen müssen, der die Kinder hütet. Manchmal habe ich bis Mitternacht gearbeitet. Und was hab’ ich jetzt davon?«
»Es wird schon wieder, Liebes«, sagte Dora.
»Einen Job beim Jugendamt bekomme ich nie wieder, das weiß ich. Erinnerst du dich an die Kinder in Stowerton, Dad? Die ›allein zu Haus‹?«
Wexford überlegte. Zwei seiner Beamten hatten die Eltern in Gatwick in Empfang genommen, als sie gerade aus dem Flugzeug aus Teneriffa stiegen. Er sagte: »Hießen die nicht Epson? Er war schwarz und sie weiß …«
»Was hat denn das damit zu tun? Wieso bringst du jetzt Rassismus ins Spiel? Das war mein letzter Auftrag bei der Fürsorge, bevor sie die Mittel gekürzt haben. Damals hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich wieder Hausfrau sein würde, noch bevor diese Kinder wieder bei ihren Eltern sind. Willst du wirklich die Jungs übers Wochenende behalten, Mutter?«
Es war die Frau in dem pinkfarbenen Auto gewesen. Fiona Epson. Nicht, dass das wichtig wäre. Wexford überlegte, ob er nach oben gehen und sich hinlegen oder die Anordnungen des Arztes in den Wind schlagen und wieder ins Büro gehen sollte. Das Büro siegte. Beim Hinausgehen hörte er, wie Sylvia ihrer Mutter einen Vortrag über eine, wie sie es nannte, politisch korrekte Ausdrucksweise hielt.
2
_____
Als die Akandes vor etwa einem Jahr nach Kingsmarkham gezogen waren, hatten die Besitzer der beiden Nachbarhäuser von Ollerton Avenue 27 ihre Häuser zum Verkauf angeboten. Obwohl dies für Raymond und Laurette Akande und ihre Kinder beleidigend war, hatte es praktisch gesehen doch Vorteile. Da die Rezession die Talsohle erreicht hatte, blieben die Häuser lange auf dem Markt, wobei ihr Kaufpreis stetig sank, doch als die neuen Nachbarn schließlich kamen, erwiesen sie sich als nette Leute, ebenso freundlich und liberal wie die übrigen Bewohner der Ollerton Avenue.
»Beachten Sie meine Wortwahl« sagte Wexford. »Ich sagte freundlich und ›liberal‹, ich habe nicht gesagt, ›antirassistisch‹. In diesem Lande sind wir alle Rassisten.«
»Ach was«, sagte Detective Inspector Michael Burden. »Ich bin keiner. Und Sie auch nicht.«
Sie saßen in Wexfords Esszimmer beim Kaffeetrinken, während die Fairfax-Jungen Robin und Ben und Burdens Sohn Mark mit Dora nebenan im Fernsehen die Tennismeisterschaften von Wimbledon anschauten. Wexford war es gewesen, der das Thema angeschnitten hatte, er wusste auch nicht, wie er darauf gekommen war. Vielleicht wegen Sylvias Anschuldigung, als sie über die Epsons gesprochen hatten. Es hatte ihn seither ziemlich beschäftigt.
»Meine Frau nicht und Ihre auch nicht«, sagte Burden, »und unsere Kinder auch nicht.«
»Wir sind alle Rassisten«, wiederholte Wexford, als habe er ihn gar nicht gehört. »Alle, ohne Ausnahme. Bloß dass Leute über vierzig noch schlimmer sind. Sie und ich sind in dem Glauben erzogen worden, wir seien schwarzen Menschen überlegen. Gut, es wurde vielleicht nicht offen ausgesprochen, aber es war immer da. Wir wurden so konditioniert, und es ist unausrottbar in uns drin. Meine Frau hatte eine schwarze Puppe, die Negerchen hieß, und die weiße hieß Pamela. Schwarze wurden als Neger bezeichnet. Wer, von Soziologen wie meiner Tochter Sylvia einmal abgesehen, bezeichnet denn Weiße als Europide?«
»Meine Mutter nannte Schwarze sogar ›Darkies‹. Sie dachte, das wäre höflich. ›Nigger‹ war ungezogen, aber ›Darky‹ war in Ordnung. Das ist aber schon lange her. Die Zeiten haben sich geändert.«
»Nein, jedenfalls nicht sehr. Bloß, dass es heute mehr Schwarze gibt. Kürzlich sagte mein Schwiegersohn zu mir, ihm würde der Unterschied zwischen einem Schwarzen und einem Weißen gar nicht mehr auffallen. Ich sagte, dann merkst du also auch keinen Unterschied zwischen hellen und dunklen Haaren, oder? Dann merkst du auch nicht mehr, ob einer dick oder dünn ist? Wird dadurch etwa der Rassismus überwunden? Wir kommen erst weiter, wenn man einen Schwarzen meint und fragt: ›Welcher ist es?‹ und als Antwort kommt: ›Der mit der roten Krawatte.‹«
Burden lächelte. Die Jungen stürmten türenknallend herein, um ihnen mitzuteilen, dass Martina und Steffi jeweils ihren ersten Satz gewonnen hatten. Nachnamen gab es für sie und ihre Altersgenossen kaum noch.
»Kriegen wir die Schokokekse?«
»Fragt eure Großmutter.«
»Die ist eingeschlafen«, sagte Ben. »Aber sie hat gesagt, nach dem Essen dürfen wir, und jetzt ist nach dem Essen. Die Schokokekse mit den Schokoladenstückchen, und wir wissen, wo die sind.«
»Na, damit ihr Ruhe gebt«, sagte Wexford und fügte mit tadelndem Unterton hinzu: »Die angebrochene Packung müsst ihr aber aufessen. Ist das klar?«
»No problem«, sagte Robin.
Nachdem die Burdens wieder gegangen waren, nahm Wexford die Broschüre zur Hand, die ihm sein Schwiegersohn dagelassen hatte, das ES 461, den Antragsvordruck. Genauer gesagt, eine Kopie der Broschüre. Das Original hatte Neil zu seinem Termin beim Arbeitsamt mitgenommen. Neil, der seinen Missgeschicken jeweils dadurch begegnete, dass er sich mit der größtmöglichen Selbstentwürdigung darin suhlte, hatte sich die Mühe gemacht, sämtliche neunzehn Seiten der Broschüre zu fotokopieren, die das Arbeitsamt als »Formular« zu bezeichnen beliebte. Er hatte die Kollektion türkisblauer, grüner, gelber und orangefarbener Blätter zum Copyshop von Kingsmarkham gebracht, wo es einen Farbkopierer gab, damit Wexford ein ES 461 in seiner ganzen Pracht (sein Ausdruck) bewundern konnte. Er sollte auch nachlesen können, welche Anforderungen eine wohltätige Regierung an ihre arbeitslosen Bürger stellte.
Auf der ersten Seite stand ein neugeprägtes Wort: »Jobsuche«. Bevor man das »Formular« ausfüllte, musste man drei Seiten Anmerkungen lesen, dann kamen fünfundvierzig oft mehrteilige Fragen, bei deren Lektüre Wexford ganz schwindlig im Kopf wurde. Manche Fragen waren harmlos, manche richtig traurig, manche unheimlich. »Ist Ihre Arbeitsfähigkeit aus gesundheitlichen Gründen eingeschränkt?« lautete Frage 30, gleich nach Frage 29: »Für welchen Mindestlohn sind Sie zu arbeiten bereit?« Nicht gerade viel wurde bei der Frage verlangt: »Haben Sie irgendwelche akademischen Qualifikationen (zum Beispiel mittleren Schulabschluss, Gesellenprüfung)?«; »Haben Sie ein eigenes Transportmittel?« fragte Nummer 9. Frage 4 wollte wissen: »Falls Sie während der letzten zwölf Monate in keinem Arbeitsverhältnis standen, womit haben Sie sich beschäftigt?«
Diese Frage ärgerte ihn maßlos. Was ging das diese Berater, diese mickrigen Beamten, dieses Regierungsministerium an? Er fragte sich, was sie, abgesehen von der Antwort »mit Arbeitssuche«, wohl erwarteten. Zwei Wochen Urlaub auf den Bahamas? Dinner in den Vier Jahreszeiten? Chinesisches Porzellan sammeln? Er schob die bunten Blätter beiseite und ging ins Wohnzimmer hinüber, wo sich Martina Navratilova auf dem Center Court immer noch tapfer schlug.
»Rutsch ein bisschen«, sagte er zu Robin, der auf dem Sofa saß.
»Pas de probléme.«
Früher sagte einem der Arzt, man solle nächste Woche wiederkommen oder »wenn die Symptome verschwunden sind«. Heutzutage sind die Ärzte meistens so beschäftigt, dass sie Patienten ohne Symptome nach Möglichkeit gar nicht mehr sehen wollen. Denn es gibt zu viele andere, die eigentlich ins Bett gehören und zu Hause besucht werden sollten, jedoch gezwungen sind, sich ins Gesundheitszentrum zu schleppen und ihre Viren im ganzen Wartezimmer zu verbreiten.
Wexfords Virus hatte sich offensichtlich im gleichen Moment verflüchtigt, als Dr. Akande die magischen Worte ausgesprochen hatte. Er hatte nicht die Absicht, zu einer bloßen Nachuntersuchung noch einmal hinzugehen, und missachtete sogar die Anordnung des Arztes, sich ein paar Tage freizunehmen. Immer wieder dachte er über die Frage nach, die sich danach erkundigte, womit das Opfer der »Jobsuche« sich beschäftigt hatte, und überlegte, wie er sie wohl beantworten würde. Wenn er zum Beispiel nicht in der Arbeit war, den Urlaub zu Hause verbrachte. Lesen, sich mit den Enkeln unterhalten, nachdenken, Geschirr abtrocknen, mit einem Freund auf ein Gläschen ins Olive and Dove gehen, lesen. Ob sie damit zufrieden wären? Oder ob sie vielleicht etwas ganz anderes hören wollten?
Trotzdem hatte er, als Dr. Akande eine Woche später anrief, erst ein schlechtes Gewissen, dann war er besorgt. Dora nahm den Anruf entgegen. Es war kurz vor neun an einem Mittwochabend Anfang Juli, und die Sonne war noch nicht untergegangen. Wexford saß in der offenen Terrassentür und las Der Fremde von Camus, das er vor dreißig Jahren zum ersten Mal gelesen hatte, und schlug mit dem Kingsmarkham Courier nach den Stechmücken.
»Was will er?«
»Das hat er nicht gesagt, Reg.«
Es konnte ja sein, dass Akande ein so gewissenhafter und sorgfältiger Arzt war, dass er sich die Mühe machte, sich sogar nach dem Befinden nur leicht erkrankter Patienten zu erkundigen. Oder aber – Wexfords Herz tat einen dumpfen Schlag – seine »Fallsucht« war überhaupt nicht die Lappalie gewesen, als die Akande sie diagnostiziert hatte, auch nicht die Folge einer allgemein verbreiteten, unbedeutenden Epidemie, sondern etwas viel Ernsteres, und bei den Symptomen handelte es sich um die Vorboten von …
»Ich komme.«
Er griff nach dem Hörer. Gleich bei Akandes ersten Worten wurde ihm klar, dass er nichts erfahren würde, sondern etwas gefragt wurde. Der Arzt verabreichte keine Belehrungen, sondern kam mit dem Hut in der Hand. Diesmal hatte er, der Polizist, die Diagnose zu stellen.
»Entschuldigen Sie, wenn ich Sie mit dieser Sache behellige, Mr. Wexford, aber ich hatte gehofft, Sie könnten mir helfen.«
Wexford schwieg abwartend.
»Wahrscheinlich hat es nichts zu bedeuten.«
Diese Worte, auch wenn er sie schon oft gehört hatte, ließen ihn immer wieder erschauern. Er hatte die Erfahrung gemacht, dass es fast immer etwas zu bedeuten hatte, und wenn er davon erfuhr, etwas Schlimmes.
»Wenn ich mir wirklich Sorgen machen würde, ginge ich zur Polizei, aber so ernst ist es nicht. Meine Frau und ich kennen nicht viele Leute in Kingsmarkham – natürlich nicht, wir sind ja noch relativ neu hier. Aber da Sie mein Patient sind …«
»Was ist passiert, Doktor?«
Ein leises, abwehrendes Lachen, ein Zögern, dann benutzte Akande eine ungewöhnliche Formulierung: »Ich versuche vergeblich, meine Tochter ausfindig zu machen.« Er hielt inne und nahm einen zweiten Anlauf. »Also, was ich sagen will, ich weiß nicht, wie ich herausfinden kann, wo sie ist. Na ja, sie ist zweiundzwanzig, eine erwachsene Frau, und wenn sie nicht zu Hause bei uns wohnen würde, sondern eine eigene Wohnung hätte, wüsste ich ja nicht einmal, dass sie nicht nach Hause gekommen ist. Ich würde nicht …«
Wexford unterbrach ihn: »Wollen Sie sagen, Ihre Tochter wird vermisst?«
»Nein, nein, das wäre zu viel gesagt. Sieist nicht nach Hause gekommen, und da, wo sie gestern Abend hätte sein sollen, istsie nicht aufgetaucht. Aber, wie gesagt, sie ist erwachsen. Falls sie sich entschieden hat, woanders hinzugehen … nun, es wäre ihr gutes Recht.«
»Aber Sie hätten erwartet, dass sie es Ihnen sagt?«
»Eigentlich schon. Sie ist nicht sehr zuverlässig in diesen Dingen, wie alle jungen Leute, wie Sie ja wohl wissen, aber wir haben noch nie erlebt, dass sie … nun, es sieht so aus, als würde sie uns belügen. Sie sagt uns etwas und tut dann etwas anderes. So sehe ich das. Meine Frau allerdings macht sich Sorgen. Das ist untertrieben, sie ist äußerst beunruhigt.«
Immer sind es ihre Frauen, dachte Wexford. Sie projizieren ihre Gefühle auf ihre Frauen. Meine Frau ist ziemlich besorgt deswegen. Es beunruhigt meine Frau. Ich unternehme diese Schritte, weil, ehrlich gesagt, die Sache meiner Frau gesundheitlich zu schaffen macht. Als starke Männer, als harte Machos, wollen sie einem weismachen, sie wären über alle Ängste, Befürchtungen und Wünsche erhaben, über Sehnsüchte, Leidenschaften und Bedürfnisse.
»Wie heißt sie?« fragte er.
»Melanie.«
»Wann haben Sie Melanie zum letzten Mal gesehen, Dr. Akande?«
»Gestern Nachmittag. Sie hatte in Kingsmarkham einen Termin und wollte dann mit dem Bus nach Myringham fahren, wo ihre Freundin wohnt. Die Freundin wollte ihren einundzwanzigsten Geburtstag feiern, und Melanie war eingeladen und sollte auch dort übernachten. Mit achtzehn werden sie volljährig, also feiern sie zwei Partys, eine mit achtzehn und eine mit einundzwanzig.«
Das wusste Wexford. Ihn interessierte viel mehr das von einem kläglichen Optimismus nur unzureichend überdeckte Entsetzen, das in Akandes Stimme mitschwang. »Wir haben sie erst heute Nachmittag zurückerwartet. Wenn sie nicht müssen, stehen sie ja vor zwölf Uhr mittags nicht auf. Meine Frau und ich haben gearbeitet, und wir hatten eigentlich mit ihr gerechnet, als wir nach Hause kamen.«
»Kann es sein, dass sie da war und wieder weggegangen ist?«
»Das kann schon sein. Sie hat natürlich einen Schlüssel. Aber sie war gar nicht bei Laurel – das ist die Freundin. Meine Frau hat dort angerufen. Melanie ist dort gar nicht aufgetaucht. Ich finde das nicht weiter beunruhigend. Die beiden haben sich gestritten – na, sagen wir, sie hatten eine Meinungsverschiedenheit. Ich habe gehört, wie Melanie am Telefon zu ihr sagte, ich kann mich noch genau an ihre Worte erinnern: ›Ich lege jetzt auf. Mit mir brauchst du am Mittwoch nicht zu rechnen.‹«
»Hat Melanie einen Freund, Doktor?«
»Nicht mehr. Sie haben vor etwa zwei Monaten Schluss gemacht.«
»Kann es sein, dass es eine Versöhnung gab?«
»Schon möglich.« Es klang ungehalten. Als er es wiederholte, klang es hoffnungsvoll. »Schon möglich. Meinen Sie, sie hat sich gestern mit ihm getroffen, und sie sind zusammen irgendwohin gegangen? Das würde meine Frau nicht gutheißen. Sie hat ziemlich – strikte Ansichten über diese Dinge.«
Ich nehme an, sie würde Geschlechtsverkehr Vergewaltigung oder Mord vorziehen, dachte Wexford ziemlich verärgert, sprach es aber selbstverständlich nicht aus. »Dr. Akande, wahrscheinlich haben Sie recht, wenn Sie sagen, es habe nichts zu bedeuten. Melanie ist irgendwo, wo sie keinen Zugang zu einem Telefon hat. Rufen Sie mich doch morgen früh an, ja? So früh Sie wollen.« Er zögerte. »Sagen wir, nach sechs. Egal, was los ist, ob sie nun auftaucht oder anruft oder nicht.«
»Ich habe das Gefühl, sie versucht gerade, uns zu erreichen.«
»Na, dann machen wir jetzt besser die Leitung frei.«
Um fünf nach sechs klingelte das Telefon.
Er schlief nicht mehr. Er war gerade aufgewacht. Vielleicht, weil er sich unterbewusst Sorgen um das Akande-Mädchen machte. Als er den Hörer abnahm und noch bevor Akande etwas sagte, dachte er, ich hätte nicht warten sollen, ich hätte gestern Abend gleich etwas unternehmen sollen.
»Sie ist nicht gekommen und hat auch nicht angerufen. Meine Frau ist sehr beunruhigt.«
Und Sie ja wohl auch, dachte Wexford. Wäre ich jedenfalls. »Ich komme. In einer halben Stunde bin ich bei Ihnen.«
Sylvia hatte geheiratet, kaum dass sie mit der Schule fertig war. Er hatte gar keine Gelegenheit gehabt, sich Sorgen zu machen, wo sie war oder was ihr passierte. Aber seine jüngere Tochter Sheila hatte ihm schlaflose, schreckerfüllte Nächte bereitet. Wenn sie die Ferien von der Schauspielschule zu Hause verbrachte, hatte sie sich darauf verlegt, mit ihrem jeweiligen Freund zu verschwinden, ohne anzurufen, ohne irgendeinen Hinweis auf ihren Aufenthaltsort zu hinterlassen, um sich dann drei oder vier Tage später aus Glasgow, Bristol oder Amsterdam zu melden. Daran hatte er sich nie gewöhnen können. Um die Akandes zu beruhigen, würde er ihnen ein paar Geschichten aus seiner eigenen Erfahrung erzählen, überlegte er, während er duschte und sich anzog, aber er würde Melanie auch als vermisst melden. Sie war weiblich, sie war jung, und deshalb würde man eine Suchaktion einleiten.
An manchen Tagen ging er um der Gesundheit willen zu Fuß ins Büro, allerdings normalerweise zwei Stunden später. Es war ein diesiger Morgen, kein Lüftchen regte sich, am weißen Himmel stand eine noch weißere, hellere Sonne. Tau lag auf dem Seitenstreifen, den die Sommerhitze strohgelb verbrannt hatte. In den ersten zwei Straßen sah er keine Menschenseele, aber als er aus der Mansfield Road bog, begegnete er einer alten Frau mit einem winzigen Yorkshire-Terrier. Sonst niemandem. Zwei Autos fuhren an ihm vorbei. Eine Katze mit einer Maus im Maul ging quer über die Straße von der Ollerton Avenue 32 zur Nummer 25 und schlüpfte durch eine Klappe an der Haustür hinein.
Wexford brauchte bei Nummer 27 nicht zu klingeln. Dr. Akande erwartete ihn bereits am Eingang.
»Das ist sehr freundlich von Ihnen.«
Wexford widerstand der Versuchung, mit einer von Robins polyglotten Versionen von »Kein Problem« zu antworten, und ging ihm voraus ins Haus. Ein nettes, langweiliges, ganz gewöhnliches Haus. Er konnte sich nicht daran erinnern, schon einmal in einem der Einfamilienhäuser in der Ollerton Avenue gewesen zu sein. Die Straße war von Bäumen gesäumt, zu dieser Jahreszeit sogar von Bäumen beschattet. Bestimmt raubte ihr Schatten den Innenräumen des Akande-Hauses jedes Licht, bis die Sonne herüberwanderte, und im ersten Moment, als er ins Zimmer trat, sah er die Frau gar nicht, die am Fenster stand und ins Freie schaute.
Die klassische Pose, von alters her die typische Haltung der Mutter, Gattin oder Geliebten, die dasteht und wartet. »Schwester Anne, Schwester Anne, siehst du jemanden kommen? Ich sehe nur das grüne Gras und den gelben Sand …« Sie drehte sich um und kam auf ihn zu, eine hochgewachsene, schlanke Frau von etwa fünfundvierzig Jahren, die die Schwesterntracht des Stowerton Royal Hospital trug – ein kurzärmeliges marineblaues Kleid, einen marineblauen Gürtel mit reichverzierter Schnalle, zwei bis drei Ansteckschildchen über der linken Brust. Wexford hatte sie sich nicht so attraktiv vorgestellt, so ungewöhnlich gutaussehend, so elegant. Wieso eigentlich nicht?
»Laurette Akande.«
Sie streckte die Hand aus. Es war eine lange schmale Hand, die Innenfläche maisgolden, der Handrücken ein dunkles Kaffeebraun. Sie brachte ein Lächeln zustande. Er dachte, sie haben immer so wunderschöne Zähne, aber gleich schoss ihm das Blut ins Gesicht, wie es ihm zuletzt als Teenager passiert war. Er war also doch ein Rassist. Wieso dachte er, seit er dieses Zimmer betreten hatte, die ganze Zeit, sonderbar, hier ist es ja wie in anderen Häusern, die gleiche Art von Möbeln, die gleichen spanischen Wicken in der gleichen Art Vase … Er räusperte sich und sprach mit fester Stimme.
»Sie machen sich Sorgen um Ihre Tochter, Mrs. Akande?«
»Wir machen uns beide Sorgen. Wir haben auch allen Grund dazu, meinen Sie nicht? Es sind jetzt schon zwei Tage.«
Er bemerkte, dass sie weder sagte, es habe nichts zu bedeuten, noch, dass sich junge Leute eben so benähmen.
»Setzen Sie sich doch.«
Sie gab sich herrisch, ein bisschen lässig. Ihr fehlte die englische Art ihres Mannes, seine umgängliche, fürsorgliche Art. Geschichten über Sheilas jugendliche Eskapaden waren jetzt nicht angebracht. Laurette Akande sprach forsch: »Es wird Zeit, dass wir offizielle Schritte unternehmen, denke ich. Wir müssen sie als vermisst melden. Sind Sie nicht ein bisschen zu hoch oben für diese Dinge?«
»Das geht vorerst schon«, erwiderte Wexford. »Zunächst brauche ich ein paar Angaben von Ihnen. Fangen wir mit Namen und Adresse der Leute an, bei denen sie übernachten sollte. Den Namen ihres Freundes notiere ich auch. Ach ja, und was war das für ein Termin, den sie in Kingsmarkham hatte, bevor sie nach Myringham gefahren ist?«
»Auf dem Arbeitsamt«, sagte Dr. Akande.
Seine Frau verbesserte ihn präzise. »Im Employment Service and Job Center – der staatlichen Arbeitsvermittlungs- und Beratungsstelle; ESJ heißt das heute. Melanie suchte einen Job.
Sie war schon auf Stellensuche, lange bevor sie mit dem Studium fertig war«, sagte Laurette Akande. »Sie hat in Myringham studiert und diesen Sommer die Abschlussprüfung gemacht.«
»An der University of the South?« fragte Wexford.
Ihr Mann antwortete. »Nein, Myringham University, das ist das ehemalige Polytechnikum. Das sind jetzt alles Universitäten. Sie studierte Musik und Tanz, ›Darstellende Kunst‹ heißt der Studiengang. Ich war immer dagegen. Auf der Schule hat sie einen guten Abschluss in Geschichte gemacht da hätte sie doch Geschichte studieren können!«
Wexford konnte sich denken, was er gegen Musik und Tanz einzuwenden hatte. »Es sind so wundervolle Tänzer«, »Sie haben diese herrlichen Stimmen …« Wie oft hatte er diese scheinbar wohlwollenden Bemerkungen gehört?
Laurette sagte: »Ihnen ist vielleicht bekannt, dass von allen gesellschaftlichen Gruppen in diesem Land Schwarzafrikaner die beste Ausbildung haben. Das ist statistisch erwiesen. Wir stellen hohe Erwartungen an unsere Kinder. Sie hätte sich auf einen Beruf vorbereiten sollen. Plötzlich schien ihr wieder einzufallen, dass es bei der momentanen Krise nicht um Melanies Ausbildung oder den Mangel an derselben ging. »Gut, das gehört jetzt nicht hierher. In den Bereichen, für die sie sich interessierte, gab es keine freien Stellen. Ihr Vater hatte ihr das bereits gesagt, aber sie wollte ja nicht hören. Ich sagte, dann musst du eben umschulen auf Betriebswirtschaft oder etwas ähnliches. Sie ging zum Arbeitsamt, um sich ein Antragsformular zu holen, und bekam für Dienstag um halb drei einen Beratungstermin.«
»Wann ist sie aus dem Haus gegangen?«
»Mein Mann hatte Nachmittags Sprechstunde, und ich hatte meinen freien Tag. Melanie nahm eine Reisetasche mit und sagte, sie wolle etwa um fünf bei Laurel sein. Ich erinnere mich noch, wie ich sagte, verlass dich nicht darauf. Wenn du um halb drei einen Termin hast, heißt das nicht, dass du gleich drankommst; es kann durchaus sein, dass du eine Stunde warten musst. Sie ging um zehn nach zwei aus dem Haus, so hatte sie genügend Zeit. Das weiß ich, denn von hier ist es eine Viertelstunde bis zur High Street.«
Laurette Akande hätte eine bewundernswerte Zeugin abgegeben! Wexford ertappte sich dabei, wie er insgeheim hoffte, dass sie nie in diese Lage käme. Ihre Stimme klang kühl und beherrscht. Sie kam sofort zur Sache. Unter ihrem südostenglischen Akzent deutete noch etwas auf das afrikanische Land hin, aus dem sie, vielleicht als Studentin, gekommen war.
»Hatten Sie den Eindruck, sie wollte vom Arbeitsamt direkt nach Myringham fahren?«
»Sicher. Mit dem Bus. Sie wollte den Bus um Viertel nach vier noch erwischen, deshalb hatte ich sie ja gewarnt, dass sie bei der Beratung wahrscheinlich warten müsste. Eigentlich wollte sie meinen Wagen haben, aber das ging nicht, weil ich ihn am nächsten Morgen selbst brauchte. Ich musste um acht zum Tagesdienst in der Klinik sein.« Sie sah auf ihre Uhr. »Heute auch. Bei dem Verkehr dauert eine sonst zehnminütige Fahrt eine halbe Stunde.«
Sie ging also zur Arbeit? Wexford hatte auf ein Anzeichen jener Angst gewartet, unter der sie, wie Dr. Akande versichert hatte, so sehr litt. Es kam nicht. Entweder war sie gar nicht beunruhigt, oder sie hatte sich eisern unter Kontrolle.
»Wo ist Melanie Ihrer Meinung nach, Mrs. Akande?«
Sie stieß ein leises kurzes Lachen aus, ein ziemlich frostiges Lachen. »Ich hoffe doch sehr, dass sie nicht da ist, wo sie höchstwahrscheinlich ist. Mit Euan zusammen in seiner Wohnung – besser gesagt, in seinem Zimmer.«
»Das würde Melanie uns nicht antun, Letty.«
»Sie würde das nicht so sehen, dass sie es uns antäte. Sie hat unsere Sorge um ihre Sicherheit und ihre Zukunft nie besonders wichtig genommen. Ich habe sie gefragt, ob sie eins von diesen Mädchen sein will, die die Jungs absichtlich schwängern und dann auch noch stolz auf diese Großtat sind? Euan hat bereits zwei Kinder von zwei verschiedenen Mädchen und ist noch nicht einmal zweiundzwanzig. Das weißt du doch, du erinnerst dich, wie sie uns von diesen Kindern erzählt hat.«
Sie hatten Wexford völlig vergessen. Er hüstelte. Dr. Akande sagte bekümmert: »Deshalb hat sie sich von ihm getrennt. Sie war genauso schockiert und erschüttert wie wir. Sie ist nicht zu ihm zurückgegangen, da bin ich sicher.«
»Dr. Akande«, sagte Wexford, »würden Sie bitte mit mir aufs Polizeirevier kommen und Melanie als vermisst melden? Ich halte die Sache für sehr ernst. Wir müssen Ihre Tochter suchen, wir müssen so lange suchen, bis wir sie finden.«
Tot oder lebendig, aber das sagte er nicht.
Das Gesicht auf dem Foto hatte nichts Europäisches an sich. Melanie Elizabeth Akande hatte eine niedrige Stirn, eine breite, ziemlich flache Nase und volle, breite Lippen. Von den klassischen Gesichtszügen ihrer Mutter zeigte sich bei ihr nichts. Ihr Vater stammte aus Nigeria, wie Wexford jetzt erfuhr, ihre Mutter aus Freetown in Sierra Leone. Ihre Augen waren riesig, das dichte schwarze Haar eine Masse kleiner Locken. Während er das Foto betrachtete, machte Wexford eine seltsame Entdeckung. Obwohl er sie nicht schön fand, verstand er, dass sie nach den Maßstäben von anderen Menschen, den Maßstäben von Millionen von Afrikanern, Leuten aus der Karibik und Afroamerikanern, wahrscheinlich als besonders hübsch galt. Wieso waren es immer die Weißen, die die Kriterien festlegten?
In der Vermisstenmeldung, die ihr Vater ausgefüllt hatte, wurde sie als eins siebzig groß, schwarzhaarig, mit dunkelbraunen Augen beschrieben, das Alter war mit zweiundzwanzig angegeben. Er musste erst seine Frau im Krankenhaus anrufen, um daran erinnert zu werden, dass Melanie achtundfünfzig Kilo wog und, als sie zuletzt gesehen wurde, mit Bluejeans, einem weißen Hemd und einer langen, bestickten Weste bekleidet gewesen war.
»Sie haben noch einen Sohn, nicht wahr?«
»Ja, er studiert Medizin in Edinburgh.«
»Da kann er jetzt aber nicht sein. Es ist Juli.«
»Nein, soviel ich weiß, ist er in Südostasien. Er ist vor etwa drei Wochen mit ein paar Freunden im Auto losgefahren. Sie wollten nach Vietnam, aber bis dahin sind sie natürlich noch nicht gekommen …«
»Zu ihm hätte seine Schwester jedenfalls nicht gehen können«, sagte Wexford. »Ich muss Sie jetzt etwas fragen, Doktor. Was für ein Verhältnis haben Sie und Ihre Frau zu Melanie? Gab es Unstimmigkeiten?«
»Wir haben ein gutes Verhältnis«, sagte der Arzt rasch. Dann zögerte er und meinte einschränkend: »Meine Frau ist sehr streng. Das ist ja an sich nichts Verwerfliches; wir stellen zweifellos hohe Anforderungen an Melanie, die sie vielleicht nicht erfüllen kann.«
»Lebt sie gern zu Hause?«
»Es bleibt ihr eigentlich gar nichts anderes übrig. Ich bin nicht in der Lage, meinen Kindern eine Wohnung zu finanzieren, und ich glaube nicht, dass Laurette großen Wert darauf legen würde … Ich meine, Laurette erwartet von Melanie, dass sie zu Hause wohnt, bis sie …«
»Bis sie was, Doktor?«
»Nun, zum Beispiel diese Idee mit der Umschulung. Laurette erwartet von Melanie, dass sie währenddessen zu Hause wohnt und vielleicht erst dann wegzieht, wenn sie genug verdient und so verantwortungsbewusst ist, dass sie sich selbst etwas leisten kann.«
»Ich verstehe.«
Sie musste bei ihrem Freund sein, dachte Wexford. Sie hatte ihn kennengelernt, wie ihr Vater sagte, als sie beide im ersten Semester am damaligen Polytechnikum von Myringham studierten, bevor derartige Institutionen den Status einer Universität erhielten. Euan Sinclair kam aus dem Londoner East End und hatte gleichzeitig mit Melanie die Abschlussprüfung gemacht, obwohl der mit Ärger und Beleidigungen einhergehende Streit die beiden bereits entzweit hatte. Als er und Melanie schon über ein Jahr zusammen waren, wurde eins von Euans Kindern geboren, das mittlerweile schon fast zwei Jahre alt war.
Akande kannte seine gegenwärtige Adresse und nannte sie in einem Ton, als hätte die Verbitterung sie ihm ins Herz geritzt. »Wir haben versucht, ihn anzurufen, aber der Anschluss ist nicht erreichbar. Das heißt doch, man hat ihn gesperrt, weil er die Telefonrechnung nicht bezahlt hat, nicht wahr?«
»Wahrscheinlich.«
»Der junge Mann stammt von den Antillen.« Der Snobismus feierte also auch hier seine Triumphe! »Afrokaribisch sagt man heute. Ihre Mutter hält ihn für jemanden, der Melanies Leben ruinieren könnte.«
Detective Sergeant Vine wurde nach London geschickt, um Euan Sinclair in seinem möblierten Zimmer in Stepney aufzusuchen. Akande meinte, es würde ihn nicht verwundern, wenn Euan dort mit der Mutter eines seiner Kinder hausen würde, womöglich samt dem Kind. Vine verkniff sich die Bemerkung, dass es in diesem Fall reichlich unwahrscheinlich sei, Melanie dort zu finden. Von der Polizei in Myringham war ein Beamter zu Laurel Tucker geschickt worden.
»Ich werde mir das ESJ selbst einmal ansehen«, sagte Wexford zu Burden.
»Das was?«
»Das Employment Service and Job Center.«
»Warum heißt es dann nicht ESAJC?«
»Vielleicht heißt es ja richtig Employment-Service-Job-Center, in einem Wort. Ich fürchte, diese Beamten, die unsere Sprache ummodeln, haben aus Jobcenter ein Wort gemacht, so wie ›Jobsuche‹.«
Einen Augenblick blieb Burden stumm. Er versuchte mit wachsender Fassungslosigkeit einen Handzettel zu entziffern, auf dem eine Firma damit warb, Autos garantiert einbruchsicher machen zu können.
»Es sperrt die Diebe in einen Metallkäfig. Nach zwei Minuten bleibt es stehen und lässt sich nicht mehr anlassen. Dann fängt es ohrenbetäubend zu heulen an. Stellen Sie sich das mal um halb sechs auf der Autobahn vor, das Verkehrshindernis, das Sicherheitsrisiko …« Burden blickte hoch. »Warum Sie?« fragte er. »Das könnten doch Archbold oder Pemberton machen.«
»Sicher«, sagte Wexford. »Aber die müssen oft genug dorthin, wenn jemand einen Verwaltungsangestellten angreift oder anfängt, den Laden zu demolieren. Ich gehe hin, weil ich mir das mal genau ansehen will.«
3
_____
Es versprach ein schöner Tag zu werden, wenn einem die Feuchtigkeit nichts ausmachte. Kein Lüftchen regte sich, es war eher drückend als diesig. Man spürte den Drang, sich die Lunge mit frischer Luft zu füllen, aber frischere Luft als diese gab es nicht. Die heiße Sonne wurde durch das Wolkengeflecht gefiltert, hinter dem der Himmel tiefblau sein musste, hier aber sah er wie ein bleicher Opal aus und war mit einem unbeweglichen, faserigen Netz aus Zirruswolken bedeckt.
Die Autoabgase blieben unter der Wolkendecke in der reglosen Luft hängen. Beim Gehen kam Wexford an Stellen vorbei, wo jemand geraucht hatte und zu einem Schwätzchen stehengeblieben war. Der Geruch von Zigaretten lag noch in der Luft, einmal von einer französischen Zigarette, ein andermal von einer Zigarre. Obwohl es erst kurz vor zehn Uhr morgens war, wehte bereits der Gestank nicht mehr ganz taufrischer Meeresfrüchte aus dem Fischgeschäft herüber. An einer Frau vorbeizugehen, deren Haut zart nach Blumen oder Moschusparfum duftete, war eine angenehme Abwechslung. Er blieb stehen, um die Speisekarte im Fenster des neuen indischen Restaurants Nawab zu studieren: Chicken Korma, Lamb Tikka, Chicken Tandoori, Prawn Biryani, Murgh Raita – das Übliche, aber das konnte man ja über Roastbeef und Fisch und Pommes ebenfalls sagen. Es kam ganz auf dieZubereitung an. Er könnte mit Burden ja mal zum Lunch herkommen, wenn sie Zeit hatten. Sonst müssten sie sich eben etwas vom Moonflower China-Imbiss holen.
Das Employment Service and Job Center befand sich auf dieser Seite der Kingsbrook Bridge, ein Stückchen weit die Brook Road hinunter zwischen dem Marks & Spencer-Lebensmittelgeschäft und der Nationwide-Bausparkasse. Kein besonders sensibel gewählter Standort, dachte Wexford, dem dies früher nie aufgefallen war. Wer hierher kam, um sich arbeitslos zu melden, würde bei der Erinnerung an drückende Hypothekenschulden und rückübereignete Häuser erschreckt zusammenzucken und beim Anblick der Kunden, die auf der anderen Seite mit Einkaufstüten voller Leckerbissen ins Freie traten, die er selbst sich nicht mehr leisten konnte, sich kaum besser fühlen. Doch das hatte keiner der Verantwortlichen bedacht, und vielleicht war das Arbeitsamt ja auch zuerst dagewesen. Er wusste es nicht mehr.
Zur High Street hin lag – »Strengstens reserviert für Angestellte des Arbeitsamts« – ein Parkplatz. Eine Treppe mit abgebröckelter Steinbalustrade führte zu einer Flügeltür aus Aluminium und Glas hinauf. Im Inneren roch es muffig. Schwer zu sagen, woher der Geruch stammte, denn Wexford sah, dass zwei Schilder auf das Rauchverbot (»Strengstens verboten«) hinwiesen und niemand dagegen verstieß. Körpergeruch war es auch nicht. Wäre er jetzt phantasievoll – aber er beschloss, dies besser zu unterlassen –, hätte er gesagt, es sei der Geruch der Hoffnungslosigkeit und des Scheiterns.
Der große Raum bestand aus zwei Abteilungen: Die größere war die Leistungsabteilung, wo man unter Angabe der persönlichen Daten, der Familiensituation und der fortdauernden Arbeitslosigkeit einen Antrag auf Unterstützung stellte, die andere war die Stellenvermittlung. Allem Anschein nach gab es Jobs in Hülle und Fülle. Auf einem Mitteilungsbrett wurden Empfangsdamen gesucht, auf einem anderen Haushälterinnen und Bedienungspersonal, ein drittes bot Stellen im Einzelhandel, in der Geschäftsleitung, als Chauffeur, Barpersonal und Verschiedenes. Bei näherem Hinsehen stellte Wexford fest, dass sich in allen Fällen bloß Leute mit Berufserfahrung zu bewerben brauchten, es wurden Referenzen verlangt, ein Lebenslauf, Qualifikationen, Fertigkeiten, dennoch war es offenkundig, dass man nur an jungen Kräften interessiert war. Zwar stand auf keiner Karte ausdrücklich »Unter Dreißig«, aber bei den Voraussetzungen wurden Energie, Flexibilität und eine aktive, jugendliche Einstellung betont.
Auf drei Stuhlreihen saßen die Wartenden. Obwohl alle unter fünfundsechzig sein mussten, sahen einige älter aus. Die Jüngeren wirkten besonders hoffnungslos. Die Stühle, auf denen sie saßen, waren in einem neutralen Grauton gehalten, und nun fiel ihm auf, dass es ein Farbdesign gab: eine ziemlich missratene Mischung aus einem hellen Buttercreme-Ton, Marineblau und eben diesem Grau. Am Ende jeder Stuhlreihe stand auf dem melierten Teppichboden eine Plastikpflanze in einer griechischen Plastikvase. Seitlich befanden sich einige Türen mit der Aufschrift »Privat«, und an einer Tür, die wahrscheinlich auf den Parkplatz hinausführte, stand »Strengstens privat«. Man schien hier eine besondere Vorliebe für das Strenge zu haben.
Offensichtlich musste man sich beim Eintreten aus einer Art Ticketspender ein Kärtchen mit Nummer ziehen. Wenn diese Nummer an einem der Schalter in rotem Neonlicht aufleuchtete, ging man hin und bestätigte mit seiner Unterschrift, dass man immer noch arbeitslos war. Es war ein bisschen wie beim Arzt. Unschlüssig blieb Wexford zwischen dem Schalter »Jobsuchende« (wieder so ein neuer zusammengesetzter Ausdruck) und den nummerierten Schreibtischen stehen. An jedem stand oder saß jemand und diskutierte seine oder ihre Probleme mit einem Mitarbeiter. Das grau-blaue Schildchen, das die ihm am nächsten sitzende Person an der Bluse trug, kennzeichnete sie als Mrs. I. Pamber, Verw.angestellte.
Der übernächste Platz war gerade frei geworden. Wexford ging auf Mrs. W. Stowlap, Verw.angestellte, zu und fragte höflich, ob er ihren Vorgesetzten sprechen könne. Sie sah hoch und erwiderte mürrisch: »Sie müssen warten, bis Sie an der Reihe sind. Wissen Sie denn nicht, dass man sich eine Karte ziehen muss?«
»Eine andere Karte als die hier habe ich nicht.« Sie hatte ihn gereizt. Er holte seinen Dienstausweis hervor und sagte barsch: »Polizei.«
Der dünnen, sommersprossigen Frau mit den hellen Augenbrauen stand es gar nicht gut zu Gesicht, dass sie jetzt rot anlief. Die rosafarbene Flut ergoss sich bis an die Wurzeln ihres blassroten Schopfes.
»Entschuldigung«, sagte sie. »Sie wollen bestimmt den Direktor sprechen – das ist Mr. Leyton.«
Während sie ihn suchen ging, überlegte Wexford, was wohl der Grund sei für diese steifen Umgangsformen, all das Getue mit »Mrs.« und »Mr.«, die Verwendung von Initialen statt Vornamen. Das schien eigentlich gar nicht zum heutigen Stil zu passen. Nicht, dass es ihn gestört hätte; er musste an Ben und Robin denken, die alle Leute mit Vornamen anredeten, selbst Dr. Crocker, der fast sechzig Jahre älter war als sie.
Diskret, ohne zu starren, betrachtete er die Wartenden. Ziemlich viele Frauen, mindestens die Hälfte. Bevor Mike Burden von seiner Frau deswegen heruntergeputzt und als Sexist, Chauvinist und vorsintflutlich beschimpft worden war, hatte der Detective Inspector immer behauptet, wenn diese verheirateten Frauen nicht alle arbeiten gingen, wäre die Arbeitslosenquote bloß halb so hoch. Ein Schwarzer, jemand aus Südostasien, ein paar Inder – Kingsmarkham wurde jeden Tag kosmopolitischer. Dann bemerkte er in der hintersten Reihe die dicke junge Frau aus dem Wartezimmer im Gesundheitszentrum. Sie trug Leggings mit rotgrünem Blumenmuster und ein enges weißes T-Shirt, lümmelte breitbeinig auf dem Stuhl und stierte auf das Plakat, auf dem unter der Zeichnung eines farbenfrohen Fesselballons für den »Jobplan-Workshop« geworben wurde, der Interessenten bei »Ihrer Jobsuche Auftrieb geben« würde.
Sie starrte vor sich hin, dachte Wexford, ohne wirklich etwas zu sehen. Sie wirkte apathisch, als hätte ihr jemand mit dem Hammer auf den Kopf gehauen, stupide, nicht einmal mehr zornig, nur noch verzweifelt. Kelly, das kleine Mädchen, das auf den Stühlen herumgeturnt war und Zeitschriften zerrissen hatte, war heute nicht dabei. Wahrscheinlich hatte sie sie bei einer Mutter oder Nachbarin gelassen, so hoffte er wenigstens, und nicht in einer dieser Kindertagesstätten, wo sie die Babys in Sportwägelchen festschnallten und vor Horrorvideos setzten. Immer noch besser, als sie allein zu lassen. Neben ihr, genauer gesagt, zwei unbesetzte Stühle weiter, bot ein gepflegtes hübsches Mädchen einen grausamen Kontrast. Alles an ihr deutete auf Mittelschicht hin, von dem langen strohblonden Haar, das vor Sauberkeit glänzte und so gerade geschnitten wie ein Vorhangsaum war, der weißen Bluse und dem blauen Jeansrock bis hin zu den braunen Halbschuhen. Eine zweite Melanie Akande, dachte sich Wexford, eine frischgebackene Hochschulabsolventin, die inzwischen gemerkt hatte, dass ein akademischer Grad einem nicht automatisch zu einem Job verhilft …
»Was kann ich für Sie tun?«
Wexford drehte sich um. Der Mann war um die Vierzig, rotgesichtig, schwarzhaarig, mit groben Zügen; wahrscheinlich litt er an hohem Blutdruck. An seinem grauen Tweedjackett war das Schildchen mit Namen und Stellung befestigt: Mr. C. Leyton, Direktor. Er hatte eine harsche, schneidende Stimme und einen nordenglischen Akzent.
»Sollen wir irgendwohin gehen, wo wir unter uns sind?«
Leyton stellte die Frage so, als erwartete er ein »Nein« oder ein »Ach nein, bemühen Sie sich nicht«.
»Ja«, sagte Wexford.
»Worum geht es eigentlich?« fragte der andere über die Schulter hinweg, während er Wexford am Schalter und den Beraterpulten vorbeiführte.
»Das kann warten, bis wir ›unter uns‹ sind.«
Leyton zuckte die Achseln. Der bullige, kahlköpfige Mann, der vor der Zimmertür stand, trat zur Seite, als sie sich näherten. In der Leistungsabteilung des Arbeitsamts war die Anwesenheit eines Sicherheitsbeamten nötiger als in den meisten Banken, und auch die Polizeistreife gab sich hier regelmäßig ein Stelldichein. Verzweiflung, Verfolgungswahn und Empörung, Auflehnung, Angst und Demütigung führen zu Gewalt, und die meisten Leute, die hierher kamen, waren entweder verärgert oder hatten Angst.
Mit einiger Verspätung stellte sich der Direktor vor: »Cyril Leyton.« Er machte die Tür hinter ihnen zu. »Was ist passiert?«
»Ich hoffe, gar nichts. Ich möchte von Ihnen wissen, ob eine gewisse … äh, Antragstellerin am Dienstag zur Beratung hier war. Am Dienstag, dem sechsten Juli, um halb drei.«
Leyton kräuselte die Lippen und zog die Brauen nach oben. Er sah aus wie der Chef des staatlichen Geheimdienstes, den ein Untergebener, etwa eine Putzfrau oder ein Fahrer, soeben um Zugang zu höchst geheimen Papieren gebeten hatte.
»Ich brauche keinen schriftlichen Beleg«, sagte Wexford ungeduldig. »Ich will lediglich wissen, ob sie hier war. Außerdem hätte ich gern den betreffenden Berater gesprochen.«
»Nun, ich …«
»Mr. Leyton, dies ist eine polizeiliche Untersuchung. Ihnen ist ja wohl klar, dass ich innerhalb von ein paar Stunden mit einem Durchsuchungsbefehl vor der Tür stehen kann. Was soll also die Verzögerungstaktik?«
»Wie heißt sie?«
»Melanie Akande. A.K.A.N.D.E.«
»Wenn sie am Dienstag hier war«, sagte Leyton verdrießlich, »müsste das jetzt im Computer sein. Warten Sie mal, ja?«
Sein Benehmen war ungehörig, kühl, indigniert, abweisend. Wexford vermutete, dass er sich besonders daran delektierte, anderen Leuten Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Was für einen Eindruck der wohl auf dieAntragsteller machte? Vielleicht bekam er sie nie zu Gesicht, vielleicht war er dafür (wie Laurette Akande es ausgedrückt hatte) zu »hoch oben«.
Der Raum war ganz in Grau, und an den Wänden standen Aktenschränke. Es gab einen grauen Stuhl von der Art, auf denen draußen die Antragsteller saßen, dazu ein graues Metalltischchen, auf dem ein graues Telefon stand. Dagegen bot der Blick aus dem Fenster dem Auge einen wahren Farbenrausch, obwohl nur das Abholfenster an der Rückseite von Marks & Spencer zu sehen war. Cyril Leyton kehrte mit