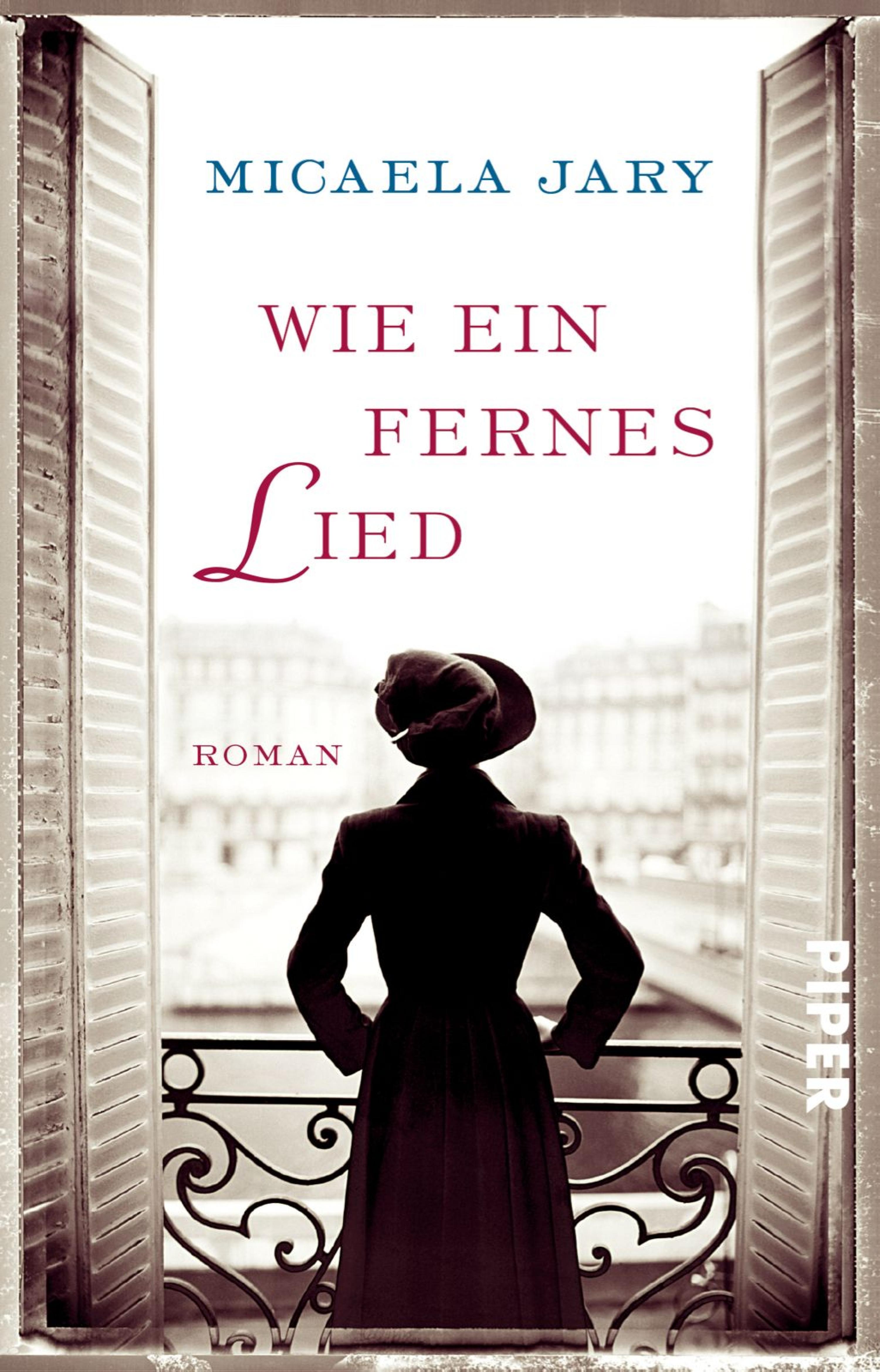9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Kino-Saga
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Band 1 der großen Kino-Saga aus der deutschen Nachkriegszeit.
November 1946: Die Film-Cutterin Lili Paal kehrt aus Berlin in ihre Heimatstadt Hamburg zurück. In der im Krieg zerbombten Innenstadt besitzt ihre Mutter ein ehemals glamouröses, nun wenig erfolgreiches Kino, das Lilis Halbschwester Hilde und deren Mann unbedingt schließen möchten. Lili will keinesfalls aufgeben, wurde im elterlichen Lichtspielhaus doch ihre Leidenschaft für den Film geweckt. Gleichzeitig sucht sie nach den Negativen eines im Krieg verschollenen Streifens, den sie restaurieren möchte. Dabei lernt Lili sowohl den smarten britischen Offizier John Fontaine als auch den charismatischen Regisseur Leon Caspari kennen. Bringt der gesuchte Film Licht in einen mysteriösen Todesfall, der Lili mehr betrifft, als sie ahnt?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 474
Ähnliche
Buch
November 1946: Die Film-Cutterin Lili Paal kehrt aus Berlin in ihre Heimatstadt Hamburg zurück. In der im Krieg zerbombten Innenstadt besitzt ihre Mutter ein ehemals glamouröses, nun wenig erfolgreiches Kino, das Lilis Halbschwester Hilde und deren Mann unbedingt schließen möchten. Lili will keinesfalls aufgeben, wurde im elterlichen Lichtspielhaus doch ihre Leidenschaft für den Film geweckt. Gleichzeitig sucht sie nach den Negativen eines im Krieg verschollenen Streifens, den sie restaurieren möchte. Dabei lernt Lili sowohl den smarten britischen Offizier John Fontaine als auch den charismatischen Regisseur Leon Caspari kennen. Bringt der gesuchte Film Licht in einen mysteriösen Todesfall, der Lili mehr betrifft, als sie ahnt?
Weitere Informationen zu Micaela Jary sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin finden Sie am Ende des Buches.
Micaela Jary
Das Kino am
Jungfernstieg
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Originalausgabe August 2019
Copyright © 2019 by Wilhelm GoldmannVerlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung:
UNO Werbeagentur München
Coverfoto: © Ildiko Neer/arcangel images,
FinePic®München, Julian Elliott Photography/gettyimages,
Vintage Germany/Katrin Schröder
Redaktion: Marion Voigt
BH • Herstellung: kw
Satz: KompetenzCenter; Mönchengladbach
ISBN: 978-3-641-22940-5V003
www.goldmann-verlag.de
Ein Film –
was kann das schon sein,
wenn es die Zensur erlaubt hat?
Kurt Tucholsky
Hamburg
Februar 1929
Prolog
Alles um sie herum funkelte und glitzerte wie in einem Palast. Lili meinte, nie einen schöneren Raum gesehen zu haben als diesen Saal. Kein Wunder, dass ihr Vater mit stolzgeschwellter Brust herumlief. Wüsste sie es nicht besser, würde sie annehmen, er habe die Wandbespannungen aus schwerem rot-goldenem Brokat persönlich angebracht und die Kristalle an den schweren Lüstern und Appliken eigenhändig auf Hochglanz poliert, ebenso wie die im Licht schimmernde warme Mahagonieinfassung der Bestuhlung. Natürlich war er begeistert von seinem Filmtheater. Lili konnte sich nicht erinnern, ihn jemals so glücklich erlebt zu haben. Und gleichzeitig irgendwie majestätisch. Ihr Vater wirkte an diesem Nachmittag, an dem er seiner Frau und den Töchtern den Neubau im Erdgeschoss des Kontorhauses am Jungfernstieg zeigte, tatsächlich wie ein König in seinem Schloss.
Robert Wartenberg machte eine einladende Geste. »Bitte, nehmt Platz, meine Lieben. Ich habe eine Privatvorstellung für euch arrangiert. Ihr bekommt einen ganz neuen Film zu sehen, der gerade in Berlin Premiere gefeiert hat.«
»Wundervoll«, rief Lilis Mutter aus.
»Hoffentlich ist der Film auch jugendfrei«, zischte Hilde.
»Also, bitte!«, ermahnte Sophie Wartenberg ihre ältere Tochter.
»Ich meine ja nur, dass es für mich wohl besser wäre, wenn es sich nicht um einen Kinderfilm handeln würde«, rechtfertigte sich Hilde. »Wenn sich die Kleine amüsiert, langweile ich mich zu Tode, und wenn ich mich gut unterhalte, wird sie quengeln.« Hinter dem Rücken der Eltern zog sie Lili kurz und heftig an einem der blonden Zöpfe.
Lili biss die Zähne zusammen. Sie war es gewohnt, von Hilde schlecht behandelt zu werden. Die Zwanzigjährige stammte aus der ersten Ehe ihrer Mutter, ihr leiblicher Vater war im Großen Krieg gefallen, und manchmal meinte Lili zu verstehen, dass die Ältere ihr deswegen gram war. Hildes Vater war tot, Lilis Mama hatte einen neuen Mann gefunden, und Lilis Papa lebte. Einen anderen Grund für die deutliche Missgunst konnte es nicht geben. Die Ältere ärgerte ihre kleine Halbschwester, seit Lili denken konnte, und selbst Sophies gelegentliche Standpauken blieben wirkungslos. Mutti meinte, die Distanz zwischen ihren Töchtern sei eine Folge des Altersunterschieds von elf Jahren, doch Lili wollte sich mit dieser Erklärung nicht abfinden. Neulich hatte sie die Erwachsenen davon reden hören, dass Hilde mit einem jungen Mann ausging, der eine vielversprechende Karriere im Hotelgewerbe vor sich hatte. Hoffentlich heiratete der Verehrer sie schnell, damit Hilde aus dem Haus kam – und Lili endlich ihre Ruhe und die Eltern ganz für sich hatte. Allerdings musste das ein ziemlich dummer Mensch sein, wenn er sich in eine wie Hilde verguckte. Sie sah zwar hübsch aus, aber im Kopf hatte sie nichts als Stroh, fand Lili.
»Euer Vater hat sicher das Richtige ausgewählt«, sagte Sophie kühl.
Robert Wartenberg ignorierte die kleine Auseinandersetzung zwischen Mutter und Tochter. »Ihr werdet gleich erleben, wie gut die moderne Technik funktioniert«, erklärte der stolze Kinobesitzer. »Ich küsse Ihre Hand, Madame – so der Titel – ist der erste deutsche Spielfilm mit einer Tonsequenz. Auch wenn es viele Kritiker gibt, der Tonfilm ist im Kommen, sage ich euch. Dafür lohnte es sich, ein bisschen mehr Geld für die Ausstattung auszugeben.«
Glücklicherweise sorgte Sophie dafür, dass Hilde zuerst in eine der Reihen in der Mitte des Kinosaals trat und sich in der Mitte auf einen der mit rotem Samt bezogenen Sessel setzte. Die Mutter folgte ihr, dann der Vater, der verstohlen nach Lilis Hand griff und sie auf diese Weise liebevoll hinter sich herzog. Das Beste aber war an der Sitzordnung, dass Lili weit entfernt von Hilde Platz nehmen durfte.
Während es sich die Neunjährige bequem machte, wurde der Vorhang an der Stirnseite des Raums wie von Zauberhand aufgezogen. Das Licht erlosch, und im nächsten Moment erklang Musik, Streicher spielten eine Melodie, und es kam Lili vor, als würde das Orchester hinter ihr stehen. Sie wandte den Kopf, aber da erstreckte sich nur ein endloses Halbdunkel. Das war wohl die Technik, von der ihr Vater gesprochen hatte.
Plötzlich flimmerten Bilder über die Wand, die der Bühnenvorhang freigegeben hatte. Lili saß zum ersten Mal in einem Lichtspielhaus. Sie sei noch zu klein, um einen Film anzusehen, hatte ihre Mutter bisher behauptet. Doch das war nun anscheinend anders, da ihr Papa, der sonst eigentlich mit Tee handelte, ein eigenes Kino besaß. Und Lili starrte auf die Leinwand, registrierte den Wechsel der Szenen, die Stimmen, die aus denselben Lautsprechern hallten wie die Musik, nahm Geräusche wahr, die etwa von dem Auto zu stammen schienen, das gerade durchs Bild fuhr, und sich doch nicht richtig einordnen ließen. Meist bewegten die Schauspieler nur die Lippen, was Lili verwunderte, weil man den netten jungen Mann doch singen und Klavier spielen hörte. Aber als die schöne dunkelhaarige Frau mit den großen Augen, die ihm hinter einem Vorhang offenbar lauschte, etwas sagte, blieb die Tonanlage stumm. Wie machten die Leute vom Film das bloß?
Lilis Augen folgten den bewegten Bildern. Es war, als schüttete ein Zauberer leuchtende Sterne über ihr aus. Atemlos schaute sie auf ein Wunder und wünschte sich zu wissen, was dahintersteckte. Über dieser wichtigen Frage vergaß sie die Zeit, auch die Handlung glitt unbeachtet an ihr vorbei. Sie bemerkte kaum, wie ihre Mutter und Hilde hin und wieder lachten. Währenddessen zerbrach sie sich den Kopf darüber, wieso echt wirkende Menschen sich benahmen, als befänden sie sich mit ihr und ihrer Familie im Kinosaal, aber gleich darauf über eine Straße gingen, in einem Kaffeehaus saßen oder durch eine Wohnung spazierten. Irgendwann fiel ihr ein, dass das vermutlich so ähnlich war wie die Sache mit dem Fotografieren: Man war da und gleichzeitig nicht da. Wie Lili mit ihrer Schultüte in dem silbernen Rahmen auf Muttis Flügel. Ob es sich beim Film um eine Aneinanderreihung von Fotos handelte? So viele Bilder zusammenzukleben musste schwierig sein, aber es war bestimmt auch eine ziemlich aufregende Tätigkeit. Lili, die geschickte Hände besaß und gern bastelte, konnte sich das lebhaft vorstellen.
Enttäuscht las sie das Wörtchen »Ende« auf der Leinwand. War das Wunderwerk schon vorbei? Es hatte doch gerade erst angefangen. Im nächsten Moment gingen die Lichter im Kinosaal wieder an, und Sophie Wartenberg klatschte Beifall.
»Ein wunderbarer Film«, schwärmte sie. »Und diese Tonsequenz … hach!« Sie seufzte beseelt.
»Es ist fast, als würde Richard Tauber ›Ich küsse Ihre Hand, Madame‹ singen«, meinte Hilde, und Lili staunte, dass sogar die ewig besserwisserische Halbschwester endlich einmal beeindruckt zu sein schien.
Sophie nickte. »Ja, es ist wirklich ganz wunderbar.«
»Aber natürlich ist es der Schauspieler Harry Liedtke, der sich am Klavier selbst begleitet«, fügte Hilde gönnerhaft hinzu.
»Nein, meine Liebe«, widersprach der Vater schmunzelnd, »du hast Richard Tauber tatsächlich singen hören. Die Szene mit Harry Liedtke wurde mit Taubers Gesang unterlegt.«
»So etwas kann man machen?« Hilde schnappte nach Luft. »Ist das nicht Betrug?«
»Es ist Illusion. Das ist der Kintopp.«
»Oh!«
»Papa«, Lili zupfte an seinem Ärmel. »Papa …« Als er sich zu ihr umwandte, fragte sie: »Kann ich so etwas auch mal machen?«
»Was denn?«
»Einen Film. Ich meine …« Lili suchte nach dem Wort, das ihr Vater eben benutzt hatte: »Kintopp.«
Hilde lachte schallend. »Wie hätte es anders sein sollen? Die Prinzessin möchte ein Filmstar werden.« Ihr Ton sagte ganz deutlich, dass sie Lili keineswegs für etwas Besonderes hielt.
»Lass doch das Kind«, seufzte Sophie, während sie sich von ihrem Sitz erhob. »Ich schlage vor, wir gehen jetzt einen Kaffee trinken. Was meinst du, Robert?«
»Einverstanden. Ich habe bereits gegenüber im Alsterpavillon einen Tisch für uns reservieren lassen. Also, kommt, meine Lieben. Lasst uns unsere erste Vorstellung im eigenen Haus feiern.«
Robert drehte sich um und rief in den Hintergrund: »Danke, Hans, das haben Sie sehr gut gemacht.« An seine Familie gewandt erklärte er: »Hans Seifert ist hier der Vorführer. Er sorgt dafür, dass die Filmrollen in der richtigen Reihenfolge in den Projektor eingelegt und ordentlich abgespielt werden.«
»Danke schön, Herr Seifert.« Sophie winkte dem unsichtbaren guten Geist zu.
Während Lili von ihrem Sitz rutschte, fasste sie einen Entschluss. Sie wollte mehr erfahren über die Menschen, die in einem Kino arbeiteten. Und über Filme. Sie erinnerte sich an Hildes bissige Bemerkung und fand es an der Zeit, das dumme Gerede der Älteren richtigzustellen. Auch wenn sie sich einen Tadel einhandeln sollte, weil sie vorlaut war und die Erwachsenen womöglich aufhielt.
»Papa!« Sie zupfte noch einmal am Ärmel ihres Vaters. »Papa, ich will keine Schauspielerin werden. Ich will einen Film machen. Das ist etwas anderes, als in einem Film zu spielen, oder?«
Hilde stieß einen entnervten Seufzer aus.
»Liebes, einen Film zu machen ist kein Beruf für eine Frau«, wandte ihre Mutter ein.
Ihr Vater beugte sich zu ihr herunter und strich ihr über den Blondschopf. »Es gibt Regisseure, Kameramänner und Drehbuchautoren, das sind sehr wichtige Leute bei einer Produktion, aber für ein hübsches junges Mädchen ist da kein Platz.«
Lili sah ihn erstaunt an. »Wieso? Gibt es denn keine Frauen, die beim Film arbeiten?«
»Doch. Natürlich. Aber außer den Schauspielerinnen sind es nicht so viele.«
Angesichts des schönen Traums, der gerade wie eine Seifenblase zu platzen drohte, füllten sich Lilis kornblumenblaue Augen mit Tränen. »Gibt es da wirklich gar keine Frauen?«
»Du könntest Kostüme schneidern«, schlug Hilde vor, die genau wusste, dass Lilis Bastelarbeiten zwar ausgesprochen schön waren, die Jüngere aber nicht gut mit Nadel und Faden umgehen konnte.
Die erste Träne kullerte über Lilis Wange.
Zärtlich wischte Robert sie fort.
»Es gibt Cutterinnen«, erklärte er geduldig. »Weißt du, Lili, ein Film wird mit einer Kamera gedreht, und das Ganze heißt so, weil die Szenen auf einem Negativ aufgenommen werden. Ein Kameramann arbeitet letztlich wie ein Fotograf. Nur dass es sich nicht um ein Standbild, sondern um ein bewegtes Bild handelt. Die Schnittmeisterinnen, wie man die Cutterinnen auch nennt, kleben die Szenen zusammen, und daraus wird dann am Ende der Spielfilm, der in die Kinos kommt.«
Mit offenem Mund starrte Lili ihren Vater an. Die Tränen versiegten. Genau so hatte sie es sich doch gedacht. Sie strahlte. »Das möchte ich werden, Schnittmeisterin oder wie das heißt. Darf ich, Papa?«
Er wechselte einen amüsierten Blick mit ihrer Mutter, und beide schmunzelten.
»Darüber reden wir, wenn du groß bist. Jetzt gehen wir erst einmal rüber in den Alsterpavillon. Möchtest du eine Limonade oder lieber eine heiße Schokolade, Lili?«
»Meine Güte«, raunte Hilde, »wie kommt sie nur darauf, arbeiten gehen zu wollen? Aber wahrscheinlich weiß dieses Gör schon heute, dass es niemals einen Mann finden wird.«
Lili sah sich nach ihren Eltern um, doch die steckten die Köpfe zusammen und hatten Hildes Kommentar anscheinend nicht gehört. Sie reckte ihr Kinn. So leicht ließ sie sich ihren neuen Traum nicht ausreden. Auf einen Ehemann konnte sie gut verzichten. Ihr graute davor, einen Frosch küssen zu müssen, damit er sich in einen liebevollen Prinzen verwandelte. Ein Beruf, in dem sie basteln durfte, erschien ihr dagegen einfach wunderbar. Lili beschloss, so viel Zeit wie möglich im Kino zu verbringen und immer wieder Fragen zu stellen. Am besten, wenn Hilde nicht in der Nähe war. Und eines Tages wusste sie bestimmt genug, um Schnittmeisterin zu werden. Und sie musste niemals einen Frosch küssen.
Berlin
November 1946
1
»Ich muss nach Hamburg. Verstehen Sie?« Sie holte tief Luft und stieß dann ebenso eindringlich wie ungeduldig hervor: »Ich. Muss. Nach. Hamburg. Sofort.«
Der junge Mann in der khakibraunen Uniform des British Empire blickte Lili durch die Gläser seiner Hornbrille an. Er betrachtete sie weder wohlwollend noch direkt unfreundlich, sondern ließ ihr vielmehr ganz offenbar Gnade zuteilwerden, weil er sie anhörte. Ebenso deutlich brachte er jedoch zum Ausdruck, dass sie seine Geduld strapazierte und ihre Probleme ihn kaltließen.
Vielleicht lag es an ihrer Erscheinung, sinnierte sie. Obwohl sie als junges Mädchen durchaus hübsch gewesen war, hatten sich im Lauf der Jahre die Erfahrungen von Krieg, Leid und Not ebenso in ihr Gesicht gegraben, wie es unter glücklicheren Umständen Lachfältchen getan hätten. Hinzu kam, dass die Attribute, die angeborene Schönheit für gewöhnlich unterstrichen, für sie unerschwinglich geworden waren: Ein Friseurbesuch kam nicht infrage, ihr schulterlanges honigblondes Haar schnitt sie sich selbst mit einer stumpfen Küchenschere, der Kauf eines Lippenstifts, um ihren breiten ausdrucksvollen Mund zu betonen, war ebenso unmöglich wie der Erwerb von Wimperntusche, mit der sie ihre blauen Augen einrahmen könnte, von modischer Garderobe ganz zu schweigen. Sie trug eine notdürftig ausgebesserte, viel zu weite dunkelblaue Hose und einen alten Tennispullover über einer doppelten Schicht Unterhemden gegen die in diesem Herbst früh einsetzende frostige Kälte. Darunter war sie so dünn, dass ihr Körper eine weibliche Figur nur noch erahnen ließ. Vermutlich wirkte sie auf den perfekt Deutsch sprechenden Engländer mit ihrer hochgewachsenen jungenhaften Gestalt wie ein Mannweib – ein Typus, der dem verhassten Bild der BDM-Scharführerin entsprach. Aber im Grunde waren ihr Äußerlichkeiten gleichgültig, es zählten andere Werte in diesen Zeiten. Nur in diesem Moment wünschte sie plötzlich, sie wäre zumindest schicker gekleidet, um ihren Gesamteindruck etwas zu verbessern.
Er schwieg eine Weile, dann verlangte er: »Bitte sprechen Sie nicht mit mir, als wäre ich schwachsinnig.«
Zu ihrem eigenen Entsetzen wurde ihr bewusst, dass sie sich eben genau des Tons einer Nazisse bedient hatte. Das war ihrer Aufregung und Sorge geschuldet, aber ganz sicher nicht ihrer Überzeugung. Doch der britische Offizier wusste nicht, dass sie Hitler und sein Regime ebenso hasste wie jedes Mitglied der alliierten Besatzungstruppen. Abgesehen von der Angst, die sie seit sieben Jahren durchlitt, hatte der Krieg ihr gleich zu Anfang die erste große Liebe und am Ende den Vater genommen. Und nun lag Lilis Mutter anscheinend im Sterben. Hildes Brief war so alarmierend gewesen, dass Lili sofort nach Hamburg fahren musste. Doch sie besaß keinen Interzonenpass, der sie gefahrlos über die Sektoren- und Zonengrenzen aus Berlin in die Hansestadt bringen würde. Seit die Russen im Sommer eine Durchreise durch die sowjetische Zone untersagt hatten, war es unmöglich, die alte Reichshauptstadt ohne Sondergenehmigung auf legalem Weg zu verlassen.
Lili war kurz vor Kriegsbeginn nach Berlin gekommen. Das Ziel, das sie schon als kleines Mädchen vor Augen gehabt hatte, zog sie nach der Mittleren Reife und der Ausbildung zur Fotografin hierher. Da in Hamburg keine Produktionsstätten existierten, versuchte sie ihr Glück im Zentrum der deutschsprachigen Filmwirtschaft. Ihre Mutter sah es nicht gern, dass Lili allein in der riesigen Stadt leben und auch noch arbeiten wollte, ihr Vater unterstützte jedoch ihre Pläne. Robert Wartenberg und der junge Mann, den Lili aus dem Kreis ihrer swingmusikbegeisterten Freunde kannte, waren die beiden Menschen, für die sie regelmäßig zurück an die Alster fuhr. Nach dem Polenfeldzug, in dem ihr Verlobter fiel, wurden ihre Besuche seltener, auch weil sie wusste, dass sie für ihre Mutter eine Enttäuschung darstellte. Und während Sophie die glanzvollen gesellschaftlichen Ereignisse besuchte, die ihre ältere Tochter Hilde als Ehefrau des neuen Direktors des Hotels Esplanade veranstaltete, und sich darüber grämte, ihre Jüngste nicht ebenfalls so gut verheiratet zu wissen, stieg Lili von einer kleinen Schnittassistentin zur Schnittmeisterin auf, die schließlich selbstständig einen Film zusammenkleben durfte, wie sie es sich damals im Kino ihrer Eltern am Jungfernstieg erträumt hatte.
»Entschuldigen Sie, bitte«, sagte sie endlich. Sie zwang sich zur Ruhe. Mit Hektik würde sie den Engländer sicher nicht dazu bringen, ihr zu helfen. »Meine Mutter ist schwer krank«, hob sie mit gesenkter Stimme an. »Deshalb muss ich unbedingt sofort nach Hamburg.«
Er nickte, und ihr fiel auf, dass der Braunton seiner Brillenfassung mit der Farbe seiner Locken korrespondierte. Eine Strähne fiel ihm bei der Bewegung in die Stirn, die er geistesabwesend zurückstrich. »Ich kann Ihre Sorge verstehen«, erwiderte er schließlich. »Aber warum kommen Sie zu mir? Ich bin nicht dafür zuständig, Ihnen einen Interzonenpass auszustellen.« Er machte eine Geste, als wollte er sein Dienstzimmer umarmen. »Das hier ist die Filmabteilung.«
»Ja. Ich weiß. Ich dachte nur, Sie könnten die Angelegenheit beschleunigen, weil wir doch …«, sie stockte, dann fügte sie mutig hinzu: »… irgendwie Kollegen sind.«
»Tatsächlich?« Offenbar war er überrascht. Er nahm seine Brille ab, betrachtete sie nachdenklich, schob sie zurück auf seine schmale gerade Nase.
Wie schaffte es dieser Mann nur, sie ständig in Verlegenheit zu bringen? Nach dem ersten Fauxpas fand Lili nun, dass sie ein wenig größenwahnsinnig klang. Sie hatte nicht die geringste Ahnung, welche Voraussetzungen dieser britische Offizier aus Friedenszeiten mitbrachte, um einen Posten in der Filmabteilung zu bekleiden. Er war zwar sicher noch keine dreißig Jahre alt, aber das bedeutete natürlich nicht, dass er ein unbeschriebenes Blatt war. Vielmehr konnte er vom Filmstar bis zum Erfolgsregisseur so ziemlich alle Positionen vor und hinter der Kamera bekleidet haben. Für den Schnitt eines Spielfilms war er allerdings bestimmt nicht verantwortlich gewesen, diesen Beruf wählten ausschließlich Frauen. Also waren sie höchstens irgendwie, aber eigentlich keine Kollegen.
Andererseits hatte sie ihn aufgesucht, weil sich seit Einführung der neuen Bestimmungen die Wartezeit auf einen Interzonenpass ständig verlängerte. Der Andrang war enorm. Die Schlangen vor den Ausgabestellen waren inzwischen fast so lang wie die vor den Lebensmittelgeschäften, wenn es angeblich neue Waren gab. In den seltensten Fällen bekamen die Kunden gleich das Gewünschte, auf dem Amt ebenso wenig wie etwa in der Bäckerei. Da Lili jedoch so schnell wie möglich nach Hamburg reisen wollte, musste sie den üblichen Behördenweg umgehen. Deshalb hatte sie die Abteilung im britischen Hauptquartier am Fehrbelliner Platz aufgesucht, von der sie annahm, sie würde hier auf die verständnisvollsten und entgegenkommendsten Mitarbeiter treffen. Unter Filmleuten ließ sich doch bestimmt etwas regeln, hatte sie gedacht. Doch nun zweifelte sie …
»Sie waren also Mitarbeiterin des Propagandaministeriums«, unterbrach der Engländer ihre Gedanken. Eine neue Facette seines Tonfalls erreichte sie: Nach Gnade, Borniertheit und einem sachten Anflug von Freundlichkeit lag nun Härte in seiner Stimme.
»Nein, um Himmels willen, nein. Ich war niemals Mitarbeiterin des Propagandaministeriums.« Lili rang die Hände, ihre Knie wurden vor Aufregung weich. Sie wünschte, sie könnte sich setzen. Doch da er sie nicht aufgefordert hatte, Platz zu nehmen, war sie stehen geblieben, während er von seinem Schreibtischstuhl zu ihr aufsah.
»Ich habe nicht für das Propagandaministerium gearbeitet«, wiederholte sie. »Jedenfalls nicht direkt. Ich meine, ich war bei der Ufa und bei der Terra, und die Produktionsgesellschaften waren verstaatlicht, aber ich war Schnittmeisterin, keine …« Sie biss sich gerade noch rechtzeitig auf die Zunge, um nicht »Schreibtischtäterin« zu sagen. Das wäre definitiv die falsche Wortwahl, nachdem sie den Engländer als Kollegen bezeichnet hatte.
Ein Schmunzeln erhellte seine Züge. »Sie sind also Schneiderin«, resümierte er und fügte ein albernes: »Fräulein Kollegin« hinzu.
Jetzt machte er sich lustig über sie!
»Ich schneide Filme«, parierte sie. »Ich bin Cutterin. Auf Deutsch nennt man das Schnittmeisterin.«
»Oha, eine Cutterin.« Überraschenderweise wurde sein Lächeln breiter. »Da lag ich wohl falsch. Wie heißen Sie?«
»Lili Wartenberg …« Sie unterbrach sich, um nach einem Räuspern fortzufahren: »Das ist mein Mädchenname. Meine Papiere lauten auf Lili Paal.« Ihre Kriegstrauung war zu unwirklich gewesen. Obwohl über drei Jahre her, hatte sie sich bis heute weder an ihren Status als verheiratete Frau noch an den Namen ihres Mannes gewöhnen können. Sie hatte Albert Paal kaum gekannt und seit ihrer überstürzten Hochzeit nicht wiedergesehen.
»Sie sind das?«
»Ja«, erwiderte sie schlicht. Was sollte sie auch sonst sagen? Dass der Engländer von ihr gehört hatte, war nicht verwunderlich, nachdem sie im Frühjahr für einigen Wirbel in den nach dem Krieg verbliebenen Resten der Berliner Filmbranche gesorgt hatte. Es war höchstens erstaunlich, dass er sich so gut auskannte, immerhin war er ein subalterner Offizier und nicht der Leiter der Abteilung.
Er deutete auf den Besucherstuhl auf der anderen Seite seines Schreibtischs. »Setzen Sie sich, Frau Paal.«
»Danke«, murmelte sie. Zögernd nahm sie Platz. Sie wünschte, er würde keine so ernste Miene aufsetzen und sie damit weiter verunsichern.
Stumm sahen sie sich über den Tisch hinweg an. Es fiel Lili schwer, durch die Brillengläser den Ausdruck seiner Augen zu erkennen. Und es war nicht einfach für sie, sich in Geduld zu fassen. Sie hielt den Atem an, um nicht zuerst das Wort zu ergreifen, aus Furcht, wieder das Falsche zu sagen.
»Warum sind Sie hier?«, wiederholte er. Er war zweifellos neugierig, doch sein Ton hatte auch wieder an Härte gewonnen. »Bei Ihren Beziehungen zu den Sowjets frage ich mich, warum Sie bei der Überquerung der Zonengrenze die Hilfe der Briten benötigen.«
Sie ahnte, worauf er hinauswollte, doch sie rettete sich in den Behördenalltag. »Ich wohne im britischen Sektor.«
»Ach, tatsächlich? Wenn ich richtig informiert bin, arbeiten oder arbeiteten Sie bei den Russen.«
»Ich habe für die DEFA gearbeitet, die mit sowjetischer Genehmigung gegründete Deutsche Film AG. Das ist richtig. Warum machen Sie mir das zum Vorwurf?« Sie wusste, sie redete sich in Rage, und es war vielleicht ein Fehler, aber sie konnte nicht anders. »Ich liebe meinen Beruf. Der Film ist mein Leben. Es gibt doch keine andere Möglichkeit, in Berlin für das Kino zu arbeiten, als für die in der sowjetischen Zone ansässige Produktionsgesellschaft. Die Russen haben schließlich die Ateliers in Babelsberg und Johannisthal besetzt.«
»Erzählen Sie mir bitte nichts, was ich schon weiß«, schnappte der Engländer. »Korrigieren Sie mich, wenn ich falschliege, aber Ihre Tätigkeit für die DEFA betrifft keine neuen Filmproduktionen, sondern die Bearbeitung eines alten Negativs. Sie haben einen Film geschnitten, der noch im Krieg gedreht, aber nicht mehr fertiggestellt werden konnte. Und Sie haben den Streifen nicht nur vollendet, sondern zuvor überhaupt erst aufgestöbert. Richtig?«
Warum fühlte sich das alles plötzlich so falsch an? Der Mann in der khakifarbenen Uniform schaffte es, sie ins Unrecht zu setzen, obwohl sie sich keiner Schuld bewusst gewesen war. Zumindest anfangs nicht.
Durch Zufall hatte sie an einem ihrer letzten Arbeitstage vor Kriegsende erfahren, wo einige der Negative der noch bis zur letzten Szene abgedrehten Filme eingelagert werden sollten. Sie hatte nicht weiter darüber nachgedacht, zumal die Ereignisse sie überrollten. Erst als sich im vorigen Winter herumsprach, dass die Sowjets nicht mehr nur ihre eigenen Streifen in einer deutschen Synchronfassung in die wiedereröffneten Kinos bringen, sondern auch die Genehmigung für eine erste deutsche Nachkriegsproduktion erteilen wollten sowie die Gründung einer Filmgesellschaft vorsahen, fragte sich Lili, was wohl aus den im Bombenhagel vergrabenen Zelluloidstreifen geworden war. Also machte sie sich auf die Suche – und wurde zu ihrer eigenen Überraschung fündig. Es war der letzte Film, den sie hätte schneiden sollen. Da sie keine Ahnung hatte, wer sich sonst dafür interessieren könnte, brachte sie die verwitterten Metalldosen in das alte Ufa-Haus am Krausenplatz, das sich jetzt in der sowjetischen Zone befand und in dem inzwischen die Verantwortlichen der jüngst gegründeten DEFA saßen.
»Es war mein Film«, rechtfertigte sie sich. »Ich kannte das Drehbuch und konnte die Szenen daher problemlos schneiden. Hätte ich ihn verrotten lassen sollen? Es ist eine so wundervolle Produktion, die …«
»Wo haben Sie die Materialien gefunden?«, unterbrach er sie.
Sie wusste leider, worauf er hinauswollte. »Die Dosen waren neben der Sonnenuhr im Hindenburgpark vergraben … ehm … im Volkspark Wilmersdorf, wie er jetzt heißt …«
»Dieser Platz liegt im britischen Sektor«, fiel er ihr ins Wort. Er beugte sich ein wenig vor, schob seine Brille zurecht und sah sie scharf an. »Wissen Sie, Frau Paal, durch die Übergabe der Negative an die Sowjets haben Sie dafür gesorgt, dass ein Beschluss des Alliierten Kontrollrats umgangen wird. Dieser besagt, dass sämtliche Filme als Beutegut der Militärregierung der jeweiligen Zone zustehen, wo die Materialien aufgefunden werden. Sie haben ganz klar das Gesetz gebrochen.«
Stumm senkte sie den Kopf.
»Nun könnte ich Sie verhaften lassen.«
Warum war sie nur an diesen Streber geraten? Er war nicht so attraktiv, wie sie anfangs angenommen hatte, er sah aus, wie sich ein Filmregisseur wahrscheinlich einen ehrgeizigen Studenten in Oxford oder Cambridge in britischer Uniform vorstellte. Ein Karrierist, dem sie sich unbeabsichtigt ausgeliefert hatte. Er kam ihr vor wie ein offenes Buch, denn die nächste Bemerkung hatte sie bereits erwartet:
»Ich habe gehört, dass Sie über mehr Filme Bescheid wissen, die angeblich verloren gegangen sind.«
»Sie sind gut informiert«, murmelte Lili überflüssigerweise. Natürlich war er das, sonst hätte er nicht gewusst, wo sie die ersten Materialien gefunden hatte. Aber letztlich sprachen sich derartig spektakuläre Neuigkeiten rasch herum. Ihre Branche war klein und bevölkert mit Selbstdarstellern, die gern den neuesten Klatsch teilten. Darüber hinaus gehörte nicht viel Fantasie dazu, sich zu überlegen, dass eine Frau, die das Versteck eines Negativs kannte, auch andere aufzufinden in der Lage war.
»Die anderen Materialien haben Sie aber noch nicht bei den Sowjets abgeliefert?«, insistierte er.
Sie schüttelte den Kopf.
»Wir Briten und unsere Freunde, die Amerikaner, sind mehr als die Russen daran interessiert, unsere eigenen Produktionen in die deutschen Kinos zu bringen. Aber wir verstehen, dass die Deutschen auch deutsche Spielfilme sehen wollen. Manche waren ja wohl nicht einmal schlecht. Wie auch immer, es ist ein großes Geschäft damit zu machen, und das können wir natürlich nicht der Seite überlassen, die sich im Kontrollrat gegen fast jeden unserer wirtschaftlich relevanten Vorschläge stemmt.«
Offenbar dozierte er auch noch gern. Für einen Collegeprofessor war er zu jung, aber vielleicht hatte er gerade sein Studium der Filmwissenschaft abgeschlossen, als er in den Krieg zog, und nun saß er hinter diesem Schreibtisch, anstatt endlich die Universitätslaufbahn anzutreten, von der er immer geträumt hatte. Das wäre ein gutes Drehbuch für einen Nachkriegsfilm, fuhr es Lili durch den Kopf. Der Absolvent, der nach vielen Jahren und schrecklichen Erfahrungen an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt und dort anknüpfen will, wo er aufgehört hat, und nun an der neuen Zeit scheitert …
»Sie wollen also auf dem schnellsten Wege nach Hamburg fahren.«
Aus ihren Gedanken gerissen zuckte Lili zusammen.
»Warum haben Sie nicht alle Negative bei den Russen abgeliefert?«
Sein plötzlicher Themenwechsel irritierte sie. Die Fragen prasselten in so rascher und unerwarteter Folge auf sie nieder, dass sie kaum wusste, was sie antworten sollte. Unwillkürlich erwartete sie, dass er wieder das Wort ergriff, doch nun schwieg er. Da er ihr anscheinend die Zeit lassen wollte, sich zu sammeln, holte sie tief Luft und versuchte einen Moment, auf ihren Atem zu lauschen. Mit einem Mal fielen ihr die Geräusche auf, die aus dem Nachbarbüro hereindrangen: Hektisches Tippen auf einer Schreibmaschine, das Schrillen eines Telefons, hinter der Tür erklangen die polternden Schritte von Armeestiefeln. Diese Normalität beruhigte sie.
Lili hob den Blick. »Ein Film pro Besatzungsmacht reicht, finden Sie nicht?«
Der Engländer stutzte, dann lächelte er. »Sie haben Humor. Das gefällt mir.« Er wurde wieder ernst. »Wenn ich Sie richtig verstehe, hat das Vereinigte Königreich jetzt Ihrer Ansicht nach zumindest einen Zugriff gut. Wir diskutieren mal lieber nicht, ob das rechtens ist. Vielmehr würde mich interessieren, was Ihnen die Reise nach Hamburg wert ist. Womöglich alle Materialien, von deren Versteck Sie wissen?«
Erpressung, dachte Lili, das ist reine Erpressung. Eigentlich konnte es ihr ja gleichgültig sein, welcher Staat sich die alten deutschen Produktionen einverleibte. Hauptsache, die jeweiligen Rohfilme wurden fachgerecht behandelt und kopiert und einem breiten Publikum zugänglich gemacht. Gute Filme sollten nicht in Vergessenheit geraten oder sich irgendwann unbeachtet selbst zerstören.
Jedenfalls deutete seine Überlegung an, dass er bereit war, ihr für die Informationen einen Passierschein zu beschaffen. Sie befand sich also auf dem richtigen Weg. »Gegen wie viele Ortsangaben würden Sie einen Interzonenpass herausgeben?« Ihre Stimme klang erstaunlich gefasst, obwohl ihr das Herz vor Aufregung bis zum Hals schlug.
»Sie sprachen von einem Film pro Besatzungsmacht. Demnach bleiben noch drei. Befinden sich Ihre Verstecke alle im Raum Berlin, oder ließen sich Materialien auch in der britischen Zone in Westdeutschland auffinden?«
Im ersten Moment war sie verwirrt, doch dann dachte sie, dass er entweder dieselben Gerüchte gehört hatte wie sie – oder es war ein Bluff. »Ich weiß natürlich nicht, ob alle Negative noch dort sind, wo sie versteckt wurden. Die meisten liegen ja schon rund eineinhalb Jahre da. Vielleicht hat sie auch jemand anderer gefunden und weggeworfen …«
»Das dürfte ein hübsches Feuerwerk gegeben haben. Zelluloid ist hochexplosiv, nicht wahr?«
»Nur, wenn es sich selbst entzündet oder angesteckt wird.«
»Hoffen wir, dass das nicht passiert ist.«
»Ja.«
»Also?«
»Was?«
»Wo in der britischen Zone liegen die Materialien?«
Sie seufzte. »In Lübeck-Travemünde. Ein paar Filmschaffende haben sich kurz vor Kriegsende zu Dreharbeiten, die niemals stattfanden, an die Ostsee geflüchtet, um nicht doch noch eingezogen zu werden. Angeblich hatten sie einige Rollen ungeschnittener Filme im Gepäck.«
»Die Welt der Buddenbrooks erscheint mir reichlich symbolträchtig als Versteck. Und die Ostsee soll ja einen ganz eigenen Zauber besitzen, waren Sie schon einmal dort?«
Für eine Plauderei über die Schönheit des Baltischen Meers hatte sie keine Geduld. Wahrscheinlich hatte sie den falschen Weg gewählt. Die Zeit, die sie mit diesem Engländer bei einer Unterhaltung verbrachte, als befänden sie sich zum Tee in einem Herrenhaus, hätte sie auch dazu nutzen können, sich in die Schlange an der Ausweisstelle einzureihen. Offenbar wollte er ihr nur Informationen entlocken, konnte ihr aber wohl tatsächlich nicht helfen. Es wäre sogar verständlich, dass ein Filmoffizier sich nicht in Passangelegenheiten mischen durfte. In ihrer blinden Sorge war sie so dumm gewesen.
Brüsk stand Lili auf. »Ich bin Hamburgerin, natürlich war ich schon einmal an der Ostsee. Das ist aber gerade nicht mein Ziel. Ich muss nach Hause, weil meine Mutter vielleicht im Sterben liegt, und nicht nach Travemünde, um Negative zu suchen. Bitte entschuldigen Sie, dass ich Sie mit meiner Sache belästigt habe.«
Ihr Monolog schien ihn zu verblüffen. Er starrte sie an, nahm die Brille ab, schaute, setzte sie wieder auf – und sagte nichts.
Enttäuscht und gleichzeitig verärgert über ihre eigene Dummheit wandte sie sich zum Gehen.
»Warten Sie!« Sein Stuhl knarrte, als er aufsprang. »Ich hatte wohl vergessen zu erwähnen, dass ich übermorgen nach Hamburg fahren muss und Sie mich begleiten können.«
Nun war es an ihr, vollkommen baff zu sein.
Er lächelte sie aufmunternd an. »Da sich in Hamburg eine neue Filmszene zu bilden beginnt, wurde ich zur dortigen Film Section kommandiert. Ich trete meine Reise übermorgen an und könnte eine Sekretärin in meiner Begleitung gebrauchen.«
Lili stockte der Atem. Seine Worte klangen nach einem Wunder. Am liebsten wäre sie ihm dafür um den Hals gefallen, aber die praktischen Überlegungen drängten in den Vordergrund. »Ich habe keine Papiere …«
»Die bekommen Sie.« Jetzt grinste er breit und wirkte dabei nicht mehr wie ein Student, sondern wie ein Schuljunge, dem ein Streich gelungen war. »Wir fahren übrigens mit dem Interzonenschnellzug ab Bahnhof Zoologischer Garten.«
Sie hatte geahnt, dass es einen Haken gab. Anscheinend wusste der Engländer nicht, wie privilegiert er war. Enttäuscht schüttelte sie den Kopf. »Diese Verbindung darf ich als Deutsche nicht benutzen, die ist für Ausländer reserviert.«
»Meine Sekretärin bekommt selbstverständlich eine Sondergenehmigung. Sie sind schließlich so tüchtig, dass ich nicht einmal auf der Bahnreise auf Sie verzichten kann.«
Es war unfassbar. Doch statt ohne Zögern anzunehmen, was er ihr bot, kamen ihr erneut Zweifel. »Warum tun Sie das?«, hauchte sie.
»Ich bin ein Filmfan wie Sie und würde gern retten, was sich zu retten lohnt. Oder anklagen, wo es sein muss, wenn ein Streifen eine deutliche politische Botschaft enthält. Jedenfalls möchte ich in keinem Fall, dass die alten Negative in die falschen Hände geraten. Deshalb werden wir beide zu gegebener Zeit einen netten kleinen Ausflug nach Lübeck-Travemünde unternehmen.«
Er bückte sich zu seinem Schreibtisch, nahm einen Notizblock und einen Stift auf und hielt ihr beides hin. »Vorher sollte ich allerdings Ihre persönlichen Angaben haben, Name, Adresse, Geburtsdatum und so weiter. Sonst kann ich Ihnen keinen Interzonenpass mit Sondergenehmigung besorgen.«
Mit vor Erleichterung und Erregung zitternder Hand griff sie danach. »Danke«, stieß sie hervor. »Ich danke Ihnen sehr … äh …« Ihre Augen suchten seinen Uniformrock nach einem Hinweis auf seinen genauen Dienstgrad ab. Den und seinen Namen, der an einem Schild außen an der Tür stand, hatte sie kaum wahrgenommen und beim Eintreten in sein Büro schon vergessen.
»Ich heiße John Fontaine, Captain Fontaine. Willkommen in meinem Stab, Lili Paal.«
2
Es blieben Lili keine achtundvierzig Stunden mehr in Berlin, bevor sie ihren neuen Chef am Bahnhof Zoo treffen sollte. In dieser Zeit packte sie ihre Habseligkeiten zusammen und beschwor ihre Untermieterinnen, eine junge Schauspielerin und eine ehemalige Souffleuse vom Schiller-Theater, dass sie in ihrer Abwesenheit keine weitere Einquartierung duldete, obwohl jeder Quadratmeter intakter Wohnraum in Berlin heiß begehrt war. Der Interzonenpass besaß üblicherweise eine Gültigkeit von nur dreißig Tagen, sie würde also lange vor Jahresende zurückkommen und dann wieder ihr Zuhause beziehen.
Ihre kleine Wohnung befand sich unter dem Dach in einem Mehrfamilienhaus an der Detmolder Straße in Wilmersdorf nahe dem Kaiserplatz und der einer Trümmerwüste ähnelnden Kaiserallee. Es war ein Wunder, dass ihre beiden Zimmer die schweren Luftangriffe fast unbeschädigt überstanden hatten, immerhin war ein Seitenflügel des Hauses getroffen worden und ausgebrannt, Teile der Fassade an dem Gebäude waren weggebrochen, aber ihr Treppenaufgang und die Außenmauern ihrer Bleibe waren intakt, nur die Fenster waren zerborsten. Das war in diesen Zeiten ein kleiner Luxus, jedenfalls hatte sie deutlich mehr Glück gehabt als ihre Mutter in Hamburg.
Zu wissen, dass sie nie mehr in die Reihenvilla zurückkehren konnte, in der sie ihre Kindheit und Jugend verbracht hatte, machte Lili traurig. Wartenbergs waren ausgebombt, woraufhin Sophie und für kurze Zeit auch noch Robert bei Hilde und deren Familie untergekommen waren. Lili bezweifelte, dass ihre Halbschwester von sich aus so viel Großzügigkeit walten ließ, sie meinte vielmehr, dass jemand in der zuständigen Behörde nachgeholfen hatte. Der Zwangswohnraumbewirtschaftung musste sich Peter Westphal, Hildes Ehemann, gewiss schon unter den Nazis beugen und unter den Besatzern erst recht. Zu dritt – Hilde, Peter und die knapp sechzehnjährige Gesa – bewohnten die Westphals eine Sechszimmerwohnung, die mit ihren schlossähnlichen Ausmaßen in der gegebenen Situation geradezu nach Untermietern verlangte, ausgebombten Hamburgern, Flüchtlingen aus dem Osten, Heimatlosen, Rückkehrern. Da waren die eigene Mutter und Schwiegermutter sowie der Stief- beziehungsweise Schwiegervater sicher die angenehmere oder zumindest naheliegende Wahl. Ihre eigenen Besuche bei Westphals konnte Lili an einer Hand abzählen, ihr Verhältnis zu Hilde war nicht so, dass sie sich oft gesehen hatten, und wenn, dann eher bei ihren Eltern. Doch nun wohnte Sophie dort, und Lili würde bei ihr unterkommen müssen.
Lili hatte nicht die geringste Ahnung, wie ihre Mutter mit den dramatischen Veränderungen in ihrem Leben wirklich zurechtkam. Im Zweiten Weltkrieg zum zweiten Mal Witwe zu werden hatte Sophie stark mitgenommen. Das wusste Lili, obwohl sie in den vergangenen drei Jahren nicht mehr nach Hamburg gefahren war. Nach dem Feuersturm im Sommer 1943 war eine private Reise in die Hansestadt kaum möglich gewesen. Nicht einmal der Beerdigung ihres Vaters hatte Lili beiwohnen können, in den letzten Kriegstagen war an eine Fahrt aus der von der Roten Armee eingekesselten Reichshauptstadt nicht zu denken. Auch nachdem sich die Verhältnisse in Berlin durch den Einmarsch der Westalliierten und die Aufteilung in Sektoren einigermaßen zu normalisieren begannen, waren Bahnfahrten so gut wie unmöglich, zumal die Sowjets die Grenzen inzwischen geschlossen hatten. Allerdings konnten Briefe zuverlässig verschickt werden, und auch Telegramme fanden ihren schnellen Weg zum Adressaten. Auf diese Weise hatte Lili von Hilde erfahren, dass ihre Mutter schwer krank war. Hilde rechnete sogar mit dem Schlimmsten – sie befürchtete, Sophie könnte den Gashahn aufdrehen und sich das Leben nehmen.
Die düstere Stimmung, die Lili bei der Erinnerung an Hildes Brief erfasste, verflog, als sie an die Fahrt im Nord-Express dachte. Die würde erheblich angenehmer verlaufen als die beschwerliche Verbindung, die mit vielen Haltestationen manchmal bis zu zwanzig Stunden auf der dreihundert Kilometer langen Strecke dauerte. Viele Gleise waren noch zerstört, und die Eisenbahn fuhr nur unregelmäßig, sodass die für Deutsche zugelassenen Züge meist überfüllt und ohne die geringste Bequemlichkeit waren. Für Ausländer galten andere Maßstäbe, vor allem für einen britischen Besatzungsoffizier wie Captain Fontaine nebst Sekretärin. Lili schmunzelte bei dem Gedanken an ihre neue Rolle.
Zu Fuß machte sie sich frühzeitig auf den Weg, um zur verabredeten Zeit pünktlich am Bahnhof zu sein. Durch die Ruinen der Kaiserallee zog ein kalter Wind, leichter Nieselregen senkte sich über die Trümmerlandschaft. Es war kaum zu glauben, dass rechts und links von der langen Verbindungsachse Straßen abgingen, deren Häuserzeilen der Zerstörung getrotzt hatten. Lili kannte diesen Weg wie ihre Westentasche. Als Kind hatte sie Erich Kästners Emil und die Detektive verschlungen, und die Geschichte spielte überwiegend in der Kaiserallee. Im Kino ihrer Eltern am Jungfernstieg hatte sie die Verfilmung gesehen. Bald nach ihrer Ankunft in Berlin war sie tatsächlich zu dieser Straße gewandert, ließ sich dann aber mehr von den Lichtspielhäusern beeindrucken, allen voran das Atrium. Es war etwas ganz Besonderes, ein Gebäude, dem Kolosseum in Rom nachempfunden, für über zweitausend Leute, mit allen technischen Raffinessen ausgestattet und atemberaubender innenarchitektonischer Schönheit. Von Bomben getroffen war es bis auf die Mauern des Erdgeschosses niedergebrannt. Lili marschierte an der Ruine mit einer gewissen Wehmut vorbei, für die sie sich aber sofort im Stillen schalt, denn es war so vieles zerstört, worum es sich weinen ließ. Wie es in Hamburg nach den verheerenden Fliegerangriffen aussah, konnte sie noch nicht einmal ahnen. Der Frage, wie sie sich fühlen würde, wenn sie vor dem Steinhaufen stand, unter dem ihre Kindheits- und Jugenderinnerungen begraben lagen, widmete sie sich besser nicht. Wahrscheinlich würde sie nicht einmal mehr hingehen, um zu schauen, was übrig war. Im Moment war nur wichtig, dass sie sich um ihre Mutter kümmerte. Sie musste dankbar sein, die schnellste und beste Reisemöglichkeit gefunden zu haben. Und sie musste nach vorn schauen, sich überlegen, wie sie mit Captain Fontaine nach den verlorenen Negativen suchen sollte, denn die Hinweise darauf waren nicht ganz so klar wie bei der Sonnenuhr in dem Park, den sie ebenfalls in Richtung Zoo passierte.
Vor dem Bahnhof herrschte ein unübersichtliches Durcheinander. Im Schatten des wie ein Stahlgerippe wirkenden Dachs der Fernbahnhalle, das man nach dem Umbau unmittelbar vor dem Krieg zu verglasen vergessen hatte, gingen die Schieber eifrig dem Schwarzmarkthandel nach. Lili kannte die verstohlenen Blicke und den gleichgültig wirkenden Gang, den Griff in eine Tasche und den raschen Wechsel der Tauschwaren in eine andere Hand. Obwohl diese Art des Einkaufs verboten war, konnte niemand ohne den Schwarzen Markt überleben, die von den Besatzern bewilligten Essensrationen waren zu gering und wurden selbst auf die offiziellen Lebensmittelkarten nicht immer voll ausgegeben. Der Hunger war auch Lilis ständiger Begleiter, obwohl es ihr während der Arbeit für die DEFA besser gegangen war, weil die Russen größere Rationen verteilten. Schlimmer noch erging es den Flüchtlingen, ausgemergelten Menschen, die an ihren ratlosen, verstörten Mienen zu erkennen waren und an der dunklen Kleidung, die noch schäbiger war als die der Berliner. Sie standen ebenso heimatlos wie hilflos herum, weil sie nicht wussten, wohin. Wohlgenährt in ihren schnittigen Uniformen wirkten vor allem die Soldaten aus den Vereinigten Staaten von Amerika, aber auch Briten und Franzosen wurden wohl meistens satt, allerdings hatten die in ihren eigenen Ländern mit einer schlechten, wenn auch nicht ganz so schlechten Versorgungslage zu kämpfen. Jedenfalls wirkten alle Besatzer – auf dem Platz zwischen Zoologischem Garten und Mittelgleis ebenso wie an jedem anderen Ort in Berlin – wie Geschöpfe aus dem Schlaraffenland.
Wahrscheinlich himmelten deshalb so viele deutsche junge Frauen die siegreichen Soldaten an, fuhr es Lili durch den Kopf. Allerdings waren manche von ihnen tatsächlich hübsche Kerle. Dieser jungenhafte, etwas schelmische studentische Ausdruck, der John Fontaine anhaftete, war ziemlich attraktiv, wie sie sich im Nachhinein eingestand, nachdem ihr anfänglicher Zorn und ihr Unverständnis schließlich der Freude über die Reisemöglichkeit gewichen waren. Wenn sie sich mit etwas anderem als der Sorge um ihre Mutter beschäftigen wollte, wäre der in der britischen Filmabteilung arbeitende Captain durchaus einen Gedanken wert.
Lili kämpfte sich durch das überfüllte Bahnhofsgebäude zu dem Treppenaufgang zum Mittelgleis, von dem in einer Viertelstunde der Schnellzug nach Hamburg abgehen sollte. Vom Eingangsportal wehte die Musik einer Drehorgel durch das Gebäude, alte Berliner Lieder aus dem Kaiserreich, die wohl jeder mitsingen konnte, aber sich niemand mehr mitzusingen getraute. Nach ein paar Schritten wurde der Leierkasten leiser, als Lili die Scharen dunkler dünner Gestalten hinter sich ließ und sich in die Schlange vor dem Bahnsteig einreihte, zwischen besser genährten Armeeangehörigen in perfekten Uniformen und Zivilisten in gut sitzenden Anzügen und wärmenden Mänteln, die nicht dutzendfach geflickt waren. Sie spürte, wie sie mit verwunderten oder neugierigen Blicken gemustert wurde. Aber sie hielt den Kopf hoch und blickte nicht nach rechts oder links, um sich die eigene Unsicherheit nicht anmerken zu lassen.
»Stop!« Ein Wachmann stellte sich ihr in den Weg. »Deutsche haben hier keinen Zutritt, der Zug ist für Reisende aus dem Ausland reserviert.«
Lili nickte. »Ich bin mit Captain Fontaine von der britischen Filmabteilung unterwegs.«
»Aha.« Der Mann sah sich demonstrativ um. »Und? Wo ist Ihr Begleiter?«
Bisher hatte sie ihren Treffpunkt für selbstverständlich gehalten, langsam stellten sich Zweifel ein. Dennoch erwiderte sie ruhig und klar: »Wir sind am Zug verabredet.«
»Ohne eine Fahrkarte kommt hier niemand durch. Außerdem brauchen Sie eine Sondergenehmigung, Fräulein. Wenn Sie beides haben, lasse ich Sie passieren.«
Hinter ihr entstand Unruhe. Die anderen Reisenden, vornehmlich Männer, fühlten sich aufgehalten und wollten nicht warten. »Go on, lady«, drängte lautstark ein GI.
Du lieber Himmel, war das peinlich! Für Lili, die es hasste, in Situationen wie dieser aufzufallen, wurde es unangenehm.
Sie räusperte sich verlegen. »Captain Fontaine hat meine Papiere. Er bringt sie mit. Zum Zug«, fügte sie schwach hinzu, sich der Ausweglosigkeit plötzlich bewusst. Wenn John Fontaine bereits am Gleis auf sie wartete und sie nicht zu ihm durchkam, würde er möglicherweise glauben, sie habe es sich anders überlegt. Und dann war diese einmalige Chance vertan.
»Bitte, lassen Sie mich durch«, flehte sie.
»Ick habe meine Vorschriften, Fräulein. Ohne Fahrkarte und Sonderjenehmigung lasse ich Sie nicht auf den Bahnsteig.« Der Wachmann lächelte sie mitleidig an, machte aber eine eindeutige Handbewegung, die besagte, dass sie verschwinden sollte.
»Aber Captain Fontaine …«, hob sie an.
»Kenne ich nicht«, unterbrach er sie. »Nun gehen Sie mal zur Seite, und halten Sie die Leute nicht auf, die eine Reiseerlaubnis besitzen.«
»Ich …« Sie biss sich auf die Zunge. Statt weiterzusprechen, trat sie aus der Schlange und an das Geländer.
Was sollte sie jetzt tun? Wenn sie sich die Treppe hinabstürzte, würde sie für einige Unruhe sorgen und John Fontaine, der neben dem Nord-Express auf sie wartete, sicher auf sich aufmerksam machen. Genauso gut konnte sie sich jedoch dabei den Hals brechen. Im nächsten Moment schalt sie sich still für ihre Gedanken. Sie sollte lieber einen Ausweg aus ihrer misslichen Lage finden. Dann dachte sie, ein englischer Offizier würde wissen, dass man sie ohne Papiere nicht zum Interzonenschnellzug vorließ. Wenn er nun gar nicht kam …! Lili wurde schwindelig, und sie befürchtete einen Moment lang, ihre Knie würden nachgeben. Mit beiden Händen umklammerte sie das Treppengeländer, um sich abzustützen.
Sie brauchte nicht ständig hinzusehen, um zu bemerken, wie sich der Stau am Aufgang zum Gleis aufzulösen begann. Leises Stimmengemurmel, Füßescharren, ein Blick in ihre Richtung. Irgendjemand murmelte: »Die jungen Dinger glauben doch wirklich jedes Märchen, das ihnen aufgetischt wird«, und ihr Herz zog sich zusammen, weil der Mann wahrscheinlich recht hatte. Die Minuten verstrichen, und es wurde immer offensichtlicher, dass Captain John Fontaine sie belogen hatte – warum auch immer. Wenn sie doch nur nicht schon Hilde ein Telegramm mit ihrer Ankunftszeit geschickt hätte! Der ungeliebten Halbschwester gegenüber zugeben zu müssen, dass sie auf den Arm genommen worden war, schmerzte fast genauso wie die Tatsache, nichts für die Mutter tun zu können und vielleicht zu spät zu kommen. Dennoch war die Vorstellung, Sophie niemals wiederzusehen, mehr, als sie im Moment verkraften konnte.
Mit hängenden Schultern trat Lili den Rückweg an. Ihre Augen füllten sich mit Tränen, und sie musste aufpassen, nicht ins Leere zu treten, als sie Stufe um Stufe langsam hinunter in Richtung Eingangshalle zu ihren deutschen Landsleuten trottete.
»Was machen Sie denn da? Wo wollen Sie hin?« Eine Hand schloss sich um ihren Arm. »Kommen Sie, kommen Sie!«
Der Griff tat ihr weh, seine Finger bohrten sich durch Mantel und Pullover in ihr Fleisch. Unfähig zu begreifen, was mit ihr geschah, ließ sie sich mitzerren. Sie hatte Mühe, nicht über ihre eigenen Füße zu stolpern. Durch den Tränenschleier sah sie kaum, wohin sie trat. Aber es ging treppauf.
»Wir müssen uns beeilen, sonst fährt uns der Zug vor der Nase weg.«
»Na, da sind Sie ja schon wieder«, stellte der Wachmann beim Blick auf Lili fest.
»Wie bitte?«, fragte John Fontaine indigniert.
Lili schloss die Augen. Es konnte nicht sein, dass er zu spät gekommen war und sie erlöste.
In der festen Meinung, einem Tagtraum aufzusitzen, hob sie die Lider. Doch als sie die Tränen fortblinzelte, sah sie, wie der Wachmann gewissenhaft Fahrkarten und Papiere prüfte. Sie spürte die wachsende Unruhe des Mannes neben sich und hatte Mühe, das hysterische Gelächter zu unterdrücken, das in ihr aufstieg.
»Machen Sie schnell, wenn Sie nicht aufspringen wollen«, riet der Wachmann, als er die Unterlagen zurückgab.
»In der Tat«, schnappte der Engländer, nahm die Reisedokumente wieder an sich und griff nach Lilis Hand.
Er brauchte sie nicht mehr mit sich zu zerren, sie bemühte sich von allein, mit ihm Schritt zu halten. Der Rucksack mit ihren Sachen, der sich beim Verlassen der Wohnung leicht angefühlt hatte, zog ihr nun die Schultern herunter. Lili spürte plötzlich jeden Muskel und jeden Knochen einzeln. Doch sie lief an Captain Fontaines Seite hinauf zum Mittelgleis. Als sie oben ankamen, fielen die ersten Waggontüren mit einem dumpfen Geräusch ins Schloss. Ein Schaffner in der dunkelblauen Uniform der Reichsbahn wanderte am Bahnsteig entlang, schwenkte die Kelle, die die Abfahrt signalisierte.
Atemlos erreichten die beiden letzten Passagiere die Plattform am hinteren Ende der Eisenbahn. Fontaine schwang sich auf die Bühne. In diesem Moment erklang ein schriller Pfiff. Stampfend und ächzend setzte sich der Zug in Bewegung, Rauchschwaden hüllten den Bahnsteig ein.
»Spring!«, brüllte Fontaine.
Lilis Beine drohten ihr den Dienst zu versagen. Nicht nur wegen der körperlichen Anstrengung, die Aufregung setzte ihr noch mehr zu. Sie zwang sich zur Konzentration auf die Eisenfläche, auf den Haltegriff und auf Fontaines Hand. Langsam entfernte sich die Plattform von ihr. Sie holte tief Luft, setzte zum Dauerlauf an – und stieß sich vom Boden ab. Seltsamerweise war es ihr in dieser Sekunde gleichgültig, ob sie zwischen den Rädern landen würde. Nur nicht zurückbleiben, hämmerte es in ihrem Kopf. Da bekamen ihre Füße in den klobigen Wanderschuhen wieder Halt. Sie schwankte – und sank nach vorn.
»Na, na, na«, meinte Fontaine, während er sie aus seiner reaktionsschnellen Umarmung befreite, »ich dachte immer, die deutschen Mädels wären beim BDM zu Höchstleistungen trainiert worden.«
Lili wischte sich über die feuchten Augen. »Auf fahrende Züge aufzuspringen gehörte nicht zu meinen Disziplinen. Im Tennis war ich besser.«
»Hatte ich schon erwähnt, dass ich Ihren Humor mag?« Lachend öffnete er die Glastür, die von der Plattform in ein Abteil führte. »Kommen Sie, lassen Sie uns unsere Plätze finden. Ich fürchte, der Zug ist ziemlich voll.«
3
John Fontaine förderte aus seiner Aktentasche, die eher wie ein alter Arztkoffer aussah, eine Thermoskanne zutage. »Möchten Sie einen Tee?«, fragte er höflich.
Lili hörte ihn kaum. Sie erholte sich noch von der unerwarteten Begegnung mit einem sowjetischen Unteroffizier, der plötzlich in ihrem Abteil aufgetaucht war und nach den Fahrkarten und Ausweisen verlangte. Während diese Aufforderung für ihre Mitreisenden selbstverständlich zu sein schien und mit gelangweiltem Interesse hingenommen wurde, klopfte ihr Herz wie nach einem Dauerlauf. Nervös beobachtete sie, wie Captain Fontaine ihren Interzonenpass und ihr Billett mit seinen Papieren vorzeigte. Mit erstauntem Gesichtsausdruck betrachtete der Russe die Dokumente, sagte schlicht »Da« und gab sie zurück. Dann verschwand er. Eine der wohl üblichen Kontrollen, nichts, worüber es sich aufregen ließ. Außer Lili hatte natürlich keiner der Männer neben ihr befürchten müssen, des Zugs verwiesen oder verhaftet zu werden.
Mit ihr und dem Engländer saßen noch drei Zivilisten in dem Abteil, die ihre lebhafte Unterhaltung nach Verschwinden des Rotarmisten fortsetzten. Eine Unterhaltung, die Lili mit gemischten Gefühlen verfolgte. Sie hatte Englisch – wie fast alle Hamburger – in der Schule gelernt und ihre Kenntnisse durch die Texte zu den beliebten Swingmelodien verbessert. Offenbar waren die Männer Pressevertreter, da der augenscheinlich Älteste eine Fotoausrüstung bei sich trug, mit der er ständig herumhantierte. Ein offener Lederkoffer stand auf seinen Knien, und mal inspizierte er das Blitzlicht, dann zählte er die Filmrollen durch, strich über das kleine Gehäuse einer Leica, die er sicher auf dem schwarzen Markt erstanden oder irgendwo beschlagnahmt hatte. Die beiden anderen unterhielten sich, ohne auf ihre Mitreisenden Rücksicht zu nehmen.
»Weißt du, warum die Deutschen sagen, unter Hitler sei es ihnen besser ergangen?«
Sein Kollege grinste in Erwartung eines guten Witzes und schüttelte den Kopf.
»Weil sie bei Hitler fünf Scheiben Brot täglich zu essen bekamen. Unter den Besatzern bekommen sie nur zwei Scheiben pro Tag. Natürlich ging es ihnen da als Nazis besser.«
Das folgende Gelächter bohrte sich in Lilis Seele. Prompt knurrte ihr Magen.
»Hier«, Fontaine hielt ihr einen Becher hin, aus dem Dampf aufstieg, »trinken Sie einen Schluck Tee. Noch ist er heiß.«
»Danke.« Ihre Hände schlossen sich um das Gefäß, und obwohl sie kurz fürchtete, sich die Finger zu verbrennen, hielt sie es fest. Vorsichtig pustete sie in die bernsteinbraune Flüssigkeit.
Ihr Gegenüber schraubte das Objektiv von dem Fotoapparat und ersetzte es durch ein anderes. Dann hob er die Kamera vor sein Auge und blickte durch den Sucher, als wollte er Lili fotografieren.
»No photos, please«, sagte Fontaine mit einer energischen, fast bedrohlichen Stimme, die Lili verwundert aufschauen ließ.
Sie hatte nicht erwartet, dass er so deutlich werden könnte. Und sie fand seine Reaktion etwas übertrieben. Unwillkürlich lächelte sie ihrem Mitreisenden entschuldigend zu. Ihr war es vollkommen egal, ob sie von einem Reporter aufgenommen wurde. Außerdem war klar, dass der Mann nur mit dem Apparat herumspielte, vielleicht waren die Sachen noch nicht lange in seinem Besitz.
»Sorry«, murmelte der Journalist halbherzig, schraubte das Objektiv wieder ab und verstaute es ordentlich in einem dafür bestimmten, mit dunkelblauem Samt ausgeschlagenen Behälter aus seinem Koffer.
Erst jetzt ging Lili auf, dass Captain Fontaine wohl nicht mit ihr gesehen werden wollte. Oder dass ihre gemeinsame Reise zumindest nicht dokumentiert werden sollte. Angesichts der Mühe, die er sich gegeben hatte, um ihr die Fahrt nach Hamburg zu ermöglichen, fand sie sein Verhalten erstaunlich. Aber vielleicht fürchtete er, dass ihm irgendjemand falsche Beweggründe unterstellte. Sie trug ja kein Schild mit der Aufschrift bei sich, dass sie Cutterin war und dem britischen Filmoffizier dabei helfen wollte, verloren geglaubte deutsche Negative aufzustöbern.
Sie nippte an dem Tee, der stark – und sehr süß war. »Du lieber Himmel«, entfuhr es ihr, »haben Sie die Zuckerration für einen ganzen Monat in die Kanne gegeben?«
»Meine Mutter sagt immer, süßer Tee wirkt Wunder. Aber wenn Sie das nicht mögen, brauchen Sie es nicht zu trinken. Ich zwinge Sie zu nichts.« Fontaine klang beleidigt.
»Nein, nein, schon in Ordnung. Ich liebe dieses Getränk.« Das stimmte zwar nicht ganz, aber echter englischer Tee war ein Luxus. Die Zuckermenge spielte nur eine untergeordnete Rolle, obwohl sie den bitteren Geschmack lieber mochte. Gemocht hatte, korrigierte sie sich in Gedanken. Es war so lange her, dass sie irgendein Genussmittel zu sich genommen hatte, seit Jahren trank sie nur Ersatzkaffee. Sie schämte sich für ihre überhebliche Reaktion auf Fontaines Angebot. Dabei war es sehr freundlich von ihm, seinen Proviant mit ihr zu teilen. Wenn er jetzt auch noch eine Schnitte auspackte, wäre die Bahnfahrt gerettet. Sie nahm einen großen Schluck Tee und verbrannte sich die Zunge. Statt Fontaine das ihm zustehende Lächeln zu schenken, verzog sie das Gesicht.
»So schlimm?«, seufzte Fontaine.
»So heiß«, gab sie zurück. Trotz des schmerzhaften pelzigen Gefühls im Mund gelang ihr ein Schmunzeln.
Endlich lächelte er. Er hielt die Thermoskanne hoch und meinte: »Das ist eben deutsche Wertarbeit.«
Zwischen den Reportern begann eine Flasche zu kreisen, die Farbe des Inhalts ließ auf Whisky oder Cognac schließen. Nach der ersten reichlich genossenen Kostprobe grölte einer der Männer: »Die Deutschen mit Format behaupten ja, nur ein Prozent von ihnen wären Nazis gewesen.« Er schlug sich kichernd auf die Schenkel. »Aber welcher Deutsche hat schon Format?«
Hör nicht hin, mahnte eine innere Stimme. Lili senkte den Blick, um ihr Gegenüber nicht ansehen zu müssen, und trank nun Schluck für Schluck aus Fontaines Becher. Trotz des vielen Zuckers schmeckte der Tee immer besser. Wärme flutete durch ihren Körper, die anregenden Stoffe belebten sie, und die Süße stillte ihren Hunger. Sie entspannte sich.
Die Gespräche der drei angetrunkenen Männer begannen sich in einer ebenso wirren wie hitzigen Mischung um die politischen Nachrichten der vergangenen sechs Wochen zu drehen, um die sogenannten Nürnberger Prozesse und die Todesurteile gegen die Hauptkriegsverbrecher, um die angebliche Ungerechtigkeit, dass der eine oder andere Nazi nur zu einer Zuchthausstrafe verurteilt oder sogar freigesprochen wurde. Ziemlich schnell wechselte die Diskussion dann zum Für und Wider der Kommunalwahlen, die in diesen Wochen in allen Zonen stattfanden.
Die schleppend geführten Sätze verschwammen in Lilis Kopf zu einer einzigen dumpfen Masse, einem einschläfernden Hintergrundgeräusch, das sich mit dem Stampfen und Puffen der Eisenbahn verband. Bevor sie einnickte, bemerkte sie, dass Fontaine ein Buch aus der Aktentasche genommen und aufgeschlagen hatte. Ein Blick unter den herabfallenden Lidern verriet ihr, dass er Siddhartha von Hermann Hesse las. Einst der Lieblingsroman ihres Vaters.
Durch eine Berührung aufgeweckt, schreckte Lili hoch. Sie riss die Augen auf – und sah in John Fontaines Brillengläser, in denen sich das durchs Abteilfenster hereinfallende Licht brach. Mit einiger Verzögerung bemerkte sie, dass ihr Kopf gegen seinen Oberarm gesunken war. Wie peinlich! Offenbar war er so geistesgegenwärtig gewesen, ihr den Becher aus der Hand zu nehmen, bevor der restliche Tee auf seine Knie floss. Sie hatte nichts davon wahrgenommen, erst als er sie an der Schulter rüttelte, verließ sie ihre Traumwelt. Sie hatte zum ersten Mal seit langer Zeit wieder von ihrem Vater geträumt. Das lag vermutlich an Fontaines Reiselektüre. Der Mann, der denselben Literaturgeschmack besaß wie Robert Wartenberg, wirkte auf sie zunehmend sympathisch. Diese Erkenntnis und auch die körperliche Nähe zu ihm ließen sie erröten.
»Entschuldigung«, murmelte sie verlegen und richtete sich auf. »Ich hätte nicht einschlafen dürfen.«
»Warum denn nicht? Es steht Ihnen frei, sich die Zugfahrt so angenehm wie möglich zu gestalten.« Mit gesenkter Stimme und einem Kopfnicken in Richtung der anderen Männer im Abteil fügte er hinzu: »Außerdem scheinen mir unsere Sitznachbarn nicht die angenehmste Gesellschaft für Sie zu sein.«
Lilis Augen flogen zu ihrem Gegenüber. Die drei Reporter waren ebenfalls eingeschlafen, Schnarchgeräusche in unterschiedlichen Lautstärken erfüllten den Raum. Auf dem Koffer mit der Fotoausrüstung rollte die leere Flasche sacht hin und her.
»Wir sind kurz vor der Zonengrenze«, erklärte Fontaine. »Deshalb musste ich Sie leider wecken. Die Kontrolle der Sowjets wird dem Schlaf der Schnapsleichen gleich ein Ende bereiten.«
»Es ist mir lieber, die Leute schlafen ihren Rausch aus, als dass ich weiter dem Unsinn zuhören muss, den die von sich geben.«
»Machen Sie sich nichts daraus, das sind nur ein paar harmlose Jungs aus den Staaten, wahrscheinlich stammen sie aus irgendeinem Kaff im Mittleren Westen und sind durch den Krieg zum ersten Mal von dort weggekommen. Die zivilisierte Ostküste kennen die sicher ebenso wenig wie Europa.«
»Waren Sie schon einmal in den USA?«, wollte sie wissen. Eine Reise über den Ozean erschien ihr unfassbar aufregend. Ihre Mutter hatte immer von einer Überseefahrt geträumt, wobei sich Lili niemals sicher war, ob es Sophie um die Ankunft in New York ging oder vielmehr um die Eleganz und den Luxus einer Passage in der ersten Klasse.
»Nein«, erwiderte Fontaine, »aber ich lese viel.«