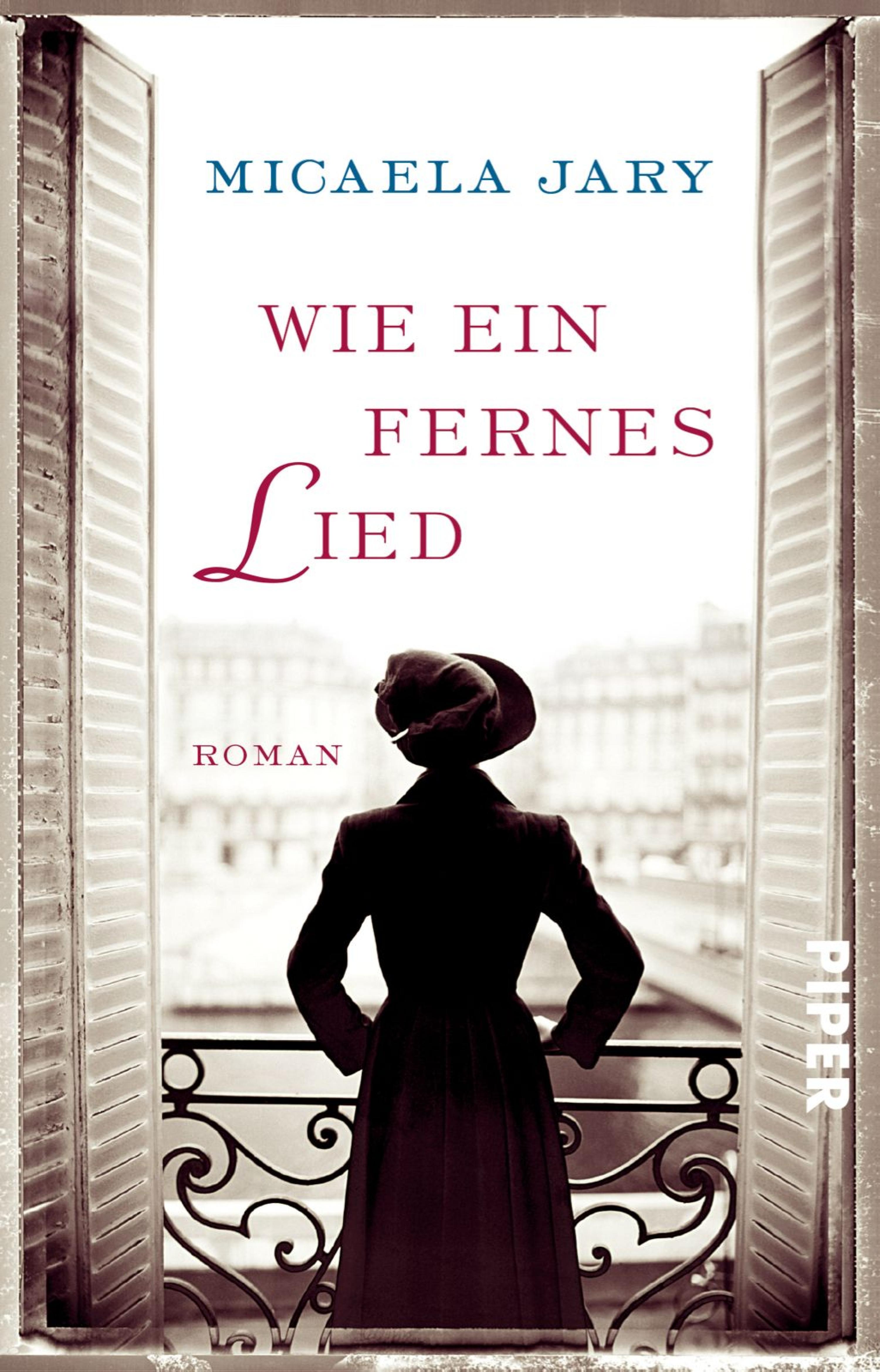9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Rund um die Gründung des berühmten Hotels Louis C. Jacob erzählt Micaela Jary zwei mitreißende Liebesgeschichten Nienstedten bei Hamburg 1790: Tradition trifft auf Revolution, Liebe auf Vernunft. Ein Unglück nimmt Maria Burmester den Ehemann und ihren Kindern den Vater. Trotz der ererbten Schulden möchte sie die Konditorei am Hochufer der Elbe behalten, doch ein Konkurrent bedrängt sie und schreckt dabei nicht vor Erpressung und Tätlichkeiten zurück. Da bietet ihr der reiche Hamburger Kaufmann Joachim Graaf einen Kredit an, wenn sie ein Fest für seine Angebetete ausrichtet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 559
Ähnliche
Micaela Jary
Die Lindenterrasse
Ein Juwel am Elbstrand
Roman
Über dieses Buch
In ihrem historischen Roman erzählt Micaela Jary zwei mitreißende Liebesgeschichten und zugleich die Geschichte der Gründung des berühmten Hamburger Hotels Louis C. Jacob. Nienstedten bei Hamburg 1790: Hier trifft Tradition auf Revolution, Liebe auf Vernunft. Ein Unglück nimmt Maria Burmester den Ehemann und ihren Kindern den Vater. Trotz der ererbten Schulden möchte sie die Konditorei am Hochufer der Elbe behalten, doch ein Konkurrent bedrängt sie und schreckt dabei nicht vor Erpressung und Tätlichkeiten zurück. Da bietet ihr der reiche Hamburger Kaufmann Joachim Graaf einen Kredit an, wenn sie ein Fest für seine Angebetete ausrichtet. Sein französischer Gartengestalter Daniel Louis Jacques bepflanzt die Terrasse am Elbufer daraufhin mit Linden und sorgt für ein exquisites kulinarisches Angebot. Doch damit beginnen erst die dramatischen Konflikte, die nicht nur Graafs Geliebte in Gefahr bringen. Um alles zu retten, braucht Maria nicht nur ihren Mut, sondern auch die weitere Unterstützung von Daniel.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Micaela Jary wurde in Hamburg geboren und wuchs an der Elbchausee auf, in Nienstedten absolvierte sie ihre ersten beiden Schuljahre. Nach Lebensabschnitten in München, Lugano/Tessin und Paris lebt sie heute in Berlin, kommt aber immer wieder gerne in ihre Geburtsstadt zurück, auch als Gast ins Hotel Louis C. Jacob. Nach dem Sprachenstudium absolvierte sie ein Zeitungsvolontariat und arbeitete lange als Redakteurin, inzwischen erreichte sie mit ihren Romanen zahlreiche Bestseller-Erfolge.
Inhalt
[Motto]
Prolog
[Motto]
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
Epilog
Nachwort
Rezepte
Schwarzbrottorte
Krebsbutter
Rotweinkuchen
Eisbaum
Schneebälle
Suppenkuchen
Die wahre Schönheit,
das ist …
die Elbe unterhalb von Altona.
Marie-Henri Beyle, genannt Stendhal
Nienstedten,
Herzogtum Holstein-Pinneberg, Königreich Dänemark
Prolog
Der wöchentliche Marktbesuch ersetzte die Lektüre von Zeitungen, Geburtenregistern, Heiratsanzeigen und Trauerbriefen. Obwohl Nienstedten nur ein Dorf war, kamen die Bauern und Kundinnen aus fast allen umliegenden Gemeinden, um zwischen den hübschen weißen Katen und im Schatten der alten Fachwerkkirche Handel zu treiben und Klatsch und Neuigkeiten auszutauschen. Heute waren die steigenden Kosten das beherrschende Thema. Die Nachricht von der Abschaffung der Salzsteuer in Frankreich hatte die Bewohner der dänischen Provinz erreicht. Die Lebensmittelpreise und damit verbundenen Abgaben gingen jeden und jede etwas an, einerlei ob Landwirt, Fischer, Kaufmann oder Hausfrau – die meisten Menschen am Hochufer der Unterelbe lebten ebenso wie die Mehrzahl der Untertanen des dänischen Königs in dessen Kernland vor allem von eingelegten Heringen und gepökeltem Speck. Deshalb benötigten sie viel Salz. Die ständig steigenden Kosten verteuerten jedoch trotz einer gewissen Zollfreiheit fast alles auf nicht mehr hinnehmbare Weise. Manche Stimmen grummelten von einer Revolution wie im Vorjahr in Paris, und nicht wenige Männer gaben sich als Sympathisanten der Jakobiner zu erkennen.
Maria spazierte durch die Reihen von gut besuchten Buden, Ständen und aufgestapelten Fässern, um die sich die Leute drängten, umrundete gackernde Hühner und an Pflöcke gebundene Kühe, lauschte der Snackeree und dachte, wie gut sie es getroffen hatte. Und das nicht nur, weil ihr Gatte mehr exotische Gewürze und Süßkram als Salz verarbeitete. Keinen Tag in ihrem Leben hatte sie Hunger leiden müssen. Als Tochter eines Kapitäns, der es bis zum Kommandanten des königlichen Arsenals in Kopenhagen gebracht hatte, hatte es ihr an nichts gefehlt. Ein gewisser Sparsinn war ihr zwar nicht fremd, doch materielle Not kannte sie nur von anderen.
Seinerzeit hatte sie lange überlegt, welchem Mann sie ihr Jawort geben wollte. Mit großer Schönheit gesegnet, hatte es ihr an Verehrern nicht gemangelt. Vor dreizehn Jahren hatte sie den Konditor Paridom Burmester allerdings nicht nur erwählt, weil er ein erstaunlich gebildeter und liebenswürdiger junger Mann war, sondern vor allem weil sie die Kunstwerke faszinierten, die er aus Zucker schuf – für die Nachbildung von Segelschiffen schien er besonders talentiert. Diese Fertigkeit hatte fast alle ihre Sinne berührt. Eine gewisse Rolle für ihre Entscheidung hatte zweifellos auch die bezaubernde Lage seines Hofs gespielt – und so war sie zu ihm in das Einhundertseelendorf am Geestrücken der Unterelbe gezogen, knapp zwei Stunden Kutschfahrt von der zweitgrößten dänischen Stadt Altona und ein wenig mehr von der reichsfreien Stadt Hamburg entfernt.
Es war eine Umstellung für sie gewesen, die Großstadt hinter sich zu lassen. Von Anfang an stillte der Rundgang über den Markt ihre Sehnsucht nach Lärm und Getümmel. Geselligkeit hatte sie durch das an Paridoms Backstube grenzende kleine Konditerei und die drei Jungen und zwei Mädchen, die sie im Laufe ihrer Ehe zur Welt brachte, mehr als genug. Dennoch war es immer wieder aufregend, den Händlern zuzusehen, Neuigkeiten aufzuschnappen und natürlich auch neue Waren aufzustöbern. Es war, als röche es sogar manchmal nach Übersee – oder danach, wie sie sich die große weite Welt vorstellte. Zudem veränderte sich seit geraumer Zeit das Publikum, Nienstedten war inzwischen um das Dreifache gewachsen, und unter die Bauern mischten sich neue Dorfbewohner.
»Sieh dir dat Volk an!« Dineke Matthiesen stöhnte auf. Die Frau des Pastors hatte sich, einen bereits recht gut befüllten Korb in der Hand, an Marias Seite gesellt. »Seit die Krone die Erschließung und den Verkauf von Parzellen in unserer Gegend erlaubt, kommen nicht nur Ausflügler her. Das sind alles reiche Hamburger. Die lassen sich Landhäuser am Heerweg bauen und treiben damit auch die Preise für alles andere in die Höhe.«
Tatsächlich ragten Zylinder und Federn über den Fischermützen und Kappen empor, Herren in Röcken aus feinstem Tuch standen neben Elbländern in groben Jacken aus Wolle in einer Reihe vor den Verkaufsständen, und Damen in Seidenkleidern traten in Konkurrenz zu den Schönheiten in Blankeneser Tracht. Münzen wanderten von manikürten in gröbere Hände, Mägde schleppten Einkäufe zu wartenden Kutschen, Buttjes verdienten sich ein Taschengeld, indem sie auf Pferde achtgaben oder Wassereimer für die edlen Tiere herbeischleppten. Manch vornehme Gesellschaft kehrte auch im Hof von Paridom Burmester ein, probierte seine Patisserien und ließ sich anschließend nicht lumpen. Deshalb erwiderte Maria: »Die neuen Gäste sind gut fürs Geschäft.«
»Deine Tüchtigkeit in Ehren, aber die Fremden bringen Zustände wie in Sodom und Gomorrha in unsere Gemeinde.«
Maria lächelte nachsichtig. »So schlimm ist es wohl noch nicht.« Während sie sprach, wich sie dem neugierigen Blick eines Mannes aus. Sie war es gewohnt, dass ihr viele Augen folgten. Die Geburten hatten sie zwar etwas fülliger werden lassen, ihr jedoch nichts von ihrer Schönheit genommen. Auch mit dreiunddreißig Jahren war sie noch eine auffallende Erscheinung: die Haut makellos, das Haar glänzend, die Haltung stolz. Ihre Herkunft und die enge Bekanntschaft ihres Gatten mit einer Reihe von Honoratioren in Altona und Hamburg hatten sie zu einer recht eleganten Dame heranreifen lassen, ihr aber nichts von ihrer Tatkraft genommen. Ein naives Püppchen wie manche Städterin war sie keineswegs. Das mochte eine anziehende Mischung für gewisse Neuankömmlinge sein, die auf den Höfen in Nienstedten wohl nur Bauernmägde erwarteten.
»Was hat ein wohlhabender Junggeselle schon vor, wenn er hier herauszieht?«, wollte Dineke wissen. »Ohne Frau. Ohne Kinder. Ich mag mir das zügellose Treiben gar nicht vorstellen, das er zu uns bringt.«
»Hast du jemand Bestimmten in Verdacht?«
Dineke seufzte so tief, als sei sie Simon, der das Kreuz Christi trug. »Der Name des Mannes, der dich so anstarrt, ist Joachim Graaf. Er soll kürzlich von einer Kavalierstour zurückgekehrt sein und ein großes Erbe angetreten haben. Jedenfalls scheint er viel Geld zu besitzen, denn er kauft zwischen hier und Teufelsbrück so viel Land auf, wie er nur kriegen kann. Es heißt, er wolle Landschaftsgärtner aus England und Kunstgärtner aus Frankreich kommen lassen, um neben einem Landgut einen Park zu erschaffen. Was will er dort wohl anderes tun als lustwandeln?«
Mit einem kleinen Seitenblick vergewisserte sich Maria, dass sich der Herr noch immer in ihrer Nähe befand. Er richtete seine Aufmerksamkeit jedoch inzwischen auf die Auslagen eines Schlachters. »Vielleicht sucht er nur Ruhe und will, wie die meisten Ausflügler, dem Gestank in der Stadt entfliehen.«
»Nimm dich in Acht vor seinesgleichen«, warnte die Pastorsfrau. »Er war in Frankreich und hat von dort sicher denselben Lebensstil mitgebracht wie die vielen Flüchtlinge, die großherzige, gottesfürchtige Seelen in den Städten aufnehmen, ohne zu ahnen, was ihnen blüht. Ich habe gehört, dass die Fremden die Sitten in Altona und Hamburg drastisch verändert haben. Selbst großbürgerliche Damen feiern die ganze Nacht hindurch, schlafen bis in den Nachmittag hinein und vernachlässigen ihre Kinder. Wenn das nicht Sodom und Gomorrha ist, weiß ich auch nicht.«
Maria wollte entgegnen, dass das alles gewiss nur Gerede war und man aufgeschlossener gegenüber den Fremden sein sollte, die ihre Heimat verlassen mussten, um die eigene Haut zu retten. Das dänische Altona war mehr noch als Hamburg für seine toleranten Gesetze berühmt. Doch zu ihrer Bemerkung kam sie nicht.
Ein Aufschrei ging durch die Menge: »Sie kommt! Die Fregatte Hanse ist in Sicht!« Als wäre dies ein Signal, strömten die Menschen zu jenem Platz zwischen den Katen, von dem aus ein freier Blick auf das breite, goldglänzende Band der Elbe bestand. Und wer seine Waren nicht alleine lassen wollte, reckte den Hals. Der Wind stand günstig, und die Aussicht auf die geblähten Segel war unvergleichlich.
Diese lenkte auch Dineke von den französischen Sitten ab. »Komm, Maria, lass uns zugucken. Obwohl ich an den Anblick der aufgetakelten Schiffe gewöhnt sein sollte, kann ich mich doch niemals daran sattsehen!«
»Oh ja«, versicherte Maria. Sie wollte der Freundin nicht dauernd widersprechen, außerdem hatte Dineke ja recht. Eigentlich aber sollte sie jetzt schnellstens nach Hause laufen und dem Segelschiff nicht mitten unter Nachbarn und Fremden zuwinken, sondern Paridoms Begeisterung an dessen Seite teilen.
Ihr Mann hegte eine tiefe Liebe zur Seefahrt. Eine Liebe, die unerfüllt geblieben war, Erbe und Pflichterfüllung waren ihm wichtiger gewesen. Maria glaubte, dass er sich für sie interessiert hatte, weil ihr Vater zur See fuhr und Paridom sich mit ihr als Ehefrau eine Art Meeresbrise in die gute Stube und zu den Segelschiffen en miniature holte. Die Fregatte Hanse würde er gewiss in Zuckerguss nachbauen. Zuvor jedoch würde er die Heimkehrer begrüßen.
Unschlüssig schritt Maria über den Marktplatz, der sich langsam leerte. Sollte sie wirklich Dineke und den anderen folgen? Oder lieber zur eigenen Aussichtsplattform hoch über der Elbe rennen, ungeachtet der Besorgungen, die sie noch erledigen musste? Vor ihrem geistigen Auge tauchte Paridom auf, der die Kinder fortscheuchte und sich bestimmt schon an der Kanone zu schaffen machte, die glänzend in der Sonne auf dem natürlichen Plateau vor ihrem Haus stand. »Ich bin der Vorposten«, würde er zu ihr sagen. Das tat er seit fast dreizehn Jahren so gut wie immer, wenn ein Schiff einlief. »Ich bin der Erste, der die Mannschaften landeinwärts empfängt.« Dann würde er einen Salut abfeuern …
In diesem Moment knallte der Schuss.
Maria nahm die Vögel wahr, die erschrocken aus einem Baum aufflogen. Dann bemerkte sie Köpfe, die sich verwundert umschauten.
Ihre Lippen bewegten sich, ohne dass sie bewusst sprach. Nach der ersten Schrecksekunde formte sie jedoch leise die Worte: »Es ist zu früh …« Und dann dachte sie, dass Paridom immer drei Schüsse zur Begrüßung abfeuerte. Auf den ersten folgte heute aber kein weiterer.
Der Einkaufskorb glitt ihr aus der Hand. Eine Kartoffel fiel heraus und rollte über das Kopfsteinpflaster.
Ohne auf die bereits erstandenen Waren zu achten, setzte sich Maria in Bewegung. Ihr Herz schlug schon bis zum Hals, bevor sie ihre Röcke raffte und zu einem schnellen Lauf ansetzte. Sie scherte sich nicht darum, dass ihre Beine bis zu den Knien für jedermann sichtbar waren. Rücksichtslos rempelte sie gegen andere Passanten.
Sie rannte wie um ihr Leben.
Kommt alle zu mir,
wenn Euch der Magen knurrt,
und ich werde Euch wiederherstellen.
Motto des Wirts Boulanger,
der 1765 das erste »Restaurant« der Welt in Paris eröffnete
Nienstedten
1
Niemand wusste, warum das Pulver zu früh explodiert war und den Schützen getroffen hatte. Vielleicht hatte Paridom die Begeisterung unvorsichtig werden lassen. Oder er war von dem Anblick der Richtung Hafen segelnden Fregatte abgelenkt worden.
Als Maria zu Hause ankam, herrschte Chaos. Der Geselle und der Lehrling waren aus der Backstube herbeigeeilt, die Magd versuchte, die jüngeren Kinder davon abzuhalten, neben ihrem sterbenden Vater Fangen zu spielen, die älteren beobachteten schockiert das Geschehen, während immer mehr Nachbarn hinzukamen, aufgeschreckt von dem Knall. Angesichts der Hausherrin traten alle plötzlich – stumm – zurück. Und es war ein Wunder, dass Maria bei all dem Blut nicht in Ohnmacht fiel. Doch die eigene Befindlichkeit kam ihr in diesem Moment nicht in den Sinn. Der sterbende Mann brauchte sie. Ihre Energie ebenso wie ihre Liebe.
Nun stand Maria in der Stube, die Paridom als Konditerei eingerichtet hatte, und strich nachdenklich über das geblähte Segel einer Kogge. Es war eine Nachbildung en miniature, in einer Reihe mit den anderen Schiffsmodellen aus seiner Herstellung. Zweifellos handelte es sich um ein besonderes Kunstwerk, mit dem er seine Sehnsucht nach der Seefahrt zu stillen versucht hatte. Am Ende hatte er seine unerfüllte Liebe mit dem Tod bezahlt.
Maria ließ von dem Zuckergussmodell der Kogge ab und drehte sich zu dem Besucher um, dessen Gegenwart sie in ihrem Rücken wie eine Bedrohung empfand. »Sie haben sich umsonst herbemüht, Herr Frese«, erklärte sie mit fester Stimme. »Ich werde den Hof nicht verkaufen. Und ich frage mich, wie Sie zu der Annahme kommen, ich würde es tun, kaum dass mein Gatte unter der Erde liegt.«
Bereits nach dem Trauergottesdienst war sie von ihren Freundinnen und Bekannten vor den Geiern gewarnt worden, die sich auf ihr Erbe stürzen würden. Das Anwesen, gelegen auf einem gewiss im Wert steigenden Grund auf der Flussseite des Dorfes, würde Begehrlichkeiten wecken. Besonders Dineke wurde nicht müde, Maria unermüdlich auf die Fremden hinzuweisen, die sich überall einzukaufen versuchten. Doch nun war es ein alter Bekannter, der ihr ein erstes Angebot unterbreitete.
Magnus Frese war groß und breit gebaut. Den erfolgreichen Gastwirt sah man ihm an. Über seinem runden Bauch, Zeugnis der guten Küche in seinem Park-Hotel in Flottbek, spannte sich die Weste. Als er die Arme ausbreitete, schien es Maria, als würden die Nähte seines schwarzen Rocks bis zum Äußersten gespannt. Noch ein Atemzug, fuhr es ihr durch den Kopf, und sie platzen.
Gerne wurde in seiner angesehenen Wirtschaft auf der anderen Seite des Flottbeker Bachs gegessen und getrunken, häufig nutzten Reisende und Ausflügler das Haus für eine Übernachtung. Diese Beliebtheit schien ihm nicht zu genügen, er ärgerte sich wohl über die wachsende Konkurrenz, die ihm in den weiter stromabwärts gelegenen Dörfern erwuchs. Offenbar meinte er, es könne sich für ihn lohnen, ihren Hof zu erwerben und zu schließen oder in eine Herberge auf eigene Rechnung zu verwandeln. Sicher bot er ihr aber zunächst einen viel zu niedrigen Preis.
»Woran halten Sie sich fest, gute Frau?«, fragte er gönnerhaft. »Das Anwesen hat in der Vergangenheit so oft den Besitzer gewechselt, dass es müßig ist, von Ehre und einer Tradition zu sprechen, die für die Nachkommen bestimmt ist.«
Leider hatte er recht. Maria war bekannt, dass es sich bei ihrem Heim um ein Spekulationsobjekt gehandelt hatte – bis es die Hamburger Witwe Magdalena Burmester vor fünfundzwanzig Jahren für immerhin dreitausend Mark als Zukunftssicherung für ihren Sohn gekauft hatte. Das viele Geld war bei Paridom gut angelegt, der hier nicht nur die Zuckerbäckerei betrieb, sondern auch eine Familie gegründet hatte. Nun war Maria seine Erbin – und aus ganzem Herzen darauf bedacht, den Nachlass für ihre Kinder zu erhalten, auch wenn Paridom nach dem Tod seiner Mutter nur zehn Jahre lang der Eigentümer gewesen war. Diese kurze Zeit war zumindest kein Grund, Freses Angebot anzunehmen.
Sie kam nicht dazu, ihn zurechtzuweisen. Die Eingangstür öffnete sich, Schritte hallten über die Fliesen, die Tür fiel mit einem dumpfen Knall ins Schloss.
»Guten Morgen, die Herrschaften. Könnte ich hier vielleicht ein Frühstück bekommen?«
Maria wandte ihren Blick zu dem Fremden. Er war nicht so groß wie Frese und von deutlich schlankerer Statur, seine Kleidung wirkte ein wenig zerknittert, die Stiefel verstaubt, offenbar hatte er eine lange Reise hinter sich. Der breitkrempige Hut warf einen Schatten auf das schmale, kantige Gesicht darunter. Als er ihn lüftete, kamen eine hohe Stirn, dunkles Haar, dichte Brauen und strahlende blaue Augen zum Vorschein. Obwohl seine Garderobe etwas heruntergekommen wirkte, war seine Haltung vorbildlich. Er trug eine Reisetasche bei sich und war sicher kein Tagelöhner, sondern ein zahlungskräftiger Kunde. Dennoch kam er ungelegen.
»Dieses ist ein Trauerhaus«, wies sie ihn seufzend ab. Dabei fühlte sie sich schlecht. Einen Gast fortzuschicken, war nicht im Sinne des Verstorbenen. Doch sie verfügte im Augenblick nicht einmal mehr über ausreichend Personal zur Bedienung oder um eine Mahlzeit zuzubereiten. Außer der Magd, die am heutigen Waschtag anderweitig beschäftigt war, und der Kinderfrau hatte Maria alle Dienstboten und Angestellten nach dem Unglück entlassen, da sie ohne Paridoms Aufsicht keine Patisserien herstellen konnte.
»Hier ist geschlossen«, blaffte Magnus Frese. »Im Dorf befinden sich vier Gastwirtschaften. Suchen Sie sich ein anderes Lokal.«
Seine Einmischung veranlasste Maria prompt zu mehr Freundlichkeit gegenüber dem anderen Mann. »Ich kann Ihnen nur einen Becher Milch und ein Stück Schwarzbrottorte anbieten, mein Herr, sonst nichts, Suppe und Grütze sind aus, belegte Brote kann ich Ihnen leider auch nicht machen lassen.«
Die Augen des Fremden wanderten von Frese zu Maria, wieder zurück und blieben schließlich an ihr hängen, wobei er wohl endlich die Witwenhaube auf ihrem hellen Haar und die schwarze Kleidung wahrnahm. Er lächelte sie an, und das Grübchen in seinem Kinn vertiefte sich. »Danke für das großzügige Angebot, Madame. Es tut mir leid, wenn ich ungelegen komme, aber da ich sehr müde und hungrig bin, nehme gerne einen Becher Milch und ein Stück Kuchen.«
Wie er dieses »Madame« aussprach! Als wohnte dem französischen Wort ein Zauber inne. Ihr unbekannter Gast schien ein Kavalier zu sein. Maria spürte ein leichtes Erröten auf ihren Wangen – und ignorierte Freses Schnauben neben sich. »Nehmen Sie bitte Platz, wo es Ihnen gefällt, Monsieur.«
Der setzte sich auf die Bank am Fenster, stellte seine Tasche daneben und deponierte seinen Hut darauf. Dann zog er ein Büchlein aus seinem Rock, blätterte darin und vertiefte sich unverzüglich in seine Lektüre. Er wirkte, als habe er sein Umfeld binnen Sekunden vergessen. Nicht einmal den schönen Blick über die Elbe schien er zu registrieren.
»Sie können die Wirtschaft nicht allein weiterführen, Maria Burmester«, zischte Frese. »Sie benötigen eine Hand, die Ihnen die Sorge um alles abnimmt.«
Sie sah ihn scharf an. »Etwa Ihre Hand?«
»Die ist besser als andere.«
»Vielleicht«, räumte sie achselzuckend ein, um dann allerdings kopfschüttelnd festzustellen: »Vielleicht aber auch nicht.«
»Der Preis, den ich zu bezahlen bereit bin, ermöglicht Ihnen ein gutes Leben.«
»Ich habe ein gutes Leben«, erwiderte sie trotzig. In Gedanken setzte sie ihre Worte in die Vergangenheit. An Paridoms Seite hatte sie ein gutes Leben geführt. In die Zukunft wagte sie noch nicht zu schauen, zu vieles musste bedacht werden, denn sie durfte sich ja nicht nur um sich selbst kümmern, sondern musste auch für das Wohl ihrer Kinder Sorge tragen.
Ohne Magnus Frese weiter zu beachten, trat sie hinter den Tresen, um ihrer Pflicht als Wirtin nachzukommen. Sie bewegte sich dabei so brüsk, dass der Saum ihres schwarzen Kleides um ihre Beine flog.
Frese hatte wohl einen Blick auf ihre Fesseln geworfen, denn er verlegte sich auf Schmeicheleien: »Sie sind eine schöne Frau, Maria, Sie sollten nicht hart arbeiten müssen …«
»Für Sie Frau Burmester«, korrigierte sie ihn scharf. »Und Sie sollten Ihre Hand anderswo anbieten, hier wird sie nicht gebraucht.«
Demonstrativ hantierte sie mit dem Milchkrug, der auf der Theke stand, und mit einem Becher, den sie aus dem Schrank dahinter nahm. Dann hob sie den Fliegenschutz, ein engmaschiges Korbgeflecht, von einer großen Platte, griff nach dem danebenliegenden Messer und schnitt eine großzügige Scheibe von dem Kuchen ab. Mit der Spitze spießte sie sie auf, um sie auf einen Teller zu legen. Erst als sie das Messer wieder fortlegte, schien sich Frese zu entspannen. Unwillkürlich lächelte sie. Glaubte dieser Dööskopp, sie wollte ihn erstechen? Was für ein Tüddelkraam!
Er stand wie ein Baum in ihrem Weg, doch Maria gelang es, sich an ihm vorbeizuschieben und die Bestellung unbeschadet an den Tisch ihres Gastes zu bringen.
Der Fremde schenkte ihr ein flüchtiges Lächeln, begleitet von einem Nicken. Dabei sah er von seinen Notizen kaum auf.
»Wohl bekomm’s«, wünschte sie. Sie zögerte einen Moment. Zu gerne hätte sie den Mann mit den strahlenden Augen in ein Gespräch verwickelt. Schon allein um Freses Aufsässigkeit zu entkommen. Aber ihr Gast schien mit sich selbst zufrieden zu sein. Sie unterdrückte ein Seufzen und wandte sich ab.
Frese stand dicht hinter ihr. »Maria«, säuselte er, »mein Verlangen gehört nicht nur dem Haus.« Offenbar war ihm die Anwesenheit des anderen gleichgültig. »Ich begehre dich.«
Was für ein unsäglich schlechtes Benehmen, fuhr es Maria durch den Kopf, Privates vor einem Gast zu offenbaren. Ganz abgesehen davon, dass es sich nicht gehörte, einer jungen Witwe so rasch nach der Beerdigung schon Avancen zu machen. Und von einer Schankhure war sie so weit entfernt wie der Mond von der Erde.
Sie schnaubte verächtlich. »Verschwinden Sie, Magnus Frese!«
»Maria«, wiederholte er und legte seine Hand auf ihren Arm.
»Was fällt Ihnen ein?«
»Ich bekomme immer, was ich möchte.«
Sie versuchte ihn abzuschütteln, doch seine Finger gruben sich in das schwarze Tuch ihres langen Ärmels und darunter in ihr Fleisch. Er tat ihr weh. Vermutlich bezweckte er das, um ihr seine Macht zu demonstrieren …
»Sie sollten die Frau loslassen«, sagte eine Stimme im Hintergrund. Es klang keinesfalls wie eine Drohung, eher wie ein freundlich geäußerter Ratschlag.
Frese ignorierte den Fremden. Sein Griff wurde noch fester, er trat so nah an Maria heran, dass er sie mit der nächsten Bewegung beinahe umklammerte.
Sie hielt den Atem an.
»Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sind Sie bereits aufgefordert worden, zu gehen«, sagte ihr Gast.
»Kümmern Sie sich um Ihre eigenen Angelegenheiten«, schnaubte Frese.
Maria wünschte, dem Fremden nicht den Rücken kehren zu müssen. Doch sie war wie gefangen hinter Magnus Freses Körper und dem Tisch. »Es ist … gut«, erklärte sie stockend und wusste selbst nicht genau, was sie eigentlich meinte, denn eigentlich war gar nichts in Ordnung. Sie hasste Schwäche und wünschte, sich aus eigener Kraft befreien zu können. Doch das war unmöglich.
»Es wäre sehr freundlich von Ihnen, wenn Sie mich mein Frühstück in Ruhe genießen lassen könnten, Monsieur. Auseinandersetzungen verderben leider den Geschmack. Und das wäre schade. Dieser Kuchen ist ganz hervorragend.«
Die Süffisanz, mit der ihr Gast sprach, hätte Maria unter anderen Umständen amüsiert. Ihr erster Eindruck hatte sie nicht getäuscht – er war ein kultivierter Mann. Wäre sie etwas weniger bedrängt, hätte sie über seine feine Ironie gelächelt. Immerhin fühlte sie sich durch seinen Schutz sicherer. »Gehen Sie endlich!«, fauchte sie.
Magnus Frese ließ sich Zeit. Sein Blick ruhte lange auf Marias Gesicht, und sie senkte die Lider, weil sie ihm nicht in die Augen sehen wollte. Stattdessen hob sie ihr Kinn und straffte die Schultern. Sicher hatte er nicht erwartet, dass ihr jemand zu Hilfe eilen würde. Glücklicherweise kapitulierte er und ließ es nicht auf einen Streit mit dem Gast ankommen. Er lockerte seinen Griff so plötzlich und trat einen großen Schritt von ihr fort, dass sie gegen ein Taumeln ankämpfen musste.
»Adieu, Monsieur«, sagte der Fremde hinter ihr.
Zweifellos ging Frese ein Fluch durch den Kopf. Seine Wangen röteten sich, eine Ader an seiner Schläfe trat blau und pochend hervor. Stumm wandte er sich ab. Er nahm seinen Hut vom Haken neben dem Eingang. Bevor er hinausging, sah er zu Maria, die sich nicht gerührt hatte. »Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen«, schmetterte er ihr entgegen. »Ich komme wieder.« Den Gast missachtete er. Mit einem lauten Knall fiel die Tür hinter Frese ins Schloss.
Maria zuckte zusammen.
Nach ein paar Atemzügen hatte sie sich wieder gefasst. Sie drehte sich langsam zu dem Herrn hinter ihr um. Der hatte sich neben dem Tresen aufgebaut.
»Es tut mir leid«, hob sie an und spürte tatsächlich mehr Verlegenheit als Dankbarkeit für seine Ritterlichkeit, »dass Sie Zeuge dieses Auftritts geworden sind.«
Er schüttelte den Kopf. »Für mich war es eine Erfahrung. Man hat mir gesagt, die Menschen im Norden seien nicht besonders feurig. Offenbar ein Irrtum.«
Seit wann ist Temperament ein Synonym für Raffgier?, fuhr es ihr durch den Kopf. Laut sagte sie: »Bitte nehmen Sie wieder Platz und genießen Sie das Frühstück.«
Er folgte ihrer Aufforderung. »Hätten Sie vielleicht noch ein Stück von diesem köstlichen Kuchen?«
»Es freut mich, dass er Ihnen schmeckt. Ich habe ihn nach einem Rezept meines verstorbenen Mannes gebacken.« Ein kleiner Seufzer schloss sich an. Sie vermisste Paridom so sehr. Sein Talent. Seine Verrücktheiten, die sie meistens zum Lachen gebracht hatten. Seinen Schutz.
Sie bemerkte den aufmerksamen, etwas neugierigen Blick ihres Gastes und wandte sich ab. Mit geübten Handgriffen führte sie seine Bestellung aus. Als sie das zweite Stück Kuchen vor ihn hinstellte, war er erneut in seine Lektüre versunken.
Nachdem der Herr gegangen war, fühlte sich Maria seltsam alleingelassen. Das war natürlich albern, da sie mit ihm kein persönliches Wort mehr gewechselt hatte. Aber es kam ihr vor, als sei mit ihm ein Sonnenstrahl in die Gaststube gedrungen, der nun wieder verschwunden war. Der Raum fühlte sich kalt und verlassen an. Unwillkürlich schlang sie die Arme um ihren Oberkörper, während sie hinter der Tür stand, ratlos, was sie als Nächstes tun sollte. Dabei hatte sie – weiß Gott! – genug zu erledigen.
Paridom hatte seine Bücher schlecht geführt. In seiner Seele schlummerte wohl mehr von einem Künstler, als Maria erwartet hatte. Jeden Tag musste sie sich inzwischen dazu zwingen, dem Durcheinander auf seinem Schreibtisch Herr zu werden, Briefe, Rechnungen und Aufträge an Lieferanten zu sortieren, Zahlungen zu kontrollieren und offene Beträge zusammenzuzählen. Es war eine Arbeit, die sie hasste, die aber notwendig war, um die offenen Verbindlichkeiten zu berechnen. Manche Nacht konnte sie nicht schlafen aus Angst vor einem Schuldenberg, den sie nicht zu bewältigen imstande sein würde. Der Verkauf des Anwesens war nicht ganz so unwahrscheinlich wie sie Magnus Frese weisgemacht hatte.
Natürlich musste sie auch das Wohl ihrer Kinder berücksichtigen. Immanuel, ihr zwölf Jahre alter Erstgeborener, besuchte ein privates Institut für Knaben in Hamburg. Paridom hatte sich für ihn eine Zukunft als Kaufmann vorgestellt, als einer, der in Übersee gute Geschäfte machte. Seit der Unabhängigkeitserklärung der Amerikaner litten die Hamburger nicht mehr unter den Monopolen der Briten, Franzosen und Holländer, die keinem fremden Schiff den Warentransport aus ihren Kolonien erlaubten. Dadurch öffneten sich neue Möglichkeiten, die wohl zu enormen Gewinnen führten. Die neuen Landhäuser an der Elbe erzählten von diesem Reichtum.
Für Elisabeth und Antoinette hätte Paridom wohlhabende, treusorgende Ehemänner ausgewählt, doch die Töchter waren augenblicklich mit zehn und neun Jahren gerade einmal alt genug für einen Lehrer. Selbst für die Älteste würde von einem Bräutigam noch lange keine Rede sein. Vielleicht würde Jean eines Tages der nächste Zuckerbäcker werden, aber wer konnte schon sagen, ob der Sechsjährige das Talent seines Vaters geerbt hatte? Oder lag es dem Kleinsten im Blut, so wohlschmeckendes Backwerk herzustellen und aus Zucker Kunstwerke zu modellieren? Nicolaus, der den zweiten Namen seines Vaters trug und erst drei Jahre alt war. Rasch wischte sich Maria die erste der aufsteigenden Tränen aus dem Augenwinkel.
Das Schicksal ihres Erbes lag in Gottes Hand – und ganz gewiss nicht in Magnus Freses. Der sollte man nicht meinen, er sei etwas Besseres, weil er einen dicken Wanst vor sich hertrug.
Einem plötzlichen Einfall folgend, nahm sie den eisernen Schlüssel aus einer Schublade und versperrte damit den Eingang. Wahrscheinlich würde Frese durch die Hintertür hereinkommen, wenn er denn unbedingt zu ihr wollte, doch sie fühlte sich wohler, solange sie seinen unverschämten Forderungen wenigstens an einer Stelle einen Riegel vorschob.
2
Als sie sich am darauffolgenden Sonntag zum Gottesdienst aufmachte, hatte sie die Inventur von Paridoms Besitz noch lange nicht abgeschlossen. Da es bis zum Konfirmandenunterricht ihrer Kinder noch dauerte, war sie – wie immer in den vergangenen Wochen – allein unterwegs.
Unter den herbeiströmenden Gemeindemitgliedern suchte Maria nach dem Gesicht von Magnus Frese. Dass er sie nach seinem Besuch neulich in Ruhe gelassen hatte, verunsicherte sie. Sie war überzeugt davon, dass er sein Ziel noch nicht aufgegeben hatte. Eine überraschende Begegnung im Kirchhof und eine womöglich kompromittierende Situation könnten ihm dem vielleicht näher bringen, wer wusste das schon? Er gehörte dem Wohnsitz nach zwar dem Kirchspiel Ottensen an, doch sie befürchtete, er würde ihr bis zum Abendmahl folgen, wenn es denn nützlich für ihn sein könnte. Sie traute ihm alles zu. Allerdings ließ er sich heute nicht blicken.
Die schöne Fachwerkkirche und der sie umgebende kleine Friedhof lagen nur wenige Schritte vom Hof der Burmesters entfernt auf der anderen Seite des Heerweges. Früher waren Maria und Paridom häufig erst mit dem letzten Glockenschlag über die Straße geeilt und hatten gerade noch pünktlich in einer der Bänke Platz genommen. Seit seinem Tod brauchte sie nicht mehr darauf zu achten, dass alles vorbereitet sein würde für Gäste, die nach Segen und Schlusslied in die Bäckerei kamen – alle Dorfbewohner wussten von dem Trauerfall und der Schließung der Lokalität, niemand klopfte an ihre Tür. Auch der freundliche Monsieur von neulich war wohl nur auf der Durchreise gewesen und nicht wiedergekommen.
Nachbarn grüßten Maria höflich, manch eine Frau blieb stehen, um sich nach ihrem Befinden zu erkundigen. Dann lächelte sie still, bedankte sich und dachte, dass sie ihre Sorgen selbst gegenüber der wohlmeinendsten Bekannten ja doch für sich behalten musste. Klatsch war ihre Sache nicht. Dumm Tüch war das Letzte, was sie in ihrer Situation gebrauchen konnte.
Eine heranrollende Kutsche lenkte die Aufmerksamkeit der Kirchgänger ab. Ebenfalls neugierig, beobachtete Maria, wie der Einspänner vor dem Südportal vom Fahrer gezügelt wurde. Der elegant gekleidete Herr, der dem Wagen entstieg, ohne auf die Hilfe des Lakaien zu achten, war kein Unbekannter: Es handelte sich um jenen Joachim Graaf, dessen Landkäufe Dinekes böseste Ahnungen hervorriefen. Maria erinnerte sich genau an seine Blicke auf dem Markt. Ein paar Minuten nur, bevor der Schuss aus Paridoms Kanone ihr Leben von Grund auf verändert hatte. Allein wegen des Zusammentreffens der Ereignisse würde sie diesen Herrn niemals vergessen. Seit damals hatte sie ihn jedoch nicht wiedergesehen. Offenbar nahm er heute zum ersten Mal am Gottesdienst von Pastor Matthiesen teil.
Überrascht registrierte Maria seinen Begleiter. Nach Graaf kletterte ein zweiter Mann aus dem Wagen – und der ließ sie nach Luft schnappen. Es war der Gast, dem sie neulich das improvisierte Frühstück serviert hatte. Seine Kleidung war weniger verstaubt und dieses Mal von ausgezeichnetem Schnitt und Tuch, sein dunkles Haar unter seinem Hut womöglich gepudert, sie konnte es nicht genau sehen. Er wirkte nicht weniger vornehm als sein Gefährte. Ein echter Monsieur eben.
Die beiden Männer sorgten für reichlich Aufsehen unter den Dorfbewohnern. Das allgemeine Geschnatter nahm zu, und Maria wünschte, sie stünde näher bei den Klatschbasen, aber außer einem Raunen, das wie das Rauschen einer Welle klang, verstand sie nicht, was sich die Leute über die Neuankömmlinge erzählten. Die Männer und Frauen, die sich in Gruppen am Portal unter der Sonnenuhr versammelt hatten, traten ehrfürchtig wie bei einem Spalier zur Seite. Unwillkürlich fand sich Maria mitten im Weg. Hastig wich sie ebenfalls zurück.
»Guten Morgen, Madame.«
Sie sah in die strahlend blauen Augen.
»Moin«, gab sie knapp zurück.
Ihre Bekanntschaft war zweifellos die Attraktion der Gemeinde. Sie brauchte nicht erst zu ihren Nachbarn hinzusehen, um das zu wissen, die Neugier schwang in der Luft wie das Flirren der Sonne. Mit einem Lächeln, das sie dem Fremden gerne geschenkt hätte, würde sie noch mehr auffallen. Deshalb verkniff sie es sich.
»Haben Sie die Gaststube wieder geöffnet?«, hob der Fremde an.
»Ich bedauere. Es ist noch geschlossen.«
»Wie schade. Die Aussicht, nach dem Kirchgang bei Ihnen einkehren und den Kuchen erneut probieren zu dürfen, hat mich beflügelt.«
»Der Kuchen ist leider aus.«
»Hoffentlich bewirten Sie bald wieder Gäste …«
Maria senkte sittsam den Kopf. Während sie auf die Spitzen ihrer Schnürstiefel sah, dachte sie, dass sie derselben Hoffnung war. Ihre Möglichkeiten waren momentan jedoch begrenzt.
»Jacques!« Eine Männerstimme drang über den Kirchhof, unterbrochen von dem Geläut der Glocken. »Kommen Sie her. Ich möchte Sie mit der Frau Pastor bekannt machen.«
Obwohl Graafs Aufforderung wie ein Befehl geklungen hatte, rief der Fremde zurück. »Bitte, einen Moment noch.« An Maria gewandt fügte er hinzu: »Ich würde mich Ihnen gerne vorstellen … und da niemand da ist, der das für mich übernimmt, tue ich es selbst: Mein Name ist Daniel Louis Jacques.«
Tatsächlich ein Franzose. Deshalb klang das Wort Madame aus seinem Mund so viel magischer als von den Lippen eines Elbländers. Wenn Dineke mit ihrer Meinung über die Sitten der Flüchtlinge recht hatte, sollte sich Maria allerdings fernhalten von diesem Mann. Sein Charisma könnte Verwirrung in den Gedanken einer jungen Witwe stiften, die Leichtsinnigkeit seiner Kultur bezaubern, das Fremdländische für Abwechslung sorgen. Doch von alldem wollte sie nichts wissen. Sie vermisste Paridom aus ganzem Herzen – und war gerade deshalb anfällig für all das, was Daniel Louis Jacques für sie verkörperte.
Nach einem Moment unruhiger Sprachlosigkeit besann sich Maria der guten Sitten und knickste leicht. Ihren Namen nannte sie nicht.
»Jacques!« Graafs Stimme donnerte wie ein Gewitter.
»Stets zu Ihren Diensten, Madame.« Daniel Louis Jacques verneigte sich vor ihr. Dann drehte er sich nach seinem Begleiter um.
Joachim Graaf verweilte neben Dineke Matthiesen, die sich zur Begrüßung der Gemeinde neben dem Eingang der Kirche aufgebaut hatte. Ihr Mann arbeitete wahrscheinlich noch an seiner Predigt – von dem war nichts zu sehen. Dineke strahlte und fühlte sich offensichtlich wie die Königin von Nienstedten. Ihre Vorbehalte, sofern sie diese gegen den neuen Anwohner noch immer umtrieben, ließ sie sich nicht anmerken.
Die Blicke der Gemeindemitglieder wanderten von den beiden Fremden zu Maria. Sicher ging allen die Frage durch den Kopf, woher sie den fremden Herrn kannte. Schlimmer noch. Als sie genau hinsah, bemerkte sie, dass Daniel Louis Jacques und Joachim Graaf nicht mehr mit Dineke sprachen, sondern ein paar leise Worte untereinander wechselten. Dabei galt die Aufmerksamkeit der beiden zweifellos ihrer Person. Sie redeten eindeutig über sie.
Hocherhobenen Hauptes stand sie da in ihrem schwarzen Kleid und der schwarzen Witwenhaube auf dem goldblonden Haar und ließ es geschehen. Sich verlegen zurückzuziehen, war ihre Sache nicht. Trotzig erwiderte sie die neugierigen Blicke ihrer Nachbarn und war gleichzeitig dankbar, dass sie niemand nach ihrer Bekanntschaft mit dem Fremden fragte. So harmlos ihre Begegnung auch war, es gefiel ihr nicht, diese vor den anderen breittreten zu müssen.
Der Klang der Orgel beendete die Szene. Das Vorspiel rief die Gemeinde zum Gottesdienst. Nach und nach schickten sich die Gläubigen an, in den Saalbau mit seinen Säulen und zweigeschossigen Emporen zu gelangen, die Sitzordnung nach Stand und Geschlechterzugehörigkeit in den Bänken streng einhaltend. Maria nahm ihren gewohnten Platz am Altar ein. Paridom Burmester war ein sehr angesehener Mann gewesen, sogar der britische Ministerresident in Hamburg war als Pate zur Taufe von Immanuel angereist. Diese Prominenz übertrug sich auf Paridoms Gemahlin und Witwe. Maria saß deshalb in direkter Sichtweite zu den seitlich gelegenen Betstühlen der Honoratioren. Wenig überraschend reihten sich dort der neue Landbesitzer und sein französischer Freund ein.
Während des Eingangslieds sah Maria verstohlen hinüber. Joachim Graaf und Daniel Louis Jacques sangen voller Inbrunst mit. Auch das »Amen« nach dem Votum fiel so nachdrücklich aus, dass sie glaubte, Jacques’ Stimme im Chor der Gemeinde ausmachen zu können. Im nächsten Moment schalt sie sich für ihre Überlegung. Was ging es sie an, ob er laut oder leise sang, deutlich oder verhalten sprach?
Um sich abzulenken, konzentrierte sie sich auf den Pastor. Der war ein liebenswürdiger Mann, der in Nienstedten besser verdiente als in seinen früheren Gemeinden und sich mit Dineke ein angenehmes Leben eingerichtet hatte. Die beiden hatten keinen Nachwuchs, nur sich, und Maria dachte, welch Trost es ihr war, zu wissen, dass Paridom in seinen Kindern weiterleben würde. Vielleicht würde Immanuel ja doch einen guten Zuckerbäcker abgeben. Wer wusste das schon? Paridoms Vater war ebenfalls Konditor gewesen. Es war natürlich die naheliegendste Lösung, ihren Ältesten von der Schule zu nehmen und in die Lehre zu geben. Preiswerter war es sicher. Vielleicht hatte sich Paridom ja geirrt, und aus Immanuel würde kein erfolgreicher Kaufmann werden. Die gebildeten Männer in ihrem Umfeld sprachen von neuen Erziehungs- und Unterrichtsmethoden, die das tief verwurzelte Können eines Kindes in Betracht zogen, anstatt nur die Pläne der Väter zu berücksichtigen. Maria beschloss, mit seinem Lehrer über Immanuels Begabung sprechen. Noch etwas, das wichtig für die Zukunft war. Für die ihres Sohnes – wie für ihre eigene.
Hamburg
3
»Wenn Sie nicht um dieses Gespräch ersucht hätten, wäre ich nicht umhingekommen, Sie einzuladen«, erklärte Schuldirektor Gröning statt einer Begrüßung. Er wies auf den Besucherstuhl. »Bitte, nehmen Sie Platz.«
Beklommen sah sich Maria in dem Büro um. Es war ein kleiner Raum mit einem Fenster, das trotz des außerhalb des Hauses herrschenden Sommerwetters wenig Licht hereinließ, weshalb wohl überall Kandelaber herumstanden, deren Kerzen im Bedarfsfall entzündet werden konnten: auf den zahlreichen Bücherstapeln, dem Kaminsims und auf dem mit Mappen, Akten und Kladden überladenen Schreibtisch, hinter den der drahtige Mann sich nun seinerseits setzte. Es roch ein wenig muffig, und Maria fühlte sich deshalb und wegen der eingeschränkten Räumlichkeiten an den Schimmel und Moder der Armenschulen erinnert. Dabei handelte es sich hier um ein reformpädagogisches Institut mit modernsten Erziehungsmethoden, untergebracht in einem alten Gebäude in einer ansonsten mit schönen Villen bebauten Garten- und Landschaftssiedlung im Marschlande von Hammerbrook.
Sie selbst war zwar von einem Privatlehrer unterrichtet worden, und auch ihre Töchter wurden entsprechend gefördert, die Armenschulen waren ihr aber dennoch nicht fremd, denn Paridom hatte die Kinder in Einrichtungen des Kirchspiels Nienstedten in der Weihnachtszeit mit kostenlosem Gebäck beliefert, und sie hatte ihn häufig begleitet. Hoffentlich gestattete ihm Gott dank dieser und anderer Wohltätigkeiten einen besonderen Platz im Himmel.
Es kostete sie einige Mühe, sich zu konzentrieren. Doch Maria nahm sich trotz aufsteigender Kopfschmerzen zusammen. Dieses namhafte Knabeninstitut für die Söhne aus wohlhabenden Kreisen hatte nichts mit den Volksschulen zu tun, in denen Jungen und Mädchen aus mittellosen Familien Grundkenntnisse im Lesen, Schreiben und Rechnen beigebracht wurden, ohne dass die Eltern dafür bezahlen mussten. Paridom hatte immer wieder betont, dass der Schulleiter hier moderne Pädagogik propagierte, etwa den Rohrstock durch Leibesübungen ersetzte. Die Idee, Sport statt Prügel zu verabreichen, war etwas vollkommen Neues, und sie hatte ihren Gatten ebenso beeindruckt wie sie selbst.
Grönings Stimme allerdings klang wenig zuversichtlich. Womöglich kamen die von dem Institutsgründer eingeführten Reformen nicht bei jedem Jungen an. Doch Immanuel war nicht jeder Junge – er war ihr Sohn!
Maria setzte sich so steif auf den Stuhl, als hätte sie die Birkenrute des Lehrers verschluckt. »Was ist passiert?«
»Natürlich wäre es besser, ich könnte dieses Gespräch mit Ihrem Gatten …«
»Der ist, wie Sie sehr wohl wissen, nicht mehr am Leben«, fiel Maria ihm energisch ins Wort, »deshalb müssen Sie nun mit mir vorliebnehmen. Aber machen Sie sich keine Sorgen, Herr Gröning, ich bin nicht zimperlich.« Beinahe hätte sie gesagt, sie sei nicht aus Zucker, konnte sich allerdings gerade noch auf die Zunge beißen. Diese Metapher erschien ihr angesichts des Berufs des armen Paridom nicht passend.
»Ja. Natürlich. Mein Beileid. Ich bedauere …«, er unterbrach sich. Offensichtlich hatte sie ihn mit ihrem Einwand aus seinem Konzept gebracht.
Stumm wartete sie darauf, dass er seine Fassung wiedergewann.
Seufzend fuhr er fort: »Immanuel zeigt ein ausgesprochen aufsässiges Verhalten. Er stiftet die anderen Knaben zu Ungehörigkeiten an und zankt sich in nicht hinnehmbarer Weise mit einem neuen Mitschüler.«
Der Junge, den der Schulleiter beschrieb, konnte nicht Immanuel Burmester sein. Lag hier eine Verwechslung vor? Immanuel war ein liebenswürdiges Kind, aufgeweckt, doch stets darum bemüht, alles richtig zu machen und vor allem seiner Mutter Freude zu bereiten. Anlässlich Paridoms Beerdigung hatte er schulfrei bekommen, an jenem Tag hatte Maria ihren Sohn zuletzt gesehen. Wie konnte es sein, dass er sich binnen weniger Wochen dermaßen verändert hatte?
»Nächste Woche beginnen die Sommerferien«, fuhr Gröning fort. »Wenn sich Immanuels Verhalten bis dahin nicht ändert, darf er mit den anderen Schülern nicht an das Institut zurückkehren. Das muss ich Ihnen leider in aller Deutlichkeit sagen.«
Maria schluckte. »Was ist passiert?«, wiederholte sie tonlos.
»Immanuel spielt die Französische Revolution nach!«
Der Lacher, der in ihr aufstieg, blieb ihr in der Kehle stecken. Gröning war nicht zu Späßen aufgelegt, das sah sie seiner Miene an, in der sich Ärger und Enttäuschung spiegelten. Allerdings konnte sie sich kaum vorstellen, dass der Ruf nach Gleichheit und Brüderlichkeit für den Schulleiter ein Vergehen darstellte. Gerade im bürgerlichen Hamburg besaßen die Jakobiner ein großes Ansehen. In Dänemark und damit in Schleswig und Holstein lag die Situation zwar anders, aber seit Kronprinz Friedrich die Regentschaft für seinen Vater König Christian VII. übernommen hatte, erlebte das Königreich einen neuen Aufschwung. Doch waren das Themen, mit denen sich ein Zwölfjähriger beschäftigte? Was wusste ein Knabe dieses Alters schon von der Revolution in Paris, die sich demnächst jährte? Außer vielleicht, dass es Proteste gegen die Obrigkeit gegeben hatte. Offenbar probte Immanuel den Aufstand gegen irgendeine Ungerechtigkeit. Das konnte von den Lehrern natürlich nicht toleriert werden. Dennoch nötigte Immanuels unerwarteter Kampfesgeist seiner Mutter ein Lächeln ab.
»Traditionell hat der Adel in Hamburg keine Vorrechte«, dozierte der Schulleiter. »Wie Sie sicher wissen, besitzen Adelige hierzulande nicht einmal die obligatorischen Bürgerrechte der Hanseaten …«
»Das ist mir bekannt.«, warf Maria ein. »Ich glaube jedoch, dass Immanuels Kenntnisse über Politik nicht so umfassend sind. Was hat das denn mit ihm zu tun?«
»Lassen Sie mich bitte noch etwas ausholen: Ein Schüler wie Amadeus von Wedekind genießt unter meiner Leitung dieselben Privilegien wie ein Immanuel Burmester. Doch scheint Immanuel davon keine Kenntnis zu nehmen. Sonst würde er kaum eine Art Revolution gegen den Adel anzetteln und Amadeus von Wedekind zu seinem Feind erklären wollen.«
»Große Worte für ein harmloses Geplänkel unter kleinen Jungen«, entfuhr es Maria, bevor sie sich bremsen konnte.
»Sie scheinen Immanuel zu unterschätzen«, widersprach Gröning.
Maria öffnete den Mund, um nach dem Grund für diese Annahme zu fragen, kam jedoch nicht weiter. In diesem Moment flog die Zimmertür auf – und wie eine Brise an einem schwülen Tag wehte ein frischer Frühlingsduft herein.
Mit dem Aroma von Hyazinthen und Maiglöckchen erschien eine Frau in dem kleinen Schreibzimmer, die jedoch mehr einer Furie glich als einer Botin des Frühlings. Der nur mittelgroßen, dunklen Person in einem hervorragend geschnittenen, zitronengelben Sommerkostüm mit passendem Hut folgte – nicht weniger aufgebracht – der Pedell des Internats. »Ich konnte sie nicht aufhalten«, klagte der Hausmeister, obwohl er fast doppelt so groß und mindestens doppelt so breit wie die Besucherin war. Dabei keuchte er vor Anstrengung – und vielleicht auch vor Zorn über die eigene Unzulänglichkeit oder die Unverfrorenheit der Frau.
»Frau von Wedekind …!«, rief Gröning irritiert aus.
Die Fremde würdigte Maria keines Blicks, als sie vor den Schreibtisch trat und den Schulleiter anherrschte: »Ist es richtig, dass meinem Sohn die Finger gebrochen wurden?«
»Nicht alle Finger. Immanuel Burmester hat nur den Daumen …«
»Was?« Marias Frage war blankes Entsetzen.
»Das spielt keine Rolle. Ich verlange sofortige Satisfaktion!« Die andere Mutter stemmte die Hände in die Hüften, als wäre sie eine einfache Wäscherin und keine Dame mit vornehmen Namen.
»Wollen Sie mich zum Duell fordern?«, gab Maria zurück.
Die Wedekind fuhr zu ihr herum. Verblüfft starrte sie sie an. Offensichtlich nahm sie erst jetzt wahr, dass sich eine weitere Person im Zimmer befand.
»Herr Direktor, kann ich gehen?«, wollte der Pedell in die plötzlich entstandene Stille wissen.
»Gehen Sie nur«, antwortete Gröning mit fester Stimme, »ich komme schon allein zurecht.«
Während sich der Hausmeister – vermutlich erleichtert – zurückzog, sah die Wedekind Maria direkt in die Augen und fragte scharf: »Was geht Sie mein Sohn an?«
Dieser unerbittliche Blick nahm Maria seltsamerweise für die andere Frau ein. Da stand eine Mutter, die sich vor ihr Kind stellte, ebenso wie Maria das tat. Ob dieses Verhalten gerechtfertigt war, erschloss sich Maria nicht. Noch nicht, dachte sie und hob sachlich an: »Wie mir scheint, handelte es sich um eine Auseinandersetzung zwischen unseren Söhnen.«
»Frau von Wedekind«, mischte sich der Schulleiter ein, »ich hatte Sie nicht erwartet. Gerade hatte ich begonnen, die Angelegenheit mit Frau Burmester zu diskutieren. Vielleicht möchten Sie später noch einmal mit Ihrem Gatten …«
»Was hat mein Mann damit zu tun? Er befindet sich auf Reisen und hat die gebrochenen Finger …«, sie räusperte sich und fügte weniger herrisch hinzu: »Er hat den gebrochenen Daumen noch nicht einmal selbst diagnostiziert. Diese Pflicht oblag seinem Assistenten.«
Bevor Gröning antworten konnte, wandte sie sich wieder an Maria: »Wissen Sie eigentlich, welchen Schaden Ihr verdorbenes Kind angerichtet hat …?«
»Ich muss doch sehr bitten!« Unwillkürlich setzte sich Maria noch ein wenig aufrechter.
»Amadeus spielt seit frühester Kindheit Klavier. Die größten Lehrer haben ihm Talent bescheinigt, sogar Georg Michael Telemann zeigte sich bei unserem Aufenthalt in Riga angetan von einem spontanen Konzert. Der Herr ist Ihnen als Enkel des Hamburger Musikdirektors Georg Philipp Telemann gewiss ein Begriff …«
Maria quittierte die herablassende Bemerkung mit einem entnervten Räuspern.
»Eine Verletzung der Hände ist für diese Begabung eine Katastrophe! Ihr Junge hat die Zukunft meines Sohnes ruiniert!«
»Frau Burmester«, wandte Gröning matt sein, »darf ich Ihnen Frau von Wedekind vorstellen?«
Keine der beiden Frauen reagierte auf die Floskel. Stattdessen sahen sie einander an wie zwei Kampfhennen.
Schließlich stieß die Wedekind hervor: »Ich wünschte, die Hanseaten wären nicht so stolz auf ihre bürgerliche Gesellschaft. Dann wäre es Amadeus erlaubt worden, eine seinem Talent entsprechende Ausbildung am Johanneum zu absolvieren.«
Wenn er auf Streit aus ist, sind seine Finger dort aber auch nicht sicherer, fuhr es Maria grimmig durch den Kopf. Rasch biss sie sich auf die Zunge, um einen ungeschickten Kommentar zu verhindern. Während sie den Schulleiter ansah, dessen Gesicht eine ungesunde rote Farbe annahm, dachte sie, dass der Grund der offenbar recht heftigen Reiberei doch eigentlich die entscheidende Frage war. Jungen stritten sich, Schulkameraden allemal, das war so und würde immer so bleiben. Aber ebenso rasch vertrugen sie sich meist auch. Dass die Französische Revolution bei den beiden Knaben eine Rolle gespielt haben sollte, konnte sie sich noch immer nicht vorstellen. Taugte der Sturm auf die Bastille Immanuel wirklich als Vorbild für eine Handgreiflichkeit? Bürger gegen Adel als Abwandlung von Räuber und Gendarm? Das erschien ihr absurd. Maria wünschte, sie wüsste mehr über die Hintergründe, aber es war ihr klar, dass sie angesichts der aufgeregten anderen Mutter kaum etwas erfahren würde. »Was soll nun geschehen?« fragte sie knapp.
Der Schulleiter warf ihr einen dankbaren Blick zu. »Ich schlage vor, dass Sie die Ferien nutzen, auf Immanuel einzuwirken. Außer einer täglich zusätzlichen sportlichen Ertüchtigung unterliegt er einem Stubenarrest und der doppelten Zuteilung der Hausaufgaben. Wenn er sich einsichtig zeigt, kann er an das Institut zurückkehren.«
»Sind seine schulischen Leistungen denn so, dass diese Rückkehr Sinn ergibt?« Das war die Frage, für deren Beantwortung sie hierhergekommen war. Für einen kurzen Moment hatte Maria die andere Frau und den Grund ihres Hierseins vergessen.
»Ich bitte Sie«, protestierte die Wedekind mit erhobener Stimme, »können Sie dieses Gespräch nicht unter vier Augen führen? Mich interessieren die Kenntnisse Ihres Sohnes nicht. Ich bestehe darauf, dass er des Internats verwiesen wird. Und zwar sofort!«
Die Verletzung des offenbar musikalisch sehr talentierten Jungen tat Maria leid, aber sie sah darin keine Rechtfertigung für einen Schulverweis. Außerdem war ja noch nicht geklärt, ob Immanuel der einzige Übeltäter war oder sich von Amadeus hatte provozieren lassen. »Ich möchte den Vorschlag von Herrn Direktor Gröning annehmen«, erklärte sie ruhig. »Es ist ein Unrecht geschehen, und das sollte durch Immanuels Einsichtigkeit geklärt werden, nicht durch eine weitere Ungerechtigkeit. Wenn ich es richtig verstanden habe, sind die Folgen der Verletzung ja wohl bisher noch nicht eindeutig absehbar.«
»Papperlapapp!« schnaubte die Wedekind. »Bis zum nächsten Mittwoch wird er keinesfalls wiederhergestellt sein.«
Maria und Gröning sahen sie erwartungsvoll an.
»Amadeus wurde die Ehre zuteil, auf dem Freiheitsfest anlässlich des vierzehnten Juli aufspielen zu dürfen. Mit einer Handschiene kann er es nicht. Und Ihr Sohn«, die Wedekind deutete recht undamenhaft mit dem Zeigefinger auf Marias Brust, ihr Ton klang wie ein Kreischen, »trägt die Schuld daran!«
»Das ist natürlich sehr bedauerlich, aber ich muss Sie bitten, die Contenance zu wahren«, mahnte der Schulleiter.
Langsam erhob sich Maria von ihrem Platz. Es war alles gesagt, und sie hatte ohnehin genug von dieser Frau. Als sie nun neben der anderen stand, überragte sie sie um Haupteslänge. Die Wedekind sah mit einem arroganten Blick zu ihr auf. Maria nickte ihr zu, bevor sie sich an Gröning wandte: »Ich bin sicher, alle Beteiligten werden aus diesem Vorfall lernen. Insbesondere Immanuel. Wir sehen uns an seinem letzten Schultag wieder, ich werde ihn abholen.«
»Sie können doch jetzt nicht einfach gehen!«, protestierte die Wedekind. »Es ist doch noch gar nichts hinsichtlich der Zukunft meines Jungen geklärt.«
»Adieu, Frau Wedekind.« Maria nickte in die jeweilige Richtung. »Auf Wiedersehen, Herr Gröning.« Als sie den beiden den Rücken kehrte und die Hand auf die Türklinke legte, gestattete sie sich den ersten tiefen Atemzug. Mit einem Mal waren die Kopfschmerzen so stark, dass sie ihren Schädel zu zerreißen drohten.
4
Nach dem unangenehmen Gespräch in der engen Schreibstube sehnte sich Maria nach einem Spaziergang an frischer Luft. Glücklicherweise gab es in dieser Gegend viele Gärten, die von Fleeten durchzogen waren und an denen es dank der lockeren Bebauung nicht so entsetzlich nach Abwasser und Müll roch wie im Sommer in der Enge der Innenstadt. Es war diese faulige Schwüle, die viele Hanseaten in neue Landhäuser nach Hamm und Billwärder und neuerdings eben auch westlich elbabwärts trieb – oder wenigstens als Ausflügler in die Gartenlokale strömen ließ. Da hatte Marias Freundin Dineke vollkommen recht.
Und ich kann davon nicht profitieren, dachte Maria bitter, während sie unter Birnen- und Apfelbäumen Richtung St. Georg wanderte. Zumindest konnte sie an der Landflucht nicht verdienen wie zu Paridoms Lebzeiten. Burmesters Backstube war geschlossen, und wenn sie sich nicht bald etwas einfallen ließ, verging der Sommer, ohne dass sie auch nur eine Krone verdiente. Aber wie sollte sie ohne ausreichende Mittel ein mit Schulden belastetes Geschäft eröffnen? War der Verkauf des Hofes an Magnus Frese nicht doch der bessere Ausweg aus ihren Sorgen, als verzweifelt abzuwarten, dass ein Wunder geschah?
Während sie langsam ihres Weges ging, wanderten ihre Gedanken zu Immanuel, ihrem ungestümen, anscheinend ruppigen Ältesten. Ein hitziges Gemüt machte weder einen Bäcker noch einen Wirt aus ihm. Vielleicht aber einen Kaufmann, denn ohne eine gewisse Risikobereitschaft würde er es im Handel nicht weit bringen. Immerhin hatte der Institutsleiter nicht von einer mangelnden Begabung Immanuels gesprochen. Dass der Junge vor dem höheren Bildungsweg bei einem Lehrherrn besser aufgehoben sein könnte, war kein Thema gewesen. Erwiesen sich Paridoms Pläne nun als richtig?
Die Sache mit Amadeus von Wedekind war jedoch ein starkes Stück. Fern des Schulgebäudes, des Direktors und der aufgebrachten anderen Mutter gestand sich Maria ein, dass ihr Sohn grundlegend falsch gehandelt hatte. Sie würde ihm gehörig die Leviten lesen, das stand fest. Wenn es sein Vater täte, wäre dies zweifellos nachhaltiger, doch Immanuel würde ihr Durchsetzungsvermögen schon noch kennenlernen …
»Uppassen, Wief!«
Völlig in ihre Gedanken versunken, hörte Maria zwar den Ruf, nahm auch das Knarren von Rädern wahr – beides jedoch zu spät.
Zuerst war es, als treffe nur ein Schlag ihre Schulter. Dann griff ein Schmerz nach ihrem Körper, der ihr den Atem raubte und sie blind und taub für alle anderen Sinneseindrücke machte. Ihre Knie wurden weich. Seltsamerweise bemerkte sie erst, dass sie fiel, als ihre Witwenhaube verrutschte. Im nächsten Moment verlor sie das Bewusstsein.
»Aufwachen! Wachen Sie auf! Bitte …! Sie sollen aufwachen!«
Der Ton war nicht unfreundlich, eher hilflos und womöglich auch besorgt, aber nicht so sanft wie der einer mitfühlenden Person. Die Stimme kam Maria vage bekannt vor, in ihrem Kopf dröhnte jedoch ein Ohrensausen, das jede vernünftige Überlegung zerstörte. Schließlich hörte sie nichts mehr und spürte nur noch, wie weh ihr ganzer Körper tat.
Im nächsten Moment schlug eine Hand gegen ihre Wange. Zuerst war es ein leichtes Klatschen, dann eine heftige Ohrfeige.
»Aua!« Empört riss Maria die Augen auf.
»Heiliger Strohsack! Ich hätte nie geglaubt, dass ich so etwas einmal tun würde.«
»Frau von Wedekind …«, hauchte Maria. Mit einer Mischung aus Entsetzen und Fassungslosigkeit sah sie Amadeus’ Mutter an.
Die hatte sich bis eben über sie gebeugt. Nun richtete sie sich errötend auf. »Entschuldigen Sie. Es ist nicht meine Art, zuzuschlagen, ich habe mein Riechsalz nicht gefunden.«
Als würden sich Nebelschwaden langsam lichten, nahm Maria ihre Umgebung wahr. Sie lag ein wenig gekrümmt auf dem Sitz einer stillstehenden Kutsche, den Kopf im Schoß der anderen Frau gebettet. Sie konnte sich nicht erinnern, in den Wagen gestiegen zu sein. »Wie …?«, hob sie an, um sich dann zu korrigieren: »Was …?« Wie komme ich hierher?, hatte sie fragen wollen. Und: Was ist geschehen? Doch die Worte formten sich nur in ihrem Kopf und kamen ihr nicht über die Zunge. Sie fühlte sich zu schwach, um ihre Gedanken in Worte zu fassen.
»Oje, oje«, jammerte die Wedekind. »Sie haben doch wohl hoffentlich nicht Ihren Verstand verloren. Oder Ihr Gedächtnis. Oder was weiß ich, was man durch einen Unfall verlieren kann. Bitte, sagen Sie mir, wer Sie sind?«
Maria versuchte sich zu konzentrieren. Sie musste sprechen, sich rühren. Sie musste die andere Frau davon überzeugen, dass sie keinen großen Schaden genommen hatte. Jedenfalls nicht in ihrem Kopf. Jetzt fiel ihr auch ein, was geschehen war: Sie hatte in Gedanken versunken eine Straße überqueren wollen und nicht auf den Verkehr geachtet. Es war eine ruhige Gegend, sie hatte sich allein gefühlt. Doch sie war gegen einen Karren mit hoch aufgetürmten Waren gelaufen, gegen etwas Hartes geprallt, gefallen und hatte sich wohl durch den Sturz verletzt. Das wusste sie freilich nicht mehr so genau, sie spürte nur diesen ziehenden Schmerz in der Schulter. Wie sie in ihrer Ohnmacht in diese Kutsche gekommen war, wusste sie allerdings noch viel weniger. Und eigentlich wollte sie viel lieber schlafen, als der Wedekind Rede und Antwort zu stehen. Sie schluckte und nannte mit brüchiger Stimme ihren vollständigen Namen: »Maria Elisabeth Burmester, geborene Onnes.« Dabei kam sie sich reichlich albern vor.
»Hm«, machte die andere. »Das scheint ja schon einmal richtig zu sein. Wenn Sie sich nun aufsetzen könnten, wäre uns beiden gedient.«
Obwohl es trotz der gekrümmten Haltung recht bequem war, folgte Maria der Aufforderung notgedrungen. Sie wollte nicht, dass die Wedekind sie fortstieß. Die Ohrfeige war heftig gewesen, nicht auszudenken, welche Kräfte diese Frau noch entwickeln würde. Allerdings bereitete ihr jede Bewegung starke Schmerzen. Maria biss die Zähne zusammen, doch einen erstickten Schrei konnte sie nicht verhindern.
»Sie brauchen einen Arzt.«
»Nein, nein.« Maria versuchte den Kopf zu schütteln, was einen Schwindel verursachte. Erschöpft lehnte sie sich gegen die Wand des Wagens. »Nein, nein, nein«, wiederholte sie so entschieden, wie es ihr unter den gegebenen Umständen möglich war. »Es ist nicht nötig, einen Arzt zu konsultieren. Ich habe fünf Kinder geboren, ich weiß, wie ich mir helfen kann …« Ihre Magd besaß magische Kräfte. Wäre Rike ein paar Jahre früher geboren, wäre sie womöglich als Hexe verbrannt worden. Im Moment vertraute Maria jedoch auf die Heilkräfte ihrer Dienerin mehr als auf alles andere. »Ich möchte nach Hause …«
»Ich werde Sie bringen …«
»Nein, das …«
»Du lieber Himmel, was denken Sie von mir? Ich bin zufällig vorbeigefahren, als sie dem armen Mann in den Karren liefen, und habe Sie also verletzt von der Straße aufgelesen. Selbstverständlich führe ich zu Ende, was ich begonnen habe, und bringen Sie nach Hause. Wie lautet die Adresse?« Die Wedekind zögerte kurz, dann hakte sie unsicher nach: »Sie erinnern sich doch an Ihre Anschrift, oder?«
Unwillkürlich streifte ein Lächeln Marias Mundwinkel. Die Furcht vor einem Gedächtnisverlust, die die Wedekind offenbar umtrieb, amüsierte sie. »Ich wohne zwei Stunden entfernt am Heerweg nach Wedel.«
»Oh! Das ist natürlich etwas weit.«
Da sie diese Reaktion erwartet hatte, erwiderte Maria: »Bringen Sie mich bitte zum Hafen, wenn es Ihnen keine Mühe bereitet. Wenn ich keine Kutsche finde, die mich mitnimmt, wird es die Fähre nach Blankenese tun.«
»Unfug! Sie sehen reichlich mitgenommen aus, überdies hat Ihr Kleid Schaden genommen, so können Sie nicht unter die Leute gehen. Oder besser gesagt: Kein anständiger Mensch wird sie so derangiert in seinen Wagen oder auf sein Boot lassen …«
Unwillkürlich senkte Maria den Blick. Tatsächlich wies der Stoff einen Riss vom Saum fast bis zur Taille auf. Wahrscheinlich war sie darin hängen geblieben, als sie hinfiel. Außerdem zogen sich graue Schlieren über das gute Tuch, Dreck von der Straße. Verwirrt starrte sie darauf – und plötzlich schien sich alles um sie her zu drehen. Rasch sah sie wieder geradeaus.
Die Wedekind plauderte munter weiter: »Ich werde den Kutscher anweisen, mich an meinem Haus abzusetzen und Sie anschließend in Ihr Dorf zu bringen, wo immer das auch ist. So. Das ist die beste Lösung.« Mit sich zufrieden klatschte sie in die Hände. »Wir Frauen müssen zusammenhalten, nicht wahr?« Da dies wohl eine rein rhetorische Frage war, streckte sie, ohne Marias Reaktion abzuwarten, den Kopf aus dem Fenster und rief dem Fahrer etwas zu, das im Innenraum nicht zu verstehen war.
Genau genommen interessierte Maria die Anschrift der Wedekind auch nicht. Sie kämpfte mit sich, ob sie das freundliche Angebot annehmen sollte oder nicht. Immerhin war das die Mutter des Kindes, mit dem sich Immanuel allem Anschein nach geprügelt hatte – und ihr war nach wie vor nicht ganz klar, was dazu geführt hatte. Schließlich war es wohl mehr als eine Rangelei unter Gleichaltrigen gewesen, und vor noch nicht einmal einer Stunde hatte die Wedekind verlangt, dass Marias Sohn von der Schule verwiesen würde. Wenn sie sich jetzt in deren Wagen nach Nienstedten bringen ließ, bedeutete es ihrer Ansicht nach ein Schuldeingeständnis. Maria wollte protestieren, doch sie fühlte sich zu schwach dafür. Auf dem gut gefederten und gepolsterten Sitz ließ es sich aushalten. Das tat ihrem Körper wohl. Die ruhige Fahrt machte sie schläfrig. Ohne ein weiteres Wort schloss Maria die Augen.
5
Die gedruckte Einladung zum Freiheitsfest am vierzehnten Juli lag bei Emilia von Wedekinds Heimkehr mit einem handschriftlichen Brief noch immer scheinbar unangetastet auf dem kleinen Tischchen im Vestibül, wo sie die Post für ihren Gatten hinterlegte. Entweder war er von seiner Reise noch nicht zurückgekommen – oder er interessierte sich nicht für Gleichheit und Brüderlichkeit und die Abschaffung des Ständestaates, was sie einem vom großen König Friedrich II. von Preußen geadelten, hochrangigen Militärarzt nicht verübeln konnte. Allerdings teilte sie seine Ansichten nicht so vorbehaltlos, wie es sich für eine gute Ehefrau gehörte.
In den vergangenen Monaten war es oft zu Streitgesprächen zwischen Tilmann von Wedekind und ihrem Bruder gekommen. In der Regel hatte sie sich herausgehalten, aber insgeheim favorisierte sie Christian Vandenbergs Meinung. Ihr Bruder führte einen renommierten Zeitungsverlag in Altona, wo die Pressegesetze noch liberaler waren als in Hamburg selbst, und zeigte sich nicht nur aus persönlicher Überzeugung, sondern auch aus beruflichem Interesse den Jakobinern äußerst wohlgesonnen. Trotz der unterschiedlichen Ansichten war Christian der Bitte seines Schwagers gefolgt und hatte das Haus im Schatten von St. Katharinen für Emilias Familie gekauft. Ihr Bruder musste als Strohmann fungieren, weil einem Adeligen untersagt war, Grundbesitz in Hamburg zu erwerben.
Letztlich tat er es nicht für Tilmann, sondern für sie. Das war ihr bewusst, und sie fragte sich oft, wie gut er über ihre Geheimnisse Bescheid wusste. In den Jahren, in denen Emilia