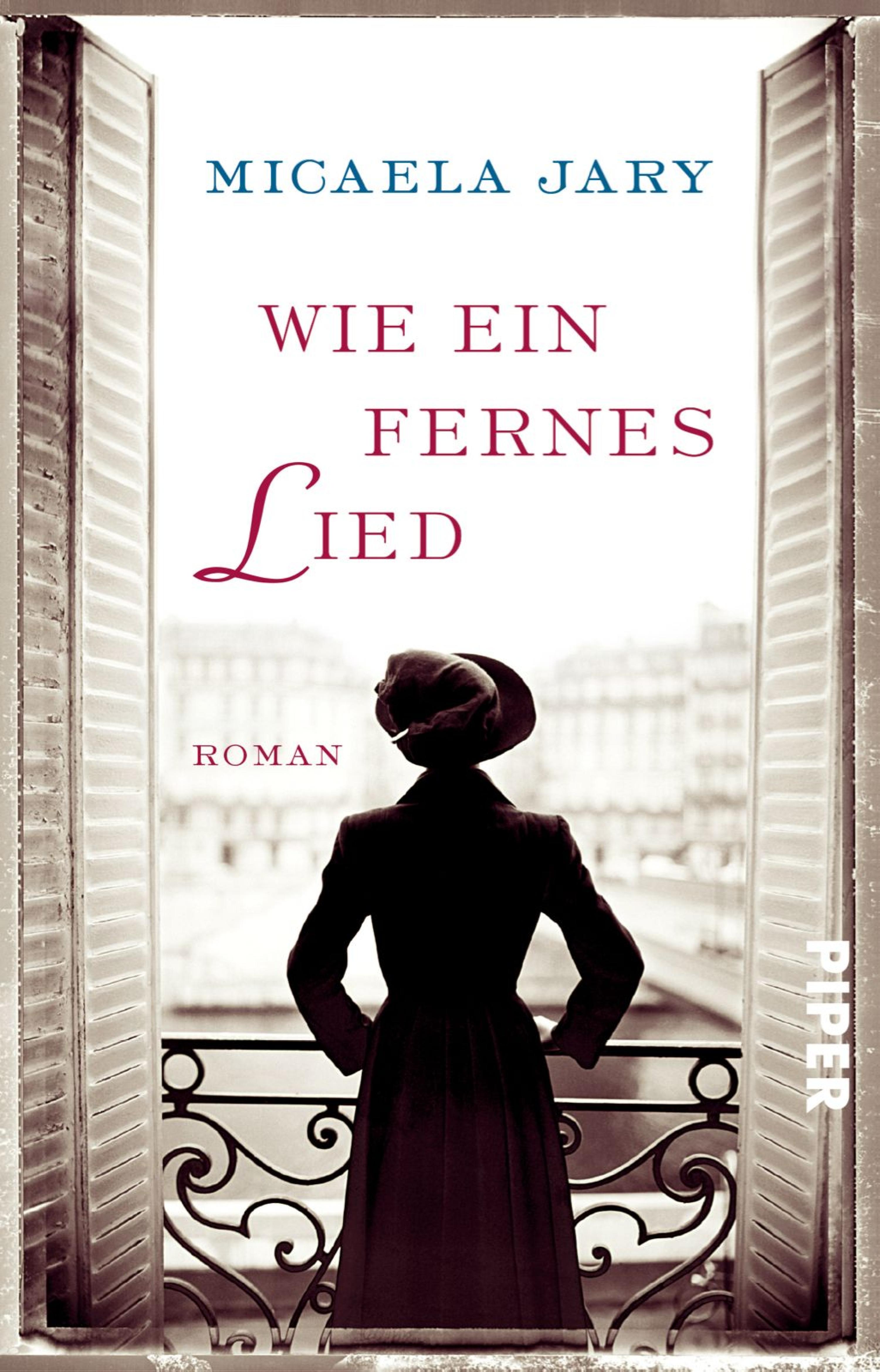0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Zwei Frauen, die ihr Leben selbst bestimmen wollen … Der Afrikaroman »Der Himmel über Namibia« von Bestsellerautorin Micaela Jary als eBook bei dotbooks. Zwischen Europa und Afrika, Wüste und Meer … Berlin, 1909: Als die junge Emma Thieme erfährt, dass ihre totgeglaubte Mutter noch lebt, wagt sie die beschwerliche Reise ins ferne Südwestafrika – fest entschlossen, herauszufinden, welches Geheimnis ihre Familie umgibt. Auf der Schiffsreise lernt sie die begnadete Pianistin Dorothee von Hirschberg kennen, die Konzerte in den Kolonien geben will und Emma bald eine treue Freundin wird. Doch noch ahnen die beiden Frauen nicht, dass ihre Begegnung kein Zufall ist – und dass das Schicksal sie im Land der roten Sonne mit zwei ebenso faszinierenden wie undurchsichtigen Männern zusammenführen wird. Eine Begegnung, die alles für immer verändert … »Ein brillantes Lesevergnügen«, empfiehlt die Zeitschrift Grazia. Jetzt als eBook kaufen und genießen: Die große Familiensaga »Der Himmel über Namibia« von SPIEGEL-Bestsellerautorin Micaela Jary, die auch unter den Namen Gabriela Galvani und Michelle Marly sehr erfolgreich veröffentlicht. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 532
Ähnliche
Über dieses Buch:
Zwischen Europa und Afrika, Wüste und Meer … Berlin, 1909: Als die junge Emma Thieme erfährt, dass ihre totgeglaubte Mutter noch lebt, wagt sie die beschwerliche Reise ins ferne Südwestafrika – fest entschlossen, herauszufinden, welches Geheimnis ihre Familie umgibt. Auf der Schiffsreise lernt sie die begnadete Pianistin Dorothee von Hirschberg kennen, die Konzerte in den Kolonien geben will und Emma bald eine treue Freundin wird. Doch noch ahnen die beiden Frauen nicht, dass ihre Begegnung kein Zufall ist – und dass das Schicksal sie im Land der roten Sonne mit zwei ebenso faszinierenden wie undurchsichtigen Männern zusammenführen wird. Eine Begegnung, die alles für immer verändert …
*** Dieser Roman ist bereits unter dem Titel DIE BUCHT DES BLAUEN FEUERS erschienen. ***
Über die Autorin:
Die Bestsellerautorin Micaela Jary wurde in Hamburg geboren und wuchs in der Schweiz und in München auf. Nach ihrem Studium arbeitete sie lange als Journalistin für diverse Printmedien, bevor sie sich ganz der Schriftstellerei widmete. Nach einem mehrjährigen Aufenthalt in Paris pendelt sie heute als freie Autorin zwischen Berlin, München und dem Landkreis Rostock. Unter den Pseudonymen Gabriela Galvani und Michelle Marly veröffentlicht sie zudem sehr erfolgreich historische Romane.
Die Websites der Autorin:
www.michelle-marly.com
www.micaela-a-gabriel.de
Bei dotbooks veröffentlichte sie auch ihren Afrikaroman »Sehnsucht nach Sansibar« sowie den 20er-Jahre-Roman »Die Tote im weißen Kleid«. Unter dem Namen Gabriela Galvani veröffentlichte sie bei dotbooks ihre historischen Romane »Die Liebe der Duftmischerin«, »Die Seidenhändlerin«, »Die Königin des weißen Goldes«, »Die Malerin von Paris«, »Die geheime Königin« und »Die Liebe der Buchdruckerin«.
***
eBook-Neuausgabe April 2024
Dieses Buch erschien bereits 2012 unter dem Titel »Die Bucht des blauen Feuers« im Wilhelm Goldmann Verlag.
Copyright © der Originalausgabe 2012 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Period Images/Mary Chronik und Shutterstock/Madlen, meaofoto, nevodka, Naypong Studio, Chad Zuber, fokke baarssen
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98952-031-8
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
In diesem eBook begegnen Sie möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. Diese Fiktion spiegelt nicht unbedingt die Überzeugungen des Verlags wider.
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Der Himmel über Namibia«an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Micaela Jary
Der Himmel über Namibia
Ein Afrikaroman
dotbooks.
Der Diamant ist ein kristallisierter Kohlenstoff
und kommt in dem sogenannten [...] Blaugrund vor.
Für gewöhnlich wird der reine, weiße Diamant
mit etwas bläulichem Feuer am höchsten bewertet.
Paul Rohrbach (1869-1956),
Die Diamantenlager von Lüderitzbucht
Prolog
Die Sonne trug ihren täglichen Kampf mit dem Nebel aus. Der Dunst hing über der Bucht wie ein großes, undurchdringliches Segel. Eine weiße Wand, wie ein Theatervorhang von unsichtbarer Hand hochgezogen, nur dass er aus dem Meer aufstieg und nicht aus einem Orchestergraben. Seltsamerweise wurde der Milchglashimmel nicht einmal von dem ständig über die Küste streichenden Wind vertrieben, der sich mal zu einem gewaltigen Sturm steigerte und an den bunten Fensterläden rüttelte, dann aber wieder als Brise mit den gelben Blüten des Kameldorns spielte.
Zugegebenermaßen war das Klima an diesem Ort gewöhnungsbedürftig. Gleichzeitig erwies es sich als sehr angenehm, denn an der Bucht wurde es niemals drückend heiß. Sogar an der Ostsee war es in manchen Sommern schwüler gewesen, doch an das Wetter in der Heimat verschwendete die Besitzerin des hübschen Strandhauses nur selten einen Gedanken. Die Erinnerung an die Ferien mit ihrer Tochter lag tief verschlossen in ihrem Herzen und brach sich nur dann Bahn, wenn sie an ihrem Tisch über dem einfachen Papier saß und einen neuen Bericht verfasste. Selten jedoch fand sie die Zeit für einen Brief.
Sie hatte sich ihr Leben gut eingerichtet. Es war so ausgefüllt, dass ihr wenig Raum zum Nachdenken blieb. Früher legte sie Wert darauf, die Zahl der Stunden möglichst einzuschränken, in denen sie ihre Gedanken auf Wanderschaft ins ferne Deutschland entließ. Inzwischen meldeten sich die vergessenen oder verdrängten Bilder jedoch immer öfter von selbst zurück.
Vielleicht lag es an diesem Haus, daran, dass sie sich zum ersten Mal ein richtiges Heim geschaffen hatte. Albernerweise war ausgerechnet der spektakuläre Blick über die Bucht schuld an ihrem neuen Wohnsitz. Eine Aussicht, die sie freilich nur an etwa hundert Tagen im Jahr genießen konnte, sonst verhüllte sie der Nebel. Es war höchst voreilig und sicher auch gänzlich unvernünftig gewesen, dieses Stück Land zu kaufen, nachdem sie es nur ein einziges Mal besichtigt hatte; noch dazu an einem der seltenen klaren Sonnentage.
Sie hatte sich in die Aussicht verliebt: die endlose Weite des tiefblauen Atlantiks, die aufspritzende und im Sonnenlicht wie ein Regenbogen leuchtende Gischt, wenn die Wellen gegen die Granitfelsen am Ufer schlugen, die weißen, vom Wind über den roten Sand getriebenen Schaumkronen. Wie Jade schimmernde Berge ragten vor dem Horizont in den lichtblauen Himmel: Sie hatte gehört, dass auf den kleineren Inseln Pinguine lebten und Seehunde; auf der größten befand sich das Lazarett, und gleich nebenan waren Menschen in Lagern eingepfercht, aber darüber dachte sie nicht nach. Sie hatte bei der Besichtigung den Blick auf eine Gruppe eleganter Rosaflamingos konzentriert, die auf dürren, überlangen Beinen im seichten Wasser herumstaksten, mit gebogenem Hals auf der Suche nach Nahrung, und sie hatte sich zum ersten Mal seit langem glücklich gefühlt. Allenfalls der eigentümliche Geruch der Grundstücksbegrenzung aus Walfischrippen hatte sie etwas gestört.
An den meisten Tagen war die See jedoch nur durch ein fernes Rauschen auszumachen, der Dunst dämpfte sogar den Ton der Wellen, die gegen den Strand unterhalb ihres neuen Heims schwappten. Selbst die rote Amaryllis in ihrem ebenso mühsam wie geduldig angelegten Garten verlor dann ihre Leuchtkraft, denn sie schien zugedeckt mit einem weißen Schleier. Und die Flamingos waren fortgezogen. Wahrscheinlich vertrieben von den vielen Menschen, die gleich einer Heuschreckenplage plötzlich scharenweise im Sand buddelten. Doch der Raubzug war rasch vorbeigegangen und die Einsamkeit weitgehend zurückgekehrt. Nur der tranige Duft des Zauns war geblieben.
Sie sah aus dem Fenster und fühlte sich wie in einer dicken Mehlsuppe. Das Licht erinnerte sie an den Kleister, mit dem sie die Bastelarbeiten ihres Kindes verschlossen hatte – Laternen am Martinstag und Sterne an Weihnachten. Voller Sehnsucht erinnerte sie sich daran und wusste gleichzeitig, dass ihre Sicht auf die Wahrheit verklebt war, weil sie sich dafür mehr schämte als für irgendetwas anderes in ihrem Leben.
Die Vergangenheit holte sie ein. Schmerzlich und unvorbereitet.
Ihre Gegenwehr erfolgte mit den falschen Waffen. Es gelang ihr immer seltener zu vergessen. Seit sie das Haus besaß, stand sie auf verlorenem Posten.
Genauso erging es der Sonne. Die hatte ihren Kampf gegen den Nebel inzwischen aufgegeben. Wenigstens für heute.
Teil 11909
Kapitel 1
Emma Thieme begann die Zecherei über den Kopf zu wachsen. Nicht nur finanziell. Das Verhalten der Trauergemeinde wurde ihrer Ansicht nach zunehmend pietätloser.
Vor gut zwei Stunden waren ihre Gäste noch gesittet am offenen Grab ihres Vaters vorbeidefiliert und hatten Emma ihr Beileid ausgesprochen. Nun aber verwandelten dieselben Leute den aus einem üppigen Mahl bestehenden Leichenschmaus im Wirtshaus Zum Hans Sachs dank eines großen Fasses Bier in ein Fest. Überwiegend fremde Menschen, die sich dem Anlass entsprechend in trauriges Schwarz gewandet hatten – und sich auf ihre Kosten nun fröhlich den Wanst vollschlugen. Sie aßen und tranken ohne Maß, als würden sie am Hungertuch nagen und nie wieder einen Tropfen Schultheiss gereicht bekommen. Dabei waren es überwiegend sehr wohlhabende Bürger, die sich im Gedenken an den Photographen Theodor Thieme versammelt hatten.
Emma besaß keine nahen Verwandten, und auf den Friedhof sowie in die Wirtschaft waren vor allem Nachbarn und Kunden gekommen, denn auch der Freundeskreis ihres Vaters hatte sich im Lauf seiner siebzig erfüllten Lebensjahre gelichtet. Im Dunst des Zigarrenqualms, der über der Tafel hing, waren ihr eigentlich nur die Gesichter seiner beiden Angestellten und die der Männer einigermaßen vertraut, mit denen ihr Vater samstags regelmäßig Skat gespielt hatte. Und seinen langjährigen juristischen Berater kannte sie natürlich.
Der beißende Geruch von gebratenem Fett, Tabak, schalem Alkohol und menschlichen Ausdünstungen trieb ihr nicht nur die Tränen in die Augen – er schlug ihr auf den Magen. Ihre Kopfschmerzen rührten jedoch eher von den anstehenden Problemen, welche die Erbschaft zwangsläufig mit sich brachte. Sie wäre dem Gespräch mit Doktor Wohlgemuth gern noch ein wenig ausgewichen, doch der alte Rechtsanwalt passte sie an der Tür ab, als sie sich heimlich davonschleichen wollte.
»Wir müssen uns dringend unterhalten.« Die Stimme des Juristen klang leise und beschwörend. »Ihr Vater hat zwar seine wichtigsten Angelegenheiten testamentarisch zu regeln versucht, aber es herrscht nicht in allen Fragen die erforderliche Klarheit.«
Ihre Augen flogen zwischen dem Herrn, der sie an die Porträts des alten Kaisers Wilhelm I. erinnerte, und der restlichen Gesellschaft hin und her. War dies der rechte Augenblick für diese Unterhaltung? Allerdings hieß es tatsächlich, dass der Leichenschmaus der Ort sei, die ersten Gespräche über die Erbschaft zu führen.
Doch Emma fühlte sich elend. Der Tod ihres Vaters bedeutete einen tiefen Einschnitt, in vielerlei Hinsicht, und sie wünschte, wenigstens ein wenig Ruhe zu haben, vorbehaltlos um ihn trauern zu dürfen, bevor sie sich seinem Erbe stellte. Das Schicksal hatte ihr nicht einmal die Zeit geschenkt, sich von ihm zu verabschieden.
Theodor Thieme war nicht durch eine Erkrankung verschieden, wie dies bei einem Mann seines Alters zu erwarten gewesen wäre, sondern bei einer Katastrophe ums Leben gekommen: Emmas Vater war eines der neun Opfer, die nach dem Motorradunfall auf der Rennbahn im Alten Botanischen Garten zu beklagen waren; sein Lehrling zählte zu den vierzig Verletzten, und Emma wusste noch nicht, ob er es schaffen würde.
Seufzend wandte sie dem Herrn mit dem schlohweißen Bart über dem steifen Vatermörderkragen ihre ungeteilte Aufmerksamkeit zu: »Ich wünschte, die Regelung des Nachlasses könnte noch ein wenig warten«, antwortete sie, um nach einer kurzen Gedankenpause stockend hinzuzufügen: »Natürlich weiß ich, dass Sie nur Ihre Pflicht tun, aber ... es kommt alles so plötzlich. Mein Vater war ein gesunder Mensch ... und dann dieser schreckliche Unfall...«
Im Hintergrund erscholl Gelächter. Einer der Trauergäste hatte offenbar einen Witz erzählt, der zur allgemeinen Erheiterung führte.
Doktor Wohlgemuth war nur wenig größer als Emma und wirkte mit seinem eingezogenen Kopf und den gebeugten Schultern wie ein Mann, der unter der Last seiner beruflichen Verantwortung zusammenzubrechen drohte.
»Es kommt jetzt viel auf Sie zu, Fräulein Thieme, mehr, als gut für eine Tochter ist, wenn Sie mich nach meiner Meinung fragen. Frauen wird heutzutage viel zu viel abverlangt, das liegt nicht in der weiblichen Natur.«
Der Anwalt war ein Herr alter Schule. Deshalb traute er einer jungen Frau wie ihr gewiss weniger zu, als sie tatsächlich zu leisten vermochte. Das Schicksal war aber nicht immer wohlmeinend mit Emma umgegangen. Sie hatte früh lernen müssen, sich mit dramatischen Ereignissen zu arrangieren. Überdies war sie keine in Watte gehüllte Bürgerstochter, die nicht wusste, was ehrliche Arbeit bedeutete.
Nach dem Tod Theodor Thiemes benötigte sie daher vor allem einen Juristen, der ihr zu einer Konzession verhalf, damit sie ihr geordnetes Leben weiterführen konnte. Ein Anwalt, der den überholten Traditionen verhaftet war und womöglich meinte, eine Weibsperson könne kein Photographisches Atelier führen, war ihr keine große Hilfe. Dabei erlaubten die gesellschaftlichen Regeln einer Dame durchaus die Erwerbstätigkeit in diesem künstlerischen Beruf. Selbst in einer konservativen, bürgerlichen Gemeinde wie Groß-Lichterfelde sollte es Emma möglich sein, den väterlichen Betrieb fortzuführen. Immerhin befand sich ihre Heimat vor den Toren Berlins, wo erstaunlich viele Frauen im Photographischen Verein aufgenommen wurden. Und dann gab es da doch gesetzliche Bestimmungen, die ihrem Vorhaben entgegenkamen. Von der Gewerbefreiheit hatte sie schon viel gehört.
Genau diese Gedanken waren es aber, die Emma gerne noch ein Weilchen von sich geschoben hätte. Wie durch einen Nebel drangen die Worte des Juristen zu ihr durch: »Leider hat sich Ihr Vater gescheut, wichtige Schritte zur Klärung gewisser Dinge zu unternehmen. Das muss ich ihm vorwerfen, Gott sei seiner Seele gnädig.«
Sie riss sich aus ihrer Wehmut los. Es war ihr völlig unverständlich, wovon Doktor Wohlgemuth sprach. Ihr Vater war ein ordentlicher Mensch gewesen, der aufrecht seinen Weg ging, weder verschwenderisch noch gedankenlos. Seine Buchhaltung war stets penibel geführt worden. Sicher hatte er auch ein Testament zu ihren Gunsten angefertigt. Der Erhalt seines Geschäfts kostete viel Geld, er hatte gewiss vorgesorgt.
»Darf ich fragen, was Sie meinen, Herr Doktor Wohlgemuth?«, fragte Emma und konnte nicht verhindern, dass ihre Stimme einen leicht schrillen Klang annahm.
»Ich habe ihn immer wieder darauf hingewiesen, dass er in der Sache Ihrer Mutter ...«
»Meine Mutter?«, unterbrach Emma verwirrt. Nervös strich sie sich eine Strähne ihres honigblonden Haares aus der Stirn. »Welche Sache mit meiner Mutter?«
Glas klirrte dumpf, als würden die bierseligen Gäste mit ihren frisch gefüllten Krügen anstoßen. Für einen Moment war es so still, dass Emma zu hören glaubte, wie ihr Herz schneller schlug. Dann setzten die Gespräche wieder ein und entwickelten sich zu einem murmelnden, gelegentlich von lauteren Tönen unterbrochenen Geräuschpegel.
Doktor Wohlgemuth war durch den Lärm abgelenkt worden. Als er sich erneut auf Emma konzentrierte, hatte er ihre Frage entweder vergessen oder überhörte sie absichtlich.
»Wäre es Ihnen recht, wenn ich im Atelier vorbeikäme und wir dann alles Weitere bereden?«, fragte er. »Es würde morgen am späten Nachmittag gut passen. Dann könnte ich auch gleich die stempelpflichtige Inventarliste aufnehmen.«
Emma hatte nicht die geringste Ahnung, was eine »stempelpflichtige Inventarliste« war – und wollte es im Moment auch nicht wissen. Es interessierte sie einzig der Hintergrund seiner Bemerkung. »Welche der Angelegenheiten meines Vaters betrifft meine Mutter?«
»Hat er es Ihnen nicht gesagt?« Doktor Wohlgemuth schüttelte den Kopf. Seine Miene drückte eine Mischung aus Bestürzung und Empörung aus. Er sah sich um, als fürchtete er eine Verschwörung unter den anderen Trauergästen, und senkte seine Stimme: »Ihr Vater hat niemals eine Todeserklärung nach Paragraph dreizehn des Bürgerlichen Gesetzbuches im Wege des Aufgebotsverfahrens beantragt. Das obliegt nun leider Ihnen, mein Kind.«
»Was heißt das?«
»Nach dem Gesetz ist Constanze Thieme noch am Leben.«
Emmas Herz zog sich schmerzhaft zusammen.
Seit zwölf Jahren trauerte sie um ihre Mutter. Anfangs hatte sie gehofft, es wäre alles ein Irrtum und Mutti würde irgendwann heimkehren, ganz selbstverständlich. Dann hatte sie geweint – bis ihre Tränen versiegten, doch der Verlust blieb bis heute allgegenwärtig. Sie hatte kaum jemals über die Tragödie gesprochen. Nicht mit ihrem Vater, weil sie fürchtete, ihn mit der Erinnerung aufzuwühlen. Und mit Freundinnen tuschelte man schon gar nicht über den Selbstmord der eigenen Mutter.
Es gab kein Grab, weil Theodor Thiemes unglückliche Frau ins Wasser gegangen war. Ihre Leiche war nie gefunden und bestattet worden, Emmas Vater hatte nur einen Abschiedsbrief besessen, der für ihn wohl so bedeutsam war wie ein Sarg.
Und nun überließ er es Emma, das Leben ihrer Mutter zwölf Jahre nach der schrecklichen Tat juristisch zu beenden. Wie konnte er ihr das nur antun?
Schwindel erfasste Emma. Eigentlich war sie von robuster Gesundheit, doch für einen Moment fürchtete sie, ohnmächtig zusammenzubrechen.
Der Anwalt spürte offenbar ihr Unwohlsein. Beherzt umfasste er ihren Arm. »Es tut mir leid, dass Sie es so erfahren mussten.«
Emma versuchte, Contenance zu bewahren. »Ich danke Ihnen für Ihre Offenheit, Herr Doktor Wohlgemuth«, murmelte sie und wusste im selben Moment, wie falsch ihre Worte eigentlich klangen.
»Hätte ich geahnt...«, in beredtem Schweigen brach er ab. Er ließ sie los, betrachtete sie eine Weile lang schweigend. Dann: »Wissen Sie, ich persönlich hielt das Preußische Allgemeine Landrecht für kein schlechtes Gesetz. Meiner Ansicht nach brauchen Frauen entweder einen Vater, einen Ehemann oder einen anderen Vormund, der sich um ihre rechtlichen Belange kümmert. So auf sich allein gestellt... und dann auch noch mit unter vierundzwanzig Jahren volljährig! Ihr Fall zeigt doch ganz deutlich, Fräulein Thieme, dass das neue Bürgerliche Gesetzbuch viele Lücken aufweist. Wie alt sind Sie jetzt?«
Emma war mit ihren Gedanken noch immer bei ihrer Mutter. Der zarte Keim, der vor so langer Zeit aus dem Boden der Hoffnung gerissen worden war, schlug flüchtig eine neue Wurzel. Wenn Theodor Thieme seine Frau niemals für tot hatte erklären lassen – glaubte er dann vielleicht, dass sie noch lebte? Aber sie waren doch beide seit zwölf Jahren von ihrem großen Verlust überzeugt. Hatte Emmas Vater sich nur aus sentimentalen Gründen geweigert, die Realität juristisch anerkennen zu lassen? Die Antwort auf ihre stummen Fragen hatte er mit in sein Grab auf dem Alten Friedhof genommen – und Emma fühlte sich angesichts der Bürde des Nachlasses, als würde sie beide Eltern noch einmal verlieren. Ihr Alter spielte dabei keine Rolle.
»Zweiundzwanzig«, murmelte sie.
»Zu jung«, behauptete Doktor Wohlgemuth, »viel zu jung. Aber Sie können versichert sein, dass ich Ihnen jederzeit beratend zur Seite stehe.«
Stuhlbeine knarrten, die ruppig zurückgeschoben wurden. Der Boden vibrierte unter den schweren Schritten mehrerer Männer. Aus den Augenwinkeln beobachtete Emma die kleine Gruppe gut angezogener Trauergäste, die sich mehr torkelnd als aufrecht in ihre Richtung bewegte.
Der durch die vielen Neubauten in Lichterfelde zu erheblichem Wohlstand gekommene Bauunternehmer Halske und seine drei erwachsenen Söhne wollten offenbar gehen, nachdem alle vier dem Bier stärker zugesprochen hatten, als den Herren gut anstand. Das Gesicht und den kahlen Schädel des Vaters zierte eine ungesunde blaurote Farbe; der jüngste Halske musste von seinen Brüdern gestützt werden, er stierte blicklos vor sich hin.
Emma wünschte, sie hätte diese Leute nicht eingeladen. Aber sie hatte sich verpflichtet gefühlt, weil die Photographie der Halskes eine der letzten von Theodor Thieme gewesen war; besondere Sympathie hegte sie nicht für den Alten, dessen joviale Art ihr schon im Atelier unangenehm aufgefallen war.
»Der Herr Anwalt und das Fräulein Erbin«, trompetete Halske aufgeräumt. »Sie haben schon Recht – über das Geschäftliche kann man nie früh genug reden.«
Überraschenderweise schien der seriöse Doktor Wohlgemuth Gefallen an dem von Herrn Halske aufgeworfenen Thema zu finden – oder er bemühte sich um Freundlichkeit gegenüber einem wichtigen Gemeindemitglied. Vielleicht war der feiste Bauunternehmer auch ein Mandant, dem er um den Bart gehen wollte.
»Man kann gewiss nicht behaupten, dass Sie kein guter Kaufmann wären«, erwiderte der Anwalt. »Deshalb werden Sie mir zustimmen, wenn ich Fräulein Thieme am dringendsten zu einer Eheschließung rate. Natürlich ist eine Verlobung vor Ablauf des Trauerjahres indiskutabel, aber ein Mann an ihrer Seite hat noch keiner Frau geschadet.«
Emma spürte den bohrenden Blick des ältesten Juniors auf sich ruhen. Ein Verehrer war das Letzte, wonach ihr momentan der Sinn stand. Sie war zwar längst im heiratsfähigen Alter, aber sie hatte niemals ein besonderes Interesse an der Ehe gezeigt und würde dies unter den gegebenen Umständen erst recht nicht tun. Es hatte sie ausgefüllt, die Gehilfin, Retoucheuse, Copiererin, Empfangsdame und Haushälterin für ihren Vater zu sein.
Und es sollte ihr erst einmal genügen, ihr eigenes Leben neu zu ordnen, bevor sie daran ging, ein so unsicheres Haus wie eine Ehe zu bauen. Im Gegensatz zu anderen Frauen ihres Alters machte sie sich nichts vor. Die Tragödie um ihre unglückliche Mutter zeigte doch, dass eine Heirat keine Garantie für Sicherheit war. Nicht einmal ein Kind konnte anscheinend daran etwas ändern. Jedenfalls hatte die Existenz einer kleinen Tochter die Mutter nicht von ihrem letzten Schritt abgehalten.
In den Tagen seit Theodor Thiemes Tod war Emma der Verlust auch ihrer Mutter nie gegenwärtig wie in diesem Moment. Ihr fuhr durch den Kopf, wie schön es wäre, keinen Ballast tragen zu müssen. Keine Erinnerungen, keine Vergangenheit und keine Zukunftssorgen.
Der Gedanke an Flucht verstärkte sich. Sie wollte allein sein und ihre Wunden lecken.
»Verzeihen Sie«, brach es aus ihr heraus, »eine Migräne ... Ich muss gehen ...« Dann riss sie in einer bühnenreifen, theatralischen Geste die Tür auf und stürzte nach draußen. Sollten der Anwalt und die Herren Halske doch denken, sie leide unter Hysterie. Ihr war es egal.
Kapitel 2
Was für ein hübscher Ort!, dachte Dorothee von Hirschberg, als sie aus dem Bahnhofsgebäude auf eine breite, von hohen Kastanienbäumen gesäumte Straße trat.
Über das Kopfsteinpflaster ratterten und rollten zwar einige Automobile und Kutschen, doch war der Verkehr übersichtlicher als im chaotischen Getriebe Berlins. Lediglich die elektrische Straßenbahn erweckte den Eindruck großstädtischer Eile. Die nur einstöckigen, mit Fachwerk, Türmen und Zinnen geschmückten, weiß gekalkten Geschäftshäuser rechts und links der Bahnhofstraße wirkten fast dörflich, und die Besucherin fühlte sich an einen Kurort erinnert. Freilich schienen die vorüberschreitenden Spaziergänger eher frisch aus der Friedrichstraße importiert, Landpartiekleidung trug hier kaum jemand. Damen flanierten in modischen Kostümen mit hüftlangen Jacken und großen, mit Reiherfedern aufgeputzten Hüten an den Schaufenstern vorbei, die Herren trugen meist Uniform, manche vorbildlich geschnittene dunkle Jacketts und Homburg.
Es war eine ziemlich einheitliche Szene wohlhabenden Bürgertums, durchbrochen nur von Kindermädchen und Zofen in ihrer berufsmäßigen Tracht, Handwerkern und Arbeitern in billigen Anzügen. Eine das Bild aufhellende, bunte Künstlerschar wie etwa im heimischen Friedenau zog es offensichtlich nicht nach Groß-Lichterfelde.
Dorothee hob unwillkürlich die Hand zu der schmalen, über ihre Augenbrauen reichenden Krempe der überdimensionalen, haubenartigen Toque auf ihrem Kopf, die aufwendig genug war, um ohne Dekoration auszukommen. Die in Mode befindlichen Pleureuses, Kokarden, künstlichen Vögel und echten Federn waren nicht ihr Stil. Dennoch war ihr Hut zweifellos das auffallendste Kleidungsstück diesseits des Bahnhofsgebäudes. Für eine Dame ihrer Herkunft vielleicht nicht unbedingt das angemessenste Accessoire, aber für eine Musikerin gewiss das Tüpfelchen auf dem i ihrer Aufmachung.
Obwohl erst vierundzwanzig, blickte Dorothee von Hirschberg bereits auf eine fast zwanzig Jahre währende Karriere zurück. In den Konzertsälen zwischen Berlin und Wien, Düsseldorf, München und Triest war sie schon früh als Wunderkind gefeiert worden, als »legitime Nachfolgerin Mozarts«. Gemeint waren mit diesem Lob jedoch nicht ihre Kompositionen, sondern ihre Virtuosität am Klavier. Das Schicksal hatte sie mit einem unvergleichlichen Talent ausgestattet, einerseits Fluch, andererseits Segen. Letzteres vor allem aus finanzieller Sicht, denn Dorothee von Hirschberg war im Laufe der Zeit zu einer berühmten Pianistin avanciert. Sie bestritt den Unterhalt ihrer kleinen Familie inzwischen allein, ihr Vater, ein verarmter Adeliger aus Schlesien, hatte seinen Dienst in einer preußischen Behörde längst quittiert und betreute nur noch ihr Talent, wie er es nannte. Tatsächlich hatte er ihre Begabung früh erkannt und sie gedrillt... nun, man könnte natürlich auch sagen – er hatte sie gefördert.
Jedenfalls hatte ihr alter Herr sie bislang so gut wie nie aus den Augen gelassen. Sie war sein größter Schatz – im wörtlichen Sinne. Seit sich ihre schwere Erkrankung nicht mehr verheimlichen ließ, litt er unter Zukunftsängsten. Der Husten, der sie schon so lange quälte, hatte sie vor einigen Wochen gezwungen, ein Konzert in Leipzig abzubrechen, und ihr Vater hatte sich daraufhin mit einer Herzattacke zurückziehen müssen. Statt Dorothee mit Arsenik zu behandeln, musste sich der herbeigerufene Arzt erst einmal um Hugo von Hirschberg kümmern, für dessen Genesung ein Glas Weinbrand und das Öffnen des Hotelfensters ausreichend waren. Die anschließenden Untersuchungen in der Berliner Charité brachten für Dorothee indes nichts außer der Bestätigung, was das rasselnde Atemgeräusch bedeutete: Sie litt an schwerer Tuberkulose.
Mit dem unerwarteten Angebot, zwei hoch dotierte Konzerte am anderen Ende der Welt zu spielen, kam die erstaunliche Wende. Die in Diamanten angebotene Gage in der Kolonie Deutsch-Südwest verklärte den Blick ihres Vaters. Seltsamerweise schützte er seinen wertvollen Besitz nun nicht mit besonderem Elan, sondern ließ Dorothee tun, wozu sie gerade Lust verspürte. Während sich der alte Hirschberg über den gegenwärtigen Preis der Edelsteine informierte, die Kosten für Schiffspassagen nach Swakopmund und Lüderitzbucht debattierte und als ihr Impresario das Programm zusammenstellte, gelang es ihr, der elterlichen Wohnung in Berlin wenigstens zeitweise zu entkommen. Sie unternahm oft einsame Spaziergänge und suchte die Heilsamkeit der frischen Luft im Tiergarten, an einem warmen Sommertag wagte sie sich sogar ohne Begleitung in die berühmte Badeanstalt am Wilmersdorfer See. Und tatsächlich schien ihre erblühende Selbstständigkeit die beste Medizin zu sein und ihr neue Kraft zu verleihen.
Das Engagement in Afrika indes nahm sie mit deutlich mehr Gelassenheit als ihr Vater. Es würden Konzerte wie viele sein, sie verlor daran keinen Gedanken. Selbst die Reise besaß nur wenig Reiz, denn sie war in den vergangenen Jahren so viel herumgekommen, dass sie von der Kolonie wenig Neues erwartete. Man hörte schließlich, dass die Auswanderer und Angehörigen der Schutztruppe viel Deutsches in die neue Heimat mitbrachten. Der wesentliche Unterschied zu ihren bisherigen Auftritten bestand für sie darin, dass sie diesmal in der Wüste spielen sollte und das dort zu erwartende trockene, heiße Klima Balsam für ihre Lungen sein würde. Auch die Seereise versprach, heilsam zu sein.
Die dicht belaubten Kastanienbäume in Groß-Lichterfelde taten ihr jedoch auch schon jetzt recht wohl. Sie sorgten für eine frische, gereinigte Luft, spendeten Schatten, und das leise Rauschen der Blätter fiel ihr als harmonische Begleitmusik auf. Dorothee fühlte sich überraschend gesund, nicht einmal einen Hauch Anstrengung empfand sie nach der Eisenbahnfahrt vom Bahnhof Zoologischer Garten hierher. Eine gute Voraussetzung, um einem Photographen Modell zu sitzen, dachte sie und schmunzelte über sich selbst.
Vielleicht lag ihre Zuversicht auch am Glück, das sie erfasste, weil sie sich ganz allein in den Zug Richtung Potsdam gewagt hatte. Ihr kam es vor, als würde sie schweben. Meistens ging es ihr so, wenn sie selbstvergessen am Piano saß und eines ihrer Lieblingsstücke von Frédéric Chopin spielte. Oder wenn sie in der Erinnerung an die Fahrt im Heißluftballon schwelgte, der sie über die stille märkische Landschaft mit ihren tiefblauen Seen, smaragdgrünen Wäldern und sandigen Feldern getragen hatte – an der Seite eines jungen Mannes, den sie seit damals nicht wiedergesehen hatte, der aber unvergessen einen Platz in ihrem Herzen bewohnte.
»Kaiser Wilhelm ernennt vormaligen Innenminister Theobald von Bethmann Hollweg zum Reichskanzler.« Der von einem starken Berliner Akzent geprägte Ausruf eines Zeitungsjungen im Stimmbruch brachte Dorothee in die Gegenwart zurück.
Sie blickte sich suchend um. Welches Gebäude war wohl der Westbazar? In diesem befand sich das Photographische Atelier Theodor Thieme, welches das Ziel ihres Ausflugs in die Vorstadt war. Sollte sie einen anderen Passanten danach fragen? Es war jedoch ihre Sache nicht, fremde Menschen anzusprechen. Ein wenig ratlos verharrte sie auf der Stelle.
In diesem Moment sah sie die junge Frau.
Die Person schien völlig aufgelöst. Sie war recht groß und von schmaler Figur, trug einen knöchellangen Bahnenrock aus schwarzem Tuch, dazu eine strenge, taillierte Jacke aus demselben Stoff. Aus dem viereckigen Kragen schaute ein schwarzes Spitzenjabot hervor, das die Trauergarderobe vervollständigte. Das Ungewöhnlichste an ihrer Aufmachung war die Tatsache, dass sie weder Handschuhe noch einen Hut trug. Ihr Haar leuchtete golden in der Sonne und löste sich aus den Schildpattspangen, mit denen es aufgesteckt worden war. Das hübsche, schmale Gesicht war so bleich wie das von Dorothee nach einem Anfall.
Aufgebracht verließ die Unbekannte eine Gaststätte, die sich schräg gegenüber an der Straßenecke befand. Sie rannte und stolperte gleichzeitig unter dem Torbogen hindurch, auf dem ein Schild prangte, das die Lokalität als »Wirtshaus zum Hans Sachs« auswies. Mit einem zufällig vorbeilaufenden Mädchen in Schuluniform stieß sie fast zusammen.
Dorothee hatte sich noch nie so schnell bewegt. Sie konnte es nicht, weil ihre kranken Lungen nicht genug Luft aufnahmen. Aber sie durfte es auch nicht, weil ein derartiges Benehmen ihrer Erziehung und ihrem gesellschaftlichen Stand widersprach.
Umso erstaunter beobachtete sie die andere Frau. Diese wirkte durchaus vornehm, ihre Kleidung war von vorzüglicher Qualität, so etwas erkannte Dorothee auf Meilen.
Warum, um alles in der Welt, führte die sich auf wie ein Gassenjunge, der beim Gemüsehändler nicht nur in die Apfelkiste, sondern auch in die Kasse gegriffen hatte? Unwillkürlich erwartete Dorothee, dass der ungewöhnlichen Person ein Kellner aus dem Gasthaus folgte. Vielleicht war sie eine Zechprellerin. Doch nichts dergleichen geschah.
Ohne sonderlich darüber nachzudenken, schlug Dorothee den Weg ein, den die andere genommen hatte. Sie folgte ihr mit einigem Abstand, da sie zu langsam war, um auf ihren Fersen zu bleiben. Ihre Augen hingen jedoch an der Unbekannten wie Kletten am Rock einer Spaziergängerin im Wald. Dennoch gelang es ihr, die übrigen Passanten zu umrunden und niemandem den Weg abzuschneiden. Auch das Herannahen eines Fuhrwerks änderte nichts an ihrer Zielstrebigkeit, als sie die Straße überqueren musste, um die Verfolgte nicht zu verlieren. Sie beschleunigte ihren Schritt ein wenig und kam ohne Blessuren auf der gegenüberliegenden Seite an.
Im Grunde legte sie keine zweihundert Meter zurück. Dorothees plötzliche Atemlosigkeit war wohl auch eher eine Folge der Aufregung, die ihr ebenso ungewöhnliches wie eigentlich unverständliches Verhalten begleitete. Die körperliche Anstrengung war gewiss nicht verantwortlich für ihre jähe Kurzatmigkeit.
Als sie bemerkte, dass die junge Frau in Schwarz vor einem nahen Ladengeschäft innehielt, drückte der beginnende Hustenanfall trotzdem mit kräftiger Faust gegen ihre Brust.
Die andere bemerkte Dorothee anfangs nicht. Ihre Aufmerksamkeit galt dem Schlüssel, den sie mit zitternden Händen in das Türschloss zu stecken versuchte und dabei mehrmals neu ansetzte.
Erst als Dorothee unmittelbar hinter ihr stand, keuchte, hustete und nach Luft rang, schaute sie sich entgeistert um.
»Ja, bitte?«
»Könnte ich wohl ein Glas Wasser bekommen?«, presste Dorothee hervor.
»Was ...? Wieso ...?« Ratlos sah sich die Verfolgte um, als suchte sie nach einer Quelle, um den Wunsch zu erfüllen.
»Würden Sie bitte so freundlich sein«, fügte Dorothee mit Nachdruck hinzu.
»Ja... ähm... wir haben geschlossen!« Die Fremde deutete auf das handgeschriebene Schild, das von innen an der Glasscheibe der Eingangstür befestigt war. Ein quadratisches Stück Karton, das die knappe Auskunft der jungen Frau bestätigte.
Endlich wurde Dorothee die Unangemessenheit der Situation bewusst. Welcher Teufel hatte sie geritten, einer Unbekannten aus einer Laune heraus nachzustellen? Die Tatsache, dass sich die andere offenbar in hellster Aufregung befand, war doch kein Grund, die eigene Neugier derart aufdringlich zur Schau zu stellen. Sie war einfach übermütig geworden, weil sie sich frei und gesund gefühlt hatte.
»Verzeihung ... ich ...«, hob Dorothee schluckend an. Sie hatte Mühe, den noch nicht gestillten Husten zu unterdrücken. In ihren Bronchien kratzte es.
Ihre Augen streiften die Ladenfront. Glastür und Schaufenster wirkten wie leere, blinde Augen durch den feinen weißen Voilevorhang, der den Blick in das Innere des Geschäfts verhinderte. Der in Kurrentschrift auf die Scheibe aufgetragene Name und Zweck des Unternehmens war jedoch deutlich erkennbar: Photographisches Atelier Th. Thieme.
Überrascht sah Dorothee zu der jungen Frau, die sie zufällig hergeführt hatte. »Ich bin Dorothee von Hirschberg«, erklärte sie, überzeugt, dass die andere ihre Person einzuordnen wisse.
Schließlich hatte sie schon vor Wochen schriftlich einen Termin vereinbart.
Doch die Antwort war nur ein ratloser Blick aus blaugrünen Augen.
Wieder löste sich der Husten. Jetzt war es eher ein nervöses Hüsteln und erschütterte nicht ihren ganzen Leib wie der Anfall zuvor.
»Ich habe einen Termin mit dem Herrn Photographen vereinbart«, Dorothee atmete vorsichtig ein, um Luft in ihre schmerzenden Lungen zu bringen. »Herr Thieme erwartet mich.«
Ein Seufzer entrang sich der Kehle der jungen Frau, die noch immer in der Ladentür stand und Dorothee auf diese Weise den Weg hinein versperrte. »Es muss sich um einen Irrtum handeln. Das Photoatelier ist geschlossen.« Sie wies noch einmal mit dem Zeigefinger auf das Schild.
Langsam verlor Dorothee die Geduld: »Wenn ich Ihnen sage, dass ich einen Termin mit Herrn Thieme vereinbart habe, dann hat das seine Richtigkeit. Melden Sie mich bitte unverzüglich an. Ich habe nicht die Absicht, auf der Straße herumzustehen und mit Ihnen zu debattieren ... Und dann hätte ich wirklich gerne ein Glas Wasser!«
Die andere zögerte einen Moment. Dann kapitulierte sie offenbar vor Dorothees entschiedenem Auftreten: »Also gut. Kommen Sie herein. Ich gebe Ihnen etwas zu trinken. Mein Name ist Emma Thieme.«
Kapitel 3
Eine feine Staubschicht überzog das Gehäuse des Photoapparats. Das Nussbaumholz schimmerte matt unter hellgrauem Pulver und bedurfte einer Politur. Das Messingobjektiv, das im Sonnenschein der Oberlichter wie Gold glänzen sollte, offenbarte weitere Zeichen der jüngsten Verwahrlosung.
Obwohl Emma nach dem Unglück überall die lichtdurchlässigen Vorhänge zugezogen hatte, drang genug Helligkeit in das Atelier, um die plötzliche Vereinsamung sichtbar zu machen. Staub lag auf der Kamera, auf den Beinen und Querverstrebungen des Stativs, auf den Lehnen der Stühle, die für eine gerade und ruhige Haltung beim Photographieren sorgen sollten.
Beim Eintreten sah Emma das Atelier mit den Augen der fremden Frau. Zum ersten Mal seit dem Tod ihres Vaters fiel ihr auf, dass die Apparaturen dringend abgestaubt gehörten. Der schreckliche Unfall hatte ihre Welt abrupt zum Stillstand gebracht. Sie konnte sich nicht weiterdrehen wie zuvor. Doch der Sand des trockenen märkischen Sommers fraß sich ebenso in das Studio wie der Ruß aus den Auspuffanlagen der vorüberfahrenden Automobile und nahen Züge.
Gleich morgen würde sie zu Besen und Staubwedel greifen; allein für die »stempelpflichtige Inventarliste« des Herrn Anwalts war ein wenig mehr Sauberkeit angesagt. Die Reinemachefrau würde sie damit nicht beauftragen. Ihr Vater hatte niemandem erlaubt, seine Ausrüstung zu putzen, nur er selbst oder seine Tochter durften dies, und daran wollte sie nichts ändern.
Die für die Herstellung der Photographien benötigte Technik befand sich im vorderen, durch die großen, über Eck gehenden Schaufenster hellsten Teil des Raumes. Das natürliche Licht konnte durch diese Positionierung ausgenutzt werden. Die Rückwand indes schmückte das farbenfrohe Fresko einer italienisch anmutenden Landschaft. In der seitlichen Nische auf der anderen Seite stand eine kleine Sitzgruppe im Schatten, die meist von Begleitpersonen genutzt wurde, um Wartezeiten zu verkürzen oder der Arbeit des Photographen in Ruhe zuzuschauen.
Emma wies auf einen der mit grünem Samt bezogenen Sessel.
»Nehmen Sie bitte Platz. Ich hole Ihnen ein Glas Wasser. Aber es wäre mir recht, wenn Sie dann gehen würden.«
Dorothee von Hirschberg kam Emmas Aufforderung nicht nach, sondern wanderte aufmerksamen Blickes durch das Atelier. Vor dem dreibeinigen Stativ aus Erlenholz und der darauf befindlichen Balgenkamera blieb sie stehen, um die Gerätschaften einer eingehenden Betrachtung zu unterziehen.
Emma ließ sie nicht aus den Augen. Das versprochene Getränk besorgte sie nicht. Vielmehr überlegte sie, ob die Besucherin eine Betrügerin, Diebin oder Hochstaplerin war. Schon vor der Ladentür hatte sie kurz bedacht, dass Dorothee von Hirschberg eine Person sein könne, die sich unter einem Vorwand Zutritt zum Atelier verschaffen wollte. Es lag auf der Hand, dass sie nicht die Wahrheit sprach: Emma hatte alle Verabredungen, die ihr Vater in seinem Kalender notiert hatte, nach dem Unfall abgesagt.
War es möglich, dass sie eine Sitzung übersehen hatte?, fragte sie sich zögernd. Doch sie war gewissenhaft vorgegangen und sicher, ihre Pflicht erfüllt zu haben.
Dabei wirkte Dorothee von Hirschberg durchaus vertrauenerweckend. Die Krempe ihres extravaganten Hutes fiel ihr zwar ein wenig tief über die sanften bernsteinbraunen Augen, aber ihr schmales, feingeschnittenes, bleiches Gesicht wirkte in seiner Offenheit extrem verletzlich. Eine schöne Frau mit einer fragilen Figur, die es sich leisten konnte, ein modisches Kostüm mit einer mondänen Frackjacke von atemberaubendem Schick zu tragen. Diese Dame gab offensichtlich viel Geld für ihre Garderobe aus, stellte Emma nicht ohne Neid fest.
»Verzeihen Sie meine Frage«, unterbrach sie Emmas Musterung ihrer Person und blickte sie über das Gehäuse der Kamera an, »aber Herr Thieme ist wohl nicht so beschäftigt, wie sein Ruf vermuten lässt.«
Der Staub!
Kostspielige Kleidung schloss ein diskretes Verhalten wohl nicht mit ein, dachte Emma grimmig.
Die Besucherin wurde zu einem Ärgernis.
Emma holte tief Luft, um ein paar Sekunden zu überbrücken, bis ihr eine vernünftige Antwort einfiel. Alles, was ihr gerade durch den Kopf ging, war nicht dazu geeignet, einer wohlerzogenen jungen Dame, noch dazu einer trauernden Tochter, über die Lippen zu kommen.
Schließlich erklärte sie sachlich: »Mein Vater ist vor kurzem verstorben, Fräulein von Hirschberg. Es geschah ganz plötzlich.«
»Das ... das ist nicht möglich ...«, die Angesprochene erbleichte noch ein wenig mehr und starrte Emma fassungslos an. Für einen Moment schien sie zu schwanken. Sie hob die Hand, wohl, um sich an dem Photoapparat abzustützen ...
Mit zwei Schritten stand Emma neben ihr und ergriff ihren Arm. »Das ist kein Möbelstück, an dem man sich anlehnen kann.«
»Oh!« Dorothee von Hirschberg wirkte verstört. »Nein. Natürlich nicht. Verzeihen Sie.«
Sie ließ sich widerstandslos zu der kleinen Sitzgruppe führen, wo sie endlich in den nächststehenden Sessel sank. Auf ihren Gesichtszügen lag Bestürzung, ihre Augen blickten ratlos zu Emma auf.
Plötzlich schimmerte Hoffnung in ihrem Blick. Sie richtete sich auf. »Gewiss habe ich mich geirrt. Wie ungeschickt von mir! Gibt es in Groß-Lichterfelde mehrere Ateliers Ihres Namens? Ich suche den Photographen Theodor Thieme und der ...«
»Mein Vater ist tot!«
»Aber unser Termin ...«, die Lider mit den langen, dunklen Wimpern flatterten nervös. »Ich brauche dringend ein gutes Porträt. Herr Thieme war mir empfohlen worden. Ich war so sicher, dass er der Richtige ist...«
Emma schüttelte traurig den Kopf.
»Wo soll ich einen anderen Bildkünstler auftreiben, der sein Handwerk versteht? Es ist nicht jeder Photograph geschickt im Umgang mit der Drucktechnik. Ich muss Plakate herstellen lassen, verstehen Sie? Meine Konzerte, die Vorbereitungen für Afrika ... ich habe keine Zeit, diese mit der Suche nach einem geeigneten Mann zu vergeuden, nachdem ich endlich die richtige Adresse gefunden hatte. Ich war so stolz, selbstständig einen Termin vereinbart zu haben. Dafür bin ich eigens angereist.«
Der hastig hervorgestoßene Monolog schien die Dame ermattet zu haben. Sie lehnte sich zurück und fuhr sich mit der Hand über die Augen. Ihre Atmung ging stoßweise und erinnerte Emma an das Rattern einer Satiniermaschine, aber wenigstens hatte sich ihr schlimmer Husten gelegt.
Emma fragte sich, ob sie Dorothee von Hirschberg anvertrauen sollte, dass sie mehr als nur die Assistentin ihres Vaters war. Anfangs war sie sein Lehrling gewesen, später seine Gesellin und inzwischen ebenfalls eine Meisterin ihres Fachs, obwohl sie sich niemals Referenzen oder eine Reputation hatte erarbeiten können, denn der Erfolg ging immer zu Ehren von Theodor Thieme. Seine Porträts waren tatsächlich über die Grenzen des Vororts berühmt. Emma war ihm jedoch zur Seite gesprungen, wo immer er ihre Hilfe benötigte. Im Atelier ebenso wie in der Dunkelkammer, beim Versorgen der Kunden mit Kaffee oder anderen Erfrischungen wie auch beim Entwickeln der Glasnegative. Sie liebte diese Arbeit, sie hatte ihr Leben ausgefüllt. Wenn ihre Besucherin eine gute Photographie benötigte, so war sie bei ihr ebenfalls an der richtigen Adresse.
Und doch sagte sie nichts von all dem, als sie leise zu sprechen begann: »Mein Vater starb vorige Woche bei dem Unglück an der Radrennbahn im Alten Botanischen Garten in Berlin-Schöneberg. Vielleicht haben Sie davon in der Zeitung gelesen ...«
Dorothee schüttelte stumm den Kopf.
»Es war die Einweihung der Rennbahn. Mehr als sechstausend Menschen waren da – und mein Vater, der die Veranstaltung im Bild festhalten wollte. Ich interessiere mich nicht so sehr für diesen Sport, deshalb nahm er seinen Lehrling mit... und die Reisekamera. Die ist leichter als der Studiophotoapparat, und das Stativ ist zusammenklappbar, wissen Sie ...« Emmas Lippen zitterten, und sie rang die Hände.
Zum ersten Mal sprach sie über die Katastrophe, deren Hergang sie selbst vor allem aus dem Berliner Tageblatt kannte. Die Polizei hatte ihr die Details erspart, die Leichenschau war schlimm genug erschienen.
Emma redete auf eine wildfremde junge Frau ein, die aufmerksam lauschte, gleichermaßen interessiert und erschüttert. Und Emma spürte, wie wohl es ihr plötzlich tat, in Worte zu fassen, was in schrecklichen Bildern ihre Träume begleitete. Ohne sonderlich darüber nachzudenken, sank sie auf den zweiten Sessel, blickte an Dorothee vorbei ins Leere und fuhr fort:
»Bei dem sogenannten Steherrennen kam es zu einem Überhol- oder Ausweichmanöver, und der Lenker eines Motorrads, welcher der Schrittmacher für ein Fahrradteam war, verlor die Kontrolle über seine Maschine. Der Tank explodierte, und das Motorrad flog wie eine Fackel in die Zuschauer auf der Tribüne an der Nordkurve. Alles brannte, und es brach Panik aus ... Und mein Vater wollte doch nur das Rennen von einer Stelle nahe der Bahn photographieren ...« Mit erstickter Stimme brach sie ab. Ihre Augen schwammen in Tränen.
Während des Berichts hatte Dorothee entsetzt die Hand vor den Mund geschlagen. Jetzt ließ sie sie langsam sinken. »Wie schrecklich!«, raunte sie betroffen. »Mein Beileid. Ich konnte ja nicht wissen ... nicht ahnen ... Ach, wäre ich doch nicht hergekommen!«
Emma wischte sich mit den Daumenballen über die Augenwinkel, als wäre sie noch ein kleines Mädchen. »Nein, nein, es ist schon richtig, dass Sie Ihren Termin wahrnehmen wollten.« Sie fügte nicht hinzu, dass sie sich wunderte, nichts von der Vereinbarung zwischen ihrem Vater und dieser Kundin erfahren zu haben.
»Ich sollte dann gehen«, entschied die Besucherin und erhob sich langsam. »Es mag Ihnen unangebracht erscheinen, aber ich möchte trotzdem fragen, ob Sie mir vielleicht einen anderen Photographen empfehlen könnten. Die Zeit bis zu meiner Abreise in die Kolonie ist vielleicht zu kurz für eine erneute Suche.«
Jetzt wäre der Moment, sich selbst zu empfehlen. Doch Emma schwieg. Die Erlebnisse dieses Tages begannen ihr über den Kopf zu wachsen. Erst die Beerdigung ihres Vaters, dann der Leichenschmaus und die schmerzliche Mitteilung des Anwalts, dass sie ihre Mutter für tot erklären lassen müsse, schließlich die Begegnung mit Dorothee von Hirschberg und die aufwühlende Berichterstattung über die Rennbahnkatastrophe – Emma fehlte die Kraft zur Kundenakquisition. Sie fühlte sich außerstande, das gewünschte Porträt sachlich zu besprechen und einen nahen Termin zu vereinbaren.
Außerdem drängte es sie zurück zum Hans Sachs. Sie sollte sich wenigstens noch einmal zeigen, von den verbliebenen Gästen verabschieden und dem Wirt sagen, dass sie die Zeche morgen bezahlen wollte. Während sie sich ebenfalls erhob, schlug sie deshalb ausweichend vor: »Wenn Sie mir Ihre Adresse geben würden, könnte ich mich melden.«
Dorothee zögerte. Wahrscheinlich war sie enttäuscht, dass sie ihren Ausflug nach Lichterfelde mit buchstäblich leeren Händen beenden musste. Statt eines Lichtbildes hatte sie die Geschichte um das tragische Ende des Photographen erhalten.
»Ich werde Ihnen schreiben«, versicherte Emma, »sobald ich kann, das verspreche ich. Es ist nur jetzt der falsche Zeitpunkt. Heute Vormittag war die Beisetzung meines Vaters, und ich ... ich habe einfach keinen Kopf für etwas anderes als meine Trauer.«
»Verzeihen Sie meine Aufdringlichkeit. Natürlich werde ich auf ein Billett von Ihnen warten. Ich wohne in Friedenau am Südwestkorso Nummer ...«
»Das muss ich mir aufschreiben.« Emma stand nach wenigen Schritten an dem Sekretär ihres Vaters, der sich in einer hellen Ecke zwischen dem Studioaufbau und der Sitzgruppe befand. Das kleine, aber schwere Möbelstück aus Nussbaumholz schimmerte ebenso matt wie das Gehäuse der Kamera.
Es war zwar auch hier nicht Staub gewischt worden, seit Theodor Thieme den Schreibtisch zuletzt benutzt hatte, doch wirkte alles ordentlich aufgeräumt. Vor dem Verlassen des Ateliers hatte Emmas Vater seine Utensilien noch feinsäuberlich in den Schubladen verstaut. Nur das in schwarzes Leder gebundene Terminbuch lag auf der Schreibunterlage aus flaschengrünem Filz. Den Kalender hatte Emma nach dem Unglück durchgesehen, nicht aber womöglich private Korrespondenz, die er hier verwahrte. Emma war bisher nicht auf den Gedanken gekommen, in Unterlagen zu wühlen, die ihr Vater vor ihren Augen und denen des Buchhalters verbergen wollte. Als sie jetzt die Fächer aufzog und nach einem Zettel und Schreibwerkzeug suchte, fiel ihr zum ersten Mal seit dem Unglück ein, dass sie auch diesen Nachlass durchsehen musste.
Überraschend dicke Stapel mit Briefen versperrten den Blick auf Bleistifte, Federhalter, Tintenfass und Papier. Theodor Thieme hatte in den Schubladen etliche Kuverts offenbar ungeöffnet und unsortiert abgelegt. Die Schrift verblasste bereits auf den oberen Umschlägen, was auf ein gewisses Alter der Botschaften schließen ließ.
Die Anwesenheit Dorothee von Hirschbergs war plötzlich vergessen. Verwirrt zog Emma eines der Schreiben aus billigem Papier unter dem Haufen hervor, das ihr nur deshalb in die Hand fiel, weil es dicker als die anderen zu sein schien. Es war offenbar neueren Datums, was auch der runde Poststempel bestätigte: »Lüderitzbucht, 21.07.08, Deutsch-Südwestafrika«. Die Marke selbst zeigte ein Dampfschiff in blassem Purpur und das Wertsiegel »10 Pfennig«, über dem Boot stand in großen Lettern noch einmal: »Deutsch-Südwestafrika«.
Ihr Blick wanderte über den unbekannten Briefumschlag, und doch sah sie im ersten Moment nichts als die weit ausholende, ungewöhnlich große, schwungvolle Schrift, in der die Adresse verfasst worden war. Es dauerte eine Weile, bis sie die Buchstaben im Geiste richtig aneinanderreihte.
An
Fräulein Emma Thieme
Photographisches Atelier Theodor Thieme
Westbazar, Bahnstraße
Groß-Lichterfelde ...
Mit gerunzelter Stirn drehte Emma das Kuvert um. Von derselben Hand, die ihre Anschrift geschrieben hatte, war auch der Absender verfasst:
Constanze Thieme, Diazstraße, Lüderitzbucht, Deutsch-Südwest
Emma las mehrmals den Namen ihrer Mutter, bevor die Buchstaben vor ihren Augen verschwammen. Sie starrte auf den Umschlag, drehte ihn hin und her, versuchte das Datum des Poststempels mit der Verfasserin des Briefs in Einklang zu bringen.
Durch ihr Gehirn wirbelten Eindrücke und Fragen, Verzweiflung und Hoffnung. Ihr Kopf schien nur noch wie ein buntes Spielrad zu funktionieren, das sich immer schneller drehte, bis die Farben und Muster unkenntlich wurden und in einer Masse zusammenliefen.
»Ihr Vater hat niemals eine Todeserklärung nach Paragraph dreizehn des Bürgerlichen Gesetzbuches im Wege des Aufgebotsverfahrens beantragt. Nach dem Gesetz ist Constanze Thieme noch am Leben.«
Die Stimme von Rechtsanwalt Doktor Wohlgemuth hallte durch Emmas Gehirn. Ihr Schall steigerte sich zu einem dröhnenden Crescendo, welches nur in ihrem Innersten zu vernehmen war. Diese seltsame Lautstärke trommelte schmerzhaft gegen ihre Schläfen, drückte gegen ihre Lider und verschleierte ihre Sicht.
Emma begann, unkontrolliert zu zittern. Übelkeit stieg ihre Kehle hoch. Dann wurde ihr schwarz vor Augen.
Kapitel 4
Zwar hatte Dorothee schon Frauen erlebt, die in Ohnmacht fielen, aber das waren meist Konzertbesucherinnen, entrückt von ihrer Musikalität. Auch kannte sie ältere Damen, die einen vermeintlichen Skandal zum Anlass nahmen, nach ihrem Riechsalz zu verlangen oder sich mit einem Schluck aus der stark nach Weinbrand riechenden Medizinflasche in ihrem Beutel zu beruhigen. Noch niemals war sie jedoch Zeugin eines wahrhaftigen, ernstzunehmenden Zusammenbruchs geworden. Und nie zuvor hatte sie sich derart hilflos gefühlt, erschrocken und fassungslos zugleich, wie gelähmt von der unerwarteten Szene.
Entsetzt beobachtete sie, wie Emma in sich zusammensackte. Völlig reglos saß Dorothee in ihrem Sessel, unfähig, der anderen zu Hilfe zu eilen. Ihr war es, als wäre sie die Zuschauerin einer aufregenden Vorführung im neuen Union-Lichtspielhaus am Alexanderplatz in Berlin und Emma die Hauptfigur des gezeigten Films.
Dorothees Erstarrung löste sich erst, als der Kopf der Bewusstlosen mit einem dumpfen Geräusch auf dem Boden aufschlug.
Sie sprang auf und griff nach ihrer Bügeltasche aus schwarzem Leder, die sie zuvor neben sich abgestellt hatte. Zwar besaß sie nicht die geringste Ahnung von Erster Hilfe, einer plötzlichen Eingebung folgend suchte sie in ihrer Handtasche jedoch fieberhaft nach dem altmodischen silbernen Riechfläschchen, das noch von ihrer nach Dorothees Geburt verstorbenen Mutter stammte.
Es war mit einer geheimnisvollen Mischung gefüllt, die stark nach Pfefferminze roch. Was ihren Lungen nach einem Hustenreiz Befreiung schenkte, war gewiss auch für eine Ohnmächtige nützlich, befand sie und kniete sich mit dem kleinen Gefäß neben die halb auf dem Teppich, halb auf den blanken Holzdielen liegende Emma. Sie hielt ihr das Riechfläschchen unter die Nase.
Während Dorothee darauf hoffte, dass der Balsam seine Wirkung entfaltete, wanderten ihre Augen zu dem Brief, der Emma beim Sturz aus der Hand geglitten war. Obwohl ihre Erziehung jegliche Neugier verbat, wurde sie von dem Schreiben wie magisch angezogen. Sie streckte die freie Hand danach aus ...
Emma stöhnte leise. Ihr Arm fuhr hoch und schob das Riechfläschchen zur Seite. Dann schlug sie mit flatternden Lidern die Augen auf. »Was ist los?«, fragte sie. Ihre Stimme klang schläfrig.
»Dieser Brief hier«, Dorothee hob ihn auf, »hat Sie anscheinend echauffiert. Dabei ist er noch nicht einmal geöffnet.«
»Geben Sie her!« Emma entriss der anderen den Umschlag, versuchte sich aufzurichten, sank jedoch unverzüglich wieder zurück. »Oh, ist mir schwindelig.«
Kommentarlos schob Dorothee ihren Arm unter Emmas Kopf.
Eine Weile lang schwiegen die beiden Frauen. Dann sagte Emma leise: »Tut mir leid, ich wollte Sie nicht anschreien. Sie sind sehr nett.«
Dorothee reagierte weder auf die Entschuldigung noch auf das Kompliment. Sie setzte sich auf die Fersen und fragte: »Wollen Sie sich nicht vielleicht besser aufrichten?«
»Ja, das sollte ich. Wenigstens dreht sich jetzt nicht mehr das ganze Atelier um mich.«
Mit tatkräftiger Unterstützung ihrer Besucherin kam Emma auf die Beine. Dorothee war ein wenig überrascht über ihre eigenen Kräfte, denn Emma war größer als sie. Aber es gelang ihr erstaunlicherweise, die andere zu stützen. Schließlich standen sie einander gegenüber – wieder sprachlos und vor allem verlegen.
Dorothee wusste, dass sie gehen sollte. Sie hielt sich schon viel zu lange in dem Photographischen Atelier auf, in dem es keinen Termin für sie gab. Wenn sie länger bliebe, würde sie gewiss die Grenze zu Emmas Privatsphäre überschreiten. Doch aus irgendeinem Grunde schaffte sie es nicht aufzubrechen.
Emma senkte ihren Blick auf den Brief, den sie noch immer fest umklammert hielt. »Der Absender ist meine Mutter«, brach es mit einem tiefen Seufzen aus ihr heraus. »Ich wusste nicht, dass sie lebt.«
»Wie bitte? Sie wussten nicht, dass Ihre Mutter am Leben ist? Das verstehe ich nicht. Über das Schicksal der eigenen Eltern ist man für gewöhnlich doch informiert.«
»Mir wurde gesagt, sie wäre tot.«
»Ach ...« Dorothee zögerte, dann sprach sie aus, was ihr spontan durch den Kopf ging: »Wie wollen Sie wissen, ob sie tatsächlich noch lebt?«
Verblüfft starrte Emma sie an. »Was?«
»Na ja ... ich meine ... Sie haben das Schreiben doch gar nicht gelesen. Vielleicht bedient sich jemand der Adresse Ihrer Mutter, oder es besteht eine Namensgleichheit. Was auch immer: Woher wollen Sie die Wahrheit kennen, ohne über den Inhalt des Briefs Bescheid zu wissen?«
Kaum hatte sie ausgesprochen, errötete Dorothee. Ihre Impertinenz war ungewöhnlich. Meist handelte sie besonnen und benahm sich zurückhaltend. Von Emma Thieme schien sie jedoch seltsam angezogen, fühlte sich ihr vertraut und verbunden.
Dorothee ging durch den Kopf, dass sie sich ein ebensolches Erlebnis wünschte: das Lebenszeichen einer Mutter aufzufinden, die für tot gehalten wurde. Ihre eigene Mutter war im Kindbett gestorben – und sie würde niemals zurückkehren. Vielleicht verhielt sie sich so aufdringlich und neugierig, weil sie – stellvertretend für ihr eigenes Schicksal – an dem Wunder teilhaben wollte, das Emma womöglich erleben durfte. Ohne darüber nachzudenken, schob Dorothee den hohen Hut herunter, und ihr Haar ergoss sich in mahagoniroten Wellen über ihre Schultern. Es war wie eine stumme Bestätigung, dass sie nicht weichen würde, bevor sie nicht alles über den geheimnisvollen Brief erfuhr.
»Meinen Sie, es könnte sich hierbei«, Emma hielt das Kuvert hoch, »um einen Irrtum handeln?«
Im ersten Moment der Enttäuschung ließ sie die Schultern hängen. Dann sank sie in den Sessel, in dem Dorothee zuvor gesessen hatte. Versonnen wog sie den Brief eine Weile in ihren Händen, schließlich riss sie den Umschlag energisch auf und förderte ein dünnes Blatt Schreibpapier zutage ...
Mehrere winzige Steine fielen wie Konfetti heraus und sprangen über den Boden. Sie waren milchig weiß wie Kiesel, wenn auch ein wenig durchscheinender. Im Licht erinnerte ihr aufblitzendes Funkeln zwar an winzige Glasmurmeln, doch waren sie eckig und spitz wie Kandiszucker.
»Was ist das denn?«, entfuhr es Emma.
Dorothee bückte sich, da ihr ein Teil des seltsamen Briefinhalts praktisch vor die Füße gefallen war. Nachdenklich betrachtete sie die Steinchen in ihrer Rechten.
»Ich habe nur eine vage Ahnung, worum es sich handeln könnte«, murmelte sie und legte das Geschenk auf den Tisch, »aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es etwas Kostbares ist. Niemand verschickt etwas von großem Wert einfach mit der Post.«
»Seltsam ...«
»Ja, das denke ich auch. Dabei sehen diese Kiesel aus wie Rohdiamanten.«
»Diamanten?«, wiederholte Emma begriffsstutzig.
Sollte Dorothee der anderen erzählen, dass ihr Vater sie seit Wochen mit der Lektüre von Fachbüchern über Mineralien und den Berichten über die Wertsteigerung von Edelsteinen belästigte? Seit ihr die Konzertreise nach Südwestafrika angeboten und die Bezahlung in Diamanten in Aussicht gestellt worden war, gab es für Hugo von Hirschberg kaum ein anderes Thema, wenn sie abends zusammen bei Tisch saßen. Er war wie besessen und ließ sie nicht in Frieden, bevor sie sich nicht ebenfalls eingehend mit der Herkunft und Verarbeitung der Juwelen beschäftigt hatte. Die geologischen Fachbegriffe hatte sie längst wieder vergessen, nicht aber die Beschreibung von Rohdiamanten. Das Faszinierende war für sie nicht der Wert, Geld interessierte sie nicht, denn sie hatte dank ihres Talents niemals sparsam leben müssen. Aufregend war einzig die Vorstellung, dass es Menschen gab, die sich in der Wüste Südwestafrikas nur niederzuknien brauchten, um die Edelsteine aufzusammeln. Einfach so.
»Wo wurde der Brief abgeschickt?«, fragte Dorothee.
»In Deutsch-Südwest. Der Ort hat etwas mit einer Bucht zu tun ... ich habe mir das in der Aufregung nicht gemerkt«, Emma lächelte verlegen. Sie griff nach dem Umschlag und deutete auf das abgestempelte Postwertzeichen. »Sehen Sie hier ... es heißt Lüderitzbucht.«
»Dann sind diese Steine zweifelsohne echte Diamanten. Wer immer Ihnen geschrieben hat, macht Ihnen damit ein großzügiges Geschenk.«
Kapitel 5
Die Schlange vor dem Schalter des Passagebureaus Max Adler im Nordwesten Berlins reichte bis auf die Neustädtische Kirchgasse hinaus. Manfred von Paschen war als Nächster an der Reihe und spürte die Ungeduld der anderen Wartenden in seinem Rücken. Nur mit Aufbieten allergrößter Disziplin war er selbst in der Lage, in irgendeiner Weise Verständnis für den Herrn vor sich aufzubringen, der seit einer guten halben Stunde mit dem Sekretär der Hamburger Hapag-Reederei verhandelte. Obwohl es Manfred von Paschen zuwider war, kam er nicht umhin, Ohrenzeuge der Diskussion zu werden – und allmählich verließen ihn sein gutes Benehmen und seine sonst vorbildliche Gelassenheit.
»Ich muss auf ein Piano in der Kabine meiner Tochter bestehen!«, donnerte der Kunde in einer Lautstärke, die jedes Sinfonieorchester übertönt hätte. »Wie oft soll ich Ihnen das noch sagen?«
»Wie ich Ihnen bereits sagte«, erwiderte der Sekretär mit einer Geduld, um die ihn Manfred von Paschen beneidete, »gehören Klaviere nicht zu der Ausstattung der Kabinen in der ersten Klasse. Ihr Fräulein Tochter kann sich aber während der Überfahrt auf dem Flügel im Gesellschaftsraum musikalisch betätigen.«
»Meine Tochter betätigt sich nicht musikalisch!«, schnappte der Herr. »Ich verbitte mir derartige Formulierungen. Sie ist eine Künstlerin!«
»Das Instrument wird sicher zur Zufriedenheit Ihres Fräulein Tochter sein. Soviel ich weiß, befindet sich auf der Windhuk ein Bechstein.«
»Aber die Leute! Sie kann doch nicht vor fremden Menschen üben. Das ist ganz ausgeschlossen. Können Sie sich überhaupt vorstellen, was die Musikkritiker schreiben werden, wenn bekannt wird, dass ihr auch einmal ein Fehler unterläuft? Ausgeschlossen. Ich bestehe auf einem Piano in ihrer Kabine.«
Der Schlagabtausch erfolgte seit einer Weile zwar in etwas abgeänderter Wortwahl, inhaltlich änderte sich jedoch nichts.
Manfred hob seinen Spazierstock und tippte dem Wutentbrannten mit dem versilberten Knauf gegen die Schulter. »Pardon, mein Herr, kann ich irgendwie behilflich sein, Ihren Disput ein wenig abzukürzen?«
Der andere drehte sich um und starrte ihn unter schweren Lidern mit einer Mischung aus Verblüffung und Ärger an. »Wie meinen?«
»Nun ...« Manfred lag auf der Zunge, den Vater der musikalischen Tochter darauf hinzuweisen, dass er den Betrieb aufhielt.
Im richtigen Moment wurde ihm jedoch bewusst, dass sie auf
demselben Schiff reisen würden. Auch er war hier, um eine Passage auf der Windhuk zu buchen. Man stritt sich einfach nicht mit Leuten in aller Öffentlichkeit herum, von denen man wusste, dass man mit ihnen wochenlang auf einem überschaubaren Raum eingesperrt sein würde. Und der starrsinnige Wunsch des Fremden nach einem Piano in der Kabine zeugte von einer gewissen Wohlhabenheit, die Manfred außerordentlich ansprechend fand. Kontakte waren für Menschen seines Schlages alles.
Manfred von Paschen gehörte zu den Männern, die mit wenig Aufwand viel erreichen wollten. Zweifellos wäre er in einem anderen Jahrhundert und einem anderen Land besser aufgehoben gewesen, wo Galanterie und Adel noch mehr gezählt hatten als Disziplin und Profit. Ein Edler aus altem brandenburgischem Geschlecht zu sein bedeutete nicht mehr so viel in einer Gesellschaft, die von den vermögenden Freunden des Kaisers und neureichen Industriellen beherrscht wurde. Der schnöde Mammon überwog Esprit und Etikette, Geld schmückte, und ein untituliertes Prädikat vor dem Namen konnte man sich heutzutage damit sogar kaufen. Für Manfred ein erhebliches Problem, denn an nichts mangelte es ihm so sehr wie an einem gut gepolsterten Bankkonto per Geburtsrecht.
Zunächst war er dem scheinbar vorbestimmten Weg vieler zweitgeborener Adelssöhne auf riesigen Rittergütern gefolgt – er ging zum Militär. Manfred meldete sich zum Garde-Schützen-Bataillon in Groß-Lichterfelde bei Berlin. Dabei handelte es sich um das kaiserliche Infanteriekorps, für das hauptsächlich Bürgerliche rekrutiert wurden, dessen Offiziere aber ausschließlich aus altem Adel stammten. Ein Regiment, wie geschaffen für Manfreds Ambitionen. Leider brachte er es nicht so weit wie erhofft, denn seine Karriere endete in einem Skandal.
Sein großer Fehler bestand in seiner Liebe zu den Frauen. Er fühlte sich vom weiblichen Geschlecht angezogen wie von nichts sonst. Schon als Knabe hatte er den Bauernmädchen unter die Röcke gesehen, als Vierjähriger hatte er bereits ein Mädchen im Heu geküsst, zehn Jahre später wusste er, wie sich der nackte Busen der Zofe seiner Mutter anfühlte. Er war attraktiv und charmant und lernte rasch, dass eine schmucke Uniform noch attraktiver und charmanter machte. Besonders Damen der besseren Gesellschaft waren für diese Attribute empfänglich – und ließen sich seine Leidenschaft durchaus etwas kosten. Eine einträgliche Beschäftigung, die seinen Sold aufwertete.
Doch sein Glück stand auf tönernen Füßen. Er war zwar davon ausgegangen, dass sein angenehmes Leben ewig anhielte, doch dann brach das Schicksal wie ein gewaltiges Unwetter über ihn herein. Der dramatische Ehebruch seiner damaligen Geliebten führte vor zwölf Jahren beinahe zu einer Katastrophe; eine unehrenhafte Entlassung konnte er gerade noch abwenden. Als habe sich die Welt nun aber gegen ihn verschworen, geriet er kurz darauf in den Strudel eines Skandals bei Hofe, und er konnte von Glück sagen, dass er nicht in einem Duell getötet worden war.
Richtige Arbeit kam für Manfred von Paschen nicht infrage. Um seinen Lebensstil aufrechtzuerhalten, betreute er ältere Damen und bot sich in den Seebädern zum Zeitvertreib der weiblichen Kurgäste an. Außerdem setzte er in gewissen Etablissements auf sein Glück im Spiel, manchmal, wenn er es sich leisten konnte, besuchte er einen eleganten Club in der Bellevuestraße. Bei all seinen Tätigkeiten ließ er jedoch nicht aus den Augen, dass seine finanzielle Unbequemlichkeit mit einem Mal vergessen wäre, wenn er einen freigebigen Mäzen fand.
Er taxierte sein Gegenüber. Dann schlug er die Hacken zusammen und verneigte sich formvollendet. »Mein Name ist Manfred von Paschen, Leutnant außer Dienst. Ich durfte Zeuge Ihres Gesprächs werden, mein Herr, und stellte fest, dass wir auf demselben Schiff reisen werden.«
Der Fremde schien ein wenig verwirrt, dann tat er der Höflichkeit Genüge und stellte sich mit einem knappen Nicken seines wohl vor Ärger hochroten kahlen Kopfes ebenfalls vor: »Hugo von Hirschberg.«
»Angenehm«, erwiderte Manfred, was inhaltlich sogar stimmte. Er war dankbar, dass er sich mit dem Herrn auf Augenhöhe befand. Auch dieser trug einen Titel, aber keinen Allerweltsnamen. Dazu die Attitüde von Wohlhabenheit – gute Voraussetzungen für eine einträgliche Bekanntschaft. Wenn ihm nur einfallen würde, wie er das Problem Hugo von Hirschbergs lösen und sich damit als Reisegefährte unentbehrlich machen könnte.
»Junger Mann«, wandte er sich an den Sekretär, obwohl dieser gewiss nicht wesentlich jünger als er selbst mit seinen zweiundvierzig Jahren war, »meinen Sie nicht, Sie sollten einem Gast Ihres Unternehmens ein wenig mehr Entgegenkommen zeigen? Die Pianofrage ist doch gewiss einvernehmlich zu lösen.«
Der Angestellte der Hapag-Reederei zuckte hilflos mit den Schultern. »Es ist leider nicht möglich, ein Klavier nach den Wünschen Herrn von Hirschbergs unterzubringen. Die Ausstattung der Kabinen ist nach bestimmten Richtlinien vorgegeben. Schließlich obliegt es dem Schiffseigner, nicht nur für die Bequemlichkeit, sondern auch für die Sicherheit der Passagiere zu sorgen.«
»Papperlapapp!«, schnaubte von Hirschberg.
»Der Atlantik ... gewiss ...«, murmelte Manfred und fragte seinen neuen Bekannten, um Zeit zu gewinnen: »Wohin wird Ihre Reise gehen?«
»Nach Lüderitzb...«