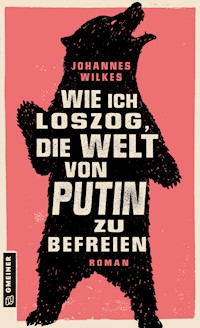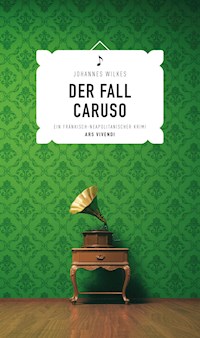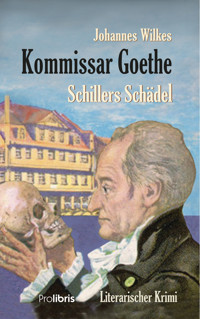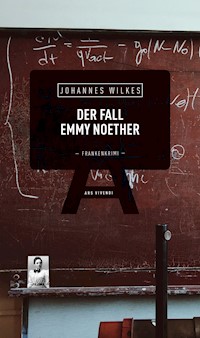Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ars vivendi Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Was wäre Deutschland ohne seine Schwaben?! In hohem Maße gewitzt und originell verfügen sie über eine reiche Geschichte, eine lebendige Gegenwart und zahlreiche Charakterköpfe. 30 Kapitel porträtieren das schöne Schwabenland und seine Bewohner – und widmen sich dabei hochbrisanten Fragen wie der nach den ungeahnten Reizen des schwäbischen Dialekts, nach dem Schönheitsgeheimnis der ansässigen Frauen und der Schwierigkeit, die definitiven Grenzen des "Ländle" festzustellen. Mit gewohntem Augenzwinkern und liebevoll ironischem Ton nähert sich Johannes Wilkes den kulturellen und kulinarischen, politischen und psychologischen, landschaftlichen und literarischen sowie historischen und humorigen Eigenheiten der Region.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 271
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vollständige eBook-Ausgabe der im ars vivendi verlag erschienenen Originalausgabe (1. Auflage April 2018)
© 2018 by ars vivendi verlag GmbH & Co. KG, Cadolzburg
Alle Rechte vorbehalten
www.arsvivendi.com
Lektorat: Eva Elisabeth Wagner
Umschlaggestaltung: ars vivendi verlag
Datenkonvertierung eBook: ars vivendi verlag
eISBN 978-3-86913-872-5
Inhalt
Wo beginnt, wo endet Schwaben?
Über den Charakter der Schwaben
So tapfer wie die Sieben Schwaben?
Sieben schwäbische Helden
Alles über das Schwabenalter
Von der Gesundheit und der Lebenserwartung der Schwaben
Wie glücklich sind die Schwaben?
Die Kehrwoche
Spätzle
Verzeihung, Frau Maultasche!
Von den Reizen des schwäbischen Dialekts
Haben die Schwaben eine Hymne?
Schwäbische Lieder und ihre Dichter
Der Berliner Schwabenkrieg
Der Schwabe und sein Apfel
Stuttgart – Deutscher Meister der Kultur
Der größte aller schwäbischen Dickschädel
Zehn schwäbische Politiker
Schwaben kann auch Kaiser!
Der schwäbische Gruß
Die schwäbische Windskala
Der größte schwäbische Knall aller Zeiten
Der Schwäbische Vulkan
Drei Orte, drei Dichter, drei Gedichte
Weltkulturerbe
Wie intelligent sind die Schwaben?
Zehn schwäbische Erfindungen
Schwäbische Überflieger
Von der Schönheit der Schwäbinnen
Schwäbischer Sex
Über die Psychologie der Sparsamkeit
Der reichste Schwabe aller Zeiten
Schwabenkinder
Von der Religiosität der Schwaben
Die Schutzmantelmadonna von Schwäbisch Hall
Wie denkt sich der Schwabe den Tod?
Wenn es Sie als Arzt ins Schwabenland verschlägt
Sind Sie ein Schwabenkenner? – Quiz
Auflösung
Ihr Ergebnis
Der Autor
Wo beginnt, wo endet Schwaben?
Undifferenziert ist die Sicht vieler Nichtschwaben. Schwaben? Das sind doch die in Baden-Württemberg! Oder die aus dem S-Bahn-Bereich Stuttgarts! Noch schwammiger definieren es die Schweizer. Alle Bewohner des nördlichen Großkantons sind für sie Schwaben, bis hin zur Nord- und Ostseeküste. Doch selbst, wer die Schwaben mit den Württembergern gleichsetzt, irrt, sind doch im Nordosten des Bundeslandes in großen Teilen Franken zu Hause; sogar unweit Schwäbisch Halls, das doch urschwäbisch zu sein scheint, heißt es: »Wir können alles, außer Schwäbisch!« Andererseits lässt sich Schwaben nicht auf die württembergischen Grenzen beschränken; ein dickes Stück des südwestlichen Bayerns, vom Lech aus der Abendsonne hinterher, besteht aus schwäbischen Urlanden.
Und damit ist noch längst nicht Schluss. Schwaben sprengt alle Grenzen! Selbst in vielen Autos mit österreichischem Kennzeichen sitzen Schwaben, auch das schöne Vorarlberg, das westlichste österreichische Bundesland, besitzt schwäbische Täler. Baden-Württemberg, Bayern, Österreich: Die Schwaben bringen das Kunststück fertig, bodenständig und international zugleich zu sein. Und wo wir schon die Welt in den Blick nehmen: Natürlich gibt es da noch die Banater Schwaben, die Stundisten in Südrussland, die Schwabenväter in den USA, die pietistischen Templer in Palästina …
Manche Historiker behaupten gar, der Name »Schwaben« leite sich vom lateinischen Wort suevia ab, »herumschweifen«. Auszuschließen ist das nicht. Auf den Auswanderungsschiffen nach Amerika wurde geschwäbelt, was das Zeug hielt. (Wurde »Schiff ahoi« gerufen, war’s ein Friese, erklang »Hoi, a Schiff!«, stand ein Schwabe am Ufer.) Schon bei der Entdeckung Amerikas soll ein Böblinger den staunenden Indianern zugerufen haben: »Isch koiner aus Beblenga do?« – »Noi, aber aus Sedelfenga!«, schallte es zu Kolumbus’ Entsetzen zurück.
Kein anderes deutsches Land hat so viele amerikanische Siedler gestellt wie Schwaben. Ein Paradoxon: So sehr der Schwabe auch an seinem Ländle hängt, so wenig scheint ihm die Auswanderung etwas auszumachen. Der Schwabe löst diesen Widerspruch, indem er seine neue Heimat sogleich schwäbisch anstreicht, was gelegentlich zu Problemen mit den Ureinwohnern führen kann – im Kapitel über den Berliner Schwabenkrieg werden wir davon noch hören. Um zu unserer Ausgangsfrage zurückzukommen: Schwaben ist überall dort, wo schwäbisch geschwätzt wird. Wenn Sie unsicher sind, ob Sie sich auf schwäbischem Terrain befinden, gehen Sie einfach in die nächste Bäckerei und fragen, ob man Ihnen nicht ein paar alte Brötchen für Ihre Hasen geben könne. Antwortet man Ihnen empört »Ommasooschd?«, können Sie sicher sein: Sie sind in Schwaben!
(Anmerkung für Nicht-Schwaben, welche die Bäckereifachverkäuferin nicht verstanden haben: Die Dame wollte Ihnen lediglich freundlich klarmachen, dass in einer Ecke des Hinterzimmers zwar noch ein paar alte Brötchen herumgammeln, dass aber auch für diese selbstverständlich etwas zu bezahlen sei.)
Über den Charakter der Schwaben
Über den Charakter der Schwaben ist oft gespottet worden, was aber weniger etwas über die Schwaben als über die Spötter aussagt. Undifferenziert sind oft die Betrachtungsweisen der Nachbarvölker. Nicht nur die Schweizer, auch viele Österreicher sehen in jedem Deutschen einen Schwaben. Schon der Berliner Aufklärer Friedrich Nicolai bemerkte: »Der Charakter der Schwaben ist oft auf unbilligste Art missgedeutet worden. In Wien nennt der Pöbel jeden Fremden aus Süddeutschland einen Schwaben – wie ehemals der Pöbel in England jeden Fremden einen Franzosen – und stellt sich darunter einen armseligen, hilflosen Menschen vor, der zur Kaiserstadt kommen müsse, um gebackene Hähnchen zu sehen.«
Friedrich Nicolai konnte darüber nur den Kopf schütteln. Auch das, was im Württembergischen Repetitorium zu lesen stand, verwunderte ihn sehr, nämlich »dass die Schwaben im Ruf einer sehr späten Geistesreife, einer Ungeschliffenheit der äußeren Sitten und einer gewissen Plumpheit in den Fertigkeiten des Leibes und der Seele stehen«. Dick und doof also! Nicolai konnte es nicht glauben und reiste selbst nach Schwaben, um den schwäbischen Charakter zu studieren. Er fand keines der Vorurteile bestätigt. »Die Schwaben zeichnen sich im Allgemeinen, soviel ich bemerken konnte, bloß durch eine unter dem gemeinen Manne weit verbreitete Gemächlichkeit, Zufriedenheit und Ruhe aus.« Ha jo! Was soll man sich denn auch immer gleich ufregge? Lohnt sich nicht und verkürzt das Leben. »Sie haben eine gewisse Treuherzigkeit und ein unbefangenes Wesen an sich, ohne Arglist, die sie auch bei andern nicht vermuten«, stellte Nicolai fest.
Hans Bayer alias Thadddäus Troll, der natürlich Hans Schwab hätte heißen müssen, attestierte vielen seiner Landsleute, aus gegensätzlichen Wesenszügen zusammengesetzt zu sein, ja, er nannte sie sogar schizoid. Zu den zahlreichen Erfindungen des Schwaben zählt unbedingt das »Sowohl als auch«. Der Schwabe lässt sich nur schwer festlegen, stets betrachtet er eine Sache auch von der anderen Seite. »So isch’s no au wieder«, sagt sich der schwäbische Grübler in seinem angeborenen Gerechtigkeitssinn und erhebt die Widersprüchlichkeit zum Prinzip. Kein Zufall, dass der Begründer der Dialektik in der deutschen Philosophie ein Schwabe gewesen ist. Hegel stellt jeder These eine Antithese gegenüber; meint man dann, mit der daraus resultierenden Synthese endlich eine belastbare Aussage tätigen zu können, kommt sogleich die nächste Antithese dahergelaufen.
Friedrich Nietzsche erweitert den Begriff der schwäbischen Widersprüchlichkeit, indem er den Schwaben Unschönes unterstellt: »Gutmütig und tückisch – ein solches Nebeneinander, widersinnig in Bezug auf jedes andere Volk, rechtfertigt sich leider zu oft in Deutschland: man lebe nur eine Zeit lang unter Schwaben.« Nun, nun, werter Herr Nietzsche, bei allem Respekt, wenn etwas tückisch ist, dann diese Aussage! Und außerdem können wir uns nicht entsinnen, dass Sie sich längere Zeit unter Schwaben aufgehalten hätten.
Da trauen wir doch lieber dem Urteil eines Mannes, dessen Name ihn schon als Schwabenkenner ausweist. August Lämmle, der schwäbische Mundartdichter, der nicht immer nur ein Lämmle gewesen ist, beschreibt die Widersprüchlichkeit des Schwaben wie folgt: »Die seltsame Mischung von verschlossener Zurückhaltung und offenbarer Zutraulichkeit, von rechnerischem Scharfsinn und träumerischem Spintisieren, von inniger Religiosität und gänzlich mangelndem Autoritätsglauben, von verschimmelter Nesthockerei und verbissenem Wandertrieb, von unglaublicher Philisterhaftigkeit und offenem Weltsinn – diese Mischung hat eine Vielseitigkeit von Gestalten und Leistungen hervorgebracht, die als Gemeinsames das Ungewöhnliche haben.«
Doch selbst seinen eigenen Genies steht der Schwabe skeptisch gegenüber. »Der Prophet zählt nichts im eigenen Land« – an welches Volk wird Jesus bei diesem Wort wohl gedacht haben? Auch der Schwabe Theodor Heuss seufzte: »Das enge Land hat den Reichtum seiner Begabungen nicht immer ertragen, hat die großartigsten Naturen, Schiller, List, auch Kepler, gequält; Hegel und Schelling haben sich draußen entfaltet; Mörike und Hölderlin hat schließlich Deutschland früher in ihrem Range erkannt, als es die Heimat getan hat.«
Sie vermissen etwas? Was mit der schwäbischen Sparsamkeit ist? Von dieser wird ein späteres Kapitel berichten.
So tapfer wie die Sieben Schwaben?
Jedes Kind kennt sie, die Geschichte von den Sieben Schwaben, die auszogen, ein gefährliches Untier zur Strecke zu bringen, beim Anblick eines harmlosen Hasen jedoch so heftig erschraken, dass ihnen der Angstschweiß ausbrach. Dieser alte Schwank, vielfach illustriert, hat sich in den Köpfen eingenistet und dient seither als Beweis für die Feigheit des Schwabenvolkes. Ein Irrtum von historischer Dimension! Und wohl mehr als das: Wir wollen den Beweis führen, dass die üble Hasenstory mutwillig in die Welt gesetzt worden ist, aus Neid und Missgunst auf den Heldenmut der Schwaben. Bei dem Märchen handelt es sich um nichts Geringeres als um die hundsgemeine Erfindung einer außerschwäbischen Agitprop-Abteilung.
Doch zunächst zu den frühesten Quellen der Hasengeschichte. Dass die Schwaben ängstliche Leute sind und dies sprichwörtlich bekannt sei, behauptete im 15. Jahrhundert ein Vikar aus Lohkirchen, womit wohl Lohkirchen im heutigen Landkreis Mühldorf gemeint war, ein Bayer also. Nachdem sich die schwäbischen Ritter auf die Seite des Markgrafen Albrecht von Brandenburg und gegen Herzog Ludwig den Reichen gestellt hatten, seien die Schwaben bei Giengen an der Brenz vor den Mistgabeln der bayerischen Bauern davongelaufen, behauptete frech der bajuwarische Chronist.
Nicht nur aus Bayern, auch aus Thüringen hagelte es Spott. »Es geht dir wie den Schwaben vor Lucka«, ist ein Sprichwort, das aus dem tiefen Mittelalter stammt. Bei dieser Schlacht im Jahr 1307 hätten sich die Schwaben in Pferdekadavern versteckt, um ihr Leben zu retten. Eine einfache thüringische Frau habe zudem neun Schwaben mit ihrem Spinnrocken erschlagen. Die originelle Waffe sei den schwäbischen Soldaten zur Schande in der Kirche zu Lucka aufbewahrt worden. In derselben Kirche soll auch ein Bild gehangen haben, das fünf tote Schwaben vor einem Backofen zeigte. Das dunkle Versteck sei den schwäbischen Kriegern zur tödlichen Falle geworden, eine alte Frau habe sie mit einer Ofengabel erledigt.
Solche Schauergeschichten gipfelten in der Mär von den »Sieben Schwaben«. Der Nürnberger Hans Sachs, dem wir eine der ersten Fassungen verdanken (wobei uns der Ausdruck »verdanken« nur schwer über die Lippen rutscht), lässt gleich der Schwaben neun vor dem Hasentier zittern. Der schusternde Poet machte sich nicht nur über ihre Ängstlichkeit lustig, sondern zugleich über ihre Dummheit. Als die Schwaben auf ihrer Flucht einen See erreichten, hörten sie jemand »Wat, wat!« quaken und missverstanden das als Aufforderung, durch das Wasser zu waten, worauf sie alle ertranken. Seitdem, so Hans Sachs, seien die Schwaben den Hasen und den Fröschen feind. Zu allem Unglück griffen die Brüder Grimm das Spottgedicht auf und verewigten die Geschichte in ihren Kinder- und Hausmärchen. Nun glaubte aber auch wirklich jeder zu wissen, wie es um den Mut der Schwaben bestellt war. In Sebastian Francks Sprichwörtersammlung aus dem Jahre 1541 liest sich das so: »Hier stehen wir Helden, sagt der Frosch zum Schwaben.«
Dass die Hasengeschichte aus reinem Neid entstanden ist, liegt daran, dass die Schwaben seit alters her für ihren besonderen Mut und ihre Standhaftigkeit berühmt waren. Sie fordern Beweise? Herzlich gerne! Wurde im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation zu den Waffen gerufen, benötigte der Kaiser ein Reichsheer, so stand den Schwaben das Recht des »Vorstreits« zu. Während Bayern, Thüringer und all die anderen gemütlich zusahen, zückten die mutigen Schwaben als Erste ihre Waffen und begannen, das Reich zu verteidigen. Belegt ist das frühe Tapferkeitsprivileg seit dem 11. Jahrhundert, es soll jedoch bereits auf Karl den Großen zurückgehen, der den schwäbischen Herzog Gerold die Kohlen aus dem Feuer holen ließ. Man kann sich gut vorstellen, welches Gegrummel bei den Zuschauern geherrscht haben muss, wenn die Schwaben schon in der ersten Runde alles klarmachten. So ist der Mensch. Zwar bewundert er seine Helden, leicht aber schlägt die Bewunderung in Neid und Missgunst um. Kamen die wieder mal nur zuschauenden Bayern und Thüringer nach einer gewonnenen Schlacht nach Hause und berichteten missmutig vom Verlauf des Kriegszugs, rollten ihre Ehefrauen verzückt die Augen und riefen: »Nein, diese Schwaben!« Welcher Mann hält das aus?
Viele Jahrhunderte ging das so, bis man im 15. Jahrhundert die Kriegsordnung änderte. Auf die tapferen Schwaben aber wollte verständlicherweise auch künftig kein Kaiser verzichten, und so bekamen die schwäbischen Krieger das Recht zugestanden, die Georgsfahne im Feld zu führen. Was für eine Auszeichnung! Jeder Feind erzitterte, wenn er diese Fahne erblickte. Die Georgsfahne, das rote Kreuz auf weißem Grund, das Symbol des heiligen Georg, der mit Todesmut den Drachen getötet hatte, indem er ihm den Spieß in den Rachen rammte. Führt man sich den legendären Drachenkampf vor Augen, so springt einem die Parallele zur Sage von den Sieben Schwaben ins Auge. Hier der Spieß, der den fürchterlichen Drachen tötet, dort der Spieß, an den sich vor dem Hasen zitternd die Sieben Schwaben klammern. Zufall? Wohl kaum. Erneut drängt sich der Verdacht auf, nichtschwäbische Stämme mussten ihr Mütchen mit einem Schmähgedicht kühlen. Rasch ging es von Mund zu Mund – und damit nicht genug: Man begann, die zentrale Szene auf Flugblättern festzuhalten und auf Häuserwände zu pinseln. In München, in Wien, in Straßburg und wer weiß wo noch, amüsierten sich die Bürger beim Anblick der vor Angst schwitzenden Schwaben. Außerdem begann man sich anzugewöhnen, die am Bodensee siedelnden Schwaben »Seehasen« zu nennen.
Richtig interessant aber wird es, wenn man sich ansieht, wie die Schwaben mit dem ausgegossenen Hohn und Spott umgegangen sind. Kein Wort davon, dass sie sich beleidigt gezeigt oder gar wütend zur Wehr gesetzt hätten. Ganz im Gegenteil! Mit schönster Selbstironie, Zeichen echter Souveränität, machten sie sich die Hasengeschichte zu eigen, ja, schmückten sie immer weiter aus und nahmen damit jedem außerschwäbischen Spötter den Wind aus den Segeln.
Zur gleichen Zeit, als die Brüder Grimm ihre Märchen herausgaben, erschienen die Sieben Schwaben in einer Geschichtensammlung von Ludwig Aurbacher. Aurbacher, der 1784 als Sohn eines Nagelschmieds im schwäbischen Türkheim zur Welt gekommen war, hatte in Landsberg am Lech die Schule besucht und später als Lehrer und Schriftsteller in München gewirkt. Möglicherweise, ja sehr wahrscheinlich, musste er als junger Schwabe – er hatte zunächst eine geistliche Laufbahn angestrebt und war in bayerischen Klöstern unterrichtet worden – den Spott seiner Kameraden erfahren. Darauf setzte er sich hin und schmückte die doch etwas dürftige Hasengeschichte auf das Hübscheste aus. Nicht nur den verschiedenen schwäbischen Landschaften setzte er dabei ein literarisches Denkmal, er versuchte auch, jeden der Sieben eine schwäbische Charaktereigenschaft repräsentieren zu lassen. Den Knöpfleschwab aus dem Ries skizzierte er zum Beispiel als gierigen Esser, den Gelbfüßler aus Bopfingen ließ er an einen ängstlichen Laubfrosch erinnern. Eine kleine Kostprobe der trickreichen Gedanken des Gelbfüßlers angesichts des bevorstehenden Kampfes mit dem Hasen: »Entweder läuft das Tier davon, dann laufe ich ihm nach; oder es läuft mir nach, dann laufe ich davon, und so kriegen wir uns beide nicht unser Leben lang.«
Einen anderen Weg, mit dem Spott über den »Schwabenstreich« umzugehen, wählte Aurbachers schwäbischer Landsmann und Zeitgenosse Ludwig Uhland. In seiner Ballade »Schwäbische Kunde«, in der »Kaiser Rotbart lobesam zum heil’gen Land gezogen kam«, blieb ein Herr aus dem Schwabenland hinter den anderen Kreuzrittern zurück, weil sein krankes, schwaches Rösslein nicht mehr konnte. Plötzlich sprengten 50 türkische Reiter daher:
Die huben an auf ihn zu schießen,
nach ihm zu werfen mit den Spießen.
Der wackre Schwabe forcht’ sich nit,
ging seines Weges Schritt vor Schritt,
ließ sich den Schild mit Pfeilen spicken
und tät nur spöttlich um sich blicken,
bis einer, dem die Zeit zu lang,
auf ihn den krummen Säbel schwang.
Da wallte auch dem Schwaben sein Blut! Mit einem Streich schlug er dem Pferd des Türken die Vorderfüße ab, schwang das Schwert erneut, zielte nun mit Macht von oben auf den Scheitel des Gegners und hieb ihn mitten entzwei:
zur Rechten sieht man wie zur Linken,
einen halben Türken heruntersinken.
Kein Wunder, dass Kaiser Rotbart ihn zu sich rufen ließ;
er sprach: »Sag an, mein Ritter wert!
Wer hat dich solche Streich gelehrt?«
Der Held bedacht’ sich nicht zu lang:
»Die Streiche sind bei uns im Schwang,
sie sind bekannt im ganzen Reiche,
man nennt sie halt nur Schwabenstreiche.«
Die Ballade mussten zahllose schwäbische Schülergenerationen auswendig lernen, mit der wachsenden Zahl türkischer Schulkameraden aber wurde sie aus den Lehrplänen entfernt. Lobesam! Niedersinkende Türkenhälften passen nicht mehr in unsere Zeit. Der lockere Umgang Aurbachers mit den Sieben Schwaben aber macht weiter Schule. Selbstbewusst reklamierten immer mehr schwäbische Institutionen den Namen für sich – und das bis heute: Augsburg vergibt den Sieben-Schwaben-Preis, in Ulm und um Ulm und um Ulm herum haben sich sieben Karnevalsvereine unter diesem Namen vereinigt, die Stuttgarter Ultimate-Frisbee-Mannschaft und zahlreiche Gasthäuser sind nach den Sieben Schwaben benannt, es existieren ein Skiclub und zahlreiche Sieben-Schwaben-Firmen, ja selbst die 7-Schwaben-Speaker gibt es, Topleute schwäbischer Unternehmen, die sich karitativ engagieren. Was noch fehlt, das sind Sieben-Schwaben-Tropfen zur Linderung von Angstattacken oder Tierphobien. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.
Wer mehr über die Sieben Schwaben erfahren möchte, dem sei die Lektüre des gleichnamigen Buches aus der Schriftenreihe der Museen des Bezirks Schwaben empfohlen (Band 48, Oberschönenfeld 2013) und natürlich auch das Sieben-Schwaben-Museum in der Ludwig-Aurbacher-Stadt Türkheim. Und wer immer noch an der Tapferkeit der Schwaben zweifelt, der höre das Wort von General Ludendorff aus dem Ersten Weltkrieg: »Alle Landschaften stellten neben guten auch weniger gute Divisionen. Die Schwaben allein hatten nur gute.«
Zur schwäbischen Tapferkeit – ein Nachtrag
Sprache ist verräterisch. Dem Eingeweihten offenbart sie viel über die seelischen Eigentümlichkeiten eines Volksstamms. So gehört es zu einer gründlichen Analyse der schwäbischen Tapferkeit auch, den schwäbischen Dialekt zu befragen. »Dapferle, komm!«, sagt die schwäbische Mutter zu ihrem Kleinkind, wenn sich dieses vor dem Schornsteinfeger fürchtet. In Schwaben kann man sich also durchaus tapfer hinter Mutters Rockzipfel verstecken. Oder hinter ihrer Jeanshose. Dass der Schwabe, so tapfer er auch ist, der Tapferkeit selbst nicht viel abgewinnen kann, beweist aufs Schönste der hübsche Doppelsinn, den das Wort »tapfer« im Schwäbischen besitzt. Es kann zwar durchaus eine Heldentat bezeichnen, genauso gut aber auch ihr Gegenteil. Wenn einer tapfer davonläuft, ist damit gemeint, dass er sich auffällig rasch vom Kriegsschauplatz entfernt, womit wir wieder bei den Sieben Schwaben wären. Die Wörter »tapfer« und »rasch« können synonym benutzt werden. Hier ist sie wieder, die berühmte schwäbische Ambivalenz. Nun aber dapfer zum nächsten Kapitel.
Sieben schwäbische Helden
Um den endgültigen Beweis für den schwäbischen Mut zu liefern, möchten wir in diesem Kapitel sieben Menschen vorstellen, die mit ihrem Leben für ihre Ideale eingestanden sind, ja, manche von ihnen haben sogar mit ihrem Leben bezahlen müssen. Diese sieben Schwäbinnen und Schwaben mögen stellvertretend für all die anderen Helden stehen, an die wir in diesem Buch nicht erinnern können.
Maria Holl
Drei Zeugen. Drei Zeugen braucht es, um einen Menschen vor Gericht zu bringen. Drei Zeugen, die sagen, dass jemand mit dem Teufel im Bunde steht. – Und wenn es nicht genügend Zeugen gibt? Dann finden sich welche, dann greift man zu den bereits Verurteilten, quetscht Zeugenaussagen aus ihnen heraus. Wer den Torturen der Folter entkommen will, dem ist alles egal, der schreit auch ein falsches Geständnis hinaus, bevor man ihn auf den Scheiterhaufen wirft, der brüllt im Schmerzenstaumel Namen angeblicher Komplizen in die Nacht: den der Freundin, des Nachbarn, der Schwägerin.
Maria Holl, die Wirtin des Gasthauses Die goldene Krone zu Nördlingen. Drei Zeugen klagen die 44-Jährige an. Drei Zeugen, die sagen, Maria Holl würde hexen, Maria Holl verkehre mit dem Belzebub, Maria Holl sei beim Höllentanz gesehen worden. Auf dem Weinmarkt, in der Trinkstube, bei Vollmond auf den Rändern des Kraters, den ein gigantischer Meteorit vor Urzeiten geschlagen hat. Mit ihren magischen Kräften vergifte sie Mensch und Vieh.
1. November 1593. Man schafft die Kronenwirtin ins »Klösterle«, in eine Zelle des ehemaligen Barfüßerklosters. Einzelhaft. Am selben Tag hat der neue Bürgermeister sein Amt angetreten. Zufall? Er ist ein verbissener Mann mit einem großen Ziel: Er will seine Stadt, will Nördlingen von den Hexen befreien. Von sämtlichen Hexen. Endgültig, ein für allemal.
5. November. Das erste Verhör. Zwei Examinatoren und vier Ratsherren. Man holt Maria Holl aus ihrer Zelle, konfrontiert sie mit den Beschuldigungen. Sie wehrt sich. Keine von den vorgebrachten Anklagepunkten stimme, sie sei unschuldig, sagt sie mit fester Stimme. Der Protokollant hält fest: »Sie werde nichts bekennen und wenn sie hundert oder tausend Jahre hier liege, denn sie sei nie vom bösen Geist versucht, angereizt oder angefochten worden. Sie setze ihre Hoffnung auf Gott, der sei mit ihr, bei ihr und um sie.«
8. November. Das zweite Verhör. Diesmal vor acht Ratsherren. Und vor zwei schwer gefolterten Zeuginnen, die stöhnend mit dem Finger auf sie zeigen. Maria Holl aber beteuert weiter ihre Unschuld, nichts an den ungeheuerlichen Vorwürfen stimme. Ihr Gewissen sei rein.
14. November. Ein Scheiterhaufen. Die beiden Zeuginnen werden verbrannt. Ihre Schreie dringen in das Gefängnis, hallen von den nackten Wänden wider, bis sie endlich verstummen.
15. November. Ein drittes Verhör. Wieder bestreitet Maria Holl jede Schuld. Der Protokollant: »Sie hoffe, man werde sie wieder auslassen. Gott solle denen verzeihen, die unschuldig Blut vergießen wollen. Sie könne und wisse sich nicht anders zu bedenken, Gott soll sie bei der Gerechtigkeit und der Wahrheit erhalten.«
21. November. Daumenschrauben. Ein eisernes Gewinde, das mittels einer Schraube hinuntergedreht wird, tiefer und tiefer, bis das Gewebe platzt, bis das Blut hinausspritzt, weiter noch, tiefer noch ins Fleisch hinein. Es soll der Wahrheitsfindung dienen. Maria Holl schreit, doch schreit sie nicht, was die Examinatoren hören wollen, sie schreit nur ihre Unschuld hinaus. Man holt den Spanischen Stiefel, zwei Eisenplatten, die um den Unterschenkel und den Fuß geklemmt werden, zieht die Schrauben fester und fester, gießt heißes Pech dazu und dreht zugleich die Köpfe weg. Eine bestialische Schwefelwolke erfüllt den Raum, es stinkt nach verbrannter Haut, nach verbrannten Haaren. Doch Maria Holl gesteht noch immer nicht. Der Protokollant: »Sie wolle sich bedenken auf ein andernmal.«
Die Wahrheit kann bisweilen hartnäckig sein. Gegen ihre Feindin aber, die Lüge, hat sie nur selten eine Chance. Die Wahrheit ist zu langweilig, es fehlt ihr an Einfällen. Ungleich bunter ist die Lüge, sie besitzt etwas, das der Wahrheit fehlt, sie besitzt Fantasie. Und sie macht Versprechungen, süße Versprechungen, wispert Dinge ins Ohr, die wie Himmelsmusik klingen: Mach Schluss! Mach ein Ende! Quäle dich nicht länger. Wahrheit? Was taugt die Wahrheit schon, wenn sie nur noch Schmerz bedeutet?
21. November, 22. November, 23. November. Man muss die Frequenz der Verhöre erhöhen, den Taktschlag. Folter folgt nun auf Folter, Tag für Tag, ohne Unterlass. Eine bewährte Methode. Der Angeklagten keine Zeit lassen, sich wieder zu erholen. Die Wunden, sie schwären, Eiter kriecht ins Gewebe, lässt den Körper glühen. Man sehnt den Schlaf herbei, will nur noch seine Ruhe, will nichts mehr sehen, nichts mehr hören, sinkt auf dem Strohsack zusammen. Doch wie immer man sich auch zu betten versucht, die Schmerzen trommeln einen schnell wieder wach. Panisch zuckt man zusammen, wenn sich Schritte nähern, wenn jemand am Türschloss rüttelt. Es gibt keine Pausen, keine Unterbrechungen mehr: Donnerstag, Freitag, Samstag … Nur den Sonntag lässt man aus. Am Sonntag geht man zum Gottesdienst, am Sonntag wird nicht gefoltert, »um sich selbst die nötige Erholung gönnen zu wollen«, wie es der Protokollant festhält.
Eine genaue Dramaturgie, alles folgt einem festgelegten Ritual. Willkür? Sadismus? Ganz im Gegenteil! Die Prozedur ist genau geregelt, bis ins Detail. Das macht ja gerade den Unterschied aus. Der Teufel, das ist Unordnung und Chaos, das Gerichtsverfahren aber ist Ordnung und Gesetz. Dort das Dunkel, hier das Licht. Nach den Daumenschrauben und dem Spanischen Stiefel folgt der Strang. Maria Holl wird ein Strick um die Hände gebunden, daran zieht man sie mit einem Ruck in die Höhe. Eine Weile halten die Muskeln ihren Körper zusammen, kämpft die Wirtin gegen die Schwerkraft an, bis sie schließlich zitternd ermüdet, bis es nicht mehr geht. Welch hässliches Schmatzen, wenn die Schultergelenke aus den Pfannen springen. Der Protokollant: »Die Angeklagte äußerte den Wunsch, dass unser Herrgott die Obrigkeit erleuchten solle. Sie sei dem Laster nie ergeben gewesen. Gott mache mit ihr, wie er wolle; man wird stets feststellen können, dass sie niemanden in ihrem Leben krank gemacht habe. Sie könne überhaupt keinem Menschen Schaden zufügen.«
Langsam dem Wahnsinn verfallen. Viele verlieren den Verstand. Zurück in der Zelle, können sie vor Angst und Schmerzen nicht mehr schlafen, finden keine Ruhe mehr, schrecken beim geringsten Geräusch zusammen, bekommen Fieber, fangen an, wildeste Fantasien zu durchleiden. Sie wissen nicht mehr, was sie getan haben und was nicht, wissen nicht mehr, was sie noch glauben, noch sagen sollen. Wahrheit, was ist Wahrheit? Was gestern noch sicher gewesen war, gerät ins Wanken. Unumstößliche Gewissheiten verschwimmen zu einem nebeligen Vielleicht. Wo man gestern noch auf festem Boden gestanden hatte, versinkt man heute in tiefem Morast. Das Netz von Sicherheiten, welches das Leben zusammenhält, beginnt zu reißen. Durch das Loch aber tut sich die Hölle auf.
24. November. Das nächste Verhör. Erneut zieht man am Strang, lässt die Wirtin baumeln. Maria Holls Blick wird trübe, vor ihrem Auge beginnen seltsame Bilder aufzusteigen, hässliche Bilder. Die Wirtin beginnt zu sprechen, hastig, stoßweise. Begierig hören die Ratsherren zu, erleichtert zugleich. Na also! Geht doch! Warum denn nicht gleich? Der Protokollant: »Sie berichtete von zwei Katzen, die sie mit Mückenpulver vergiftet hatte, weil sie ihr Eier und anderes weggefressen hatten; ob sie daran gestorben sind, wisse sie nicht, aber wiedergekommen seien sie nicht mehr. Außerdem zeigte sie an, sie habe mit dem Mückenpulver einen Buben umgebracht, was sie sofort widerrief. Man solle sie ein, zwei Tage besinnen lassen.«
26. November. Die nächste Folterstunde. Von Schmerzen fiebernd beginnt Maria Holl zu fantasieren. Es sei ein hübscher junger Gesell zu ihr gekommen, habe ihr geträumt, welcher mit ihr habe zu schaffen gehabt, Thomas Hefelins Sohn. Es sei der Teufel gewesen, das habe sie an den Geißfüßen erkannt. Da habe sie sich dem Bösen verschrieben, wollte sein Eigen werden und dem Vieh und den Menschen schaden.
Als ihre Folterknechte schon zu triumphieren beginnen, widerruft sie aber alles wieder: »Und wenn man mich zerreißet und erzerret, ich kann nichts anzeigen.«
Der Protokollant: »Also wurde der Meister eingelassen, der band sie und stellte sie an den Strang.«
Auch als man droht, sie erneut in die Luft zu ziehen, bestreitet Maria Holl das Gesagte. Sie habe das eben doch nur zugegeben, um der Folter zu entkommen.
Der Protokollant: »Aufgezogen.«
Heftig zieht man an, reißt es Maria Holl in der Höhe. Von oben ruft sie herab, sie wisse nichts, man solle ihr tun, wie man wolle: »Ach Christus erbarm dich mein, du Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt!« Man solle sie herablassen, sie wolle sich bis auf morgen weiter besinnen.
Maria Holls Standhaftigkeit spricht sich herum. Ihre Ulmer Verwandten schreiben empört an den Rat, verwenden sich an höherer Stelle für sie. Niemals habe Maria Holl etwas Unrechtes getan. Auch der Nördlinger Pfarrer setzt sich für die Gefangene ein. Von der Kanzel darf er nichts sagen, dazu hat ihn der Rat verpflichtet, aber bei Hochzeiten spricht er offen aus, was er denkt. Dass der Rat irrt, fürchterlich irrt, dass er nur auf Verräter und Zuträger höre.
Was nun? Wie werden die Ratsherren reagieren? Die Peinigungen abbrechen, Maria Holl freilassen? Ohne ein Geständnis ist keine Verurteilung möglich, so will es das Recht. Bricht man die Folter jedoch ab, lässt man die Angeklagte frei, klagt man sich zugleich selber an, erklärt sich schuldig, jemanden unschuldig ins Gefängnis geworfen, gequält und gefoltert zu haben.
Also gehen die Torturen weiter, heftiger noch als zuvor. Man setzt die Folter auch am Nachmittag fort, mit größtmöglicher Härte. Vergebens. Der Protokollant: »Man habe von ihr abgelassen, obwohl sie zum dritten Mal steif am Strang gehalten und auf- und abgeschnellt worden war.« Am 11. Dezember zieht man sie zweimal am Strang hinauf, lässt sie eine Stunde hängen, am 8. Januar des neuen Jahres legt man ihr zweimal den Spanischen Stiefel um und zieht sie dann viermal am Strang in die Höhe. Maria Holl gesteht nichts. Darauf greift man zu einem neuen Folterinstrument, zur Streckbank, reißt ihr damit die Gelenke aus. Immer noch kein Geständnis.
Woher nimmt Maria Holl die Kraft? Wie kann sie diese unmenschlichen Qualen überleben? Wie gelingt es ihr, standhaft zu bleiben, nicht durch ein falsches Geständnis die Flucht in den gnädigen Tod zu suchen? Immer wieder ruft sie ihren Herrgott zum Zeugen an, ruft nach Jesus Christus als ihrem Beistand. So ist es in den Protokollen belegt. Zu Maria ruft sie nicht. Sie ruft direkt zu ihrem Gott, ruft keinen Fürsprecher an, keinen Vermittler, keinen Heiligen. Auch nicht die Gottesmutter, deren Namen sie doch trägt. Nördlingen und Ulm haben sich früh zur lutherischen Konfession bekannt, so auch Maria Holl. Ist es ihr Glauben, aus dem sie die unfassbare Kraft schöpft? Oder kann sie gar nicht anders, gibt es eine Unfähigkeit zur Lüge? Vielleicht aber schöpft sie ihre nicht versiegende Lebensenergie aus einer gänzlich anderen Quelle, vielleicht ist es allein die Wut, der rasende Hass auf ihre Peiniger. Der Protokollant: »Am jüngsten Tag will sie über die Rache schreien, die sie dahin brächten, falsches Zeugnis zu geben.«
Ein Jahr. Ein volles Jahr bleibt sie im Gefängnis. Dann erst wird der Druck von außen zu groß, und man lässt sie frei. Nachdem man für sich Vorsorge getroffen hat. Nachdem ihr Mann die Verpflegungskosten bezahlt und die Angeklagte ein Schriftstück unterzeichnet hat, in dem sie die Rechtmäßigkeit ihrer Verhaftung bestätigt. Dass bei den Verhören immer gnädig verfahren worden sei. Dass sie keine Rachegefühle hege. Dass sie fürs Erste ihr Haus nicht verlassen wird. Mit dieser Unterschrift hat das Martyrium ein Ende. Zumindest das des Leibs.
Akribisch ist alles festgehalten, alles protokolliert, mit der pedantischen Gewissheit, die nur jemand besitzen kann, der sich im Recht wähnt. Die Buchführung hält fest: 62 Folterungen. 2 Mal mit den Daumenschrauben, 26 Mal mit dem Spanischen Stiefel, 19 Mal mit dem Strang, 15 Mal auf der Streckbank.
Was macht man, wenn man ein Jahr lang gequält worden ist? Wenn der ganze Körper geschunden, wenn man ständig gefoltert worden ist. Wie soll man danach weiterleben? Mit Narben, die weiter schmerzen, mit Erinnerungen, die einen nicht mehr zur Ruhe kommen lassen. Mit Nachbarn, die daran glaubten und vielleicht weiter daran glauben, dass man mit dem Teufel im Bunde steht. Findet man sich dann wieder im Leben zurecht?
Maria Holl macht an der Stelle weiter, wo sie aufhören musste. Sie arbeitet wieder als Gastwirtin, als Wirtin der Goldenen Krone am Weinmarkt, dem ersten Haus am Platz, einem Gasthaus, in dem sogar der Kaiser absteigt. Sie überlebt ihren Mann, auch den zweiten, heiratet ein drittes Mal. Und sie überlebt alle ihre Peiniger, alle Ratsherren, die sie gefoltert haben. Maria Holl wurde 85 Jahre alt. Als sie am 2. Oktober 1634 starb, wurde sie mit allen Ehren bestattet. Die mutige Wirtin hat es nicht nur geschafft, die Folter zu überleben, sie hat mit ihrer Standhaftigkeit auch dafür gesorgt, dass die Hexenprozesse zu Ende gingen. Zumindest in Nördlingen. Dort hat man ihr ein Denkmal gesetzt.
Robert Scholl und seine Kinder Sophie und Hans
Ins Gefängnis hat man ihn gesperrt. Wegen einer unbedachten Äußerung. Eine Arbeitskollegin hatte ihn verpfiffen, hatte ihn bei der Polizei angezeigt. Hitler sei eine Geißel Gottes, hat er gesagt. Das hat gereicht, ihm den Prozess zu machen und einzusperren, in Ulm, wo der gebürtige Schwabe seit zehn Jahren lebt. Es ist das Kriegsjahr 1942, Oktober. Eine unabhängige Justiz gibt es schon lange nicht mehr, die Nazis sind ja bereits seit neun Jahren an der Macht. Erfolglos hat sein Anwalt auf Freispruch plädiert, hat darauf hingewiesen, dass der Angeklagte ein unbescholtener Mann ist, jemand, der sich als Bürgermeister für das Gemeinwohl eingesetzt hat, der mit seinen fünf Kindern eine große Familie ernähren muss. Vergeblich.
Robert Scholl wurde hinter Gitter geschickt, vier Monate muss er hier sitzen. Zusätzlich wurde ihm verboten, seinen Beruf als Steuerberater wieder auszuüben. Welche Strafe aber hätten sie ihm erst aufgebrummt, wenn er seinem Herzen freie Luft verschafft hätte, wenn er hinausgeschrien hätte, was er noch so alles von Hitler und den Nazis hält?
Wie hat diese Brut Deutschland und die Welt schon ins Unglück gestürzt, hat die Seelen der Menschen vergiftet. Und was vielleicht das Schlimmste ist: Auch seine eigenen Kinder hatten die Nazis infizieren können. Hans hatte sich für das propagierte Gemeinschaftsideal begeistern lassen, ebenso Sophie, sein drittes Kind. Sophie war dem BDM, dem »Bund deutscher Mädel« beigetreten, der Naziorganisation für die Schülerinnen, hatte sich eine Uniform schneidern lassen und für einige Jahre begeistert getragen.
Während Robert Scholl in seiner Zelle sitzt, wird er plötzlich aus seinen düsteren Gedanken gerissen. Was ist das? Was ist das für eine Melodie? Helle Flötentöne dringen an sein Ohr. Sie kommen von draußen, aus dem Freien. Irgendjemand hat begonnen, zu musizieren, ein Kind vielleicht. Robert Scholl kennt das Lied, kennt es gut, kann den Text mitsingen:
Die Gedanken sind frei,
Wer kann sie erraten?
Sie fliegen vorbei
Wie nächtliche Schatten.
Kein Mensch kann sie wissen,
Kein Jäger erschießen,
Es bleibet dabei:
Die Gedanken sind frei.