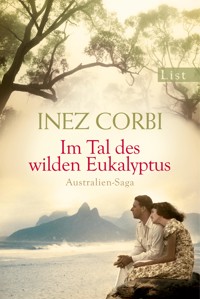7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Australien, 1800: Die junge Irin Moira kommt nach New South Wales, wo ihr ungeliebter, wesentlich älterer Ehemann als Arzt der Strafkolonie arbeiten soll. Einer der Sträflinge ist Duncan, ein verurteilter Rebell. Als Duncan Moira vor einem Überfall rettet, kommen die beiden sich näher. Ihre Liebe scheint jedoch aussichtslos, und so ergreifen sie gemeinsam die Flucht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Das Buch
Die junge Irin Moira war schon immer ein Wildfang, aber mit dem letzten Eklat hat sie den Bogen überspannt. Ihre Eltern zwingen sie, den Arzt Alistair McIntyre zu heiraten, einen Mann, der doppelt so alt ist wie sie. Und zu allem Überfluss muss sie mit ihm auch noch nach Australien auswandern, wo er eine Stelle antritt – in einem Straflager! Fernab von der Heimat und ihren geliebten Pferden gewöhnt sie sich nur schwer an das karge Leben und ihre Rolle als Ehefrau des tyrannischen Alistair. Bis sie Duncan kennenlernt, einen jungen Iren, der als Rebell zu sieben Jahren Verbannung verurteilt wurde. Moira fühlt sich sofort zu ihm hingezogen, und Duncan scheint ihre Gefühle zu erwidern. Eine leidenschaftliche Affäre beginnt. Doch als Alistair die beiden ertappt, bleibt nur eines: die Flucht in den australischen Busch.
Die Autorin
Inez Corbi, geboren 1968, studierte Germanistik und Anglistik in Frankfurt/Main. Sie lebt im Taunus und widmet sich inzwischen vollständig dem Schreiben. Das Lied der roten Erde ist ihr zweiter Roman, eine Fortsetzung ist bereits in Arbeit.
Die Website der Autorin: www.inez-corbi.de
Inez Corbi
Das Lied der roten Erde
Australien-Saga
Ullstein
Meiner Mutter
PROLOG
Irland, März 1787
Ein Vogel sang. Der Ton hallte klar und rein durch die Luft und brach sich an den steinernen Mauern des Kerkers. In dieser freudlosen Umgebung klang das Lied seltsam fehl am Platz.
Der Junge blinzelte. Licht fiel fächerförmig durch die Gitterstäbe. Das Stroh, auf dem er geschlafen hatte, roch faulig. Er erhob sich von seinem Lager und wischte sich ein paar zerdrückte Halme vom Körper. Entlang der Wände konnte er die zusammengekrümmten, schmutzigen Leiber seiner schlafenden Zellengenossen ausmachen. Das Huschen winziger Füße verriet die Ratten. Der Junge hatte sich noch immer nicht an sie gewöhnt, genauso wenig wie an den ständigen, nagenden Hunger. Der pappige Brei, den es zweimal am Tag gab, verdiente nicht die Bezeichnung »Essen«. Dennoch würgte er ihn hinunter. Es gab schließlich nichts anderes.
Das Licht war wunderschön. Wie es so durch das vergitterte Fenster schien, war es nahezu greifbar. Staubflocken und kleinste Teilchen trieben darin wie in einem nährenden Strom. Der Junge trat auf das Licht zu und streckte den Arm aus, badete seine Hand in ihm.
Ob sein Vater auch schon wach war und dieses Licht betrachtete? Der Junge hatte lange vor dem Gefängnis gewartet und gehofft, dass man seinen Vater freiließe. Bis man ihn selbst aufgegriffen und in diese Zelle geworfen hatte. Wie viele Tage das jetzt her war, wusste er nicht. Jedenfalls mehr, als er Finger hatte.
Ob ihre Leute auf sie warten würden? Oder waren sie schon weitergezogen, so, wie sie es immer taten, wenn sie an einem Ort nicht mehr erwünscht waren?
Als ein lautes Quietschen ertönte, zuckte der Junge erschrocken zusammen. Die schwere Kerkertür öffnete sich. Neben ihm richteten sich ein paar schlaftrunkene Gestalten auf. Ein Wärter spähte in den halbdunklen Raum.
»He«, rief er, als er den Jungen entdeckte. »Du bist doch der kleine O’Sullivan! Du kannst gehen.«
Seine Gebete hatten gewirkt! Der Junge trat freudig einen Schritt vor. »Wirklich?«
»Wenn ich es doch sage!«
»Und mein Vater?«
»Dein Vater?« Im düsteren Licht konnte er den Wärter kaum sehen, aber er bildete sich ein, dass der Mann die Schultern hob. »Hat es dir noch keiner gesagt? Den haben sie vorhin gehängt!«
Der Junge starrte den Mann an, sein Magen zog sich zu einem eisigen Klumpen zusammen. Er hörte die Worte, aber etwas in ihm weigerte sich, sie zu verstehen.
»Nein«, murmelte er. »Er hat doch nur ein Pferd gestohlen …«
»Nur ein Pferd? Kleiner, darauf steht die Todesstrafe! Anders wird man euch verbrecherischen Abschaum ja nie los. Und jetzt komm, raus mit dir!«
Das Licht, das durch das Fenster fiel, füllte jetzt die ganze Zelle aus und beschien die Gestalten der anderen. Einer der Gefangenen wisperte etwas, ein Gebet oder einen Fluch, doch der Junge achtete nicht darauf. Er stand wie erstarrt, konnte keinen Schritt tun. Sein Herz klopfte laut.
Dann stürzte die Welt über ihm zusammen.
1.
Moira schreckte mit einem Ruck aus dem Schlaf. Sturm wütete vor ihrem Fenster im vierten Stock und rüttelte an den Fensterläden, die sie nicht geschlossen hatte, weil sie sich auf diese Weise weniger eingesperrt vorkam. Regenkaskaden peitschten gegen die Scheiben. Aber das war es nicht, was sie geweckt hatte. Stimmen, Schritte, das eilige Trappeln von Füßen, die auf den Treppen des schmalen Dubliner Stadthauses hinauf und hinunter liefen. Moira war jetzt hellwach. Sie schlug die Decke zurück, griff nach dem Zunderkästchen und entzündete die Kerze auf ihrem Nachttisch, dann warf sie sich einen Schal über ihr Nachthemd und eilte zur Tür.
Vergeblich. Natürlich war sie verschlossen, wie stets während der vergangenen Wochen. Sie versuchte, durchs Schlüsselloch zu spähen, sah aber nichts, da der Schlüssel von außen steckte. Sie legte das Ohr an die Tür, glaubte ihre Mutter zu hören, die mit durchdringender Stimme Anweisungen gab, und rüttelte am Türknauf.
»Mutter? Bitte mach auf!«
Niemand antwortete.
Wieder Schritte.
Moira verlegte sich aufs Klopfen. »Bitte, Mutter, öffne die Tür! Was ist denn los?«
Jemand drehte den Schlüssel, die Tür öffnete sich. Im Gang stand ihre jüngere Schwester Ivy, die blonden Haare zu einem losen Zopf zusammengefasst, einen Leuchter mit einer brennenden Kerze in der Hand.
»Gott sei Dank! Was ist denn los? Ich habe nur –«
»Vater«, unterbrach Ivy sie ängstlich. »Ich glaube, er stirbt! Komm!«
Gemeinsam eilten die Schwestern die Treppe einen Stock hinunter zum Schlafzimmer der Eltern. Hinter der angelehnten Tür drang ein schmerzerfülltes Stöhnen hervor.
Moira klopfte und schob sich gleich darauf ins Zimmer, Ivy dicht hinter sich. Der Vater lag im Bett, die massige Gestalt unter einer Decke begraben, das sonst so rosige Gesicht aschfahl im Schein einer flackernden Kerze.
»Vater! Was fehlt dir?«
»Es fühlt sich an«, keuchte Philip Delaney, die Hände in die Bettdecke gekrallt, »als wühle jemand mit einem Messer in meinem Unterleib.«
»Was ist mit dir?« Moiras Stimme klang schrill. »Ivy hat gesagt, du würdest sterben!«
»Unsinn!« Mutter erhob sich von einem Stuhl neben dem Bett. Trotz der nächtlichen Stunde lagen ihre Haare makellos. »Es ist nur ein Bauchgrimmen, nichts weiter. Wahrscheinlich hat er wieder zu reichlich dem Essen zugesprochen.« Ihr Blick ging zu Moiras lose herabhängendem Schal. »Es gibt keinen Grund, wie ein Straßenmädchen herumzulaufen. Und ordne dein Haar!«
Zerstreut kam Moira dieser Aufforderung nach, doch ihr Haar war so störrisch wie sie selbst. In die kleinen Löckchen, die Mutters Gesicht wie das der griechischen Vorbilder umgaben, ließ sich Moiras dunkler Schopf kaum zwingen.
Ivy drängte sich neben sie. »Wo bleibt Dr. Ahern?«
»Dr. Ahern weilt wegen dringender familiärer Angelegenheiten auf dem Kontinent. Ich habe das Hausmädchen zu diesem Dr. McIntyre geschickt.« Mutters Stimme klang wie immer. Kühl und gefasst.
»Dem Bekannten von Mr Curran?«
Mutter nickte. »Ich hoffe nur, dass er etwas taugt.« Sie warf einen Blick aus dem Fenster, vor dem es noch immer in Strömen goss. »Euer Vater hat sich für seine Unpässlichkeit das denkbar schlimmste Wetter ausgesucht. Dieser April macht mich noch ganz krank.«
Vor der Tür waren eilige Schritte zu hören. Jane, die Haushälterin, kam mit einer kupfernen, mit glühendem Torf gefüllten Wärmflasche herein, die sie mit einem Tuch umwickelt hatte. Sie keuchte; die vier Stockwerke vom Keller, wo die Küche lag, zogen sich. Mrs Delaney nahm die Kupferflasche und schob sie ihrem Gatten unter die Bettdecke. Der schwere Mann ächzte auf, sein Gesicht verzog sich vor Schmerzen.
»Hoffentlich beeilt Bridget sich«, murmelte Jane, während Mutter die Decke über dem fülligen Leib glattstrich. Moira erhaschte einen flüchtigen, irgendwie strafenden Seitenblick. Aber sie konnte doch nichts dafür, dass es dem Vater schlecht ging!
»Es ist alles deinetwegen!« Mutter schien ihre Gedanken zu lesen. »Wenn er sich nicht so hätte aufregen müssen, dann –«
»Eleanor, bitte!« Philip Delaney versuchte, sich in seinem Bett aufzurichten, sank aber stöhnend wieder zurück.
»O doch, sie weiß es ganz genau. Du bringst deinen Vater noch ins Grab mit deinen … deinen Eskapaden.« Mutters Lippen waren noch schmaler als sonst, ihre Augen blickten kalt.
Moira öffnete den Mund, eine scharfe Erwiderung auf den Lippen, dann schloss sie ihn wieder. Es hatte doch keinen Sinn, sich gegen diese Vorwürfe aufzulehnen.
Als die Türglocke ging, atmete sie auf. Jane eilte hinunter. Nach einer Weile hörte Moira schwere Schritte, dann öffnete Bridget, hörbar außer Atem, die Tür zum Schlafzimmer.
»Dr. McIntyre!« Mutter trat auf den Arzt zu. »Was für ein Glück, dass Ihr kommen konntet.«
Der Doktor, der ebenso wie das Hausmädchen vom Treppensteigen schnaufte, war im Alter ihrer Eltern, schätzte Moira. Ein rotbrauner Backenbart gab seinem Gesicht einen grimmigen, verkniffenen Ausdruck, der durch die schweren Tränensäcke noch verstärkt wurde. Dieser Mann wusste die schönen Seiten des Lebens sicher nicht zu würdigen. Außerdem roch er nach abgestandenem Schweiß. Aber das war kein Wunder – Bridget hatte ihn schließlich mitten in der Nacht aus dem Bett geholt.
Dr. McIntyre stellte seine Arzttasche auf den Nachttisch, seine Schuhe hatten feuchte Abdrücke auf dem Teppich hinterlassen. Er holte eine kleine Brille mit runden Gläsern heraus, setzte sie auf seine grobporige Nase und strich sich mit Daumen und Zeigefinger über seinen Backenbart.
»Wenn ich die Damen jetzt bitten dürfte, den Raum zu verlassen.« Er wandte sich dem Vater zu, ohne darauf zu achten, ob man seiner Bitte nachkam.
Eleanor Delaney scheuchte ihre Töchter hinaus und schloss die Tür von außen. Sie wartete, bis Bridget den Leuchter im Flur entzündet hatte, dann schickte sie die beiden Dienstboten ins Bett. Jetzt war nur noch die Familie versammelt.
Moiras Blick ging zu Ivy. Ihre Schwester, das Tuch um das Nachthemd züchtig geschlossen, ordnete mit den Fingern ihr Haar. Mutter griff helfend ein.
Ivy war in allem so, wie sich Eleanor Delaney eine wohlerzogene Tochter vorstellte. Ihre Stiche bei der Handarbeit waren stets gerade, sie konnte bezaubernd singen und Klavier spielen, und sie liebte schöne Kleider. Wenn man sie in zwei Jahren in die Gesellschaft einführte, würde Ivy unweigerlich die Blicke aller Männer auf sich ziehen. Ihre kleine Nase wies ein wenig himmelwärts, und für ihr feines naturblondes Haar hätte so manche Frau ein Vermögen hergegeben. Nicht einmal Mutter hatte so helles Haar, obwohl sie es wöchentlich mit Zitronensaft behandelte.
Moiras Haar dagegen war nachtschwarz wie das Fell ihrer Stute Dorchas. Für ihr Debüt im März hatte Moira es sich abschneiden lassen, aber seitdem war mehr als ein Monat vergangen, und die einstmals sorgsam gelegten Löckchen waren auf dem besten Weg, wieder zu einer wilden Mähne zu werden. Ein weiterer Minuspunkt auf der endlosen Liste von Vorwürfen, die sie sich immer wieder anhören musste, neben ihrer mangelnden Fähigkeit oder auch dem Unwillen, Klavier zu spielen oder Kissen zu besticken. Ganz abgesehen von ihrem letzten, ungeheuerlichen Fauxpas.
Der Kerzenleuchter im Flur warf flackernde Schatten auf die Wände und den dichten Teppich. Der Sturm hatte sich gelegt, nur noch dann und wann konnte Moira ein paar Zweige gegen die Fenster schlagen hören. Am liebsten hätte sie das Ohr an die Tür zum Schlafzimmer der Eltern gelegt, aber das hätte Mutter, die seufzend auf einen Hocker gesunken war, nie zugelassen. Und so konnte sie nur dastehen und auf die Geräusche lauschen, die aus dem Zimmer drangen.
Gemurmelte Stimmen, dann ein langes Stöhnen. Für eine Weile herrschte Stille, dann setzte es wieder ein. Moira hob den Daumen an den Mund und biss an ihrem Nagel herum, bis Mutters strafender Blick sie traf. Schuldbewusst zog sie den Finger zurück.
Ein leiser Schrei ertönte, der die Frauen zusammenzucken ließ, dann ein Aufseufzen. Wieder Stimmen, dann öffnete sich die Tür.
Dr. McIntyre bat die Frauen herein. »Ein Blasenstein«, sagte er ohne weitere Eröffnung. »Eingeklemmt auf dem Weg nach draußen. Ich konnte ihn zurückdrängen.«
»Dr. McIntyre, Ihr seid ein Engel!« Eleanor Delaney gelang es selbst jetzt noch, gekünstelt zu klingen.
»Und ein wahrer Meister Eures Fachs«, ergänzte ihr Mann. Er saß bleich, aber mit einem glücklichen Lächeln halb aufgerichtet im Bett und wischte sich mit dem Handrücken ein paar Schweißperlen von der Stirn. Auf dem Nachttisch lag eine dünne Sonde, in der Luft schwebte der Geruch einer medizinischen Essenz. »Ich hätte diese Schmerzen keine Minute länger ertragen.«
»Ihr müsst in nächster Zeit viel trinken, Mr Delaney. Wasser, keinen Wein! Auch wenn Ihr damit handelt.« Dr. McIntyre rieb die Sonde mit einem Lappen ab und verstaute sie in einem Futteral, das er anschließend in seine Tasche packte. »Außerdem solltet Ihr mehr auf Eure Ernährung achten. Weniger fette Speisen. Und bewegt Euch mehr.«
»Ja«, seufzte der Vater. »Alles, was Ihr sagt.«
»Ich fürchte dennoch, diese Kolik wird nicht die letzte gewesen sein. Ich rate Euch sehr dazu, den Stein entfernen zu lassen.«
»Eine Operation?« Der Vater wurde noch blasser.
Dr. McIntyre hob die Schultern. »Keine schöne Sache, ich weiß. Aber der Stein ist nicht groß. Wenn Ihr es wünscht, könnte ich in den nächsten Tagen versuchen, ihn auf natürliche Weise zu entfernen.«
Philip Delaney sah aus, als hätte man ihn gebeten, einen lebenden Frosch zu schlucken. Dann nickte er. »Bitte. Tut das. Alles, was mir den Schnitt erspart. Ich werde Euch reichlich entlohnen.«
»Auf natürliche Weise?« Moira konnte ihre Neugier nicht zurückhalten. »Wie meint Ihr das?«
Dr. McIntyre blinzelte sie hinter seinen Brillengläsern verwirrt an. Offenbar war er es nicht gewohnt, dass ihm junge Frauen derartige Fragen stellten.
»Nun«, begann er umständlich, setzte seine Brille ab und sah fragend auf. »Ich weiß nicht, ob –«
»Ihr habt vollkommen recht, Dr. McIntyre«, kam ihm Mutter zu Hilfe. »Das ist wirklich kein Thema, das eine junge Dame interessieren sollte.« Sie lächelte ihm liebenswürdig zu. Irgendwie zu liebenswürdig, wie Moira fand.
»Ein tüchtiger Mann«, sagte Mutter nachdenklich, nachdem sie den Arzt verabschiedet und ihm trotz seines Zauderns eine Kiste besten italienischen Rotweins mitgegeben hatte. »Zu schade, dass er Irland schon so bald verlassen wird.«
*
»Von allen Dingen ist die Freiheit wohl das kostbarste Gut.« John Curran nahm einen weiteren Schluck Tee.
Moira nickte, den Mund voller Gurkensandwich. Während der Zeit ihres Stubenarrests hatte sie sich schließlich selbst wie eine Gefangene gefühlt. Bis auf Bridget, die ihr das Essen aufs Zimmer gebracht, und Ivy, die sich ab und zu verbotenerweise zu ihr geschlichen und ihr erzählt hatte, was es Neues gab, hatte sie niemanden gesehen.
»Wir stehen kurz vor einem neuen Jahrhundert«, fuhr Curran fort. »Ich hoffe, dass die Menschheit ein wenig vernünftiger geworden ist und sich an die Ideale der Französischen Revolution erinnert.«
»Seid Ihr etwa ein Jakobit, Mr Curran?«
Er lächelte. »So würde ich es nicht gerade nennen, Miss Moira. Aber wenn gute Männer nicht handeln, kann das Schlechte immer weiter wachsen. Und manches von dem, was die Jakobiten vertraten, ist durchaus geeignet, diese Welt ein bisschen besser zu machen.«
»Ich weiß so wenig von der Welt«, sagte Moira. »Vater will nicht, dass wir die Zeitung lesen. Er sagt, das gehöre sich nicht für eine Frau.«
Natürlich gehörte es sich genauso wenig, sich als unverheiratete junge Frau allein mit einem Mann in einem Raum aufzuhalten. Aber Miss Egglestone, die auf solche Dinge geachtet hätte, war nicht mehr da, und so war nur das Hausmädchen Bridget anwesend, das sich wie ein dienstbarer Geist im Hintergrund hielt. Moira hätte nicht gedacht, dass sie die altjüngferliche Gouvernante vermissen würde. Doch auch wenn Moira die Handarbeit und das Musizieren nie sonderlich geschätzt hatte, so hatte der Unterricht doch ein wenig Abwechslung in die nicht enden wollende Abfolge gleichförmiger Tage gebracht.
Umso mehr genoss sie es jetzt, sich mit Mr Curran zu unterhalten. John Curran war der Vater ihrer Freundin Sarah – und einer der wenigen, die sich nach dem Skandal nicht zurückgezogen hatten. Sicher, Moira hatte einen schweren, in Mutters Augen sogar unverzeihlichen Fehler begangen. Und doch, wenn sie die Zeit hätte zurückdrehen können, sie hätte es wieder getan. Selbst jetzt musste sie grinsen, wenn sie daran dachte, was am Abend ihres Debüts vorgefallen war.
Für Moira hatte dieser Tag, an dem sie in die Gesellschaft eingeführt werden würde, eine eher lästige Pflicht dargestellt, denn die endlosen Anproben im Beisein von Schneiderin, Gouvernante und ihrer Mutter nahmen ihr die Zeit, mit Dorchas zusammen zu sein. Die Stute war zum ersten Mal trächtig. Moira wollte diese Geburt unbedingt miterleben, und sie betete darum, dass dieser Termin nicht ausgerechnet mit ihrem Debüt zusammenfallen würde. Ihre Eltern hätten nie gestattet, dass ihre Tochter dem Ball fernbliebe.
Doch ganz genauso war es gekommen. Kurz bevor Moira, herausgeputzt wie eine Prinzessin, mit ihren Eltern die Kutsche bestieg, war sie noch einmal heimlich in den Stall geschlüpft. Dorchas’ Euter, das in den vergangenen Wochen deutlich größer geworden war, glänzte, an den Zitzen zeigten sich bereits harzige Tropfen – das sichere Zeichen für eine bevorstehende Geburt. In diesem Moment stand Moiras Entschluss fest.
Kaum hatte sie den ersten Tanz hinter sich, entschuldigte sie sich bei ihrem Tanzpartner und stahl sich durch eine Hintertür nach draußen. Mit der Perlenkette, die Mutter ihr geschenkt hatte, bezahlte sie eine Mietkutsche, die sie nach Hause brachte. Zurück zu Dorchas. Moira war noch nie so glücklich gewesen wie in dem Moment, als der kleine Pferdekörper aus Dorchas’ Leib auf die Erde gefallen war und sie ihn mit Stroh trockenreiben konnte.
Dass ihre Eltern mittlerweile in der Annahme, ihre Tochter sei entführt worden, die Konstabler eingeschaltet hatten – das hatte Moira natürlich nicht erwartet. Als Philip und Eleanor Delaney nach langen Stunden des Wartens und Hoffens schließlich nach Hause gefahren waren, hatten sie ihre Erstgeborene im Stall vorgefunden, das weiße Ballkleid und sie selbst mit Blut, Dreck und Heu beschmutzt. Nie würde Moira Mutters eisigen Blick vergessen, mit dem sie ihre Tochter auf ihr Zimmer schickte. Als hätte sie einen Mord begangen.
Der Skandal war perfekt. Miss Egglestone hatte schon am nächsten Tag gekündigt, und auch die meisten ihrer Bekannten hatten sich seitdem zurückgezogen. Sogar einige von Vaters Kunden waren ausgeblieben. John Curran war einer der wenigen, die der Familie noch beistanden.
»Sarah will auch immer so viel von mir wissen«, riss dieser sie jetzt aus ihrer Erinnerung. »Neulich erst musste ich ihr genau erklären, wie ich meinen letzten Freispruch erreicht habe.« Er wischte sich den Zeigefinger an einer Serviette ab.
Moira mochte den kleinen, linkischen Mann, der trotz seiner unscheinbaren Statur einer der angesehensten Anwälte Dublins war. Sie hörte ihm gerne zu, vor allem, wenn er über sein Steckenpferd, die irische Befreiung, redete. Obwohl er wie sie alle Protestant war, setzte er sich für die Belange der Katholiken ein. Nachdem im vergangenen Jahr ein landesweiter Aufstand blutig niedergeschlagen worden war, hatte er die Verteidigung einiger Rebellenführer übernommen – und dank seiner glänzenden Rednergabe so manchen Angeklagten freibekommen. Dabei schien ihn kaum etwas zu einer solchen Aufgabe zu befähigen. Er war schmal und kurz gewachsen und dazu mit einer Stimme ausgestattet, die sich anhörte, als käme sie aus einer rostigen Gießkanne.
»Leider konnte ich nicht allen helfen. Einige dieser armen Gestalten verschifft man jetzt als Sträflinge nach –«
»Moira!« Mutters Stimme durchschnitt den Raum wie eine Messerklinge. Moira sprang schuldbewusst auf. »Es tut mir sehr leid, Mr Curran, wenn meine Tochter Euch belästigt hat. Man sollte meinen, sie wüsste, was sich geziemt.«
»Aber nicht doch.« Curran erhob sich, als Mrs Delaney, gekleidet in raschelnde cremefarbene Seide, auf ihn zukam, und deutete eine Verbeugung an. »Wir hatten eine ganz reizende Unterhaltung. Eure Tochter ist eine vielseitig interessierte junge Frau.«
Mutter lächelte säuerlich. »Etwas mehr Interesse an anderen Dingen stünde ihr gewiss besser zu Gesicht. Aber setzt Euch doch, lieber Mr Curran. Du auch, Moira.«
Moira, die erwartet hatte, dass Mutter sie auf ihr Zimmer schicken würde, nahm zögernd wieder Platz.
»Mr Curran hat Hamilton Rowan verteidigt«, brach es aus ihr heraus, während Bridget der Mutter eine gefüllte Teetasse reichte.
»Tatsächlich?« Eleanor Delaney verzog keine Miene und warf einen Blick zur Tür, als erwarte sie jemanden. Sie goss etwas Milch in ihren Tee. »Haltet Ihr es wirklich für angebracht, Mr Curran, Euch mit diesen … diesen Rebellen abzugeben?« Sie spuckte das Wort aus wie ein ungenießbares Stück Fleisch, dann hob sie die Tasse zum Mund.
Curran neigte den Kopf. »Verehrte Mrs Delaney, bei allem nötigen Respekt, aber was würdet Ihr denn tun, wenn man Eure Rechte immer mehr beschnitte? Glaubt Ihr nicht, dass auch den Katholiken ein Teil vom Kuchen zusteht?«
Mutter setzte die Tasse mit vollendeter Anmut ab. »Lieber Mr Curran, wir wollen uns diesen schönen Tag doch nicht mit solch unerfreulichen Themen verderben.«
Curran beugte sich diesem Wunsch mit undurchdringlicher Miene. Moira konnte sehen, wie seine rechte Augenbraue zuckte.
»Ich hoffe, Euer Gemahl ist wohlauf«, sagte er schließlich.
Eleanor Delaneys Züge wechselten zu einem erleichterten Lächeln. »Oh, in der Tat. Dr. McIntyre ist noch bei ihm. Ich habe gerade erfahren, dass die Bemühungen der letzten Wochen von Erfolg gekrönt waren. Eine weitere Sitzung wird nicht nötig sein.«
»Das freut mich zu hören.«
»Ja, es war ein großes Glück, dass wir Dr. McIntyre begegnet sind. Wir sind ihm überaus dankbar.« Sie blickte erneut zur Tür. »Wirklich, das sind wir. Irland verliert mit ihm einen guten Arzt. Jetzt will der gute Dr. McIntyre also sein Glück in der Wildnis der neuen Kolonien versuchen … Welch reizvolles Abenteuer.«
Moira blickte erstaunt auf. Sie hätte gedacht, dass Eleanor Delaney als Letzte für solche Abenteuer zu haben wäre.
»Neue Kolonien?«, fragte sie. »Geht er nach Amerika?«
»Nein, Miss Moira«, antwortete Curran, »nach Neuholland, auch terra australis genannt. Aber ganz so wild, wie Ihr, Mrs Delaney, meint, wird es dort wohl nicht mehr zugehen. Sydney existiert immerhin schon seit elf Jahren, und auch weitere Ansiedlungen scheinen zu gedeihen.« Er lächelte. »Obwohl ich zugeben muss, dass mich selbst nichts dorthinziehen würde. Es ist einfach zu weit weg.«
»Nun«, gab Mutter zurück, »ich bin sicher, dass Dr. McIntyre in terra australis schnell zu einem bedeutenden Mann aufsteigen wird. Ist denn inzwischen bekannt, wann er abreist?«
Curran schüttelte den Kopf. »Die Minerva liegt schon seit Wochen bei Cork vor Anker. Der arme Alistair.« Curran nahm noch einen Schluck Tee. »Er hatte seine Praxis bereits aufgegeben und wollte sich einschiffen, als man ihm sagte, dass sich die Abreise um unbestimmte Zeit verzögern würde.«
»Es ist sehr großzügig von Euch, ihn solange bei Euch wohnen zu lassen«, warf Moira ein. Ivy hatte ihr davon erzählt.
Curran lächelte ihr freundlich zu. »Das ist ein Gebot unter Freunden. Ich konnte ihn doch nicht auf der Straße sitzen lassen – schließlich ist sein Nachfolger mit seiner Familie längst in die neuen Räume eingezogen.«
»Und Dr. McIntyre hat keine Familie?«
»Nein. Seine Ehe blieb kinderlos, und seine Frau ist im vergangenen Jahr gestorben.«
»Haben die Rebellen sie umgebracht?«, wollte Moira wissen.
Curran wirkte für einen Moment verwirrt, und auch Mutter sah sie irritiert an.
»Nein, sie … war krank«, sagte er dann. Moira fiel das kurze Zögern in seiner Antwort auf.
»Und Dr. McIntyre konnte ihr nicht helfen?«
»Nein. Es gibt Krankheiten, bei denen auch der beste Arzt versagt.«
Mutter zuckte zusammen, als es an der Tür klopfte.
»Herein!«, rief sie und stellte die Teetasse etwas zu hastig ab. Eine bräunliche Lache bildete sich auf der Untertasse. Sie schien es nicht zu bemerken.
Jane, die Haushälterin, erschien. »Ma’am, Miss? Mr Delaney wünscht Euch zu sprechen.«
So nervös hatte Moira ihre Mutter noch nie gesehen. »Mr Curran, Ihr entschuldigt uns?«
Curran hatte sich erhoben, verneigte sich würdevoll und blieb stehen, bis die beiden Frauen den Raum verlassen hatten.
Mutter eilte wortlos und mit raschelndem Seidenrock die Treppe hinauf. Ihr Schweigen beängstigte Moira mehr, als wenn sie ihr erneut eine Strafpredigt gehalten hätte.
»Warte«, sagte Mutter, als sie vor dem Zimmer der Eltern angekommen waren. »Lass mich dich ansehen.«
Mit zwei Fingern zupfte sie an Moiras Haar herum, dann holte sie tief Luft und klopfte an der Tür. Bei ihrem Eintreten erhob sich Dr. McIntyre von einem Stuhl.
»Vater! Geht es dir gut?« Moiras Blick flog zum Bett. Auf Vaters rundem, rosigen Gesicht lag ein seliges Lächeln.
»Aber ja, Liebes. Es geht mir sogar ausgesprochen gut. Dr. McIntyre hat mir lediglich noch einige Tage Bettruhe verordnet.«
Neben ihm hüstelte seine Frau. Philip Delaney wies auf einen weiteren Stuhl. »Setz dich, Moira. Dr. McIntyre möchte mit dir sprechen.«
Moira sah ihren Vater verwirrt an. »Aber ich bin nicht krank.«
Mutter seufzte auf. »Gott, ich wünschte, du wärst es. Dann gäbe es vermutlich ein Heilmittel für dein Verhalten!«
»Miss Moira«, sagte Dr. McIntyre in diesem Moment. Er fuhr sich über seinen Backenbart. Sein fleckiges Gesicht hatte eine rötliche Färbung angenommen.
»Miss Moira«, sagte er noch einmal und räusperte sich. »Erweist mir die Ehre, Euch zur Frau zu nehmen.«
»Was?!« Moira blieb der Mund vor Überraschung offen stehen, dann begann sie zu lachen. Es war einfach zu absurd. Glaubte dieser alte Bock tatsächlich, er könnte um ihre Hand anhalten?
Dr. McIntyre lachte nicht. »Euer Vater hat schon eingewilligt. Wenn Ihr –«
»Mein lieber, mein guter Dr. McIntyre«, unterbrach ihn die Mutter freudig. »Ich … Wir … Von Herzen gerne!«
Moira erstarb das Lachen in der Kehle. Sie starrte ihre Mutter an, als sei dieser plötzlich ein zweiter Kopf gewachsen. Das konnte sie doch nicht ernst meinen! Sicher würde sie gleich aufwachen und erkennen, dass dies alles nur ein Alptraum war.
Aber sie wachte nicht auf. Das hier war die Wirklichkeit.
Sie hatte gar nicht bemerkt, dass sie aufgestanden war. »Nein!« Ihre Stimme hörte sich ganz fremd an. »Nein, das werde ich ganz sicher nicht!«
»Moira! Hört nicht auf sie, verehrter Dr. McIntyre. Sie meint es nicht so. Nicht wahr, Moira?« Mutters Stimme hatte einen drohenden Unterton angenommen.
Moiras Gedanken flogen, ihr Herz hämmerte schmerzhaft. Ihr fiel nur eines ein, mit dem sie verhindern konnte, wie ein Stück Vieh an diesen alten Mann verschachert zu werden.
»Ich … ich bin nicht mehr unberührt«, platzte sie heraus und spürte, wie ihr bei diesen Worten das Blut ins Gesicht schoss.
Philip Delaney fiel mit einem dumpfen Ton zurück ins Kissen. Die Züge ihrer Mutter entglitten, zeigten pures Entsetzen. Für einen Moment tat sie Moira sogar leid.
»O Moira, wie konntest du nur?« Kraftlos sank sie neben ihrem Mann auf das Bett. »Was habe ich nur verbrochen, dass ich so gestraft werde?«
Es herrschte betretenes Schweigen; nur Mutters leises Schluchzen erfüllte das Zimmer. Moira stand in der Mitte des Raumes, ihr Herz klopfte laut. Sie wollte ihren Eltern keinen erneuten Schmerz bereiten, doch sie musste es tun, um sich selbst zu schützen.
Lediglich Dr. McIntyre schien unbeeindruckt, seine anfängliche Unsicherheit war wie weggeblasen. »Mrs Delaney, wenn ich etwas vorschlagen dürfte?«
Mutter hob den Kopf und winkte stumm mit der Hand.
»Ich habe gewisse Zweifel an dieser Aussage. Mit Eurer Erlaubnis würde ich die Behauptung Eurer Tochter gerne überprüfen. Durch eine ärztliche Untersuchung.«
»Wie bitte?!« Moira glaubte sich verhört zu haben.
»Ich möchte nur sichergehen, dass Ihr die Wahrheit sagt.«
»Vater!«
Philip Delaney war sein Unbehagen anzusehen, als er ihrem verzweifelten Blick auswich. »Du solltest tun, was er sagt«, murmelte er.
Moira sah entgeistert zu, wie Dr. McIntyre seine Brille aus einem Etui holte, sie aufsetzte und anschließend seinen ausgebeulten Arztkoffer aufklappte.
»Bitte, Miss Moira, wenn Ihr so freundlich wärt.« Er wies auf eine Ecke des Schlafzimmers, wo ein Paravent und ein Sessel standen. »Es dauert nicht lange. Und wenn Ihr wirklich nicht mehr unberührt seid, wird es auch nicht weh tun.«
Die plötzliche Stille lastete wie ein Alpdruck auf Moira, ihr Herz raste.
»Ich denke ja nicht daran.« Sie machte einen Schritt auf die Tür zu.
Im nächsten Moment verstellte ihre Mutter ihr die Tür. »Du wirst diesen Raum nicht eher verlassen, als bis wir Klarheit haben!«
Moira schluckte, ihr Kopf war vollkommen leer. Aber nicht um alles in der Welt würde sie sich von diesen Fingern berühren lassen!
Ihre abwehrend erhobenen Schultern sanken zurück. »Das wird nicht nötig sein«, flüsterte sie kaum hörbar, mit gesenktem Kopf und brennenden Wangen. »Ich … ich habe gelogen.«
»Was sagt Ihr?«, fragte Dr. McIntyre, der die kurze Szene ohne erkennbare Regung verfolgt hatte. »Ich habe Euch leider nicht verstanden.«
»Ich habe gelogen!«
»Dann seid Ihr also noch unberührt?«
Moira nickte stumm, das Blut pulsierte in ihren Ohren. Von ihren Eltern kam ein doppeltes Aufseufzen.
Dr. McIntyre lächelte grimmig. »In diesem Fall, Mr Delaney, meine Damen, steht einer baldigen Vermählung nichts im Wege.«
Moira bekam kaum mit, wie Dr. McIntyre und ihre Eltern einander die Hände schüttelten und zu ihrer Verbindung beglückwünschten. Sie wusste nur, dass sie soeben den ersten Schritt in Richtung Abgrund getan hatte.
2.
Der Blick aus dunklen Augen strahlte Vertrauen aus und fast so etwas wie Mitgefühl. Weiche, haarige Lippen kitzelten Moiras Handfläche, als die schwarze Stute den Apfel entgegennahm. Dorchas blies warme Luft aus ihren Nüstern und begann zu mahlen. Mit geschlossenen Augen drückte Moira ihren Kopf an den Pferdeleib, bis ihre Haut prickelte, spürte den warmen Körper, das pochende Herz, und sog den vertrauten starken Duft ein.
Etwas Feuchtes berührte ihre Hand. Als sie die Augen öffnete, sah sie das Fohlen, tintenschwarz wie seine Mutter, und kniete lächelnd nieder, das warme Gefühl bedingungsloser Zuneigung im Bauch.
»Guten Morgen, Ossian«, flüsterte sie. Sie hatte den kleinen Hengst nach dem kriegerischen Barden aus den Sagen getauft. Für dieses Tier war sie bei ihren Eltern in Ungnade gefallen. Und doch war die Geburt des Fohlens die wundervollste Erfahrung, die Moira je gemacht hatte.
Sie nahm Striegel und Kardätsche aus ihrer Wandhalterung und begann, Dorchas mit langsamen, gleichmäßigen Bewegungen zu bürsten. Die stickige Wärme im Stall und die Bewegung ließen Moira schon bald in Schweiß ausbrechen, aber sie arbeitete angestrengt weiter, bis Dorchas’ schwarzes Fell wieder glänzte. Ungeduldig wedelte sie eine Fliege fort und hängte ihr Arbeitsgerät zurück an die Stalltür. Die Haare klebten ihr feucht an Stirn und Schläfen. Sie trat aus der Stalltür und hielt das Gesicht in die warme Brise. Ein schwacher Salzgeschmack legte sich auf ihre Zunge – der Hafen war nah. Wie gerne wäre sie jetzt ausgeritten, vielleicht die Straße entlang nach Donnybrook, oder auch nach Ballsbridge. Aber es ging nicht. Nicht heute, am Tag ihrer Hochzeit. Und vielleicht nie mehr.
Ein Knoten ballte sich in ihrer Kehle. Sie biss die Zähne zusammen, um die aufsteigenden Tränen zurückzudrängen, und blickte hinüber zum umzäunten Gelände des Merrion Parks, den die hochherrschaftlichen Häuser der Reichen säumten. Von hier aus war es nicht weit bis ins Herz Dublins, obwohl Moiras Eltern auch für die kurze Strecke meist die Kutsche nahmen. Die unbefestigten Straßen verwandelten sich nach den häufigen Regengüssen in eine schlammige Masse, und der Vater schimpfte jedes Mal, wenn er sich nach einem Besuch bei seinen Kunden die Schuhe auskratzen lassen musste. Bis der Wagenschuppen errichtet worden war, hatte ihre Kutsche in den Stallungen hinter dem langgestreckten Garten an der Rückseite ihres Hauses gestanden, dort, wo Moira sich jetzt befand. Dahinter lag offenes Gelände. Hier war sie schon so manches Mal entlanggeritten, über Felder und saftiggrüne Wiesen bis zum Hafen von Irish Town, von wo aus sie den einlaufenden und abfahrenden Schiffen zuschauen konnte. Früher war sie oft mit ihrem Vater dort gewesen, doch seit England sich mit Frankreich im Krieg befand, war es fast unmöglich geworden, auf gesetzlichen Wegen an französischen Wein zu kommen. Philip Delaney musste immer mehr auf spanische und italienische Händler ausweichen, zu denen er längst nicht so gute Verbindungen hatte wie nach Frankreich. Was sich an französischem Burgunder noch in seinem Weinkeller befand, verkaufte er zu Höchstpreisen, doch der Vorrat schwand rapide.
Sie trat zurück in den Stall und drückte ihr Gesicht erneut in Dorchas’ dichtes Fell. Die Stute drehte den großen Kopf und legte ihn an Moiras Schulter. Jetzt kamen ihr doch die Tränen. Aber sie wollte nicht weinen. Jemand wie Moira weinte nicht.
»Das ist alles so ungerecht«, flüsterte sie. »Ich will hier nicht weg!«
Dorchas schnaubte, als würde sie verstehen.
»Ach, hier bist du.« Die Stimme ihrer Schwester riss Moira aus ihrem Kummer. Hastig richtete sie sich auf und wischte sich die Tränen aus dem Gesicht. »Mutter sucht dich.«
»Das kann ich mir denken«, murmelte Moira. »Sie kann mich wohl nicht schnell genug loswerden.« Sie vergrub ihre Hand in Dorchas’ dichter Mähne. »Ach, Ivy. Ich will das nicht! Ich will nicht seine Frau werden!«
Ivy blickte betreten zu Boden. »So schlimm finde ich Dr. McIntyre gar nicht.«
»Ach nein? Dann kannst du ihn ja heiraten! Kannst ihm seinen alten faltigen Hintern streicheln und ihn füttern, wenn er den Löffel nicht mehr halten kann!«
Ivy versuchte sichtbar, ein Grinsen zurückzuhalten. »Vater sagt –«
»Vater!« Moira spuckte das Wort aus, als enthalte es Galle. »Vater hat mich an ihn verkauft! Von Mutter hätte ich nichts anderes erwartet, aber Vater! Er gibt mich dem Erstbesten zur Frau, der um meine Hand anhält!«
Wieder schossen ihr die Tränen in die Augen, aber sie blinzelte sie hastig fort. Vaters Verrat war am schlimmsten zu ertragen.
»Er meint es doch nur gut«, versuchte Ivy zu beschwichtigen. »Er sagt, Dr. McIntyre ist ein guter Arzt, und ein –«
»Dr. McIntyre ist ein widerlicher Tattergreis!«
»Er ist zwei Jahre jünger als Vater. Und es gibt viele junge Frauen, die ältere Männer heiraten. Kennst du Rosie Farelly? Sie hat ihren Vormund geheiratet, und sie scheint sehr glücklich zu sein!«
»Sie muss ihn ja auch nicht bis ans Ende der Welt begleiten! Neuholland! Was gibt es dort schon? Sträflinge und wilde Tiere!« Moira redete sich immer mehr in Rage. »Es dauert fast sechs Monate, bis wir dort sind. Sechs Monate! Wie soll ich das nur ertragen? Zusammen mit diesem … diesem Dr. Sauertopf!«
Ivy kicherte, und dann musste auch Moira lachen, bis beide Schwestern Tränen in den Augen hatten.
»Dr. Sauertopf«, keuchte Ivy. »O Moira, wie werde ich dich und deine Sprüche vermissen!«
Mit einem Schlag wurde Moira wieder ernst. Bei der Vorstellung, demnächst all das hier hinter sich lassen zu müssen, krampfte sich ihr Magen zusammen, als hätte sie etwas Schlechtes gegessen.
»Ich könnte wegrennen«, murmelte sie. »Dann wäre ich wenigstens frei. Ich könnte Pferde züchten und ein eigenes Gestüt haben und das tun, was ich will.«
Noch während sie es aussprach, wurde ihr klar, wie absurd ihre Aussage war. Sie musste sich anhören wie ein kleines Mädchen, dem ein Wunsch abgeschlagen worden war. Natürlich ging es nicht. Wer sollte sie aufnehmen? Wo sollte sie wohnen, was sollte sie essen? Als Frau hatte sie kein Geld und keine Rechte.
»Ich kann doch Dorchas und das Fohlen nicht zurücklassen!«
»Jetzt mach es dir doch nicht so schwer.« Ivy blickte sie hilflos an. »In Neuholland gibt es sicher auch Pferde.«
»Willst du mich etwa auch loswerden?« Moira hob kämpferisch den Kopf, um nicht schon wieder in Tränen auszubrechen. Sie würde sich keine Schwäche mehr erlauben.
»Moira!« Wie eine Statue stand Mutter in der Stalltür und kräuselte die Nase; ganz leicht nur. Nur so wenig, dass ihre Nasenflügel sich hoben. Moira hasste diesen Gesichtsausdruck. So sah Mutter sie immer an, wenn sie wieder etwas vermeintlich Ungeheuerliches getan hatte. »Komm sofort zurück ins Haus! Meine Güte, Kind, was denkst du dir nur? Und wie du riechst! Wie der letzte Pferdeknecht.« Eleanor Delaney drehte sich um. »Bridget! Setz einen Kessel Wasser auf. Meine Tochter wünscht zu baden. Und danach werden wir aus ihr eine wunderschöne Braut machen.«
*
Die schweren, mit großen Blumen bedruckten Vorhänge waren zugezogen, dennoch war es nicht richtig dunkel in dem Zimmer, das bis vor kurzem die Gouvernante bewohnt hatte. Moira lag im Bett, mit klopfendem Herzen, die Decke hochgezogen bis zu ihrer Nase. Die Abenddämmerung tauchte den Raum in ein düsteres Zwielicht und ließ den mit graphischen Mustern bemalten Boden noch unheimlicher erscheinen. Ein schmaler, hoher Schrank erhob sich an der gegenüberliegenden Wand, daneben standen eine große und eine kleinere Truhe. Sie gehörten Dr. McIntyre. Am Morgen waren sie von Mr Currans Haus in dieses Zimmer gebracht worden, wo das frisch verheiratete Ehepaar bis zur Abreise wohnen würde.
Seit wenigen Stunden war sie nun Mrs Alistair McIntyre, ein Name, der so fremd auf ihrer Zunge schmeckte wie eine ungewohnte Speise. Alistair. Ob sie sich je daran gewöhnen würde, ihren Ehemann bei diesem Namen zu nennen? Sie bezweifelte es.
Die Tür öffnete sich, und sie hörte mehr, als dass sie es sah, wie er den Raum betrat. In ihrem Magen machte sich ein flaues Gefühl breit, ihr war etwas übel. Sie hörte, wie er sich seiner Kleidung entledigte, lag stocksteif da und beobachtete ihn. Ihr Herz schlug schmerzhaft laut. Was sie wohl gleich erwartete? Vielleicht würde er sich ja einfach nur neben sie legen und schlafen?
Er bewegte sich dunkel vor dem nur wenig helleren Hintergrund, eine krummbeinige Gestalt, die jetzt ein bodenlanges Nachthemd überstreifte. Kurz verharrte seine Hand unter dem Hemd, es sah aus, als bewegte er sie dort. Dann schlug er die Decke zurück und legte sich neben sie. Moira zwang sich stillzuhalten, obwohl der Ekel sie zu übermannen drohte. Sie presste Augen und Mund fest zusammen und wünschte, sie könnte auch ihren Geruchssinn abschalten, als ihr das säuerliche Aroma von altem Schweiß in die Nase stieg. Wenigstens küsste er sie nicht. Sonst hätte sie sich vermutlich übergeben müssen.
»Es ist die Aufgabe der Frau, sich unterzuordnen«, hatte Eleanor Delaney ihrer Tochter kurz vor der Eheschließung eingeschärft. »Denk immer daran, auch wenn dir manches zuwider sein wird. Du wirst dich mit der Zeit daran gewöhnen. Er ist dein Mann. Widersprich ihm nicht.«
Diese Worte noch im Ohr, überschwemmte die Panik Moira jetzt wie eine Woge, als McIntyre ihr Nachthemd hochstreifte. Erschrocken rutschte sie ein Stück höher, bis sie gegen das Kopfteil des Bettes stieß.
McIntyre zog sie unsanft zurück. »Jetzt stell dich nicht so an«, knurrte er. Es waren die ersten Worte, die er in diesen vier Wänden mit ihr sprach. Er griff nach ihrem rechten Handgelenk, dann nach dem linken und legte ihr die Arme über den Kopf auf das Kissen. Mit einer Hand hielt er ihre Handgelenke fest, mit der anderen hob er sein Nachthemd und schob sich zwischen ihre Beine. Angsterfüllt versuchte sie, sich von ihm zu befreien, doch er hatte mehr Kraft, als Moira erwartet hatte, und da er mit einem Großteil seines Gewichts auf ihr lag, war ihre Gegenwehr zwecklos. Sie spürte den tastenden Vorstoß von etwas Warmem, Festem an ihrem Schenkel, dann hatte er die richtige Stelle gefunden.