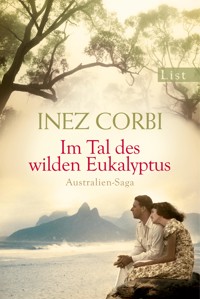
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Glück scheint vollkommen: Moira und ihr Geliebter Duncan bekommen ein Kind! Ihr Leben in einer einfachen Hütte ist hart, aber sie sind glücklich. Bis Duncan fliehen muss, weil britische Soldaten ihn verfolgen. Da nutzt Moiras offizieller Ehemann die Gelegenheit und nimmt ihr den lang ersehnten Sohn. Moira ist am Boden zerstört. Doch sie nimmt den Kampf um ihr Kind auf und schreckt auch vor den lauernden Gefahren im Busch nicht zurück . . .
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Das Buch
Die junge Irin Moira hat einiges durchmachen müssen: erst die Zwangsheirat mit dem ungeliebten Arzt Dr. McIntyre, dann die Auswanderung nach Australien. Jetzt aber hat sie ihren Mann verlassen, um ein neues Leben mit dem Exsträfling Duncan zu beginnen. Und das Schönste ist: Moira und Duncan bekommen ein Kind!
Doch die Ruhe trügt. Ein Aborigine-Häuptling verbreitet Angst und Schrecken mit Überfällen auf weiße Siedler, Duncan ist plötzlich verschwunden, und zu allem Unglück nimmt McIntyre Moira auch noch das Kind weg. Moira bleibt allein zurück, weiß nicht, wo ihr Geliebter ist und muss ohne Hilfe die Ernte durchbringen. Die junge Frau sieht nur einen Ausweg, um ihr Kind zurückzubekommen: Kurzerhand entführt sie ihren Sohn – und nimmt dafür alle Gefahren in Kauf …
Die Autorin
Inez Corbi, geboren 1968, studierte Germanistik und Anglistik in Frankfurt am Main. Sie lebt im Taunus und widmet sich inzwischen vollständig dem Schreiben.
www.inez-corbi.de
Von Inez Corbi ist in unserem Hause bereits erschienen:Das Lied der roten Erde
Besuchen Sie uns im Internet:www.list-taschenbuch.de
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Originalausgabe im List TaschenbuchList ist ein Verlag der Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin. 1. Auflage September 2012 © Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2012 Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München Titelabbildung: Liebespaar: Getty Images/© Kurt Hutton; Pflanzen: plainpicture/© Lonely_Planet Satz und eBook: LVD GmbH, Berlin
ISBN 978-3-8437-0254-5
Für Katja
1.
Grob zerteilte Karotten und Lauchstücke lagen auf dem Küchentisch, daneben die Blätter eines halben Kohlkopfs und drei kleine Zwiebeln. Mit etwas Glück würde das Gemüse eine essbare Suppe ergeben, und dazu hätten sie dann noch die Reste des gestern gebackenen Brots.
Moira schob die Ärmel ihrer Bluse hoch und strich sich eine Strähne ihrer schwarzen Haare zurück, die ihr ins Gesicht gefallen war. Sie sehnte sich nach etwas Abwechslung in dem eintönigen Speiseplan, der jetzt, im Winter, meist nur Kohl und ähnliches Gemüse umfasste. Wie lange hatten sie schon kein Fleisch mehr gegessen? Aber wenn das der Preis für ein Zusammenleben mit Duncan war, wollte sie ihn gerne zahlen.
Sie wuchtete den schweren Topf aus dem Regal und stellte ihn auf den Tisch. Sollte sie alles zugleich aufsetzen? Kurz entschlossen gab sie das gesamte Gemüse in den Topf, eine Kelle Wasser folgte. Sie griff nach dem Fässchen mit dem Salz. Wie viel Würze brauchte dieses Gericht? Moira tat sich noch immer schwer mit solchen Dingen. Schließlich warf sie eine großzügige Prise der weißen Körner hinein, hängte den Topf über das Feuer und schob ein weiteres Holzscheit in die Flammen.
Auch wenn der Winter in Neuholland weniger streng war als in ihrer alten irischen Heimat, war sie froh über die Wärme, die die einfache Feuerstelle ausstrahlte. Für eine Weile stand sie dort und sah zu, wie die Hitze im Gemüse aufstieg und die Suppe langsam zu köcheln begann. Dann griff sie nach ihrem wollenen Schultertuch, öffnete die Tür und ging hinüber zu der kleinen Vorratshütte, die Duncan erst in der vergangenen Woche errichtet hatte. Auf dem umzäunten Stück Erde daneben fingen ihre drei Hühner aufgeregt an zu gackern, als Moira das Gatter aufsperrte.
Auf der Wäscheleine, die sie auf der Wiese von Baum zu Baum gespannt hatte, flatterten Hemden und Strümpfe, die sie heute Morgen gewaschen hatte. An solchen Tagen wünschte sich Moira jemanden, der ihr diese anstrengende Arbeit abnehmen könnte. Jemanden wie Ann, die für solche Dinge zuständig gewesen war, als Moira noch in Toongabbie gelebt hatte. Sie hatte nicht gewusst, wie viel Anstrengung es bedeutete, auch nur die wenigen Kleidungsstücke zu waschen, die sie besaßen und die zum Teil schon arg verschlissen waren. Für Moira war es nicht länger wichtig, ihre Garderobe danach auszuwählen, ob sie ihren hellen Teint und ihre blauen Augen am besten zur Geltung brachte. Wichtiger war inzwischen, dass die Kleidung so lange wie möglich hielt. Ihre feingliedrigen, ehemals gepflegten Hände waren mittlerweile rau und rissig, und oft genug hatte sie Schmutz unter den Fingernägeln. Ihre Mutter wäre sicher entsetzt, könnte sie sehen, wie ihre Tochter hier lebte. Und doch hätte Moira dieses Leben um nichts in der Welt wieder hergegeben.
Sie ließ den Blick über das Stück Land schweifen. Dreißig Morgen, die Duncan gehörten, seit er kein Sträfling mehr war. Eine leicht hügelige Fläche von dreihundert mal vierhundert Schritten, größtenteils bewachsen mit Gras und Büschen, im Süden begrenzt von einem schmalen Bach. In den vier Monaten, die seitdem vergangen waren, hatten sie Bäume gefällt, Wurzeln entfernt, Sträucher herausgerissen und Erde umgegraben. Wenn der Winter vorüber war, würden sie ihre erste Saat ausbringen können. Hinter ihrer Hütte, wo Duncan demnächst eine Scheune für das Getreide bauen wollte, stapelten sich grobgeschnittene Bretter.
Moira öffnete den Hühnerverschlag, griff hinein und tastete im Stroh herum. Nur ein Ei. Nicht gerade viel, aber besser als nichts. Duncan würde sicher wieder darauf bestehen, dass sie es bekam.
Sie schloss den Verschlag – und fuhr zusammen, als sich ein dunkler Schatten neben dem Schuppen erhob. Vor Schreck ließ sie fast das Ei fallen.
»Ningali!«
Das Mädchen stand vor ihr, mit leuchtenden Augen in seinem lachenden, karamellbraunen Gesicht, bekleidet nur mit einem alten Hemd, um das es einen Leinengürtel geschlungen hatte und das ihm bis zu den Oberschenkeln reichte. Die lockigen, goldgesträhnten Haare nahmen sich seltsam fremd über der dunklen Haut aus.
Es war ungewohnt, Ningali ohne ihren Dingo zu sehen, der sie sonst immer begleitet hatte. Vor einigen Wochen war er von einem Soldaten erschossen worden. »Willst du mit hineinkommen?«
Ningali schüttelte lächelnd den Kopf. Duncans zwölfjährige Halbschwester ließ sich nur selten zum Sprechen bewegen; anfangs hatte Moira sogar geglaubt, das Mädchen sei stumm. Inzwischen jedoch hatte Ningali so viele englische Worte aufgeschnappt, dass sie einem Gespräch gut folgen konnte und hier und da auch selbst etwas sagte.
Dampf und der Geruch nach Kohl erfüllten die Hütte, als Moira die Tür öffnete. Sie wedelte die Schwaden fort. Das brodelnde Gemisch im Topf hatte inzwischen eine unansehnliche Färbung angenommen, der größte Teil des Wassers war verdampft. Moira goss weiteres Wasser nach und rührte.
»Mo-Ra!« Ningalis Stimme, so selten gehört, drang in die Hütte. »Komm!«
Mit dem Kochlöffel in der Hand eilte Moira hinaus. Von dort, wo der kleine Fluss ihr Grundstück von dem des Nachbarn trennte, näherte sich ein Reiter. Besorgt drehte sie sich zu Ningali.
»Schnell, du musst verschwinden! Niemand darf dich hier sehen!«
Es tat Moira weh, das Mädchen verjagen zu müssen, aber es geschah zu seinem eigenen Schutz. Da es in letzter Zeit wiederholt zu Überfällen von Eingeborenen auf weiße Siedler gekommen war, hatte der Gouverneur verfügt, dass jeder Eingeborene, der sich Parramatta näherte, erschossen werden dürfe. Ningalis Dingo war diesem Wahnsinn bereits zum Opfer gefallen.
Aber Ningali dachte nicht daran, zu verschwinden. Gelassen steckte sie sich eine getrocknete Beere in den Mund und kaute.
»Ningali, bitte!«
Das Mädchen schüttelte den Kopf. »Dan-Kin«, sagte es dann mit breitem Grinsen und wies auf den Reiter.
Ningali hatte recht: Es war tatsächlich Duncan, der da näher kam. Moiras Herz tat einen Satz vor Freude.
Duncan hatte seit frühester Kindheit mit Pferden zu tun gehabt. Aber noch nie hatte sie ihn reiten gesehen. Er saß auf dem Pferd, als sei er mit ihm verwachsen. Moira konnte ihre Blicke nicht von seiner hochgewachsenen, schlanken Gestalt lassen. Und von dem Pferd – einer kräftigen, braun-weiß gescheckten Stute, wie sie erkannte, als er es vor ihr zum Stehen brachte.
»Du bringst ein Pferd mit?«, jubelte sie. »Woher?«
Duncan sprang ab. Seine dunkelbraunen Haare waren vom Ritt zerzaust, seine grünen Augen leuchteten. »Von Dr. Wentworth. Hallo, Ningali.«
»Er hat dir ein Pferd geschenkt?«
»Nicht geschenkt, das hätte ich nicht angenommen! Es ist als Bezahlung gedacht, für meine Arbeit der letzten Wochen.« Er strich der Stute über die Mähne. »Sie heißt Artemis und ist ein wenig störrisch … Ich habe mir schon überlegt, ob ich sie umnennen sollte. In Moira …« Geschickt wich er dem Kochlöffel aus, den Moira nach ihm warf.
Ohne sich darum zu kümmern, dass seine Schwester feixend danebenstand, wollte er Moira an sich ziehen. Normalerweise genoss sie diese viel zu seltenen Momente, wenn er auch in der Öffentlichkeit zeigte, dass sie zusammengehörten. Aber jetzt wand sie sich aus seinen Armen und griff nach dem Zügel. Statt eines Sattels lagen eine zusammengefaltete Decke und ein Schaffell auf dem breiten Pferderücken, und es gab auch keine Steigbügel.
Duncan hielt ihren Arm fest. »Denk nicht einmal daran!«
»Nur ein kurzes Stück! Ich habe so lange nicht mehr auf einem Pferd gesessen …« So lange hatte sie nicht mehr den Wind in ihren Haaren spüren können und das Gefühl des Tieres unter sich. Das Reiten hatte sie am meisten vermisst, seit sie Irland hatte verlassen müssen, mehr noch als ihre Familie.
Duncan ließ ihren Arm nicht los. »Moira, ich weiß, wie sehr du es dir wünschst, aber ich halte das für keine gute Idee.«
»Du verbietest mir zu reiten?«
»Ich würde dir nie etwas verbieten. Aber wir dürfen nichts riskieren. Nur bis das Kind da ist.«
»Andere Frauen in Umständen reiten auch!«
»Andere Frauen in Umständen haben auch nicht erst letztes Jahr ein Kind verloren!«
Damals, als Moiras Ehemann Dr. McIntyre ihre Liebschaft entdeckt hatte und sie beide überstürzt in die Wildnis geflohen waren. Die darauf folgenden tagelangen Entbehrungen sowie Hunger und Kälte hatten bei Moira eine Fehlgeburt ausgelöst und sie an den Rand des Todes gebracht. Nur Duncans Entschluss, sie zurück nach Toongabbie, zurück zu ihrem Ehemann zu bringen, hatte ihr das Leben gerettet.
Duncan ließ sie los. »Ich werde einen Karren bauen, dann kannst du damit nach Parramatta oder bis nach Sydney fahren. Das Pferd kann man auch davorspannen.«
Moira blieb neben Artemis stehen, schmiegte sich an den muskulösen Pferdehals und streichelte die kurze Mähne. Für einen Moment war sie versucht, sich trotz Duncans Bedenken auf die Stute zu schwingen und einfach loszureiten. Aber dann nickte sie. Er hatte ja recht.
Wenig später saßen sie zu zweit an dem Tisch in ihrer Hütte – Ningali hatte nicht bleiben wollen. Moira teilte die Suppe aus. Duncan rührte in dem heißen Gemisch, fischte ein zerkochtes Kohlblatt heraus, blies darauf und probierte.
»Und?«, fragte sie gespannt.
»Ganz ordentlich. Du machst dich.«
»Wirklich?« Moira griff erfreut nach ihrem Löffel – und hätte fast übersehen, dass Duncan verstohlen nach seinem Becher griff und hastig trank.
Auch Moira steckte ihren Löffel in die Suppe. Es schmeckte nach Kohl. Und salzig. Sehr salzig. So sehr, dass auch sie eilig nach ihrem Wasserbecher langte.
»Wieso sagst du mir nicht die Wahrheit?«, ächzte sie nach einem tiefen Schluck.
»Hab ich doch. Es schmeckt. Nur eben … ein bisschen versalzen.«
Moira ließ den Kopf hängen. »Ich werde es wohl nie lernen.«
»Na ja, immerhin lässt du das Essen inzwischen kaum noch anbrennen. Was ist da schon ein bisschen zu viel Salz.« Duncan lächelte. »Man könnte meinen, du bist verliebt.«
Moira gab das Lächeln zurück und griff über den Tisch nach seiner Hand. »Das bin ich«, sagte sie leise. »Das bin ich.«
*
»Dr. Wentworth hat bedauert, dass wir nicht zu seiner Jahresfeier kommen konnten.« Duncan malte mit dem Finger eine kleine Spirale auf Moiras Rücken. Das Herdfeuer knackte und knisterte, kleine Funken stoben auf und beleuchteten Moiras Truhe, das einzige Möbelstück, das sie aus Irland mitgebracht hatte, und den Tisch. Eng aneinandergeschmiegt lagen sie auf ihrer einfachen Bettstatt aus Strohmatratzen und Decken. Obwohl die Nächte kühler geworden waren, trug Moira kein Nachthemd. Zu sehr genoss sie es, Duncans Haut an ihrer zu spüren und sich von ihm wärmen zu lassen. »Aber er hat eingesehen, dass das keine gute Idee gewesen wäre.«
Die Feier, die D’Arcy Wentworth zu jedem Jahrestag seiner Ankunft in Neuholland abhielt, war ein gesellschaftliches Großereignis. Aber die Dinge hatten sich verändert, und manchen Personen wollte Moira möglichst nicht begegnen. Am allerwenigsten ihrem Ehemann. Oder der Klatschtante Mrs Zuckerman. Dass sie mit einem ehemaligen Sträfling zusammenlebte, obwohl sie mit einem anderen Mann verheiratet war, machte sie in den Augen gewisser Leute zu einem schamlosen Flittchen.
Sie seufzte wohlig, als Duncans Finger langsam ihre Wirbelsäule emporfuhren.
»Es ist jetzt über ein Jahr her«, sagte sie leise.
»Was?« Er hatte ihren Haaransatz erreicht und kraulte sie leicht.
»Dass du mich zum ersten Mal geküsst hast. Weißt du noch? Bei Wentworth, im – huch!« Sie stieß ein überraschtes Schnauben aus. »Ich … ich glaube, es hat sich gerade bewegt!« Sie drehte sich auf den Rücken, nahm Duncans Hand und legte sie auf ihren kaum wahrnehmbar gewölbten Bauch, rechts unterhalb des Nabels.
Beglückt lauschte sie in sich hinein. Ein leichtes Kribbeln erfüllte ihren Unterleib, wie ein sanftes, inwendiges Streicheln. »Kannst du es auch spüren?«
Duncan verharrte einen Moment völlig reglos, dann schüttelte er den Kopf.
»Es fühlt sich an, als würde ein winziger Fisch in mir aufsteigen und an meine Bauchdecke stoßen«, flüsterte sie. »Wie nennen wir ihn?«
»Den Fisch?«
Sie nickte lächelnd. »Unseren Sohn.«
»Wer sagt dir, dass es ein Sohn wird?«
»Ich dachte, Männer wollen immer einen Sohn.«
»Ich werde mich über jedes Kind freuen, sei es nun ein Sohn oder eine Tochter.«
Sie verschränkte ihre Finger mit seinen. »Nun sag schon: Wie soll er heißen?«
»Wir könnten es wie in Irland halten. Dann müsste man den ersten Sohn nach dem Vater des Vaters nennen.«
»Also Joseph«, überlegte Moira. »Dann könnte man ihn Josie rufen. Oder Joey.« Sie ließ sich den Namen auf der Zunge zergehen. »Ja, Joey. Das gefällt mir.«
Duncans Vater Joseph war als einer der ersten Sträflinge nach Neuholland gekommen, geflüchtet und hatte sich unter den eingeborenen Eora eine Frau genommen. Duncan hatte seinen Vater tot geglaubt. Erst vor wenigen Monaten hatten die beiden sich wiedergefunden.
»Und wenn es ein Mädchen wird, würde man es nach der Mutter der Mutter benennen. Deine Mutter heißt Eleanor, nicht wahr?«
»Ja«, fauchte Moira. »Aber du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich mein Kind nach ihr benenne? Sie hat mich zur Heirat mit diesem alten Bock gezwungen!«
»Aber wenn sie das nicht getan hätte, wärest du nicht hier. Und ich hätte dich nie kennengelernt. Also hatte ihr Tun auch etwas Gutes.«
»Ja sicher«, gab Moira widerstrebend zu. Dann musste sie kichern. »Auch wenn sie sich bestimmt nicht vorgestellt hat, dass ich meinen Mann verlasse und mit einem ehemaligen Sträfling in einer skandalösen Verbindung lebe.«
»Wir können den Namen ja abkürzen«, schlug Duncan vor. »Ellie zum Beispiel. Oder Nora.«
Moira schüttelte den Kopf. »Nein, das gefällt mir alles nicht. Wie wäre es mit Eileen? Nach deiner Mutter?«
Er nickte nachdenklich. Ein Holzscheit knackte laut im Feuer, Funken sprühten auf, Wärme erfüllte die Hütte. Moira strampelte sich die Decke vom Leib, bis sie nackt dalag. Duncan stützte sich auf einen Ellbogen, umkreiste ihren Nabel mit dem Zeigefinger und fuhr dann sanft bis zu ihrer Scham. Langsam stieg wohlige Hitze in ihr auf.
»Ich wünschte, ich könnte dich heiraten«, murmelte er.
Moira sah ihn an. »Stell dir vor, es wäre möglich. Stell dir vor, ich wäre frei. Wie würdest du mich heiraten?«
Er hob die Schultern. »Ich bin Katholik. Du bist Protestantin. Allein das –«
»Ich könnte konvertieren«, unterbrach Moira ihn. »Ich würde zu einer papistischen Frömmlerin werden, den Rosenkranz lernen und den Papst anbeten.«
»Wir beten doch nicht den Papst an!« Sein Finger wanderte wieder aufwärts. »Außerdem würde ich das nie von dir verlangen.«
»Das tust du doch auch gar nicht. Es wäre meine freie Entscheidung.«
»Aber dann wäre dein Ruf endgültig ruiniert.«
»Na und?« Sie sagte es fast trotzig. »Ist er das nicht längst? Aber davon abgesehen geht es ja sowieso nicht.« Sie drehte sich zu ihm, wollte ihn ganz dicht an sich spüren. Ihre Hand glitt tiefer.
Duncan stöhnte auf und wich ein Stück zurück. »Nicht …«
»Meinst du immer noch, es könnte dem Kind schaden?«
Er nickte und versuchte, die Decke zwischen ihre nackten Körper zu bringen.
Moira ließ ihn nicht. »Sollte der Vater nicht dafür sorgen, dass die werdende Mutter sich gut fühlt? Und die gefährliche Zeit ist lange um.« Mit der Rechten strich sie sanft über seine Flanke, spürte, wie seine Haut sich zusammenzog.
Mit einem kleinen Lachen legte er seine Hand auf ihre. »Das kitzelt!«
»Wirklich?« Sie befreite ihre Hand und fuhr erneut über seine Haut. Bewegte ihre Finger im Spinnengang wie kleine Insektenfüße über seinen flachen Bauch. Spürte, wie seine Muskeln unter ihren Fingern krampfhaft zuckten. Sah, wie angestrengt er versuchte, sich zusammenzureißen. Als sie anfing, ihn in die Seite zu stechen, konnte er das Lachen nicht länger zurückhalten. Japsend rollte er sich auf die Seite und griff nach ihren Handgelenken. »Du kleine Wildkatze! Wirst du jetzt aufhören?«
Sie grinste ihn von unten an. »Nein.« Sie spürte seine Erregung. »Komm«, flüsterte sie und öffnete sich. »Komm endlich!«
Er gab nach, drang behutsam in sie ein, sein Körper ein vertrautes Gewicht auf ihrem. Entzückt seufzte sie auf und klammerte sich an ihn, und die Nacht begann zu leuchten.
*
Etwas Hartes drückte gegen seine Wange. Der Boden seines Zimmers in der Kaserne. James Penrith schmeckte Blut und roch den beißenden Geruch frischen Urins. Nässe breitete sich auf dem Stoff seiner Hose aus. Mühsam richtete er sich auf und nahm das Taschentuch heraus, das er sich gerade noch rechtzeitig in den Mund hatte stecken können. Sein Kopf dröhnte. Als er mit der Hand danach fasste, spürte er eine schmerzende Stelle an seinem Hinterkopf. Er musste während des Anfalls mit dem Kopf auf dem Boden aufgeschlagen sein. Vorsichtig bewegte er seine Arme. Alles intakt, bis auf eine tiefgreifende Schwäche in seinen Gliedmaßen. Aber auch das würde vorübergehen.
Er würde sich von dieser Krankheit nicht in die Knie zwingen lassen!
Zum Glück hatte ihn dieser Anfall ereilt, als er allein in seiner Unterkunft war. Nicht auszudenken, was geschehen wäre, wenn irgendjemand mitbekommen hätte, wie er sich in Krämpfen am Boden wand. Bis jetzt hatte er sein Leiden verheimlichen können, wenn auch nur mit erheblichem Aufwand. Der Einzige, der davon wusste, war sein unfähiger jüngerer Bruder. Und natürlich McIntyre, dieser widerliche Kriecher. Aber auf dessen ärztliche Schweigepflicht konnte er sich wohl verlassen.
Am Boden lag das Tablett, das sein Bursche mit dem Frühstück hereingebracht hatte, Toast und Porridge waren in einer Zimmerecke gelandet, daneben lag zerbrochen die Teetasse. Penrith erhob sich, der Stoff seiner Hose klebte unangenehm zwischen seinen Beinen. Wie viel Zeit war vergangen? Warteten sie schon auf ihn? Nein: Ein kurzer Blick aus dem Fenster zeigte ihm, dass der Morgenappell gerade erst vorbei war.
Vorsichtig bewegte er den Kopf hin und her. Die Schmerzen waren erträglich. Das wattige Gefühl war noch da, aber der dumpfe Druck, den er seit Tagen gespürt hatte, gepaart mit einer erhöhten Reizbarkeit, die ihn seine Männer bei den geringsten Anlässen anfahren ließ, war verschwunden. Wie stets nach den Anfällen. Dennoch fühlte er sich nicht gut. Zu der Müdigkeit gesellte sich auch noch ein Gefühl, als hätte er Fieber.
Er richtete den Blick in den kleinen Frisierspiegel auf der Kommode. Er sah erschöpft aus, die wenigen rotblonden Haare auf seinem Kopf waren schweißverklebt. Aber da war kein Zeichen flackernden Irrsinns in seinen Augen, keine Andeutung nahenden Wahns. Nichts als das Gesicht eines Mannes in den besten Jahren. Kein Anzeichen, dass er auf demselben Weg war wie seine Mutter, die in einem Irrenhaus an der Küste Englands dahinvegetierte. Nein, er litt lediglich an der göttlichen Krankheit. Und er würde sie überwinden.
Immerhin war der leidige Strafdienst vorüber, zu dem er Anfang des Jahres verdonnert worden war. Man hatte ihn inder Kaserne tatsächlich Latrinen entleeren und den Hof reinigen lassen. Diese Erniedrigung nagte noch immer an ihm. Ihn, einen Major, zum einfachen Lieutenant zu degradieren, nur weil er bei der Verfolgung eines Straftäters zu eifrig gewesen war! Aber er würde es diesem aufgeblasenen Gouverneur schon zeigen. Zumindest war es ihm, James Penrith, mittlerweile gelungen, wieder zum Captain befördert zu werden. Bis zum Major würde es allerdings mehr brauchen als Beziehungen. Und das alles hatte er diesem verfluchten papistischen Ex-Sträfling zu verdanken, diesem Duncan O’Sullivan. Der verdammte Ire würde sich noch umsehen.
Sein Kopf schmerzte. Er zwang sich zur Ruhe. Er musste sich jetzt schonen; Aufregung würde in diesem Stadium nur die Gefahr eines weiteren Anfalls nach sich ziehen.
Er hatte sich von innen in die Wange gebissen. Zumindest fühlte es sich so an, auch wenn er kein Blut schmeckte. Er öffnete den Mund, fuhr mit dem Finger in die Wange und warf erneut einen Blick in den Spiegel. Das war kein Biss. Es ähnelte eher einem kleinen, rundlichen Geschwür, das aussah, als habe man ein Loch aus seiner Schleimhaut gestanzt.
Er nahm den Finger aus dem Mund und begann fluchend, sich die Stiefel auszuziehen – eine Tätigkeit, die ohne seinen Burschen einiges an Kraft und Geschicklichkeit erforderte. Aber natürlich war es in dieser Situation ausgeschlossen, den Burschen dafür zu rufen. Der linke Stiefel war unten, nun zog er am rechten. Keuchend zerrte er an dem schwarzglänzenden Leder, bis er sich endlich vom Fuß löste. Jetzt noch die Hose.
Er schälte sich aus dem nassen Beinkleid und warf es zu Boden, zog den Hocker heran und setzte sich. Dann goss er etwas Wasser aus dem Krug in die Waschschüssel, tauchte einen Lappen hinein und begann, den Urin von seiner Haut zu waschen.
Sein Blick wanderte zu seinem Penis, der schlaff zwischen seinen Beinen hing. Auf der Oberseite, knapp unterhalb der rötlichen Schamhaare, saß eine kleine runde Wunde mit erhabenem Rand. Als Penrith darauf drückte, sonderte sie ein paar Tropfen einer wässrigen Flüssigkeit ab. Was zum Teufel hatte er sich da geholt? Immerhin juckte oder schmerzte es nicht.
Rasch trocknete er sich ab, suchte ein frisches, blütenweißes Beinkleid aus seiner Truhe und zog es an. Dann tauchte er die beschmutzte Hose in die Waschschüssel und wusch den stechenden Uringeruch aus. Zum Schluss überprüfte er noch einmal sein Erscheinungsbild im Spiegel, richtete die silberne Offiziershalsberge und die scharlachrote Uniformjacke. Dann öffnete er die Tür und rief nach seinem Burschen.
Es dauerte nur wenige Sekunden, bis der junge, etwas kurzgewachsene Kerl vor ihm auftauchte. Penrith drückte ihm seine feuchte Hose in die Hand.
»Sie war schmutzig«, erklärte er kurz angebunden. Er wies auf die noch immer auf dem Boden liegenden Frühstücksutensilien. »Und sieh zu, dass du die Unordnung beseitigst! Wenn ich zurückkomme, ist hier alles aufgeräumt!«
2.
Die Elizabeth Farm duftete nach frischen Frühlingsblumen. Die Fenster waren geöffnet, Vogelgezwitscher drang herein, Sonnenschein glänzte auf den prachtvollen Blumenrabatten in Weiß und Purpur und den kugeligen gelben Blüten der Silberakazie, und auf der breiten, schattigen Veranda lud eine Bank zum Verweilen ein. Nur der bewaffnete Soldat, der dort gerade ein Stück Kuchen aß, trübte das friedliche Bild ein wenig.
Moira riss sich von seinem Anblick los. »Wann müsst Ihr aufbrechen?«, wandte sie sich an John Macarthur, der neben ihr im Zimmer saß.
John, ein gutaussehender Mann mit entschlossenem Kinn, warf verächtlich den Kopf zurück. »Ich weiß es noch nicht. Vermutlich in den nächsten Wochen, wenn dieser Taugenichts von Gouverneur endgültig darüber entschieden hat. Wenn Ihr es wünscht, kann ich ein paar Briefe von Euch mitnehmen. Von England nach Irland ist es ja nur ein Katzensprung.«
Moira nickte erfreut. »Das wäre sehr freundlich von Euch.« Sie würde ihrer Schwester schreiben. Und wohl auch ihren Eltern. Vor diesem Brief hatte sie sich bislang gedrückt.
Auch Duncan nickte. Moira sah ihn erstaunt an. Hatte er nicht gesagt, er habe niemanden mehr in Irland? Ach nein, es gab ja noch die alte Haushälterin des Pfarrers, der ihn aufgezogen hatte.
Elizabeth, die ihre dunklen Haare zu einem schlichten und doch eleganten Knoten aufgesteckt hatte, rührte gedankenverloren in ihrer Teetasse. Moira konnte nur ahnen, wie es hinter ihrer Stirn aussah. Johns bevorstehende Abreise schwebte wie ein düsterer Schatten über ihnen.
»Wie geht es dem Colonel?«, fragte Moira.
»Besser.« Elizabeth sah auf. »Nicht auszudenken, wenn John ihn –« Sie sprach nicht weiter, aber Moira wusste, was sie sagen wollte. Wenn er ihn getötet hätte.
Die Auseinandersetzung der beiden hochrangigen Offiziere war seit Wochen das beherrschende Thema in der gesamten Kolonie. Nach etlichen heftigen Meinungsverschiedenheiten mit Gouverneur King hatte John Macarthur versucht, seinen vorgesetzten Offizier, Colonel Paterson, auf seine Seite zu ziehen und dazu zu bewegen, mit dem Gouverneur zu brechen. Paterson hatte sich geweigert, darauf einzugehen, und John zum Duell gefordert. In dessen Verlauf hatte er eine gefährliche Schusswunde an der Schulter erhalten. Gouverneur King hatte Macarthur sofort verhaften lassen.
»Er hat mich ins Gefängnis gesteckt. Mich!« John schnaubte vor Wut.
»Aber nur für eine Nacht«, beschwichtigte Elizabeth. Sie legte sanft eine Hand auf seinen Arm und wandte sich wieder an Moira. »Seitdem steht er unter Hausarrest. Keans« – sie deutete auf die Veranda, wo der Soldat soeben seinen Teller auf einen kleinen Tisch stellte – »ist einer der freundlichen Gentlemen, die der Gouverneur zu Johns Bewachung abgestellt hat. Bis das Schiff nach England geht.«
Gouverneur King hatte verfügt, dass das Gerichtsverfahren in London stattfinden sollte.
»Das ist lächerlich!«, ereiferte sich John. »Ich darf das Haus nicht verlassen. Ich darf nicht einmal nach meinen Tieren sehen!«
Moira bemerkte, dass Elizabeth sich auf die Lippen bissund offenbar zurückhielt, was immer sie hatte sagen wollen.
Duncan war es auch nicht entgangen. »Ich wusste gar nicht, dass Ihr auch Pferde züchtet, Mr Macarthur«, lenkte er das Gespräch in eine andere Richtung. »Wie seid Ihr zu solchen Prachtexemplaren gekommen?«
Vorhin waren sie mit Elizabeth bei den Tieren gewesen. Moira hatte sich kaum von den herrlichen Vollblütern losreißen können.
John lächelte verschwörerisch. »Beziehungen. Und kluge Taktik.« Moira verstand. Die Pferde waren illegal eingeschifft worden – und sicherlich ein Vermögen wert. »Ich hoffe nur«, er legte seine Hand auf die seiner Frau, »dass meine liebe Elizabeth das alles auch ohne mich bewältigen kann.«
»Wann immer Ihr Hilfe braucht, Mrs Macarthur«, wandte sich Duncan an die Dame des Hauses, »könnt Ihr auf uns zählen.«
Elizabeth setzte ihre Tasse ab und lächelte ihn an. »Das ist sehr freundlich von Euch, Mr O’Sullivan. Es ist immer gut zu wissen, dass Freunde in der Nähe sind.«
Moira atmete fast unmerklich auf. Sie schätzte Elizabeth Macarthur sehr, aber sie wusste auch, dass Elizabeth Moiras Verbindung mit Duncan nicht guthieß. Eine Frau gehöre zu ihrem Ehemann, war ihre Meinung.
»Auch wenn ich glaube«, fuhr Elizabeth fort, »dass Ihr zuerst meine Hilfe benötigen werdet. Oder habt Ihr schon jemanden, der Eurer …«, sie zögerte nur kurz, »… der Moira in ihrer schweren Stunde beistehen wird?«
Moira hatte darum gebeten, sie bei ihrem Vornamen anzusprechen. »Mrs McIntyre« genannt zu werden, fand sie einfach unpassend.
Sie wollte sich gerade für das Angebot bedanken, als Geschepper und Gerumpel von der Hinterseite des Hauses erklang.
»John? John, bist du da?«, hörte sie eine jugendliche Stimme rufen. Im nächsten Moment wurde die Tür zum Salon aufgerissen, und ein halbwüchsiger Eingeborener stürmte herein. Sein Gesicht war weiß bemalt, so dass es aussah wie ein Totenkopf, der schlanke, dunkle Körper mit einem Muster aus weißen Streifen und Punkten geschmückt. In seiner Hand trug er ein ganzes Bündel von Speeren.
»Tedbury!« John sprang auf, und auch alle anderen erhoben sich alarmiert.
Der Soldat auf der Veranda riss die Muskete von der Schulter und legte auf den jungen Schwarzen an.
»Die Waffe runter, Keans!«, rief John. »Dieser schwarze Gentleman steht unter meinem Schutz! Wenn Ihr ihm auch nur ein Haar krümmt, mache ich Euch persönlich dafür verantwortlich!«
Der Soldat ließ das Gewehr wieder sinken. »Aber der Gouverneur hat angewiesen, jeden Wilden zu erschießen, der …«
»Was kümmert mich der Gouverneur? Das hier ist mein Land, und Tedbury ist mein Gast.« Er nickte dem Jungen zu.
Tedbury, Sohn des gefürchteten Eingeborenenhäuptlings Pemulwuy, wirkte in Johns Salon etwas deplatziert. Bisher hatte Moira den jungen Schwarzen als einen netten und umgänglichen Jüngling kennengelernt. Ihn jetzt bewaffnet und in Kriegsbemalung zu sehen, bestürzte sie.
»Tedbury«, sagte Duncan, »was soll das?«
Das weiß gefärbte Gesicht verzog sich zu einem breiten Grinsen. Tedbury ließ die Speere sinken. »Habe ich Euch erschreckt?« Bis auf einen kleinen Akzent war sein Englisch fehlerlos. »Ich bitte die Damen um Entschuldigung.«
»Ist schon gut, Tedbury.« Moira und Elizabeth setzten sich wieder.
John deutete auf die Speere, die der junge Krieger noch immer in der Hand hielt. »Was willst du damit, Tedbury?«
»Gouverneur King erschrecken«, gab der junge Mann zurück. »Und ihm sagen, dass er dich nicht fortschicken darf.«
»Das ist sehr ehrenhaft«, bemerkte John, »aber das würde alles noch schlimmer machen.«
Der junge Krieger schüttelte den Kopf. »Pemulwuy, mein Vater, sagt, die Weißen sind schlechte Menschen. Sie kommen zu uns und nehmen uns unser heiliges Land weg. Sie gehen auf den Pfaden der Ahnen ohne Wissen. Sie töten unser Volk.«
»Nicht alle Weißen sind so, Tedbury«, widersprach John.
»Nein, nicht alle. Du nicht. Duncan nicht. Aber die meisten. Und mein Vater sagt, wir müssen uns wehren. Das sagt auch Bun-Boe.«
Moira sah, dass Duncan zusammenzuckte. Bun-Boe, so nannten die Eingeborenen Duncans Vater Joseph, der schon lange bei ihnen lebte. Im vergangenen Jahr hatte ein Soldat Joseph lebensgefährlich verletzt, und er war nur knapp dem Tod entgangen. Noch bevor man darüber entschieden hatte, wie mit ihm zu verfahren sei – schließlich war er vor vielen Jahren aus einem Straflager geflohen –, war er wieder zu den Eora zurückgekehrt.
»Das hat Bun-Boe gesagt?«, fragte er.
Tedbury sah plötzlich aus, als habe man ihn bei etwas Verbotenem ertappt. Er nickte zögernd.
»Möchtest du nicht erst einmal etwas essen, Tedbury?« Elizabeth reichte ihm einen Teller voller Kuchenstücke.
»Danke.« Tedbury legte die Speere auf den Boden und griff beherzt zu. Moira staunte, welche Mengen der junge Mann in rasender Geschwindigkeit verschlingen konnte.
»Es ist bereits alles entschieden«, erklärte ihm Elizabeth. »John wird demnächst nach England aufbrechen. Du weißt, das Land weit hinter dem Meer, wo wir herkommen.«
Tedbury nickte mit vollem Mund und schob sich einen weiteren Keks zwischen die großen, strahlend weißen Zähne.
»John wird sich dort vor Gericht verantworten müssen.« Elizabeth seufzte auf. »Und er wird Lizzie und Johnny mitnehmen. Sie werden in England zur Schule gehen, wie es schon Edward, unser Ältester, tut.«
Moira sah Elizabeth erstaunt an. Das war ihr neu. Mit neun und sieben Jahren waren die Kinder offenbar alt genug, um fern von ihren Eltern ausgebildet zu werden.
»D’Arcy Wentworth überlegt übrigens, ob er bis Kapstadt mitreist«, wandte Elizabeth sich an sie. »John und er wollen dort Schafe kaufen.«
Tedbury erhob sich. »Kann ich mich von Johnny und Lizzie verabschieden?«
»Natürlich.« Elizabeth neigte zustimmend den Kopf. »Sie spielen draußen. Aber, Tedbury, lass deine Speere hier, in Ordnung?«
Tedburys weiß geschminktes Gesicht verzog sich erneut zu einem breiten Grinsen. »Schon verstanden, Madam Elizabeth. Für heute ist der Gouverneur sicher.«
*
Dr. McIntyre saß an seinem Schreibtisch, blinzelte durch seine runden Brillengläser und strich behutsam über das silbrig glänzende, fingerdicke Metallrohr, das Duncan in den vergangenen Tagen nach seinen Vorgaben gefertigt hatte. »Sehr schön. Das ist gute Arbeit. Ich hoffe, es ist dir recht, wenn ich dir dafür einen Schuldschein ausschreibe.«
Duncan war einverstanden. Natürlich wäre ihm Geld lieber gewesen, aber wegen der in der Kolonie herrschenden Münzknappheit bekam der Doktor seinen Sold zum Teil in Naturalien ausgezahlt. In McIntyres engem Studierzimmer sah es noch genauso aus wie vor vielen Monaten, als er zum letzten Mal hier gewesen war.
McIntyre begann zu schreiben, die Feder kratzte über das Papier. Als die Tinte getrocknet war, reichte er Duncan das Blatt. Dann griff er erneut nach dem glänzenden Rohr.
»Dun… O’Sullivan?«
Duncan runzelte die Stirn. Hätte der Doktor ihn gerade fast mit dem Vornamen angesprochen? »Sir?«
»Könntest du dir vorstellen, dich noch einmal für meine Versuche zur Verfügung zu stellen?«
Mit dieser Frage hatte Duncan gerechnet. »Nein, Sir. Beim besten Willen nicht.«
»Ich … ich würde dich auch dafür bezahlen.«
Für einen Moment kam er ins Schwanken. Das Geld würden sie gut brauchen können. Aber schon die Vorstellung, noch einmal das starre Rohr in Kehle und Speiseröhre geschoben zu bekommen, löste bei ihm einen kaum zu bezwingenden Würgereiz aus. Er schüttelte den Kopf.
Der Doktor nickte, als hätte er nichts anderes erwartet. Fahrig fuhr er sich über seinen rotbraunen Backenbart, den bereits ein paar graue Haare durchzogen. »Willst du … willst du vielleicht zum Essen bleiben? Ann kocht inzwischen recht gut.«
Duncan musste sich bemühen, seine Verwirrung nicht zu zeigen. Der Doktor hatte ihn noch nie zum Essen eingeladen.
»Nein, Sir, danke. Ich … muss nach Hause.« Moira wartet auf mich, hätte er fast gesagt. Aber sie sprachen nicht über Moira. Als hätten sie eine geheime Absprache, erwähnte keiner von ihnen ihren Namen.
»Natürlich.« Irrte er sich, oder schien der Doktor tatsächlich enttäuscht zu sein? Doch gleich darauf suchte McIntyre geschäftig in irgendwelchen Papieren auf seinem Schreibtisch und schien ihn vergessen zu haben.
Duncan stand noch immer vor ihm. In diesem Moment fühlte er sich wieder wie ein Sträfling. »Sir.«
Der Doktor blickte auf. »Ja?«
»Sir, das … Geld.« Brennende Scham der Demütigung stieg in ihm auf.
»Ah, natürlich.« Der Doktor öffnete eine Schublade, zog einen kleinen Beutel heraus und reichte ihn Duncan. Ein paar Münzen beulten den Stoff. Zumindest die Zahlung für Moira war diesmal richtiges Geld.
Am liebsten hätte er es zurückgewiesen. Sicher, es stand Moira zu, aber es gab ihm stets das Gefühl, nicht selbst für sie sorgen zu können.
Moira war da praktischer veranlagt. »Zeig her«, bat sie, als er zu ihr zurückgekehrt war. »Ich will sie sehen.«
Ihre kindliche Freude angesichts der Münzen sorgte bei Duncan jedes Mal für Erheiterung. Sie hatte fast noch nie Geld in der Hand gehabt. Früher, in Irland, hatten ihre Eltern oder die Angestellten Geldgeschäfte für sie erledigt und in Neuholland ihr Ehemann. Allerdings hatte sie schnell gelernt, wie viel die meisten Sachen kosteten.
Erwartungsvoll öffnete sie den kleinen Beutel und kippte seinen Inhalt auf den Tisch. Etliche Münzen verteilten sich auf der Tischplatte: riesige Kupfermünzen, wegen ihrer Größe und ihres Gewichts Wagenradpenns genannt; silberne britische Shillings; holländische Silbergulden; dazwischen die Achterstücke – in Viertel und Achtel geschnittene spanische Silberdollars, die in der Kolonie als Shillings und Sixpence gehandelt wurden. Da es in der Kolonie vor allem an Münzgeld fehlte, hatte Gouverneur King vor kurzem in einer öffentlichen Proklamation den Wert jeder Währung festgelegt, die in Neusüdwales kursierte. Um zu verhindern, dass das Geld wieder ausgeführt wurde, hatte er außerdem den Wert dieser »Proklamationsmünzen« verdoppelt.
»Oh, sieh nur!« Moira fischte aus dem Haufen eine kleine goldene Münze heraus und hielt sie hoch. Auf einer Seite war eine kleine Figur eingeprägt, die Rückseite zierte ein fünfzackiger Stern. »Ich glaube, das ist eine indische Pagoda.«
Sie erhob sich und wühlte in der Truhe, bis sie mit einem Papier zurückkam, das sie neben sich auf den Tisch legte – der Text der Proklamation. Die meisten Werte kannten sie inzwischen auswendig, aber manche Münzen hatten sie noch nie gesehen.
»Eine Pagoda …«, Moira fuhr mit dem Finger die Liste entlang, »… ist acht Shilling wert.«
Sie zählte die restlichen Münzen, rechnete, dann nickte sie zufrieden. »Alles in Ordnung. Darin ist er korrekt.«
»Außerdem hat er mir einen Schuldschein über drei Shilling gegeben«, sagte Duncan.
Moira presste die Lippen zusammen. Sie sah es nicht gerne, dass er immer wieder für den Doktor arbeitete, aber manchmal war es die einzige Möglichkeit, überhaupt an Geld zu kommen. Noch war das Getreide nicht reif, und auch nach der Ernte würde es wohl nur für sie selbst reichen. Verkaufen würden sie dieses Jahr noch nichts davon können.
Sie begann, die Münzen zurück in das Säckchen zu geben. »Hat er nach mir gefragt?«
Duncan verneinte.
»Und du hast ihm auch nicht erzählt, dass wir bald zu dritt sind?«
»Nein. Wieso sollte ich?«
Über Moiras Gesicht glitt ein Lächeln, während sie die goldene Pagoda auf ihrer Handfläche betrachtete. »Es wird ihm ganz schön zusetzen, wenn er es erfährt. Wo er doch selbst so dringend einen Sohn haben wollte. Ich glaube, nur deswegen hat er mich überhaupt geheiratet.«
Sie setzte die goldene Münze auf die Kante und stieß sie an. Klingend rollte das Geldstück über die Tischplatte. Bevor es zu Boden fallen konnte, fing Duncan es auf. Dann sammelte er auch die restlichen Münzen ein, verschnürte den Beutel und öffnete Moiras große Truhe, in der sie ihre gemeinsamen Habseligkeiten verstaut hatten. Das meiste davon stammte von Moira. Den Beutel legte er ganz zuunterst und packte den Text der Proklamation dazu, dann öffnete er ein Leinenpäckchen und holte eine der teuren Bienenwachskerzen heraus.
Moira sah ihm zu, als er den Docht in die Flammen des Kaminfeuers hielt. »Was tust du da?«
»Ich zünde eine Kerze an.«
»Das sehe ich! Aber warum?«
Duncan stellte die brennende Kerze auf den Tisch. »Ich habe heute Namenstag. Das ist für meinen Heiligen.«
»Du hast einen eigenen Heiligen? Den hast du mir aber noch nie vorgestellt.« Sie sah ihn amüsiert an. »Der heilige Duncan also?«
Auch Duncan musste lächeln. »Nein, den gibt es nicht. Vater Mahoney meinte, für mich sei der heilige Dionysius zuständig.«
Moira zog die dunklen Augenbrauen hoch. »Der heilige Dionysos. Sicher doch. War das nicht der griechische Gott des Weines?« Sie grinste über beide Ohren. »Und der Fruchtbarkeit? Mir scheint, dein Ziehvater wusste genau, was für einer mal aus dir werden wird.«
»Diony-SIUS, nicht Diony-SOS! Das war ein frühchristlicher Märtyrer. Nachdem die Römer ihn geköpft hatten, ist er noch sechs Meilen weit gelaufen und hat dabei die ganze Zeit gebetet.«
»Während sein Kopf noch immer auf dem Richtplatz lag?«, fragte Moira mit erstickter Stimme, der er anhörte, dass sie das Lachen zurückhielt.
»Nein«, gab er trocken zurück. »Den hat er natürlich mitgenommen. Unter dem Arm.«
»Natürlich. Wie sonst?« Sie lachte auf. »Sag jetzt nicht, dass du das glaubst!«
Duncan hob die Schultern und bemühte sich um ein ernstes Gesicht. »Natürlich. Er war schließlich ein Heiliger.« In Wahrheit bezweifelte er diese Geschichte genauso wie sie.
Moira zog ihr Schultertuch um sich und blickte in die flackernde Kerzenflamme. »Ihr Papisten seid schon eigenartige Leute. Was ist mit denen, die keinen Heiligen haben?«
»Die feiern am ersten November Namenstag. An Allerheiligen.«
»Aha. Sehr praktisch. Alle für einen.« Kurz verzog sie das Gesicht und legte die Hand auf ihren gewölbten Leib. »So kann nur ein Junge treten. Joey. Wann wird sein Namenstag sein?«
»Ich weiß nicht.« Ein warmes Gefühl machte sich in ihm breit. »Dann willst du ihn katholisch taufen lassen?«
Sie lächelte. »Ja.«
»Ich habe schon einmal ein Kind getauft«, murmelte er.
»Du? Ich dachte, das dürfen nur Kirchenmänner.«





























