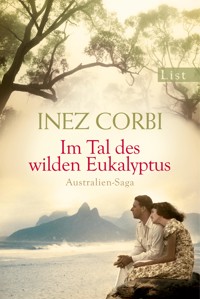7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Neuguinea 1890: Als die junge Lehrerin Isabel Maritz in der fernen deutschen Kolonie ankommt, muss sie erfahren, dass ihr Verlobter vor Kurzem gestorben ist. Verzweifelt zieht sie in die Missionsstation, in der ihr Verlobter gearbeitet hat, und lernt dort den Einheimischen Noah kennen. Obwohl der junge Mann ein großes Geheimnis aus seiner Vergangenheit macht, fühlt Isabel sich bald zu ihm hingezogen. Doch dann geschieht ein Mord – und Noah wird der Tat verdächtigt. Noch bevor Isabel weiß, wie ihr geschieht, entführt Noah sie in die Urwälder der exotischen Insel.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Über das Buch
Finschhafen auf Deutsch-Neuguinea, 1890. Nach ihrer Ankunft muss die junge Lehrerin Isabel Maritz erfahren, dass ihr Verlobter, ein Missionar, vor kurzem gestorben ist. Berthold von Faber, ein Kolonialbeamter, und seine Schwester Henriette kümmern sich in den ersten Tagen um Isabel. Um zu wissen, wie ihr Leben als Missionarsfrau ausgesehen hätte, zieht sie bald darauf nach Simbang, wo ihr Verlobter gelebt hat. In der Missionsstation lernt sie den deutschsprachigen Papua-Mischling Noah kennen, der als Dolmetscher arbeitet und ein Geheimnis aus seiner Vergangenheit macht. Obwohl sie nicht weiß, was sie von dem jungen Mann halten soll, fühlt Isabel sich von ihm angezogen, und auch Noah scheint ihre Gefühle zu erwidern.
Doch wenig später wird Noah eines Mordes verdächtigt. Auf seiner Flucht nimmt er Isabel als Geisel – und diese ist hin- und hergerissen zwischen Entsetzen und Zuneigung. Wird sie den beschwerlichen Weg durch den Urwald überleben?
Über die Autorin
Inez Corbi, geboren 1968, studierte Germanistik und Anglistik in Frankfurt/Main. Nach ersten Erfolgen als Schriftstellerin widmet sie sich inzwischen vollständig dem Schreiben. Sie lebt mit ihrem Mann bei Frankfurt am Main.
www.inez-corbi.de
Von Inez Corbi sind in unserem Hause bereits erschienen:
Das Lied der roten Erde
Im Tal des wilden Eukalyptus
Inez Corbi
Im Herzen der Koralleninsel
Ein Südseeroman
List Taschenbuch
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-buchverlage.de
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-0668-1
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2013
Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München
Titelabbildung: © Nectarinia Gouldae from ›Tropical Birds‹, 19th century (colour litho), Gould, John (1804–81)/Private Collection/The Bridgeman Art Library (Vogel); © New York Harbour, 1850 (oil on canvas), Lane, Fitz Hugh (1804–65)/Museum of Fine Arts, Boston, Massachusetts, USA/Gift of Maxim Karolik for the M. and M. Karolik/Collection of American Paintings, 1815–65/The Bridgeman Art Library (Schiff und Meer); © getty images/Dea Picture Library (Hand, Blüten und Blätter); © Fine Pic®, München (Karte, Fond und Bullauge)
Alle Rechte vorbehalten.
Unbefugte Nutzung wie etwa Vervielfältigung,
Verbreitung, Speicherung oder Übertragung
können zivil- oder strafrechtlich
verfolgt werden.
eBook: LVD GmbH, Berlin
Meinem Vater
1.
Kaiser-Wilhelms-Land, Neuguinea, 1890
Conrad hatte ihr nicht zu viel versprochen. Dieses Fleckchen Erde war das Paradies, wenn auch auf eine wilde, ungezähmte Art. In der Morgendämmerung, die den Himmel wie mit feuerfarbenen Pinselstrichen überzog, hielt Isabel sich an der Reling fest und starrte hinüber auf die Spitze der Halbinsel, die die Ottilie jetzt ansteuerte. Hinter einem schmalen Uferstreifen stiegen in langen Ketten gewaltige Gebirge auf. Düster, majestätisch, erhaben. Das war also Kaiser-Wilhelms-Land, von manchen auch Deutsch-Papua genannt. Die zweitgrößte Insel der Welt, nördlich von Australien gelegen. Seit hier vor sechs Jahren die deutsche Flagge gehisst worden war, gehörte der nordöstliche Teil Neuguineas zur deutschen Südsee. Ein Platz an der Sonne, wie der Kaiser es nannte. Und sonnig war es in der Tat. Sonnig, heiß und unglaublich schwül. Keine noch so leichte Brise wehte über das Wasser. Selbst jetzt, am frühen Vormittag, fühlte Isabel sich bereits wieder klebrig und verschwitzt, dabei hatte sie sich doch erst vor wenigen Minuten in ihrer Kabine gewaschen.
Sechs Wochen war sie unterwegs gewesen. Die meisten Passagiere waren in Soerabaya auf Java von Bord gegangen, um von dort nach Australien zu reisen. Auch Isabel hatte die Reise dort einen Tag unterbrechen müssen, bevor sie auf die Ottilie hatte wechseln können.
Die See war ruhig, die Sonne glitzerte auf dem Meer wie von tausend Diamanten und stach in den Augen. Isabel beobachtete einen Vogel, der mit kräftigen Flügelschlägen knapp über der Wasseroberfläche dahinflog. Dann wandte sie sich ab und zog die hinaufgerutschten Ärmel ihrer leichten Bluse wieder hinunter. Jetzt, da sie das Ziel ihrer weiten Reise fast erreicht hatte, überfiel sie die lange unterdrückte Angst erneut. Was, wenn Conrad doch nicht so freundlich wäre, wie er in seinen Briefen klang? Wenn sie ihm nicht gefallen würde? Wenn ihr schwaches Bein ihn doch abstoßen würde? Nein, versuchte sie sich selbst Mut zu machen. Das würde nicht passieren. Auch wenn sie ihren Verlobten noch nie gesehen hatte – aus seinen Briefen hatte stets so viel Wärme, so viel Verständnis gesprochen. Er würde sie mit offenen Armen hier aufnehmen, ganz so, wie er es immer wieder geschrieben hatte. Und in wenigen Tagen würde sie nicht mehr Fräulein Maritz, sondern Frau Conrad Felby, Missionarsfrau, sein.
Sie griff nach ihrer aufwendig mit gestickten Rosen verzierten Handtasche und zog den Umschlag heraus, der sie kurz vor ihrer Abreise aus Zirndorf erreicht hatte. Neben einem Brief enthielt er auch eine schwarzweiße Photographie von Conrad, die er noch in Deutschland hatte anfertigen lassen. Sie zeigte einen jungen Mann von Ende zwanzig, mit ebenmäßigen Zügen, den Blick entschlossen in die Ferne gerichtet. Er trug den strengen schwarzen Lutherrock der evangelischen Pastoren, die vollen Haare waren zurückgekämmt, und ein dunkler, leicht gekräuselter Bart umrahmte wie ein Kranz das stille, ernste Gesicht. Ein hübsches Gesicht, wie Isabel fand.
Ein letzter Blick noch, dann steckte sie die Photographie sorgfältig wieder in ihre Handtasche. Die Küste war nun ganz nah. Ein Strand, an dem ein paar Palmen wuchsen. Eine Ansammlung einfacher, auf Pfählen errichteter Hütten, daneben einige dunkelhäutige Männer, die ein Kanu mit einem seitlichen Ausleger ins Wasser zogen. Isabel hob den Arm und winkte zaghaft. Sie senkte ihn wieder, als keiner der Männer ihren Gruß erwiderte, und ihre Beklommenheit wuchs. Ob das ein schlechtes Omen war?
Ein hölzerner Landungssteg, der auf Stelzen ins Hafenbecken ragte, kam in Sicht, dahinter erkannte sie ein paar einfache Bretterhütten. Eine kleine Straße verlor sich zwischen den Büschen und Palmen am Strand. Isabel konnte einige helle Dächer durch das allgegenwärtige Grün leuchten sehen – wahrscheinlich Finschhafen, der Hauptsitz der Verwaltung von Kaiser-Wilhelms-Land und das Ende ihrer Reise.
Ihr Herz schlug schneller. Bald würde sie von Bord gehen und ihrem Conrad zum ersten Mal leibhaftig gegenüberstehen. Ihre Hände wurden feucht, und sie wischte sie an ihrer Bluse ab, unter der das Korsett plötzlich viel zu eng schien.
Sie spürte den Schiffskörper erzittern wie vom Fieber geschüttelt, die Schiffsschraube sirrte unangenehm, als der Dampfer die Fahrt verlangsamte. Das türkisfarbene Wasser sprudelte und schäumte weiß, die Turbinen röhrten. Eine Schar bunter Vögel flatterte kreischend auf; Isabel sah ihnen nach, wie sie im dichten Tropenwald verschwanden. Neben und hinter ihr erklangen die Stimmen der anderen Passagiere, die sich nun ebenfalls an Deck versammelt hatten; aufgeregtes Reden war zu hören. Bis auf zwei ältere Engländerinnen, die bereits in Port Moresby auf der britischen Seite Neuguineas ausgestiegen waren, reisten nur Männer auf dem kleinen Überseedampfer. Hauptsächlich Kolonialbeamte, Pflanzer und ein paar Abenteurer, wie sie den Gesprächen bei der Pflichtveranstaltung des gemeinsamen Abendessens hatte entnehmen können. Während der langen Wochen auf See hatte Isabel sich mit niemandem angefreundet. Selbst in ihrer Kabine war sie allein gewesen, denn eine Reisegefährtin hatte im letzten Moment kalte Füße bekommen und die Überfahrt abgesagt.
Rasselnd verschwand die Ankerkette im Wasser. Von der Landungsbrücke legte eine kleine Dampfpinasse ab und näherte sich der Ottilie, um die Passagiere an Land zu bringen.
Am Pier stand eine Handvoll Menschen. Vereinzelt hörte Isabel freudige Ausrufe, und auf dem Schiff wie auch an Land begannen die Leute zu winken und Hüte zu schwenken, als sie Freunde oder Verwandte erkannten. Isabel reckte sich und blickte angestrengt zum Land hinüber. Sie sah einen großen, kräftigen Mann in hellem Anzug und mit Tropenhut, an seiner Seite eine zierliche Gestalt, wahrscheinlich seine Frau. Isabels Beine wurden weich, als sie den Mann daneben erblickte. Auch er trug einen hellen Anzug, und sein Gesicht verschwand fast vollständig hinter einem dunklen Bart. Das musste Conrad sein! Großer Gott, wie lang und dünn er war!
Plötzlich wurde die Angst in ihr übermächtig, und unter ihrem fest geschnürten Korsett blieb ihr die Luft weg. Sie ließ die Reling los, raffte ihren langen dunkelblauen Rock und eilte hinter den freudig winkenden Passagieren leicht hinkend über das Deck. Ungelenk kletterte sie die Treppe ins Zwischendeck hinab, tauchte in das Dämmerlicht und ging mit hastigen kleinen Schritten zu ihrer Kabine am Ende des Gangs. Schnell jetzt, schnell! Es kam ihr vor, als würge sie jemand. Selbst als sie die Kabinentür hinter sich geschlossen hatte und allein war in der vertrauten Enge, löste sich der Druck nicht. Sie glaubte zu ersticken, riss fast die Knöpfe ihrer Bluse ab, als sie das Kleidungsstück mit zitternden Fingern öffnete und schließlich ablegte. Hektisch zog sie an den Schnüren und zerrte an den Häkchen ihres engen Korsetts, das ihren Körper in eine sanduhrförmige Form presste. Als es sich endlich lockerte, lehnte sie sich mit einem erleichterten Aufatmen gegen die Kabinenwand und ließ Luft in ihre Lungen strömen.
Sie kam sich unendlich klein und verloren vor. Da hatte sie allen Nörglern und Bedenkenträgern getrotzt, war allein um die halbe Welt gereist, und nun hatte sie Angst, ihrem Bräutigam gegenüberzutreten. Aber das war ja nicht anders zu erwarten gewesen. Fast glaubte sie die Stimme ihrer Mutter zu hören. »Du willst zu den Wilden reisen und einen Missionar heiraten? Ausgerechnet du?« Dabei hätte sie doch froh sein sollen, dass ihre jüngste Tochter endlich ihr Leben in die Hand genommen hatte.
Isabel atmete tief durch. Ja, sie würde hier ein neues Leben anfangen. Ein neues, ein besseres Leben.
Wenn da nur nicht die Angst wäre. Wie würde es wohl sein, wenn Conrad sie anfasste? Wenn er sie küsste? Bis auf einen unschuldigen Kuss unter Nachbarskindern, als sie elf Jahre alt gewesen war, hatte sie noch nie jemanden geküsst. Und wie würde es erst sein, wenn sie verheiratet waren und Conrad sein Recht als Ehemann forderte? Sie schluckte und zwang sich, stattdessen an das zu denken, was daraus erwachsen mochte: Dass sie vielleicht bald Mutter werden würde. Bei dem Gedanken an ein kleines Mädchen oder einen kleinen Jungen wurde ihr warm ums Herz. Dafür würde sie alles ertragen.
Fast musste sie über sich selbst lächeln. Da reiste sie in ein Land, in dem angeblich noch Kannibalen hausten, und sie fürchtete sich vor dem Zusammensein mit ihrem Zukünftigen! Dabei hatte niemand sie zu irgendetwas gezwungen. Aus freiem Willen hatte sie dieser Verlobung mit einem ihr fast gänzlich Unbekannten zugestimmt.
Lieber Gott, bat sie stumm, erweise mir Gnade und steh mir bei. Steh uns bei. Schaffe Harmonie zwischen uns. Dann wird alles gut.
Sie hörte Schritte auf dem Deck und das Rufen der Seeleute. Ihr stolpernder Herzschlag beruhigte sich, das kurze Gebet hatte ihr Kraft gegeben. Jetzt würde sie sich ihrem neuen Leben stellen können. Sie warf einen flüchtigen Blick in den Spiegel. Herrje, wie blass sie aussah! Die kastanienbraunen Haare, die sie unter dem Hütchen zu einem einfachen Knoten hochgesteckt hatte, waren an den Schläfen schon wieder verschwitzt. Sie kniff sich in die Wangen, um ein wenig Farbe hineinzubringen, dann schnürte sie ihr Korsett zu, diesmal etwas weniger eng, und legte die Bluse wieder an.
*
Ihre ersten Schritte auf der hölzernen Landungsbrücke waren so unsicher, dass sie zu fallen glaubte. Der feste Boden schien zu schwanken nach all den Tagen auf See. Die Überfahrt von Java war unruhig gewesen. Zu Anfang hatte ihr die Seekrankheit sehr zu schaffen gemacht, und Isabel hatte kaum etwas essen können – aber das kam zumindest ihrer Taille zugute, die seitdem wenigstens ein bisschen geschrumpft war, wenn auch bei weitem nicht so viel, wie sie es sich gewünscht hatte.
Immer mehr Menschen bevölkerten den Pier. Nackte Kinder mit buschigen Krausköpfen liefen umher, dunkelhäutige Männer mit nicht mehr als einem Tuch um die Hüften halfen, Koffer, Taschen und andere Gepäckstücke an Land zu bringen. Auch Isabels zwei Koffer wurden von dunklen Händen ergriffen und, ehe sie etwas einwenden konnte, auf die Landungsbrücke getragen. Isabel blieb neben ihrem Gepäck stehen, umklammerte den Bügel ihrer Handtasche und sah sich hilfesuchend um. Als die beiden Männer in den hellen Tropenanzügen, die sie vorhin schon erblickt hatte, zögernd auf sie zukamen, versuchte sie zu lächeln, aber ihr Herz klopfte so laut, dass ihr ganzer Körper zu vibrieren schien.
»Fräulein Maritz?« Der große, massige Mann hatte seinen Tropenhut, den eine schwarz-weiß-rote Kordel zierte, abgenommen und unter den linken Arm geklemmt; der Ärmel seiner leichten Jacke war in Höhe des Ellbogens umgeschlagen, der Unterarm fehlte. Ein Lächeln ging über sein Gesicht, als Isabel nickte. »Herzlich willkommen in Finschhafen. Ich freue mich sehr, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ich bin Berthold von Faber, der stellvertretende Leiter der Station Finschhafen.« Mit einer leichten Verbeugung ergriff er Isabels Finger zu einem angedeuteten Handkuss.
Sie senkte den Blick, Hitze flutete in ihre Wangen. So hofiert zu werden war sie nicht gewöhnt.
»Sehr erfreut, Herr von Faber«, murmelte sie. Ihre Hand lag schlaff und klebrig in seiner. Waren ihre Finger so schweißfeucht, oder waren es seine?
»Ach, Berthold, nun gib Fräulein Maritz schon frei und lass das arme Kind doch erst einmal ankommen!« Die Frau in dem vornehmen Kleid, die sie schon vom Schiff aus gesehen hatte, klopfte Herrn von Faber mit einem zusammengelegten Fächer leicht auf den rechten Arm. »Henriette Thilenius«, stellte sie sich vor und reichte Isabel die Hand. »Bertholds Schwester. Ich freue mich sehr, wieder einmal ein weibliches Wesen in diesem Junggesellenrefugium zu sehen.«
Herrn von Fabers Schwester war eine Schönheit und so zierlich, wie ihr Bruder massig war. Sie war nicht mehr jung, vielleicht Mitte oder Ende dreißig, aber sie hielt sich kerzengerade, und ihre Taille hätte ein Mann mit seinen Händen fast ganz umfangen können.
Isabel murmelte eine Erwiderung – und verstummte dann, als ihr Blick zu dem großen, dünnen Mann ging, der sich bislang im Hintergrund gehalten hatte und der jetzt zu ihnen trat. Seine dunklen Augen blickten sie freundlich an, und was sie von seinem Gesicht unter dem dicht wuchernden Bart erkennen konnte, war knochig, fast schon ausgezehrt. Er wirkte ganz anders als auf der Photographie, die sie nun schon so oft angesehen hatte. So viel älter. Conrad war doch erst achtundzwanzig – dieser Mann sah aus wie vierzig.
»Conrad?«, flüsterte sie fast ohne Stimme.
Das Gesicht hinter dem Bart verzog sich zu etwas, das Isabel nicht deuten konnte. War es Bedauern? Schmerz?
»Nein«, sagte der Mann dann. »Nein, das bin ich nicht. Ich bin Pater Paul Lorenz. Gott zum Gruß, Schwester Maritz.«
Sein Händedruck war warm und trocken. Isabel nickte verwirrt. Und gleichzeitig erleichtert darüber, dass diese hagere Vogelscheuche nicht ihr Conrad war. Von Bruder Lorenz hatte Conrad ihr geschrieben; er war einer der vier Missionare der Station Simbang.
Jetzt schlug er die Augen nieder. »Bruder Felby konnte … leider nicht kommen«, sagte er leise.
Ihr Herz sank. Dieser Anfang war alles andere als vielversprechend. War Conrad ihrer schon überdrüssig geworden? Hatte er sich etwa doch gegen sie entschieden?
»Er ist vergangene Woche am Schwarzwasserfieber erkrankt.«
»Am Schwarzwasserfieber?«, wiederholte Isabel. Diesen Namen hatte sie noch nie gehört.
»Eine besonders schwere Form der Malaria.« Bruder Lorenz blickte sie traurig an. »Es tut mir unendlich leid, Schwester Maritz. Bruder Felby ist vor vier Tagen gestorben.«
Der Aufschrei erstarb in ihrem Mund. Das weiße Rauschen schien plötzlich von überall her zu kommen. Die Menschen vor ihren Augen flimmerten, und der Sonnenschein war auf einmal entsetzlich grell. Immer heller wurde es, immer heller. Sie spürte schon nicht mehr, wie sie auf dem Landungssteg zu Boden sank.
*
Zuerst war da der Geruch. Leicht süßlich, wie ein Parfüm von unbekannten Blumen. Er wehte an Isabel vorbei, flüchtig wie eine Sommerbrise, kitzelte ihre Nase und verschwand wieder in der Dunkelheit.
Dann Stimmen. Leise, geflüsterte Stimmen. Ein Mann? Eine Frau? Sie sprachen miteinander.
Weitere Geräusche. Ein leises, aber stetiges Auf- und Abwogen, ein Rauschen, regelmäßig wie Meeresbrandung. Das Schnarren von Zikaden, wie ein unermüdliches Konzert. Das nervtötende Surren eines Insekts, heller werdend, verstummend, dann erneut einsetzend.
Etwas wurde ihr an die Lippen gehalten. »Dringim, misis«, hörte sie jemanden sagen. Der Geschmack einer kühlen, süßen Flüssigkeit auf ihren Lippen, ihrer Zunge. Schlucken.
Unter sich spürte sie eine weiche Unterlage. Wo war sie? Mühsam öffnete sie die Augen und schloss sie gleich wieder. Sie blinzelte und öffnete abermals vorsichtig ein Auge. Sie lag in einem Bett, und der Himmel über ihr war diesig und neblig. Die Augen fielen ihr wieder zu.
Als sie erneut die Lider aufschlug, war die Helligkeit einem dämmrigen Zwielicht gewichen. Nur der Nebel war noch da. Sie zwang sich wach zu bleiben, die Augen offen zu halten. Ihr Blick huschte hin und her, suchte nach einem Fixpunkt, bis sie einen fand: Auf ihrem Handrücken saß eine Mücke. Sie war klein und schmächtig, kaum länger als einen halber Zentimeter, der Kopf duckte sich tiefer als der Hinterleib, als würde sie sich verbeugen, und fuhr eine Art Rüssel aus. Im nächsten Moment verspürte Isabel ein Brennen. Sie zog die Hand zurück, und die Mücke verschwand.
Es war kein Nebel, sondern ein feingewebtes Netz aus Baumwolle, das das ganze Bett wie ein Zelt umgab. Hier und da waren winzige Flickstellen zu sehen. Ein Moskitonetz. Nun, offenbar hatte es seinen Zweck nicht ganz erfüllt.
Unter dem Netz war es stickig; je länger Isabel das feine Gewebe anstarrte, desto schlechter bekam sie Luft. Und ihr war schrecklich warm. Sie schlug das Laken, das ihren Körper bedeckte, nach unten. Obwohl sie nur ein leichtes Nachthemd trug, war sie nassgeschwitzt. Sie blickte an sich hinab. Was hatte sie da überhaupt an? Das war keines ihrer Nachthemden. Es war aus cremefarbener Seide, mit einem zarten Spitzenbesatz am Ausschnitt und an den Handgelenken, und es spannte ein wenig an den Schultern.
Wer immer ihr dieses Nachthemd angezogen hatte, schoss es ihr plötzlich siedendheiß durch den Kopf, hatte sie auch ausgezogen. Und sie unbekleidet gesehen. Trotz des langärmeligen Hemdes kam sie sich nackt vor.
Erst dann kehrte die Erinnerung zurück. Die Ankunft in Finschhafen. Die vielen fremden Eindrücke. Conrad! Schlagartig fiel ihr wieder die furchtbare Nachricht ein, die Bruder Lorenz ihr überbracht hatte.
Und wo war sie hier überhaupt? Sie gab ein leises, erschöpftes Schluchzen von sich und drehte den Kopf. War sie allein?
»Ist da jemand?«, fragte sie zaghaft.
Hinter dem zeltartigen Moskitonetz erhob sich ein Schatten.
»Yu na slip?«, hörte sie eine tiefe Frauenstimme fragen. Dann hoben zwei dunkle Hände das Netz an, und ein braunes, fülliges Gesicht erschien und begann, auf sie einzureden.
Erschrocken zog Isabel die Decke wieder über sich. Die schwarze Frau hievte ihren gewaltigen Körper nun ganz unter das Moskitozelt und zog das baumwollene Netz hinter sich wieder zu. Isabel konnte zunächst kaum etwas von ihrem Wortschwall verstehen, doch dann glaubte sie einzelne Wörter zu erkennen, die vage an Englisch erinnerten.
»Do you speak English?«, fragte sie hoffnungsvoll. »Oder … vielleicht sogar Deutsch? Wo bin ich hier? Bitte … verstehen Sie mich?«
Die Frau sah sie ruhig an, dann nickte sie. »Wetim, misis. Lukluk misis.« Damit verschwand sie.
Hatte sie das richtig verstanden? Wollte die Frau jemanden holen? Vorsichtig setzte Isabel sich im Bett auf und zog die Decke bis fast hoch zu den Schultern. Ihr Handrücken juckte von dem Mückenstich.
Schon nach kurzer Zeit hörte sie Schritte, dann trat jemand ins Zimmer und schob das Moskitonetz zur Seite: Henriette Thilenius.
»Ach, wie schön, dass Sie wieder aufgewacht sind, Fräulein Maritz«, sagte sie und ließ das Netz hinter sich sinken. »Wir haben uns große Sorgen um Sie gemacht, als Sie am Hafen umgekippt sind, aber Doktor Weinland meinte, das sei nur die Hitze und der Schock gewesen. Wie geht es Ihnen?«
»Ich fühle mich noch etwas schwach, aber es wird schon«, gab Isabel zurück. »Wo bin ich hier?«
»In unserem Haus, das heißt im Haus meines Bruders.«
»Dann ist das Ihr Nachthemd?«
»So ist es. Ich wollte Ihre Sachen nicht ohne Ihre Zustimmung auspacken. Ich hoffe, es passt?«
»Ja, danke. Frau Thilenius, ich möchte mich –«
»Henriette«, unterbrach Frau Thilenius sie. »Bitte, meine Liebe, sagen Sie Henriette zu mir. Ich habe hier doch so wenig weibliche Gesellschaft. Und vielleicht darf ich Sie Isabel nennen?«
»Sehr gerne.« Isabel schwirrte der Kopf. Es war alles noch zu neu und zu viel, dennoch war sie froh über Frau Thilenius’ – Henriettes – Gesellschaft.
»Ist es wahr? Ist Conrad wirklich … tot?«
Henriette schenkte ihr einen kurzen Blick, dann nickte sie, einen leicht verkniffenen Zug um den Mund, der wohl ihr Bedauern ausdrücken sollte. »Ja, meine Liebe, so leid es mir tut. Das Fieber verschont hier nur wenige, und manche trifft es besonders schwer.«
Isabel drängte die Tränen zurück. Das hier war nicht das Paradies, von dem Conrad ihr so viel erzählt hatte. Das hier war ein schreckliches Land, und sie würde zusehen, dass sie so schnell wie möglich wieder nach Hause zurückkehren konnte.
»Ich bin furchtbar müde«, murmelte sie. »Am liebsten würde ich weiterschlafen.«
»Sie haben zwei Tage lang geschlafen, meine Liebe. Es wird Zeit, dass Sie aufstehen! Aber zuvor müssen Sie dringend Ihre erste Dosis Chinin zu sich nehmen. Sie wollen doch nicht gleich an Malaria erkranken? Kiso!«, rief Henriette. »Bringim kinin!«
»Yes, misis«, erklang es von irgendwo hinter dem Netz, und schon entfernten sich die schlurfenden Schritte.
Henriette warf einen Blick über die Schulter. »Die Schwarzen arbeiten recht ordentlich, aber man muss sie ständig antreiben.«
Isabel fühlte sich ein wenig unbehaglich. Sie war es nicht gewohnt, mit Dienstboten umzugehen; daheim in Zirndorf hatten sie keine Angestellten gehabt. Henriette Thilenius dagegen sprach mit einer Sicherheit, die langjährige Gewohnheit verriet.
Die füllige Papuafrau mit Namen Kiso kam zurück und brachte ein Glas Wasser und einige Tabletten, von denen Henriette zwei in das Glas gab, die daraufhin zu einem weißen Pulver zerfielen.
»Trinken Sie das. Es ist sehr bitter, aber unerlässlich, wenn Sie von der Malaria verschont bleiben wollen.«
Isabel griff pflichtbewusst nach dem Glas. Es roch fruchtig nach Zitrone – offenbar hatte Kiso dem Wasser noch etwas Limettensaft beigegeben.
»Halten Sie sich die Nase zu, und dann in einem Zug hinunter damit«, riet Henriette. »So mache ich es immer. Manchmal gebe ich auch noch etwas Gin dazu, wie die Engländer, aber das haben wir heute nicht im Haus.«
Es war nicht ganz einfach, mit der Hand an der Nase zu trinken, und als es Isabel schließlich gelang, war der bittere Geschmack dennoch so scheußlich, dass sie sich um ein Haar übergeben hätte. Hastig presste sie sich den Handrücken auf den Mund.
»Ich weiß«, sagte Henriette ungerührt. »Man möchte es sofort wieder ausspucken.« Sie nahm das leere Glas an sich. »Ruhen Sie sich noch etwas aus, meine Liebe. In zwei Stunden erwarten Berthold und ich Sie zum Abendessen.«
*
Das Chinin könne unangenehme Nebenwirkungen haben, hatte Henriette erklärt, bevor sie gegangen war. Jetzt lag Isabel auf dem Bett und versuchte, noch etwas zu schlafen. Es gelang ihr nicht. Alles drehte sich. Sie hatte ein Bein über die Bettkante gehängt, einen Fuß auf dem Boden, und versuchte gegen den Schwindel und die Übelkeit anzukämpfen. In ihren Schläfen hatte sich ein hartnäckiger Schmerz festgesetzt. War das jetzt jedes Mal so, wenn sie Chinin nehmen musste? Oder war die Dosis zu hoch gewesen?
In den Schwindel und die Übelkeit mischten sich Geräusche. Erst glaubte Isabel, es wäre Wellenrauschen oder Vogelgezwitscher, bis sie begriff, dass es eine Stimme war. Offenbar stand Henriette fast direkt vor ihrem Fenster und sprach leise mit jemandem. Isabel wollte zwar nicht lauschen, aber sie war schließlich auch nicht verpflichtet, sich die Ohren zuzuhalten. Außerdem tat ihr die Ablenkung gut.
»Du solltest nicht hierherkommen!«, hörte sie Henriette jetzt auf Deutsch flüstern. Sie klang aufgebracht. »Ich habe doch gesagt, nicht hier! Berthold kann jeden Moment zurückkommen.«
Einige Sekunden vergingen. Offenbar gab Henriettes Gesprächspartner ihr eine Antwort, aber sosehr Isabel auch die Ohren spitzte, sie konnte nichts davon verstehen. Sie vermochte nicht einmal zu erkennen, ob Henriette mit einem Mann oder einer Frau sprach.
»O nein!«, vernahm sie dann wieder Henriettes erregtes Flüstern. »So einfach ist das nicht! Was glaubst du, wer –« Sie verstummte, als Schritte zu hören waren. »Schnell, er darf dich hier nicht sehen!«, hörte Isabel sie noch zischen, dann war es still. Gleich darauf erklang Herrn von Fabers tiefe Stimme. Sie hörte sich tröstlich vertraut an, und zu ihrer Erleichterung bemerkte Isabel, dass ihr nicht länger übel war. Auch der Schwindel war fast verschwunden, und sie spürte, wie die Erschöpfung wieder nach ihr griff. Dankbar glitt sie hinüber in einen leichten Dämmerschlaf.
2.
Das Speisezimmer war eleganter, als Isabel erwartet hatte, und nach der neuesten kolonialen Mode eingerichtet. Auf einer niedrigen Kommode stand eine Vase mit einer geschmackvollen Kombination bunter Orchideen, und hinter dem Esstisch, der mit feinem Porzellan gedeckt war, erblickte sie einen ausladenden Schaukelstuhl. An der Wand hing eine Landkarte, die Neuguinea zeigte. Die große Insel erinnerte mit ihrer langgezogenen Form entfernt an die Gestalt eines sitzenden Vogels, Finschhafen befand sich etwa in Höhe der Schwanzfedern. In diesem fernen Teil der Welt tummelten sich gleich drei europäische Nationen: Die westliche Hälfte befand sich schon lange in holländischer Hand, den Ostteil hatten vor sechs Jahren Briten und Deutsche unter sich aufgeteilt. Seitdem war in Deutschland das Tropenfieber ausgebrochen. In den Zeitungen und Amtsblättern wurde immer wieder von der neuesten deutschen Kolonie am anderen Ende der Welt berichtet, wo es stets warm und sonnig war und wo die Menschen angeblich wie im Paradies lebten.
Auch Isabel hatte sich begeistern lassen von den Verlockungen der Ferne und dem idyllischen Leben unter Palmen. Begierig hatte sie jeden noch so kleinen Bericht über Kaiser-Wilhelms-Land aus den Neuesten Mittheilungen aufgesogen. »Die Temperatur ist außergewöhnlich regelmäßig und gleichmäßig«, hatte es da geheißen, »die Jahresmittel-Temperatur beträgt an der Küste 26 Grad Celsius. Gemüse aller Art gedeihen sehr gut, dasselbe gilt für Rindvieh und Pferde, Schweine und Ziegen und alles Geflügel. Das Klima bei Finschhafen ist außerordentlich angenehm und auch dem Nord-Europäer sehr zuträglich. Die einzige Krankheit, von welcher allerdings 75 Prozent der im Lande weilenden Deutschen heimgesucht werden, ist die Malaria, die jedoch nur selten tödlich verläuft und ihre Keime in dem sumpfigen Boden und verwesenden Holz- und Pflanzenresten hat, daher denn auch wohl dem fortschreitenden Anbau weichen wird.«
Und nun war Conrad dieser Krankheit erlegen, und all ihre Pläne und Hoffnungen waren zunichte.
»Wie geht es Ihnen, Fräulein Maritz?« Aus Herrn von Fabers Worten sprach ehrliche Sorge, und sein fülliges Gesicht verzog sich zu einem Lächeln, als er Isabel entgegenging. In leichten Wellen legten sich seine dunkelblonden, am Ansatz schweißfeuchten Haare um seine Stirn.
»Viel besser, Herr von Faber.« Isabel unterdrückte ein Grinsen, als sie sah, dass unter der silbergrauen Weste ein Zipfel seines Hemdes hervorlugte, der offenbar seiner Aufmerksamkeit entgangen war.
»Das freut mich sehr. Und … Sie sehen wirklich bezaubernd aus, wenn Sie mir das Kompliment erlauben.«
»Danke«, murmelte sie, während ihr die Hitze ins Gesicht schoss. Auch wenn sie sicher war, dass er nur höflich sein wollte.
Sie hatte die Haare zu einem festen Knoten zusammengefasst und ihr vornehmstes Kleid in hellem Veilchenblau angezogen, das mit weißen Passen abgesetzt war, dennoch kam sie sich entsetzlich plump und ungelenk vor. Ihren linken Ärmel hatte sie mit einem schwarzen Band versehen, um ihre Trauer auszudrücken, denn dunkle oder gar schwarze Kleidung trug man in den Tropen nicht. Henriette sah dagegen elegant wie immer aus, in einen Traum aus hellgelber Seide gehüllt, dessen Rock über dem Gesäß mit einer Tournüre aufgebauscht war, die ihre schmale Taille höchst vorteilhaft betonte. Ihr blondes Haar fiel in weichen Ringellöckchen in ihre Stirn und war im Nacken zu einem kunstvollen Chignon gebunden. Sie wirkte vollkommen beherrscht. Nichts deutete auf ihre vorhin im erregten Flüsterton geführte Unterhaltung hin. Mit wem sie wohl geredet hatte? Oder hatte Isabel sich das alles doch nur eingebildet?
»Etwas zu trinken?« Einhändig goss von Faber Gin ein, wobei er ein wenig verschüttete, und reichte ihr dann das Glas. Isabel bemühte sich, nicht auf die Stelle zu sehen, wo seine linke Hand gewesen wäre.
»Danke.« Sie nahm das Glas. »Ich … Vielen Dank, Herr von Faber, dass Sie mich hier aufgenommen haben während meiner … Unpässlichkeit. Das war ausgesprochen freundlich von Ihnen.«
»Oh, aber ich bitte Sie! Ich freue mich, dass wir helfen konnten. Und bitte, bleiben Sie, so lange Sie möchten. Es tut gut, ein junges, frisches Gesicht hier zu sehen. Henriette, so ist es doch?«
Isabel warf einen schnellen Seitenblick auf seine Schwester. Irrte sie sich, oder glitt für einen Moment ein säuerlicher Ausdruck über die sonst so gefasste Miene?
»Berthold hat recht«, sagte Henriette. »Sie sind hier herzlich willkommen. Aber setzen Sie sich doch.«
Das Essen war eine eher steife Angelegenheit. Kiso trug die Speisen auf. In einer großen Schüssel schwamm eine undefinierbare Masse von Fleischbrocken in einer braunen Sauce – Schildkrötenragout, wie Herr von Faber erklärte. Dazu wurden Rettichsalat und Kartoffelbrei aus Süßkartoffeln gereicht. Es schmeckte nicht schlecht, wenn auch ungewohnt. Ihr Gastgeber griff beherzt zu, seine Schwester begnügte sich mit wenigen Happen. Isabel zwang sich ebenfalls zur Zurückhaltung, obwohl ihre Übelkeit vergangen und sie hungrig war.
»Zu Hause schmeckt es doch am besten«, erklärte von Faber, während er sich zum zweiten Mal aus der Schüssel bediente. »Die meisten der Kompagnie-Angestellten essen allerdings kostenfrei in der Speiseanstalt. Leider zeichnet sich das dortige Essen durch kulinarische Eintönigkeit aus. Es gibt kaum etwas anderes als süße Kartoffeln und Dosenfleisch, und das ist auch noch von schlechter Qualität.« Er schüttelte den Kopf und verzog das Gesicht. »Ich habe es einmal probiert – nicht zu empfehlen. Auf dem Teller zerfällt es in eine trockene Masse zäher Fäden und schmeckt wie ein Stück altes Schiffstau, das man in Stearin gekocht hat. Auf der Speisekarte heißt das dann ›Kabelgarn‹.«
Isabel lächelte. Herr von Faber war ein netter Mann und gab sich sichtlich Mühe, damit sie sich wohl fühlte. Tatsächlich entspannte sie sich allmählich ein wenig.
Der Mückenstich auf ihrem Handrücken juckte. Sie legte das Besteck zur Seite und kratzte sich unauffällig. Dennoch entging ihr nicht der flüchtige Blick von Henriette, die in vollendeter Anmut neben ihr saß.
»So, liebe Isabel«, sagte sie, kaum dass sie sich den Mund abgetupft hatte, »nun müssen Sie uns aber ein bisschen von sich erzählen. Ich brenne vor Neugier! Wie kommt eine junge Frau wie Sie dazu, nach Kaiser-Wilhelms-Land zu reisen, um hier einen Missionar zu heiraten?«
»Henriette, ich glaube nicht, dass Fräulein Maritz …«
»Nein, nein«, beeilte sich Isabel zu sagen, obwohl sich etwas in ihr sträubte. »Sie haben mich hier so gastfreundlich aufgenommen, da ist es Ihr gutes Recht, etwas über mich zu erfahren.«
Berthold von Faber lächelte sie verlegen an; sie konnte ihm ansehen, dass auch er Antworten wollte. »Was Ihrem Verlobten zugestoßen ist, tut mir sehr leid.«
»Danke, das ist sehr liebenswürdig. Kannten Sie ihn denn?«
»Ja, wenn auch nur flüchtig. Wir Deutschen sind hier alle mehr oder weniger miteinander bekannt. Er war ein netter junger Mann.«
»Nun ja, vielleicht ein wenig zu still für meinen Geschmack«, wandte Henriette ein. »Vermutlich hätten Sie gut zu ihm gepasst – Sie scheinen mir auch so eine Stille zu sein.« War das etwa ein Vorwurf? »Wo haben Sie sich kennengelernt?«
Isabel schoss erneut das Blut in die Wangen. Herrje, würde sie diese Schüchternheit wohl jemals ablegen?
»Wir … wir kannten uns nicht richtig. Nicht persönlich. Nur über Briefe.«
Stockend begann sie zu erzählen. Von ihrer Kindheit als jüngstes von fünf Kindern des Pastors von Zirndorf. Wie der Vater ihr eines Tages erzählt hatte, dass die Missionare aus dem nahe gelegenen Neuendettelsau heiratswillige Frauen suchten, die bereit seien, ihren Männern in die junge Kolonie von Kaiser-Wilhelms-Land zu folgen. Und wie sie schließlich den ersten Brief eines gewissen Conrad Felby aus Simbang erhalten hatte, dem sie sofort zugetan war. Sie schrieben sich öfter, bis Isabel schließlich einwilligte, seine Frau zu werden.
»Eine sehr mutige Entscheidung.« Herr von Faber nickte anerkennend und fuhr sich mit einem Taschentuch über das schweißglänzende Gesicht. »Ich bewundere Sie dafür.«
Daran ist nichts Bewundernswertes, dachte Isabel und konnte sich gerade noch zurückhalten, den Kopf zu schütteln. Sie war schlichtweg geflüchtet aus der Heimat, die ihr in letzter Zeit wie ein Gefängnis erschienen war.
»Aber wieso haben Sie sich überhaupt darauf eingelassen?«, fragte Henriette. »In Deutschland gab es doch sicher genug fesche Mannsbilder, die Sie heiraten wollten?«
In der plötzlichen Stille war der Regen, der auf das Dach trommelte, überlaut zu hören.
Isabel schluckte. »Nein«, sagte sie leise. »Niemanden.«
Das stimmte nicht ganz. Den einen oder anderen hatte es schon gegeben. Aber keiner von ihnen wollte eine Frau mit ihrem Makel heiraten. Sie zögerte, dann gab sie sich einen Ruck und erzählte weiter. Sie fasste sich kurz, ging nur flüchtig ein auf die vielen Wochen, die sie im Bett hatte verbringen müssen, als sie als Achtjährige an Kinderlähmung erkrankt war, und die langen Jahre, die sie Schienen an den Beinen hatte tragen müssen, um ihre geschwächten Gliedmaßen wieder zu stärken. Sie hatte wieder richtig laufen gelernt, aber ihr rechtes Bein blieb ein wenig verkürzt und schwächer.
»Tatsächlich?« Herr von Faber sah sie erstaunt an. »Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen.«
»Das ist … sehr freundlich von Ihnen«, erwiderte Isabel. Sie glaubte ihm kein Wort. Jeder mit Augen im Kopf musste es doch sofort bemerken.
»Bei mir liegt die Sache natürlich etwas anders. Eine fehlende Hand lässt sich weniger gut verbergen.« Er hob den Armstumpf und offenbarte dabei einen frischen Soßenfleck auf seiner Weste. »Wollen Sie wissen, wie ich sie verloren habe? Es war in Deutsch-Südwest.«
Isabel war überaus dankbar, dass er mit seiner Geschichte von ihr ablenkte. »Haben Sie etwa mit einem Löwen gekämpft?«
Er lachte. »Nein, aber vielleicht sollte ich allmählich eine entsprechende Geschichte erfinden. Jeder erwartet, dass es ein Löwe war, der mich angefallen hat und dem ich heldenhaft gegenübergetreten bin. Zu meiner Schande muss ich jedoch gestehen, dass es kein wildes Tier war, sondern eine lächerliche kleine Wunde, die ich mir beim Zeltaufbau zugezogen hatte. Nun, ich will Sie nicht mit der ganzen gruseligen Geschichte erschrecken. Am Ende mussten sie mir jedenfalls den halben Arm abnehmen, und ich schied aus dem Dienst als Kolonialoffizier aus.« Er nahm einen tiefen Schluck aus seinem Glas. »Wenig später bin ich bei der Neuguinea-Kompagnie gelandet. Mein Schwager und meine liebe Schwester wollten mich begleiten, und hier sind wir nun.«
Herr von Fabers Schwager? Das hieß also, Henriettes Mann? Was war mit ihm? War er womöglich ebenfalls verstorben? Isabel überlegte, ob es angebracht war nachzufragen, als Henriette ihr zuvorkam.
»Mein Mann«, sagte sie mit ausgewählter Betonung, »befindet sich schon seit längerer Zeit auf einer Forschungsreise. Kiso«, wandte sie sich dann an die schwarze Frau, die wie ein Schatten im Hintergrund gewartet hatte, »du kannst jetzt das Dessert auftragen.«
Kiso hob den Kopf, machte aber keine Anstalten, den Raum zu verlassen. »Mi no save, misis.«
Henriette verdrehte die Augen, dann sagte sie langsam: »Bringim switpela kaikai. – Sie wollen unsere schöne deutsche Sprache einfach nicht verstehen«, erklärte sie kopfschüttelnd, als Kiso verschwunden war.
»In welcher Sprache sprechen Sie mit ihnen?«
»Es nennt sich Tok Pisin, ein grässlicher Plantagen-Jargon, der sich wie ein Lauffeuer fortpflanzt. Ein Kauderwelsch aus Englisch, Deutsch und ihren Eingeborenensprachen.«
Isabel nickte interessiert. »Wie bedankt man sich?«, erkundigte sie sich, und Henriette erläuterte es ihr.
Als Kiso kurz darauf zurückkam und kleine Schüsseln mit Ananaskompott verteilte, blickte Isabel sie an. »Tenkyu«, sagte sie und glaubte, in Kisos schwarzen Augen Freude aufblitzen zu sehen, bevor diese wieder die Lider senkte.
»Wenn Sie möchten«, wandte Henriette sich an Isabel, »kann ich Ihnen eine kleine Liste mit den wichtigsten Wörtern und Regeln geben, die ich vor Jahren von einem der Herren Missionare erhalten habe. Die Sprache ist von äußerst einfacher Struktur und sehr leicht zu lernen. Zumindest so weit, dass sie einen verstehen.«
»Ich glaube kaum«, mischte sich ihr Bruder ein, »dass es Fräulein Maritz interessiert –«
»Oh, doch«, widersprach Isabel. »Das würde es. Ich bin … ich war … nämlich Lehrerin. In Deutschland.«
»Tatsächlich?« Henriette betrachtete sie prüfend. »Nun, hier leben hauptsächlich alleinstehende Männer und nur sehr wenige deutsche Familien – nur für den Fall, dass Sie sich zum Bleiben entschließen. Hier gibt es leider so gut wie keine weißen Kinder. Nur ein paar Mischlingskinder und natürlich die der Eingeborenen. Aber die wollen Sie sicher nicht unterrichten.«
»Wer weiß?« Isabel fühlte sich plötzlich herausgefordert. »Ich hatte gehofft, nach … nach …«, sie schluckte, dann fasste sie sich und sprach weiter, »nach meiner Heirat als Lehrerin weiterarbeiten zu dürfen. Schließlich sind wir hier nicht in Deutschland.« Dort hätte sie nach ihrer Eheschließung ihren Beruf aufgeben müssen, denn Lehrerinnen mussten ledig sein. »Auch Conrad schrieb, hier würden Lehrkräfte gebraucht.«
Henriette sah sie einen Augenblick regungslos an. »Nun, wie auch immer. Sie müssen jetzt erst einmal überlegen, wie es mit Ihnen weitergeht. Ob Sie überhaupt hierbleiben oder wieder zurück nach Deutschland reisen wollen. Nicht wahr, meine Liebe?«
Als Isabel nickte, fing sie Herrn von Fabers Blick auf, dessen Ausdruck sie für einen Moment an ein verträumtes Schaf erinnerte.
*
Isabel sah das Meer zwar nicht, aber sie konnte es hören; ein ständiges leises Rauschen, einem gleichmäßigen Atmen vergleichbar, das sie nun schon seit vier Tagen begleitete. Aus dem geöffneten Fenster, vor dem ein leichter Gazevorhang hing, wehte der schwere, tropische Geruch fremder Blüten hinein. Die ausgefransten Blätter eines Kasuarinenbaums streiften mit leisem Rascheln am Rahmen entlang, von irgendwoher erklang das Zetern einiger streitender Kakadus.
Isabel saß vor der Ankleidekommode im Gästezimmer und schloss für einen Moment die Augen. Sie fühlte sich nicht gut. Ihr war erneut leicht schwindelig und übel, woran das Chinin schuld war. Vor ihr stand das Glas, das sie vor wenigen Minuten geleert hatte. Eine feine weiße Spur zog sich vom Glasboden bis zu seinem Rand, wo sich die Chininreste abgesetzt hatten.
Noch immer wusste sie nicht, was sie tun sollte. Aber sie musste eine Entscheidung treffen. Und die hieß: hierbleiben oder abreisen. Abreisen wäre natürlich die einfachste Möglichkeit – einmal ganz davon abgesehen, dass sie über so gut wie keine finanziellen Mittel verfügte. Die Reise hierher hatte die Neuendettelsauer Mission bezahlt – ob sie auch für die Rückreise aufkommen würde? Aber möglicherweise könnte Herr von Faber ihr das nötige Geld vorstrecken. Irgendwie würde sie es schon schaffen, es ihm zurückzuzahlen. Noch hatte sie Zeit: Das nächste Schiff nach Soerabaya, von wo aus sie dann einen Reichspostdampfer zurück nach Deutschland nehmen könnte, ging erst in fünf Wochen.
Aber wollte sie das überhaupt? Wollte sie zurück nach Deutschland – und damit ihr Scheitern eingestehen? Bei ihrer Abreise hatte sie gehofft, ihr altes Leben hinter sich lassen und hier, am anderen Ende der Welt, neu anfangen zu können. Mit einem freundlichen Ehemann, der auf ihren Charakter sah und nicht auf ihr schwaches Bein. Nachdem sie es endlich gewagt hatte, Conrad davon zu schreiben, hatte sie die Wochen bis zu seinem nächsten Brief in ständig wachsender Nervosität verbracht. Als dann seine Antwort gekommen war, hatte sie vor Freude geweint: Er sehe nicht ihren vermeintlich makelhaften Körper, hatte er geschrieben, sondern ihr Herz, und das sei wunderschön. Außerdem habe ja auch der hochwohlgeborene Kaiser einen verkürzten Arm, sie befinde sich also in bester Gesellschaft. Und dann hatte er sie gefragt, ob sie ihn heiraten wolle.
Und nun war dieser wunderbare Mensch tot. Sie blinzelte die aufsteigenden Tränen fort – sie hatte genug geweint in den vergangenen Tagen. Erneut griff sie nach den wenigen Seiten Papier vor sich, die Henriette ihr gegeben hatte. Handschriftlich waren dort eine Reihe der wichtigsten Ausdrücke der hiesigen Pidgin-Sprache aufgelistet. Henriette hatte recht gehabt; die meisten Worte kamen aus dem Englischen oder Deutschen und waren leicht zu lernen, wenn man sich erst einmal an die eigenwillige Schreibweise gewöhnt hatte.
Moning, las Isabel halblaut. Guten Morgen. Apinun – guten Nachmittag. Gutbai – auf Wiedersehen. Hauskuk – Küche. Kaikai – Essen.
In ihrem Mund war noch immer ein bitterer, ekliger Nachgeschmack. Im Nebenzimmer sang Kiso leise vor sich hin. Ob sie die Gelegenheit nutzen sollte, ihr neu erworbenes Wissen anzuwenden?
Sie räusperte sich, um ihre Stimme klar zu bekommen, dann rief sie: »Kiso?«
Sie hörte Schritte, und dann stand die schwarze Frau auch schon vor ihr. »Misis?«
Isabel nahm all ihren Mut zusammen. »Kiso, mi laikim … sampela wara?«, sagte sie stockend. Könnte ich etwas Wasser haben?
Kisos dunkles Gesicht verzog sich vor Freude. »Yu save long tok pisin, a?«
»Nein, nein«, wehrte Isabel ab. »Ich … ich lerne noch. Ich spreche nicht. Mi … mi no save long … tok pisin.«
Kiso schüttelte den Kopf. »Wara? Mi bringim mobeta.« Damit verschwand sie.
Isabel sah ihr nach. Mobeta? Hatte sie richtig verstanden? Wollte Kiso etwas Besseres bringen? Offenbar war es so, denn als die Frau nach wenigen Minuten zurückkam, trug sie ein Glas mit einer trüben Flüssigkeit.
»Wara bilong kokonas«, erklärte sie und reichte Isabel das Glas. Wasser von der Kokosnuss.
Das süße Getränk schmeckte herrlich und vertrieb tatsächlich den bitteren Geschmack, den die Medizin auf ihrer Zunge hinterlassen hatte.
Als sie die tiefrote Hibiskusblüte in Kisos Hand sah, wollte sie erst abwehren, ließ es dann aber doch zu, dass die schwarze Frau sie ihr hinter das Ohr steckte. Im Spiegel konnte sie sehen, dass die leuchtend rote Blüte wie ein riesiger Blutstropfen in ihrem braunen Haar erschien.
Kiso trat einen Schritt zurück und betrachtete ihr Werk.
»Naispela misis«, sagte sie zufrieden. Hübsche Herrin.
*
Finschhafen war mehr eine Ansammlung einfacher Hütten und Häuser als ein wirklicher Ort. Vor fünf Jahren gegründet, machte es auf Isabel den Eindruck, als stünden noch immer die unausgepackten Überseekisten herum. Hier wohnte der Großteil der deutschen Bevölkerung, zumeist Beamte und Kaufleute. Die meisten der ausnahmslos einstöckigen Häuser standen zum Schutz vor Überschwemmungen auf hohen, schlanken Pfählen und waren aus vorgefertigten, aus Deutschland importierten Holzelementen erbaut. Fast alle trugen sie ein Dach aus Wellblech – der geringeren Einsturzgefahr wegen, wie sie von Herrn von Faber an diesem Morgen erfahren hatte. Zuweilen wackele die Erde hier ein wenig, aber bis auf etwas zersprungenes Geschirr habe es noch keine größeren Schäden gegeben.
Nach dem Frühstück an diesem Sonntag hatte ihr Gastgeber sein Versprechen eingelöst. Zu dieser frühen Stunde, bevor der heiße Mittagsdunst aufsteige und solange die Tropengewitter noch fern seien, sei die beste Zeit für einen Spaziergang für ihn und die beiden Damen, hatte Herr von Faber befunden. Kaum waren sie jedoch auf die Straße getreten, war ihnen Hans von Kosse begegnet, der nach einer kurzen Begrüßung sofort das Gespräch an sich gerissen und seitdem nicht mehr zu reden aufgehört hatte.
»Und Sie sind also Leiter der Versuchsplantage? Das ist sicher eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe«, sagte Isabel höflich, als er eine kurze Pause machte. Sie raffte ihren langen Rock, um einer der vielen Pfützen auf dem schlammigen Weg auszuweichen. Herr von Kosse reichte ihr hilfreich den Arm.
»Ach was«, erklärte er grinsend. »Man hat mich lediglich dazu gemacht, weil ich bei meiner Ankunft hier ein Buch im Gepäck hatte, das sich hochtrabend Tropische Agrikultur nannte. Und da sie keinen Besseren fanden, stellten sie eben mich ein.«
Isabel sah ihn fragend an, unsicher, ob er sie auf den Arm nehmen wollte.
Der junge Mann strahlte sie unter seinem Schnurrbart an. »Ich schwöre, das ist die Wahrheit. Dabei will in diesem Malarialoch außer Radieschen so gut wie nichts wachsen. Oder ich mache etwas falsch, was aufs Selbe hinausläuft. Nun ja, immerhin nimmt die Speiseanstalt mir die Dinger ab. Mögen Sie Radieschen?«
Sie bejahte und wollte noch mehr erwidern, als sie sah, dass ihnen drei Frauen entgegenkamen – keine Papua, wie Isabel an der milchkaffeebraunen Hautfarbe und den ebenmäßigen Gesichtern erkannte. Sie trugen nichts weiter als ein paar fransige Blätterröcke, die knapp unter ihren Knien endeten, die lockigen schwarzen Haare hatten sie mit bunten Blüten geschmückt. Ihre schlanken Körper mit den bloßen Brüsten bewegten sich mit lässiger Selbstverständlichkeit. Sie wirkten so … natürlich. Ganz anders als Isabel und ihre Begleiter in ihren weißen Kleidern und Anzügen.
»Ah, drei Damen aus Samoa«, bemerkte Herr von Kosse, während er flüchtig seinen Strohhut lüftete. »Sie wissen sicher, Fräulein Maritz, dass Samoa Verbindungen zu Deutschland hat?«
Isabel nickte. Seit dem vergangenen Jahr wurde das Königreich Samoa gemeinsam von Deutschland, den USA und Großbritannien verwaltet. Außerdem war Samoa fast jedem Deutschen durch das Hamburger Handelshaus Godeffroy, das seit Jahrzehnten den Südseemarkt beherrschte, ein Begriff.
»An diesen Anblick müssen Sie sich auch gewöhnen«, raunte Henriette ihr zu, die wirkte, als könne keine Hitze dieser Welt ihr etwas anhaben. Kein einziger Schweißtropfen verunstaltete ihren makellosen Teint. Sie verzog voller Verachtung den hübschen Mund. »Diese Frauen haben weder Anstand noch Moral. In dieser Aufmachung hier herumzustolzieren – einfach schamlos!«
Die beiden Herren schienen diese Meinung nicht ganz zu teilen – jedenfalls bemerkte Isabel, dass Herr von Kosse recht unverhohlen und Herr von Faber zumindest flüchtig große Augen machte.
Als die Frauen vorüber waren, schien sich von Kosse wieder auf Isabel zu besinnen. »Kennen Sie denn schon unsere Speiseanstalt?«
»Ja«, erwiderte sie etwas einsilbig. »Herr von Faber hat mir bereits davon erzählt.«
Sie versuchte, sich mit der Hand unauffällig Luft zuzufächeln. Eine Dame schwitzt nicht, war ihr von ihrer Mutter eingebläut worden. Aber ihre Mutter war noch nie in den Tropen gewesen. Nach dem gestrigen Regen war der Himmel noch immer bedeckt, und obwohl es noch lange nicht Mittag war, lag eine erdrückende Schwüle über dem Ort, während sie langsam an den einfachen Häusern im Kolonialstil mit ihren tiefgezogenen Wellblechdächern vorbeiflanierten. Normalerweise wäre jetzt Gottesdienstzeit. Aber Finschhafen hatte noch keine eigene Kirche; das einzige Gotteshaus stand in der Missionsstation von Simbang.
»Sie müssen unbedingt einmal in der Speiseanstalt vorbeikommen«, fuhr von Kosse fort und strich sich über seinen blonden Schnauzer. »Hat der gute von Faber Ihnen auch erzählt, dass wir dort einen Trinkclub gegründet haben? Wir haben ihn ›Zum blutigen Knochen‹ getauft.«
»Wie originell«, gelang es Isabel einzuwerfen.
»Nicht wahr? Kommt von der Flagge der Neuguinea-Kompagnie. Haben Sie sich das rätselhafte Wappentier darauf schon einmal näher angesehen? Angeblich soll es ja einen schwarzen Löwen mit einer roten Fackel darstellen, aber für die meisten sieht es aus wie ein Hund, der einen blutigen Knochen trägt. Daher auch der Name des Clubs, der natürlich nur Angehörigen der ersten Klasse offensteht.«
»Sie haben verschiedene Klassen in der Speiseanstalt?«
»So ist es, das muss alles seine deutsche Ordnung haben. Unser Club ist sehr beliebt. Dort sitzt die Elite der hiesigen Kolonialbeamten, trinkt sauren Wein und spielt Karten. Was soll man hier auch anderes machen? Für drei Jahre sind die meisten hier verpflichtet, und es gibt kaum weiße Frauen. Sie beide«, sagte er mit einer leichten Verbeugung in Isabels und Henriettes Richtung, »bilden da eine löbliche Ausnahme. Und irgendwie muss man die Zeit ja –«
»O mein Gott!« Isabel schreckte zurück, als sie mitten im Schlamm der Straße einen großen roten Fleck sah, und griff hilfesuchend nach dem nächstbesten Arm. Er gehörte Herrn von Faber. »Ist das etwa Blut?«
»Keine Sorge, Fräulein Maritz«, beruhigte dieser sie. »Das ist nur der Saft der Betelnuss. Die Einheimischen kauen sie und spucken sie oft auf höchst widerwärtige Weise auf den Weg.«
Sie atmete erleichtert auf. Durch den Ärmel seines Tropenanzugs hindurch spürte sie die feuchte Wärme seiner Haut und löste ihre Hand wieder von ihm.
»Schauen Sie«, sagte er und blieb vor einem schlichten hölzernen Gebäude stehen, an dem ein Schild mit dem Reichsadler und der Aufschrift »Kaiserlich Deutsche Postagentur« prangte. »Finschhafen hat zwar noch nicht viel vorzuweisen, aber immerhin haben wir eine Poststation. An diesem Stationsgebäude wurde der erste Briefkasten von Kaiser-Wilhelms-Land aufgestellt. Und seit drei Jahren sind wir dem Weltpostverein angegliedert.«
Isabel erinnerte sich. Von hier aus hatte auch Conrad seine Briefe an sie versandt.
»Das dort«, fuhr von Faber fort und deutete mit dem Kopf zu einer Gruppe asiatisch aussehender Arbeiter, die im Schatten einiger Palmen offenbar ihren freien Tag verbrachten und von denen jeder einen langen schwarzen Zopf trug, »sind übrigens Kulis, Fräulein Maritz. Chinesische Tagelöhner.«
»Die einheimischen Kanaker sind nämlich nur schwer zum Arbeiten zu bewegen«, mischte sich Herr von Kosse erneut ein. Isabel sah, wie Berthold von Faber die Augen verdrehte. »Und so hat die deutsche Reichsregierung in ihrer unerschöpflichen Weisheit entschieden, Arbeiter aus China zu importieren und auf den Feldern arbeiten zu lassen. Das Problem ist nur: Sie sterben so schnell. Diese chinesischen Kulis sind von einer geradezu hysterischen Feinfühligkeit. Die kleinste Kleinigkeit, die geringste Provokation verschnupft sie, und schon bringen sie sich um.«
»Wie bitte? Sie scherzen, Herr von Kosse.«
»Aber mitnichten. So ein Chinese legt nicht viel Wert auf sein Leben. Wenn ihm das Essen nicht schmeckt, hängt er sich auf. Wenn ihm das Opium entzogen wird, stößt er sich ein Messer in den Leib. Wenn es regnet, bringt er sich um.«
»Aber das ist ja fürchterlich!«
Berthold von Faber zog ein Taschentuch hervor und tupfte sich über das Gesicht. »Nehmen Sie den jungen Mann nicht zu ernst, Fräulein Maritz. Sicher gab es hier und da ein bedauerliches Ereignis, aber das waren Einzelfälle.«
Isabel schenkte ihm ein zerstreutes Lächeln. Allmählich wurde ihr das alles zu viel, und sie wünschte sich sehnlichst, jetzt alleine zu sein.