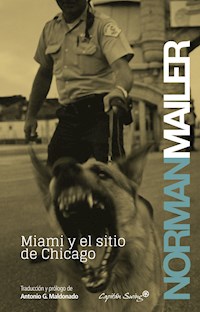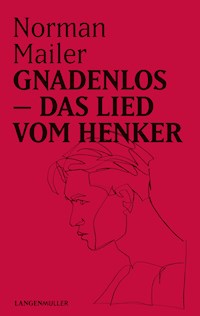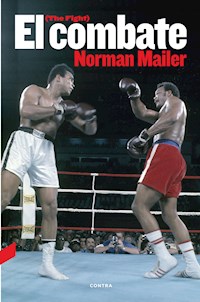15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Langen-Müller
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Auf der Suche nach der Quelle des Bösen: 1938 erhält ein hochrangiger SS-Offizier einen Geheimauftrag, der das Schicksal des Dritten Reiches entscheiden kann. Er soll einen alten Brief widerlegen, in dem scheinbar nachgewiesen wird, dass Adolf Hitler jüdischer Abstammung ist. Ausgehend von Hitlers Kindheit im Waldviertel entdeckt der Agent ein teuflisches Geflecht aus inzestuösen Verhältnissen, Obsessionen, dumpfer Gewalt und Angst. In seinem viel diskutierten Roman entwickelt Mailer ein furioses Szenario mit dem Ziel, das Wesen Adolf Hitlers zu entschlüsseln.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 633
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Das Schloss im Wald ist ein Roman auf historischer Grundlage. Einige Namen und Ereignisse entstammen der Fantasie des Autors, oder sie werden fiktiv eingesetzt. In diesen Fällen ist jede Ähnlichkeit mit aktuellen Begebenheiten, Orten oder Personen, ob lebend oder tot, rein zufällig.
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2007 unter dem Titel »The Castle in the Forest« bei Random House, Inc., New York.
© für die Originalausgabe und das eBook: 2007, 2018 LangenMüller in der F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten.
THE CASTLE IN THE FOREST
Copyright 2007, Norman Mailer
All rights reserved
Besuchen Sie uns im Internet unter
www.langen-mueller-verlag.de
Umschlaggestaltung: STUDIO LZ, Stuttgart
Übersetzung: Alfred Starkmann
Umschlagmotiv: Inès Longevial
eBook-Produktion: VerlagsService Dietmar Schmitz GmbH, Heimstetten
ISBN 978-3-7844-3450-6
Inhalt
Buch I
Die Suche nach Hitlers Großvater
Buch II
Adolfs Vater
Buch III
Adolfs Mutter
Buch IV
Der Geheimdienstoffizier
Buch V
Die Familie
Buch VI
Der Bauernhof
Buch VII
Der Alte und die Bienen
Buch VIII
Die Krönung von Nikolaus II.
Buch IX
Alois junior
Buch X
Ehrfurcht und Furcht
Buch XI
Der Abt und der Hufschmied
Buch XII
Edmund, Alois und Adolf
Buch XIII
Alois und Adolf
Buch XIV
Adolf und Klara
Epilog
Danksagung
Für meine Enkelkinder Valentina Colodro, Alejandro Colodro, Antonia Colodro, Isabelle Moschen, Christina Marie Nastasi, Callan Mailer, Theodore Mailer, Natasha Lancaster, Mattie James Mailer, Cyrus Force Mailer und für meine Großnichte Eden River Alson wie auch für meine Patenkinder Dominique Malaquais, Kittredge Fisher, Clay Fisher, Sebastian Rosthal und Julian Rosthal
Buch I
Die Suche nach Hitlers Großvater
1
Nennen Sie mich einfach D.T., wobei D. für Dieter steht. Das wird zu Ihrem Verständnis hinreichen, nachdem ich jetzt in Amerika lebe, dieser kuriosen Nation. Wenn ich mittlerweile an den Reserven meiner Geduld zehre, so deshalb, weil die Zeit hier sinnlos für mich verstreicht, und das ist ein Zustand, in dem man zur Rebellion neigt. Kann das der Grund sein, warum ich jetzt ein Buch schreibe? Meine Kameraden und ich mussten früher für alle Zukunft absolute Geheimhaltung schwören, denn wir waren Mitglieder einer unvergleichlichen Geheimdienst-Gruppe. Ihre Klassifizierung war SS, Sonderabteilung IV-2a, und wir unterstanden direkt der Aufsicht von Heinrich Himmler. Heute gilt der Mann als Monstrum, und ich würde das nicht abstreiten – er stellte sich in der Tat als ein wahrhaft höllisches Monstrum heraus. Trotzdem, Himmler hatte einen originellen Verstand, und eine seiner Thesen führt mich zu meinen literarischen Intentionen, die – seien Sie versichert – keine Routine sind.
2
Der Raum, den Himmler benutzte, wenn er zu unserer Elitegruppe sprach, war ein kleiner Vorlesungssaal mit dunklen Walnusspaneelen und nur zwanzig Sitzen, die in vier Reihen zu je fünf hochstiegen. Solche Einzelheiten sind jedoch nebensächlich, ich werde mich im Folgenden vielmehr mit Himmlers unorthodoxen Ideen beschäftigen. Sie haben mich wahrscheinlich überhaupt bewogen, dieses brisante Memoir niederzuschreiben. Ich weiß, dass ich dadurch in ein Meer der Turbulenzen geraten werde, denn ich muss radikal mit vielen konventionellen Vorstellungen aufräumen. Bei dem Gedanken hämmerte es in meinem Kopf – es war ein deutlicher Missklang. Als Geheimdienstoffiziere versuchen wir oft unsere Befunde zu verschleiern, denn die Verlogenheit gehört zu unseren Künsten, aber bei meinem Unterfangen verbieten sich solche Tricks.
Genug! Lassen Sie mich Ihnen Heinrich Himmler vorstellen. Sie als Leser müssen sich auf eine schwierige Begegnung einstellen. Dieser Mann, dessen Spitzname hinter seinem Rücken Heini lautete, war 1938 einer der vier wirklich wichtigen Anführer in Deutschland. Doch seine liebste und geheimste Beschäftigung war das Studium des Inzests. Die Blutschande dominierte unsere Forschungen auf höchster Ebene, und unsere Befunde verblieben in geschlossenen Akten. Inzest, erläuterte Heini, gab es schon immer bei den Armen aller Nationen. Sogar unsere eigene Bauernschaft sei arg davon betroffen gewesen, sogar noch im neunzehnten Jahrhundert. »Normalerweise will in den gelehrten Kreisen niemand darüber reden«, bemerkte er. »Schließlich kann man nichts dagegen tun. Wer macht sich schon die Mühe, irgendeinen elenden Wicht als das gesicherte Ergebnis eines Inzests zu identifizieren? Nein, die Führung jeder zivilisierten Nation kehrt solchen Kram lieber unter den Teppich.«
Das trifft auf alle höheren Regierungsvertreter der Welt zu außer auf unseren Heinrich Himmler. Hinter seiner seltsamen Brille brodelten die abartigsten Ideen. Ich muss wiederholen, dass er für einen Mann mit glatter und kinnloser Visage eine frustrierende Mischung aus Brillanz und Dummheit an den Tag legte. Er bezeichnete sich zum Beispiel als einen Heiden. Er prophezeite, dass die Menschheit einer blühenden Zukunft entgegengehe, sobald das Heidentum die Welt übernommen habe. Dann wären der menschlichen Seele keine Ausschweifungen mehr untersagt. Niemand von uns konnte sich allerdings eine Orgie der Fleischeslust vorstellen, bei der eine Frau bereit wäre, sich im Rausch Heinrich Himmler hinzugeben. Nein, selbst im innovativsten Sinn nicht! Denn man konnte immer noch sein Gesicht sehen, wie es früher bei einem Tanzabend in der Schule gewirkt haben musste, dieses bebrillte, missbilligende Beobachten des Milchgesichts, ein Jüngling, aufgeschossen, dünn, voller physischer Unzulänglichkeit. Er hatte bereits einen kleinen Bauch. Da stand er, an der Wand wartend, während die Tänzer sich vor ihm drehten.
Im Laufe der Jahre wurde er von Dingen besessen, die andere nicht einmal laut zu erwähnen wagten (was ja gewöhnlich der erste Schritt zu neuem Denken ist). Sein ganzes Interesse konzentrierte sich auf Geisteskrankheiten. Himmler bejahte die Theorie, dass die besten menschlichen Fähigkeiten eng neben den schlechtesten liegen. Also nahm er an, dass vielversprechende Kinder in unbedeutenden Familien aus einem inzestuösen Verhältnis stammten, dass sie Inzestuarier waren. Er mochte nicht den gebräuchlicheren Ausdruck Blutschande oder Blutdrama, den man in vornehmen Kreisen benutzte.
Niemand von uns hielt sich für genügend qualifiziert, um seine Theorien als abwegig zu bezeichnen. Schon in den frühen Jahren der SS hatte Himmler erkannt, dass wir unbedingt hoch spezialisierte Forschungsgruppen einrichten mussten. Wir hatten die Pflicht, nach dem Ultimativen zu suchen. Wie Himmler es ausdrückte, hing das Gedeihen des Nationalsozialismus von nichts weniger als den letzten Fragen ab. Wir hatten Probleme zu erkunden, an die andere Nationen sich nicht heranwagten. Inzest stand ganz oben auf seiner Liste. Der deutsche Geist musste sich in der gelehrten Welt wieder als die führende Inspiration etablieren. Als Gegenleistung – so lautete seine unausgesprochene Folgerung – würde Heinrich Himmler möglicherweise weltweite Anerkennung für seinen profunden Zugriff auf Probleme ernten, die aus dem landwirtschaftlichen Milieu stammten. Er pflegte den gravierenden Punkt zu betonen: Man kann schlecht die Landwirtschaft erforschen, ohne den Bauern zu begreifen. Um jedoch den Mann des Bodens zu verstehen, muss man von Inzest reden.
An dieser Stelle, versichere ich Ihnen, erhob er immer seine Hand zu exakt derselben kleinen Geste, die Hitler oft benutzte – einem gezierten kleinen Ruck mit dem rechten Handgelenk. Das war Heinrichs Art zu sagen: »Jetzt kommt das Fleisch. Und dann die Kartoffeln!« Weiter floss seine Rede. »Ja«, sagte er, »Inzest! Das ist ein triftiger Grund, warum alte Bauern fromm sind. Die akute Angst von Sündern äußert sich zwangsläufig in einem von zwei Extremen: absolute Hingabe an religiöse Riten oder Nihilismus. Ich kann mich aus meiner Studentenzeit daran erinnern, dass der Marxist Friedrich Engels einmal geschrieben hat: ›Als die katholische Kirche erkannte, dass es unmöglich sei, den Ehebruch zu verhindern, machte sie die Scheidung unmöglich.‹ Eine brillante Anordnung, wenn auch von der falschen Instanz. Ähnlich verhält es sich mit der Blutschande. Die kann man ebenso wenig verhindern. Also verhält sich der Bauer fromm.« Er nickte. Er nickte noch einmal, als wenn mindestens dies zweimal notwendig sei, um uns zu überzeugen, dass er aus tiefem Herzen sprach.
Wie oft, fragte er, konnte wohl der durchschnittliche Bauer des vergangenen Jahrhunderts den Lockungen der Lust widerstehen? Das war keineswegs einfach. Bauern sind gewöhnlich keine attraktiven Menschen. Ihre Gesichtszüge sind durch schwere Arbeit gezeichnet. Außerdem stinken sie nach Feld und Stall. Heiße Sommer bewirken Körpergeruch. Unter solchen Umständen erwachen in ihnen triebhaft verbotene Neigungen. Wegen des Mangels an anderem Umgang besitzen sie nicht die Kraft, sich von Verstrickungen mit Brüdern und Schwestern, mit Vätern und Töchtern fernzuhalten.
Er redete nicht näher über das wilde Durcheinander aus Beinen und Körpern von drei oder vier Kindern in einem Bett oder über den Prozess selbst, das fieberhafte, keuchende Anschwellen der Lust bis zum Höhepunkt, aber er erklärte: »Immer mehr Leute im landwirtschaftlichen Sektor sehen allmählich, ob sie wollen oder nicht, den Inzest als eine akzeptable Option. Wer findet denn am ehesten die ehrlichen, von der Arbeit gezeichneten Gesichtszüge des Vaters oder des Bruders attraktiv? Die Schwestern natürlich! Oder die Töchter. Oft sind sie die Einzigen. Nachdem der Vater sie gezeugt hat, bleibt er im Mittelpunkt ihrer Beachtung.«
Man muss es Himmler lassen: Er hatte seit zwei Jahrzehnten Theorien in seinem Kopf gespeichert. Als großer Bewunderer Schopenhauers stellte er auch ein Wort in den Vordergrund, das 1938 noch relativ neu war – Gene. Diese Gene, sagte er, seien die biologische Verkörperung von Schopenhauers Konzept des Willens. Sie seien das grundlegende Element seines mysteriösen Willens. »Wir wissen«, sagte er, »dass Instinkte von einer Generation auf die nächste vererbt werden können. Warum? Ich würde sagen, dass es in der Natur des Willens liegt, seinen Ursprüngen treu zu bleiben. Das bezeichne ich sogar als Vision oder Vorsehung, meine Herren, als Kraft, die im Kern des menschlichen Wesens lebt. Es ist diese Vorsehung, die uns von den Tieren unterscheidet. Seit dem Beginn seiner Existenz auf diesem Planeten strebt der Mensch danach, in vor ihm unbekannte Höhen emporzusteigen.
Natürlich gibt es Hindernisse auf dem Weg zu diesem hehren Ziel. Die edelsten unserer Gene müssen stets stark genug bleiben, um die Entbehrungen, Erniedrigungen und Tragödien des Lebens zu verkraften, da die Gene ja Generation nach Generation, vom Vater auf das Kind, übertragen werden. Große Anführer, hören Sie zu, sind selten das Produkt eines Vaters und einer Mutter. Wahrscheinlicher ist, dass der außergewöhnliche Anführer erfolgreich die Fesseln von zehn frustrierten Generationen gesprengt hat, die in ihrem eigenen Leben keine Vision hatten, sie jedoch durch ihre Gene weitergeben konnten.
Selbstverständlich bin ich zu diesen Gedanken gelangt, indem ich über das Leben von Adolf Hitler nachgedacht habe. Sein heldenhafter Aufstieg klingt in unseren Herzen nach. Da er, wie wir wissen, aus einer langen Linie bescheidenen Bauernvolks stammt, demonstriert sein Leben eine übermenschliche Errungenschaft. Totale Ehrfurcht muss uns übermannen.«
Als Geheimdienstagenten lächelten wir innerlich. Nach dieser Ansprache ging unser Heinrich dann ans Eingemachte. »Die eigentlich zu stellende Frage«, sagte er, »ist doch die, wie sich die strahlende Vision dagegen schützt, durch Vermischung verdunkelt zu werden. Das ist im Prozess der sogenannten normalen Reproduktion inbegriffen. Stellen Sie sich die Multimillionen von Spermien vor. Eines davon muss den ganzen Weg zum Ovum der Frau schaffen. Für jede einsame Samenzelle, die im Meer des Uterus schwimmt, ragt dieses Ovum so hoch wie ein Schlachtschiff.« Er hielt inne, bevor er nickte. »Die gleiche Bereitschaft zur Selbstaufopferung, die im Krieg Männer zum Angriff auf einen befestigten Hügelkamm treibt, muss auch in gesunden Spermien existieren. Das Grundwesen des männlichen Samens besteht in seiner Bereitschaft eben zu dieser Hingabe, damit wenigstens eine Zelle das Ovum erreicht!«
Er starrte uns an. Teilten wir seine Erregung? »Sofort«, sagte er, »erhebt sich die nächste Frage. Sind die Gene der Frau kompatibel mit der Samenzelle, die es geschafft hat, sie zu erreichen? Oder geraten die einzelnen Elemente der jeweiligen Gene in Widerstreit? Werden sie dann zu unglücklichen Ehepartnern? Ja, würde ich antworten, die Diskrepanz überwiegt häufig. Das Zusammentreffen mag kompatibel genug zur Fortpflanzung sein, aber die Kombination ihrer Gene garantiert noch längst keine Harmonie.
Wenn wir daher von der menschlichen Sehnsucht sprechen, einen Mann zu erschaffen, der die Vision verkörpert – den Übermenschen –, müssen wir die Chancen betrachten. Keine zehn Millionen Familien bringen ein Paar hervor, dessen Gene so zueinander passen, dass sie ein Wunderkind zeugen. Vielleicht noch nicht einmal hundert Millionen. Nein!« – wieder die erhobene Hand – »sagen wir eine Million Million. Im Fall Adolf Hitlers reichen die Zahlen sogar bis in die ehrfurchtgebietenden Dimensionen, die wir aus der Astronomie kennen.
Deshalb, meine Herren, legt uns die Logik nahe, dass jeder Übermensch, der die Vision verkörpert, aus einer Verbindung von außergewöhnlich ähnlichen genetischen Inhalten stammt. Nur so sind die Gene in der Lage, einander zu verstärken.«
Wer wusste nicht, worauf Heinrich hinauswollte? Der Inzest bot die besten Voraussetzungen für sein Ziel.
»Trotzdem«, sagte Himmler, »müssen wir vernünftig bleiben und zugeben, dass die genetische Entwicklung einen solchen Fall eher verhindert. Viel häufiger sind es minderwertige männliche und weibliche Nachkommen, die aus diesen intimen Familienbeziehungen in die Welt gelangen. Produkte des Inzests leiden gewöhnlich unter Kinderkrankheiten und sterben früh. Anomalien überwiegen, darunter sogar monströse Verunstaltungen.«
Da stand er, traurig und ernst. »Das ist der Preis. Einerseits kann es sein, dass sich erhöhte Begabungen in einem Inzestuar wiederfinden, andererseits aber auch verstärkte bösartige Neigungen. Labilität ist eine häufige Folge des Inzests, ebenso latente Idiotie. Und wenn eine echte Chance bestehen soll, dass jemand sich zu einem großen Geist entwickelt, dann muss dieser seltene Mensch noch eine Menge Frustrationen überwinden, die ihm den Verstand rauben oder ihn in ein frühes Grab bringen könnten.« Also sprach Heinrich Himmler.
Ich glaube, alle Anwesenden begriffen den Unterton seiner Anmerkungen. Im Jahr 1938 suchten wir (absolut geheim, wie sich versteht) nach einem Anhaltspunkt, ob unser Führer aus einem Inzest ersten oder zweiten Grades stammte. Oder aus keinem. Falls beides nicht zutraf, würde Himmlers Theorie der Boden entzogen. Wenn aber unser Führer wirklich das Produkt eines Inzests war, dann wäre er nicht nur ein strahlendes Beispiel für die Wahrscheinlichkeit seiner These, sondern sogar ihr Beweis.
3
Ich komme nun auf die Besessenheit zu sprechen, die sich um Adolf Hitler rankt. Es verdirbt einem die Stimmung, wenn man mit einer Frage leben muss, auf die es keine Antwort gibt. Noch heute ist Hitler die erste aller Besessenheiten. Wo gibt es einen Deutschen, der nicht versuchte, ihn zu verstehen? Und wo findet man jemanden, der sich mit der fehlenden Antwort begnügen würde?
Ich werde Sie überraschen. Ich habe dieses Problem nicht. Ich lebe in dem festen Glauben, dass ich Adolf verstehen kann. Denn Tatsache ist, dass ich ihn kenne. Ich wiederhole, ich kenne ihn durch und durch, bis in die letzten Winkel seines Körpers.
Nichtsdestoweniger bin auch ich besessen. Es handelt sich dabei aber um ein völlig anderes Problem. Wenn ich daran denke, was ich Ihnen alles mitteilen werde und woher ich es weiß, bricht mir der Angstschweiß aus – wie wenn ich nachts von einer steilen Klippe ins tiefe Wasser springen müsste.
Deshalb will ich am Anfang behutsam vorgehen und nur darüber reden, was damals der SS an Material zur Verfügung stand. Das mag vorerst genügen.
Uns lagen Einzelheiten über Hitlers Familienwurzeln vor. In der Sonderabteilung IV-2a hüteten wir unsere Befunde – wie schon erklärt – mit absoluter Vertraulichkeit. Das war notwendig. Wir hatten als Einzige den Auftrag, uns mit äußerst delikaten Fragen zu befassen, wobei wir stets befürchten mussten, solch böse Antworten zu entdecken, dass sie das Dritte Reich gefährdeten.
Andererseits genossen wir ein besonderes Vertrauen. Wenn die Fakten, die wir gesammelt hatten, sich als brisant erwiesen, konnten wir immer noch geeignete Unwahrheiten verbreiten, um die patriotischen Gefühle in der Bevölkerung zu fördern. Natürlich gab es im Voraus keine Garantie, dass man mit jedem Befund umgehen konnte. Es gab Fragen voll Sprengstoff, zum Beispiel: War Adolf Hitlers Großvater väterlicherseits ein Jude?
4
Das war nur eine Möglichkeit. Andere waren fast ebenso entsetzlich. Eine Zeit lang tüftelten wir an einem fast schon komischen, aber heiklen Gerücht: Monorchidismus. Gehörte unser Führer zu jener Gruppe von unglücklichen und hyperaktiven Männern, die nur einen Hoden besitzen? Tatsächlich bedeckte er immer seinen Schritt mit der Hand, wenn ein Foto von ihm gemacht werden sollte – eine klassische Geste verständlicherweise, wenn man seinen einzigen Hoden schützen will. Aber so etwas zu beobachten ist leichter, als eine eventuelle Anfälligkeit zu verifizieren.
Obwohl wir durch Gespräche mit den wenigen Frauen, die intimen Umgang mit dem Führer hatten und noch lebten, ohne Weiteres Informationen einholen konnten, mussten wir vor den Auswirkungen auf der Hut sein. Was wäre zum Beispiel, wenn Hitler davon Wind bekäme, dass zwei SS-Offiziere sozusagen an seinen Genitalien (beziehungsweise Genital) fummelten? Wir mussten das Projekt aufgeben. Himmlers Entscheidung lautete so: »Falls sich unser verehrter Führer als Inzestuar ersten Grades herausstellen sollte, sind alle Fragen des Monorchidismus subsummiert. Denn Monorchidismus ist ein wahrscheinliches Nebenprodukt des Inzests ersten Grades.«
Es lag mithin auf der Hand, dass wir auf die beste Erklärung für den legendären Willen des Führers zurückgriffen – Blutschande!
Zudem hassten wir alle die Vorstellung, dass Adolf Hitlers Großvater väterlicherseits ein Jude gewesen sein könnte. Das würde nicht nur Himmlers These vernichten, sondern uns auch zwingen, einen enormen Skandal zu vertuschen. Unser Unbehagen rührte teilweise von einem Gerücht her, das bei uns vor acht Jahren, 1930, für Aufregung gesorgt hatte, als ein Brief auf Hitlers Schreibtisch landete. Der junge Mann, der ihn unterschrieben hatte, hieß William Patrick Hitler und stellte sich als Sohn von Adolfs älterem Halbbruder Alois Hitler junior vor. Der Brief des Neffen deutete Erpressung an. Er bezog sich auf »gemeinsame Umstände in unserer Familiengeschichte«. (Der Bursche hatte diese Wörter sogar unterstrichen). Ein derartiger Brief wäre für den Absender gefährlich gewesen, wenn er in Deutschland gelebt hätte, aber er hielt sich damals in England auf.
Was bedeuteten also diese »gemeinsamen Umstände«? William Patrick Hitler erwähnte die Großmutter des Führers, Maria Anna Schicklgruber. Im Jahr 1837 hatte sie einen Sohn geboren, den sie Alois nannte. Zu der Zeit und auch danach wohnte Maria Anna in einem elenden Ort namens Strones, einem armseligen Dorf im Waldviertel, wo sie geringe, aber regelmäßige Geldbeträge erhielt. Leute in ihrer Umgebung vermuteten, dass sie von dem ungenannten Vater ihres Jungen stammten.
Dieser Junge sollte zu Adolf Hitlers Vater heranwachsen. Da Adolf erst 1889 geboren wurde und 1933 an die Macht kam, hielt sich unter den Bauern von Strones hartnäckig das Gerücht, die Alimente kämen von einem wohlhabenden Juden, der in der Provinzstadt Graz lebte. Nach dieser Lesart arbeitete Maria Anna Schickelgruber als Dienstmädchen in dem Haus des Juden, wurde schwanger und musste in ihr Dorf zurückkehren. Als sie das Kind zur Taufe brachte, registrierte der Pfarrer die Geburt als »unehelich«, ein verbreiteter Eintrag in dieser Gegend. Das Waldviertel galt als Armenhaus Österreichs. Hundert Jahre später, nach dem Anschluss 1938, wurde ich in diese Region geschickt, und meine Recherchen erwiesen sich als wahrhaft faszinierend. Während es noch verfrüht wäre zu berichten, wie ich an meine Ergebnisse gelangt bin, kann ich doch schon meine Schlussfolgerungen darlegen. Das soll im Moment genügen. Ich hoffe später den Mut zu haben, auf Details einzugehen.
5
Das Waldviertel nördlich der Donau ist ein Land voll schöner hoher Kiefern. Das Schweigen der Wälder ist dunkel und steht im Kontrast zum Grün der eingestreuten Felder. Der Boden eignet sich jedoch nicht für die Landwirtschaft. In jener Zeit lebten die Hiedlers (woraus später Hitlers wurden) in dem Flecken Spital, und die Schicklgrubers lebten in der Nähe im vorher erwähnten Strones, an dessen einziger Straße tiefer Schlamm lag, nicht mehr als ein paar Dutzend Hütten mit Strohdächern. Gab es in Strones selbst reichlich Schweine, die sich um die Häuser herum suhlten, so wogen auf den Wiesen des Orts Kuhfladen und vergleichsweise angenehm riechende Pferdeäpfel vor.
In dieser Gegend mussten viele Bauern noch ihren Pflug selbst durch verschieden dicke Schlammschichten ziehen. Es gab Morast so zäh wie Lava, Bäche aus Schlick, Kiesgruben, Dreck und Matsch, Klumpen, Steinbrocken, gewöhnlichen Lehm. Auch hatte Strones nicht einmal eine Kirche. Die Einwohner mussten in ein anderes Dorf laufen, nach Döllersheim. Im Register der Pfarrei dort war der Name von Maria Annas Sohn als »Alois Schicklgruber, katholisch, männlich« eingetragen – und dazu, wie wir wissen, »unehelich«.
Die 1795 geborene Maria Anna war zweiundvierzig, als Alois 1837 geboren wurde. Da sie aus einer Familie mit elf Kindern kam, von denen fünf schon tot waren, hätte sie bestimmt mit einem ihrer Brüder beischlafen können. (Himmler hatte natürlich keine Einwände, da ihr Bastard Alois somit Adolfs Vater war.) Jedenfalls wohnte Anna Maria trotz der unsäglichen Armut ihrer Eltern die nächsten fünf Jahre in einem der zwei kleinen Zimmer ihres Vaters. Die mysteriösen Gelder, die in kleinen, aber zuverlässigen Beträgen eintrafen, trugen zum Unterhalt der Schicklgrubers bei.
Obwohl wir natürlich bemüht waren, eine Fundgrube an interfamiliären Kopulationen zu entdecken, durfte dieser Wunsch uns nicht dazu verleiten, den Juden aus Graz abzutun. In der Tat waren schon vor acht Jahren, 1930, Nachforschungen in dieser Richtung angestellt worden. Wie Himmler uns mitteilte, hatte Hitler den Brief seines Neffen, nachdem er ihn gelesen hatte, sofort an einen Nazi-Anwalt namens Hans Frank weitergeleitet. Der Führer, was manche vergessen haben mögen, wurde erst 1933 Reichskanzler, aber Hans Frank hatte schon 1930 begonnen, in den inneren Kreis um den Führer vorzudringen.
Frank musste Hitler nun einen ungünstigen Bescheid übermitteln, was Maria Annas Schwangerschaft betraf. In aller Wahrscheinlichkeit, so erklärte er, sei der Vater ein Neunzehnjähriger gewesen, der Sohn eines reichen Kaufmanns namens Frankenberger, der – ja – ein Jude war. Es passte zusammen. In diesen Zeiten hatte der Spross so mancher wohlhabenden Familie sein erstes sexuelles Erlebnis mit einem Hausmädchen. Sie brauchte keineswegs in seinem Alter zu sein. Diese Art Initiation wurde von der bürgerlichen Moral einer Provinzstadt wie Graz als vernünftige, wenngleich verschwiegene Praxis akzeptiert. Es war doch vernünftiger, als wenn ein betuchter Bursche sich mit Huren abgab oder vorzeitig sein Liebchen aus einer weniger wohlhabenden Familie heiratete.
Frank behauptete, er habe schlüssige Beweise gesehen. Er erzählte Hitler, man habe ihm einen Brief von Herrn Frankenberger gezeigt, dem Vater des jungen Mannes, mit dem Maria Anna das Bett geteilt hatte. Dieser Brief versprach regelmäßige Zahlungen für Alois bis zum Alter von vierzehn Jahren.
Unser Adolf jedoch bestritt diese Befunde. Er sagte Hans Frank, sein Vater Alois habe ihm selber den wahren Sachverhalt mitgeteilt, dem zufolge Maria Annas Cousin Johann Georg Hiedler sein Großvater gewesen sei, der sie schließlich fünf Jahre nach der Geburt von Alois auch geheiratet habe. »Trotzdem«, sagte Hitler zu Hans Frank, »ich möchte diesen Brief von dem Juden an meine Großmutter überprüfen.«
Frank sagte Hitler, er sei nicht in seinem Besitz. Der Mann, der ihn habe, verlange einen zu hohen Preis. Außerdem sei der Brief bestimmt fotografiert worden.
»Haben Sie das Original gesehen?« fragte Hitler.
»Ja, in seinem Büro. Neben ihm standen zwei große Kerle. Es lag auch eine Pistole auf dem Tisch. Womit hat er wohl gerechnet?«
Hitler nickte. »Man kann diesen Mann nicht einmal verurteilen. Es gibt bestimmt eine fotografische Kopie des Briefs.«
Eine weitere Bürde auf Hitlers Schultern.
Jedoch, im Jahr 1938 lieferten unsere Nachforschungen Alternativen. Es schien nicht mehr sicher, dass Maria Anna fünf Jahre nach der Geburt von Alois noch feste Gelder bezog. Nach ihrer Heirat 1842 waren sie und ihr Mann, Johann Georg Hiedler, so arm, dass sie zeitweilig in einem abgenutzten alten Trog schlafen mussten, der früher als Futtertrog für das Vieh in der Scheune eines Nachbarn gedient hatte. Das bewies natürlich noch nicht, dass kein Geld mehr gekommen war. Johann Georg hätte es ohne Weiteres vertrinken können.
In Strones war er eine Legende, was das Ausmaß seines Saufens betraf. Sein Schnapskonsum stand eigentlich der Vermutung entgegen, dass sie arm waren: Warum sonst sollte ein Trinker wie der fünfzigjährige Johann Georg eine Frau von siebenundvierzig mit einem fünfjährigen Balg heiraten, wenn sie nicht ein genügendes Einkommen hatte, um ihm das Trinken zu ermöglichen? Darüber hinaus machten es seine Saufgewohnheiten wenig wahrscheinlich, dass er der Vater von Alois war. In der Tat erhob dieser Johann Georg Hiedler keine Einwände, als Johanns jüngeren Bruder, der auch Johann hieß (aber genauer Johann Nepomuk Hiedler), darum bat, den Jungen bei sich aufnehmen und erziehen zu dürfen. Dieser jüngere Bruder Johann Nepomuk war ein vergleichsweise nüchterner, fleißiger Bauer mit einer Frau und drei Töchtern, aber er hatte keinen Sohn.
Mithin schien Johann Nepomuk nun eine echte Alternative. Konnte er nicht der Vater sein? Es war gewiss möglich. Wir mussten aber erst noch genügend Beweise sammeln, um den Juden auszuschalten.
Himmler schickte mich nach Graz, und ich prüfte gewissenhaft die jahrhundertealten Listen. In den Büchern der Stadt fand sich niemand mit dem Namen Frankenberger. Ich durchforschte die Israelitische Kultusgemeinde des jüdischen Registers von Graz, und meine Vermutung wurde bestätigt: Im Jahr 1496 waren die Juden aus der Region vertrieben worden. Selbst dreihunderteinundvierzig Jahre später, also 1837, im Geburtsjahr von Alois, war ihnen immer noch nicht die Rückkehr gestattet. Hatte Hans Frank gelogen?
Nachdem er sich meine Resultate angesehen hatte, erklärte Himmler: »Frank ist ein Teufelskerl!« Um das zu verstehen, sagte mir Heinrich, müsse man von 1938 nach 1930 zurückkehren. Als damals das Schreiben von William Patrick Hitler eintraf, war Hans Frank nur einer von vielen Anwälten, die bei unseren Leuten in München herumlungerten, aber jetzt war sein Vorgehen offenbar: Er hatte den kompromittierenden Brief erfunden, um eine engere Verbindung zum Führer herzustellen. Da das Dokument fehlte, konnte Hitler nicht wissen, ob Frank es gefälscht hatte, ob er log oder ob er, schlimmstenfalls, tatsächlich ein solches Schreiben besaß. Es wäre das Ende von Hans Frank gewesen, wenn Hitler einen Rechercheur nach Graz geschickt hätte, aber der Anwalt setzte wohl darauf, dass Hitler die Wahrheit gar nicht wissen wollte.
Da Himmler mich auf die Rolle seines engsten Mitarbeiters vorbereitete, vertraute er mir auch an, er werde meine Recherchen von 1938, nach denen es 1837 überhaupt keine Juden in Graz gab, nicht an Hitler weiterleiten. Stattdessen sagte er es Frank. Wir lachten unisono, denn ich begriff sofort. Es gab keinen Funktionär in unserer herrschenden Gruppe, der nicht danach trachtete, ein paar oder alle anderen in den Griff zu bekommen. Frank war jetzt in Himmlers Griff. Aus dieser Übereinkunft leistete er Himmler gute Dienste. Im Jahr 1942 (Frank war damals bekannt als »der Schlächter von Polen«) wurde Hitler wieder nervös hinsichtlich des jüdischen Großvaters, und er bat uns, einen verlässlichen Mann nach Graz zu schicken. Himmler wollte Hans Frank schützen und berichtete dem Führer, er habe einen Agenten nach Graz geschickt, der aber keine greifbaren Beweise gefunden habe. Weil jeder nun vorrangig mit dem Krieg beschäftigt sei, könne man die Sache mehr oder weniger zu den Akten legen. So lautete Himmlers Rat an Hitler.
Buch II
Adolfs Vater
1
Die Jahre 1938 und 1942 folgten jedoch erst mehr als hundert Jahre später auf 1837. Ich erwähne 1938 noch einmal wegen einer kleinen Episode, die sich in Österreich während des Anschlusses abspielte. Sie ermöglicht einen Blick in Himmlers Inneres. Wenn er hinter seinem Rücken als Heini verhöhnt wurde – schiefe Haltung, aufgeblasen, breitarschig –, so beschrieben seine Lästerer lediglich die Schale. Niemand, selbst Hitler nicht, glaubte tiefer an die philosophischen Prinzipien des Nazismus als er.
Ich erinnere mich, wie am ersten Morgen nach dem Einmarsch der Braunhemden ein Trupp von ihnen, Biersaal-Typen mit dicken Bäuchen, eine Gruppe alter und jüngerer Juden zusammentrieb – Angehörige gehobener Berufe, den Kneifer korrekt auf der Nase – und sie zwang, den Gehsteig mit Zahnbürsten zu schrubben. Die Sturmtruppler schauten ihnen lachend zu. Fotografien des Vorfalls erschienen auf den Titelseiten vieler Zeitungen in Europa und Amerika.
Am nächsten Tag sprach Himmler mit einigen von uns. »Das war eine teure Orgie, und ich bin froh, dass keiner unserer SS-Männer etwas mit dieser Rohheit zu tun hatte. Wir alle wissen, wie solche Exzesse die Moral sogar unserer besten Leute untergraben. Sie ermutigen sicher die Rüpel in Wien. Trotzdem sollten wir nicht voreilig den primitiven Instinkt dieser Aktion verurteilen. Nach langem Überlegen kann ich nur sagen, es war ein erfolgreiches Spottstück.« Er hielt inne. Er hatte unsere Aufmerksamkeit. »Bei vielen Menschen in unserem Volk gibt es ein kurioses, ein verborgenes Gefühl der Minderwertigkeit. Sie meinen, die Juden könnten bei jedem Wettbewerb mehr Konzentration aufbringen als die meisten von uns, und die Juden verstünden das richtige Studieren, weshalb sie so unverschämt erfolgreich seien. Bei diesen Leuten herrscht die Vorstellung, die Juden würden immer gewinnen, weil sie härter arbeiteten als die Gastgeber-Rasse aller Länder, in denen sie wohnen.
Diese Meinung entspringt einer groben, aber instinktiven Einstellung unseres deutschen Volks. Sie übermittelt den Juden die Botschaft, dass Arbeit sinnlos ist, wenn sie nicht einem edlen Ziel dient. ›Schrubbt nur weiter mit euren Zahnbürsten‹, sagen unsere Straßenjungen, ›weil ihr Juden ja jeden Tag genau das Gleiche tut, ob ihr es wisst oder nicht. Eure tugendhafte Gelehrtheit bringt euch nur in endlose Widersprüche.‹ Nach reiflicher Überlegung«, schloss Himmler, »möchte ich daher die Taten dieser gemeinen Nazis nicht vorschnell verurteilen.«
Die Geschichte ist lehrreich, wenn man Himmler verstehen will, aber sie unterbricht meinen Bericht darüber, wie ich erfuhr, wer in Wahrheit Hitlers Vater war. Ich bin zwar bereit, Ross und Reiter zu nennen, erkenne aber an, dass es manche Leser ärgern wird, meine Enthüllungen ohne Angabe der Quellen präsentiert zu bekommen. Eine Tatsache ist keine Tatsache, mögen sie sagen, wenn die Mittel und Wege zu ihrer Ermittlung fehlen.
Dem stimme ich zu. Nichtsdestoweniger können meine wirklichen Mittel vorläufig noch nicht enthüllt werden. Selbst die Vorteile der Abteilung IV-2a reichten damals nicht zur Klärung des Falls aus, aber ich bemühte mich trotzdem um eine Antwort für Heinrich, die ich aus vielen Nachforschungen zusammensetzte. Ich wusste, wenn mein Endprodukt seine These unterstützte, würde er es akzeptieren.
Begnügen wir uns also im Augenblick mit den Schlussfolgerungen, die ich Himmler 1938 vorlegte. Nachdem ich ihm mitgeteilt hatte, dass der Jude aus Graz nicht existierte, schlug ich vor, unsere Nachforschungen auf das Verhalten des einen Bruders von Maria Anna Schicklgruber zu verlagern, der es tatsächlich geschafft hatte, dem Schlamm von Strones zu entrinnen und als Handlungsreisender ein wenig Geld zu verdienen. Das Beste an diesem Bruder war, dass er regelmäßig durch Graz kam; deshalb beschloss ich, unseren Fall von ihm aus aufzurollen und die eigentliche Familie, für die Maria Anna gearbeitet hatte – eine Witwe mit zwei Töchtern – zu vergessen. Aus ihren alten Bankauszügen ging hervor, dass diese Damen nie Sonderzahlungen überwiesen und Maria Anna viel mehr wegen irgendeines dummen Diebstahls entlassen hatten. Die Schwangerschaft eines unverheirateten Mädchens konnte man hinnehmen, aber nicht den Verlust von ein paar Münzen! Dann erwog ich, dass Maria Anna vielleicht ihren Bruder schützen wollte, indem sie ihrem Vater und ihrer Mutter erzählte, das Geld komme von einem Juden. Das würde sie von der Spur ablenken.
Bevor ich jedoch diese Spekulation an Himmler weiterleitete, dachte ich mir eine noch mehr versprechende Alternative aus: Warum nicht Johann Nepomuk Hiedler, den fleißigen jüngeren Bruder, als den Samenspender in Betracht ziehen? Er würde einen Prima-facie-Fall von Inzest liefern, obwohl das immer noch einen Schritt von Himmlers wahrem Ziel entfernt wäre, denn es würde bedeuten, dass nur der Vater, Alois, ein Inzestuar war, und nicht Adolf selbst.
Jedoch, wenn Maria Anna ihren Sohn Alois von Johann Nepomuk empfangen hatte, würde Himmlers These ganz enorm gestützt, denn die junge Klara Pölzl, die Alois’ dritte Frau und Adolf Hitlers Mutter werden sollte, war auch eine Enkelin von Johann Nepomuk. Wenn Alois der Sohn Nepomuks war, wäre Klara eine Nichte von Alois! Ein Onkel und seine Nichte hätten demnach unseren Führer gezeugt. Das ergäbe eine solide Präsentation. Darüber hinaus wusste ich, wie man sie für Heini ausschmückte. Mein abschließendes Szenario enthielt erotischen Reiz: Ich erklärte, Maria Anna Schicklgruber und Johann Nepomuk Hiedler hätten Alois an dem Tag gezeugt, als sie von Graz auf einen Besuch nach Strones kam. Nepomuk, der in Spital wohnte, war zufällig auch gerade dort und legte sich eine Stunde mit Maria Anna ins Heu. Sie wurde auf der Stelle schwanger. Nepomuk zweifelte nie daran, denn der Akt war außergewöhnlich gewesen. Sobald sie ihren Atem wiedergewonnen hatte, sagte sie ihm: »Du hast mir ein Baby gemacht. Ich schwöre es. Ich habe es gespürt!«
Wie mein Szenario weiterhin erläuterte, liebte Johann Nepomuk seine Frau und seine drei Töchter, und er würde seine Familie nie zerstören. Trotzdem war er bereit, die Sache aus Maria Annas Sicht zu betrachten. Er war ein anständiger Mann. Deshalb ermunterte er sie, ihren Eltern zu erzählen, sie erhalte Geld aus Graz, während in Wirklichkeit er, Johann Nepomuk, regelmäßig für das Kind zahlen würde. Sie sagte also später ihrer Familie, das Geld käme jeden Monat aus Graz, obwohl niemand je die Briefumschläge sah.
Maria Anna fand sich mit der Situation ab, aber sie war nicht zufrieden. Nachdem fünf Jahre verstrichen waren, sagte sie Nepomuk, sie müsse die Wahrheit erzählen. Es sei erniedrigend, jedes Mal, wenn sie mit ihrem fünfjährigen Jungen an der Hand aus der Tür trete, die Blicke der Frauen von Strones ertragen zu müssen.
Nepomuk schlug vor, statt seiner solle sein älterer Bruder Georg als Bräutigam eingeführt werden. Nepomuk mochte seinen Bruder nicht, und Georg mochte Nepomuk nicht, doch eine neue Geldquelle ist Herzblut für einen Trinker. Ich übertreibe, aber nicht stark. Georg heiratete Anna wegen ihrer Alimente und genoss das Bewusstsein, dass sie von Nepomuk stammten, der sich noch mehr auf seinen Feldern mühen musste, um die Extra-Kronen zu beschaffen. Für Georg war es ein besonderes Vergnügen, sich seine Ausschweifungen von dem schwer arbeitenden jüngeren Bruder bezahlen zu lassen. Er hatte ein rundum niederes Gemüt. Er war ein ungehobelter Mensch und Versager.
Als Maria Anna endlich verheiratet war, wollte sie ihren Mann dazu bewegen, dass er sich als der Vater von Alois bekannte, aber Georg bedeutete ihr schnell, sie solle sich nicht in Angelegenheiten seiner persönlichen Ehre einmischen. Da er im Verlauf so manchen Gelages schon etliche Trinkkumpane über das Motiv seiner Heirat informiert hatte – wegen des Geldes, Dummkopf! –, sah er jetzt überhaupt keinen Grund, sich lächerlich zu machen, indem er dieses Balg legitimierte, von dem jeder wusste, dass es nicht seines war. Er mochte ein Trunkenbold und ein Versager sein, aber er war bestimmt kein Hahnrei. Sollte dieser Bastard doch ein Bastard bleiben!
So sah die Legende aus, die ich Himmler präsentierte. Sie stützte sich auf Gespräche, die ich mit den wenigen alten Einwohnern von Strones geführt hatte, die vor dem Tod unseres Trunkenboldes Johann Georg Hiedler 1857 geboren waren. Die Geschichte stimmte zwar hinten und vorn nicht, wenn man sie näher untersuchte, aber Himmler gefielen meine Schlussfolgerungen, und darum hielt sie stand. Ich hatte ihm eine Familiengeschichte geliefert, nach der kein jüdisches Blut in Hitlers Adern floss und derzufolge sein Vater und seine Mutter als Onkel und Nichte blutsverwandt waren. Es war mir damit gelungen, Adolf Hitler zu einem erstrangigen Inzestuar zweiten Grades zu erklären.
Himmler hatte eine Offenbarung. »Dies«, sagte er, »enthüllt mehr als alles andere die unglaubliche Tapferkeit und Standhaftigkeit des Führers. Wie ich schon oft angemerkt habe, sind ein früher Tod oder schwere Verunstaltungen die wahrscheinlichsten Erwartungen für Inzestuare ersten Ranges, aber wieder einmal hat uns der Führer seine unvergleichliche Kraft des Beharrens gezeigt. Genie und Wille, seine einzigartigen Charaktereigenschaften, leiten sich aus der seltenen Intensivierung her, wie man sie bei erstrangigen Inzestuaren findet, selbst wenn sie zweiten Grades sind. Unser Volk ist mit einem herrlichen genetischen Resultat gesegnet. Die agrarischen Gene des Führers sind über Generationen hinfort gestärkt worden und haben eine triumphale Metamorphose in seine transzendenten Tugenden erfahren.«
Hier schloss Himmler die Augen, lehnte sich zurück und atmete langsam aus. Es war, als wolle er jeglichen Zweifel aus seinen Lungen blasen. »Ich werde mit Ihnen nie wieder darüber reden«, fuhr er mit leiser Stimme fort, »aber Fälle des engen Inzests sind wahrhaft gefährlich. Man braucht den Willen des Führers, um eine solche Situation zu meistern. Ich bin überzeugt, dass es in der Welt der übernatürlichen Geister um uns herum viele Elemente gibt, die wir zu Recht böse nennen. Es ist sogar möglich, dass die ärgsten dieser Geister sich um eine Präsenz scharen, die man in früheren Zeiten als Satan bezeichnet hat. Sollte diese Verkörperung tatsächlich existieren, würde sie bestimmt Inzestuaren höheren Ranges die größte Aufmerksamkeit widmen. Jeder böse Geist bemüht sich, die außerordentlichen Chancen zu vereiteln, die aus der Symbiose von gottgegebenen Genen resultieren. Umso mehr Kraft besitzt mithin Adolf Hitler. Er hat es geschafft, möchte ich behaupten, mit seiner Vision dem Teufel selbst zu widerstehen.«
Himmler ahnte nicht, dass er noch mehr Grund zur Begeisterung hatte, denn die Geschichte – und das war die Ironie –, die er aus den kleinsten Beweisen zusammengebraut hatte, war zufällig wahr. Es war Johann Nepomuk Hiedler, der das Geld zur Verfügung gestellt hatte, und Alois Schicklgruber war sein verheimlichtes Kind. Die Ironie des Ganzen bestand darin, dass der Sohn von Alois, Adolf Hitler, nicht nur ein erstrangiger Inzestuar zweiten Grades, sondern sogar in einem vollen Inzest gezeugt worden war. Die Nichte Klara Pölzl, die Alois’ dritte Frau und Adolf Hitlers Mutter werden sollte, war nämlich nicht nur Alois’ Ehefrau, sondern auch seine eigene Tochter. Über diese Beziehung kann ich bald mehr Details vorlegen.
2
Erst jedoch muss ich mein Memoir ausweiten und wie ein konventioneller Romanautor der alten Schule die Familiengeschichte ausbreiten. Ich werde dabei in die Gedanken von Johann Nepomuk dringen, ebenso in die Sichtweisen seines illegitimen Sohnes Alois Hitler, und ich werde auch die Empfindungen von Alois’ drei Frauen und seinen Kindern mit einschließen.
Wir sind nun mit Maria Anna Schicklgruber fertig. Diese unglückliche Mutter kam 1847 im Alter von zweiundfünfzig ums Leben, zehn Jahre nach der Geburt von Alois. Als Ursache wurde »Tuberkulose wegen Lungenödem« angegeben, eine galoppierende Schwindsucht, die sie sich zugezogen hatte, als sie während ihrer zwei letzten Winterjahre in dem Viehtrog schlafen musste. Eine zusätzliche Ursache war Wut. Vor ihrem Tod dachte sie oft daran zurück, wie gesund sie im Alter von neunzehn gewesen war, wie biegsam ihr Körper war, und wie man ihre schöne Singstimme bewundert hatte, als sie die Solistin im Kirchenchor von Döllersheim war. Nach drei Jahrzehnten verlorener Hoffnungen staute sich dann in der Ehe neben dem Frust die gleiche Wut an, mit der Georg sie jedes Mal bei ihrem gelegentlichen Beischlaf überfallen hatte. Er jedoch schaffte es, wie mancher Trunkenbold vor ihm, entgegen der allgemeinen Vermutung keines frühen Todes zu sterben. Nach ihrem Hinscheiden hielt er noch zehn Jahre durch. Das Trinken war nicht nur seine Nemesis, sondern auch seine geliebte Medizin und erst zum Schluss sein Henker gewesen. Er starb innerhalb eines Tages. Schlaganfall, hieß es. Da er sich nie die Mühe gemacht hatte, Nepomuk oder Alois zu besuchen, wurde er nicht vermisst, aber Alois war damals zwanzig und arbeitete in Wien.
Alois hatte auch nicht sonderlich gelitten, als er seine Mutter verlor. Spital, wo er mit Johann Nepomuk, der Frau und den drei Töchtern der Hiedler-Familie wohnte, lag einen langen Fußmarsch von Strones entfernt, und er hatte Maria Anna fast vergessen. Er war glücklich in seiner neuen Familie. Anfangs waren Nepomuks Töchter Johanna, Walburga und Josefa, zwölf, zehn und acht Jahre alt, begeistert von ihrem fünfjährigen Bruder und ließen ihn gern in ihr Schlafzimmer. Da Spital eher schon eine beträchtliche Gemeinde als ein Dorf war, hatte sich eine Trennung zwischen arm und reich vollzogen. Sogar ein Bauer konnte als wohlhabend gelten, zumindest in seinem eigenen Ort. Davon gab es einige in Spital, Johann Nepomuk an erster Stelle. Seine Frau Eva führte ein gutes Heim. Sie war außerdem sehr praktisch veranlagt. Obwohl sie argwöhnte, Nepomuk mochte vielleicht mehr als nur der Onkel des Jungen sein, konnte sie anderseits nicht die Enttäuschung in seinen Augen vergessen, wenn sie ihm eine Tochter nach der anderen gebar. Es war wohl besser für alle Beteiligten, einen Jungen im Haus zu haben. Ja, sie war praktisch veranlagt.
Und Alois wurde geliebt! Von seinem Vater, von den Mädchen, sogar von Eva. Er sah gut aus und hatte wie seine Mutter eine schöne Stimme. Als er älter wurde, bewies er auch, dass er zur Feldarbeit taugte. Eine Zeit lang erwog Nepomuk sogar, ihm den Hof zu vererben, aber der Junge war unruhig. Er würde vielleicht nicht mehr da sein, um all die unvorhersehbaren kleinen und großen Hindernisse in den täglichen Mühen des Bauern zu beseitigen. Johann Nepomuk liebte hingegen seine Arbeit so sehr, dass er an guten Tagen meinte, er könne das Murmeln der Erde hören. In dem langen lastenden Schweigen am Ende eines Nachmittags wurde ihm manchmal unbehaglich, aber nachts drang oft ein Zauber in seine Träume. Seine Felder, seine Ställe, seine Tiere und seine Scheune wuchsen ihm darin zu einem Wesen gleich einer verlangenden Frau zusammen, gewölbt, magisch, riechend, gierig, immer mehr aus ihm heraussaugend. Er wachte dann in der Gewissheit auf, dass er Alois den Hof nie überlassen konnte – Alois war das Kind der Frau in seinem Traum. Er musste die Idee ohnehin aufgeben, denn dieses Geschenk an Alois hätte seine Frau Eva erzürnt. Sie wollte ihre Töchter versorgen, und der Hof würde für mehr als zwei ansehnliche Brautaussteuern nicht hinreichen.
Im Laufe der Jahre tauchten weitere Probleme mit dieser Mitgift auf. Bei der ersten Ehe erhielt die älteste Tochter Johanna nur einen Bruchteil des Landes. Sie hatte einen armen Mann geheiratet, einen fleißigen, aber glücklosen Bauern namens Pölzl. Als es um die Aussteuer für die zweite Tochter Walburga ging, die schon einundzwanzig war, musste Nepomuk großzügiger sein. Der künftige Bräutigam, Josef Romeder, war ein robuster Bursche von einem wohlhabenden Hof in Ober-Windhag, dem nächstgelegenen Dorf, und die Verhandlungen über Walburgas Mitgift verliefen zäh. Schließlich überschrieb Nepomuk ihm den fruchtbarsten Teil seines Landes. Das ließ nur einen bescheidenen Streifen für die dritte Tochter Josefa übrig, die kränklich und jungfernhaft war. Für Eva und sich selbst behielt er einen hübschen kleinen Wohnsitz in einem Obstgarten, der an Romeders Grundstücke grenzte. Das kleine Haus in dem Obstgarten genügte ihnen. Er war so weit, sich zur Ruhe zu setzen.
Nepomuk führte seinen neuen Schwiegersohn über das Gelände, Grenzlinie nach Grenzlinie, und hielt an jedem Stein inne, der eine Trennung zwischen seinen Feldern und denen des nächsten Bauern markierte. Nepomuk sagte: »Und wenn du je Früchte aus dem Obstgarten dieses Mannes aufsammelst, wird dich der schwarze Himmel strafen.« Danach versetzte er Josef Romeder einen Hieb an den Kopf. Bei jedem der acht Gänge die Grenzlinien entlang wiederholte er die Prozedur. Johann Nepomuk betrauerte nicht die Abtretung seines Hofs, sondern die Abwesenheit von Alois. Sein lieber adoptierter Sohn Alois war fort, weil er ihn vor drei Jahren, als der Junge dreizehn und Walburga achtzehn war, verbannt hatte. Er hatte sie im Heuschober seiner Scheune erwischt, und das hatte ihn an die andere Scheune erinnert, in der er einst mit Maria Anna im Stroh gelegen und Alois gezeugt hatte.
Die Erinnerung an die Pracht dieses Liebesakts mit Maria Anna Schicklgruber war ihm stets gegenwärtig geblieben. Er hatte nur zwei Frauen in seinem Leben besessen, und Maria war die zweite – für ihn keineswegs eine Bauerndirne, grobschlächtig und nacktarschig im Heu, sondern eine vom Sonnenlicht beleuchtete Madonna, dem Bild entsprechend, das sich ihm früher in einem bunten Glasfenster der Kirche von Strones eingeprägt hatte. Dieses Bild vergrößerte ihm immer das Ausmaß seiner Schuld. Er lebte in Schande, er wusste es, und trotzdem ging ihm das Bild von Maria Annas Gesicht in dem bemalten Fenster nicht aus dem Sinn. Deshalb ging er nur selten zur Beichte, und wenn er es tat, erfand er im Beichtstuhl andere schwere Sünden. Einmal beichtete er sogar einen Koitus mit der Stute des Hofs, was er nie versucht hatte, und der Priester fragte ihn, wie oft er diese Sünde begangen habe. »Nur einmal, Herr Pfarrer.«
»Wann war das? Wie lange ist es her?«
»Monate, glaube ich.«
»Und welche Gefühle haben Sie, wenn Sie jetzt mit dem Tier arbeiten? Kommen Ihnen wieder ähnliche Begierden?«
»Nein, nie. Ich schäme mich.«
Der Priester war mittleren Alters, und er konnte kaum noch etwas über die Bauernschaft dazulernen; deshalb spürte er, dass Nepomuk log. Trotzdem nahm er das Geständnis als wahr hin, weil Sodomie zwar ebenso wie Ehebruch oder Inzest eine Todsünde war, aber nach seiner Meinung nicht so schädlich. Es konnten schließlich keine Nachkommen dadurch entstehen. Er fuhr also im Gespräch fort und tat, was sein Amt von ihm erforderte.
»Sie haben sich als ein Kind Gottes entwürdigt«, sagte er zu Nepomuk, »Sie haben eine schwere Sünde der Lust begangen. Sie haben ein unschuldiges Tier verletzt. Als Buße erlege ich Ihnen fünfhundert Vaterunser und fünfhundert Gegrüßet seist du Maria auf.«
Das war die gleiche Buße, die der Priester früher am Morgen einem Schuljungen auferlegt hatte, der im Unterricht in seine Hand gespuckt und dann heimlich masturbiert hatte, um anschließend seine Spucke und seinen Samen in das Haar des Jungen vor ihm zu schmieren, eines kleinen Jungen. Johann Nepomuk beichtete später demselben Priester gelegentlich, er habe immer noch lüsterne Gedanken der Stute gegenüber, aber er hüte sich davor. Damit war das Kapitel Beichte für ihn abgeschlossen.
Die fortwährende Abwesenheit von Alois verursachte Johann Nepomuk Hiedler wahre Liebesmartern. Er hatte gleich einem biblischen Vater geweint und sein Hemd zerrissen, als er seinen Sohn und seine Tochter im Heu entdeckte. Er wusste in dem Augenblick, dass er seinen Sohn verloren hatte. Er musste das hellste Licht seiner Tage, dieses lebhafte junge Gesicht, verbannen. Zum Entsetzen der anderen Frauen in der Familie wurde Alois noch am selben Abend in das Haus eines Nachbarn geschickt und am nächsten Morgen in eine Kutsche nach Wien gesteckt.
Nepomuk erzählte Eva nichts davon, sie wusste aber auch so Bescheid, denn er verbot Walburga drei Jahre lang, das Haus zu verlassen. Die Heirat der jungen Frau mit Romeder sollte ohne Brautzeit stattfinden. Doch obwohl Eva wie ein Feldwebel, der bei der Uniformparade die Kleiderordnung seines Zugs prüft, über die Keuschheit ihrer Töchter wachte, quälte sie Johann Nepomuk ständig mit der Bitte, dass er Walburga wenigstens am Sonntag einen Spaziergang mit ihrer Freundin erlaubte.
»Nein«, entgegnete Nepomuk. »Die beiden werden in den Wald wandern. Dann werden ihnen die Jungen folgen.«
Als er mit Romeder die Grenzlinien entlangschritt, war es ihm jedes Mal peinlich, wenn er den Mann seiner Tochter schlug. Welches Unrecht tat er seinem neuen Schwiegersohn an! Deshalb schlug er noch fester zu. Diese Ehe gründete auf einer Lüge. Folglich durfte das Land des Nachbarn nicht betreten werden. Das wäre ein Sakrileg gegen die Erde. Wie tief Nepomuk die Abwesenheit seines Sohnes betrauerte!
3
Alois erging es gut in Wien. Mit seinem hübschen und angenehmen Gesicht war er in einem Geschäft untergekommen, das Kavalleriestiefel für Offiziere anfertigte.
Er bediente jetzt junge Männer, die so wirkten, als stammten ihre Körper, ihre Uniformen, ihre Schuhe, ihr Schmuck und ihre Seelen allesamt von demselben vornehmen Hersteller. Ihr Vertrauen auf ihre persönliche Erscheinung imponierte Alois. Sie waren offensichtlich gegenüber den elegant gekleideten Damen in ihrer Begleitung völlig unbefangen. Fast jeden Sonntag beobachtete er sie bei ihrer Promenade. Die Hüte der Frauen waren so zierlich gewirkt. Eine Zeit lang träumte er, wenn er eine junge Hutmacherin träfe, könne er mit ihr ein Geschäft eröffnen, in das junge Paare der besten und höchsten Klasse Hand in Hand einträten und nach modischen Schuhen und feschen Hüten suchten. Es war seine einzige Geschäftsidee auf Jahre hinaus, aber er spielte mit diesem Traum, weil schöne Damen ihn stimulierten. Er liebte junge Frauen. Hatte er sich nicht beim Spiel mit seinen Stiefschwestern oder besser mit seinen Halbschwestern, was aber nur Nepomuk wusste, höchst vergnügt!
Er traf jedoch keine junge Hutmacherin, und die Idee machte einer besseren Platz. Er konnte nie Kavallerieoffizier werden, da man dafür aus einer angemessenen Familie stammen musste und er aus einer Gegend kam, wo man eher über die Gewohnheiten von Schweinen Bescheid wusste als darüber, welches Parfum ein Mann auf seinem Taschentuch benutzen sollte. Alois wollte nicht etwas anstreben, was es für ihn nicht gab. Aber eines wusste er – das Leben in Wien lag ihm. Niemand sonst in Spital hatte so sehr danach getrachtet, sich zu verbessern. Und bald spürte er seinen Ehrgeiz: Er wollte sein Leben in einer anständigen Uniform verbringen und wegen seiner Haltung bewundert werden. Und wegen seiner Intelligenz. Er war bestimmt nicht dumm, das wusste er.
Mit achtzehn bewarb er sich nach fünf Jahren in dem Stiefelgeschäft beim österreichischen Finanzministerium um eine Stelle in der Zollbehörde, und er wurde angenommen. Nach weiteren fünf Jahren war er in den Rang eines Oberaufsehers der Finanzwache aufgestiegen, der zwar nur dem eines Korporals entsprach, aber seine Uniform war schon beeindruckend, und es dauerte gewöhnlich sogar zehn Jahre, bis man diese Stufe erreichte, besonders wenn man ohne Verbindungen in den Dienst eingetreten war.
Er hatte Johann Nepomuk mehrfach geschrieben und über seine Fortschritte berichtet, und schließlich kam im Jahr 1858 ein Brief von ihm zurück. Nepomuks jüngste Tochter Josefa war gestorben, ein schwerer Schlag für die Familie, und Nepomuk deutete an, dass er einen Besuch von Alois begrüßen würde.
Er wirkte ungewöhnlich groß für einen Mann von mittlerer Statur, als er 1859 nach Spital zurückkehrte: In den Augen seiner Familie war sein Auftreten so gebieterisch, als sei er von hoher Abstammung.
Es dauerte nicht lange, bis Johann Nepomuk merkte, dass die Einladung an Alois ein schwerwiegender Fehler war, aber Nepomuk war mittlerweile so gebeugt wie ein Baum, der zu viele Jahre lang zu vielen Stürmen getrotzt hatte. Josefas Tod pochte in seiner Seite gleich der Wunde, die eine Axt geschlagen hatte. Er fühlte sich zu müde, um Alois zu überwachen.
Ja, was konnte er tun? Seine älteste Tochter Johanna, sieben Jahre älter als Alois, war mit achtzehn verheiratet worden und ihrem Mann Johann Pölzl, der sie regelmäßig schwängerte, während der letzten elf Jahre treu geblieben. Sie hatte einmal ganz gut ausgesehen. Jetzt waren ihre Hände und Füße rau, und ihre Gesichtszüge waren aufgedunsen durch das Austragen von sechs Kindern, von denen nur noch zwei lebten.
Johannas ausgezehrtes, einst so fröhliches Gemüt belebte sich wieder, als sie Alois erblickte. Er war ihr Liebling gewesen, seit er zum ersten Mal ins Haus kam. Sie hatte den Fünfjährigen jedes Mal liebkost, wenn sie ihn zum Schlafen in ihr Bett holte. All die Jahre hindurch hatte sie ihn an den Haaren gezogen und auf die Wange geküsst, bis sie einmal, als er acht und sie fünfzehn war, wie in einem Ringkampf im Heu der Scheune herumrollten. Aber es war nichts passiert.
Diesmal gab es keine Frage. Bei der ersten Gelegenheit, die sich als die einzige erwies, setzte Alois seines Vaters Tradition des apokalyptischen Beischlafs im Scheunenstroh fort, und Klara Pölzl wurde gezeugt. Daran bestand für Johanna kein Zweifel. Sie hatte es zwar auch jedes Mal gespürt, wenn ihr Mann Johann Pölzl ihr ein Kind machte. Aber dieses Ereignis war höherer Art. In ihrem Körper geschah Großes. »Ich habe mich mit dir so gefühlt wie noch nie zuvor«, sagte sie, als es vorbei war, und als Klara geboren wurde, schickte ihm Johanna einen Brief, der ihn mitten in den strengen Vorbereitungen für eine Prüfung erreichte, die ihn zum Finanzwachen-Respizienten befördern sollte, dem höchsten verfügbaren Posten für Angehörige der unteren Dienststufen in der Zollbehörde. Vorgänge in Spital kümmerten ihn deshalb wenig.
Trotzdem blieb der Brief die Jahre hindurch in seinem Gedächtnis haften. Er bestand nur aus drei Wörtern, die Johanna mit Sicherheit richtig buchstabieren konnte, und er las sie viele Male. »Sie ist hier«, schrieb Johanna voller Stolz auf dieses bedeutende Ereignis (allerdings ohne Unterschrift), und »Sie ist hier« nahm einen Platz in der Wachstube seines Herzens ein, obgleich Alois’ Trachten seiner Karriere galt. Ja, vielleicht hätte er Johanna bei diesem Besuch gar nicht berührt, wenn er nicht vor vielen Jahren schon mit Walburga zusammen gewesen wäre und ein Jahr zuvor mit der Jüngsten, Josefa, seinem Liebling damals, als er zwölf war (sein erstes Mal), und deshalb glaubte er es, sich selbst schuldig zu sein, auch die übrig gebliebene Schwester zu nehmen. Wie viele Männer konnten sich schon brüsten, drei Schwestern so intim gekannt zu haben?
Wenn er sich selbst an solchen Taten maß, zog er auch Vergleiche zu den Errungenschaften anderer niedrigrangiger Beamten in der Finanzwache. Sein Aufstieg war für einen Mann mit seiner kargen Bildung bemerkenswert. Trotzdem folgte nach vier Jahren eine weitere Beförderung und 1870 noch eine, sodass er sich mit fünfunddreißig zum Zolleinnehmer hochgearbeitet hatte. Im Jahr 1875 wurde er ein echter Inspektor und vermerkte nun auf allen Regierungsdokumenten nach seiner Unterschrift die gesamte Titulierung: »Beamter Erster Klasse der Kaiserlichen Zollstation im Bahnhof Simbach, Bayern. Residenz Braunau, Linzer Gasse.«
Während seines ganzen beruflichen Aufstiegs verließ ihn nie seine Lust auf Frauen. Das erste Prinzip der österreichischen Bürokratie gebot, seine Arbeit zu erledigen, und je effektiver man dabei war, desto weniger hatte man bei den kleinen Ausschweifungen in seinem Privatleben zu befürchten. Dieser Übereinkunft gehorchte er aufs Wort. Er wohnte an seinen Einsatzorten gewöhnlich in einem Gasthof. Mit seiner Selbstsicherheit hatte er bald die nur schwach verteidigten Bastionen der Köchinnen und Zimmermädchen des Wirtshauses überwunden. Wenn er dann alle verfügbaren Frauen genommen hatte, zog er gewöhnlich in einen größeren Gasthof. In den vierzig Jahren seiner Karriere wechselte seine Adresse häufig. In Braunau zum Beispiel zog er zwölf Mal um. Es störte ihn nicht, dass seine Frauen nicht von der eleganten Art waren, mit der Kavallerieoffiziere spazieren gingen. Überhaupt nicht! Elegante Frauen, so hatte er für sich entschieden, waren zu schwierig, gar kein Zweifel, während Zimmermädchen und Köchinnen ihm für seine Zuwendung dankbar waren und nicht aufbegehrten, wenn er weiterzog.
Im Jahr 1873 heiratete er eine Witwe. Da er ein Auge für den gesellschaftlichen Status von Frauen bekommen hatte, die als Damen gelten wollten – sein Beruf verlangte schließlich einige Fähigkeiten in dieser Richtung –, war er mit seiner Wahl nicht unzufrieden. Er mochte sechsunddreißig und die Witwe schon fünfzig sein, er begehrte sie nicht, er respektierte sie. Sie stammte aus einer ehrbaren Familie. Vielleicht sah sie nicht blendend aus, aber sie war die Tochter eines Beamten beim kaiserlichen Tabakmonopol, welcher der Krone einen Teil ihres Einkommens sicherte, und ihre Mitgift war zufriedenstellend. Sie lebten gut, sie hatten ein Dienstmädchen. Sein eigenes Gehalt war mittlerweile beträchtlich, selbst der Direktor des Gymnasiums in Braunau verdiente nicht mehr.
Indem sein Rang stieg, vermehrten sich die Goldstreifen und die vergoldeten Knöpfe an seiner Uniform entsprechend, und an seiner schief aufgesetzten Mütze prangten elegante offizielle Stickereien. Sein Schnauzbart war mittlerweile eines ungarischen Edelmanns würdig, und sein Gesicht mit dem vorgestreckten Kinn zeigte sein ganzes Selbstbewusstsein. Seine Untergebenen in der Zollstation wurden angewiesen, ihn immer mit seinem korrekten Titel anzureden. Auch nahm er an Körpergewicht zu. Bald nach seiner Heirat rasierte er auf Drängen seiner Frau den Schnäuzer ab und ließ sich Koteletten wachsen, sodass sie seinem Gesicht den entsprechenden Rahmen gaben. Da er sie sorgsam pflegte, wurden sie bald so imposant wie Schlosstore. Nun sah er nicht nur wie ein Zollbeamter im Dienst der Habsburger aus, sondern er ähnelte sogar Franz Joseph selbst! Da stand er also, eine gelungene Nachbildung des Kaisers, mit dem hehren Ausdruck von Pflicht und harter Arbeit im kaiserlichen Gesicht.
Seine Ehefrau, Anna Glassl-Hörer, büßte jedoch ihre Anziehungskraft auf ihn ein, als er zwei Jahre nach dem Beginn ihrer Ehe entdeckte, dass auch sie eine Waise und adoptiert worden war. Im Gegenzug verlor sie jeglichen Respekt vor ihm, als er ihr gestand (nachdem er es müde geworden war, Geschichten über einen imaginären und sagenhaften Herrn Schicklgruber zu erfinden), dass es auf der väterlichen Seite seines Geburtsregisters keinen Eintrag, sondern nur eine leere Stelle gab.
Sie begann eine Kampagne. Alois sollte sich legitimieren lassen. Schließlich war seine Mutter verheiratet gewesen. Warum sollte also Johann Georg Hiedler nicht sein Vater sein? Alois wusste, dass es unwahrscheinlich war, aber nachdem seine Frau jetzt ein Problem daraus machte, war er einem Versuch nicht abgeneigt. Sein Nachname hatte ihm ohnehin nie gefallen, und Anna Glassl hatte recht damit, dass ihm in seiner Karriere trotz aller Erfolge der Klang des Namens, den er jeden Tag vernahm, ziemlich unangenehm war.
Er fuhr von Braunau über Weitra nach Spital, um zu sehen, ob Johann Nepomuk ihm helfen würde. Der alte Mann, jetzt siebzig, verstand ihn erst nicht. Als Alois ihm erzählte, er wolle seinen Nachnamen auf den eigentlich richtigen ändern – Hiedler! –, empfand dieser eine heftige Scham. Er glaubte, er solle selbst als der Vater benannt werden, und wehrte es innerlich sofort mit dem Argument ab, dass er an die zwei ihm verbliebenen verheirateten Töchter denken müsse (seine Frau Eva gar nicht zu erwähnen!) und dass er sich unmöglich als Vater von Alois bekennen könne. Diese Ausflüchte drangen ihm jedoch nicht über die Lippen. Am Ende begriff er, dass es Alois darum ging, Johann Georg als seinen Erzeuger zu benennen. Woraufhin er – alte Männer können gleich jungen Mädchen augenblicklich von einem extremen Gefühl in das andere fallen – auf Alois wütend wurde. Sein eigener Sohn wollte ihn, Nepomuk, als seinen Vater verleugnen. Es dauerte ein wenig, bis er einsah, dass nur Georg aufgrund seiner Heirat mit Maria Anna legal ins Register eingetragen werden konnte.
In einem von zwei alten Pferden gezogenen Polterwagen fuhr er mit Alois und Romeder und zwei Nachbarn, die sich als Zeugen zur Verfügung gestellt hatten, die langen Meilen von Spital nach Strones, dann ein paar Meilen weiter nach Döllersheim, insgesamt knapp vier Stunden in einem engen, rutschenden Gefährt auf einem mit vielen abgebrochenen Ästen und entwurzelten Bäumen übersäten Weg, der aber frei von Schlamm war. (Mit Schlamm hätte es vielleicht acht Stunden gedauert.) Bei ihrer Ankunft stand Johann Nepomuk demselben Priester gegenüber, an den er sich nicht erinnern mochte. Er war inzwischen ein sehr alter Priester, etwas gebeugt, aber immer noch derselbe Priester, der ihn wegen seines Umgangs mit der Vulva einer Stute gescholten hatte.
Beide Männer erinnerten sich, obwohl sie keine Blicke austauschten. Alois, Nepomuk, Romeder und die zwei Zeugen, die sie aus Strones mitgebracht hatten, waren nur zum Zweck der Namensänderung hier. Da außer Alois keiner des Schreibens mächtig war, unterzeichneten die anderen das Dokument mit drei Kreuzen. Sie erklärten, sie hätten Georg Hiedler gekannt, und er habe »in ihrer Gegenwart und wiederholt« eingestanden, dass er der Vater dieses Kindes sei. Die Mutter habe es bestätigt. Das schworen sie.
Der Priester sah, dass im legalen Sinn kaum etwas korrekt daran war. Alle Hände der Zeugen hatten vor lauter Gottesfurcht gezittert, als sie ihre Kreuze malten. Einer von ihnen, der Schwiegersohn Romeder, war nicht einmal fünf Jahre alt gewesen, als Maria Anna starb! Abgesehen davon war auch Johann Georg schon lange tot. In einem solch dubiosen Fall hätte man behutsamer verfahren sollen.
Doch der Priester tat, was er immer tat: Er beglaubigte das Dokument mit einem Lächeln um seinen alten und zahnlosen Mund. Er wusste, dass sie logen.
Er lehnte es aber ab, das Datum einzutragen. Auf dem vergilbten Blatt des alten Pfarreiregisters vom 1. Juni 1837 strich er »unehelich« durch, setzte den Namen Johann Georgs in die leere Stelle und lächelte wieder. In legaler Hinsicht war das Dokument anfechtbar, aber das spielte keine Rolle. Welche Kirchenbehörde in Wien würde schon diese Änderung anzweifeln? Man war dort für jede Bestätigung einer Vaterschaft dankbar, auch wenn sie spät im Leben erfolgte. In manchen Gegenden Österreichs war die Zahl der unehelichen Geburten bereits auf vierzig Prozent gestiegen. Konnte man unter diesen vierzig auch nur die Hälfte von verbotenen Intimitäten in der Familie freisprechen? Der Priester missbilligte die Oberflächlichkeit des Vorgangs und verweigerte deshalb seine Unterschrift. Wenn es jemals schiefging, konnte er das Dokument ableugnen.
Er buchstabierte die Namen der freiwilligen Zeugen, und da es zwischen den Provinzen keine orthografische Übereinkunft gab, wurde aus Hiedler schließlich Hitler.
Nachdem Alois nun seinen neuen Namen hatte, beschloss er, noch eine Stunde in Spital zu bleiben, statt sofort mit Nepomuks Wagen zum Bahnhof von Weitra zu fahren. Der Wechsel von Schicklgruber zu Hiedler gefiel ihm so gut, dass er ein Aufwallen in der Gegend unterhalb seines Nabels spürte. Das war eine Gabe der Natur, wie er aus langer Erfahrung wusste. Schnell wie ein Hund spürte er, wann weibliche Gesellschaft in der Nähe war.
War es Johanna, die den Hund geweckt hatte? Sie lebte in dem Haus neben ihrem Vater, und in diesem Moment sah Alois eine Frau aus dem Fenster schauen. Aber nein, das konnte nicht Johanna sein. Sie sah älter aus als seine eigene Frau. Mit dem Besuch hatte es also keine Eile.
Seine Schritte führten ihn trotzdem an die Tür. Wieder einmal hatte der Hund ihn nicht getrogen. Denn neben der frühzeitig gealterten Johanna stand ein sechzehnjähriges Mädchen im Türeingang. Sie war so groß wie er selbst, mit den hübschesten und angenehmsten Gesichtszügen, bescheiden, wohlgeformt, mit einem Kopf voll üppiger dunkler Haare und den blauesten Augen, die er je erblickt hatte – sie waren so blau wie das reflektierte Licht des großen Diamanten, den er einmal in der Vitrine eines Museums gesehen hatte.
Sobald er sich von der kräftigen Umarmung und den zahlreichen feuchten Küssen, die Johanna mit ihrem Speichel auf seinem Mund hinterließ, befreit hatte, zog er seinen schief sitzenden Hut und verbeugte sich. »Das ist dein Onkel Alois«, sagte sie zu ihrer Tochter. »Er ist ein wunderbarer Mann.« Sie drehte sich zu ihm um und fügte hinzu: »Du siehst besser aus als je – und es ist auch noch mehr an deiner Uniform dran, ja?« Sie zog ihre Tochter an sich. »Das ist Klara.«